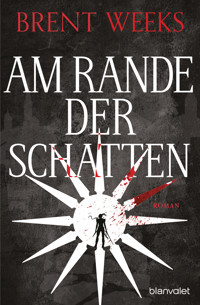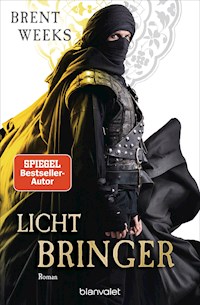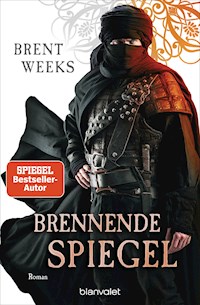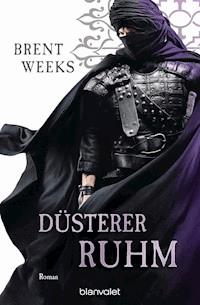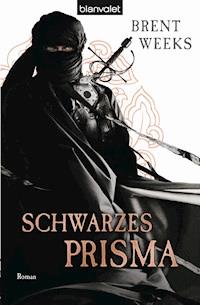9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nightangel
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt der packenden »New York Times«-Bestseller-Saga »Nightangel« – jetzt ein TOP-10-Titel der Phantastik-Couch Bestenliste
Der Nachtengel dient der Rache, der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Kylar Stern ist diese Verkörperung der Vergeltung. Die Macht des schwarzen Ka’kari hat ihn zum besten Assassinen der Welt gemacht. Und doch hat er geschworen, nie wieder zu töten. Da wird ein weiterer Ka’kari entdeckt, und niemand sollte über so eine Macht verfügen. Wenn Kylars Plan aufgeht, wird er nicht einmal töten müssen, um das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Aber seine Feinde sind so mächtig, dass die Lösung nur in den Schatten zu finden ist – und der Nachtengel muss zurückkehren!
Lernen Sie den Assassinen Kylar Stern in der »Schatten-Trilogie« kennen. Erfahren Sie in der »Nightangel-Saga« wie seine Geschichte weitergeht. Erfahren Sie in der E-Shortstory »Nachtengel. Der Ursprung«, wie alles begann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 917
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Der Nachtengel dient der Rache, der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Kylar Stern ist diese Verkörperung der Vergeltung. Die Macht des schwarzen Ka’kari hat ihn zum besten Assassinen der Welt gemacht. Und doch hat er geschworen, nie wieder zu töten. Da wird ein weiterer Ka’kari entdeckt, und niemand sollte über so eine Macht verfügen. Wenn Kylars Plan aufgeht, wird er nicht einmal töten müssen, um das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Aber seine Feinde sind so mächtig, dass die Lösung nur in den Schatten zu finden ist – und der Nachtengel muss zurückkehren!
Autor
Brent Weeks wurde in Montana geboren und wuchs auch dort auf. Seine ersten Geschichten schrieb er auf Papierservietten und Stundenplänen. Doch Tausende Manuskriptseiten später konnte er endlich seinen Brotjob kündigen und sich ganz darauf konzentrieren, was er wirklich machen wollte: Schreiben. Seither wurde er mehrfach für sein Werk ausgezeichnet und ist ein fester Bestandteil der »New York Times«- und der SPIEGEL-Bestsellerliste. Brent Weeks lebt heute mit seiner Frau und seinen Töchtern in Oregon.
Von Brent Weeks bereits erschienen:
Die Schatten-Trilogie:
1. Der Weg in die Schatten
2. Am Rande der Schatten
3. Jenseits der Schatten
Die Nachtengel-Saga:
1. Nachtengel – Nemesis
2. Nachtengel – Gemini
Weitere Titel in Vorbereitung
Brent Weeks
Nachtengel
Nemesis
Roman
Deutsch von Clemens Brunn
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Night Angel Nemesis (The Kylar Chronicles 1) S.1- 420« bei Orbit, New York
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Brent Weeks
Published by Arrangement with Brent Weeks
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Orbit USA © 2023 Hachette Book Group. Inc.
Umschlagdesign: Unusual Co.
Umschlagmotive: Shutterstock.com (STILLFX; MeSamong)
HK · Herstellung: sam
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-18939-6V001
www.blanvalet.de
Für die, die dem Ruf folgen – und dennoch den Preis zahlen.
Und
für Kristi, die mich mit ihrem Mut und ihrem Charme noch immer überrascht.
Kapitel 1
Einen Unschuldigen töten
Er ist jung und vermutlich unschuldig, und ich wünschte, es würde einen Unterschied machen. Wenn er sich in den nächsten drei Minuten nicht von der Stelle rührt, muss der Junge sterben.
Die meisten Leute verstehen meine Arbeit nicht: Sie glauben, der Mord wäre das Schwere.
Am Anfang vielleicht – wenn man vierzehn ist, sich unter einem Bett versteckt, laut keuchend, die Knöchel weiß auf dem Stahl, die Augen heiß von den Tränen von morgen, und Schritte sich nähern.
Aber selbst dann war nicht der vorbestimmte Tod das Schwere; das Schwere waren die Lebenden. Sie halten sich nie an den Plan. Die Lebenden drängen sich immer in den Vordergrund, folgen den Todgeweihten auf dem Fuß, als wollten sie, wenn nun sie dem Tod begegnen, nur mal mit einem Nicken grüßen und dann weitergehen.
Bei meinem ersten Mal ist es die Dienstbotin in einer Burg gewesen, die nach ihrem nichtsnutzigen Geliebten schauen wollte, den zu töten ich ausgesandt worden war. Er wollte sie verlassen, nun ging stattdessen sie mit ihm in die Ewigkeit. Mein erster Mord an einem unschuldigen Menschen.
Jetzt ist es dieser Junge.
Was macht ein Kind um diese Zeit draußen beim Ballspielen? Was hat er ausgerechnet hier zu suchen?
Von meinem Beobachtungsplatz aus kommt es mir vor, als sei er tausend Schritt entfernt, winzig klein auf der anderen Seite eines Abgrunds an Erfahrung, und ich allein oben auf einem Felsvorsprung – obwohl er einfach nur unten auf dem Boden ist und ich oben auf dem Dach auf der anderen Seite der Gasse bin.
Der Junge hat sich ein paar Steine hingelegt, die die Breite des Tores anzeigen sollen. Während ich ihn beobachte, wirbelt er um einen imaginären Verteidiger herum, lässt den Ball einmal aufspringen und tritt ihn dann gegen die Mauer des gesicherten Anwesens.
Ka-tunk, ka-tunk, ker-tschunk.
Immer wieder und wieder. Er reckt die Hände und macht ein Geräusch wie eine Beifall grölende Menge. Ein kleiner Junge, vielleicht zwölf, voller Dummheiten und großer Träume. Vielleicht glaubt er, seinen einzig möglichen Ausweg aus diesen Elendsvierteln gefunden zu haben.
~Erinnert dich das an jemanden?~
Ich ignoriere die Stimme des Ka’kari in meinem Kopf. Wäre das verdammte Ding nicht so hilfreich – wenn es Lust dazu hat –, würde ich es so weit von mir wegschleudern, wie ich kann.
Die Dämmerung ist eine brennende Lunte, und bald wird die Sonne erbarmungslos am Horizont explodieren und alles enthüllen, was ich getan oder zu tun versäumt habe. Doch noch warte ich, in der Hoffnung, irgendeine dritte Möglichkeit zu finden.
Ka-tunk, ka-tunk, ker-tschunk.
Er ist nur ein Kind.
Aber er gibt seine Ballübungen einfach nicht auf.
Ich weiß, was das bedeuten könnte. Doch werde ich es auch wirklich tun?
Ja. Ja, das werde ich. Sie ist es wert. Sie verdienen Gerechtigkeit.
Gut, das war’s. Der Morgen bricht an. Die Zeit ist um. Für uns beide.
Ich setze mich in Bewegung, lasse mich lautlos vom Dach in die tieferen Schatten der Gasse fallen.
Ka-tunk, ka-tunk, ker…
Ich komme aus dem Nichts angeschossen und schnappe mir den Ball aus der Luft. Sogar mit der linken Hand, einfach so. Vielleicht habe ich meine Berufung verfehlt. Ich hätte im Straßenballspiel ganz groß rauskommen können.
Dem Jungen klappt die Kinnlade herunter, und seine Augen werden bei meinem Anblick lächerlich groß. Es ist für mich durchaus ein wenig befriedigend, nach dem Motto: »Ich bin ja so stolz, dass ich kleine Kinder erschrecken kann.« Ist das etwa eine der dunklen Freuden der Macht, vor denen mich Graf Drake zu warnen versucht hat? Ich habe mich nicht eigens in Schale geworfen, um Eindruck zu schinden. Heute Nacht – genau genommen heute Morgen – trage ich meine grau-schwarz gemusterte Arbeitskleidung mit Kapuze und Gesichtsmaske und bin mit einem gut verstauten, unbespannten Bogen und einem schwarzen Kurzschwert in einer spannungsfreien Rückenscheide bewaffnet.
~Der Ball hat irgendwie etwas Interessantes an sich.~
Ich nehme das Ding in Augenschein. Der Ball besteht aus einem mit Leder überzogenen, luftgefüllten Ziegenmagen, zu einer fast perfekten Kugelform genäht. Die Kinder in diesem Viertel müssen sich normalerweise mit einem Bündel aus Lappen und Schnur begnügen.
»Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Junge«, knurre ich. »Ich habe mit dir nichts zu schaffen. Also möchte ich, dass du von hier verschwindest. Ganz leise. Bitte. Hast du verstanden? Heute Nacht ist hier ein Mann unterwegs, der ein Kind umbringen würde.«
Ich halte lange genug inne, dass er sich fragen kann, ob ich damit mich selbst oder den Drecksack von Adligem meine, der in dem Anwesen hinter dieser Mauer lebt.
Ja, lebt, aber vielleicht werde ich das ja noch ändern.
»Hat er dir den da gegeben?«, will ich wissen und lasse den Ball auf einem meiner Finger herumwirbeln. »Lord Repha’im?«
Der Junge kann nicht einmal zustimmend nicken, er ist wie erstarrt, doch ich weiß, dass meine Vermutung stimmt. In einem Elendsviertel wie diesem sind solche Geschenke eine billige Methode, um sich treue Ergebenheit zu erkaufen.
»Ihr seid der Nachtengel«, würgt der Junge hervor. »Ihr seid Kylar Stern.«
Der Ball dreht sich langsamer, bleibt stehen, aber er balanciert weiterhin auf meiner Fingerspitze.
Sie wissen, dass ich wieder in der Stadt bin. Lord Repha’im weiß, dass ich komme. Das erklärt die verschlungenen magischen Fallen, die die Luft über seinen Mauern versperren und mich daran hindern, einfach hinüberzuklettern. Und wenn dieser Junge über mich Bescheid weiß …
»Du arbeitest für ihn«, sage ich und nehme den Ball in die Hand. »Deshalb bist du um diese Zeit hier draußen. Du sollst Ausschau halten.«
~Aha. Das macht die Sache komplizierter.~
Ich bin bisher davon ausgegangen, ihn verscheuchen zu können, wenn ich mich ihm zeige, wollte mir einen Vorwand geben, ihn zu verschonen. Aber als Spähposten ist er dafür zu gefährlich, oder?
Er schluckt erneut, doch dann huscht sein Blick gierig zurück zu seinem Ball. Er sollte jetzt eigentlich auf der Stelle davonlaufen, aber ich habe seinen Schatz, und er erträgt es nicht, ihn zurückzulassen. Sein Leben für einen albernen Ball.
»Junge, wie nennt man einen Unschuldigen, der bösen Menschen hilft, und sei es auch nur ein bisschen? Wie nennt man einen Unschuldigen, der anderen Unschuldigen den Tod bringt?«
Er antwortet nicht. Und läuft noch immer nicht weg.
~Ich habe da eine bessere Frage. Wie nennst du diesen Unschuldigen hier, Kylar?~
Heute? Heute nenne ich ihn einen hinnehmbaren Verlust.
Die Grenzen werden zunehmend fließend. Aber so ist es bei meiner Arbeit eben. Deshalb hasse ich sie fast so sehr, wie ich sie liebe.
»Sie haben dir irgendeine Art von Signal gegeben«, fahre ich fort. »Eine Leuchtkugel oder so was, nicht wahr? Für den Fall, dass du mich siehst? Ich sage es dir offen und ehrlich: Wenn du ihnen dieses Signal gibst, stirbst du.«
Er wird blass, doch sein Blick geht sofort wieder zu seinem Ball. Seinem Schatz.
Wenn ich ihn töten muss, wird die Welt nicht gerade einen ihrer hellsten Köpfe verlieren.
»Junge, ich habe so viel Macht, dass es mir selbst Angst macht. Eine so große Macht, dass sie Grenzen braucht. Ich könnte ein noch schlimmerer Mensch werden als diejenigen, die ich getötet habe. Vielleicht bin ich das schon. Aber ich gebe mir hier Mühe. Versuche, gut zu sein, verstehst du? Also habe ich für mich ein paar Regeln aufgestellt. Zumindest arbeite ich an ihnen. Und eine davon lautet: Lass nie jemanden dein Gesicht sehen, sonst muss er sterben.«
Wenn ich ihn gehen lasse, wird er glauben, dass meine Aufmerksamkeit nun nicht mehr so sehr ihm gilt, sondern hauptsächlich meinem Versuch, heimlich ins Anwesen einzudringen. Dann könnte er zurückkommen und sie warnen. Aber wenn er wegrennt, kann ich meine Klinge ziehen und ihn verfolgen. Er wird nicht wissen können, wie lange ich hinter ihm her bin. Wahrscheinlich wird er mindestens bis Mittag weiterlaufen.
Ich ziehe meine Maske ab. »Na, was hältst du davon?«, frage ich.
Er quiekt, aber er rührt sich nicht vom Fleck. Zäher Bursche. Oder vielleicht wirklich nur unglaublich dämlich.
»Ich weiß, wie es ist, für solche Leute zu arbeiten, mein Junge. Ich kenne so was aus eigener Erfahrung. Sogar genau das hier. Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen, in einem Teil des Labyrinths, der diese Gegend freundlich aussehen lässt. Die Straßen geben den meisten jungen Leuten keine Chance. Ich weiß das. Und finde es schrecklich. Deshalb bekommt bei mir jeder eine Chance. Eine. Eine einzige. Dann ist mein Urteil endgültig. Erst gewähre ich Gnade, wenn ich kann, dann bringe ich Gerechtigkeit, unbarmherzig und blutig.«
Er rennt nicht davon, nimmt den rettenden Ausweg nicht an, den ich ihm zu bieten versuche. Was bedeutet, dass ich einen weiteren weißen, leblosen Körper den übel riechenden, schlammbraunen Fluss hinuntertreiben lassen muss.
Es sei denn …
Mir kommt eine vage Idee. Meine dritte Möglichkeit. Vielleicht.
Ich drehe mich um und schieße den Ball auf das Tor. Ich verfehle es knapp. Verdammt! Ich bin noch nicht so gut wie mein Meister. Immerhin, der Ball hüpft zu dem Jungen zurück, der seinen kleinen Schatz hastig aufhebt.
Das Gesicht zur Mauer und zum heller werdenden Himmel gewandt, während ich meine Maske wieder aufsetze, um mich vor dem Gestank des Flusses und der Elendsquartiere zu schützen, frage ich leise: »Und jetzt sag mir, wofür hast du dich entschieden?«
Da ist keine Antwort, nur das leise Tappen von fliehenden Füßen auf dem Kopfsteinpflaster. Der Junge ist auf und davon. Endlich.
Ich ziehe meine Klingen, knurre und renne ihm hinterher. Er wirft einen Blick zurück, als er um die Ecke biegt, sein Gesicht bleich, die Augen weit aufgerissen, stolpert über Abfälle, die aus einer Gasse hervorquellen. Während er Hals über Kopf davonrennt, verstaue ich meine Waffen wieder, ziehe die Schatten um mich herum und verfolge ihn auf den leisen Füßen eines Albtraums.
Ich habe ein Gift bei mir. Setzt einen Erwachsenen außer Gefecht. Ich könnte es bei dem Jungen anwenden, die Dosis seinem Gewicht entsprechend verringern. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es ihn umbringt. Das lässt sich einfach nicht genau sagen.
Im Blutgeschäft kann ein Fehler ein totes Kind bedeuten. Wer damit nicht umgehen kann, ist im falschen Berufsfeld tätig.
Nach ein paar raschen Abzweigungen hintereinander biegt der Junge in eine Straße ein, die parallel zu dem Anwesen verläuft, und ich denke schon, er hat endlich Vernunft angenommen und rennt nach Hause. Dann schlüpft er in eine Öffnung zwischen einer verwahrlosten Werkstatt und der makellosen Mauer des Anwesens und verschwindet zwischen verrottendem Holz und bröckelndem Mörtel.
Meine Brust zieht sich zusammen.
Ich finde das Loch nur über das Geräusch seiner Hose, die im Kriechen über den Boden wetzt. Ich folge ihm.
Der Tunnel stinkt nach Dreck und Katzenpisse. So unangenehm das auch ist, es ist ein gutes Zeichen. Wäre er sauber und aufgeräumt, wüsste ich, dass Erwachsene ihn gebaut und gewartet haben. Dennoch gehe ich die Sache langsam an. Nicht aus Platzangst. Beengte Räume machen nur Angst, wenn man sich darin zugleich machtlos fühlt, und als ich klein war, haben mich solche Räume immer vor den älteren Kindern geschützt. Auch die Angst vor der bedrückenden Dunkelheit bremst mich nicht. Seit ich den schwarzen Ka’kari gebunden habe, ist die Dunkelheit meinen Augen willkommen.
Nein, die Sache ist vielmehr die: Wenn ich mich jagen würde, würde ich genau hier die wahre Falle aufstellen.
Die große Falle, der ich gerade ausweiche, indem ich auf diese Weise in das Anwesen eindringe, befindet sich direkt in und über den Mauern des Geländes. Unsichtbar in der Luft hängt eine Art magische Schlinge, die das Werk von mindestens drei verschiedenen Magi sein dürfte. Zwei von ihnen sind raffiniert unauffällig vorgegangen. Der dritte ist ein Feuermagier.
Feuermagier haben es in der Regel nicht so sehr damit, unauffällig zu sein.
Ich weiß nicht, was die unsichtbaren Fangvorrichtungen, Riegel und Auslöser über den Wänden bewirken – ich bin selbst kein Magier –, doch ich weiß, dass man eine Bärenfalle nicht dadurch testet, dass man den Fuß hineinsteckt.
Der Ball, wird mir klar.
Der Ball war mit Magie belegt, nicht wahr?, frage ich den Ka’kari. Warum hast du mir das nicht gesagt?
~Du bist jetzt ein großer Junge, Kylar. Ich habe nicht vor, dir alles haarklein auseinanderzusetzen.~
Das also war das Seltsame an dem Ball, nicht nur, dass er für einen Straßenjungen zu teuer war – der Ball selbst war die warnende Leuchtkugel des Spähpostens. Wahrscheinlich hätte er ihn über die Mauer werfen sollen, sobald er mich bemerkte.
Ich schiebe mich durch den engen Tunnel, so schnell ich es wage. Dann verharre ich an seinem Ausgang im Schutz eines großen Felsblocks, der sich gegen ein Wirtschaftsgebäude lehnt. Das Loch selbst ist von hohem Gras überwachsen. Der Ausgang ist zu eng, als dass ein Erwachsener hindurchpassen könnte. Selbst der Junge hat es nur mit Mühe hinausgeschafft.
Das ist die gute Neuigkeit. Es bedeutet, dass das hier nicht der Notausgang des Anwesens ist. Es bedeutet, dass Lord Repha’im vielleicht gar nicht weiß, dass es diesen Gang gibt. Also wird er auch nicht bewacht.
Die schlechte Neuigkeit ist, dass die Hunde des Anwesens dieses Loch durchaus kennen, und jeder einzelne von ihnen scheint diesen Winkel genutzt zu haben, um sein Revier zu markieren und seinen Darm zu entleeren.
Ich höre ein entferntes Klopfen an einer Tür und die erhobene Stimme des Jungen, der laut etwas schreit.
Ich muss mich beeilen.
Ich scharre mit bloßen Händen in der harten Erde, um den Ausstieg zu verbreitern. Der Ka’kari könnte mir dabei behilflich sein, was jedoch nicht der Fall ist, und ich bitte ihn auch nicht darum. Die Magie des Ka’kari könnte auch den Geruch der frischen Hundescheiße abschwächen, in die der Junge getreten ist und die er überall verschmiert hat, als er aus dem Tunnel gekrochen ist – aber auch darauf verzichtet er.
Warum nur bekommt man es in dieser Branche immer mit Abwasserkanälen und glatten Felswänden zu tun, an denen es dreihundert Meter senkrecht bergab geht? Warum führen mich meine Aufträge nicht auf Vergnügungsreisen mit schönen Frauen, teurem Alkohol und Kammermusik?
Ich arbeite mich nach draußen und steige behutsam über all den Hundekot hinweg. Es spielt keine Rolle mehr, dass dein eigener Körper keinen Geruch hat – so wie es bei mir der Fall ist –, sobald du nach dem stinkst, in das du hineingetreten bist. Mein Meister hat mir immer eingeschärft, dass es die kleinen Dinge sind, die dich am Ende umbringen.
Aber er hat sich auch um die großen Dinge gesorgt. Und um die mittleren Dinge. Und die meiste Zeit auch um einen Haufen Dinge, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nur eingebildet waren.
Das bittere Geschäft ist die Hölle, wenn man zum Verfolgungswahn neigt.
Ich husche von Schatten zu Schatten, entferne mich vom Tunneleingang. Ich überlege, ob ich auf das Dach eines niedrigen Nebengebäudes klettern soll, bleibe aber lieber unten am Boden, um zu vermeiden, dass meine Umrisse sich sichtbar abheben könnten, und ziehe schnell den unbespannten Bogen aus dem Rucksack. Ich stütze das untere Ende des Bogens auf dem Boden ab, lege die Sehne in die unten dafür vorgesehene Kerbe, biege den Bogen, während ich ihn mit dem Fuß festhalte, und befestige die Sehne auch am oberen Ende. Ich überprüfe tastend meine Pfeile, dann lege ich einen Pfeil mit breiter, wie ein Schwalbenschwanz geflügelter Spitze ein.
Der Junge ist kein schwieriges Ziel. Er ist zwanzig Schritt entfernt und hat sein Klopfen an der Tür eingestellt, als schreiende Söldner mit gezogenen Waffen auf ihn zustürmen. Seinen kostbaren Ball linkisch unter den Ellbogen geklemmt, hebt er kapitulierend die Hände.
Ich habe nur einen kurzen Moment, bis sie ihn umringt haben. Ich habe eine breit zulaufende, geflügelte Pfeilspitze gewählt, weil ein Pfeil immer zurück in die eigene Richtung zeigt, wenn man jemanden in den Oberkörper trifft.
Daher habe ich einen bei Weitem schwierigeren Schuss im Sinn. Wenn ich seinen schmächtigen Hals gekonnt mit der dicken Schwalbenschwanzspitze streife, wird der Pfeil weiterfliegen und in der Dunkelheit verschwinden. Es wird das leise Surren eines fliegenden Pfeils zu hören sein, gefolgt vom beängstigenden Spritzen von arteriellem Blut, und der Junge wird zu Boden sinken, zum Schweigen gebracht, bevor er mir die Arbeit allzu schwer machen kann, ohne einen klaren Hinweis darauf, aus welcher Richtung sein Tod gekommen ist.
Ich habe ihm den Preis genannt, den er zu zahlen hat. Ich habe ihm die Wahl gelassen. Er hat selbst den Tod gewählt, nicht ich.
Ich ziehe die Sehne an meine Lippen. Es ist windstill. Vor Angst vor den herannahenden Söldnern erstarrt, rührt sich der Junge nicht vom Fleck. Leichtes Spiel für mich.
Wer noch nie mit einen Reflexbogen geschossen hat, sollte wissen, sie sind nicht dafür gemacht, voll gespannt gehalten zu werden. Dennoch halte ich ihn.
Er ist ein Kind.
Ein Kind, das ein Ungeheuer schützt. Ein hinnehmbarer Verlust.
Ich denke an Graf Drake. Ich zeichne das hier für ihn auf, erstatte dem Ka’kari über alles Bericht. Graf Drake hätte mich nie gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Er würde mir vorhalten, dass ich dadurch meine Seele gefährde. Er würde fragen, ob ich mir auch sicher bin, dass ich es im Namen der Gerechtigkeit tue.
Ich bin mir sicher.
Aber wie kann ich ihm in die Augen sehen und ihn wissen lassen, dass ich ein Kind ermordet habe?
Ich kann sagen, dass Kinder in Kriegen sterben, dass unser Krieg noch nicht wirklich vorbei ist, dass er gar nicht vorbei sein kann, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist.
Ein riesiger Schlägertyp von Wachmann kommt auf den Jungen zugestürzt. Er wird meine Schusslinie in etwa zwei Sekunden verdecken.
In einer.
Ich löse langsam die auf dem Pfeil lastende Spannung. Senke den Bogen ohne einen Schuss. Leise fluchend, spanne ich ihn ab und verstaue ihn wieder.
Die Tür öffnet sich, und ein Mann in edler Kleidung kommt heraus. Ich verliere ihn aus dem Blick, während ich mich wieder in Bewegung setze. Ich höre nur Gesprächsfetzen, Fragen gehen hin und her. Aus dem Augenwinkel bemerke ich wildes Gestikulieren, als der Mann, der das Kommando hat, die anderen ins Verhör nimmt.
Nein, die Wachen haben nichts von dem vereinbarten Alarm zu sehen bekommen, wo also ist das Problem?
Nein, sie kennen den Jungen nicht, aber sie sind neu, sie kennen viele der Leute hier noch nicht.
Dann, als ich nah genug herangekommen bin, um seine Worte deutlich zu verstehen, nimmt die Stimme des Anführers einen anderen Tonfall an. Mit der einen Hand hält er den Jungen vorn an seinem Kittel fest, in der anderen Hand hat er den Ball. »Willst du mir erzählen, der Nachtengel habe mit dir gesprochen? Und du hast uns das Signal nicht gegeben?!«
Die Wachen wechseln Blicke, einige voller Unglauben, andere von plötzlicher Angst erfüllt.
Als der Mann das Kind loslässt, sehe ich rote Symbole auf der kahlen Kopfhaut des Mannes aufleuchten.
Aha, ein roter Magier. Wahrscheinlich derselbe, dessen Werk ich oben über den Mauern des Gebäudekomplexes gesehen habe.
»Ich habe meinen Ball nicht verlieren wollen«, erklärt der Junge im Jammerton.
Mit lautem Gebrüll schleudert der Magier den Ball des Jungen über die Mauer und hinein in die Elendsquartiere dahinter.
Als der Ball durch das magische Gespinst über den Mauern fliegt, pulsiert tiefrotes Licht über das gesamte Areal. Ranken aus rotem Licht flammen auf, als habe jemand eine Spur aus vergossenem Öl angezündet, zu jedem Fenster und jeder Tür des Herrenhauses hin, die dann in dem gleichen Rot zu pulsieren beginnen. Zum Summen der aktivierten Magie gesellt sich das Klacken von zuschnappenden mechanischen Schlössern, sodass das gesamte Anwesen abgeriegelt wird.
»Mein Ball!«, schreit der Junge.
Oben in der Luft leuchtet ein verschwommener Klecks blauer Magie auf, und ein laut schmatzendes Knirschen ist zu vernehmen. Die Wachen in der Nähe zucken zusammen, im Glauben, es sei ein Angriff. Alle fahren herum und sehen, wie eine Fledermaus, in mehrere blutige Stücke zerteilt, zu Boden klatscht, ihre Jagd im schwachen Licht der beginnenden Morgendämmerung jäh abgebrochen.
Der rote Magier knurrt den Jungen an: »Du bist nicht über die Mauer gekommen. Und du bist auch nicht durch das Tor gekommen. Wie bist du dann hereingekommen?«
»Ich, ich …«
»Egal.« Der rote Magier fährt ruckartig herum und lässt den Blick suchend durch die Dunkelheit schweifen. »Du kleiner Schwachkopf, du hast ihn direkt hereingeführt. Der Nachtengel ist bereits hier.«
Kapitel 2
Das Totenbuch
Vi hob den Blick von der Seite, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und bemühte sich, ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen, um sich nicht anmerken zu lassen, welch manischer Schmiedehammer da in ihrer Brust arbeitete. Die Handschrift sah ohne Frage wie die von Kylar aus, aber als eine Frau, die unter der Sa’kagé von Cenaria aufgewachsen war, wusste Vi, dass eine Fälschung jederzeit möglich war. Sie war keine Expertin. Sie konnte getäuscht werden. Und je wichtiger das Dokument, desto größere Skepsis war geboten.
Und die Schwestern behandelten dieses Buch, als sei es sehr, sehr wichtig.
Sie hatten sie aus ihrem Unterricht herausgerufen. Das hatte sie erwartet. Ihre Freundin Gwaen hatte ihr mit einem angespannten Lächeln viel Glück gewünscht. Vi hatte gewusst, dass sie früher oder später bestraft werden würde, aber die ernste, schweigende Schwester hatte sie nicht vor irgendein Tribunal geführt. Stattdessen hatte sie sie in diese heimelige Bibliothek hoch oben im Weißen Seraph mit einem halben Dutzend ramponierten Studiertischen aus schwarzem Walnussholz und einigen Hundert dicken Wälzern und Schriftrollen in den Regalen gebracht. Sie hatte sich geweigert, irgendeine von Vis Fragen zu beantworten, und Viridiana an einen Tisch gesetzt, auf dem ein einziges, wenig beeindruckendes Buch lag. Der Einband sah nach ganz gewöhnlichem Ziegenleder aus, war abgenutzt und schwarz eingefärbt. Statt Goldprägungen waren da nur einige wenige armselige geometrische Muster im Blinddruck auf dem Einband, und die Kanten waren weder ziseliert noch mit Goldschnitt versehen. Und doch lag das Buch hier auf einer Platte mit goldenen Kontaktpunkten unter einem Glasbehälter mit Goldrand.
Während sie einen für Vi unhörbaren Zauberspruch deklamierte, hatte die Schwester einen Hebel an der Seite des Glasbehälters umgelegt. Luft zischte, und ein violetter Puls schimmerte im Inneren auf. Die Schwester hob den Behälter vorsichtig ab.
»Das Buch verbleibt in dieser Bibliothek. Und Ihr ebenfalls. Ihr dürft es nicht mit Magie berühren. Ihr sollt es einfach nur lesen, sonst nichts.« Dann war die Schwester verschwunden.
Das Buch sah nicht so aus, als mache es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen nötig. Es wirkte wie das Rechnungs- oder Tagebuch eines herumreisenden Kaufmanns, im Format so gewählt, dass es in eine große Tasche passte, und schlicht gehalten, damit es keine Diebe in Versuchung führte. Vi hatte es mit banger Erwartung aufgeschlagen, aber es hatte keine magischen Explosionen gegeben.
Genauso wenig war da irgendeine Inschrift, die verraten hätte, wem das Buch gehörte oder worum es sich dabei handelte. Vi hatte erst ein paar Absätze lesen müssen, bis sie begriffen hatte, warum ihr die Handschrift vertraut vorgekommen war. Dann war sie sofort skeptisch geworden. Ein Tagebuch? Kylar?
Doch im Weiterlesen waren ihre Zweifel verflogen. Es war ganz ohne Frage Kylars Stimme, die da durch den Text zu ihr drang. Sie erkannte seine Sprechweise so deutlich, als würde sie sein Gesicht sehen. Aber was war das für ein Buch? Wie war die Schwesternschaft an es herangekommen?
Vi gab sich alle Mühe, das unbeteiligte Interesse ihrer Lehrmeisterinnen zu imitieren, als sie den Blick auf einen der von ihr meistgehassten Menschen der Welt richtete: Schwester Ayayah Meganah, die Anführerin des Kommandos für Sonderprobleme und Spezialtaktiken. »Was hat es damit auf sich?«
»Du kannst es also lesen?«, fragte die Schwester, das Kinn hochgereckt und in einem Tonfall, als sei Vi irgendetwas Widerwärtiges.
»Natürlich kann ich das!«, blaffte Vi. »Glaubt Ihr etwa, ich könnte nicht lesen? Glaubt Ihr, ich hätte all die vielen Stunden in der Bibliothek, seit wir zurückgekehrt sind, nur damit zugebracht, herauszubekommen, wie lange es dauert, bis mir die Stühle den A… – den Hintern platt drücken?« So viel zum Thema ruhige Gefasstheit.
Sie schloss die Augen. In ihrem alten Leben hätte sie von noch wesentlich mehr Kraftausdrücken und mindestens ein paar Beleidigungen Gebrauch gemacht, doch Schwester Ayayah schien nicht gerade geneigt, sie für ihre Zurückhaltung zu loben.
Ihre ehemalige Gruppenleiterin ließ ihre weißen Zähne blitzen, und Herablassung troff aus ihrer Stimme wie das Gift der Blutwurzel, als sie antwortete: »Ich habe nicht gefragt, ob du lesen kannst, kleine Schwester …«
Bevor sie in die Chantry gekommen war, hatte Viridiana nie darauf geachtet, auf wie viele unterschiedliche Arten eine Frau »kleine Schwester« genannt werden kann. Ihre Lehrerinnen hatten erklärt, dass diese Benennung als freundliche Mahnung an die ausgelernten Schwestern gedacht sei, nachsichtig mit den Unzulänglichkeiten der hier in Ausbildung befindlichen, weniger erfahrenen Schwestern zu sein.
Von der sehnigen älteren Frau war schon lange nichts Freundliches mehr zu hören gewesen. Nicht für Vi. Nicht seit den Ereignissen auf Burg Sturmfest und noch weniger, seit sie von dem Debakel auf dem Sturmschiff zurückgekommen waren. Langsam, als sei Vi dumm, erklärte die Schwester: »Ich habe gefragt: ›Kannst du es lesen?‹ Aufpassen!«
Schwester Ayayah trug ihr dunkles Haar dicht am Schädel geschoren und hatte große Ringe in den Ohren, aber sie bewegte sich mit so viel majestätischer Gelassenheit, dass ihre Ohrringe nicht hüpften und schwangen, wenn sie sich bewegte. Sie hätte genauso gut ein aus Ebenholz geschnitztes Götzenbild der hungrigen Oyuna sein können.
Mit aufreizender Anmut glitt die Schwester auf Viridiana zu, vor der das kompakte kleine Buch aufgeschlagen auf einem Tisch der winzigen Bibliothek hoch oben in der Chantry lag.
Vi hatte sich gewundert, warum die Schwester so weit von ihr entfernt gestanden hatte, als Vi die ersten Seiten gelesen hatte. Jetzt sah sie den Grund. Als die Schwester näher kam, gerieten die Wörter auf der Seite durcheinander.
Vi konnte nicht einmal erkennen, ob sich die Buchstaben überhaupt noch zu richtigen Wörtern zusammensetzten. Aber Schwester Ayayahs verkniffene Lippen ließen sie vermuten, dass dem nicht so war. »Was … was ist das?«, fragte Vi leise. Ihr Groll war vergessen.
»Ich nehme mal an, dass selbst du nicht so dumm bist, zu fragen, ob es sich hierbei um ein magisches Buch handelt. Ich gehe also davon aus, kleine Schwester, dass du vielmehr fragst: ›Was ist das für ein magisches Buch, das ich da lese? Warum lässt es zu, dass ich es lesen kann, aber nicht meine Respektspersonen?‹ Und im Gegensatz zu deiner ersten Frage ist das in der Tat eine sehr gute Frage.«
Vi klappte den Mund zu. In ihrem früheren Leben hatte sie viel schlimmere Beschimpfungen ertragen müssen, aber Schwester Ayayah hatte rasch herausgefunden, dass »dumm« genannt zu werden, Vi tiefer verletzte als andere Beleidigungen. Die Schwester stach gerne in diese Wunde und behauptete immer, dass das zu Viridianas eigenem Wohl geschehe, dass sie Vi damit helfe, an einem wunden Punkt eine Art seelisches Narbengewebe zu entwickeln.
»Dieses Buch«, erklärte Schwester Ayayah mit schneidender Stimme, »ist Müll. Es ist Schund. Es hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit Kylar zu tun. Er hätte ohne Frage gar nicht über den Sachverstand verfügt, eine derartige Magie zu erschaffen. Aber jetzt bin ich froh, sagen zu können, dass dieses Buch deine Laufbahn zerstören wird, so wie es fast meine eigene zerstört hätte.«
»Wie bitte?«
Schwester Ayayah fuhr fort, als hätte Vi gar nichts gesagt. »Denn aus irgendeinem Grund, trotz oder gerade wegen deiner Dämlichkeit und mangelnden Kultiviertheit, erlaubt dieses Buch dir, es zu lesen, und, soweit wir wissen, niemandem sonst. Daher habe ich den Auftrag, dich wissen zu lassen, dass der Friedensrat dir drei Tage Zeit gibt, alles zu lesen und sämtliche Hinweise aufzuspüren, die du finden kannst, um dann darüber Bericht zu erstatten.«
Es war wie in den schlechten alten Zeiten, als das manipulative Scheusal, das ihr Meister gewesen war, eine Übungseinheit gerne einmal damit angefangen hatte, Vi erst auf die Nase zu schlagen und sie dann mit brutaler Gewalt zu attackieren, sodass sie sich in benommenem Zustand verteidigen musste, während ihr Tränen aus den Augen strömten, die ihr die Sicht nahmen, und ihr das Blut aus der Nase schoss.
»Warum tagt der Kriegsrat denn?«, brachte Vi heraus. »Und welche Hinweise? Worauf?«
»Wir müssen … entschuldige bitte. Du …« Schwester Ayayah lächelte grausam, als würde sie, an einer undankbaren Aufgabe gescheitert, nun entdecken, welche Freuden es mit sich bringt, sie jemand anderem zu übertragen. »Du musst herausfinden, wo sich Kylars Leichnam befindet.«
»Mit diesem Buch? Aber Ihr habt doch gesagt, Ihr wüsstet nicht einmal, was drinsteht, woher sollen wir also wissen, dass es uns …«
»Mit diesem Buch. Ja. Zwing mich nicht, mich zu wiederholen. Du klingst dann noch dümmer als sonst.«
Ganz. Langsam. Atmen.
Blinzelnd, den Blick abgewandt, brauchte Vi nur einen tiefen Atemzug, bis sie sich wieder im Griff hatte.
»Aber … warum? Warum interessiert uns das? Kylar hat sich hier nicht gerade viele Freunde gemacht. Dem Rat kann unmöglich so viel an ihm liegen, dass er extra noch mal eine Expedition nach Alitaera ausschicken würde, nur um ihm ein ordentliches Begräbnis zu bereiten. Jedenfalls nicht nach dem, wie wir die Lage dort hinterlassen haben.«
Der Mund der Schwester wurde zu einem dünnen Strich. »Du bist früher eine Meuchelmörderin gewesen. Ist es denn nicht offensichtlich? Wenn man hört, dass jemand so Mächtiges wie Kylar Stern tot ist, zahlt es sich immer aus, selbst einen Blick auf die Leiche zu werfen.«
»Es wird aber keine Leiche geben! Das habe ich Euch doch schon gesagt. Es ist unmöglich, dass er es geschafft hat, sich bis nach …«
»Wir haben Grund zu der Annahme, dass es ihm gelungen ist. Zumindest ein Stück weit.«
»Aber ich habe gedacht, die Magie des Sehers hätte bereits bestätigt, dass er tot war. Tot ist.«
Im Fall von Kylar lagen Welten zwischen diesen beiden Sätzen, aber Vi hoffte, dass es Schwester Ayayah nicht weiter aufgefallen war.
Unvermittelt löste Ayayah Meganah den Blickkontakt. »Also gut. Er hat etwas bei sich gehabt, angeblich ein Artefakt von überaus mächtigen magischen Fähigkeiten. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er es heimlich stets am Leib getragen hat. Wusstest du davon?«
»Nein. Ihr wollt also das Artefakt haben. Sein Leichnam ist Euch eigentlich egal.«
Vi konnte sehen, dass sie mit ihren Worten ins Schwarze getroffen hatte, doch Schwester Ayayah hatte nicht die Absicht, ihr die Genugtuung zu geben, es einzuräumen. »Aber dir ist er nicht egal, nicht wahr?«, gab die Schwester prompt zurück. »Du kannst den anderen erzählen, was du willst, und vielleicht glauben sie dir ja. Aber ich habe gesehen, wie du ihn angeschaut hast.«
Dieses Mal war es für Vi eine Leichtigkeit, die gleichgültige, ausdruckslose Miene des schwesterlichen Hasses aufzusetzen. »Wenn ich ihn finde, darf ich ihn dann begraben?«
»Ach, kleine Viridiana. Du hast gesehen, wie hier die Schwestern aus allen Teilen der Welt eingetroffen sind. Wir haben eine Vollversammlung einberufen, um das Desaster von Alitaera zu besprechen. Wir werden in drei Tagen darüber abstimmen, was zu tun ist. Als deine Vorgesetzte werde ich die dringende Empfehlung aussprechen, dich weder an dieser noch an irgendeiner anderen Expedition teilnehmen zu lassen, und zwar auf Jahre hinaus. Deine Aufgabe beginnt und endet also mit deinem Arsch auf diesem Stuhl. In Anbetracht deines katastrophalen Versagens auf dem Sturmschiff wird es Folgen für deine Stellung in dieser Schwesternschaft haben, solltest du uns in dieser Angelegenheit im Stich lassen. Du hast drei Tage Zeit, Viridiana«, sagte Schwester Ayayah mit einem unangenehmen Lächeln. »Und heute zählt als Tag eins.«
Erster Tag
Kapitel 3
Einer Amnestie zuvorkommen
Ich hänge oben an Lord Repha’ims höchstem Turm unter einer Reihe von vergitterten Fenstern und warte darauf, dass ein Wachmann sich in Bewegung setzt.
Ich habe die Sache jetzt schon vermasselt. Ich hätte das Ganze in dem Moment bleiben lassen sollen, als das Wort »Nachtengel« aus dem Mund des Jungen kam. Und erst recht, sobald er mich Kylar Stern nannte. Es gibt keinen guten Grund, warum ich nicht warten und die Angelegenheit in einem Monat zu Ende bringen kann. Oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren.
Nun ja, keinen anderen guten Grund als den Erlass des Hochkönigs.
Der schwarze Ka’kari bedeckt meine Haut, sodass ich für alle unsichtbar bin, die sich magischer Mittel bedienen. Der Ka’kari hat mich wissen lassen, dass ich zwischen Unsichtbarkeit für magische Sicht und Unsichtbarkeit für die profane Alltagssicht wählen kann, aber nicht beides zugleich. Andererseits könnte der Ka’kari auch gelogen haben, um mir das Leben schwerer zu machen.
~Ich? Lügen?~
In Anbetracht all der hier befindlichen Magier habe ich meine Wahl getroffen. Also drücke ich mich jetzt in dunkle Ecken und werfe in regelmäßigen Abständen Blicke auf den Wachmann hinter dem Fenster sowie in den Himmel hinauf.
Die rosigen Finger der Morgenröte kratzen bereits jetzt am Horizont.
Würde ich sagen, ich bin hier, um jemanden für meinen Freund, den Hochkönig, zu töten, würde man gleich wissen, worum es geht. Aber die Sache ist komplizierter. Schwerer zu bewerkstelligen. Ich hoffe, hier jemanden ohne seinen Befehl töten zu können, vielleicht sogar seinem Befehl entgegen, und trotzdem der Freund des Königs zu bleiben.
Gelingt es mir, nur dieses eine Ungeheuer im Inneren dieses Gebäudes tot zurückzulassen, könnte Logan mir womöglich vergeben. Wenn ich ein Dutzend Männer abschlachte – ganz egal, wie sehr sie es verdient haben mögen –, habe ich es mir mit ihm verscherzt. Wahrscheinlich würde er sogar seine Leute schicken, um mich zu verhaften, und dann würde er mich hinrichten lassen.
Würde er wirklich die Hinrichtung seines besten Freundes anordnen?
Sagen wir einfach, ich habe guten Grund zu glauben, dass er es tun würde.
Ich kann die ganze Unternehmung immer noch abbrechen. In mehrfacher Hinsicht habe ich alle Zeit der Welt.
Schreckliche Menschen haben stets viele Feinde, und niemand kann für immer in höchster Alarmbereitschaft leben. Die zu Tötenden, unsere »Leichen«, werden ungeduldig. Sie verkriechen sich eine Zeit lang, aber irgendwann wird ihnen langweilig, sie entscheiden, dass die Gefahr vorüber ist, und kommen wieder heraus.
Und genau in dem Moment bringt mein Meister sie um. Das ist die schlaue Herangehensweise. So sollte auch ich es halten.
Aber wenn ich die Sache noch heute Nacht zu Ende bringe, könnte mir der Hochkönig vielleicht doch noch verzeihen. Wenn ich es heute Nacht erledige, wäre es immer noch glaubhaft, dass ich noch nichts von seiner großen Amnestie gehört habe. Ich habe die Boten überholt, um ihnen zuvorzukommen und als Erster hier zu sein. Aber die Herolde werden die Amnestie als Erstes am Morgen verkünden.
Das ist jedoch nicht der wahre Grund, warum ich jetzt hier bin, und das wissen wir beide, nicht wahr, Graf Drake?
Die Wahrheit ist, dass ich es einfach nicht dabei bewenden lassen kann. Es ist zu spät, meine Ziehschwestern zu retten. Aber es ist nicht zu spät für Rache.
Gerechtigkeit, meine ich.
Ich reibe mir mit der einen Hand die Augen. Ich habe in den Monaten seit der letzten Schlacht am Schwarzen Hügel nicht gut geschlafen und seit etwa ein oder zwei Tagen überhaupt nicht mehr. Das ist nicht gut. Mein magisches Talent kann schlechte Reflexe und ein getrübtes Urteilsvermögen nicht wettmachen.
Schließlich geht der Wachmann weg. Ich begutachte die Gitterstäbe vor dem Fenster. Der Ka’kari kann kleine Stahlscheiben verschlingen, um auf diese Weise die Gitterstäbe zu durchtrennen, aber er ist bereits bis oben hin mit Kraft angefüllt. Es wäre, als würde man versuchen, Öl in eine bereits randvoll befüllte Lampe zu gießen. Das zusätzliche Öl würde nur aus der Lampe tropfen, was nicht ratsam ist, wenn man es mit Feuer zu tun hat. Auf ähnliche Weise wäre das Durchschneiden der Stäbe mit dem Ka’kari hier oben wie das Entfachen eines Leuchtsignals sowohl im magischen als auch im allgemein sichtbaren Spektralbereich.
Ich werfe einen Blick in den Innenhof hinunter. Ein Magier, diesmal hilfreicherweise in blaue Gewänder gekleidet, patrouilliert dort. Ich kann, ohne gesehen zu werden, Magie für innerliche Dinge einsetzen, wie die Kräftigung meiner Muskeln für einen Sprung, aber alles, was ich äußerlich an Magischem mache, wäre, wie in der Dunkelheit eine Fackel zu schwenken. Möglich, dass er es nicht sieht, wenn ich nur schnell genug bin. Wenn ich genau in dem Moment handle, in dem er sich abwendet …
Nein, es ist das Risiko nicht wert. Irgendein anderes Augenpaar könnte mich sehen.
Ich ziehe mich hinauf und spähe durch das Fenster. Der Wachmann bewegt sich immer noch von mir weg, steuert das gegenüberliegende Fenster an, um sich dort zu einem anderen Mann zu gesellen. Wenn sich der andere umdreht, um ihn zu begrüßen, während ich gerade am Fenster vorbei hinaufklettere, sitze ich in der Patsche.
Es gibt hier einfach zu viele Augen, die auf mich gerichtet sein könnten, und zu viele Möglichkeiten, mich durch schlichtes Pech zu verraten.
Ich muss es riskieren. Also los.
Ich spüre das Kribbeln des Ka’kari an meinen Fingerspitzen, als er Feuchtigkeit und Fett aufsaugt, damit ich besseren Halt habe. Wie gesagt, wenn er will, kann er sehr hilfreich sein.
Verzierte Kragsteine stützen das überhängende Flachdach des Turms über mir. Die Tatsache, dass ich keinen Gebrauch von Magie machen darf, dazu die Fenster und das überhängende Dach, all das bedeutet, dass meine größte Aussicht auf Erfolg in einer schnellen Abfolge dynamischer Bewegungen besteht. Nicht zum ersten Mal bin ich froh über die Jahre, die ich ohne magisches Talent zugebracht habe. Um mit meinem Meister mithalten zu können, habe ich mir eine gute Klettertechnik aneignen müssen.
Allerdings bin ich in jenen Jahren auch oft genug ins Seil gefallen – und ich habe nie etwas derart Dummes versucht wie jetzt. Und dieses Mal verfüge ich über kein Sicherungsseil, das mich auffangen kann.
Ich führe mir die Bewegungsabfolge rasch noch einmal vor Augen: ein schneller Lauf die Wand hoch, ein Sprung von der Wand weg mit einer halben Drehung, die Gesimsfigur unter dem Überhang umklammern, einmal um sie herumwirbeln und dann ein Rückwärtssalto auf das Dach hinauf.
Kein Problem, oder? Ich schaffe das.
Ich werde sterben.
Ich werfe einen Blick ins Innere und sehe, wie einer der Wachleute mit dem Daumen auf mein Fenster zeigt. Der andere blickt herüber, nickt. Einer von ihnen wird jeden Moment in diese Richtung kommen.
Jetzt!
Ich stemme mich unter Zuhilfenahme meines magischen Talents nach oben, klettere auf die Fensterbank und hangele mich die Gitterstäbe vor den Fenstern hinauf, als wären sie eine Leiter. Meine Füße folgen und rasen die Stäbe empor. Ich drehe mich von der Wand weg und springe nach oben in den leeren Raum hinaus.
Für einen kurzen Moment wirbele ich verbindungslos im Nichts, berühre nur Luft. Dann klatschen meine Hände auf die kugelig hervorgewölbten Steinaugen der Gesimsfigur, die in die Kragsteine über mir hineingemeißelt ist. Ich drehe mich um die Figur herum, wie ein Akrobat um eine Reckstange wirbelt, um mich dann zurück in Richtung Gebäude zu werfen.
Doch während ich mich mit aller Kraft emporziehe, bricht eines der Steinaugen in meiner Hand heraus, was mich aus der vorgesehenen Flugbahn wirft.
Ich fliege nach oben, aber nicht hoch und auch nicht weit genug.
Als ich meinen Salto vollende, treffen statt meiner Füße meine Knie auf Stein, gerade noch auf der Kante des Daches. Zu schnell verliere ich den Schwung, und ich erreiche diesen unangenehmen Moment am höchsten Punkt eines Sprungs, wenn man aufhört zu steigen.
Mein Körperschwerpunkt liegt immer noch außerhalb der Dachkante.
Ich werfe meine Hände zur Seite, um die Zinnen rechts und links des Zwischenraums zu fassen zu bekommen, doch sie sind zu weit auseinander. Es ist unmöglich, dass ich nicht falle.
Aber ich strecke auch meine Beine nach beiden Seiten aus, mache einen Spagat und erwische eine der Zinnen mit dem Fuß – und verlagere einen Großteil meines Gewichts schmerzhaft direkt auf die Leistengegend.
Dann rutsche ich ab, weil ich mich nirgendwo festhalten kann.
Ich rette mich nur vor dem freien Fall, indem ich mit einer Hand nach der Dachkante greife und meinen ausgestreckten Fuß ins offene Maul der Gesimsfigur stemme, dort, wo sie ein winziges Stück unter dem überhängenden Dach hervorlugt.
Über mehrere lange Augenblicke hinweg kann ich mich kaum bewegen und habe sogar Mühe zu atmen. Hodenschmerzen haben etwas Mystisches an sich. Aber man kann sich antrainieren, sie auszuhalten und immer noch zu tun, was man tun muss.
Möchtest du raten, auf welche Weise mein Meister mich darin trainiert hat, diese Art Schmerz zu ignorieren?
Gerne, tu dir keinen Zwang an, denn ich werde nicht darüber reden.
Mein magisches Talent macht es nicht gerade einfach, sich mit einem einzigen unsicheren Haltegriff und auf den Zehenspitzen eines Fußes an eine kalte, grobkörnige Wand zu klammern – aber es macht es immerhin möglich. Ich nehme alle Kraft zusammen, dann springe ich von meinem einen Fuß auf der Gesimsfigur aus in die Höhe, um meine andere Hand über die Dachkante zu schwingen. Von da an ist es nur noch ein einfaches Hinaufziehen, solange mich die Kante des Turms aushält.
Was der Fall ist. Ich klatsche auf das Dach und rolle von der Kante weg, endlich in Sicherheit. Dann erst wälze ich mich auf die Seite und kauere mich in Embryonalstellung zusammen, wie es sich für einen erwachsenen Mann gehört.
~Was für ein Glück!~
»Glück?«, krächze ich.
~Das Auge, das du der Gesimsfigur abgerissen hast, ist in die Büsche gefallen, und die Wache war zufällig zu weit weg, um es zu hören.~
Ich kann nur stöhnen. Ich Glückspilz.
Kaum bin ich aufgestanden und habe mir den Staub von Händen und Kittel gewischt, höre ich eine Stimme von unten heraufrufen: »Stern! Kylar Stern, ich weiß, dass du hier bist!«
Im Bewusstsein, dass mich ein Armbrustbolzen oder eine magische Attacke erwarten könnte, sobald ich unten meinen Kopf sehen lasse, nähere ich mich vorsichtig der Kante, doch der Mann, der da spricht, erhebt seine Stimme nicht aus dem Hinterhalt. Er steht auf einer überdachten Terrasse fast direkt unter mir. Es kann nur Lord Repha’im persönlich sein. Er muss von Leibwächtern umringt sein, die gar nicht froh sein dürften, dass er herausgekommen ist – und von Magiern noch dazu, denn ich kann sehen, wie sich kleine Kugeln aus verschiedenfarbigem Licht wirbelnd von der Terrasse erheben und in die Schatten eintauchen, um mich zu jagen.
Als Nächstes wird er mich auffordern, herauszukommen und gegen ihn zu kämpfen wie ein Mann.
»Stern!«, ruft er erneut. Dann wird seine Stimme leiser, aber ich kann sie immer noch hören, ohne mich anzustrengen. Er hat eine dieser weithin vernehmlichen Stimmen. »Du glaubst zu wissen, wie die Sache enden wird. Du irrst dich.«
Die leuchtenden Kugeln sausen noch ein letztes Mal herum und verschwinden dann. Ich höre, wie die Tür zugeknallt wird, und dann das laute Klappern von vorgelegten Riegeln magischer und mechanischer Natur.
Ich irre mich also, hm?, denke ich und lasse den schwarzen Ka’kari sich in meiner Hand zusammenziehen. Das werden wir schon noch sehen.
Ich stehe auf, und da nun der gesamte Turm allen Menschen unten den Blick auf die Magie des Ka’kari versperrt, schneide ich einfach durch das Schloss der Tür hindurch.
Ich nehme mir einen Moment Zeit, um meinen Willen zu stählen und mich auf das Hässliche vorzubereiten, das da meiner harrt.
Die Verantwortung liegt allein bei mir. Meine Schuld ist unermesslich, unentrinnbar, unaussprechlich – aber es ist nicht ganz allein meine Schuld. Ihr und Eure Familie habt mich als Sohn in Euer Haus aufgenommen, Graf Drake. Es ist meine Schuld, dass meine Schwester tot ist. Doch nicht ich habe sie von jenem Balkon geworfen. Nicht ich habe ihren Leichnam verunstaltet. Ich kann nicht mich selbst dafür bezahlen lassen, was passiert ist, doch jemand wird heute Nacht zahlen müssen.
Ich wickle ein dämpfendes Luftgewebe um die Scharniere, um ihr Quietschen zu überdecken, und schlüpfe hinein, um meine blutige Arbeit zu tun.
Kapitel 4
Ein hilfreiches Ungeheuer
Scheint eine ziemliche Verschwendung, an einem Ort bis hinauf zur Spitze des höchsten Turms zu klettern, nur um dann den ganzen Weg in den schwer bewachten Keller hinabzusteigen, nicht wahr? Besonders wenn es in diesem Turm zahlreiche enge Nadelöhre gibt, die von disziplinierten Wachleuten leicht gehalten werden können, von Magiern gar nicht erst zu reden.
In diesem Turm hat Lord Repha’im alle paar Stockwerke Gruppen von Wachleuten stationiert. Und solche Wachmannschaften bewachen ausnahmslos jeden Zugang zu seinem Allerheiligsten. Mindestens fünf dieser Gruppen bestehen aus einem Wächter mit einem Magier an seiner Seite.
Das sind eine Menge Magier für irgendeinen neuen Lord, der aus dem Nichts kommt. Und alle von ihnen, Wachleute und Magier gleichermaßen, befinden sich jetzt in höchster Alarmbereitschaft. Es ist fast so, als sei der Mann nicht nur reich, sondern daneben auch noch klug und vorsichtig und nicht willens zu sterben.
Aber das geht schon in Ordnung. Lord Repha’ims Verteidigungsvorkehrungen werden für mich kein Problem darstellen. Ich wurde zum Blutjungen ausgebildet. Das heißt, ich bin ein Super-Meuchelmörder, der durch Wände gehen kann, tötet, wen immer er will, und wieder verschwunden ist, bevor die Leiche auch nur den Boden berührt, verstanden?
Ach ja, richtig. Ihr habt ja selbst Blutjungen beauftragt, damals, bevor Ihr mich bei Euch aufgenommen habt, nicht wahr, Graf Drake? Damals, bevor Ihr ein anderer Mensch geworden seid.
Von der schmalen zentralen Treppe, die zu den Zimmern im obersten Stockwerk des Turms führt, gehen zwei Türen ab: ein Dienstboteneingang und eine vornehmere Tür für den Herrn des Hauses oder seine Gäste. Ich zögere hier oben in der Dunkelheit und überlege, wie laut der Schall wohl die steinerne Wendeltreppe hinabdringt.
Ich weiß nicht viel über Lord Repha’im, aber ich weiß eine Menge über Cenaria. Ich bin hier in den Elendsquartieren aufgewachsen, und die Höfe der Stadt sind nicht minder voller Gemeinheit und auch nicht viel sauberer. Niemand kommt nach Cenaria, wenn er nicht willens ist, sich schmutzig zu machen. Mit Sicherheit kommt niemand hierher und wird plötzlich wohlhabend, wenn er nicht sehr gut darin ist, sehr schlecht zu sein.
Nenn mich also meinetwegen einen Zyniker, doch ich wette, Lord Repha’im hat allen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben.
Nicht, dass er überhaupt ein Gewissen hätte, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Eine Art Empfangszimmer füllt das Stockwerk unter mir aus, durch hohe Bücherregale zweigeteilt, mit großen Fenstern auf jeder Seite, von denen man die Aussicht auf die Stadt genießen kann. Bereits beim Hinaufklettern habe ich gesehen, dass sich dort eine Wache und ein Magier im Inneren befinden, aber was ich nicht gesehen habe, ist, dass die Wendeltreppe nicht durchgehend durch diesen Stock verläuft. Sie führt vermutlich auf der einen Seite hinauf, und dann beginnt eine neue Treppe auf der anderen Seite des Raums.
Darin bekundet sich ein wahrhaft ärgerliches Maß an Verfolgungswahn. Wenn deine Feinde deine ganze Burg bis auf den höchsten Raum deines Turms eingenommen haben, hast du ohnehin schon verloren. Von den damit verbundenen Unannehmlichkeiten einmal abgesehen, bedeutet es allerdings, dass ich wahrscheinlich richtigliege.
Der Grund, warum ich den Jungen nicht sofort getötet habe, nachdem er mir den Weg ins Innere gezeigt hat, besteht nicht etwa darin, dass ich ein netter Mensch wäre. Sondern vielmehr darin, dass ich ein Zyniker bin. Ich hatte nicht die Zeit, meine Unternehmung mit gebührender Sorgfalt auszukundschaften, und so habe ich das eine oder andere raten müssen: verderbter Mann von Adel, schlechtes Gewissen, ängstlich, vorsichtig, Egoist?
Zählt man das alles zusammen, lässt sich darauf schließen, dass dieser Adlige über einen fast uneinnehmbaren Schutzraum allein für sich selbst verfügt.
Aber weißt du, was? Das ist kein Problem. Es ist die Lösung.
Ein Meuchelmörder bricht in ein stark befestigtes Anwesen ein? Alle versammeln sich um den Herrn des Hauses, weil alle davon ausgehen, dass der Meuchelmörder gekommen ist, um ihn zu töten.
In diesem Fall liegen sie alle daneben.
Der Alarm hat fast sämtliche Wachen zu Stellungen gerufen, von wo aus sie einen Mann verteidigen können, an dem mir nichts liegt.
Lord Repha’im verdient es vermutlich, getötet zu werden. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht seinetwegen hier. Ich bin hier, um jemanden aus dem Kreis seiner Gäste zu töten. Jemanden, von dem ich glaube, dass er sich in dem Raum hier oben befindet.
Wenn Repha’im ein guter Mensch ist, dürfte er seine Gäste mit in seinen Schutzraum genommen haben. Wenn er ein schlechter Mensch ist, hat er sie sich selbst überlassen. Vielleicht von einem oder zwei Wächtern beschützt – wie den beiden Männern im Empfangsraum.
In diesem Entweder-oder besteht das eigentliche Risiko, denn ich kenne Repha’im nicht. Mein Meister hätte nie auf eine solche Art und Weise gezockt. Aber ich? Jetzt? Ich habe keine andere Wahl.
Die Tatsache, dass es hier oben immer noch Wachen gibt, verrät mir, dass ich wahrscheinlich recht habe. Dass sie noch nicht weggerufen worden sind, deutet darauf hin, dass sich etwas Wertvolles in den Zimmern am oberen Ende der Treppe befindet. Oder, wie ich hoffe, jemand Wertvolles.
In das Zimmer einzubrechen, könnte laut werden. Was ich drinnen vorhabe, wird es definitiv, deshalb muss ich mich zuerst um diese beiden Männer kümmern.
Ohne sie umzubringen. Keine Massaker, Logan zuliebe. Mein Arm zittert. So plötzlich an meine Erschöpfung erinnert, kneife ich blinzelnd die Augen zusammen.
Ich höre die Männer reden, aber ich kann keine einzelnen Wörter verstehen. Es bedeutet, dass sie gleich ihre Plätze wechseln werden, auch wenn ich nicht mehr weiß, wie lange es jetzt her ist, dass ich hier am Fenster vorbei nach oben geklettert bin. Mein Meister Durzo würde genau wissen, wen der beiden er gleich vor sich sehen würde. Er würde auch genau wissen, über welche Art Auslöser sie verfügten, um ihrerseits Alarm zu schlagen – das könnte ein einfaches profanes Pfeifen sein oder so komplex wie magische Leuchtsignale, die auf Dutzenden von Wegen ausgelöst werden können und zum Teil sehr schwer aufzuhalten sind.
Mein Vorhaben sieht immer mehr nach einem gewaltigen Fehler aus.
Selbst jetzt noch kann ich die Sache abblasen.
Aber Trudana Jadwin befindet sich genau hier. Ihr Hochverrat bekümmert mich nicht so sehr wie die Tatsache, dass sie den Leuten geholfen hat, die meine Ziehschwester Magdalyn ermordet haben, und dass sie ihren Leib dann für das verwendet hat, was sie Kunst nennt: Sie hat ihn in eine völlig lebensechte Statue aus unverderblichem Fleisch verwandelt und zur Schau gestellt, damit sich andere wie die Geier wohlig daran erregen konnten.
Wenn ich jetzt wieder gehe, kommt die Herzogin mit alldem davon. Sie wird im Rahmen der Nachkriegsamnestie von Hochkönig Logan begnadigt werden, und ihre Verbrechen bleiben ungesühnt. Sie hat sich seit der letzten Schlacht versteckt gehalten, aber nach dem heutigen Tag wird sie diesen Turm verlassen können, um wieder ins gesellschaftliche Leben zurückzukehren. Und das nicht irgendwo ganz unten, sondern wie gehabt direkt in den obersten Kreisen.
Ich werde das nicht zulassen. Ihr versteht mich doch, oder, Graf Drake? Die Vorstellung, dass Ihr Euch an den Hof begebt und sie dort lachen und mit ihren Freunden Wein trinken seht? Sie ist genau der Typ, der sich voller hämischer Freude auch Euch vorknöpfen würde, im Wissen, dass Ihr Euch einem Leben der Gewaltlosigkeit verschrieben habt.
Ich verstehe, warum Ihr das alles hinter Euch gelassen habt, aber die Welt braucht Männer, die des Nachts den Weg des Werwolfs gehen, die durch Blut waten, um dem Unrecht Einhalt zu gebieten. Männer wie mich.
Ich lege meinen Waffengürtel und meinen Rucksack ab und verstaue beides außer Sichtweite oben an der Treppe. Ich öffne zwei kleine Behälter; zuerst streiche ich mir eine schützende Fettschicht auf die Finger, dann trage ich zwei Tupfer meines Betäubungsgifts darauf auf. Ich lasse den Ka’kari wieder unter meine Haut sinken, sodass ich splitternackt bin.
Dann stehe ich zögernd im Schatten der Treppe. Gestern Abend schien mir das alles noch eine viel bessere Idee zu sein.
Ich stelle fest, dass der Mann auf meiner Seite des Empfangsraums der Magier ist, und ich befehle dem Ka’kari, mein Talent vor seinen Augen verborgen zu halten, nur sicherheitshalber.
»Psst«, mache ich.
Er steht am Fenster und blickt auf die Stadt und den beginnenden Sonnenaufgang. Er ist viel größer, als es mir bewusst gewesen ist. Ich werde ihm beide Dosen verpassen müssen.
Wie habe ich so etwas nur übersehen können?
»Psst«, sage ich noch einmal, lauter. Meine Schultern sind hochgezogen, und ich verberge meine Nacktheit unter meinen übereinandergeschlagenen Händen. Alles an mir drückt Verletzlichkeit aus.
Er dreht sich um. »Was zum …?«
Verlegen winke ich ihn mit der einen Hand heran.
»Dannil?«, sagt er, allerdings im Flüsterton. Das muss der Name der anderen Wache sein.
Ich schüttle den Kopf, als würde ich mich schämen, nackt und als flehender Bittsteller gesehen zu werden.
Er kommt auf mich zu. »Was machst du hier?«, fragt er nicht gerade leise.
»Schhh, bitte«, wispere ich. »Ich verliere meine Anstellung, wenn mein Meister das hier erfährt. Seit der Alarm ausgelöst worden ist, versuche ich, von hier wegzukommen.«
»Was machst du hier?«, wiederholt er seine Frage und kneift die Augen zusammen. Er hält eine zerbrechliche Glaskugel in der rechten Hand, seinen dicken Daumen darauf gelegt.
»Ich war … bei … du weißt schon, gestern Abend.« Ich mache eine Kopfbewegung in Richtung Treppe. Trudana Jadwin ist bekannt für die Unersättlichkeit ihrer geschlechtlichen Bedürfnisse und ihre Vorliebe für Männer, die etwa halb so alt sind wie sie – also in etwa so alt wie ich. Ich sage: »Als der Alarm losging, hat sie mich aus ihren Gemächern geworfen! Und sie will mich nicht wieder reinlassen. Meine Kleider sind da drin!«
Er prustet amüsiert. Ich sehe, wie sich seine Anspannung löst. Er kann sich das Lachen kaum verkneifen.
»Bitte!«, flüstere ich. Er hat Handschuhe an. Es gibt da nur sehr wenig entblößte Haut, wo ich das Kontaktgift anbringen kann. »Du musst mir helfen. Du kannst dir nicht vorstellen, welch erniedrigende Dinge sie mich letzte Nacht hat tun lassen – und was sie alles ihrerseits mit mir gemacht hat! Ich werde den Rest der Woche in der Badewanne zubringen und versuchen wegzuschrubben, wo sie auf mich … igitt. Und wenn ich zu allem Überfluss dann auch noch meine Anstellung verliere? Bitte, alter Junge.« Ich falle vor ihm auf die Knie und umklammere seine Hand mit beiden Händen. Ich schmiere ihm das Kontaktgift oben und unten ums Handgelenk, dann halte ich seine Hand in einer flehentlichen Geste mit beiden Händen umfasst, um die erste Berührung zu überspielen.
Es ist ein alter Taschendiebtrick. Eine einzelne Berührung lässt sich gut spüren, aber eine kurze, leichte Berührung kann in der Sinneswahrnehmung durch eine festere, großflächigere Berührung unmittelbar davor oder danach verdrängt werden.
»Dannil!«, sagt der Wachmann lauter und mit belustigter Stimme. »Komm und sieh dir das an!«
»Ach, komm schon!«, jammere ich, immer noch auf den Knien. »Muss das sein?«
Er zieht seine Hand angewidert von mir weg und steckt den gläsernen Alarmauslöser wieder ein. »Du solltest eigentlich wissen, dass man besser nicht mit Leuten verkehrt, die über einem stehen, Junge.«
Dann blinzelt er.
»Was ist denn?«, höre ich den Wachmann auf der anderen Seite der Bücherwand fragen.
Der massige Magier blinzelt noch einmal, dann gerät er ins Wanken.
Ich bin hinter ihm, bevor er es merkt, und schlage ihm die Fäuste in beide Kniekehlen.
Er kippt in meine wartenden Arme, und ich setze ihn mit einem Würgegriff außer Gefecht, um sicherzustellen, dass er still ist. Er wird schlaff, und ich lasse ihn sofort los. Ich möchte die Blutzufuhr in seinen Kopf nicht zu lange unterbrechen; da könnte er mir sterben, und außerdem will ich das Betäubungsgift in seinem Gehirn haben.
Ich springe über ein niedriges Bücherregal, als der Wachmann um die Ecke kommt.
Ich glaube, das Letzte, was er erwartet hat, war ein nackter Mann, der in die Luft springt und seine Arme weit ausbreitet. Mein rechtes Bein geht über seine Schulter, das linke sticht irgendwo unter seine rechte Achselhöhle, und ich verfehle mein Ziel. Aber ich drücke seinen Kopf nach unten, mein ganzes Gewicht lastet auf ihm, und wir fallen beide um. Ich klatsche auf den Boden, fange meinen Sturz ab, und er schlägt auf allen vieren über mir auf. Als sich meine Beine um ihn schlingen, schafft er es aufzuspringen, in der Hoffnung, mich hochheben und dann auf den Boden schleudern zu können. Doch ich packe ihn an der Ferse und hindere ihn daran, einen Schritt zurück zu machen, während er versucht, irgendwie das Gewicht von uns beiden abzufangen.
Er stolpert und fällt auf den Hintern, während sich meine Beine nun vollends zum Dreieck um seinen Kopf schnüren. Und das war’s dann auch schon.
Von dem Moment an, als er mich entdeckt hat, über unseren Kampf bis zu dem Augenblick, wo er bewusstlos daliegt, ist nicht einmal genug Zeit vergangen, um bis zehn zu zählen. Es ist ihm gar nicht erst in den Sinn gekommen, seine gefährlichste Waffe einzusetzen: seine Stimme.
Ich lasse ihn schnell wieder los. Erneut könnte ich allzu leicht einen Menschen töten, ohne es zu wollen. Ich schnappe mir seine Waffen und finde seinen Alarmauslöser in einer Tasche verstaut. Dann streife ich mir den Ka’kari über die Haut, damit er mich wieder als der Nachtengel umkleidet. Es lässt sich nie genau sagen, wie lange ein Mann, der bewusstlos gewürgt wurde, auch bewusstlos bleibt.
In diesem Fall ist es nicht annähernd lange genug. Statt dass erst ein Flattern seiner Augenlider anzeigen würde, dass er bald wieder zu Sinnen kommt, öffnen sich seine Augen unvermittelt ganz.
Ich mache es nicht mit Absicht, will es auch gar nicht, aber vielleicht liegt es an der Nähe unserer Gesichter, vielleicht an der Angst in seinem Blick, jedenfalls ruft etwas meine Kräfte wach: Der Nachtengel – was zum Teufel er auch immer ist, was zum Teufel ich jetzt bin – kann manchmal die Verbrechen eines Menschen in seinen Augen sehen, wie ein unauslöschlicher Fleck direkt in seine Seele eingeschrieben, für alle anderen unmöglich zu bemerken, für mich unmöglich zu übersehen.
So schnell ich kann, breche ich den Blickkontakt ab. Ohne es beabsichtigt zu haben, bin ich bereits zu ihm gesprungen, halte ihn jetzt mit dem Knie fest zu Boden gedrückt, habe seinen Kopf mit der einen Hand zurückgerissen und mit der anderen eine Klinge gezogen – bereit für den Todesstoß, die Kiefer fest zusammengebissen, die Zähne gefletscht, während die Nachtengelmaske mein Gesicht verhüllt, Rauch von Augen aus blauer Flamme aufsteigt, brennende Verdammung.
Der Blick meiner von seinem Gesicht abgewandten Augen fällt auf seine Uniform. Irgendwie habe ich eine wichtige Sache bis jetzt übersehen.
Die beiden Männer tragen nicht das Wappen der Repha’im, sondern die Livree der Jadwin. Dieser Mann war an der Entführung von Mags beteiligt und … und ich weiß nicht, woran sonst noch. Ich habe sofort weggeschaut, als ich in seinen Augen gesehen habe, wie er sie geschlagen hat.
Ich kann diesen Mann unmöglich töten.
Ich kann es unmöglich nicht tun.