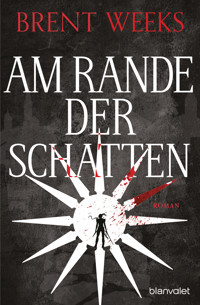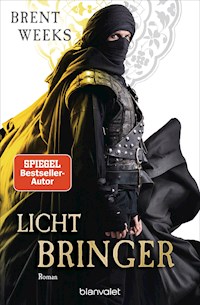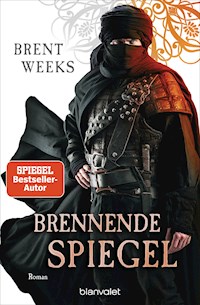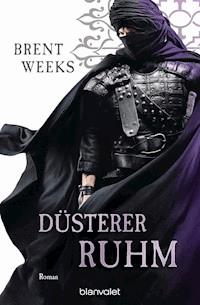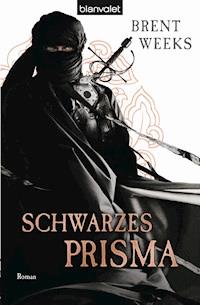9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nightangel
- Sprache: Deutsch
Was wird der Nachtengel tun, wenn ein unschuldiges Kind eine Bedrohung für die ganze Welt ist? Die Fortsetzung der Nightangel-Saga.
Als Nachtengel ist Kylar Stern der Avatar der Rache und der Gerechtigkeit – aber auch der Barmherzigkeit. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er sich für den Schutz eines Kindes in Lebengefahr begibt. Er wird alles tun, um es aus der Macht seiner Gegner zu befreien, bevor diese es für ihre finsteren Zwecke benutzen können. Aber was wird der Nachtengel tun, wenn der Junge zwar unschuldig und Kylars Feinde wahrhaft bösartig sind – doch die magischen Kräfte des Kindes eine Bedrohung für die ganze Welt darstellen …?
Lernen Sie den Assassinen Kylar Stern in der »Schatten-Trilogie« kennen. Erfahren Sie in der »Nightangel-Saga« wie seine Geschichte weitergeht. Erfahren Sie in der E-Shortstory »Nachtengel. Der Ursprung«, wie alles begann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 963
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Als Nachtengel ist Kylar Stern der Avatar der Rache und der Gerechtigkeit – aber auch der Barmherzigkeit. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er sich für den Schutz eines Kindes in Lebensgefahr begibt. Er wird alles tun, um es aus der Macht seiner Gegner zu befreien, bevor diese es für ihre finsteren Zwecke benutzen können. Aber was wird der Nachtengel tun, wenn der Junge zwar unschuldig und Kylars Feinde wahrhaft bösartig sind – doch die magischen Kräfte des Kindes eine Bedrohung für die ganze Welt darstellen …?
Autor
Brent Weeks wurde in Montana geboren und wuchs auch dort auf. Seine ersten Geschichten schrieb er auf Papierservietten und Stundenplänen. Doch Tausende Manuskriptseiten später konnte er endlich seinen Brotjob kündigen und sich ganz darauf konzentrieren, was er wirklich machen wollte: schreiben. Seither wurde er mehrfach für sein Werk ausgezeichnet und ist ein fester Bestandteil der »New York Times«- und der SPIEGEL-Bestsellerliste. Brent Weeks lebt heute mit seiner Frau und seinen Töchtern in Oregon.
Von Brent Weeks bereits erschienen:
Die Schatten-Trilogie:
1. Der Weg in die Schatten
2. Am Rande der Schatten
3. Jenseits der Schatten
Die Nachtengel-Saga:
1. Nachtengel – Nemesis
2. Nachtengel – Gemini
Weitere Titel in Vorbereitung
Brent Weeks
Nachtengel
Gemini
Roman
Deutsch von Clemens Brunn
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Night Angel Nemesis (The Kylar Chronicles 1) S. 421 – 838« bei Orbit, New York
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Brent Weeks
Published by Arrangement with Brent Weeks
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Orbit USA © 2023 Hachette Book Group. Inc.
Umschlagdesign: Unusual Co.
Umschlagmotive: Shutterstock.com (STILLFX; MeSamong)
HK · Herstellung: sam
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-31938-0V001
www.blanvalet.de
Kapitel 1
Ehrenhaft zu sein hat seine Zeit und seinen Ort
Die Atemluft, die mir in die Lunge dringt, ist wie eine Armee, die über einen Gebirgspass strömt und rings um mein Herz herum in Stellung geht, um alle Besorgnis in die Flucht zu schlagen. Mein Körper nimmt die Haltung höchster Kampfbereitschaft ein, und meine Gedanken werden ruhig, alle Gefühle halten still, die Sinne erweitern sich. Es ist Schönheit in der Gewalt. All die Hässlichkeiten sind nur ihre Nachwehen. Zu tun, was ich tue, bedeutet, ein Ganzes zu sein und doch geteilt zu scheinen. Die eine Hälfte meines Gesichts ist von hartem, unbarmherzigem Licht erleuchtet, die andere in Dunkelheit verborgen, und doch bin ich ein einziger, ganzer Mensch. Wenn ich überhaupt noch ein Mensch bin, denn wenn ich in den Zustand der fieberhaft-wilden Versenkung eintrete, den Tanz des Schicksals, die erste Zuflucht von Narren und die letzte der Weisen, werde ich zu etwas, das mehr ist als ein Mensch.
Siebzehn Männer, überwiegend Techniker, sind über diesen großen Raum mit all seinen Zahnrädern und hölzernen Laufgängen auf vier Ebenen und sich drehenden eisernen Achsen verstreut, die in summenden magischen Kästen verschwinden.
Ich atme tief aus und verbeuge mich. Erst dann bemerke ich, dass ich halb nackt bin. Der Ka’kari hat sich in meinen Körper zurückgezogen und mich in meiner Unterwäsche zurückgelassen. Ein halb nackter Mann ist im Kampf nicht Ehrfurcht gebietend: Er ist entweder etwas Lächerliches oder etwas Erschreckendes.
Damit kann ich arbeiten.
Der Ka’kari schäumt mir aus den Augen, bedeckt meine Augenhöhlen mit einem ausdruckslos schwarzen Film. Ich lächle und lasse auch in meinem Mund das schwarze Nichts aufscheinen. Mit meinem Atem flackert kurz ein blaues Schimmern durch die Luft.
Ich sehe, wie sich Augen weiten.
Diese Männer sind unbewaffnet. Sie haben nicht den Hauch einer Ahnung, was sie da vor sich haben. Nach einer Waffe zu greifen wäre nicht gerade ehrenhaft von mir.
Ich lasse den Ka’kari eine Klinge quer über meine Handfläche bilden und zerschneide ein nahes Geländer, das aus lackiertem Holz über Eisen besteht. Ich reiße ein Stück von der Länge eines Kampfstabes heraus. Ich bin fest davon überzeugt, dass ehrenhaft zu sein seine Zeit und seinen Ort hat; ich habe nur noch nicht herausgefunden, wann und wo das sein soll.
Jemand lässt ein Werkzeug fallen.
Mit einem Heulen greife ich an.
Sie stieben auseinander. Außer einem einzigen Kerl. Es gibt immer diesen einen Kerl. Der heute hat einen schicken Hut auf, ganz als hätte er hier das Sagen, obwohl er noch jung ist und mindestens genauso stark geweitete Augen hat wie die meisten anderen, die davonlaufen. Er hält ein Stemmeisen in der Hand und macht ganz den Eindruck, als hätte er es bisher auch wirklich nur zum Aufstemmen von Türen und dergleichen benutzt.
Ich bin bei ihm, bevor er reagieren kann, schlage ihm das Stemmeisen aus der Hand, packe seinen Arm, zerre ihn in einen Würgegriff, sodass er zwischen meinem Arm und meinem Kampfstab gefangen ist, und halte seinen anderen Arm hinter seinen Rücken gedrückt. Er schnappt keuchend nach Luft.
»Wie heißt du?«, verlange ich zu wissen, während ich den Raum nach Ausgängen absuche. Aus einem der unteren Vordereingänge strömen jetzt Soldaten in den Raum.
»Caravaldi. Hmmahcll Caravaldi«, antwortet er. Ich drücke ihn so fest, dass er seinen Vornamen zur Hälfte verschluckt.
»Dein Leben hätte hier enden können, Caravaldi«, lasse ich ihn wissen. »Du bist ein mutiger Mann. So mutig, dass du etwas Besseres als diese Arbeit hier verdient hättest.«
Ich presse die Druckpunkte hinter seinen Ohren, um ihn außer Gefecht zu setzen, dann laufe ich den Soldaten entgegen, die jetzt mit gezückten Knüppeln die Treppe hochstürmen.
Treppen in Burgen sind im Hinblick auf den Kampf von Soldaten so konstruiert, dass sie Rechtshändern, die auf höheren Stockwerken Verteidigungspositionen einnehmen, einen Vorteil bieten, während sie umgekehrt Rechtshändern, die nach oben zu gelangen versuchen, zum Nachteil gereichen. Offensichtlich wurde diese Treppe nach dem gleichen Muster gebaut, wenn auch vermutlich aus reiner Gewohnheit und nicht etwa, weil jemand vorausgesehen habe könnte, dass der Nachtengel einmal sieben – jetzt schon acht – Soldaten würde abwehren müssen, die die Treppe herauf auf ihn zugestapft kommen.
Ich erreiche das obere Ende der Treppe kurz vor dem ersten Soldaten und ramme ihm meinen Stab wie einen Speer durch seine Deckung hindurch mitten in sein Wams und die Brust darunter. Ich muss ihn erwischt haben, als er gerade einen Schritt nach vorn gemacht hat, denn ich schleudere ihn mit Leichtigkeit zurück und in seine Kameraden hinein.
Vier von ihnen stürzen zu Boden, woraufhin die beiden Folgenden aus dem Schritt geraten und stehen bleiben, statt weiterzugehen.
Mein Tun ist auf eine derart lächerliche Weise erfolgreich, dass es mich ganz aus dem Konzept bringt. Was sind das bloß für Idioten, die …
Ach so, jetzt erst fallen mir ihre pompösen Uniformen auf. Das hier sind keine kaiserlichen Soldaten. Es sind Schiffswachen, darin geschult, senile Greise zu den Latrinen zu lotsen und mit betrunkenen Edelleuten fertigzuwerden, nicht jedoch darin zu töten.
Ich verharre noch einen Moment an Ort und Stelle, um meine nächsten Schritte zu planen, und dann, sobald sich die Männer wieder in Bewegung setzen, stürme ich vorwärts. Sie zucken heftig zusammen, als ich auf sie zukomme, aber dann hüpfe ich leichtfüßig auf das Geländer und springe hinunter auf die nächste Ebene, rolle mich ab, als ich auf dem Treppenabsatz lande, und gebe zwei Männern, die zur Verstärkung heraneilen, mit meinem Kampfstab aus dem Treppengeländer je einen leichten Klaps auf den Helm, von links nach rechts, und mache dann einen Satz zwischen ihnen hindurch.
Zwei Techniker stehen vor der geöffneten Doppeltür, die aus dem großen Raum herausführt. Beide heben kapitulierend die Hände und drücken sich mit dem Rücken dicht an die Wand.
Ohne zu zögern – schließlich könnte jemand, den ich nicht bemerkt habe, Pfeil und Bogen bei sich haben –, schlüpfe ich zwischen ihnen hindurch auf den Flur hinaus und ziehe die Tür hinter mir zu. Die Doppeltür hat Schlaufengriffe, also stoße ich mein Stück Treppengeländer hindurch und verbiege es mithilfe meines magischen Talents, um auf diese Weise die Tür zu verbarrikadieren.
Doch mein Geländerstab zerbricht mir in den Händen, Holz birst, und ein Hagel aus kleinen Stahlsplittern durchsiebt meinen Unterarm.
Ich stoße einen Fluch aus. Stahl. Ich dachte, es sei Eisen.
Aber der Stab ist immer noch lang genug, dass ich sein eines Ende in den Holzbelag rammen und dort fest verankern kann, während ich oben beide Schlaufengriffe der Tür einhake. Das wird sie verlangsamen, aber auch nicht mehr.
Ich höre das Stampfen von Füßen auf dem Flur und die unverwechselbaren Laute eines Offiziers, der Truppen befehligt. Diesmal sind es keine Schiffswachen, sondern reguläre Soldaten der Alitaeri, die dem Alarm auf den Grund gehen wollen. Jetzt, wo die Tür hinter mir versperrt ist, gibt es auf dem langen Korridor keine weiteren Ausgänge, außer durch eine Tür, die direkt zu den Soldaten führt.
~Hast du nicht etwas vergessen?~
Weißt du, wie wär’s, wenn du vielleicht einfach mal hilfreich wärst, statt dämliche Fragen zu stellen …
Oh. Ach so. Du willst mich daran erinnern, dass ich das hier vergessen habe.
Ich lasse den Ka’kari meine Haut überziehen und werde mit einem kurzen Schimmern unsichtbar. Im nächsten Moment stürmt ein Dutzend Soldaten durch die Tür.
Kapitel 2
Aus dem Schlimmsten heraus
»Halt!«, brüllt der Offizier, als er durch die Tür tritt – doch er ruft es nicht mir zu, sondern seinen Männern.
Sie gehorchen, wenn auch nicht ganz unmittelbar, drängeln und rempeln, zwölf von ihnen auf meiner Seite des Flurs, weitere sind auf der anderen Seite sichtbar und können nun erst mal nicht weiter.
Der Offizier hat einen guten Instinkt, doch seine Männer haben nicht genug Disziplin, um eine Verlängerung seines Willens zu sein. Wollte ich jemanden in einen Hinterhalt locken, so sind sie genau an der Stelle stehen geblieben, wo ich sie in diesem Fall hätte haben wollen.
~Und du willst aber niemanden in einen Hinterhalt locken?~
Mein Gewicht verlagert sich bereits nach vorn in die Zehenspitzen. Ich sehe den Speer, den der Mann zur Linken des Offiziers locker in der Hand hält. Ein bereits klar ausgeformter Plan erscheint vor meinen Augen: ein Tritt zur Seite in die Achsel des Mannes, um ihn in seine Kameraden an der Tür hineinzuschleudern, meine eine Hand an seinem Speer, die breite Klinge des Speers durch den Hals des Offiziers stoßen, dann …
Aber ich will nicht töten. Diese Männer tun nichts Unrechtes. Sie sind rechtmäßige kaiserliche Soldaten, die ein Rätsel aufzuklären suchen.
Mein Moment des Zögerns reicht dem Offizier, um zwei seiner Männer anzuweisen, rechts und links von ihm in Stellung zu gehen, während er den Rest draußen vor der Tür warten lässt. Er beauftragt seinen Stellvertreter, die Hälfte dieser Männer zu einem anderen Eingang des Maschinenraums zu führen, dann schreitet er auf die Tür zu, die ich mit dem gebogenen Stück Treppengeländer verriegelt habe.
»Was ist passiert?«, schreit der Beamte durch die Tür.
Da er keine Antwort erhält, weist er seine Männer an, sich an der Stange zu schaffen zu machen, und schreit ein weiteres Mal.
»Keine Zeit für eine Antwort«, kommt eine gedämpfte Stimme von drinnen. Vielleicht ist es Caravaldi. »Wenn wir nicht« – es folgen ein paar Wörter, die ich nicht verstehen kann – »rammen wir das Sturmschiff in zwei Minuten gegen den M…felsen!«
Ich höre ein Summen tief unten im Bauch des Sturmschiffes, nicht ein einzelner Laut, sondern mehrere, einige unerträglich hoch und einer so tief, dass ich ihn in meinem Zwerchfell vibrieren spüre, wobei sich die einzelnen Töne nicht zu einem Akkord zusammenfügen.
Oder vielleicht ist es doch ein Akkord, aber ein fürchterlicher. Was weiß ich schon von Musik?
Das misstönende Konzert unter meinen Füßen verändert sich ständig, die einzelnen lärmenden Geräusche, aus denen es sich zusammensetzt, werden immer höher und schneller. Gleichzeitig spüre ich einen tiefen, magischen Taktschlag, als würde ich mein Ohr an die Brust eines Leviathans pressen und, während er zum Leben erwacht, seinen Herzschlag nicht nur in meinem Ohr, sondern durch meinen ganzen Körper hören. Und dann noch ein weiterer Schlag und noch einer, aus dem Rhythmus. Wuuuhmmm … wumm … wumm … wuuuhmmm.
Das Deck bewegt sich unter unseren Füßen, und obwohl ich breitbeinig dastehe, wäre ich fast umgekippt.
Ich kann das Gesicht des Offiziers nicht sehen, aber die Soldaten, die mir den Ausgang versperren, werden hin und her geworfen. Sie wirken beunruhigt.
Na großartig.
Den Männern des Offiziers gelingt es, die Verrieglung aufzubrechen, und sie reißen mit großem Schwung die Türen zum Maschinenraum auf.
Der Offizier lässt seinen Blick nach links und rechts wandern, noch einmal nach links und rechts, überrascht, dass alle im Raum nur ihre Arbeit zu machen scheinen. »Was liegt hier für ein Notfall vor?«, will er wissen. Er wedelt mit der Hand, winkt seine Männer heran. Ich drücke mich so flach wie möglich an die Wand.
Der Gang ist nicht breit, und auch wenn die meisten Männer ihre Kurzspeere in Laufordnung halten – in der rechten Hand, den Schaft eng an den Leib gedrückt, in einem steilen Winkel nach oben, um ihn nicht in die hinter ihnen laufenden Männer zu rammen –, halten mehrere ihre Speere quer, die Spitze nach links oben, was bedeutet, dass einiges an scharfem Stahl auf genau die Stelle zukommt, die mein Kopf einnimmt. Ich ducke mich und kauere mich so tief hinunter, wie ich kann, doch noch während die Männer auf mich zueilen, findet sich das mechanische Heulen zu einem gleichbleibenden Akkord zusammen, und der magische Taktschlag nimmt ein gleichmäßiges Tempo an.
Plötzlich schießt das Sturmschiff mit einem so gewaltigen Ruck nach vorn, wie es für einen solchen Koloss eigentlich unmöglich sein sollte – und nicht nur nach vorn, sondern es beginnt auch scharf zu wenden, sodass sich die Decks schräg zur Seite neigen.
Die Drehung wirft die Soldaten in meine Richtung – klar, natürlich, das ist keine Überraschung. So ist es nun mal bei mir, mein Schicksal. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passiert, bei eins zu eins liegt, dann kommt bei mir jedes Mal das Schlimme. Ich lasse mich zu Boden fallen, während im gleichen Moment die Hände von einem halben Dutzend Mann eine Stütze suchend zu genau der Wand hingehen, an der ich mich noch einen Augenblick zuvor verborgen gehalten habe.
Ein gestiefelter Fuß streift meine Nase, als ein schlanker Soldat zur Seite taumelt. Seine Hand rutscht von der Wand ab, und er steht im Begriff, auf mich zu fallen – aber ein jüngerer Mann mit blondem Haar und runderem Gesicht packt ihn und zieht ihn gerade noch rechtzeitig wieder hoch, bevor er uns alle umbringt.
Ein breites, ansteckendes Lächeln legt sich über das Gesicht des jüngeren Soldaten. »Warum muss ich dich nur ständig retten?«
»Na klar, vor dem sicheren Untergang«, entgegnet der andere spöttisch. »Mat, ob du wohl immer noch eine so große Nervensäge sein würdest, wenn du nicht mein Bruder wärst?«
Seine Antwort entgeht mir, da sie nun alle nach vorn drängen. Ein weiterer Soldat tritt mir voll auf die Finger, bricht sie mir unwillentlich und geht weiter.
Im Gehen wirft er verdutzt einen schnellen Blick zurück, hält Ausschau, worauf er da getreten ist. Aber seine Kameraden drängen ihn vorwärts, in den Maschinenraum, wo der Offizier herumschreit, Antworten verlangt. Caravaldi scheint ihn zu ignorieren, er brüllt seiner eigenen Mannschaft Befehle zu, lässt das Schiff sich noch stärker drehen, der gewaltige Akkord von Maschinen und Magie setzt zu einem triumphalen Crescendo an.
Ich warte nicht, um zu sehen, wie sich die Sache entwickelt. Ich fühle mich bereits wie betäubt, taub gemacht, sowohl in körperlicher als auch in magischer Hinsicht. Mein magisches Talent ist so sehr auf meine Umgebung abgestimmt, dass es mich überempfindlich macht. Die Magie hier lastet als lähmender Reiz auf mir, als habe jemand seit einer halben Stunde dieselbe Stelle an meinem Arm gerieben.
Ich umfasse meine schmerzenden Finger mit der anderen Hand, bin schon wieder aufgesprungen und renne lautlos aus dem Flur hinaus und in das Treppenhaus dahinter. Ich nehme die Stufen nach oben, aber schon das bloße Treppensteigen genügt, meinen Körper beschließen zu lassen, dass es an der Zeit ist, mich daran zu erinnern, wie wenig ich in letzter Zeit geschlafen und wie sehr ich mich überanstrengt habe.
Unsichtbar erreiche ich das obere Ende der Treppe. Ich erhasche einen kurzen Blick auf kaiserliche Wachen in gespannter Aufmerksamkeit und auf Magier mit einzelnen roten Steinen an ihren Halsbändern. Dahinter Edelleute, in Unterhaltungen vertieft, den Blick zu einer Reihe schmaler Fenster gerichtet, durch die sie in den aufkommenden Sturm hinausschauen. In der Nähe sehen sie einen aus den Wogen ragenden Felsen vorbeiziehen, in seliger Unkenntnis der Tatsache, dass noch vor kaum einer Minute die reale Möglichkeit bestand, ihn zu rammen.
Ich sehe nur jeweils einen einzelnen blauen Stein an den Armbändern, nur einen einzelnen klaren Stein an den Armbändern ihrer Diener; das hier sind alles Leute von niederem Adel. Ich bin hier ganz hinten auf dem Schiff. Nach den Gesetzmäßigkeiten der alitaerischen Hierarchie kann ich wohl davon ausgehen, dass sich alle Personen von Bedeutung vorne am Bug befinden.
Im Moment bin ich nicht in der Lage, mich mit Magiern und kaiserlichen Wachen herumzuschlagen. Ich steige die Treppe wieder hinunter, immer weiter hinunter, bis ich einen Gepäckraum erreiche, in dem die Kisten und Truhen so angeordnet sind, dass ich mir sicher sein kann, dass hier niemand Zugang erhalten soll. Ich verkrieche mich in einer kleinen Ecke und verstaue den Ka’kari auf seinem Platinarmband. Das Schwarz fügt sich recht hübsch in den Raum um die silberweißen Muster. Normalerweise behalte ich ihn am Körper, wenn ich in Gefahr bin, aber ihn ganz abzulegen ist nach einiger Zeit ein so schönes Gefühl, wie wenn man am Ende eines langen Tages eine eng anliegende Hose auszieht.
Ich schlafe zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder wie ein normaler Mensch.
Es ist wunderbar, sehr erholsam – trotz der Träume.
Als ich wieder erwache, verdrehe ich mein Handgelenk so, dass meine Haut den Ka’kari an seinem Platinarmband berührt. Mir wird klar, dass das Armband speziell für einen solchen kaum merklichen Kontakt angefertigt wurde. »He«, sage ich mit leiser Stimme. Ich könnte es auch nur an seine Adresse gerichtet denken, aber ich habe mehr Kontrolle über das, was er hört, wenn ich Worte formuliere. »Ich glaube, es ist allmählich an der Zeit, dass du mir ein paar Fragen beantwortest.«
Kapitel 3
Geplauder mit einem Uralten
»Wenn ich dich berühre, träume ich nicht, oder?«
~Meine Magie wird hauptsächlich von deiner gespeist. Ich nehme den Überschuss, wo du ihn nicht brauchst, um ihn dort einzusetzen, wo du ihn brauchst.~
»Ich brauche also meine Träume nicht?«, hake ich nach.
~Mein Schöpfer mochte seine Träume nicht besonders. Er betrachtete traumlosen Schlaf als eine Wohltat.~
»Du nährst dich also schon seit Jahrhunderten von Träumen. Du musst doch inzwischen eine Art Traumexperte sein, oder?«, frage ich.
~Wie oft hast du schon Weizen gegessen? Verleiht es dir einen tieferen Einblick in Sachen Landwirtschaft? Ich nehme die Träume nicht direkt zu mir. Ich vertilge die Energieschübe, von denen sie bei magisch hochbegabten Menschen begleitet sind.~
Direkt ist hier das Schlüsselwort. Er nährt sich von Träumen, jedoch nicht absichtlich. Was stellt es mit einem Menschen an, nicht zu träumen? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so lange nicht geträumt habe, dass meine Träume, als sie sich nun wieder eingestellt haben, besonders eigenartig, lebhaft und unheilvoll waren – ich, wie ich mich knapp über dem Wasser unten an ein Schiff klammere, während irgendein schuppiges Ungeheuer unter mir schwimmt und mich schnappen will; oder ich stehe an einem Strand und kneife die Augen zu, vom Sand gepeitscht, den die Winde des Großen Sturms mit sich tragen; oder ich stürze wie ein Stein aus großer Höhe herab – du weißt schon, derlei spaßige Sachen eben. Ich hoffe allerdings, dass da nicht noch mehr dahintersteckt. Doch wenn meine schlimmen Träume alle noch die Nachwirkungen des einen Mals sein sollten, als ich Kiern im Arm gehalten habe, während Jenine seit Monaten jede Nacht unter Albträumen litt und sie gleichzeitig mit dem Stress fertigwerden musste, den es bedeutet, Mutter von zwei Säuglingen zu sein …
Dann ist es kein Wunder, dass sie verrückt geworden ist. Schlafmangel, die Strapazen der Einrichtung eines neuen Königshofes, der Verrat des einen Ehemanns und sein Verlust an den Wahnsinn; alles, was man als junge Eltern beim ersten Kind lernen muss, gleich mit Zwillingen durchzumachen; die belastete Beziehung mit ihrem frisch gekrönten ersten Ehemann, nun frisch wieder vereint, und dann zu allem Überdruss auch noch jedes Mal, wenn sie schläft, bizarre und beängstigende Träume? Vielleicht sind die einzelnen Komponenten für ihren Wahnsinn auch bereits in ihr vorhanden gewesen, und die Magie hat sie nur miteinander vermengt. Oder vielleicht wäre sie auch ohne diesen Auslöser zusammengebrochen. Ich habe gehört, dass derlei bei frischgebackenen Müttern manchmal vorkommt.
Plötzlich, inmitten der Dunkelheit des Frachtraums, taucht ein Bild aus meinen Träumen vor meinem geistigen Auge auf, schnell wie ein Hai, der mit aufgerissenem Maul und spitzen Zähnen aus den trüben Tiefen des Meeres emporschießt: ein mir unvertrauter Dolch in meiner Hand, ringsum ein Kreis von Soldaten, den Stahl gezückt, etwas Warmes in meiner Ellbogenbeuge, heulender Wind und heulende Schreie vereinen sich in meinen Ohren zu einem Chor der Verzweiflung.
Wenn Träume die Boten der Götter sind, dann nehme ich an, die Götter wollen mir sagen, dass ich das Gefühl habe, in der Falle zu sitzen.
~Du sitzt in der Falle.~
Zeigt mal wieder, wie nützlich Träume sind, was? Und genauso die Götter.
»Möchtest du mir nicht mal etwas Nützliches sagen? Ich könnte alles wiederholen, was ich dich vor einiger Zeit gefragt habe, aber wahrscheinlich erinnerst du dich sowieso besser an die Fragen als ich.«
~O ja, ich erinnere mich an sie. Und ich sage dir mit Freuden etwas Nützliches.~
»Wirklich?«
Er wirkt ernsthaft gekränkt. Eingeschnappter jugendlicher Knabe? Aber das ist jetzt vielleicht eher die Halbwüchsiges-Mädchen-Variante. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich bei ihm nicht um eine echte Persönlichkeit handelt. Auf jeden Fall geht ihm völlig die Reife von jemandem ab, der angeblich schon vor siebenhundert Jahren ein Uralter war.
Hoppla. Entschuldige, ich habe dich bei diesem Gedanken eigentlich nicht berühren wollen.
~Hier kommt nun etwas Nützliches für dich, Stern. Du hättest eigentlich schon längst selbst draufkommen müssen, doch das war offensichtlich nicht der Fall: Du kannst mich dazu nutzen, deine Probleme zu lösen, aber ich werde keine Probleme für dich lösen. Wenn du stirbst, weil du eine offensichtliche Anwendungsmöglichkeit meiner Kräfte übersehen hast, dann soll es eben so sein. Das liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Ich bin dein Werkzeug, nicht dein Retter. Also hör auf, von mir zu verlangen, dir das Leben leicht zu machen. Du bist ein Waisenkind. Hör auf, nach Papa zu suchen, damit er dich rettet.~
Ich drehe mein Handgelenk weg, um die Verbindung zu trennen.
~Gut. Wir haben da eine kleine Lücke in unserer Chronik. Möchtest du nachreichen, was du in der letzten Zeit so unternommen hast?~
Damit du zuhören und dich lustig machen kannst? Ich verzichte. Sollte ich je die Gelegenheit bekommen, etwas hinzuzufügen, nachdem du es auf Haut oder Pergament oder was auch immer niedergeschrieben hast, mache ich es vielleicht dann.
Ich bin gerade dabei, den nächsten Teil des Schiffes auszukundschaften.
Gut, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Auskundschaften ist, aber ich nenne es so, für den Fall, dass ich bei meinem Versuch scheitere, in den nächsten Schiffsabschnitt vorzudringen. Meine Nische hier tief unten im rückwärtigen Teil des Sturmschiffs … am Schiffsheck … Schiffshintern? Ich weiß nichts über Schiffe.
~Achtern.~
Achtung? Was ist los?
Er antwortet nicht.
Ach so. Achtern. Hinten am Schiff ist achtern.
Wie auch immer, mein Frachtraum achtern ist sicher. He, hast du nicht gesagt, du würdest nicht freiwillig deine Hilfe anbieten?
~Das? Das war keine Hilfe. Ich bügle der Klarheit halber sprachliche Schnitzer aus. Ein erstklassiges Werkzeug lässt seinen Benutzer manchmal viel begabter aussehen, als er eigentlich ist. Betrachte es als eine Art von Übersetzung.~
Aus dem Dämlichen, meiner Muttersprache?
Der Ka’kari zieht es vor zu schweigen, statt sich zu rechtfertigen. Ein Mensch würde antworten: So habe ich das nicht gesagt. Nicht der Ka’kari.
He, als du das alles aufgezeichnet hast, wie sehr hast du da auch alles andere, was ich dir gesagt habe, »übersetzt«?
Er antwortet nicht.
Wenn die ganze Sache einmal vorbei ist, werde ich alles durchsehen müssen, was er da gemacht hat. Sorgfältig. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Mein Versteck im Frachtraum ist sicher. Doch ich bin nicht hier, um in Sicherheit zu sein. Ich muss mir einen Weg zum Bug des Sturmschiffes bahnen – und höchstwahrscheinlich auch noch nach oben. Diese Alitaeri wollen immer, dass ihre Position im Raum ihre gesellschaftliche Stellung widerspiegelt. Höher oben bedeutet höher oben, auch wenn das in einem Schiff mitten im Sturm zugleich schlechtere Reisebedingungen mit sich bringt.
Ich habe meine Wunden untersucht, bevor wir den Frachtraum verlassen haben. Während ich geschlafen habe, ist alles gut verheilt. Ich frage mich manchmal, wo da die Grenzen liegen. Ich weiß, dass mich eine schlimme Wunde wie jeden anderen auch töten kann, und daraufhin greift dann meine Unsterblichkeit. Wenn ich wieder zurückkomme, wache ich heil und unversehrt auf. Aber ich bin auch schon schwer verwundet gewesen und habe festgestellt, dass ich auf magische Weise geheilt wurde, während andere dauerhaft verkrüppelt geblieben wären. In wie starkem Maße meine Verletzungen auf dieser Seite des Todes heilen können – auf magische oder nicht magische Weise –, bleibt also mit einem Fragezeichen versehen. Doch es besteht auch eine ebenso große Frage, was die andere Seite angeht. Ich weiß, dass Curoch – das mittlerweile im Verborgenen befindliche magische Schwert der Macht, das Jorsin Alkestes geschmiedet oder getragen hat oder was auch immer – mich für immer töten könnte. Dazu wurde es geschaffen. Aber was ist, wenn ich geköpft oder vollständig verbrannt oder aufgefressen werde? Würde ich genau in der Mitte in zwei Hälften geteilt, welche Hälfte von mir würde zurückkehren? Beide? Könnte ich mich theoretisch verdoppeln?
Könnte praktisch sein.
Es ist ein alberner Gedanke, aber nur, weil mir das alles Angst macht. Was, wenn ich ein Körperteil verliere und es nie wieder zurückkommt? Was ist, wenn ich dazu verdammt bin, für immer ohne meine Beine zu leben oder Ähnliches?
Durzo ist verschwunden; die einzige Möglichkeit, meine Grenzen zu finden, besteht darin, sie auszutesten.
Ein solches Austesten hat echte Nachteile.
~Und du hattest ja nicht das Geringste damit zu tun, warum er sich aus dem Staub gemacht hat, nicht wahr?~
»He, Klappe halten. Streich das. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, stimmt: Du kannst mich also wirklich sonst nichts weiter über die Nachtengel, über meine Kräfte oder gar über Durzo wissen lassen?«
~Ein Teil meiner Bestimmung besteht darin herauszufinden, ob du ein Mensch bist, der die Grenzen anderer respektiert. Wenn du das nicht bist, dauert es viel länger, bis ich dir etwas anvertraue. Mein Schöpfer war der Überzeugung, dass diejenigen Menschen, die von vornherein keine Grenzen respektieren, auch diejenigen sind, die mit deinen Geheimnissen Schindluder treiben, sobald du sie einmal in sie eingeweiht hast.~
»Du sagst mir also, wenn ich schnell machen will, soll ich es lieber gleich ganz lassen?«
~Oh, schau an! Du bist ja gar nicht so schwer von Begriff, wie Blint befürchtet hat.~
Das wurmt. Im Klartext sagst du also: »Wenn du deine Fragen beantwortet haben willst, dann stell sie gar nicht erst?« Wie lächerlich. Damit bin ich dem Ka’kari auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Hoppla. Letzteres hätte er eigentlich nicht mitbekommen sollen. Er hat in Wirklichkeit gar nicht befürchtet, dass ich schwer von Begriff bin, denke ich, um das Thema zu wechseln.
Schweigen.
Stimmt doch, oder?
Die Flure in diesem Teil des Schiffes sind bisher verdächtig leer gewesen. Ich weiß nicht, welche Verteidigungsvorkehrungen sie für mich bereithalten. Mein Schlaf hat mich geheilt und mich in eine viel bessere geistige Verfassung versetzt, in der ich bessere Entscheidungen schneller treffen kann, was mich zugleich zu einem besseren Kämpfer gemacht hat – aber die Stunden meines Schlafs haben meinen Feinden auch Zeit gegeben, Verteidigungsvorkehrungen zu treffen. Sie wissen, dass es einen Eindringling auf dem Schiff gibt.
Wenn ich versuchen würde, einen heimlichen Eindringling aufzuhalten, würde ich die hierfür nötigen Schutzvorrichtungen an irgendwelchen sonderbaren Orten in Stellung bringen, wo Eindringlinge nicht danach Ausschau halten würden. Militärs neigen jedoch dazu, in militärischen Kategorien zu denken. Sie denken daran, Kreuzungspunkte zu kontrollieren, Schussbahnen und höher liegende Bereiche. Ich habe bisher sorgfältig alle Wegkreuzungen auf dem Schiff überprüft, bevor ich mich ihnen genähert habe, und endlich zahlt sich meine Arbeit aus …
Kapitel 4
Schäfer und Schüler
Viridiana legte das Buch zur Seite. Sie rieb sich die Schläfen. »Darf ich womöglich gar nicht mit Euch reden?«, wandte sie sich an Schwester Ariel.
»Haben sie dich dazu aufgefordert zu schweigen?«, fragte Schwester Ariel zurück, ohne von ihrer Lektüre aufzublicken. Die Frau las in einem Tempo, dass es einen verrückt machte. Hätte Viridiana so schnell lesen können, wäre sie mit ihrer elendigen Aufgabe schon längst fertig gewesen.
»Nein.«
»Dann rede einfach unbekümmert drauflos. Doch lass mich anmerken, dass im Übrigen ich die Anweisung erhalten habe, nicht mit dir zu sprechen.«
»Tatsächlich? Von wem?«, fragte Viridiana.
»Das tut nichts zur Sache. Ich habe nicht die Absicht zu gehorchen.«
Vi gestattete sich ein Lächeln. Unter ihrem unscheinbaren, mausgrauen Äußeren konnte Schwester Ariel eine heimliche Unruhestifterin sein. Von draußen vor der Tür ließ sich ein leises Knarren vernehmen. Es durchschoss Vi wie der Blitz, und sie zuckte heftig zusammen. Die Angst vor Entlarvung, vor dem Entdeckt-Werden packte sie so heftig, dass sich ihr der Magen umdrehte. Sie biss die Zähne zusammen, richtete rasch die Augen auf das Buch vor ihr und starrte bereits mit leerem Blick darauf, bevor sich die Tür der Bibliothek einen Spaltbreit öffnete.
Sie riss sich zusammen und zwang sich, ruhig zu bleiben. Er ist tot, sagte sie sich. Hu Gibbet ist tot.
Als sie noch ein Kind war und unter Hu zum Blutjungen ausgebildet wurde, hatte er ihr wiederholt Aufgaben gestellt und sie dann bei deren Erledigung vergessen. Einmal hatte sie stundenlang seine zehn meistverwendeten Rezepte für die Zubereitung von Gifttränken abgeschrieben und hart darum gekämpft, ihre Aufmerksamkeit nicht abschweifen zu lassen, sich eingeschärft, dass sie Prügel bekommen würde, wenn sie damit aufhörte, aber schließlich hatte sie einfach versucht, einen der Tränke herzustellen. Er war hereingekommen, nicht völlig geräuschlos, die Diele hatte einmal ganz leise geknarzt.
Wenn er nüchtern war, war er völlig still. Sie hatte auf der Stelle gewusst, wie schwer der Fehler war, den sie da gemacht hatte.
Nachdem sie sich von den Schlägen erholt hatte, hatte er sie zur Strafe eine Zeit lang einem anderen Mann gegen Geld überlassen, um ihre »Schuld« für die von ihr verschwendeten Ingredienzen abzuarbeiten. Die »Arbeit«, in die er sie verkauft hatte, war genau jenes Schreckliche gewesen, das Kinder leisten zu lassen Momma K der Sa’kagé verboten hatte. Bei den Gesprächen, die ihrer Aufnahme in die Chantry vorausgegangen waren, hatte sie auch Fragen zu solcherlei Dingen beantworten müssen, und Viridiana hatte behauptet, dass es ihr nicht viel ausgemacht habe, weil sie zu diesem Zeitpunkt angeblich bereits gelernt hatte, ihre Seele von dem abzuschotten, was mit ihrem Körper geschah. Es war einfach die Ungerechtigkeit gewesen, die sie zur Weißglut getrieben hatte – sie hatte jene Zutaten für den Trank keineswegs verschwendet; sie hatte den Trank perfekt zubereitet, und Hu musste es auch gewusst haben, denn schließlich hatte er Gebrauch von dem Trank gemacht, den sie gebraut hatte.
Sie hatte ihm geholfen, und er hatte sie dafür bestraft. Aber Hu war das egal. In jenen frühen Tagen war er gar nicht daran interessiert gewesen, einen Lehrling zu haben; er wollte eine Sklavin. Erst als er bemerkte, wie sehr es den Ruf anderer förderte, wenn diese fähige Lehrlinge hatten, begann Hu ernsthaft, sie einer Ausbildung zu unterziehen.
All das schoss Vi in Sekundenschnelle durch den Kopf; die alte Panik nutzte breit ausgetretene mentale Pfade. Die Tür öffnete sich.
Das hier ist nicht Hu Gibbet, sagte sie den verkrampften Muskeln in ihrer Kehle und unter ihrem Zwerchfell. Das war einfach nur Schwester Ayayah Meganah, die alte Hexe. Viridianas Muskeln entspannten sich und sie lächelte. »Große Schwester«, sagte sie in unbeschwertem Tonfall.
»Wie geht es mit der Arbeit voran?«, erkundigte sich Schwester Ayayah.
»Leidlich gut«, antwortete Vi. Sie rechnete es sich als Erfolg an, dass sie es schaffte, einen freundlichen Ton anzuschlagen.
»Aber nicht gut?«
»Leidlich gut«, wiederholte Vi etwas angespannter. Sie versuchte, ein falsches Chantry-Lächeln aufzusetzen, was jedoch ziemlich misslang.
»Das beunruhigt die Schwesternschaft. Die Zeit ist knapp. Du sollst so schnell wie möglich fertig werden und nicht hier herumsitzen und mit einer alten Schachtel tratschen. Wenn es sein muss, komme ich wieder und überwache dich selbst. Noch Fragen?«
Vis falsches Lächeln erstarb. »Nur eine einzige«, erwiderte sie. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Schwester Ariel sich aufrichtete, sah die Hand der älteren Frau eine unwillige Bewegung in Vis Richtung machen, ein Zeichen, doch bitte aufzuhören, nicht fortzufahren, es nicht zu tun. »Warum nur müsst Ihr so ein widerliches Miststück sein?«, sagte Vi.
Schwester Ariels Hand erstarrte an Ort und Stelle und fiel dann herab, sie gab sich geschlagen.
Schwester Ayayahs Nasenlöcher blähten sich. Ihr Hals spannte sich an. »Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob es für mich überhaupt je im Bereich des Möglichen gelegen hat, dich zu mögen. Du stehst einfach auf der falschen Seite von zu vielen Trennlinien. Aber du machst es einem wirklich leicht, dich zu hassen.«
»Ich stehe mit niemandem und nichts auf einer Seite«, erklärte Vi. »Ich bin in keiner Weise politisch.«
»Siehst du, genau das meine ich. Du glaubst das wirklich. Und das macht dich zu einer von ihnen.«
»Ihr habt nach einer Ausrede gesucht, mich zu hassen, seit Ihr mich zum ersten Mal gesehen und erkannt habt, dass ich alles bin, was Ihr nicht seid.«
»Ich habe gesagt, dass du es leicht machst, dich zu hassen, Viridiana, nicht dass ich es auch tue. Ein Mensch muss ein gewisses Format haben, damit man ihn hassen kann. Doch du? Du bist gerade mal der schlammige Satz am Boden des Fasses meiner Verachtung. Und selbst das hast du dir nur deshalb verdient, weil sich ein paar Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, durch dein hübsches Gesicht dazu haben verleiten lassen, dich ernst zu nehmen. Sie werden ihren Fehler früh genug bemerken, und man wird dich einfach wegwerfen, wie jedes andere kaputte Werkzeug in ihren erbarmungslosen Händen. Du würdest mir ja leidtun, würde deine anmaßende Arroganz nicht dafür sorgen, dass ich nur Verachtung für dich übrighabe. Du bist auf einen Stiefel geschmierter Mist: ein widerlicher Geruch, lästig, aber vergessen, sobald man den Dreck weggewischt hat.« Sie wandte sich von Vi ab, als hätte sie sie bereits vergessen. »Schwester Ariel, Eure Uneinsichtigkeit ist mir nicht entgangen.«
Schwester Ariel musterte Schwester Ayayah über ihre Lesebrille hinweg. Sie deutete auf das überquellende Arsenal an aufgeschlagenen Büchern vor sich. »Sieht es so aus, als wäre ich damit beschäftigt, mich mit dem Mädchen zu unterhalten, oder nicht eher so, als sei ich einfach beschäftigt? Möchtet Ihr vielleicht gerne die Ergebnisse meiner Forschungen der letzten zwei Tage für denjenigen überprüfen, in dessen Diensten Ihr steht? Hm? Meint Ihr etwa, ich wüsste nicht, dass Ihr Eure eigenen Schwestern ausspioniert? Meint Ihr, ich wüsste nicht, wem Ihr Bericht erstattet? Dass es mich nicht kümmert, heißt nicht, dass ich es nicht bemerke, Schwester. Und was ich da bemerke, könnte an diejenigen weitergeleitet werden, die es kümmert. Und das wird es auch, solltet Ihr meine Arbeit weiter behindern. Das hier ist eine Bibliothek, ein Ort der Stille und, falls Ihr es vergessen haben solltet, des Studiums. Unsere kleine Schwester hier hat es ohne Schwierigkeiten geschafft, sich an diese Traditionen zu halten und voller Fleiß und in Ehren zu arbeiten. Ihr könntet von ihr noch etwas lernen.« Damit wandte sich Schwester Ariel wieder ihren Büchern zu.
Schwester Ayayah starrte sie mit offenem Mund an. Ihre Augen funkelten wütend, und ihr Mund arbeitete sich durch ein Dutzend Gesichtsausdrücke, bis er sich schließlich zu einem verkniffenen Strich zusammenzog. Sie schnaubte verächtlich und stach drohend mit dem Zeigefinger in Vis Richtung. Dann verließ sie den Raum. Schweigend.
Zwei Minuten später hob Schwester Ariel ihre Schreibfeder. »Seltsames Mädchen«, sagte sie. »Stets von meinem Intellekt eingeschüchtert, seit sie mich damals im Unterricht herausgefordert hat, als es um diesen obskuren kleinen Zauber ging, den die Schäfer von Ogogia angeblich eingesetzt haben, um die Wolle vor dem Scheren zu behandeln. Ich hatte mathematisch nachgewiesen, dass es in der Tat dreiundsiebzig mögliche Variationen der Beschwörungsformeln gibt, die man dazu aufsagen muss. Sie hat mich aufgefordert zu zeigen, wie das im praktischen Gebrauch vonstattengehen soll, also habe ich es ihr gezeigt.«
»Ihr habt es ihr gezeigt? Ihr habt also … dreiundsiebzig Variationen von … Wollmagie auswendig gelernt?«
»Mach dich nicht lächerlich. Ich bin keine magische Schöpferin und habe nicht das geringste Interesse an Tuchwaren. Außerdem verabscheue ich Wolle. Ich habe herausgefunden, worin diese Variationen bestehen. Aber das ist nicht der springende Punkt.«
Viridiana neigte den Kopf zur Seite. Diese Frau hatte dreiundsiebzig jeweils einzigartige Varianten des Aufsagens einer Beschwörungsformel herausgefunden – einfach so aus dem Stegreif?
»Ayayah – sie war damals natürlich noch keine Schwester – hat auf stur geschaltet, weil sie glaubte, ihr Gesicht verloren zu haben. Von Zeit zu Zeit bekommen wir es alle mit arroganten Schülerinnen und Schülern zu tun, die nicht merken, wie dumm es sie aussehen lässt, wenn sie die Gelehrsamkeit als einen Wettbewerb mit zwei Seiten, mit Gewinnern und Verlierern betrachten. Wenn ich Hypothesen aufstelle, die spätere Gelehrte dazu anregen, vertiefter zu forschen, und sie dadurch auf eine Erkenntnis stoßen, die ich übersehen habe, habe ich einen unersetzlichen Beitrag zur Enthüllung dieser Wahrheit geleistet. Ich habe das gesamte menschliche Wissen vorangebracht. Ich bin von wesentlicher Bedeutung gewesen. Schüler, wie sie es war, und die Sorte von Gelehrten, zu denen sie später allzu oft werden, wollen nur die Entdecker der Wahrheit sein, deren Namen unvergessen bleiben. Das verleitet sie dazu, Wissen zu verfälschen und sogar denjenigen Steine in den Weg zu legen, die auf ihrer Arbeit aufbauen wollen. Sie werden zu Dämmen im Strom des Wissens, ängstlich und eifersüchtig auf ihren Ruhm bedacht, in der Überzeugung, dass sie sich nur dann ein wachsendes Vermächtnis sichern können, wenn sie die Wissensfortschritte anderer verhindern. Das ist nichts als dumme, arrogante Torheit und eine Sünde wider das Wissen. Ayayah räumte damals ein, dass es zwar durchaus dreiundsiebzig verschiedene Aufsagemöglichkeiten geben könne, was sie aber doch offensichtlich gemeint habe, sei gewesen, dass diese nicht zu dreiundsiebzig unterschiedlichen Ergebnissen in der Ausführung der Beschwörungsformel führen könnten. Mit jenem triumphierenden Grinsen, das ihr eigen ist, meinte sie, sie wette, dass ich in zwei Wochen mit irgendeinem obskuren Text zurückkommen würde, in dem behauptet werde, dass sämtliche möglichen Tuchwaren, die alle eindeutig gleich sind, doch irgendwie anders seien – dass wir aber alle die Wahrheit kennen würden. So hatte sie also mit nur ein paar wenigen Sätzen die Regeln ihres Spiels geändert und mir auch noch unterstellt, dass ich wahrscheinlich versuchen würde, den Streit durch Berufung auf eine Autorität zu gewinnen. Das hat mich sehr aufgebracht. Erstens war da die unterschwellige Anschuldigung, dass ich zu gewinnen versuchte – dass ich Wissen, so wie sie, als eine Art Wettkampfspiel betrachtete. Zweitens muss ich zugeben, dass ihr Lächeln bei ihren Worten, ihre selbstsichere Arroganz, mich verärgerte. Drittens unterstellte sie mir, so unehrlich zu sein, dass ich mich ihr gegenüber einer Täuschung bedienen würde, während sie im gleichen Atemzug selbst auf eine zurückgriff. Also habe ich mich auf ihre Wette eingelassen. Meine Schwester Istariel meinte, das sei voreilig von mir gewesen, aber ich hatte aufrichtig gehofft, nicht nur die ganze Klasse zu retten, indem ich ihnen ein wenig Demut beibrachte, sondern auch Ayayah selbst – die inzwischen freilich bewiesen hat, dass sie all die Schwächen hat, für die wir Schwestern anfällig sind. Dass in ihr all das stolz wuchernde Unkraut gedeiht, dessen Wurzeln im Boden der Begabung wachsen.«
Mit einem Achselzucken und einem kurzen Blick auf ihre tintenverschmierten Finger nahm sie ihre Schreibfeder wieder auf und kehrte zu ihrer Arbeit zurück.
Viridiana starrte sie entgeistert an. »Ihr könnt die Geschichte doch nicht einfach an dieser Stelle abbrechen. Was habt Ihr unternommen?«
»Oh! Ach ja, ich hatte vergessen, dass … Nun, ich habe so ein paar Vermutungen angestellt und dann dreiundsiebzig Varianten ausgeführt. Dreizehn davon waren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die Varianten, die die Schäfer von Ogogia verwendet haben, weil Wolle und menschliches Haar nun mal unterschiedlich sind, klar, aber die Tatsache, dass es nennenswerte – wenn auch nicht unbedingt brauchbare – Unterschiede zwischen den dreiundsiebzig verschiedenen Proben gab, reichte der Klasse aus, um anzuerkennen, dass ich recht gehabt hatte. Ayayah war so wütend, und die Sache war ihr so peinlich, dass sie sich das Haar komplett abrasierte, statt es eine Woche lang so zu tragen, wie es eigentlich durch unsere Wette vorgesehen war.«
»Moment, Moment«, ging Vi dazwischen. »Ihr habt die Beschwörungsformeln auf ihr Haar angewandt?«
»Ach, habe ich das ausgelassen? Ja. Sie hatte so einen wunderschönen Haarschopf, den sie immer sorgfältig ausgekämmt hat. Sie war sehr stolz auf ihr Haar, und das auch zu Recht. Unsere Wette sah vor, dass sie, sollte sie verlieren, eine Woche lang ihr Haar mit all den Variationen darin tragen müsse, und sollte ich verlieren, könnte sie stattdessen mit meinem Haar tun, was immer sie wollte. Sie wollte keinen Rückzieher machen. Sie ist viel zu stolz für so etwas. Seither hat sie sich die Haare nie wieder länger wachsen lassen. Weißt du, mir fällt gerade ein, dass sie nie zu mir gekommen ist, damit ich die Magie rückgängig mache, die ich bei ihr angewendet habe. Sie hat sich das Haar ja sofort rasiert, statt es so zu tragen. Einige dieser Varianten könnten ihre Haarfollikel über Monate, wenn nicht gar auf Jahre hinweg beeinträchtigt haben. Vielleicht sogar … nein, sicherlich nicht bis zum heutigen Tag.«
»Und da wundert Ihr Euch noch, warum sie Euch hasst«, murmelte Vi.
»O nein, das wundert mich überhaupt nicht«, erwiderte Schwester Ariel. »Wir Schwestern sind alle jede für sich etwas Besonderes. Wenn du ganz und gar verinnerlicht hast, dass du eine von tausend bist und dir das wichtiger ist als alles andere, dann ist es für dich nicht das Schlimmste, eine Frau mit einer Begabung zu treffen, die sie zu einer von einer Million macht – diese Leute sind für alle so etwas wie Göttinnen. Das Schlimmste ist es vielmehr, denjenigen Frauen zu begegnen, die eine von zehntausend sind. Jenen Menschen, die einem selbst so ähnlich sind, dass man das Gefühl hat, dass ihre Gegenwart einen in der Hierarchie weiter nach unten befördert.«
»Und Ihr glaubt, eine von zehntausend zu sein.«
»Ja«, sagte Schwester Ariel mit einer verblüfften Aufrichtigkeit im Tonfall, als wäre das doch völlig offensichtlich, sodass die Frage in Wirklichkeit irgendetwas anderes bezwecken musste.
»Ich finde, Ihr seid womöglich allzu bescheiden«, bemerkte Vi mit einem Kichern.
»Nein, bin ich nicht. Ich bin ziemlich intelligent und überdurchschnittlich begabt, aber ich bin kein Talent, wie es in einer Generation nur einmal vorkommt. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass das, was mich in dieser Schwesternschaft außergewöhnlich macht, im Wesentlichen gar nicht meine Intelligenz ist, sondern die Tatsache, dass ich meine Grenzen ohne Ranküne anzuerkennen vermag.«
Vi wusste nicht, was Ranküne war. Bei Schwester Ariel musste sie ständig raten, was alle möglichen Wörter bedeuteten. »Tja, wenn Ihr das sagt. Ich weiß es nicht. Ihr seid mir so meilenweit voraus, dass ich den Unterschied nicht wahrnehmen kann.«
Schwester Ariel legte ihre Schreibfeder hin. »Nein, Viridiana. Lass das bitte. Ich bin klüger, als du es je sein wirst. Das stimmt. Aber ich glaube, du bist intelligenter, als du glaubst. Du glaubst die Lügen immer noch, die dir dein Meister über dich erzählt hat, nicht wahr?«
»Nein!«, sagte Vi verächtlich. »Welche Lügen?«, fragte sie, und unerwartet schnürte sich ihr die Kehle zu. Aber schon, als ihr der Protestruf reflexartig entfuhr, ahnte sie, wovon Schwester Ariel da sprach. Sie konnte das Hohnlächeln auf Hus Gesicht sehen, wenn er sie eine dumme Fotze nannte, nachdem sie es zum fünften Mal vermasselt hatte, eine Falle zu stellen, und ihre Finger unter seinem Blick zitterten. Was konnte ich von einer derart dämlichen Göre wie dir schon erwarten? Nur Titten, kein Hirn. Geh ins Schlafzimmer und warte dort auf mich. Ich mach das hier fertig, und dann kannst du das Einzige tun, wofür du gut bist.
Schwester Ariel seufzte. »Meinst du, ich hätte dieses Gespräch nicht auch schon mit anderen geführt? Glaubst du, du bist die erste Frau, die sich hier eingeschüchtert fühlt, ja sich dumm vorkommt? Ich weiß es besser, als zu versuchen, Frauen ihre krankhaften Einbildungen auszureden. Du bist klüger als der Durchschnitt. Leider schaffen es Frauen, die zwar magisch begabt, aber nicht klug sind, auch nicht in die Chantry. Unsere Arbeit verlangt allzu viel Abstraktion. Nur Schwestern, die überdurchschnittlich schlau sind, kommen weiter, also gibt es nur sehr wenige ausgelernte Schwestern, die nicht intelligent sind. Was bedeutet, dass die durchschnittliche Chantry-Schwester da draußen in der übrigen Welt eine ziemlich intelligente Frau ist. Wer hier einfach nur schlau ist, muss sich die meiste Zeit dümmer vorkommen als die Frauen um einen herum, und das durchaus zu Recht. Worauf es ankommt, ist jedoch: Für dich ist das alles völlig nebensächlich. Für dich, Viridiana, zählt allein, dass du hinreichend intelligent bist, um fast alles tun zu können, was du tun willst. Für manches wirst du länger brauchen als andere. Keine Frage. Aber was du da besitzt, Viridiana, ist pure Kraft. Um einen Vergleich zu bemühen: Mit demselben Problem konfrontiert, lösen wir beide es auf unterschiedliche Weise. Sagen wir … nein, zu kompliziert.« Ihre Augen blickten kurz nach oben und zur Seite. »Angenommen, wir haben einen großen Stein vor uns und müssen ihn auf einen Wagen heben. Du hebst ihn mit deiner magischen Kraft einfach auf und legst ihn auf den Wagen. Und ich? Ich würde eine Rampe oder einen Flaschenzug oder etwas Ähnliches austüfteln. Und so lösen wir beide das Problem.«
»Aber ein Flaschenzug könnte das Problem tausendmal lösen. Mir würde die Kraft ausgehen.«
»Genau. Der Nachteil meiner Herangehensweise wiederum besteht darin, dass ich für den Flaschenzug oder die Rampe Materialien benötige, ich brauche also mehr Zeit und Zubehör, doch es kann die gleiche Arbeit erledigt werden. Aber jetzt stell dir mal vor, wir befinden uns mitten in einer Schlacht, und alles, was zur Verfügung steht, ist dieser eine Stein. Ich weiß, wie ich ein Katapult bauen kann, das diesen Stein Hunderte Meter weit schleudert, doch wenn das Problem darin besteht, dass mich ein feindlicher Reiter gerade niederreiten will, bin ich verloren. Eine starke Frau wie du wird den Stein einfach aufheben und selbst werfen. Ihre herausragenden Fähigkeiten passen zu dieser Situation. Steck sie in eine Bibliothek, um Texte zu übersetzen, und sie wird Jahre dafür brauchen. Wenn die Übersetzungen fristgebunden sind, ist sie verloren. Jeder von uns ist auf seine eigene Weise besonders und keiner von uns ist in jeglicher Hinsicht besonders. In der großen weiten Welt versteht das jeder und erkennt es so an, mit Ausnahme der Intellektuellen, wenn es um den Intellekt geht.«
»Nein, genauso machen es auch Kämpfer, wenn es ums Kämpfen geht. Niemand will hinnehmen, dass – egal, wie schwer er sich auch ins Zeug legt und über wie viele Jahre hinweg – jemand, der weniger hart an seinen Fähigkeiten arbeitet, in den Dingen, die ihm am meisten bedeuten, besser sein könnte als er selbst. Oder dass jemand, der genauso viel dafür tut, am Ende viel, viel besser sein kann als er selbst.«
»Aha, da haben wir es ja. Ein weiterer Grund, warum ich die Chantry liebe«, erwiderte Schwester Ariel. »Ich lege dir eine spezielle Wahrheit vor, und du hilfst mir, stattdessen eine allgemeine Wahrheit darin zu erkennen. Großartig. Gut, wenn diese Erkenntnis auch hilfreich für deine Lektüre ist, ist dir gerade der ideale Moment für akademische Erleuchtungen beschieden.«
Vi starrte auf ihr Buch und verzog die Lippen. Wo war sie gerade überhaupt gewesen? Ach ja, das Gespräch von Kylar mit dem Ka’kari.
Als sie wieder aufblickte, sah Schwester Ariel sie erwartungsvoll an.
»Ähm … ich glaube nein.«
»Ach, macht nichts. Wir würden die Perfektion nicht so sehr schätzen, wenn sie uns häufiger begegnen würde, nehme ich an.«
»Was wissen wir über die Ka’kari?«, fragte Vi.
Die Augenbrauen von Schwester Ariel zuckten in die Höhe. »Springst direkt zu den gefährlichen Fragen, was? Das hat mir schon immer an dir gefallen, Viridiana, auch wenn ich befürchte, dass es dich eines Tages umbringen wird. Wissen tun wir weit weniger, als die meisten Schwestern glauben, denn sie verwechseln das, was wir vermuten, sowie das, was von interessierter Seite an uns herangetragen wurde, mit dem, was wir für wahr halten wollen, und dem, was wir wirklich wissen. Bis zum letzten Kampf auf dem Sturmschiff wusste die Schwesternschaft, dass es sechs Ka’kari gibt, die alle von einem hochintelligenten Magier mit Jahrtausendbegabung namens Ezra, später Ezra der Verrückte, geschaffen wurden, der vor sieben Jahrhunderten ein Vertrauter von Kaiser Jorsin Alkestes war. Heute ›wissen‹ wir, dass Ezras sechs Ka’kari auf einen anderen, älteren zurückgehen. Einen schwarzen, der manchmal als der Verschlinger bezeichnet wird. Für die meisten Schwestern, die über die Ka’kari Bescheid wissen, sind sie deshalb so wichtig, weil wir glauben, dass manche von ihnen oder auch alle ihrem Träger eine Unsterblichkeit niederen Grades verleihen. Du kennst die traditionelle Einteilung der Arten von Unsterblichkeit?«
»Ähm … ja.« Vor ein paar Tagen hätte sie noch nichts darüber gewusst, aber Kylar hatte doch darüber geschrieben, nicht wahr? Auf jener Seite, die er zu streichen versucht hatte. »Da gibt es die völlige Unverwundbarkeit gegenüber der Zeit und dem Schwert, über die womöglich der eine Gott verfügt, wenn es ihn denn gibt. Doch für Menschen gibt es die Unverwundbarkeit gegenüber der Zeit, aber nicht gegenüber dem Schwert, und … nein, ich habe da etwas ausgelassen, oder? Dazwischen gibt es noch die Fremden, stimmt’s?«
Schwester Ariel wirkte beeindruckt, dass Vi überhaupt etwas darüber wusste. »Das Dazwischen ist umstritten. Manche behaupten, dass es mächtige Wesen gibt, die zwischen den Tausend Welten hin und her reisen und nach Belieben in einen sterblichen Körper schlüpfen können, aber wenn dieser sterbliche Körper getötet wird – oder vielleicht auch nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise getötet wird –, werden sie selbst nicht wirklich ebenfalls getötet, sondern für immer aus ihrer körperlichen Inkarnation in dieser Welt verbannt. Klingt, als seien solche Wesen beängstigend mächtig, nicht wahr?«
»Ich, ich … denke schon, ja.«
»Lustigerweise vertreten einige Gelehrte die Ansicht, dass auch der Mensch ein solches Wesen ist – dass wir in unserem Wesen unsterblich sind und dass unser Tod hier kein endgültiger Tod ist, obwohl er uns aus diesem irdischen Reich verbannt. Ich persönlich finde, dass solche Schriften an der Grenze dessen liegen, was sich beweisen oder widerlegen lässt, und daher nicht sonderlich interessant sind. Das ist ein Bereich der Spekulation und der Religion, nicht der Wissenschaft.«
»Aber wir haben diese Fremden am Schwarzen Hügel gesehen.«
»Einige von uns, ja. Oder sie dachten es zumindest. Und ich für meinen Teil will gar nicht behaupten, dass alle, die sie gesehen haben wollen, Lügner sind. Doch auch du selbst hast Täuschungszauber von beträchtlichen Ausmaßen angewandt. Wie viel kann es schon bedeuten, dass ein Dutzend Magier an einem Tag, an dem derart viel Magie in der Luft lag, irgendetwas gesehen haben? Es handelt sich um klare Indizien, das bestreite ich nicht, aber ist es auch ein zwingender Beweis? Vielleicht ja dann, wenn man selbst zu denen gehört, die diese Dinge gesehen haben. Wie auch immer, was Kylars Beispiel der Chantry verlockend in Aussicht stellt, ist die Möglichkeit einer Unsterblichkeit niederer Stufe, bei der der Zahn der Zeit entweder ganz aufgehalten oder der Alterungsprozess zumindest verlangsamt wird. Ein solcher Unsterblicher niederen Grades kann immer noch getötet werden. Wenn es so etwas gibt, funktioniert es entweder durch das Aufhalten der normalen Prozesse, durch die ein Körper erfährt, dass er altert, oder vielleicht auch durch die energische Heilung eines Körpers von den Schäden des an ihm nagenden Zahns der Zeit. Auf beiden Feldern haben die Schwestern jahrhundertelang geforscht und experimentiert, ohne sich die Vorteile der Ka’kari zunutze machen zu können. Auf ihre Erkenntnisse ist es zurückzuführen, dass diejenigen von uns, die sie befolgen, eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben. Aber unsere Heilerinnen und führenden Gelehrten sind der Überzeugung, dass wir nur die niedrig hängenden Früchte der Lebensverlängerung gepflückt haben. Keine Schwester hat unter Rückgriff auf unsere Methoden nachweislich länger als zweihundert Jahre gelebt, und die meisten sind nach hundertfünfzig Jahren so gebrechlich, dass sie auf weitere Behandlungen lieber verzichten. Im Gegensatz dazu scheinen die Ka’kari den Alterungsprozess ganz aufzuhalten oder vielleicht sogar umzukehren.«
»Aber Kylar …«
Schwester Ariel zischte und Vi brach ab. Schwester Ariel sah sich mit vielsagendem Blick im Raum um, ein Blick, der zu besagen schien, dass es, selbst wenn sie sich nahezu sicher war, dass sie nicht belauscht wurden, Dinge gab, die hier drinnen laut auszusprechen einfach zu gefährlich war.
Kylar hatte vermerkt, selbst der Beweis dafür zu sein, dass die Chantry völlig falschliege – denn wenn Kylar starb, kam er wieder vom Tod zurück. Und Schwester Ariel hatte das mit eigenen Augen gesehen, sie hatte gesehen, wie Kylars Leichnam von Magie und Leben durchtränkt worden war, hatte selbst gesehen, dass er nicht mehr atmete, und dann gesehen, wie er sich wieder aufgesetzt und keuchend nach Luft geschnappt hatte.
»Kylar hat nie über solche Dinge gesprochen«, führte Vi ihren Satz zu Ende, als hätte sie genau das sagen wollen.
»Wie sollte er auch? Was genauso für jeden anderen in seinem Alter gilt. Er war in der Blüte seiner Jahre. Wie lange hätte es gedauert, bis er gemerkt hätte, dass er nicht älter wurde? Er war nie zuvor alt gewesen. Er hatte keine Vorstellung davon, wie es ist, mit einem pochenden Knie aufzuwachen, das am Tag zuvor noch nicht wehgetan hat, oder mit Rückenschmerzen, die auch in den nächsten ein, zwei Tagen nicht besser werden. Mir kommt der Gedanke, dass der Grund, warum sich junge Erwachsene unsterblich fühlen, wohl darin zu sehen ist, dass sie es auf eigentümliche Weise in gewisser Hinsicht auch sind. Ihre Körper sind genau das, was wir uns von unsterblichen Körpern erhoffen: immerzu vor Kraft strotzend, stets wieder gesundend, unaufhörlich voller Vitalität. Tja! Wie auch immer, das ist es, was jedermann will. Wahre Göttlichkeit wäre schön. Etwas darunter wäre ewige Jugend toll. An dritter Stelle würde es ausreichen, den Alterungsprozess anhalten zu können. In den letzten Monaten hat sich eine neue übereinstimmende Ansicht durchgesetzt. Die meisten Schwestern glauben nun, dass die Möglichkeit, den Alterungsprozess dauerhaft aufzuhalten, für uns in greifbare Nähe gerückt ist – sobald es uns einmal gelungen ist, einen Ka’kari ausfindig zu machen, ganz egal, welchen. Aber sie sind auch zu der Überzeugung gelangt, dass wir ewige Jugend finden könnten, sollten wir den schwarzen Ka’kari in unsere Hände bekommen – was für jemanden, der hundertdreißig Jahre alt ist, jahrzehntelang unter chronischen Schmerzen gelitten hat und nun die ersten Anzeichen von Demenz erkennen lässt, ein weitaus verlockenderer Gewinn ist. Oder, sagen wir, für jemanden, der erst sechzig ist, in dessen Gedärm jedoch Tumore wachsen. Eine solche Beute würde das Leben jeder einzelnen Schwester und die gesamte Chantry für immer verändern. Und damit auch die ganze Welt.«
Vi wurde klar, dass sie Kylars Kräfte nicht ein einziges Mal als etwas betrachtet hatte, das sie ihm stehlen wollte. Die Erkenntnis, dass das bei Weitem nicht die Reaktion aller anderen sein dürfte, brandete über sie hinweg wie eine tosende Welle. Für die anderen war Kylar nicht jener junge Mann, den Vi in Cenaria kennengelernt hatte – ob er den Ka’kari damals überhaupt schon getragen hatte? Für die anderen war Kylar eine bedrohliche Figur, die die Sprecherin gedemütigt hatte, ein Mann, der nur zufällig auf derselben Seite wie sie gegen Khalidor gekämpft hatte, jemand, der der Schwesternschaft unendliches Kopfzerbrechen bereitet hatte und der ihnen nun das Mittel zur ewigen Jugend vorenthielt. Kylar war nicht nur ein Hindernis, das zwischen den Schwestern und demjenigen stand, was ausnahmslos jede einzelne Schwester besitzen wollte; indem er den Schwestern seine Geheimnisse nicht anvertraute, verurteilte er sie darüber hinaus auch alle zum Tode. Es war eine Kränkung, eine Beleidigung. Unerträglich. Er brachte sie alle regelrecht um mit seiner – wie hatte Schwester Ayayah es noch gleich genannt? Mit seiner Uneinsichtigkeit.
Die Sonderkommandos waren weit weg von der Chantry gewesen, als sich die neue übereinstimmende Ansicht durchgesetzt hatte. Andernfalls hätten sie mit Sicherheit ihre ganze Energie darauf verwendet, Kylar gefangen zu setzen.
Aber das warf auch ein neues Licht auf den Druck, den sie auf Vi ausübten.
»Wenn ich also herausfinden kann, wo sich Kylars sterbliche Überreste befinden, und damit auch, wo der Ka’kari ist …«
»Dann veränderst du alles. Ausnahmslos alles.«
Vi holte tief Luft. »Schwester? Wenn ich Euch etwas sage, werdet Ihr mich dann verraten?«
»Kommt ganz drauf an«, antwortete Schwester Ariel.
Vi zog das Kinn ein.
»Meine oberste Treuepflicht gilt nicht dir«, fuhr Schwester Ariel fort, »und daran wird sich auch nichts ändern, nur weil du es von mir verlangst. Wenn du aber etwas einforderst, bei dem ich keinen Verrat an meinen höheren Treuepflichten begehen muss, werde ich dich niemals verraten, egal was es mich kostet.«
Vi holte tief Luft und setzte zu einer Erwiderung an.
»Nein, lass es«, ging Schwester Ariel dazwischen. »Lass dir eins von mir gesagt sein: Wenn du irgendetwas über Kylar oder den Verbleib des Ka’kari herausfindest, dann verrate es mir nicht. Verrate es niemandem. Du darfst dieses Wissen nicht unter Wert verkaufen, verstehst du das? Solche Informationen sind von nahezu unermesslichem Wert – und ich fürchte, du wirst alles brauchen, was du dafür bekommen kannst.«
Kapitel 5
Das Gegenteil von hilfreich
Neun Soldaten. Drei davon den Blick gen Backbord gerichtet, drei mit Blick gen Steuerbord und drei mit Blick nach achtern. Normale Soldaten, kein Magier unter ihnen, zumindest soweit ich es erkennen kann. Für gewöhnlich wäre das also kein Problem. Schließlich muss ich sie nicht umbringen. Ich muss nur an ihnen vorbeikommen.
Aber wir befinden uns hier nicht mehr auf den weiten Korridoren von Burg Sturmfest. Die Flure hier sind so eng, dass ein Mensch mit ausgebreiteten Armen beide Wände mit den Fingern berühren kann. Drei Männer, die Schulter an Schulter stehen, verstopfen den Gang komplett.
Was auch noch dumm von ihnen ist. Sie sind mit Speeren bewaffnet, die länger sind als sie selbst. Drei Mann dicht nebeneinander, die versuchen, auf derart beengtem Raum mit Stangenwaffen zu kämpfen? Offenbar haben sie hier die Schlechtesten der Schlechtesten auf mich angesetzt.
Nun gut, es sind Soldaten, keine Schiffswachen, also die Schlechtesten der Zweitschlechtesten. Aber trotzdem war dieses Verhalten schon außerordentlich schlecht durchdacht.
An sich sind es nicht unbedingt die schlechtesten Männer, doch es sind Männer, die von den schlechtesten Offizieren geführt werden. Manchmal wimmelt es in den unteren Rängen einer Armee von bemerkenswert fähigen Kämpfern, die niemals im Rang aufsteigen, weil sie angesichts der Dummheit ihrer Offiziere einfach nicht den Mund halten können, und welcher Offizier auch immer für das hier verantwortlich ist, muss ein wahres Paradebeispiel für einen …
Genau. Da sitzt er auf einem Stuhl, einen runden Schild auf dem Schoß, der ihm als Servierbrett dient, ein Krug und ein Teller mit Essen darauf, während er mit vollem Mund sagt: »Ihr esst, sobald eure Schicht vorüber ist, ihr faulen …« Er fährt fort, sie halbherzig zu verfluchen, während sie in eisigem Schweigen geradeaus starren, an dergleichen gewöhnt.
Ich ziehe meinen Kopf von der Kreuzung zweier Gänge zurück, wo ich mich befinde. Nun gilt es, Nutzen und Risiko gegeneinander abzuwägen. Soll ich an der Decke über die Soldaten hinwegklettern? Da ist kaum Platz, und wenn sie mich bemerken, bin ich so nah an den Spitzen ihrer Speere, dass sie mich durchbohrt haben, bevor ich reagieren kann. Sie alle zu töten bedeutet, nun ja, neun Unschuldige zu töten. Möglicherweise. Es bedeutet auch, denen, die hier das Sagen haben, die Botschaft zu senden, dass ihr unbekannter blinder Passagier jemand ist, der neun Soldaten zu töten in der Lage ist.
König Repha’im würde sofort wissen, dass das nur ich sein kann. Im Moment gibt es da schließlich bloß eine ominöse Geschichte über irgendeinen halb nackten Mann, der sich an ein paar Zivilisten und ein paar der rangniedrigsten Wachen vorbeischleicht. Bis die den König erreicht, dürfte es noch ein Weilchen dauern, wenn sie ihm denn überhaupt je zu Ohren kommt.