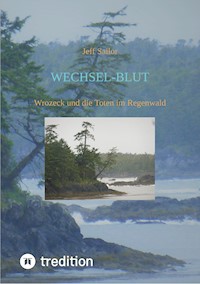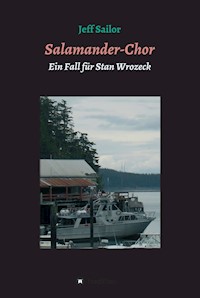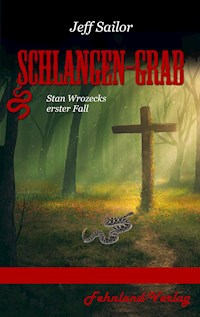13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KUUUK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hier trifft Grit auf Jack, aber immer schreibt offenbar im Hintergrund das Ahnenreich eines Herrn John Steinbeck mit. Es ist eine wundersame Verstrickung, in die wir geraten. Bücher, die wir vielleicht kennen, sind jetzt neu verwoben. und aus allem wird eine Art Fortsetzung dessen, was wir nach „Die Straße der Ölsardinen“ (Cannery Row) und „Wonniger Donnerstag“ (Sweet Thursday) immer auch noch über das stets brausende Kalifornien zu lesen hofften. Aber zuvor geht es an den wilden Columbia River nach Oregon. Spannend wie ein Krimi, abgefahren wie ein surreales Drama und doch eine Art Roman. In dieses Buch lässt sich eintauchen, als sei es ein Unterwassermuseum. Zugleich muss man sich auf das Vergnügen einer John-Steinbeck-Nachwelt einlassen. Was also wird aus den Helden und Schelmen, die wir irgendwie ja kennen? Und doch dann wieder nicht! Hier kehrt sich oben nach unten. Und die Klippen machen uns viel Angst. Jeff Sailor wurde am 31.8.1956 in Salinas, Kalifornien, als Sohn eines USamerikanischen Ozeanologen und einer deutschen Chemikerin geboren. Nach der Trennung seiner Eltern zog er bereits als Fünfjähriger mit seiner Mutter nach Deutschland und lebte mit ihr in Düsseldorf. Er studierte Germanistik an der Universität zu Köln, brach das Studium nach einigen Jahren aber ohne Abschluss ab und kehrte zurück in den Westen der USA zur Familie seines Vaters. Dort nahm er im Folgenden etliche Gelegenheitsjobs an. So betätigte ersich als Erntehelfer im Steinbeck Country, als Werftarbeiter in Monterey sowie als Zeitungsredakteur in Astoria, Oregon. Als freier Schriftsteller verfasste er unter anderem die Romane „Starksturm“, „Löwenjahre“ und „FernEndlichkeit“. Außerdem schrieb er die Kurzgeschichtensammlung der „Tossing Tales“, viele weitere Storys, Essays, Theaterstücke sowie Lyrik.Er schreibt in deutscher Sprache und übersetzt hin und wieder eines seiner Werke ins Englische. Häufig publiziert er unter Pseudonym. Nach fünf gescheiterten Ehen, unter anderem mit einer der Protagonistinnen dieses Romans, lebt er inzwischen zurückgezogen und pfeiferauchend in seiner vom Vater ererbten Villa in Carmel bei Monterey. Sein apricotfarbener Pudel heißt Carli IV.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
INFO | TITEL | Sailor | JvJ
Jeff Sailor
Jenseits von Jenen
Hommage an J.S.
Roman
INHALT
Hier trifft Grit auf Jack, aber immer schreibt offenbar im Hintergrund das Ahnenreich eines Herrn John Steinbeck mit. Es ist eine wundersame Verstrickung, in die wir geraten. Bücher, die wir vielleicht kennen, sind jetzt neu verwoben ... und aus allem wird eine Art Fortsetzung dessen, was wir nach „Die Straße der Ölsardinen“ (Cannery Row) und „Wonniger Donnerstag“ (Sweet Thursday) immer auch noch über das stets brausende Kalifornien zu lesen hofften. Aber zuvor geht es an den wilden Columbia River nach Oregon. Spannend wie ein Krimi, abgefahren wie ein surreales Drama und doch eine Art Roman.
In dieses Buch lässt sich eintauchen, als sei es ein Unterwassermuseum. Zugleich muss man sich auf das Vergnügen einer John-Steinbeck-Nachwelt einlassen. Was also wird aus den Helden und Schelmen, die wir irgendwie ja kennen? Und doch dann wieder nicht! Hier kehrt sich oben nach unten. Und die Klippen machen uns viel Angst.
AUTOR
Jeff Sailor wurde am 31.8.1956 in Salinas, Kalifornien, als Sohn eines US-amerikanischen Ozeanologen und einer deutschen Chemikerin geboren.
Nach der Trennung seiner Eltern zog er bereits als Fünfjähriger mit seiner Mutter nach Deutschland und lebte mit ihr in Düsseldorf. Er studierte Germanistik an der Universität zu Köln, brach das Studium nach einigen Jahren aber ohne Abschluss ab und kehrte zurück in den Westen der USA zur Familie seines Vaters. Dort nahm er im Folgenden etliche Gelegenheitsjobs an. So betätigte er sich als Erntehelfer im Steinbeck Country, als Werftarbeiter in Monterey sowie als Zeitungsredakteur in Astoria, Oregon.
Als freier Schriftsteller verfasste er unter anderem die Romane „Starksturm“, „Löwenjahre“ und „Fern-Endlichkeit“. Außerdem schrieb er die Kurzgeschichtensammlung der „sailor Tales“, viele weitere Storys, Essays, Theaterstücke sowie Lyrik.
Er schreibt in deutscher Sprache und übersetzt hin und wieder eines seiner Werke ins Englische. Häufig publiziert er unter Pseudonym.
IMPRESSUM
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek erfasst diesen Buchtitel in der Deutschen Nationalbibliografie. Die bibliografischen Daten können im Internet unter http://dnb.dnb.de abgerufen werden.
Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen und Medien – auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere neuartige Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
HINWEIS: Deutsch ist überaus vielschichtig und komplex. Der Verlag versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alle Bücher zu lektorieren und zu korrigieren. Oft gibt es allerdings mehrere erlaubte Schreibweisen parallel. Da will entschieden werden. Zudem ergeben sich immer wieder Zweifelsfälle, wozu es oft auch keine eindeutigen Antworten gibt. Schlussendlich haben auch die Autorinnen und Autoren ureigene Sprachpräferenzen, die sich dann bis in die Kommasetzung, Wortwahl und manche Schreibung wiederfinden lassen können. Bitte behalten Sie das beim Lesen in Erinnerung. Aus Gründen der Sprachökonomie folgen die älteren Tagebuchnotizen der neuen Rechtschreibung seit 2006.
Cover: Das hier verwendete Acrylbild „An der Oregon-Küste“ stammt von © Gudrun Tossing, die beiden Landkarten im Innenteil sind Federzeichnungen von Jeff Sailor. Coverentwurf © Gudrun Tossing & Klaus Jans, Lektorat: KUUUK
E-BOOK ISBN 978-3-939832-64-5
Erste Auflage E-BOOK Dezember 2013
KUUUK Verlag und Medien Klaus Jans
Königswinter bei Bonn
K|U|U|U|K – Der Verlag mit 3 U
www.kuuuk.com
Alle Rechte [Copyright] © KUUUK Verlag – [email protected] und © Jeff Sailor
...
„Wer sind Sie?“, fragte Grit streng.
„Ich bin Lulla“, sagte das Mädchen.
„Sei nicht so unfreundlich zu ihr“, sagte Rick.
„Ich bin so freundlich, wie der Tag lang ist“,
antwortete Grit.
- Lulla war blond.
- Sie war jung.
- Sie war schön.
Da beschloss Grit, Lulla nicht zu mögen.
Aus dem Kapitel
„Wie die Unruhe in ihr Haus zog“
Steinbeck Country *
„Die Expedition fuhr nicht schnurstracks durch Monterey, sondern vielmehr aus zarter Rücksicht auf ihre Nummernschilder durch Seitenstraßen. ... Im Carmeltalweg ging es dann wieder; da war kein Mensch und keine Gefahr.“ (John Steinbeck in „Die Straße der Ölsardinen“)
* Karte nicht maßstabsgerecht
Sailor Country *
„In Gedanken malte ich mir eine Landkarte davon aus, damals auf meiner hohen Klippe über Astoria.“ (Jeff Sailor im Prolog zu „Jenseits von Jenen“)
* Karte nicht maßstabsgerecht
INHALTSVERZEICHNIS VORBEMERKUNG
Im Folgenden zitiere ich, wie Mack, einer der beiden Hauptprotagonisten aus John Steinbecks Roman „Cannery Row“, sich die Aufzählung von einzelnen Buchkapiteln wünscht. In einer Diskussion mit seinen Freunden Whitey No.1 und Eddie übt er strenge Kritik am Schriftsteller der Ölsardinen. Wenn dieser Steinbeck doch nur mal seinen Weg kreuzen täte, ja dann ... dann würde Mack ihm schon was ganz anderes erzählen.
Mack: „Also, da heißt es: Kapitel eins, Kapitel zwei, Kapitel drei. So weit, so gut; aber ich hätte gern noch ein paar Worte oben drüber, in denen mir gesagt wird, wovon das Kapitel handelt. Vielleicht will ich wieder mal zurückgehen, und wenn ich dann lese ,Kapitel fünf‘, dann besagt mir das gar nichts. Wenn dagegen bloß so ein paar Worte drüberstünden, dann wüsste ich, das ist das Kapitel, das ich wieder vornehmen will.“
Whitey No 1: „Ei verflucht, Mack kann jederzeit alles sagen. Mack könnte einem Gespenst sagen, wie es zu spuken hat.“
Mack: „Da hast du verdammt recht, dass ich das könnte, ... und da gäb’s kein Tischklopfen und Kettenrasseln. Diese Spukerei hat seit Jahren keine Fortschritte gemacht. Hast verdammt recht, dass ich das könnte! ... Ich seh’ sie schon vor mir.“
Eddie: „Die Gespenster?“ ...
Mack: „Zum Donnerwetter, nein ... die Kapitel ...“ 1
1
INHALTSVERZEICHNIS
Aufzählung der einzelnen
Teile & Kapitel des Romans
„Jenseits von Jenen“
Prolog: Wie es einst begann
Teil 1: Die Farm der beiden Schelme
Zwei schweifen in die Ferne
Die Obstfarm im Columbia-Tal
Grits großer Coup
Ankunft in Hood River
Wie in Maryhill eine Idee geboren ward
Und wie man noch auf eine weitere Idee kam
Shanghaied in Astoria
Nicht mehr allein auf weiter Flur
Was man dem Strom entriss
Mit Carli nach Sonoma
Was sich in der Zwischenzeit begab (I)
Jene Jungs
Ein Philosoph, der alles kann
Teil 2: Jenseits von Jenen
Warum Rick nicht so ist wie „Jene“
Famose Fortschritte?
Von Katzen und Menschen
Ein ernstes Wort mit Jack
Die schwarze Mourna
Auf nach Okanagan
Was sich in der Zwischenzeit begab (II)
Erinnerung an Chinatown
Die zerbrochene Jade
Die Tafelrunde des edlen Königs Artus
Ginevras Vision oder: Eine von „Jenen“
Wie die Unruhe in ihr Haus zog
Teil 3: Verwicklungen, Verstrickungen
Lullas Secret Garden
Begegnung am Fluss
Zwischen Hund und Wolf
Streitgespräch und Neubeginn
Wie Grit ein falsches Spiel treibt
Im Palace-Hotel
Wonniger September
„Als wir von Liebe sprachen“
Bergzweisamkeit?
So ein Skandal!
Ein Mädchen verschwindet
Das rätselhafte Cape
Jeder gegen Jeden
Teil 4: Also sprach Mount Hood
Unter Mordverdacht
Entzieht Jack sich der Entscheidung?
Hoher Besuch droht
Dem Chaos seinen Lauf
Doc & Dynamit
Wie sich die Pforten der Hölle auftun
Also sprach Mount Hood
Evakuierung
Das Ende eines Abenteuers?
Tiefe Nachdenklichkeit
Eine unzuverlässige Zeugin
Der Lügenkapitän
Teil 5: Dezemberreise
Unter der Asche wuchsen die Träume
Die Wahrheit tritt ans Licht
Wiedersehen in Mendocino
Rückkehr nach Monterey
Doc’s Western Lab
Die Geschichte von Mack, Ed und Rose
Aus fernen Tagen
Der Abschied
Was sich in der Zwischenzeit begab (III)
Auf letzter Fahrt
Das Kap der Ewigkeit
Die Zukunft scheint Vergangenheit
Epilog: Wie es jedoch wirklich ward
Prolog: Wie es einst begann
Damals in Astoria, einer Hafenstadt im US-Bundesstaat Oregon, lernte ich Doc und Rick kennen, die ich mir dann auch bald als zwei Hauptfiguren dieses Romans auserkor. Jack und Teddy, meine beiden anderen wichtigsten Protagonisten, kannte ich schon vorher, aus unseren gemeinsamen Tagen in Monterey, Kalifornien.
Es ging mir finanziell nicht so gut, damals an der Westküste. Ich hatte gerade meinen Job als Zeitungsjournalist beim Astoria Sundown verloren. Das Blatt war total den Bach heruntergegangen, und die letzten Wochen hatten sie mich in ihrer Not gar als Chefredakteur eingesetzt. War ja sonst keiner mehr da ... Und dann kam das endgültige Aus.
Da hing ich dann jeden Abend mit einer Clique von Trinkern ab – oft im Golden Anchor, einer Taverne am Kai, die gleichzeitig auch die Nachrichtenbörse des Städtchens war. Vielleicht konnte ich ja eine gute Story aufschnappen und woanders zu Geld machen.
So redete ich mir meine dortigen Saufgelage schön, als seien sie nur aus journalistischem Ehrgeiz begründet gewesen. Na ja, später habe ich mir auf diese oder ähnliche Art immer wieder Barbesuche schöngeredet. Schließlich war ich ständig auf der Suche nach guten Geschichten – und vorzugsweise recherchierte ich an Lokalitäten, wo alkoholische Erfrischungen gereicht wurden.
Mein großes Vorbild war JS, also John Steinbeck, in meinen Augen der amerikanische Dichterfürst schlechthin. Mein Gott, was hatte der mit „Cannery Row“ doch für einen klasse Roman hingelegt. So wie er wollte ich sein, den Pulitzerpreis bekommen und den Nobelpreis für Literatur noch dazu. Aber ich bekam keine Preise, sondern immer nur Geld, viel Geld, aber erst viel später.
Damals in Astoria, als ich noch keine 30 war, da ging es mir wirtschaftlich grottenschlecht. In all den Wirtschaften, wo ich mich betrank, hatte ich Schulden. Mein Vater, der aus Salinas bei Monterey stammte, war ein recht wohlhabender Wissenschaftler und schickte mir schon mal einen Scheck, wenn ich ihn hartnäckig anbettelte. Der war ein renommierter Ozeanologe, saß in seiner Villa in Carmel wie die Made im Speck und lebte bereits mit seiner dritten Ehefrau zusammen.
Mich, seinen einzigen Spross und Sohn aus erster Ehe, wollte er nicht unbedingt zwischen den Füßen haben. Dann sandte er lieber hin und wieder einen Wechsel, um seine Ruhe zu bekommen, und kümmerte sich ansonsten nicht viel um mich.
Ich war erst seit ein paar Jahren wieder in den USA, aus Deutschland zurück, wo ich bei meiner Mutter aufgewachsen war und ein Germanistikstudium abgebrochen hatte. Mein Gefühl sagte mir, dass ich keine akademischen Lehren oder Ehren bräuchte, sondern vielmehr praktische Lebenserfahrung, um ein guter Schriftsteller zu werden. So war das bei JS doch schließlich auch gewesen. Der verdingte sich sogar als Erntehelfer in der Gegend, die man später nach ihm „Steinbeck Country“ nannte.
Das konnte ich auch, die Sache mit dem Erntehelfen. So pflückte ich denn Trauben im Long Valley und Kürbisse in Half Moon Bay – ganz so wie Jack und sein Bruder Teddy. Die beiden kannte ich bereits von der Cannery Row in Monterey, wo Jack als Schiffszimmermann arbeitete und ich eine Weile als sein Handlanger jobbte.
Schon in Monterey tranken wir zünftig zusammen, Jack und ich, gemeinsam mit anderen Zechbrüdern, die Jack so um sich sammelte. Nur Teddy trank nichts. Der war schwachsinnig und brachte seinen Bruder mal in solche Schwierigkeiten, dass die beiden Hals über Kopf von zuhause abhauen mussten.
„Komm doch mit, Jeff“, lockte Jack vor seinem – recht eiligen – Aufbruch. „Du bist doch schließlich mein Chronist und Hauspoet.“
Da war was dran. Ich schrieb gern die Anekdoten auf, die Jack so in abendlicher und zuweilen auch nächtlicher Runde zum Besten gab. Und meine Güte, der kannte vielleicht Geschichten ... Was ich nicht im Suff vergaß, schrieb ich dann alles am nächsten Vormittag – oder war es eher bereits Nachmittag? – sehr sorgfältig nieder.
Im Erzählen und Sprücheklopfen war Jack der veritable Enkel seines Großvaters Mack, und den hatte der große JS doch immerhin als steten Quell seiner Inspiration angesehen und all seine Abenteuer aufgezeichnet und literarisch virtuos verbrämt.
Jack kam nicht nur im Wesen seinem berühmten Großvater gleich, er sah sogar haargenau so aus wie dieser in jungen Jahren. An den mexikanischen Land- und Gelegenheitsarbeiter Mack, einen bauernschlauen Paisano mit trunkselig-philosophischer Ader, konnten sich alle älteren Leute in Monterey noch gut erinnern und bestätigten, dass der Enkel seinem Abuelo wie aus dem Gesicht geschnitten war.
Wenn JS den Großvater meines Freundes gleich durch zwei seiner Meisterromane unsterblich machte, dann verdiente auch Jack als wohlgeratener Enkel einen gewissen Ruhm, sagte ich mir. Und warum dann nicht durch einen Schriftsteller wie mich? So sagte ich mir auch.
Vielleicht wollte der große JS seinerzeit eine Trilogie über Doc, Mack und die anderen Jungs der Cannery Row schreiben und war vor seinem Tod einfach nicht mehr dazu gekommen, sie zu vollenden.
Diesen dritten Roman musste jetzt ein anderer im Hier und Jetzt verwirklichen, einer, der das Zeug dazu hatte, in die Fußstapfen dieses bedeutenden Autors zu treten. Wer, wenn nicht ich? Ganz sicher hatte ich mit John Steinbeck noch sehr viel mehr gemein als nur die Namensinitialen.
Also folgte ich Jack und Teddy, zunächst in die Umgebung und dann noch über Steinbeck Country hinaus in den nördlichen Nachbarstaat Oregon.
Die Gegend mit Tal und Delta des mächtigen Columbia-Stroms gefiel mir ausnehmend gut und war glücklicherweise noch nicht nach einem berühmten Schriftsteller und Poeten benannt. „Jeff Sailor Country“ schwärmte ich, wenn ich hin und wieder von Astorias steilen Klippen aus die Strommündung zum Pazifik hin und landeinwärts weit ins Valley des Columbia River blickte. In Gedanken malte ich mir eine Landkarte davon aus, damals auf meiner hohen Klippe über Astoria.
Aber da fehlte mir noch etwas an meiner kühnen Vision, das heißt, mir fehlte noch einer. Das war nämlich der Meeresforscher Doc, der zweite Romanheld aus „Die Straße der Ölsardinen“ und aus „Wonniger Donnerstag“. Er repräsentierte Macks Pendant und Counterpart zugleich und war als Protagonist einfach unverzichtbar. Wurde Mack in Monterey von seinen Mitzechern als der größte und wichtigste Mensch auf Erden angesehen, so verehrten sie Doc als ein schon kaum mehr irdisches Wesen.
„Den werde ich auch noch finden, wenn es auch schwer wird. Kommt Zeit, kommt Rat“, träumte ich damals auf meiner hohen Meeresklippe.
Dass ich in Deutschland aufgewachsen war, ließ ich so gar nicht raushängen, in den abendlichen Treffen mit Jack und den Jungs. Ich wollte integriert und von ihnen als „Einer der Ihren“ anerkannt sein, ohne besonders aufzufallen oder ihr spezielles Interesse zu erwecken. Ich erwähnte Europa erst gar nicht, behauptete, ich hätte mit meiner Mutter in Baltimore an der Ostküste gelebt und die USA nie verlassen. Ich wollte auf keinen Fall als Exot gelten. Ich gefiel mir in der Rolle des Beobachters. Ich war der Chronist.
Und dann ... ja dann tauchten diese beiden jungen Deutschen auf, wie aus dem Nichts und quasi sogar Landsleute von mir, was ich ihnen aber gar nicht erzählte. Nun, die beiden überrumpelten mich zunächst ja auch, damals in Astoria. Sie waren ein Studentenehepaar aus Solingen und hießen Grit und Rick. Rick war ein „simpatico“, ein netter, ganz gutaussehender, blonder Typ, der das Leben leicht nahm, es sich auch auf keinen Fall allzu schwer machen wollte. Mit angeborener Lässigkeit ließ er gerne den lieben Gott einen guten Tag sein. Mit Arbeit hatte der wirklich nicht viel am Hut. Das merkte ich schon bald, als er mich auf die Farm seines reichen, amerikanischen Onkels mitnahm. Dort spielte er nämlich ganz gerne den Landlord und übernahm ausschließlich buchhalterische Pflichten, um nicht bei der Farmarbeit mitanpacken zu müssen.
Seine Frau Grit hingegen konnte nie lange stillsitzen. Sie war eine hübsche Brünette mit halblangem, leicht naturgewelltem Haar und intelligenten, graublauen Augen, quecksilbrig, immer aktiv, ständig in Bewegung, fast schon ein wenig hyperkinetisch. Für alles und jedes interessierte sie sich, und stets war sie neugierig, wissenschaftlich neugierig. Die drehte jeden Stein um, egal was darunter hervorkroch.
Weinchemikerin wollte sie werden oder Meeresbiologin oder beides. So genau legte sie sich da nicht fest. Ständig kritzelte sie in irgendwelchen Tagebüchlein und Kladden herum, musste alles aufzeichnen, was sie beobachtete, angeblich, um irgendwann einmal bedeutende wissenschaftliche Abhandlungen darüber zu schreiben, wann auch immer ... Die theoretische Seite schien mir nicht so ihr Ding zu sein. Aber sie hatte Ambitionen und Visionen, war aktiv, mutig, zupackend und schreckte vor nichts zurück
Ihre Freunde in Deutschland nannten sie wegen ihres ausgeprägten Forscherehrgeizes „Doc“, so erzählte sie mir. Wenn das kein gutes Omen war. Ich rief sie dann zumeist auch so, und bald schon überzeugte mich ihre temperamentvoll-investigative Art.
Ja, sie war es. Sie war dieser Doc aus Cannery Row, wenn diesmal auch als attraktiv-weibliche Variante. Nur sie empfand ich einem Jack als ebenbürtig. Ich hatte in ihr meine Romanheldin gefunden. Jetzt waren wir endlich komplett.
Die ganze Geschichte schrieb ich dann später sogar aus Grits Perspektive, wo sie doch so gern die erste Geige spielte. Und ich – ich nahm mich wie immer zurück, beobachtete nur und stützte mich auf Grits vielfältige Tagebuchaufzeichnungen, die sie mir nach einigen Jahren schließlich anvertraute.
Auch wenn ich im Geschehen selbst mit vorkam und manche Dinge beeinflusste, ab und an gar aktiv eingriff: Die Bühne gehörte Doc und Jack. So schreibt man über sich selbst, als sei man sich ein Fremder. So weit kann es kommen ...
Doch ich war sowieso und überhaupt nur der Chronist dieser Ereignisse.
Teil 1: Die Farm der beiden Schelme
Zwei schweifen in die Ferne
„Ich darf es jetzt nicht vermasseln“, denke ich, als ich in die erwartungsvolle Runde von Weinkennern schaue und alle Blicke auf mich gerichtet finde. Um eine würdevolle Miene bemüht, senke ich meine Nase tief über den dünnwandigen Glaskelch. Auf dessen Boden schwappt eine Probe des 1981er Primitivo di Solento, DOC, ein ganz trinkbarer Wein, den ich kenne, aber ich spüre instinktiv, dass ich das Prädikat „trinkbar“ nun auf gar keinen Fall von mir geben darf.
Mein krampfhaftes Grübeln merkt mir keiner an, denn ich bin eine ziemlich gute Schauspielerin. Es wird mir zunächst mal als angemessene Pause für meine Weinkundigkeit ausgelegt.
Zumindest solange, bis ich schließlich zu folgendem Kommentar anhebe: „Hm, ein Hauch von Päonien, überlagert vom Duft einer reifen Ananas im Dialog mit einer pürierten Birne. Daraus resultiert dann ein Gesamtbukett von – Buttersäurediäthylester“, höre ich mich sagen und schaue selbstbewusst auf und in die Runde.
Auch wenn meine feine Nase empfindlicher ist als ein Gaschromatograph, sollte ich hier die Chemikerin nicht so heraushängen lassen, kommt es mir in den Sinn, als ich die verwirrten und beunruhigten Gesichter sehe. Jetzt ist es aber schon gesagt. Was soll’s, da muss ich nun durch.
Nach der Geruchsanalyse verkoste ich einen Schluck, den ich bedächtig von einer Wangenseite in die andere schiebe. Ich simuliere Kaubewegungen dabei. Meine Augen halte ich geschlossen, obwohl ich liebend gerne auf den Sekundenzeiger meiner Uhr geblinzelt hätte.
So zähle ich dann im Geist langsam bis 25 durch. Wenn das jetzt nicht von meiner subtilen Kennerschaft und profunden Expertise überzeugt, was dann?
Nun schlucke ich den Wein hinunter und horche in mich hinein, wobei ich wieder andachtsvoll die Augen schließe.
„Eine Sinfonie von gebrannten Erdnüssen, Mandeln und Pistazien mit nur leicht metallischer Couleur des Grillrosts bei einem allerdings dominanten chlor-bromigen Abgang“, bekunde ich schließlich und linse ringsumher. Man ist ratlos bis empört.
Was kann ich denn für meine äußerst sensiblen Geschmacksknospen?
Kein anderer Verkoster hätte den Grillrost bemerkt, von dem Hauch von verkokelter Pistazie ganz zu schweigen. Allmählich fühle ich mich überqualifiziert im Kreis dieser Ignoranten.
Doch egal, ich brauche den Job unbedingt, und jetzt ist ein selbstsicheres Finish vonnöten, wenn ich noch irgendetwas retten will. „Mit einem leichten Nachhall von geschwefelten Rosinen, Nitrit und – Spearmint Gum“, konstatiere ich mit Bestimmtheit und im Übrigen völlig wahrheitsgemäß.
Ihre Blicke sind nun einheitlich empört. Der Sommelier vom Roten Ochsen stiert mich geradezu feindselig an.
Ich verschränke die Arme über der Brust und setze mein hochmütigstes Gesicht auf, doch diese Trotzhaltung entspricht nicht im Geringsten meiner Befindlichkeit, die ich mir tunlichst nicht anmerken lassen will.
„Du hast es mal wieder vergeigt“, geht es mir durch den Kopf. Ich hätte mir vor der Weinprobe halt die Reste von meinem Kaugummi aus der Zahnlücke pulen sollen.
Ein gehässig-böses Raunen geht nun durch die Reihen dieser sogenannten und selbsternannten Weinkennerschaft.
„Die gehört eher zu den Kellergeistern als zu den Kellermeistern“, höhnt der Inhaber des Edelberger’schen Traditionsweinhauses Zum güldenen Kelter. Einige lachen darob – boshaft und zynisch.
Doch bei anderen ist nicht einmal mehr anflugweise Humor zu erwarten, so vor allem beim erzürnten Geschäftsführer der hiesigen Filiale nicht, den man nun mit hochrotem Kopf erlebt. „Sonst kenne ich ihn nur mit geröteter Nase“, denke ich noch gehässig und sehe ihn arrogant und herausfordernd an.
„Sie gehen jetzt besser“, zischt er böse. „Nichts anderes hatte ich vor – bei diesem miserablen Ausschank hier“, gifte ich zurück. Inmitten solcher tumben und kretinistischen Provinzgourmets fühle ich mich in der Tat völlig fehl am Platze. Die reinste Zeitverschwendung, dieser Auftritt.
„Jetzt ist es mal wieder nichts geworden, mit deinem Traumjob als Vorkosterin in Jacques’ Weindepot“, denke ich frustriert und erzürnt beim Herausgehen und knalle so lautstark die Tür hinter mir zu, dass die Weingläser klirren.
Hoffe ich zumindest, denn davon bekomme ich durch die geschlossene Tür ja schon nichts mehr mit.
Natürlich durfte ich nicht einmal mehr den Dessertwein probieren, einen kanadischen Eiswein, an dem mir doch am meisten lag. Davon bekomme ich dann auch nichts mehr mit, im wahrsten Sinne des Wortes.
(Aus Grits Tagebuch, Montag, den 15. April 1985)
„Jeder blamiert sich, so gut er kann“, grinste Rick, Grits ihr angetrauter Ehegatte, als sie ihm zuhause empört Bericht zur Verkostung in Jacques’ Weindepot erstattete.
„Warum willst du überhaupt neben dem Studium noch arbeiten? Lassen wir doch lieber unsere Freiheit nutzen und ein halbes Jahr verreisen“, schlug er vor.
Das war wieder typisch für Rick, den ewigen Studenten. Weder eine angespannte Finanzlage kümmerte ihn, noch die Tatsache, dass Semesterferien nur von Mitte Juli bis Mitte Oktober andauerten.
Grit hielt ihm seine unbekümmerte Lebensweise und Nonchalance nun wortreich vor, doch er blieb weiterhin bemerkenswert gut gelaunt.
Endlich verriet er ihr den Grund für seine Zuversicht: „Onkel Theo aus Portland hat geschrieben und uns mal wieder für ein paar Monate zu sich eingeladen. Der alte Knabe hat doch wenigstens ein Herz für arme Studenten.“
Als Amerikaner in der zweiten Generation hielt Theo an seinem letzten Anker in der von ihm hoch geschätzten europäischen Zivilisation und Tradition fest. Und das war Rick, sein geliebter Großneffe, und dessen charmante, geistreiche, gutaussehende und eloquente Gattin. Mit solchen Attributen schmückte sich Grit zumindest gerne selbst. Bescheidenheit war nämlich nicht gerade ihre Kerndisziplin.
Das Studentenehepaar schlug außerdem mit Studiengängen in Psychologie beziehungsweise Chemie und Biologie akademische Laufbahnen ein, die Theo sich für seine beiden Adoptivsöhne auch sehnlichst gewünscht hätte.
George, sein Ältester, war aber zurzeit gerade als Verkaufsagent für Softdrinks unterwegs, und Jim war Railroadengineer, also Lokomotivführer, geworden, ganz so wie sein lustiger Namensvetter aus der Augsburger Puppenkiste. Ach nein, der hieß ja Lukas, aber Jim war sein Gehilfe.
Die in seinen Augen unangemessene Berufswahl seiner Söhne nahm Theo noch mehr für seine „German cousins“ ein, die gerade vielversprechende Abschlüsse an der deutschen Universität zu Düsseldorf anstrebten, zweifellos eine Lehrstätte mit der Anwärterschaft auf künftigen Exzellenzstatus. Sie war schließlich nach dem deutschen Dichter Heinrich Heine benannt, was Theo gern in seinem Bekanntenkreis zur Sprache brachte, wenn vom beruflichen Werdegang seiner Neffen die Rede war. Da kannte man Heinrich Heine allerdings überhaupt nicht. Nicht einmal Theos bester Freund, der Bischof von Oregon, hatte je von dem gehört.
Das bestärkte den Onkel in der Ansicht, unter Kulturbanausen zu leben und die Beziehungen zu seinen gebildeten europäischen Verwandten besonders zu pflegen.
Bei so viel wohlwollender Sympathie vonseiten der amerikanischen Verwandten sah es Rick umgekehrt auch als seine familiäre Pflicht an, Onkelchens Wunsch zu entsprechen und in Portland wieder vorstellig zu werden, inzwischen bereits zum dritten Male. Insbesondere als die Einladungen auch stets eine Übernahme aller Flugreisekosten einschlossen.
Grit reiste zwar ebenfalls liebend gerne in die USA, hatte aber – ihrem Leitbild einer Selfmade Woman folgend – immer eine gewisse Abneigung davor, sich was schenken zu lassen. So dachte sie nun auch gleich daran, wie man sich für die Großmut des Onkels revanchieren könnte.
Außerdem stand ihr nicht unbedingt der Sinn danach, wochenlang untätig in Theos Stadtdomizil in Portland herumzuhocken und bei seinen Grillpartys vorgezeigt zu werden, wie es bei den früheren Gelegenheiten der Fall war.
Auch mit dem Bischof von Oregon wurde sie nicht so richtig warm. Der mochte sie schon deshalb nicht besonders, weil sie Protestantin war und weil sie immer beim Bridge gewann.
Neben seiner religiösen Intoleranz war er nämlich ein ziemlich schlechter Verlierer bei allen Brettspielen. Beim Pokern und Würfeln sicherlich ebenfalls, doch diese Glücksspiele verdammte er ja sowieso schon berufsbedingt und verurteilte sie von der Kanzel herab bei seinen Predigten. Das hörten Rick und Grit zwar nicht selbst, da sie seine Gottesdienste nie besuchten, aber es wurde ihnen von anderen so berichtet.
Nein, den Bischof, den mochten sie beide nicht leiden.
Einmal pro Woche, nämlich immer mittwochsabends, pflegte er bei Theo und dessen Gattin Emily zum gemütlichen Bridgeabend aufzutauchen, und das war für Grits Geschmack schon einmal pro Woche zu viel.
Na ja, vielleicht war sie selbst ja auch ein wenig intolerant. Aber ihr war der betuliche Lebensstil von Ricks Verwandten einfach zu fad. Theo hatte beruflich so viel um die Ohren, dass er abends Wert auf einen ruhigen und gemächlichen Feierabend legte. „Deutsche Gemütlichkeit“, wie er es als Deutschstämmiger gerne nannte: bei kühlem Wetter daheim im Kaminzimmer sitzend und bei schönem Wetter mit Freunden im Garten grillend, vorzugsweise den Fisch, den er und der Bischof beim Wochenendausflug an der nahen Küste geangelt hatten.
Rick fand das ganz okay. Ihm behagte das bequeme Leben – und das den lieben, langen Tag, denn er hatte, im Gegensatz zu Theo, ja gar keinen stressigen Job, von dem er sich abends erholen musste. Rick war lediglich Psychologiestudent und dabei im zweiundzwanzigsten Semester noch ohne Abschluss, gerade weil er Anstrengungen nicht liebte und jeder Examensprüfung fernblieb.
Theos Frau, die herzensgute Tante Emily, war eine exzellente Köchin, was Rick auch sehr zu schätzen wusste, denn seine Angetraute war das nicht.
Für Kochen und andere häusliche Arbeiten fehlten Grit einfach Lust und Zeit. Ihre naturwissenschaftlichen Ambitionen, die der Chemie und Biologie in allen ihren Facetten und Fakultäten galten, vereinnahmten sie komplett.
Sie bescherten ihr langwierige Studiengänge und mannigfaltige Anregungen: zu mineralogischen Bestimmungen von Schiefergestein des Bergischen Landes, zur Erforschung von Mikroben im Wasser des unteren Wupperlaufs und zu Exkursionen in die Botanik des Eschbachtals, die ihr neue Erkenntnisse über drei unterschiedlich hybridisierte Holunderarten bescherten. Von denen war nur die klein-rotblättrige Spezies, im Volksmund auch „Krätzenholler“ genannt, zur Gewinnung von Beerenwein geeignet, wie sie bei der Verkostung der Destillate in selbstlosen Eigenversuchen feststellte.
Sie untersuchte die Bodenbeschaffenheit von Weinbergen im benachbarten Rheinland. Dabei glich sie links- mit rechtsrheinischen Erdproben ab und zog wertvolle weinwirtschaftliche Rückschlüsse, die die dortigen Winzer bis zum heutigen Tag noch nicht in aller Konsequenz nachvollzogen, geschweige denn umgesetzt haben.
Seesternen und Feuerquallen der holländischen Nordseeküste galt ebenfalls ihr brennendes Interesse. Erstere trocknete und zermörserte sie, um daraus einen besonders effektiven, wenn auch etwas übelriechenden Kakteendünger herzustellen. Bei den Quallen musste sie eine analoge Versuchsreihe allerdings erfolglos abbrechen.
Ständig war Grit hin- und hergerissen, ob ihr eigentlicher zukünftiger Fokus die Meeresbiologie oder aber die Weinchemie sein sollte, und nur deshalb zogen sich ihre diversen Studiengänge so über die Jahre hin.
Wie auch immer: Bei ihren Exkursionen war sie mit der näheren Umgebung mittlerweile durch und suchte nun neue und weiter entfernte Ziele für ihren Forschungsdrang.
Da kamen ihr die verwandschaftlich-gesponserten USA-Aufenthalte gerade recht. Und die wollte sie nicht im Schoße der Familie verbringen. Sie war ein Mensch, der Aktion und Abwechslung brauchte. Ihr war bislang noch immer etwas Kurzweiliges eingefallen, der trauten Familienhäuslichkeit in Portland zu entgehen.
So grübelte sie auch jetzt bereits über Pfade und Wege, wie sie sich in diesem anstehenden Aufenthalt im fernen Amerika etwas Zerstreuung und neue Herausforderungen für ihren Forschungseifer verschaffen konnte.
Da kam ihr doch gerade eine vage Idee. Also war mit Rick zunächst mal eine bestimmte Sache zu klären.
Die Obstfarm im Columbia-Tal
„Hat Onkel Theo eigentlich noch die Parzelle Land im schönen Tal des Columbia River?“, fragte Grit möglichst beiläufig. „Ja, klar“, bestätigte Rick.
Theo hatte sich vor einigen Jahren einen Flecken Land östlich vom Städtchen Hood River am Ufer des Stroms gekauft, um dort seine eigenen Netzmelonen und Boysenberries zu kultivieren.
Tante Emily legte für ihre Koch- und Küchenkünste großen Wert auf eigenen Obst- und Gemüseanbau, weil sie die Produkte der umliegenden Farmers’ Markets qualitativ geringer schätzte als selbstgezogene Früchte.
Sie liebte es zudem, ihr Heim mit wundervollen Blütengestecken und Sträußen zu dekorieren, ebenfalls von Blumen aus dem eigenen Anbau, denn auch hier genügten käufliche Gärtnerprodukte nicht ihren hohen Ansprüchen.
So vollbrachte sie im eigenen Garten hinter dem Haus, das sich in einem grünen Randbezirk der Großstadt Portland befand, wahre Wunder in Rosenzucht, während ihr die etwas gröbere Arbeit bei der Obst- und Gemüsekultur weitgehend von ihrem hobbygärtnernden Gatten abgenommen wurde.
Auf diese Art hatte sie immerhin stets genügend frische Produkte eigener Herkunft für ihren Küchen- und Blütenzauber.
Zumindest solange, bis ... tja ... 1980 der Mount St. Helens ausbrach.
Es war nun fünf Jahre her, dass Onkel und Tantchen hilf- und fassungslos eine Lavastaubschicht von vier Inches, sprich zehn Zentimetern, Dicke auf ihren Gartenstolz herniedersinken sahen.
Dabei lag der von einer Riesenexplosion zerborstene Krater immerhin 70 Meilen von Portland entfernt. Dennoch: Es wurde in der Stadt dunkel wie zu einer Sonnenfinsternis, und als sich die Aschen lichteten, waren ihre damalige Ernte sowie die Rosen vernichtet und Emily geradezu traumatisiert.
So bedrängte sie ihren Gatten, ein Stück Land zu erwerben, das nicht im Umfeld dieses grässlichen Bergs lag und das auch in einem künftigen Aschenkatastrophenfall noch zu bewirtschaften war.
Theo zog mit dem Zirkel auf der Landkarte einen Kreis um den Mount St. Helens mit dem Maximalradius seiner damaligen Ausstreuung, schlug noch einen Sicherheitsabstand drauf und landete schließlich nach Westen hin im Meer und nach Osten hin in der Nachbarschaft des Örtchens Hood River am großen Columbia-Strom. Letzteres erschien ihm ein geeigneter Flecken für seine eigene private Obstfarm zu sein.
Er schaute sich dort in der Umgebung um und kaufte schließlich ein Stück Land am Fluss mit einem alten, kleinen Farmhaus darauf, das er in den folgenden Jahren liebevoll renovierte, soweit es seine knapp bemessene Freizeit eben zuließ.
Er versuchte, den alten Orchard neu zu kultivieren – denn es war eine Obstfarm gewesen – und pflanzte ein paar Beerensträucher und ein Melonenbeet an.
Dass sein kleines Anwesen nur zwanzig Meilen nördlich eines anderen Vulkans, des Mount Hood, lag, hatte er beim Grundstückskauf wohl nicht bedacht.
Von seinen Freunden später darauf aufmerksam gemacht, verkündete er nonchalant, dass er bei einem Ausbruch des Mount Hood ja immerhin noch das Obst aus seinem Garten in Portland zur Verfügung habe, da die Explosion beider Vulkane zur gleichen Zeit extrem unwahrscheinlich sein würde. Soviel zu Onkelchens Risikostreuung.
Viele Ernten standen ihm ohnehin nicht ins Haus, da er drei Jahre darauf zum Chefarzt befördert wurde und damit beruflich so stark eingebunden war, dass er kaum noch Zeit für das nette Farmhäuschen und seine kleine Plantage fand.
Das Landhaus ließ er durch einen rüstigen Eisenbahnpensionär aus dem Ort Hood River in Schuss halten. Doch die Obstplantage war für diesen älteren Herrn namens Bill Craig zu viel Arbeit und verwilderte über die letzten beiden Jahre, da Emilys wenig robuste Natur nicht für schwere Gartenarbeit geschaffen war.
Sie fuhr zwar einige Male hinaus, um wenigstens den Blumengarten instand zu halten, doch auch der wuchs ihr buchstäblich über den Kopf.
Konnte sie doch inzwischen im eigenen Hausgarten in Portland auch nicht mehr auf die Hilfe ihres vielbeschäftigten Mannes zählen und musste dort alles selbst bewirtschaften.
Theo und Emily beschränkten sich also im Weiteren auf Melonen und Boysenberries aus dem Garten, der ihr Stadtdomizil umgab. Diese konnten sie immerhin aschefrei genießen, da der Mount St. Helens in der Folgezeit kein zweites Mal ausbrach.
Ab und an fuhr Theo mit seinem Freund, dem Bischof von Oregon, zu einem Angelausflug an den Columbia River, und für diese raren Wochenenden diente ihnen das kleine Landhaus als Übernachtungsmöglichkeit.
„Es ist wirklich jammerschade, dass man diesen paradiesischen Flecken nicht agrarwirtschaftlich ergiebiger nutzen kann“, überlegte sich Grit. Bislang bescherte er dem Onkel nur ein paar Beeren im Sommer und ein paar Äpfel der überalterten Obstbäume im Herbst.
Einmal hatte er Rick und sie vor drei Jahren bei einem Wochenendausflug dorthin mitgenommen, und sie hatte die wunderbare Hanglage des Anwesens über dem Flusstal des mächtigen Columbia-Stroms bewundert.
Auch der romantische Baumgarten nahm sie sehr gefangen. Gärtnern kam ihr als Beschäftigung im Freien eher entgegen als andere häusliche Tätigkeiten. In ihrem winzigen Gärtlein in Solingen widmete sie sich immerhin der Blumenkultur, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Mit Obst und Gemüse hatte sie zunächst mal wenig am Hut. Allerdings interessierte sich Grit für den Anbau von Reben. Schließlich strebte sie zu dieser Zeit noch eine spätere Karriere als Weinchemikerin an.
Dummerweise brauchte man dazu nicht nur Begabung und Talent, die sie bei zahlreichen Weinverkostungen – wie jüngst in Jacques‘ Weindepot – mal mehr und mal weniger überzeugend unter Beweis stellte, sondern auch noch handfeste Qualifizierungen, mit einem akademischen Abschluss begütesiegelt.
Und das machte die Sache dann schon wieder etwas kompliziert. Denn auch sie studierte wie ihr Ehemann bereits im zweiundzwanzigsten Semester und genauso wie Rick völlig abschlussfrei. Nun galt das Studium der Chemie aber auch als ein besonders anspruchsvolles Betätigungsfeld. Ein anderes Fach, wie zum Beispiel Psychologie oder Pädagogik, hätte sie sicherlich schon längst erfolgreich beendet, so dachte sie im Stillen. Doch man war ja ehrgeizig und hatte sich unter all den Möglichkeiten das denkbar schwierigste Metier ausgesucht. Deshalb titulierte sie sich im Hinblick auf ihre künftigen wissenschaftlichen Meriten auch immer als „Doc“ und hörte es gerne, wenn ihre Freunde sie auch so riefen. Man tat ihr in der Regel den Gefallen. Nur Rick, der nannte sie hartnäckig Grit. „Klingt doch viel weiblicher“, meinte er immer. Das konnte sie aber nie so ganz nachvollziehen.
Sie begann also, darüber nachzudenken, wie sie ihren Ambitionen den passenden Rahmen schaffen könnte. Und ihre Gedanken kreisten dabei um die kleine idyllische Obstfarm im Tal des großen Columbia-Flusses wie die Motten um die Lampe.
Nun galt es, sich nicht die Flügel zu verbrennen, wenn man der Glühbirne zu nahe kam. Das hieß in ihrem Fall aber nichts anderes, als dass man noch nicht allzu viel Licht in die Angelegenheit bringen durfte.
Die größten Schwierigkeiten hatte sie von ihrem die Bequemlichkeit liebenden Mann zu erwarten, der seine Tage zweifelsfrei lieber in der – und um die – Heimstatt des Onkels verbrachte, gute Verpflegung genoss und die Großstadt Portland für angenehme abendliche Zerstreuung wie Theater, Konzert oder Kino in seiner unmittelbaren Nähe wusste.
Das wäre ihm zweifellos sehr viel angenehmer, als mit der nichtkochenden Gattin ein rurales Häuschen in der Landeinsamkeit zu beziehen, in dem permanente Eigenarbeit und Improvisationstalent bei der Haushaltsführung angesagt waren.
Insbesondere die gärtnerischen Fertigkeiten waren Rick völlig abhold, und ohne solche würde es in Grits kühnen Plänen nun einmal nicht gehen.
Insofern war es klug und weise, ihm zunächst mal gar nichts von ihrem Vorhaben zu verraten und ihn dann an Ort und Stelle zu überraschen. Für Überraschungen war sie nämlich immer gut. Sie erfreute sich ihres Plans, und die Vorfreude wuchs während der nächsten Wochen.
Jeder Tag endete mit einer Nacht; jeder Gedanke mit einer Schlussfolgerung; und jeden Morgen stieg eine neue Freiheit über den Bergen im Osten auf und erleuchtete die Welt.2
Als man schließlich die Einladung von Onkel Theo in sein Stadtdomizil nach Portland dankend annahm, stürzte sie sich mit gleichem Eifer wie Rick in die gemeinsamen Reisevorbereitungen. „Nur nichts zu früh verlauten lassen von meinen Plänen und Ideen“, so sagte sie sich.
Die Farm am Columbia River würde sie erst ganz zuletzt wie ein Zaubermeister sein weißes Kaninchen aus dem Zylinder ziehen.
Doc, der große Houdini!
2 Der Text in Times New Roman ist zitiert aus dem Roman „Wonniger Donnerstag“ von John Steinbeck in der deutschen Übersetzung von Harry Kahn, Diana Verlag, Zürich, 1956.
Grits großer Coup
Endlich war es so weit. Für Grit und Rick war ihr ersehnter Reisetag angebrochen. An einem sonnigen Freitagmorgen der letzten Maiwoche (sie hatten ihre Semesterferien wie immer etwas früher angetreten als ihre Mitstudenten und Konsemestranten) brachte sie Grits Bruder in seinem klapprigen VW-Käfer nebst zwei großen Koffern von Solingen zum Düsseldorfer Flughafen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!