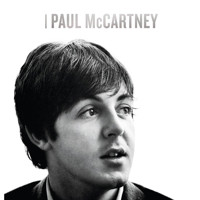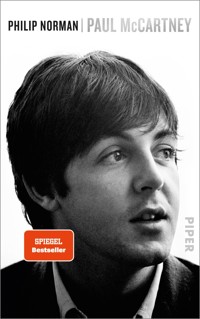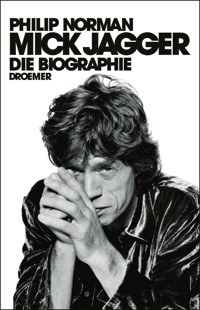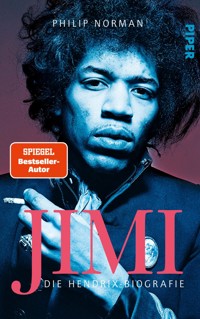
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Live fast, love hard and die young – die explosive Biografie über den Ausnahmemusiker Auf dem Höhepunkt seines Könnens starb Jimi Hendrix einsam und hinterließ eines der größten Rätsel der Musikgeschichte. Philip Norman geht den Geheimnissen um den Gitarrengott auf den Grund. Die Gitarre war sein Werkzeug, - sein Talent und sein Genie hoben ihn in den Olymp der wichtigsten Musiker aller Zeiten: Jimi Hendrix ließ nichts aus und prägt die Rockmusik bis heute. Als er im September 1970 in einem Londoner Hotelzimmer starb, wurde er zum tragischen Gründungsmitglied des Club 27. Kultautor Philip Norman hat den Fall Jimi Hendrix neu aufgerollt und tief in den Archiven gegraben. Anhand bislang unveröffentlichter Dokumente und persönlicher Gesprächen mit engen Begleitern des Jahrhundertgenies rekonstruiert Norman den Aufstieg und das traurige Ende des Gitarristen und Aktivisten. »JIMI: Die Hendrix-Biografie« bleibt stets bei den Fakten und lässt die Geschichte für sich sprechen. Gleichzeitig ist dieses Buch auch die Würdigung eines lebenslangen Fans. Philip Norman setzt Hendrix ein literarisches Denkmal, das jeden Musikliebhaber begeistern und packen wird. »Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an den Künstler, sondern auch ein spannendes Kriminalstück.« – Rosenheimer Journal Philip Norman hat sich seine Lorbeeren als Biograf des Rock 'n' Roll verdient. Der ehemalige Musikjournalist hat bereits die Beatles und die Rolling Stones hautnah beleuchtet und den Menschen hinter dem Star Paul McCartney von einer neuen Seite gezeigt. »Wer sich mit der Musikgeschichte beschäftigt, kommt an der fesselnden Biografie ›Jimi‹ nicht vorbei. Empfehlenswert!« – From me to you Newsletter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de© Philip Norman, 2020Titel der englischen Originalausgabe: »Wild Thing. The Short, Spellbinding Life of Jimi Hendrix« bei Weidenfeld & Nicolson, The Orion Publishing Group Ltd., London 2020deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: Gered Mankowitz/Iconic ImagesSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
VORWORT: »Er war ein feiner Kerl«
EINS: »Er konnte die Musik hören, aber er hatte kein Instrument, um sie zu sich auf die Erde zu holen«
ZWEI: »Jimmy war schon ein Hippie, als noch niemand wusste, was ein Hippie ist«
DREI: »Ich habe immer noch meine Gitarre und meinen Verstärker, und solange ich die habe, kann mich niemand davon abhalten, meinen Lebensunterhalt zu verdienen«
VIER: »Es läuft eher so mittelprächtig in dieser großen, schäbigen Stadt namens New York«
FÜNF: »Ich hab genau den richtigen Mann für dich«
SECHS: »Ganz ehrlich, Chas … er ist fast schon zu gut«
SIEBEN: »O mein Gott, jetzt bin ich nicht mehr Gott«
ACHT: »Geh mal los und besorg ’ne Dose Feuerzeugbenzin«
NEUN: »Nicht auf meinem Sender!«
ZEHN: »Vom Gerücht zur Legende«
ELF: »Er war uns eine unendlich große Hilfe«
ZWÖLF: Electric Ladys
DREIZEHN: »Ich werde sterben, bevor ich dreißig bin«
VIERZEHN: »Nichts weiter als eine Band of Gypsys«
FÜNFZEHN: Miles und Miles
SECHZEHN: »Mein geliebter Vater …«
SIEBZEHN: »Hey Mann, leih mir mal deinen Kamm«
ACHTZEHN: »Nenn mich einfach Helium«
NEUNZEHN: »Gute Nacht, süßer schwarzer Prinz«
ZWANZIG: Ein großer schwarzer Schutzengel mit Hut
EINUNDZWANZIG: »Scuse me while I kiss the pie«
NACHWORT: »DANKE, JIMI!«
DANKSAGUNG
ANHANG
QUELLENNACHWEIS
Bildteil
Bildnachweis
Jimi arbeitete mit Licht. Mit Licht brachte er Mauern zum Einstürzen.
Carlos Santana
VORWORT: »Er war ein feiner Kerl«
Alle Rockmusik-Legenden begannen ihre Karriere damit, die Songs anderer Leute nachzuspielen. Meistens blieb es beim faden Abklatsch, der aus dem Repertoire fiel, wenn der Künstler erst einmal seinen eigenen Sound gefunden hatte. Die große Ausnahme war Jimi Hendrix, der auch während seiner kurzen Erfolgszeit nie damit aufhörte, Coverversionen zu spielen, wobei er die Songs nie einfach kopierte, sondern oft auf radikale Weise neu erfand. So verwandelte er zum Beispiel die skurrile Beatles-Nummer »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« in eine Heavy-Metal-Breitseite, die Paul McCartney – selbst jemand, dem nicht eben wenig Anerkennung zuteilwurde – zu der Bemerkung veranlasste, das sei die größte Ehre seines Lebens gewesen.
Sämtlichen anderen Künstlern, die von Jimi gecovert wurden, ging es ähnlich: Keiner warf ihm vor, er habe sein Werk entweiht, ganz im Gegenteil erntete er nichts als Bewunderung dafür, dass es ihm gelang, einem Song völlig neue Dimensionen zu eröffnen. Tatsächlich werden in weiten Kreisen nicht etwa seine eigenen Kompositionen wie »Purple Haze« oder »Voodoo Child« als Höhepunkt seines Schaffens angesehen, sondern sein Cover von Bob Dylans »All Along the Watchtower«. Der Song war ursprünglich 1966 auf Bob Dylans Album John Wesley Harding erschienen, und wie meistens spiegelte er eher den Lesestoff als das Leben seines Komponisten wider. Der Titel entstammte einer Passage des Buches Jesaja aus dem Alten Testament – die übrigens auch die Zeile »Go set a Watchman« (Gehe hin, stelle einen Wächter) enthält, nach der Harper Lee einen frühen Entwurf von To Kill a Mockingbird(Wer die Nachtigall stört) betitelte. Dylan legte den Song in einem mittelalterlichen Setting an, gesehen wie durch die Augen eines viktorianischen Dichters wie Alfred Lord Tennyson – bekannt für seine Artus-Ballade »Die Lady von Shalott« –, für den er zu jener Zeit eine große Vorliebe entwickelt hatte.
Das Ergebnis schien mehr ein Rückschritt in seine Folk-Vergangenheit als die Bestätigung seiner kürzlich erfolgten Bekehrung zum Rock: die einsame Stimme, das repetitive Akustikgitarrengeschrammel, die Mundharmonika zu quietschig, um die übliche Durchschlagskraft zu entwickeln, und weit und breit keine Spur von seiner viktorianischen Muse, nirgendwo eine Sad-Eyed Lady of Shalott. Obwohl »All Along The Watchtower« allgemein positiv und als weiterer Beweis für Dylans Ausnahmestellung aufgenommen wurde, musste er sich von Musikerkollegen anhören, er komme über ominöse Andeutungen nicht hinaus. Sein früherer Folk-Mentor Dave Van Ronk kritisierte selbst die Wortwahl und nannte den Song »falsch, beim Titel angefangen: Ein Wachturm ist keine Straße oder eine Mauer, und man kann ihn nicht entlanggehen«.
Jimis Version erschien auf Electric Ladyland, seinem dritten Album, seit es ihn von New York nach London verschlagen und er sich mit den beiden weißen Briten Mitch Mitchell am Schlagzeug und Bassist Noel Redding zur Jimi Hendrix Experience zusammengetan hatte. Diese Version legt nicht nur die treibende Urkraft des Hardrock frei, sie zeugt zugleich davon, dass, in welcher Kunstsparte auch immer, zur wahren Größe nicht nur unvergleichliches Können und unbändige Energie gehören, sondern auch Disziplin und Understatement.
In Jimis Händen wird das gehetzte Tempo der Dylan-Version gleich durch eine Akkordfolge im Intro rausgenommen, die formal simpel ist, aber dennoch ein schäumendes Brodeln heraufbeschwört, eine wilde Meeresbrandung, deren wütende Wellen auf den Kies klatschen und den Seetang zum Glitzern bringen, während sich darüber dunkle Wolken formen. Die ganze Trostlosigkeit und Melodramatik Tennysons, die das Original vermissen ließ, sind mit einem Schlag da.
Der Text beginnt mit einem Dialog zwischen dem »Joker«, also der traditionellen Kartenspielfigur mit dem gestreiften Dreispitz, der den Ausbruch aus einer nicht näher benannten Gefangenschaft plant, und dem »Dieb«. Wo bei Dylan jede einzelne Silbe nur so vor Ironie und Doppeldeutigkeit troff, geht Jimi mit seinem sanften Bariton völlig unverstellt an die Sache heran, legt vielleicht gerade mal eine leichte Betonung auf »There’s too much confusion« und »I can’t get no relief«, womöglich auch ein Hinweis darauf, wie er sein neues Leben in Großbritannien bereits empfand.
Seine Stimme hat die gleiche Überzeugungskraft bei der verworren moralisierenden Antwort des Diebs. Doch mit der Gitarre hält er sich noch immer zurück, nicht mal B. B. King hat ein Riff jemals so sparsam eingesetzt.
Und dann schließlich, als es spät wird, »the hour is getting late«, kündigt ein prägnantes »Hey« den Break an, der, für mich, alle anderen übertrifft, seit man Gitarren elektrische Drähte durch den Körper gezogen und metallene Tonabnehmer, Lautstärkeknöpfe und Tremolohebel ins Antlitz gebohrt hat. Vergesst Eric Clapton bei Creams »Crossroads« und Jimmy Page bei Led Zeppelins »Stairway to Heaven« und James Burton bei Ricky Nelsons »My Babe« und Mark Knopfler bei Dire Straits’ »Sultans of Swing« und Scotty Moore bei Elvis’ »Heartbreak Hotel«. Ihr könnt sogar Chuck Berrys »Johnny B. Goode« vergessen – go, Jimi, go.
Der Break besteht aus vier getrennten musikalischen Sätzen, von denen nur der erste wie ein konventionelles Gitarrensolo wirkt, die Töne so sorgsam gewählt und so elegant »gezogen« wie bei B. B. King zu seinen besten Zeiten. Der zweite Satz ist mit einer Metall Slide gespielt und hätte bei Elmore James oder Howlin’ Wolf schroff und wütend geklungen, aber bei Jimi ähnelt er eher der aufregenden Fahrt durch eine außerirdische Stadtlandschaft, jeder Tonschwall der Slide wie ein glühender Aufzug, der zischend auf- oder abwärtsgleitet. Erst schießt einer in die Tiefe, dann steigt ein anderer empor, und ein weiterer noch höher, bis es fast so scheint, als ob er durch das Zeitgefüge tanzte.
Darauf folgt eine ausgedehnte Passage mit Wah-Wah-Pedal (eigentlich klingt es eher nach »fwacka-fwacka«), die die sanft gleitenden Maschinen ablöst und durch eine Stimme ersetzt, die fast nach der menschlichen klingt, als ob die Gitarre sinnieren und über ihren eigenen kleinen Insiderwitz glucksen würde. Weil es unmöglich erscheint, das Vorangegangene noch einmal zu übertreffen, läutet plötzlich ein Trio einfacher melodischer Akkorde auf den hohen Saiten, ergänzt durch Vorschlagsnoten mit dem kleinen Finger, das Finale ein – man könnte es vergleichen mit einem Dreisternekoch, der es vorzieht, sein Können mit den einfachsten Gerichten zu beweisen, sagen wir einem Brathähnchen oder den perfekten verlorenen Eiern.
Schließlich taucht doch noch ein Wachturm in dem Song auf, wenn auch mittlerweile weniger Sicherheitsmaßnahme denn Ausguck, von dem Prinzen herabblicken (»princes kept the view«). Großes Drama scheint sich mit »two riders were approaching« abzuzeichnen, dessen apokalyptischer Ausgang sich mit »and the wind began to howl« andeutet.
Aber noch bevor erklärt wird, wer die beiden Reiter sind, und gerade als Jimis Gitarre lauter aufheult als jeder Sturm, der König Lear gequält haben mag, wird das Ding ausgeblendet. Es ist das Outro.
Immer, wenn ich es höre, muss ich das Gleiche denken: Geh nicht!
»Womöglich der größte Instrumentalist in der Geschichte der Rockmusik«, ist in der Laudatio der Rock & Roll Hall of Fame zu lesen. Doch zur Debatte stand das nie, trotz all der Gitarren-Superhelden, die in den Sechzigern hervortraten – Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards, George Harrison, Jimmy Page, David Gilmour, Peter Green, Robbie Robertson, Duane Allman und Jerry Garcia. Jeden von ihnen hatte es beim ersten Hören von Jimi Hendrix so erwischt, dass er bildlich gesprochen kurz davor war, sein Plektrum hinzuschmeißen und sich mit erhobenen Händen zu ergeben.
Ein halbes Jahrhundert später bleibt James Marshall Hendrix immer noch eine einzigartige Erscheinung, weil er sich als Afroamerikaner von den traditionellen »schwarzen« Genres Blues, R&B und Soul löste, um stattdessen harten Rock vor einem mit überwältigender Mehrheit weißen Publikum zu spielen, und dabei fast im Alleingang die Musik erfand, die man heute als Heavy Metal bezeichnet. Leute wie Billy Gibbons von ZZ Top, Slash von Guns N’ Roses oder Kirk Hammett von Metallica geben freimütig zu, dass sie ihm ihre Weltkarrieren zu verdanken haben. Dennoch stand er für so viel mehr als nur eine Art Nischenmusik, die über die Jahre stetig kakofonischer wurde und sich nahe an der Selbstparodie bewegte. Genau wie man Bob Marley lieben kann, ohne Reggae zu mögen, muss man keinen Metal mögen, um Jimi zu lieben.
Jimi steht als dauerhaftes Sinnbild für das Genie, das unter tragischen Umständen aus dem Leben gerissen wurde: Er ist im Alter von nur 27 Jahren angeblich an einer Überdosis Barbiturate gestorben. Einige weitere große Talente der ersten Liga gingen im gleichen Alter zugrunde an Drogen, Alkohol oder verwandten Gefahren des Rock-’n’-Roll-Lebensstils – der »Club 27«, zu dessen (ansonsten ausschließlich weißen) Mitgliedern Brian Jones von den Rolling Stones, Jim Morrison von den Doors, Janis Joplin und als letzte Zugänge Kurt Cobain und Amy Winehouse zählen. Tatsächlich gilt dieses verfrühte Abtreten – alle starben sie einsam, trotz der Heerscharen von Leibwächtern und Handlangern – als sichere Eintrittskarte ins Rock-Walhalla. Jimi, dessen Tod alle zuvor genannten Elemente enthielt, ist beim »Club 27« Präsident auf alle Ewigkeit.
Er war ein junger Mann von geradezu spektakulärer Schönheit, mit seinem Atompilz-Afro und seinem fein gezeichneten Gesicht, das sich – vom Schnäuzer mal abgesehen – auch gut bei einer der Girlgroups seiner Ära gemacht hätte, etwa den Supremes oder den Ronettes. Ganz im Kontrast zur zurückhaltenden Männermode der Sechziger kreierte er mit seiner bordürenbesetzten viktorianischen Militärjacke, seinen Brokatwesten, Rüschenblusen, Chiffonschals, Riesenhüten und indianischen Stirnbändern einen Vagabundenlook für Rockstars, den manche heute noch hartnäckig bis ins hohe Alter beibehalten. Genau wie Little Richard in den wilden Rock-’n’-Roll-Zeiten der Fünfziger wirkte Jimi oft wie nicht von dieser Welt. Damals schrieb ein Kritiker, »er holte den Blues aus dem Mississippi-Delta heraus und schickte ihn zum Mars«.
Bis dahin hatte ein Rock-Gitarrengott keinen »Act« gebraucht, mal abgesehen von einer statischen Pose der gequälten Kreativität. Aber Jimi kombinierte Gesang und Griffbrettakrobatik mit einem Showtalent, das an Grenzen ging, die sogar Mick Jagger bei den Stones oder Jim Morrison von den Doors nie erreichten. Er spielte seine Linkshänder-Stratocaster hinter dem Kopf, mit den Zähnen oder mit seiner schlängelnden Zunge, die anscheinend völlig immun war gegen elektrische Schläge, ohne sich dabei auch nur bei einem Ton zu verhaspeln. Wenn er seiner Gitarre jedes mögliche magische Dezibel entrungen hatte, unterzog er sie einem rituellen sexuellen Angriff, legte sie flach und besprang sie, überschüttete sie mit Benzin, zündete sie an und schlug den brennenden Kadaver in Stücke. Dieser voodoobeeinflusste Porno-Vandalismus hätte nicht weiter entfernt sein können von seinem wahren Wesen: Er war bescheiden, höflich und schüchtern, auch wenn die Schlangen von Frauen vor seiner Schlafzimmertür selbst Jagger und Morrison wie Klosterschüler aussehen ließen.
Seine monumentale Promiskuität mag heutzutage verpönt sein, wo man in die Jahre gekommene Rocker regelmäßig als »Sexualstraftäter« brandmarkt, weil sie sich vor fünf Jahrzehnten auf Backstageorgien mit weiblichen Anhängern einließen, deren Alter sie selten bis gar nicht interessierte. In den »freizügigen« Sechzigern galt das allerdings als völlig normal, es zählte einfach zu den von vielen beneideten Begleiterscheinungen des Rockstarlebens. Doch Jimi war kein Aufreißer. »Man konnte ihn nicht als omanizer bezeichnen«, erinnert sich sein Musikerkollege und Freund Robert Wyatt, »es war eher so, dass die Frauen Hendrixizer waren.«
Heutzutage verkauft er jedes Jahr mehr Platten als zu seinen Lebzeiten, aber das macht nur einen Teil seiner anhaltenden Popularität aus. Er ist untrennbar mit der Ikonografie der Sechziger verbunden, der sogenannten »Dekade, die niemals stirbt«.
In jeder Ausstellung über die Sechziger, jedem Bildband eines der vielen herausragenden Fotografen wie Terence Donovan oder Gered Mankowitz wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Foto von Jimi in seiner Husarenjacke mit den Goldlitzen finden, die zu seinem Markenzeichen wurde. Er ist eine Ikone im exakten Wortsinn dieses überstrapazierten Begriffs. In irgendeinem Land der Welt trägt genau in diesem Moment ein junger Rockfan ein T-Shirt mit Jimis Konterfei darauf, auf dem er so schüchtern wie schamlos unter dem lockigen Heiligenschein hervorlugt wie ein schwarzer südamerikanischer Jesus, einem Turiner Grabtuch aus Massenproduktion ähnelnd.
Obwohl er bis ins tiefste Innere Amerikaner war – Afroamerikaner wie auch Native American –, wird man ihn auf ewig mit London in seiner glamourösesten Epoche in Verbindung bringen. Und trotz seiner erstaunlichen Begabung musste er erst 23 Jahre alt werden, bis man ihn in seinem Heimatland wahrnahm; eine Konsequenz der Rassentrennung, die die Auftritte schwarzer Musiker, mit Ausnahme der allergrößten Namen, auf die Theater und Clubs des Chitlin’ Circuit beschränkte, wo sie unter sich bleiben mussten.
1966 wurde er in New York von der Freundin des Rolling-Stones-Gitarristen Keith Richards entdeckt und von Chas Chandler, dem Bassisten der Animals, nach London geholt, Chandlers erster Vorstoß in die Welt des Managements. Es war die gerade frisch gekürte »Stilmetropole Europas«, in der er endgültig aufblühte. Die gesamte Elite der britischen Popmusik, allen voran die Beatles und die Rolling Stones, kam zusammen, um ihn live in Clubs wie dem Scotch of St James oder dem Speakeasy spielen zu sehen und ihn zu bewundern.
Sofort nachdem Chandler ihm die beiden weißen Musiker Redding und Mitchell an die Seite gestellt und damit die Jimi Hendrix Experience formiert hatte, erntete er Riesenerfolge mit einer Handvoll Hitsingles und drei Alben, die umgehend Klassikerstatus erlangten. Als Revanche für die »British Invasion«, die sich in den Fußstapfen der Beatles in den US-Charts festgesetzt hatte, leitete er alleinig die amerikanische Gegenoffensive. Und trotzdem nahm er dankbar seine neu adoptierte Kultur an, lernte ihre Eigenheiten wie warmes Bier und Fish & Chips zu schätzen und Institutionen wie A. A. Milnes Pu-der-Bär-Geschichten oder die nordenglische Fernsehsoap Coronation Street zu lieben.
Von London aus trat er seinen Siegeszug durch Europa an, dann kehrte er zurück in die USA, wo er mit seiner brennenden Gitarre beim ersten großen Popfestival in Monterey 1967 allen die Show stahl. Im darauffolgenden Jahr, als die Nation erschüttert wurde von Rassenunruhen und der brutalen staatlichen Gegenreaktion, ging er auf Tournee als Schwarzer, der zwei Weiße anführte – ein mutiges Zeichen für die Integration, das nicht hinter den Leistungen der Bürgerrechtsbewegung zurückstehen muss. 1969 gipfelte das gigantische Woodstock-Festival in seiner Solo-Instrumental-Performance der Nationalhymne »The Star-Spangled Banner«, mit der er gegen den Vietnameinsatz des US-Militärs protestierte, bei dem er selbst einst stolz gedient hatte.
Nach nur vier Jahren wurde sein glänzender Aufstieg jäh unterbrochen, gerade als sich neue Türen für ihn zu öffnen schienen. In derselben Metropole, in der seine Karriere Fahrt aufgenommen hatte, starb er im September 1970 einen einsamen, elenden Tod in einem Westlondoner Hotel, dessen Umstände nie richtig aufgeklärt wurden – eins der größten ungelösten Rätsel der Popgeschichte. Seitdem kursieren die Gerüchte, dass es bei seinem Tod nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, dass er von seinem sinistren Manager Mike Jeffery umgebracht worden sei oder von der Mafia oder gar von einer paranoiden US-Regierung, die Jimis Missachtung der Rassenschranken als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft habe.
Ich habe Jimi nie getroffen, obwohl ich mich als fest angestellter Reporter für die superschicke Farbbeilage der Sunday Times mitten im Epizentrum von Swinging London bewegte, jeden interviewen konnte, nach dem mir der Sinn stand, und ich in sämtlichen Clubs, in denen er auftrat, reservierte Plätze genoss. Doch ich war schon halb auf dem Absprung in die USA, wo ich die etablierteren Stars der schwarzen Musik treffen wollte: James Brown, Stevie Wonder oder Diana Ross.
Ende 1969 brachte das Magazin der Sunday Times mein Porträt von Eric Clapton, dessen Anhänger ihn zum »Gott« ausgerufen hatten, bevor Jimi auf der Bildfläche erschien. Als sich ein Jahr später die Nachricht von Jimis Tod verbreitete, bat die New York Times Clapton um ein Interview über seinen ehemaligen Rivalen, der zum guten Freund geworden war. Clapton willigte ein – unter der Bedingung, dass ich das Interview führte. Kurz vor der Abreise nach Detroit und L. A. stehend, wo ich über das Motown-Label schreiben und den elfjährigen Leadsänger der als »schwarze Beatles« vermarkteten Jackson 5 treffen sollte, lehnte ich den Auftrag ab. Ich habe es immer bereut, meinen Flug nicht verschoben zu haben.
Warum nehme ich also ein Buch über Jimi in Angriff, wenn die Erschöpfung nach meiner Eric-Clapton-Biografie noch nicht abgeklungen ist? Wo ich doch, wie immer nach einem solchen Projekt, keinerlei Lust mehr hatte, auch nur ein einziges Wort über Musik oder Musiker zu schreiben? Die Antwort ist die: Das Buch hat keine Rücksicht auf meine Befindlichkeiten genommen und wie von selbst Form angenommen.
2018 machte mich mein fantastischer Recherchekollege Peter Trollope darauf aufmerksam, dass sich im September 2020 Jimis Todestag zum fünfzigsten Mal jähren würde, ohne dass es bislang eine zufriedenstellende Erklärung der Todesursache gegeben habe. In den Achtzigern war Pete Produzent der bekannten Fernsehdokumentationsserie World In Action gewesen und hatte an einer Sendung gearbeitet, die sich mit dem Todesfall beschäftigt hatte, aber nie ausgestrahlt worden war. Er wollte mir seine gesamten Unterlagen zur Verfügung stellen, einschließlich der Aussagen wichtiger Zeugen, die nie bei der Feststellung der Todesursache gehört worden waren.
Und dann bekam ich eine völlig unerwartete E-Mail von Sharon Lawrence, einer früheren Reporterin der Nachrichtenagentur UPI, die nach seiner triumphalen Rückkehr in die Staaten zur engen (platonischen) Freundin von Jimi geworden war. Sharon war in den frühen Neunzigern eine wichtige Quelle für meine Biografie von Elton John gewesen, aber danach hatten wir uns aus den Augen verloren. Obwohl sie selbst ein Buch mit sehr persönlichen Jimi-Erinnerungen verfasst hatte, willigte sie ein, mir als Beraterin zur Seite zu stehen, sollte ich etwas schreiben wollen.
Dann fiel mir ein, dass ich immer noch die Telefonnummer von Ray Foulk hatte, der zusammen mit seinen Brüdern Ronnie und Bill 1970 das Isle of Wight Festival veranstaltet hatte, bei dem Jimi zusammen mit den Doors Co-Headliner gewesen war, gerade einmal zwei Wochen vor seinem Tod (und nur ein Jahr vor dem Tod Jim Morrisons). Ich erinnerte mich, dass ich Ray das letzte Mal bei der Veröffentlichungsparty zu seinem Buch über die drei Isle of Wight Festivals der Brüder gesehen hatte, bei dem ich als Insel-Junge ein wenig mitgeholfen hatte. Die Party fand in dem zur Berühmtheit gelangten Haus in der Brook Street in Mayfair statt, das sowohl Jimi als auch – zwei Jahrhunderte zuvor – Georg Friedrich Händel, einen weiteren großartigen musikalischen Einwanderer, beherbergt hatte.
Ganz zufällig war es dann wieder an der Zeit für eines unserer zweimal im Jahr in einem Ufer-Pub in Barnes, Westlondon stattfindenden Get-togethers von alten Rockstars und jenen Schreibern, die deren Erlebnisse aufgezeichnet hatten, auch bekannt als »The Scribblers, Pluckers, Thumpers and Squawkers Lunch«. Dort saß ich neben Keith Altham, dem New-Musical-Express-Journalisten, der Jimis erstem Manager Chas Chandler vorgeschlagen hatte – im Scherz, wie er selbst behauptet –, dass Jimi doch locker The Who mit ihrer Instrumentenzerstörung auf der Bühne die Show stehlen könnte, indem er seine Gitarre in Brand setzte. Und am Nebentisch saß Zoot Money, der R&B-und-Blues-Veteran: Jimis erste Anlaufstation, nachdem er in London angekommen war.
Dann ließ Ron Pluckrose, mein Milchmann in Nordlondon, so nebenbei fallen, dass er in seinem früheren Leben als Maler und Raumausstatter einmal zusammen mit seinem Bruder eine Wohnung am Marble Arch renoviert habe, die Jimi von den Walker Brothers gemietet gehabt habe. »Er wollte alles schwarz gestrichen haben, sogar den wunderschönen Walnuss-Kleiderschrank im Schlafzimmer. Der Teppich war gelb und die Bettlaken orange, im ganzen Badezimmer war die Fanpost verstreut, und er hatte einen ganzen Wandschrank voller Goldener Schallplatten, die wir für ihn an die Wand hängten. Er war ein feiner Kerl …«
Daraufhin hörte ich mir noch einmal »All Along the Watchtower« an und gab jeden Widerstand auf.
EINS: »Er konnte die Musik hören, aber er hatte kein Instrument, um sie zu sich auf die Erde zu holen«
Zwischen Jimis Geburtsort und meiner eigenen Kindheit gibt es eine Verbindung, auch wenn sie eher indirekt ist. Nachdem William, der Ehemann meiner Großmutter, ein Kapitän, im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs gefallen war (das Schiff, das er befehligte, wurde von einem deutschen Torpedo in der Irischen See versenkt), wanderte sie nach Seattle zu ihrer Schwester Gwen aus. Sie nahm meinen Vater Clive mit, damals vier Jahre alt, seinen sechsjährigen Bruder Phil und die beiden Teenager, die aus Williams vorheriger Ehe stammten, einen Jungen namens Calver und ein Mädchen, das Iris hieß. Sie überquerten den Atlantik auf einem amerikanischen Linienschiff, auf dem es zum Frühstück »so viele Pflaumen gab, wie man essen konnte, für nur zehn Cent«, wie meine Großmutter immer wieder gern erzählte.
So, wie sie das Seattle des Jahres 1918 schilderte, klang es, als ob es mitten in der Wildnis gelegen hätte. Nicht weit vor der Stadtgrenze gab es Wälder, in denen sich Bären über Picknickkörbe hermachten, ganz wie Yogi und Boo Boo in der Zeichentrickserie von Hanna-Barbera (»wir mussten im Auto sitzen bleiben und konnten nur zusehen«). Mit den Kindern besuchte Großmutter ein Indianerreservat – zu meiner Enttäuschung konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, welcher Stamm es gewesen war – und kaufte dort Wildlederjacken mit Fransen und weiß-blauen Perlenstickereien, die sie zusammen mit den Erinnerungsstücken aus Großvater Normans Marinekarriere über lange Jahre aufhob. Von der Stadt selbst waren ihr hauptsächlich der ewige Dauerregen und die Hügel in Erinnerung geblieben, die so steil waren, dass die damals allgegenwärtigen Ford Model T, auch bekannt als »Tin Lizzy«, sie nur im Rückwärtsgang, dem Gang mit der kraftvollsten Übersetzung, erklimmen konnten.
Während meiner Zeit als Korrespondent der Sunday Times reiste ich quer durch die USA, nach Seattle kam ich dabei aber nur einmal, 1973, als ich auf Tour mit der Soul-Diva Roberta Flack war. Erst da dämmerte es mir, dass »Seattle, Washington« nicht bedeutete, dass es um die Ecke vom Weißen Haus lag, sondern dass der Bundesstaat Washington gemeint war, ganz im Nordwesten an der Grenze zu Kanada. Ich war nur einen Abend in Seattle, die Zeit reichte nicht groß zum Sightseeing, von der Einschienenbahn mal abgesehen, die nun all die Hügel verband, über die sich vorher die ganzen T-Modelle im Rückwärtsgang hatten quälen müssen. Ich kann mich aber daran erinnern, wie groß der Unterschied zwischen den amerikanischen und kanadischen Nachrichtensendungen war, die ich mir im Hotelfernseher ansah: Erstere standen immer kurz vor dem Umkippen in die Hysterie, während die Berichterstattung der Kanadier eher von einer gewissen Besonnenheit geprägt war, ganz wie es das britische Erbe vermuten lassen würde.
Bing Crosby, neben Frank Sinatra und Elvis Presley einer der bekanntesten Sänger des 20. Jahrhunderts, wurde in Seattles Nachbarstadt Tacoma geboren. Ansonsten ist Seattle bekannt als eine der niederschlagsreichsten Städte in Nordamerika, als ursprünglicher Standort der Boeing-Flugzeugwerke, Schauplatz der TV-Serie Frasier, Geburtsort des Microsoft-Gründers Bill Gates und der Kaffeehauskette Starbucks. Und auch die wenigen erfolgreichen Popmusiker, die die Stadt vor dem Durchbruch des Grunge hervorgebracht hat – The Ventures, Judy Collins, die Frauenband Heart –, könnte man in Anlehnung daran durchaus als »Flat White« bezeichnen.
Im Allgemeinen herrscht die Auffassung, dass Seattle wenig zur Geschichte der schwarzen Musik beigetragen habe – dass dieses unschätzbare Geschenk an die Menschheit ausschließlich Städten wie New Orleans, Memphis, Chicago und den unerbittlichen Baumwollfeldern des Mississippi-Deltas zu verdanken ist.
Aber sie vergessen Jimi dabei.
Es war zu Seattles Zeit der Tin Lizzies und Bärenpicknicks, als eine rein schwarze Varietéshow mit dem Namen Great Dixieland Spectacle durch die Stadt kam. Selbst in der romantisierten Fantasiewelt »Dixieland« durfte schwarz nicht zuschwarz sein. Tänzerinnen wurden nach ihrem Hautton ausgewählt, der einer weißen Postkarte entsprechen musste, die man neben ihr Gesicht hielt. Unter den Tänzerinnen war Jimis Großmutter väterlicherseits, Zenora Hendricks, die ihre hellere Pigmentierung zum Teil ihrer Urgroßmutter, einer Cherokee-Indianerin, zu verdanken hatte.
Auch Zenoras Ehemann Bertran, der bei der Truppe als Aufbauhelfer arbeitete, hatte helle Haut, aber aus Gründen, die man damals besser für sich behielt: Er war das uneheliche Kind einer ehemaligen Sklavin und des weißen Kaufmanns, in dessen Besitz sie gewesen war. Solche Beziehungen waren seit dem Bürgerkrieg als »Rassenmischung« geächtet, und sie erfüllten in den meisten Bundesstaaten, im Süden wie im Norden, den Tatbestand einer schweren Straftat.
Nach Ablauf ihres Seattle-Engagements beim Great Dixieland Spectacle entschieden sich Bertran und Zenora, ihr Wanderleben aufzugeben, sich in der Stadt niederzulassen und dort Kinder zur Welt zu bringen. Aber bereits nach einem Sommer änderten sie ihre Meinung und zogen über die Grenze nach Vancouver, Kanada. Vancouver war damals eine überwiegend »weiße« Stadt, in der es keine Beschäftigung für schwarze Tänzerinnen oder Bühnenhelfer gab. Das Showgeschäft schien sich damit für das Paar, das seinen Familiennamen mittlerweile in »Hendrix« umgeändert hatte, erledigt zu haben.
Das jüngste ihrer vier Kinder, James Allen, immer nur Al genannt, kam 1919 auf die Welt, ein gesundes, kräftiges Kind, dem jedoch an jeder Hand ein zusätzlicher Finger wuchs. Noch zu jener Zeit herrschte der Aberglaube, solche angeborenen Fehlbildungen seien ein Zeichen, dass das Kind vom Teufel besessen sei, und der arme Säugling wäre noch gar nicht lange zuvor in aller Heimlichkeit erstickt worden. Statt zum Kindesmord riet man aber zu einer Art Do-it-yourself-Amputation: Zenora sollte die überflüssigen Finger mit Seidenschnüren abbinden und ihnen damit die Blutzufuhr entziehen, bis sie abfielen. Das taten sie auch, allerdings wuchsen sie als kleinere verschrumpelte Stümpfe nach, an denen sogar kleine Fingernägel auszumachen waren.
Al war klein gewachsen, muskulös und aggressiv, das genaue Gegenteil seines großen, gertenschlanken und sanften zukünftigen Sohnes. Al zeigte früh seine tänzerische Begabung, doch nur ein einziges Mal war ihm das Rampenlicht vergönnt, bevor sein zukünftiger Sohn Berühmtheit erlangte: als ihn eine Zeitung beim Jitterbug-Tanzen bei einem Konzert von Duke Ellington fotografierte. Sein Körperbau und sein wenig konfliktscheues Wesen wiesen ihm unweigerlich den Weg in den Boxring. Er hatte ein paar Kämpfe als Weltergewicht, verdiente aber nie genug, als dass sich die Quälerei für ihn gelohnt hätte. Als ihm auch noch der Job bei der kanadischen Eisenbahn, auf den er gehofft hatte, verwehrt blieb, suchte der erlebnishungrige Al sein Heil auf der anderen Seite der Grenze, in der Stadt, in der seine Eltern kurz gelebt hatten.
Im Seattle der ausgehenden 1930er-Jahre fand sich wenig vom offenen, brutalen Rassismus des von den »Jim Crow«-Gesetzen geprägten amerikanischen Südens. Die afroamerikanische Bevölkerung lebte vorwiegend im Central District, der sich auf etwa zehn Quadratkilometer ausdehnte, ein eher multikulturelles Viertel, in dem auch Juden, Filipinos und Japaner wohnten. Der Central District war wie eine kleinere, verregnetere Version von New Yorks Harlem, hatte seine eigenen Zeitungen, Restaurants und eine Reihe von Musikclubs in der Jackson Street, zu denen der berühmte Rocking Chair zählte, in dem der junge Ray Charles entdeckt wurde, nachdem er aus Florida zugezogen war. Rassendiskriminierung drückte sich eher subtil aus: Die schwarzen Bewohner des Central District lebten in den heruntergekommensten Häusern, und wie im Rest des Landes standen ihnen nur Beschäftigungsmöglichkeiten als Handwerker oder Hilfsarbeiter offen.
1940 arbeitete der 21-jährige Al in einer Eisengießerei, als er bei einem Konzert von Fats Waller die umwerfend hübsche Highschool-Neuntklässlerin Lucille Jeter kennenlernte. Sie hatten einiges gemeinsam: Auch die 16-jährige Lucille war Nachkommin von Sklaven und Cherokee-Indianern, aber vor allem war es ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Tanzen, die dazu führte, dass sie bald zusammen in den Federn landeten.
Im Dezember 1941 erfolgte Japans Überraschungsangriff auf Pearl Harbor, der zum Eintritt der US-Streitkräfte in den Zweiten Weltkrieg führte. Al, der mittlerweile in einem Billardsalon arbeitete, wurde klar, dass er bald eingezogen werden würde, und da Lucille schwanger war, beschloss er, schnellstmöglich zu heiraten. Die Hochzeit fand im März 1942 statt, drei Tage später ging Al zur Army, die ihn umgehend verlegte, und seine junge Braut kehrte an ihre Highschool zurück.
Ein ganzes Jahr lang kam nichts von Als Armeesold bei Lucille an. Sie war gezwungen, die Schule abzubrechen und sich Jobs in den Bars und Amüsierschuppen entlang der Jackson Street zu suchen. Sie hatte eine gute Stimme, trat als Sängerin auf, und manchmal arbeitete sie als Bedienung, bis ihre fortgeschrittene Schwangerschaft das unmöglich machte. Das einst so unschuldige Mädchen fand Geschmack am Alkohol, der sich bald zur Sucht entwickelte.
Am 27. November 1942 brachte sie im Harborview Hospital in Seattle einen Jungen zur Welt. Al, der mittlerweile in Fort Rucker, Alabama stationiert war, wurde die Erlaubnis verweigert, sein Kind zu sehen, man steckte ihn sogar ins Militärgefängnis, um zu verhindern, dass er sich unerlaubt von der Truppe entfernte. Kurz darauf wurde sein Regiment in den Pazifikraum verlegt, er war auf Fidschi, bis er ein Foto seines Erstgeborenen zu sehen bekam.
Al beschwerte sich, dass Lucille ihm zu selten schrieb, während er in der Fremde für sein Land kämpfte (in einer gefährlichen Kampfzone befand er sich allerdings nie). Man muss ihr jedoch zugutehalten, dass zum Leben als alleinerziehende minderjährige Mutter noch ganz andere Probleme dazukamen. Ihr Vater war gestorben, was bei ihrer Mutter zum Rückfall in eine psychische Erkrankung führte, und das Haus, in dem die Familie lebte, war in Flammen aufgegangen, sämtliche Besitztümer waren darin verbrannt. Der Krieg hatte den Anteil der männlichen schwarzen Bevölkerung in Seattle stetig anschwellen lassen: Männer, die auf den Militärbasen, die in Erwartung eines japanischen Seeangriffs errichtet worden waren, Dienst leisteten oder auf den Werften am Puget Sound arbeiteten. Wegen Als ausbleibender Zahlungen und der fehlenden Unterstützung durch seine Familie, der ihr nächtliches Leben auf der Jackson Street missfiel, war Lucille darauf angewiesen, sich finanzielle Hilfe bei anderen Männern zu holen, und sie musste den Preis dafür bezahlen.
Es dauerte nicht lange, bis Al die ersten Briefe erreichten, unterschrieben mit »ein Freund«, die ihn von der Untreue seiner Frau und ihrem Versagen als Mutter in Kenntnis setzten, das anscheinend so dramatisch war, dass sich bereits ein anderes Paar um das Erziehungsrecht für ihren Sohn bemühte. Impulsiv, wie Al war, unternahm er keinerlei Anstrengungen, der Sache auf den Grund zu gehen, und leitete noch von seiner Militärbasis im Pazifik aus den Scheidungsprozess ein.
Als er schließlich nach Seattle zurückkehrte, war das Kind drei Jahre und befand sich – anscheinend dauerhaft – in der Obhut einer Frau namens Mrs Champ, die in Berkeley, Kalifornien lebte, fast 1300 Kilometer südlich von Seattle. Al machte sich sofort daran, seinen Sohn zurückzuholen, wobei er keinen Gedanken daran verschwendete, dass es für einen Dreijährigen womöglich ein einschneidendes und beängstigendes Erlebnis war, wenn er den Armen einer treu sorgenden Pflegemutter entrissen und von einem Fremden mitgenommen wurde.
Auch die lange Zugfahrt zurück nach Seattle brachte den lange abwesenden Vater und den verschreckten Sohn einander nicht näher. »Ich habe ihm seine erste Tracht Prügel im Zug verpasst«, erinnerte sich Al fast schon stolz in seiner Autobiografie, von der er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es einmal einen Grund geben würde, sie zu schreiben.
Bereits der Vorname des weinerlichen Knirpses sorgte bei dem Paar für Unfrieden. Ohne Al zu fragen, hatte sich Lucille für Johnny Allen entschieden, doch versuchte sie, dies so lange wie möglich vor ihm geheim zu halten. Das einzige Foto, das ihn auf Fidschi erreichte, war lediglich mit »Baby Hendrix« beschriftet.
Lucille hätte sich kaum einen Vornamen einfallen lassen können, der Al mehr in Rage gebracht hätte, denn John war auch der Vorname von John Page, einem Hafenarbeiter und angehenden Zuhälter, mit dem sie sich eingelassen hatte – und den Al im Verdacht hatte, der tatsächliche Vater des Kindes zu sein. Nachdem sie nach Seattle zurückgekehrt waren, ließ Al den Vornamen in James Marshall ändern, zurückgehend auf seinen eigenen offiziellen Vornamen und den Zweitnamen seines verstorbenen älteren Bruders Leon.
Sehr zu Als Verärgerung weigerte sich der ansonsten sanftmütige und fügsame Junge beständig, auf seinen Namen zu hören, und reagierte weder auf James noch auf Jimmy. Er bestand darauf, Buster genannt zu werden, nach Buster Crabbe, dem Schauspieler, der sowohl Tarzan als auch Flash Gordon verkörpert hatte. Schließlich gab Al es auf, seine Namensvorstellung durchzusetzen, und es blieb bei Buster.
Sehr viel schwieriger war zu verkraften, dass der Junge Linkshänder war, was vielen Leuten ähnlich als Teufelswerk erschien wie eine Überzahl von Fingern. Dass zu seinen eigenen verkümmerten Fingerstummeln nun noch ein zweites Stigma hinzukommen sollte, macht Al Angst. Er stellte sich dem Problem auf die einzige Art, die er kannte: Er verkündete, sollte Buster jemals dabei erwischt werden, die »böse« Hand zu benutzen, könne er sich auf eine saftige Ohrfeige gefasst machen.
Trotz des Namensstreits und John Page hatten sich Al und Lucille entschieden, ihrer Ehe noch einmal eine Chance zu geben. Aber der frisch ausgemusterte Soldat fand wenig Gefallen am häuslichen Alltag, und der Stammbesucherin vieler Etablissements auf der Jackson Street ging es da nur unwesentlich anders. Ihr Zusammenleben bestand bald aus einer nicht enden wollenden Abfolge von alkoholgeschwängerten Partys, die nicht selten im Streit, mit viel Geschrei und dem Verschwinden von Lucille endeten, die manchmal Stunden, manchmal Tage oder gar Wochen nicht mehr nach Hause kam. Für das zaghafte, verängstigte Kind dieser Beziehung hätte man sich kaum einen unpassenderen Namen als Buster vorstellen können.
Indem sie unter Verwendung von Briefen, Notizen und Tagebucheinträgen Jimi selbst zu Wort kommen lässt, wird die Netflix-Dokumentation Voodoo Child, zusammengestellt aus Filmschnipseln, Livemitschnitten, Fernsehbeiträgen und Interviews aus seinen hektischen letzten vier Lebensjahren, zu einer Art Autobiografie. James Browns einstiger Bassvirtuose Bootsy Collins, der ihm äußerlich ähnelte und die gleiche sanfte, einschmeichelnde Art hat zu sprechen, leiht ihm darin die Stimme.
Nirgendwo äußert Jimi auch nur die leiseste Kritik an seinem Vater oder an seiner Erziehung, es lässt sich jedoch einiges zwischen den Zeilen lesen.
»Dad war sehr streng und vernünftig, aber meine Mutter hat sich gern schön angezogen und amüsiert. Sie hat viel getrunken und nicht gut auf sich aufgepasst, aber sie war ziemlich groovy … Meistens hat sich mein Dad um mich gekümmert. Er hat mir beigebracht, dass ich den Älteren jederzeit Respekt entgegenbringen muss. Ich durfte nicht reden, bis ich von den Erwachsenen angesprochen wurde. Deshalb war ich immer still. Aber ich habe eine Menge gesehen. Ein Fisch bekommt keine Schwierigkeiten, wenn er seinen Mund nicht aufmacht. Ich kann mich erinnern, als ich erst vier war, habe ich mir mal in die Hose gemacht … Darauf habe ich mich stundenlang in den Regen gestellt, bis ich überall nass war, damit meine Mom nichts merkt.«
1948 bekam Lucille einen zweiten Sohn, dessen Namensfindung ohne Kontroversen ablief: Er wurde Leon getauft, nach Als Bruder. Weder im Aussehen noch im Temperament konnte ihm eine Nähe zu einem gewissen Werftarbeiter vorgehalten werden, er glich exakt seinem Vater. Deshalb erfuhr er eine Vorzugsbehandlung, die Buster nie erlebt hatte oder erleben würde. »Er war immer ein braver Junge, still, hat nie widersprochen, war ruhig«, erinnert sich Leon. »Ich war derjenige, der sich gegen die Autorität aufgelehnt hat. ›Bodacious‹ (unverfroren) war das Wort, das mein Vater für mich gebraucht hat.« Beide Jungs wussten: Wenn man Al verärgerte, gab es Schläge, eine »Abreibung«, wie sie es nannten, mit seinem dicken Ledergürtel.
Lucille brachte weitere Kinder zur Welt, aber sie war so oft und so lange in unbekannten Gefilden verschwunden, dass Al für keines der Kinder die Vaterschaft anerkannte. Obwohl Buster und Leon gesund und kräftig zur Welt gekommen waren, war es nun, als ob sich ein Fluch über die Familie gelegt hätte. Der dritte Sohn Joseph wurde ein Jahr nach Leon mit einer Gaumenspalte, einem verkrüppelten Fuß, unterschiedlich langen Beinen und einer doppelten Zahnreihe geboren. Tochter Kathy, eine Frühgeburt, folgte 1950. Sie wog nur ein Pfund und war blind. Da das Maß, das sie an Pflege bedurfte, die Kräfte und die finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern überstieg, wurde sie umgehend in staatliche Betreuung übergeben.
Inmitten des wirbelnden Chaos um sie herum wurde Buster zur einzigen Bezugsperson und zum Schutzschild für Leon. Oft genug nahm er die Schuld für eine Missetat seines kleinen Bruders und damit die Schläge an seiner Stelle auf sich. Während der heftigen alkoholisierten Auseinandersetzungen ihrer Eltern suchten sie Zuflucht im Wandschrank, Buster schlang seine Arme schützend um Leon. »Er hat Tag für Tag die ganze Negativität in sich aufgesogen«, erinnert sich Leon, »und weil er selbst niemanden hatte, an den er sich wenden konnte, lernte er, seine Gefühle tief in seinem Innersten zu vergraben.«
Al und Lucille ließen sich 1951 scheiden. Al bekam das Sorgerecht für Buster, Leon und den bedauernswerten Joe. Lucille kehrte geradezu zwanghaft immer wieder zu ihrem geschiedenen Ehemann zurück, weitere Kinder ließen nicht lange auf sich warten, und immer wieder verweigerte Al die Anerkennung der Vaterschaft. Auch der vermeintliche Fluch blieb ungebrochen: Die zweite Tochter Pamela, die im Jahr der Scheidung zur Welt kam, hatte ebenfalls Geburtsfehler, die zwar nicht so schwerwiegend waren wie die ihrer nächstälteren Geschwister, aber nichtsdestoweniger die Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung nötig machten. Ebenso erging es Al junior, der 1953 geboren wurde. Bald darauf konnte Al die Kosten für Joes Pflege nicht mehr aufbringen. Joe folgte seinen drei Geschwistern in eine Pflegeeinrichtung, wobei der Unterschied darin bestand, dass Buster und Leon dieses Mal mitansehen mussten, wie er mitgenommen wurde.
Al hatte zu kämpfen, wollte er seine beiden verbliebenen Schützlinge mit körperlicher Arbeit durchbringen. Er wuchtete Tierkadaver in Schlachthäusern, fegte im Stahlwerk, zapfte Benzin. Selten brachten ihm die Handlangertätigkeiten mehr ein als 90 Dollar im Monat, er hatte aber die Hoffnung nicht aufgegeben, Elektriker werden zu können, und besuchte einen von der Regierung finanzierten Lehrgang für Veteranen. Die drei kamen bei diversen Verwandten und Freunden unter oder in billigen Absteigen und Kurzzeit-Mietverhältnissen in den trostlosen Sozialbauten des Central District. In der Regel mussten sie nach ein paar Wochen wieder umziehen. Es war, so beschreibt es Leon Hendrix, »wie ein andauernder Campingurlaub«.
Wenn Al nicht arbeitete, zog er um die Häuser, trank, jagte den Frauen nach und spielte – manchmal verlor er den ganzen Wochenlohn bei einem einzigen Würfelspiel –, während die Jungen sich selbst überlassen waren. War Al flüssig, bezahlte er jemanden, der nach ihnen schaute und für sie kochte, aber meistens waren sie auf die Wohltätigkeit ihrer Nachbarn angewiesen. »Die schwarzen Ladys und die jüdischen Damen im Central District haben uns irgendwie adoptiert«, erzählt Leon. »Mrs Weinstein hat uns Matzeknödelsuppe gekocht, Mrs Jackson hat uns Hühnchen gebraten mit Kartoffelbrei, und Mrs Wilson, die einen kleinen Laden betrieb, hat unsere Klamotten gewaschen und darauf geachtet, dass wir auch mal in die Wanne kamen.«
Dadurch, dass Lucille immer wieder zu Al zurückkehrte, nährte sie die Illusion, die Familie werde wieder zusammenfinden. Sie kam meistens nachts, Buster und Leon wurden am nächsten Morgen wach, weil der Duft von gebratenem Speck oder ihrer Spezialität Hirn mit Ei in der Luft lag. Trotz ihrer Trinkerei war sie stets nett und liebevoll zu Buster und Leon, ohne einen von ihnen zu bevorzugen. Sie fehlte den beiden sehr.
Leon folgte seinem Bruder überallhin, es war ein Leben ohne elterliche Aufsicht, ohne dass jemand ihnen Grenzen setzte. Einmal spielten sie auf den Eisenbahngleisen. Leon blieb mit einem Schnürsenkel in den Schienen hängen, als ein Zug heranrauschte. Buster konnte ihn gerade noch wegzerren, Sekunden später hätte ihn der Zug erfasst. »Und er hat mich vor dem Ertrinken gerettet, als ich in den Green River gefallen bin. Ich weiß nur noch, dass ich im Wasser gestrampelt habe und ein totes Schwein vorbeigetrieben wurde. Dann ist er reingesprungen und hat mich auf eine Sandbank gezerrt.«
Die permanenten Umzüge ihres Vaters bedeuteten für Buster, dass er ständig die Schule wechseln musste und nie Zeit hatte, sich irgendwo einzugewöhnen. In der Folge blieben seine Noten bestenfalls mittelmäßig, obwohl er das Wissen begierig aufsaugte. »Ich habe nie gesehen, dass er ein Buch liest«, erinnert sich Leon, »aber trotzdem konnte er dir was über sämtliche Planeten des Universums erzählen.« Er hatte künstlerisches Talent und verbrachte Stunden damit, Ritter, Rennautos, Footballspieler oder Karikaturen zu zeichnen (wobei er immer darauf achtete, dass Al ihn nicht dabei erwischte, wie er die »böse Hand« benutzte). Vielleicht hätte er den gleichen Weg eingeschlagen wie die talentierten, aber undisziplinierten jungen Engländer John Lennon, Keith Richards und Eric Clapton – doch anders als diese hatte er keinen Lehrer, der sein Talent erkannte und ihn ermutigte, eine Kunstschule zu besuchen.
Von früher Kindheit an erwies Buster sich als der geborene Athlet, der sehr schnell sprinten konnte und deshalb im Baseball wie im Football gleich gut aufgehoben war. Selbst während er Sport trieb, behielt er stets Leon im Auge, der auf dem Platz nebenan für die Little League spielte. Die Kindheitsfotos, auf denen er am glücklichsten aussieht, zeigen ihn grinsend mit einem zu engen Footballhelm auf dem Kopf. Nichtsdestoweniger war er selbst beim Football immer gehemmt und schämte sich, weil er schäbige alte Sportklamotten auftragen musste. Die unbeholfenen Haarschnitte, die Al ihm verpasste, brachten ihm an der Schule den Spitznamen »Slick Bean« (geschniegelte Bohne) ein.
Wie die meisten einsamen Kinder liebte er Tiere. Er brachte immer wieder streunende Hunde mit nach Hause, die ihm auf der Straße nachgelaufen waren, und flehte Al an, sie behalten zu dürfen. Doch Al hatte keinerlei Interesse daran, noch ein weiteres hungriges Maul stopfen zu müssen, und noch dazu war die Aufnahme eines Tiers in den häufig wechselnden Unterkünften meistens unmöglich. Ein Straßenköter, der »Prince Buster« getauft wurde, hatte dann doch Glück und durfte bleiben. Besonders wilde Tiere faszinierten Buster, vor allem die Hirsche, die er manchmal in den weitläufigen Nationalparks von Washington und British Columbia beobachten konnte und zu denen er eine fast spirituelle Beziehung entwickelte – ganz so, als ob sich seine schlummernden Indianergene regen würden. In den lebhaften Träumen, die er jede Nacht hatte, tauchten regelmäßig die gleichen rätselhaften Zahlen auf: eins, neun und zweimal sechs. Das gab ihm »das Gefühl, dass ich zu etwas bestimmt war und ich die Chance bekommen würde, gehört zu werden«.
Ihr äußerlich verwahrloster Zustand führte zwangsläufig dazu, dass Seattles Fürsorgebehörden auf ihn und Leon aufmerksam wurden. Al hatte nur zu deutlich gemacht, dass sie im schlimmsten Fall ihren zwei Brüdern und zwei Schwestern in die staatliche Obhut folgen würden, wo man sie mit Sicherheit voneinander trennen würde. »Wir haben uns immer vor den Leuten vom Jugendamt versteckt«, erzählt Leon. »Wenn wir allein zu Hause waren, zogen wir die Vorhänge zu, ließen das Licht aus, und wenn jemand klopfte, öffneten wir nie die Tür.«
Obwohl sie nicht hungern mussten, konnten sie es sich nicht leisten, so wählerisch zu sein wie andere Jungen ihres Alters. »Wir aßen Pferdefleisch-Burger, weil die nur ’nen Nickel gekostet haben. Buster hatte einen Job, er machte in einer Metzgerei sauber, und einmal hat ihm der Metzger eine ganze Zunge mitgegeben.«
Weniger Stress und normalere Zustände erlebten die Jungen, wenn sie über die kanadische Grenze zu ihrer Großmutter Zenora nach Vancouver durften. Zu Buster war sie streng, versohlte ihm auch mal den Hintern, wenn er ins Bett gepinkelt hatte, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, welche emotionalen Gründe dahinterstecken könnten. Aber Zenora putzte ihn auch heraus und zog ihm eine mexikanische Jacke mit Fransen an, die er sehr mochte. Sie erzählte ihm Geschichten aus ihrer Zeit bei den Minstrel Shows, von seiner Urgroßmutter, die noch Sklavin gewesen war, und seiner Ururgroßmutter, der Cherokee-Indianerin. Jahre später strickte er daraus das Märchen, dass Zenora Cherokee gewesen sei und dass er bei ihr im Reservat gelebt habe.
»Noch bevor er Musik gemacht hat, trug er sie schon in sich«, erzählt Leon. »Er hat Großmutter immer gesagt, dass er diese seltsamen Geräusche im Kopf habe, worauf sie ihm die Ohren mit Babyöl ausgetupft hat. Er konnte die Musik hören, aber er hatte noch kein Instrument, um sie zu sich auf die Erde zu holen.«
Er muss ungefähr zwölf gewesen sein, als er begann, mit dem Besenstil zur Musik im Radio zu mimen. »Er hat Luftgitarre gespielt, noch bevor überhaupt jemand gewusst hat, dass es so was gibt«, sagt sein Bruder. »Ich bin sicher, hätte er ein Klavier anstatt der Gitarre bekommen, wäre er eben ein großartiger Pianist geworden.«
Mittlerweile arbeitete Al als selbstständiger Landschaftsgärtner, wobei seine Nebenbeschäftigung darin bestand, Weggeworfenes einzusammeln und zu sehen, ob man nicht noch was davon zu Geld machen könnte. Seine Söhne mussten ihn dabei unterstützen. Eines Tages fand Buster auf einem Müllhaufen eine ramponierte Ukulele, an der nur noch eine Saite baumelte. Als erster Gedanke war, dass sie noch einige Dollar bringen würde, aber Buster flehte ihn an, sie behalten zu dürfen. Er entdeckte, dass sich die einzig verbliebene Saite spannen ließ, wenn er eine der Mechaniken am Kopfende drehte, und er ihr Töne entlocken konnte. Das Ergebnis faszinierte ihn so, erinnert sich Leon, dass er es mit allem probierte, was ihm in die Finger kam, von Gummibändern bis zu Schnüren, die er zwischen zwei Bettpfosten spannte.
1955 wurde er 13 und war damit alt genug, dass sich die Fürsorgebehörde nicht mehr als zuständig betrachtete. Der achtjährige Leon hingegen wurde abgeholt, unter großem Geschrei seinem Vater und seinem Bruder entrissen und in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Er erwies sich jedoch als zu widerspenstig, flüchtete aus mehreren Heimen oder wurde rausgeworfen und suchte stets den Weg zurück zu Al und Busters aktuellem Wohnsitz.
1955 war auch das Jahr, als Elvis Presley Amerika erschütterte, weil er der erste weiße Sänger war, der mit einer Körpersprache auftrat, die man nur von schwarzen Performern kannte. Schwarzer Rhythm & Blues, neu versehen mit dem Etikett Rock ’n’ Roll, brachte die weißen Teenager in Massen zum Ausrasten.
Der Rassismus schlug Elvis mit Macht entgegen. Er wurde beschimpft, ihm wurde vorgeworfen, er mache »Dschungelmusik« populär, die die weiße Jugend genauso verderben werde, wie es ihr mit der schwarzen schon gelungen sei.
Weil aber R&B-Songs wie Ivory Joe Hunters »Shake, Rattle and Roll«, Roy Browns »Good Rocking Tonight« and Little Richards »Tutti Frutti«, mit ihren kaum versteckten sexuellen (und in Little Richards Fall homosexuellen) Anspielungen, ein unbestreitbares kommerzielles Potenzial hatten, veröffentlichte man sie in verwässerten, leicht verdaulichen Coverversionen von weißen Künstlern wie Pat Boone und Ricky Nelson, die dann die Mainstream-Charts für sich einnahmen. Die lange Tradition, dass schwarze Musiker bestohlen wurden, erreichte einen nie gekannten Höhepunkt.
Buster war fasziniert von Elvis: von seiner schrill-bunten Kleidung, die aus der Countrymusic-Tradition kam, seinen angeblich »obszönen« Bewegungen und der Gitarre, die ein so wichtiges Element des explosiven Gesamtpakets war. An Footballspieler und Rennautos verschwendete er nun keinen Gedanken mehr und zeichnete stattdessen ein sorgfältiges Porträt von Elvis, umrahmt mit dessen Songtiteln wie »Blue Suede Shoes«, »Don’t Be Cruel« und »Parilized« (sic). Presleys hysteriegesäumte Konzerttour führte ihn auch in Sick’s Baseball Stadium in Seattle, aber weil der Eintrittspreis von 1,50 Dollar Busters Mittel bei Weitem überstieg, konnte er sich das Konzert nur von einem Hügel oberhalb des Stadions ansehen. Elvis war von dort oben nur als kleiner Farbfleck auszumachen, der ständig in Bewegung war. »Er hat mir zum Einschlafen immer Lieder von Elvis vorgesungen«, erinnert sich Leon. »Mein Lieblingssong war ›Love Me Tender‹.«
In den folgenden Monaten verließ das Glück Al Hendrix, wie so oft, mal wieder. Er hatte gerade genug zusammengekratzt, um sich die Anzahlung für ein kleines Haus leisten zu können, geriet aber schnell mit den Zahlungen in Rückstand. Das Haus ging an den Besitzer zurück, Al und Buster kamen in einer Pension unter, die von einer Mrs McKay geführt wurde. Dort fand Buster in einem Hinterzimmer eine alte Akustikgitarre, passenderweise eine Kay, die einst für den querschnittsgelähmten Sohn der Betreiberin angeschafft worden war und die sie für fünf Dollar verkaufen wollte.
Er bat seinen Vater, sie für ihn zu kaufen, aber der klamme Al weigerte sich standhaft, diese in seinen Augen völlig sinnlose Anschaffung zu machen. Bei seiner Tante Ernestine fand Buster mehr Gehör. Der einfühlsamen Frau war aufgefallen, welche positive Wirkung die Ein-Saiten-Ukulele auf ihn gehabt hatte, und weil sich Al immer noch nicht dazu bewegen ließ, gab sie ihm das Geld.
Von jenem Moment an, erinnert sich Leon Hendrix, war es vorbei mit dem Sport. Buster lebte nur noch für die Gitarre: »Er hat sie nie aus den Händen gegeben. Damals gab es den Film Johnny Guitar, in dem der Typ, der von Sterling Hayden gespielt wird, seine Gitarre immer und überall auf seinem Rücken mit sich rumschleppt. Mein Bruder tat es genauso. Er spielte im Bett, schlief ein mit der Gitarre auf der Brust, und sobald er aufwachte, fing er wieder an zu spielen. Um mich zu beschäftigen, während er übte, band er mir einen Stift ans Handgelenk, damit ich zeichnete oder Hausaufgaben machte. Das war für mich so wertvoll wie für andere die Uni.«
An Gitarrenunterricht war nicht zu denken, es gab nicht einmal jemanden, der Buster zeigen konnte, wie man die Gitarre stimmte. Ihm blieb nur übrig, in ein Musikgeschäft zu gehen und dort so lange verstohlen jede Saite eines ausgestellten Instruments anzuschlagen, bis er den Klang auf seine eigene Gitarre übertragen konnte. Danach war er auf das Radio angewiesen, dessen Klangwellen immer noch zweigeteilt waren: hier die schwarzen Sender, die R&B und Blues spielten, und dort die weißen, auf denen weich gespülter Rock ’n’ Roll zu hören war. Genau wie Chuck Berry hatte er außergewöhnlich lange, feingliedrige Finger, mit denen er ohne Anstrengung auch entlegene Bünde auf den hohen Saiten erreichen konnte. Sein Daumen war so groß, dass er damit fast die Höhe des Griffbretts abdecken konnte, und er setzte ihn beim Spiel von Akkorden und Läufen ein, statt ihn wie üblich auf der Rückseite des Halses ruhen zu lassen. Eine seiner ersten Showeinlagen war es, so zu tun, als ob ihm die Gitarre aus der Hand rutschte und er sie erst wieder »einfangen« müsste. Den Trick wiederholte er in allen seiner folgenden Shows. Ihm kam nie in den Sinn, dass er solche Spielereien überhaupt nicht nötig hatte.
Aus der Zeit der turbulenten Partys seiner Eltern erinnerte er sich an die Musik von Blues-Urgesteinen wie Muddy Waters, Elmore James oder Howlin’ Wolf, deren schroffe Bottleneck-Töne oft nur der Auftakt dafür waren, dass dann tatsächlich die Flaschen flogen. »Ich mochte Muddy am liebsten, als er nur die beiden Gitarren hatte, die Mundharmonika und Bassdrum«, sagte Jimi später, »so was wie ›Rollin’ and Tumblin’‹, dieser echt primitive Gitarrensound.«
Einer der Hauptvorwürfe der Rockgegner an Elvis und die in seinem Schlepptau nachfolgenden gitarrenschwingenden weißen Teenageridole war, dass sie ihre Instrumente lediglich als Bühnenrequisiten nutzten und sie deshalb neben der Obszönität auch noch der Hochstapelei schuldig seien. In Wirklich waren einige, Buddy Holly etwa oder Eddie Cochran und Charlie Gracie, fantastische Gitarristen, deren Riffs aber nichtsdestoweniger auch vom blutigsten Anfänger einigermaßen nachgespielt werden konnten. Während also der junge Eric Clapton in einem weit entfernten englischen Dörfchen von den schwarzen Blues- und R&B-Musikern lernte, schaute sich Buster etwas bei den weißen Popmusikern ab – und zufällig hatten beide dabei eine Gitarre der Marke Kay in der Hand.
Auch als Gitarrist war Buster Linkshänder, und beim Üben war er deshalb ständig der Gefahr ausgesetzt, sich eine Ohrfeige von Al einzufangen. Immer wenn Al auftauchte, drehte er deshalb die Gitarre um und spielte sie verkehrt herum (ein Trick, auf den auch sein linkshändiger Zeitgenosse Paul McCartney zurückgreifen musste, um John Lennons Rechtshändergitarre spielen zu können). So konnte er die »Abreibung« vermeiden und bekam stattdessen nur einen Vortrag zu hören, dass er etwas Sinnvolles mit seinem Leben anstellen müsse. Al, der mittlerweile beachtliches Geschick im Umgang mit Rasenmäher und Gartenschere entwickelt hatte, ließ keinen Zweifel daran, was er damit meinte: Arbeit »mit den eigenen Händen«.
»Nicht dass ich darauf gehört hätte … na ja, er ist mein Dad«, ist die unendlich nachsichtige Stimme in der Voodoo-Child-Doku zu hören. »Ich denke nicht, dass mein Dad je geglaubt hat, dass ich es schaffen würde. Für ihn war ich der Junge, der immer alles falsch gemacht hat.«
Ob schwarz oder weiß, für die aufregendsten Sounds sorgten elektrische Gitarren, aber selbst das billigste Modell war für Buster immer noch astronomisch teuer. Wenn auch eine reguläre E-Gitarre fernab seiner Mittel lag, so gab es doch die Möglichkeit, einen Tonabnehmer an der Akustikgitarre zu befestigen, der mit einem Steckerkabel versehen war und damit an einen Verstärker angeschlossen werden konnte. Buster sparte sich den Tonabnehmer zusammen, aber für einen Verstärker fehlte natürlich das Geld: Die einzige Möglichkeit, die Gitarre zu verstärken, bestand darin, sie an den Plattenspieler anzuschließen, den sein Vater wie seinen Augapfel hütete.
Dies funktionierte aber nur dann, wenn Leon mit einem Finger das Kabel an die richtige Stelle hielt, was er auch treu immer tat, selbst wenn er sich den einen oder anderen leichten Stromschlag dabei einfing. Die Gitarre brachte den überforderten Einbaulautsprecher des Plattenspielers zum Kratzen und Dröhnen. »Nicht nur, dass wir auf einmal eine elektrische Gitarre hatten«, erinnert er sich, »jetzt kam dazu auch noch Verzerrung.«
Ihren häufigen Umzügen und dem unsteten Elternhaus geschuldet, bekamen die Jungs sehr selten eine Kirche von innen zu sehen. Buster entging daher die musikalische Früherziehung, die fast jeder nennenswerte afroamerikanische Musiker erfahren hatte, wie auch die Rock ’n’ Roller (sowohl schwarze wie weiße), denen man nun vorwarf, Handlanger des Teufels zu sein. Dass er nie in einem Gospelchor gesungen hatte, erklärte, warum er sich so komplett anders anhörte als die herkömmlichen Blues-, R&B- oder Soul-Sänger.
Trotzdem verdankte er der Kirche die erste Begegnung mit einer Persönlichkeit, die großen Einfluss auf seine spätere Karriere haben sollte. Eines Tages kam Leon völlig aufgeregt nach Hause und berichtete, er habe Little Richard gesehen, der Downtown einer langen schwarzen Limousine entstiegen sei. Tastenmann Richard, der gar nicht mal so klein war, hatte sich mit seiner von schrillen Kieksern und der schwer geschminkten, manierierten Bühnenpersönlichkeit geprägten Musik (seine größten Hits produzierte übrigens der in Seattle geborene Robert »Bumps« Blackwell) eine immens große weiße Zuhörerschaft erspielt. Kürzlich hatte er, sehr zum Erstaunen seiner Fans, verkündet, dass er aus dem Showbusiness aussteigen und sich als Prediger der Kirche zuwenden wolle.
Es stellte sich heraus, dass Richard eine Tante hatte, die die gleiche baptistische Pfingstgemeinde besuchte wie die Hendrix-Familie und dass er dort predigen wollte, um sich für seine neue Laufbahn aufzuwärmen. »Wir sind zweimal hingegangen, um seine Predigt anzuhören«, erzählt Leon. »Wir haben uns so fein herausgeputzt, wie es ging. Wir trugen weiße Hemden, die eigentlich grau waren, Socken, die nicht zueinanderpassten, und unsere Schnürsenkel waren so oft gerissen, dass wir sie zusammenknoten mussten. Die ganze Kirche hing an seinen Lippen, als er auf der Kanzel herumstolzierte, johlte, die Stimme erhob und von der Kraft des Allmächtigen predigte. Er erklärte, er habe erst vor Kurzem geträumt, dass er ein diamantenverziertes Flugzeug geflogen habe, aber damit abgestürzt und am Boden zerschellt sei … Für ihn war das ein eindeutiges Zeichen, dass Gott ihm sagen wollte, er müsse Prediger werden.« Für Buster hingegen war es die erste Lehrstunde im Showgeschäft.
Ihre Mutter hatten die Jungen da schon einige Monate nicht mehr gesehen. Lucille hatte erneut geheiratet, einen Werftarbeiter im Ruhestand namens William Mitchell, der dreißig Jahre älter war als sie. Jahrelanger Alkoholismus und Verwahrlosung zeigten bei Lucille nun Folgen. 1957 wurde sie zweimal wegen einer Leberzirrhose ins Krankenhaus eingeliefert. Al sprach selten von ihr, und wenn, dann immer abschätzig. Buster hasste es, wenn schlecht von ihr geredet wurde, aber er verbiss sich jeden Kommentar.
Im Frühjahr 1958 erfuhren sie, dass sie wieder im Krankenhaus lag, eingeliefert mit Hepatitis, nachdem man sie bewusstlos vor einer Kneipe aufgefunden hatte. Als sie Lucille im Harborview besuchten – wo Buster geboren worden war –, lag sie in einem Bett auf dem Gang. Man hatte es nicht einmal für nötig gehalten, ihr ein Zimmer zu geben. »Sie setzten sie in einen Rollstuhl«, weiß Leon noch, »sie war so blass, kalkweiß, es sah aus, als ob sie schwebte.«
Es war das letzte Mal, dass die Söhne sie sahen. Ein paar Tage später starb sie, erst 32 Jahre alt, an einem Milzriss. Für ihren Ältesten wurde ein Traum, den er als kleines Kind gehabt hatte, traurige Realität. Im Traum hatte er tatenlos zusehen müssen, wie sie von einer Kamelkarawane weggetragen wurde: »Es war eine lange Karawane, und die Schatten der Blätter haben sich auf ihrem Gesicht abgezeichnet. Du weißt schon, wie wenn das Sonnenlicht durch einen Baum fällt. Es waren grüne und gelbe Schatten. Und sie hat gesagt: ›Wir werden uns jetzt nicht mehr so oft sehen.‹«
Lucille wurde unter dem Nachnamen ihres Ehemanns Mitchell in einem Armengrab im Greenwood Memorial Park beigesetzt. Eigentlich hätte Al Buster und Leon in seinem Lieferwagen zur Beisetzung bringen sollen, aber er hatte sich vorher betrunken und verfuhr sich dermaßen, dass sie sechs Stunden zu spät dort eintrafen. Ihm fiel nichts anderes ein, um seine trauernden Söhne zu trösten, als jedem einen Schluck Whisky anzubieten, und dann die Flasche alleine zu leeren.
Wie immer behielt Buster seine Gefühle für sich, aber seiner Tante Delores entging nicht, dass er auf ihrer Terrasse weinte, wenn er sich unbeobachtet glaubte. Jahre später, in einem anderen, damals noch völlig unvorstellbaren Leben, schrieb er den Song »Castles Made of Sand« über eine junge Frau, deren Herz voller Zweifel war, die ihren Rollstuhl an den Meeresstrand bugsierte und ihre Beine anlächelte: Ihr könnt mir jetzt nicht mehr wehtun.
»Er hat unserem Dad nie verziehen«, sagt Leon, »dass er sich nicht besser um unsere Mama gekümmert hat.«
ZWEI: »Jimmy war schon ein Hippie, als noch niemand wusste, was ein Hippie ist«
Er war nicht der erste zukünftige Rock-Superstar, dem die Musik darüber hinweghalf, dass er die Mutter bereits im Teenageralter verloren hatte – was beinahe genauso tragisch ist, wie wenn die Mutter bei der Geburt stirbt.
Zwei Jahre zuvor war in Liverpool die Mutter des 14-jährigen Paul McCartney an Brustkrebs gestorben, und er fand Trost, als er in die Skiffle-Band des 16 Jahre alten John Lennon einstieg (dessen Mutter einige Wochen später bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen sollte). In einer anderen Ecke Englands, in Ripley, in der Grafschaft Surrey, hatte der 13-jährige Eric Clapton zwar nicht den Tod seiner Mutter zu beklagen, aber – was vielleicht noch schlimmer war – sie hatte ihn als Zweijährigen bei den Großeltern zurückgelassen und ließ ihn in dem Glauben aufwachsen, sie sei seine ältere Schwester, womit sie ihm einen emotionalen Schaden zufügte, den nur eine Kay-Gitarre und die schmerzgeprüften Stimmen amerikanischer Bluessänger zu lindern vermochten.
Aber der abgerissene 15-Jährige in Seattle, der sich immer noch Buster Hendrix nannte, hatte einen weiteren Grund, warum er unablässig zur Musik aus dem Radio übte. Jeder Erfahrung zum Trotz hoffte er immer noch, dass er so seinen Vater dazu bringen könnte, stolz auf ihn zu sein. Die Stimme des Erwachsenen in der Voodoo-Child-Doku spricht das aus, was er Al als Teenager nie zu sagen gewagt hatte: »O Daddy! Eines Tages werde ich berühmt sein. Ich werde es schaffen, Mann.«
Einige seiner Freunde besaßen nun schon richtige E-Gitarren mit flachem Korpus und zackiger Kopfplatte, die seine einst so geliebte Kay so veraltet wirken ließen wie ein Ford-T-Modell und ihn übertönten, wenn er mit ihnen jammen wollte. Tatsächlich hatte er mit der Gitarre so lange und verbissen geübt, sie so hart rangenommen, dass sie schon am Auseinanderfallen war. Wieder war es seine Tante Ernestine, die ihm zu Hilfe kam, indem sie bei jeder Gelegenheit ihrem Schwager ins Gewissen redete: »Du musst dem Jungen eine elektrische Gitarre besorgen!«
Schließlich ließ sich Al erweichen und stimmte zu, Buster zu Myers Music Store zu begleiten. Angesichts der Wand voller Instrumente knickte er aber wieder ein und murmelte etwas davon, dass alles unbezahlbar teuer sei. Dieser Vorgang wiederholte sich einige Male, bis er – Buster hatte die Hoffnung schon aufgegeben – schließlich doch zustimmte, die Anzahlung für eine auf 15 Dollar runtergesetzte »champagnerfarben« (»altweiß« würde es auch treffen) lackierte Supro Ozark zu leisten.