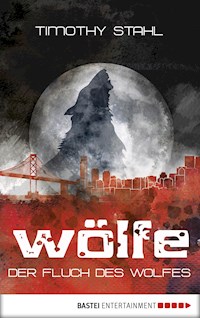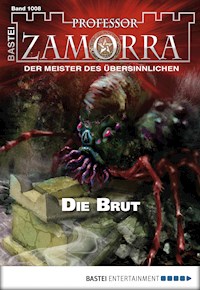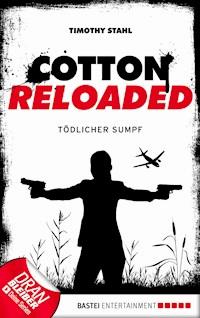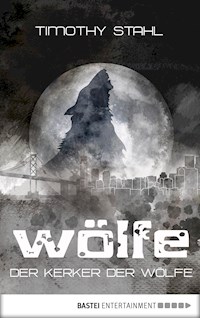1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Ein Mörder war aus dem berüchtigten Gefängnis im Dartmoor entkommen. Eigentlich kein Fall für einen Geisterjäger. Doch Curt Nayland war besessen, und mit seiner Flucht wurde eine Macht entfesselt, die das wahre Grauen nach Dartmoor brachte.
Da konnte nur noch einer helfen: ich, John Sinclair ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Im Dartmoor geht das Grauen um
Briefe aus der Gruft
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Néstor Taylor/Bassols
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-4907-8
„Geisterjäger“, „John Sinclair“ und „Geisterjäger John Sinclair“ sind eingetragene Marken der Bastei Lübbe AG. Die dazugehörigen Logos unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Die Figur John Sinclair ist eine Schöpfung von Jason Dark.
www.john-sinclair.de
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Im Dartmoor geht das Grauen um
von Timothy Stahl
Mit zusammengebundenen Hinterläufen hing die schwarze Katze an einem dünnen Seil kopfüber von der niedrigen Decke. Im Moment rührte sich das Tier nicht, nachdem es lange wie rasend gezappelt und gefaucht hatte. Jetzt schien es sich endlich damit abgefunden zu haben, dass es sterben sollte.
Unter der Katze stand auf dem feuchten Kellerboden eine Schüssel bereit, deren Metall im Schein der Kerzen rötlich schimmerte, als wäre es schon von Blut benetzt.
Wie blutverschmiert glänzte in dem schummrigen Licht auch die Klinge des Dolchs. Tatsächlich war sie jedoch blitzblank. Obwohl sie im Laufe von vielen hundert Jahren ungezählte Leben genommen hatte.
Die Hand, die den hölzernen Dolchgriff umfasste, drehte sich etwas. Ein Gesicht spiegelte sich auf der Klinge.
»Eigentlich würde ich lieber dein Blut trinken«, raunte der Dolch hinter der Stirn dieses Gesichts – und stieß zu!
24 Stunden vorher …
Das war es also.
Das Haus des Mörders.
Ein Auto stand davor. Seit einigen Minuten schon. Hinter dem Steuer saß ein regloser schwarzer Schemen. Die Scheinwerfer strahlten das Haus an.
Jetzt erloschen sie. Finsternis verschluckte das Haus. Eine Autotür ging auf und wieder zu.
Schritte näherten sich dem Haus. Die Eingangstür schwang knarrend nach innen und fiel zurück ins Schloss. Die Nacht war wieder still wie zuvor. Nicht einmal ein Käuzchen rief. Nebel tanzte. Am Himmel verbarg sich der fast volle Mond hinter Wolken.
In der Ferne schlug eine Kirchturmuhr Mitternacht. Ein leiser Wind trug die Glockenschläge über das Moor heran und wehte sie mitsamt seiner Kühle durch die zerbrochenen Fenster ins Haus hinein.
Hier hatte einst ein Mann gelebt, der achtzehn Mal getötet hatte. Mindestens. So viele Morde hatte man ihm nachweisen können. Alle seine Opfer hatte er auf die gleiche Weise umgebracht. Abgestochen. Aufgeschlitzt. Ausgeblutet. Immer mit derselben Waffe. Einem Dolch. Vermutlich. Denn gefunden hatte man ihn nie.
Bis heute nicht …
Schutt knirschte unter Sohlen. Der Lichtstrahl einer Taschenlampe focht wie eine weiße Klinge gegen die Dunkelheit.
Die Zimmer waren alle nahezu leer, das wenige Mobiliar entweder von selbst zusammengebrochen oder mutwillig zertrümmert.
Zwar lebte seit der Verhaftung des Mörders niemand mehr hier, ungebetene Gäste hatte es in der Zwischenzeit jedoch immer wieder gegeben. Unübersehbar. Die Wände waren beschmiert. Müll türmte sich, vom Wind zusammengefegt, in den Ecken.
In irgendeinem Zimmer rollte eine leere Flasche über den Boden.
Die Schritte in diesem Raum hielten inne. Der Gast, der heute gekommen war, lauschte mit angehaltenem Atem.
Nichts. Nur Stille.
Er pirschte weiter. Leise, als fürchtete er, womöglich doch nicht ganz allein zu sein.
Es war leicht, sich vorzustellen, wie im Laufe der Jahre immer wieder Jugendliche in das Haus eingestiegen waren. Als Mutprobe. Um sich selbst zu gruseln und einander mit schrecklichen Geschichten über den Mörder, der hier gelebt hatte, zu übertreffen.
Wenn sie die Wahrheit gewusst hätten! Und welch tödliches Geheimnis dieses Haus immer noch barg …
Hier musste es irgendwo sein.
Der Lampenstrahl wanderte über den Boden, die Wände. Die Tapeten waren feucht geworden und hatten sich gelöst. Stellenweise war der Putz abgebröckelt und nacktes Ziegelgemäuer zum Vorschein gekommen.
Da war es.
Das dreibeinige Tischchen, alt und unscheinbar. Genau wie er gesagt hatte. Und unversehrt war es, als hätte es über die Jahre keiner der zerstörungswütigen Rabauken entdeckt oder schützend eine unsichtbare Hand darüber gelegen.
Beides traf zu.
Der Besucher sammelte vernehmlich Spucke im Mund. Jetzt galt es, und es kam auf jede einzelne Silbe an. Ein falscher Ton und …
»Kasid gotha ank goi!«
Atemlose Stille. Nichts geschah.
Oje. Habe ich irgendetwas falsch …?
Und dann ging es so schnell, dass sich nicht sagen ließ, wie es geschah.
Auf einmal waren sie da, auf dem kleinen Tisch – das alte Buch, der lederne Einband rötlich braun und rau wie verkrustetes Blut, und darauf der Dolch. Die Klinge war nur daumenbreit und kaum länger als eine Männerhand.
Seit zwanzig Jahren lagen das Buch und der Dolch auf diesem Tisch. Ein dunkler Zauber, gewirkt in den Worten einer uralten Sprache, hatte sie vor allen Blicken und jeder Berührung bewahrt. Sowohl vor der Polizei als auch vor allen späteren Eindringlingen.
Jetzt war dieser Zauber aufgehoben, durch andere Worte derselben Sprache, die Unsichtbarkeit weggezogen wie ein Tuch.
Die Hand mit der Taschenlampe zitterte leicht. Der Schein brach sich flimmernd auf der Dolchklinge. Als blinzelte ein aus langem Schlaf erwachendes Auge ins Licht.
Dann beruhigte sich die Hand mit der Lampe, und die Klinge erstrahlte in ihrem Schein. Als freute sie sich, endlich wieder da zu sein.
Und so war es auch.
***
24 Stunden später war der Dolch vollends wach und wieder da – und er lechzte nach Blut!
Nur wollte er sich nicht mit der läppischen Menge einer Katze begnügen. Nein, der Dolch wollte das Blut des Menschen, dessen Hand ihn hielt. Und gegen den Willen dieses Menschen und die Kraft seiner Hand lehnte er sich deshalb auf.
Die Katze spürte, wie die Situation und die Energie im Raum umschlugen. Diese Unruhe erfasste auch das lethargisch von der Decke hängende Tier. Es fauchte von Neuem und zappelte wieder.
Unterdessen jagte der Dolch wie ein Blitz auf die nackte Brust des Menschen zu. In das Herz darin wollte er stoßen.
Die Klinge reflektierte die rosige Farbe der Haut, auf die sie zufuhr – bis sich die Faust, in der die Waffe lag, im letzten Moment als kräftiger erwies! Keine zwei Fingerbreit vor der Stelle, unter der das Herz lockend pulsierte, kam der alte Dolch abrupt zum Stillstand.
Noch im selben Augenblick begann er jedoch wie unter Strom stehend zu vibrieren. Weil ein Ringen begann – zwischen dem gierenden Dolch und der Hand, die ihn sich mit aller Kraft vom Leibe hielt.
Und der Mensch war stark. Der Dolch jedoch noch schwach nach der langen Zeit der Tatenlosigkeit und des Hungerns. Mit Worten einer fast ausgestorbenen Sprache schwächte ihn der Mensch noch weiter. Er las sie im flackernden Licht der Kerzen aus jenem Buch, auf dem der Dolch so lange geschlafen hatte. Eine Hexe hatte ihr Wissen darin niedergeschrieben, Geheimnisse und Zauber, die ohne dieses Buch längst in Vergessenheit geraten wären.
Der Dolch wünschte, sie wären vergessen! Dann könnten ihm diese magischen Worte jetzt nicht verwehren, wonach er sich verzehrte.
Wütend verwarf er den Versuch, sich in die nackte Brust zu versenken, und hackte stattdessen nach dem aufgeschlagenen Buch. Mitten hinein in die von Hand beschriebene Seite wollte er sich bohren. Doch beide Hälften des Buches klappten hoch, um sich wie die Kiefer eines Mauls um die Hand mit dem Dolch zu schließen!
Die Hand war um die entscheidende Idee schneller. Das Buch schnappte ins Leere. Reglos wie zuvor lag es da.
Fiebrig huschende Augen suchten die Stelle, an der sie im Lesen unterbrochen worden waren. Die Stimme hob neu an.
»Eh’ian uhtv!«
Die Klingenspitze ließ sich abermals nicht gegen die Katze richten. Wieder visierte sie eigenmächtig das schlagende Menschenherz an. Bis auf eine Handspanne gelang es ihr, sich diesem Ziel zu nähern, ehe sie bebend in der Luft verharren musste.
»Julg rodog!«
Die Katze gebärdete sich wie toll. Sie schaukelte an dem Seil hin und her und schlug mit den Pfoten in Richtung des Dolches, der darauf reagierte und nach der Katze zuckte.
»Hagn goi nahf!«
Die Hand um den Dolchgriff verlängerte den Stoß der Waffe nach dem Tier – und wurde von dessen Krallen getroffen. Die brennenden Furchen auf dem Handrücken füllten sich mit rot glänzendem Blut.
»Au, verdammt …«
Etwas von dem Blut versickerte zwischen den Fingern der Faust und netzte den Dolchgriff, um den sie sich ballte. Die Waffe leckte buchstäblich Blut und brach den Widerstand der Hand. Die Klingenspitze flirrte diesmal auf die Bauchdecke zu, ritzte die Haut und …
»Yagh nor nuh’hanm!«
Da packte die andere Hand zu. Wie eine Klammer legte sie sich um das Gelenk der Waffenhand, stoppte sie und bog sie zur Seite.
Dann eben anders, sagte sich der Dolch.
Willenlos wie eine ganz gewöhnliche Waffe ließ er sich auf einmal führen. Und schon wurde er nach der Katze gerammt, die bis vor ein paar Tagen noch auf einem Bauernhof in der Nähe Mäuse gefangen hatte, bis sie selbst gefangen wurde. Weil sie perfekt war – am gesamten Leib tiefschwarz, genau wie die Kräfte, die mit ihrem Blut und Leben beschworen und dienstbar gemacht werden sollten.
»Ph’agl ehye zor!«
Die Katze fauchte und entging der Klinge. Weil sie immer noch wie wild am Seil zappelte, pendelte sie nach rechts, und der Dolch stach links an ihr vorbei. Die Hand traf das Tier mit dem Knauf des Dolchs am Kopf. Daraufhin war es benommen, und die Finger der freien Hand bekamen es im Nacken zu fassen.
Die bloße Berührung schien die Kraftreserven der Katze zu wecken. Sie wand sich im Griff der Hand, als hätte sie keine Knochen, sondern Gummi im Leib. Sie schlug mit den Vorderpfoten um sich und hieb eine mit voller Kraft auf die rasiermesserscharfe Schneide des Dolches.
Tief schnitt die Klinge in den empfindlichen Ballen hinein. Blut quoll hervor, tropfte einesteils in die Schüssel auf dem Boden und rann andernteils über den Dolch.
»N’hag abunag idor! Ervefel’oguh!«
Immer noch ließ der Dolch scheinbar widerstandslos mit sich umspringen, während das Blut der Katze von seiner Klinge aufgesogen wurde.
»Dnalyan’truc!«
Der Dolch genoss das grausame Spiel mit der Katze. Er labte sich an ihrer Verzweiflung und ihrem Schmerz und fing das von ihrer Pfote spritzende Blut auf wie eine silberne Zunge. Und er wiegte die Hand in Sicherheit, gab dem Menschen das Gefühl, nun endgültig das Sagen zu haben.
Doch die Versuchung, tatsächlich nachzugeben, war beinahe übermächtig. Das Tier war so nah und schon verletzt … aber der Mensch war kaum weiter weg und so viel größer und köstlicher!
Und in der nächsten Sekunde geschah es endlich. Die Klinge fuhr hinein in warmes Fleisch. Sie badete in Blut und Leben.
Der Mensch schrie ein letztes Wort …
… und das Ritual erfüllte seinen Zweck.
Ziel war gewesen, eine Tür in diese Welt zu öffnen und etwas aus einem Zwischenreich herüberzuholen. Und das gelang auch: Es kam.
Aber es kam nicht allein.
***
Der Gefangene B212 schrie wie am Spieß.
»Der weckt uns noch den ganzen Laden auf«, schnaufte Charles Flanagan, Schichtleiter der Nachtaufsicht im Dartmoor-Gefängnis.
Eigentlich HM Prison Dartmoor. Berühmt-berüchtigt war diese Strafanstalt in der Grafschaft Devon immer noch. Obwohl sie mit dem Zuchthaus aus alten Romanen und Schwarz-Weiß-Filmen nicht mehr viel gemein hatte. 2002 wurde Dartmoor Prison in eine Justizvollzugsanstalt der Kategorie C umgewandelt. Seitdem saßen hier keine gewaltbereiten Schwerverbrecher mehr ein. Nur noch Gefangene, die nicht zur Flucht neigten. Im Klartext hieß das allerdings auch, dass sich hier keineswegs nur Waisenknaben tummelten.
Dieser brüllende Gefangene zum Beispiel, den Flanagan und sein Kollege mit vereinten Kräften aufs Krankenrevier geschafft hatten, der hatte einiges auf dem Kerbholz. Auch wenn er bei Gott nicht so aussah. Unscheinbar war er, ein Buchhaltertyp. Immer saß er nur da und guckte, als könnte er keiner Fliege etwas zuleide tun – und als hätte er nie und nimmer das Zeug dazu, sich gegen zwei im Umgang mit renitenten Häftlingen erfahrene Männer zur Wehr zu setzen …
»Chuck! Pennst du? Fass mit an!«
»Sorry, Jimmy.« Flanagan schüttelte den Kopf. »War in Gedanken …«
Sie wuchteten den sich windenden Gefangenen auf die einzige Liege im Raum. Jimmy hielt ihn fest, Flanagan legte ihm die Riemen an. Dann traten sie keuchend zurück.
Flanagan wischte sich Schweiß von der hohen Stirn. Er freute sich auf seinen näher rückenden Ruhestand. Auch wenn, zugegeben, Vorfälle wie dieser eher die Ausnahme waren. Sicher, er erinnerte sich noch gut an den Gefangenenaufstand im Jahr 1982. Da war er noch jung gewesen, hatte seinen Dienst in Her Majesty’s Prison Dartmoor gerade erst angetreten und war beinahe heiß gewesen auf so eine Sache.
»Menschenskinder, Chuck, was ist denn los mit dir?« Jimmy Flynn musterte ihn argwöhnisch. Die dunklen Augen saßen wie tief eingenähte Knöpfe in Jimmys Gesicht, das Ähnlichkeit mit einem zerknautschten Kissen hatte. »Träumst du immer noch?«
»Von besseren Zeiten, ja«, gab Charles, genannt Chuck, Flanagan zurück.
Der Gefangene B212 tobte immer noch, obwohl er nun mit Armen und Beinen ans stabile Bettgestell und zusätzlich durch breite Lederriemen über Brust und Becken gefesselt war.
Unterdessen setzte der diensthabende medizinische Assistent – Flanagan nannte sie ausnahmslos alle »Sani«, so brauchte er sich keine Namen zu merken – dem Mann eine Spritze, die wahrscheinlich irgendein Beruhigungsmittel enthielt. Hoffentlich brachte das etwas. Er hatte keine Lust, sich wegen dieses Zwischenfalls die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen. Wenn es ruhig blieb, konnte man in dieser Schicht nämlich durchaus auch mal ein Auge zutun.
Das Mittel half. Ein bisschen. Oder vielleicht verließen B212 auch einfach nur die Kräfte. Immerhin führte er sich inzwischen – Flanagan schob den Uniformärmel hoch und sah auf seine Uhr – seit gut einer halben Stunde auf, als wäre er grundlos irrsinnig geworden.
Zwischen Mitternacht und eins hatte es angefangen. Die Schreie aus der Zelle B212 drangen durch die Tür auf den Flur und brachen sich an den kahlen Wänden. Flanagan und Flynn waren angerückt und hatten erst einmal gehofft, dass der Gefangene nur einen schlimmen Albtraum hatte und sich schon wieder einkriegen würde. Den Gefallen tat er ihnen nicht.
Warum er so raste, ließ sich mit bloßem Blick nicht feststellen. Was er schrie und redete, war entweder gar nicht zu verstehen, oder es ergab einfach keinen Sinn. Flanagan hatte es schnell aufgegeben, mit ihm reden zu wollen, und bestimmt, ihn aufs Krankenrevier zu bringen. Natürlich wusste er, dass die längst nicht mehr so hieß, sondern medizinische Station. Aber auf seine »letzten paar Tage« gewöhnte er sich doch keine neuen Ausdrücke mehr an.
Leider hatte B212 sich dermaßen aufgeführt, dass Jimmy Flynn allein nicht mit ihm fertigwurde. Flanagan sah sich gezwungen, entweder Verstärkung zu alarmieren oder selbst mit anzufassen. Weil er die Sache nicht dramatischer machen wollte als nötig, entschied er sich für Letzteres. Direktor Sheasby und er waren ohnehin keine Freunde. Flanagan wollte ihm nicht unnötig Munition liefern, mit der ihm dieser Schnösel das Arbeitsleben auf die letzten paar Tage noch schwerer machen konnte …
»Sollen wir?«, fragte der Sani, dessen Hipster-Bart es fast unmöglich machte, sein Alter zu schätzen.
»Sollen Sie was?«, entgegnete Flanagan verdutzt.
»Dr. Jones anrufen, meint er«, half Jimmy aus und seufzte. »Kriegst du denn gar nichts mehr mit, Chuck?«
»Was redest du denn da?«, raunzte Flanagan.
»Miste Nayland möchte, dass wir Doktor Jones verständigen«, erklärte der bärtige Sani.
»Im Ernst?«, fragte Flanagan. »Ich versteh kein Wort von dem, was der Kerl vor sich hin brabbelt.«
»Ich hab dir doch gesagt, du solltest mal zum Ohrenarzt …«, begann Jimmy.
»Ach, hör auf. Das lohnt sich doch nicht mehr auf meine letzten paar Tage.«
Flanagan musterte den ans Bett gefesselten Häftling. Curt Nayland hieß der Mann. Echt ein komischer Typ. Nicht im Sinne von »Ha-ha-komisch«. Ein besonderer Fall eben. Die Ruhe, die er für gewöhnlich hatte, war auf ihre Art genauso unheimlich wie dieser Anfall jetzt. Sie musste ihm auch geholfen haben, in ein Gefängnis der Kategorie C verlegt zu werden. Angesichts dessen, was er draußen angestellt hatte, hätte Curt Nayland nämlich in ein tiefes, dunkles Loch gehört. Für immer.
»Also?«, hörte Flanagan den Sani fragen.
Naylands Augen sahen ihn an. Es flackerte darin. Seine Lippen bewegten sich.
Der Mann hatte Angst. Dieser kaltblütige Mörder schien um sein Leben zu fürchten.
»Holt … Doktor Jones«, flüsterte es aus Naylands Mund. Sein Blick wurde fast schmerzhaft bohrend.
Flanagan schauderte. Überlegte. Und war schließlich einverstanden: »Okay.«
***
Die Hände in den Hosentaschen, stiefelte Flanagan im Schein des Vollmonds über den nächtlichen Gefängnishof zum Tor, um Dr. Jones in Empfang zu nehmen. Nebel wollte vom Hochmoor draußen über die Mauern hereinklettern. Ein Schleier aus kühlen Tröpfchen legte sich auf sein Gesicht. Er fröstelte. Kategorie C hin oder her, und ganz egal, wie lange er schon hier arbeitete: In Nächten wie diesen war das Dartmoor Prison für Chuck Flanagan immer noch der unheimlichste Ort der Welt.
»Mister Flanagan, guten Abend!«
Zwei dunkle Gestalten traten hervor unter dem Torbogen, durch den der Weg hinaus in die Freiheit führte.
»Doktor Jones, ich grüße Sie«, erwiderte er und nickte der zierlicheren Gestalt zu. »Entschuldigen Sie die späte Störung …«
»Schon gut. Notfälle kennen eben keine Uhrzeit.«
»Trotzdem vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich weiß doch, wie viel Sie zu tun haben«, sagte Flanagan. »Sie beackern hier in der Gegend ein riesiges Gebiet als Allgemeinärztin und stellen sich obendrein noch für unsere Anstalt zur Verfügung. Ein solches Engagement ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.«
Dr. Thea Jones hob lächelnd die Schultern und blies sich eine dunkle Haarsträhne aus der Stirn. »Irgendjemand muss die alten Tugenden ja wieder aufleben lassen, nicht wahr?«
»Da sagen Sie was.«
Flanagan nickte dem Kollegen zu, in dessen Beisein Dr. Jones auf ihn gewartet hatte und der sie jetzt an ihn übergab. Zivilisten durften sich zu keiner Zeit und an keiner Stelle des Gefängnisses alleine aufhalten. Auch dann nicht, wenn sie so gut bekannt waren wie Dr. Jones.
Die freundliche junge Frau Doktor hatte vor ungefähr einem Jahr die Praxis von Dr. Livesey übernommen, einem alten Arzt, der viel zu spät in den Ruhestand gegangen und kurz darauf verstorben war. Wie er teilte sich Dr. Jones den Posten des Gefängnisarztes mit zwei anderen Kollegen aus dem Bezirk. Flanagan wusste, dass man mit diesem Teilposten nicht reich werden konnte. Es war also weiß Gott höchst bewundernswert, dass eine junge Frau wie Dr. Jones sich dafür opferte.
Und dann kam sie auch noch mitten in der Nacht her, nur weil ein Häftling nach ihr verlangte. Ebenso gut hätte sie ihn auch einen Krankenwagen verständigen lassen können. Das wäre ein Riesenaufwand geworden. Und teuer. Das hätte Ärger mit Direktor Sheasby gegeben. Und davon wiederum hatte Flanagan schon genug.
Dr. Jones lief los. Die Arzttasche in ihrer rechten Hand schwang hin und her. Ihre Schritte hallten über den Hof und von den Mauern wider. Flanagan musste sich anstrengen, damit sie ihn nicht abhängte. Er schnaufte. Und das auf seine letzten paar Tage …
Sie hörten Curt Nayland schon von Weitem schreien. Was immer der Hipster-Sani ihm gespritzt hatte, sehr lange hatte es nicht gewirkt.
Flanagan erreichte mit Dr. Jones das Einzelzimmer, in das sie den Gefangenen gesteckt hatten. Es war nicht viel größer als eine Zelle und genauso karg. Und als sie sich nun zu fünft darin befanden, den Gefangenen mitgezählt, schien es so eng zu sein, dass man kaum Luft bekam.
Aus Leibeskräften brüllend, versuchte Curt Nayland seine Fesseln zu sprengen. Die Lederriemen knirschten, als würden sie tatsächlich gleich reißen.
Speichel sprühte dem Häftling von den verzerrten Lippen. Adern und Sehnen traten hervor. Seine Augen glänzten glasig. Tränen und Schweiß liefen ihm übers gerötete Gesicht.
Flanagan wollte den Knüppel zücken, den er am Gürtel trug. Jimmy Flynn hatte seinen bereits in der Hand und halbherzig zum Schlag ausgeholt. Ein irgendwie lächerlicher Anblick, fand Flanagan plötzlich und ließ seine Waffe stecken. Aus unerklärlichem Grund war er auf einmal überzeugt, dass sie Nayland mit ihren Knüppeln nicht beikommen würden, sollte es ihm wirklich gelingen, sich zu befreien.
»Herrje, der Ärmste«, sagte die Ärztin. Sie warf dem Sani einen Blick zu. »Sammy, wie sieht es aus?«