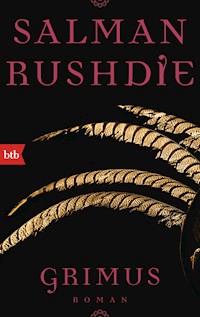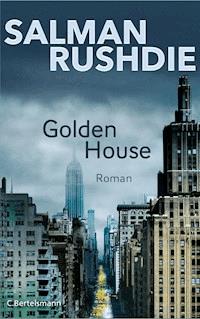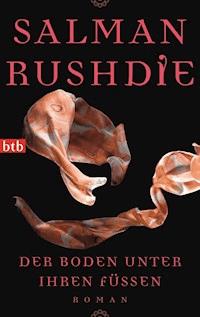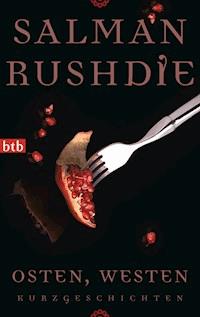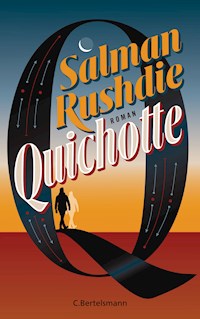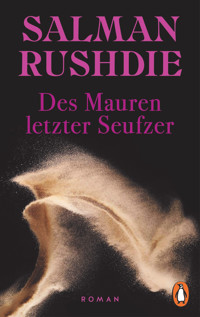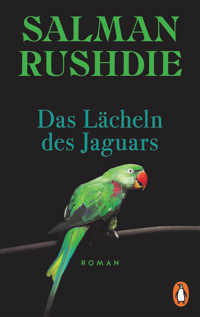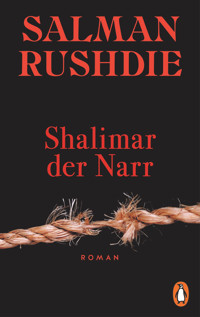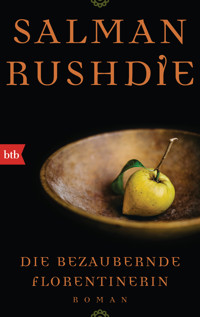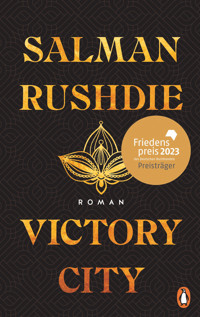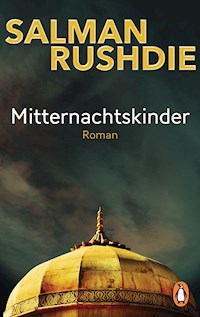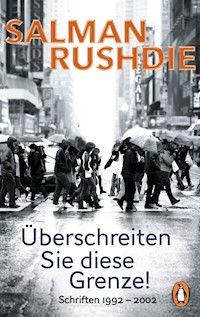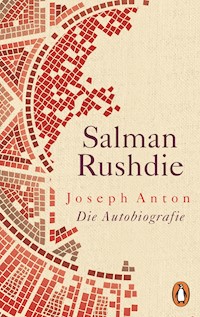
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Gerade jetzt muss man Salman Rushdies Autobiografie lesen. Sie lehrt, dass man den Mob widerstehen muss." Welt am Sonntag
Was bedeutet es für einen Schriftsteller, über neun Jahre lang mit einer Morddrohung zu leben? Wie fest hat die Verzweiflung sein Denken und Handeln im Griff? Zum ersten Mal erzählt Salman Rushdie seine beeindruckende Geschichte; es ist die Geschichte eines Kampfes: dem Kampf um die Meinungsfreiheit. Rushdie erzählt vom teils bitteren, teils komischen Leben unter bewaffnetem Polizeischutz; von den engen Beziehungen, die er zu seinen Beschützern knüpfte; von seinem Ringen um Unterstützung und Verständnis bei Regierungen, Verlegern und Schriftstellerkollegen; und davon, wie er seine Freiheit wiedererlangte.
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1195
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Salman Rushdie
JOSEPH ANTON
Die Autobiografie
Aus dem Englischen übersetzt von Verena von Koskull und Bernhard Robben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2012 by Salman Rushdie
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Joseph Anton. A Memoir«
bei Random House, New York, USA
© 2012 für die deutschsprachige Ausgabe by C. Bertelsmann Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Verena von Koskull und Bernhard Robben
Lektorat: Rainer Wieland
Covergestaltung: R·M·E, Rosemarie Kreuzer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 78-3-641-07605-4V004
www.cbertelsmann.de
Für meine KinderZafar und Milansowie deren MütterClarissa und Elizabethund für alle,die geholfen haben
Und dadurch sie ersehn zu einer Handlung,Wovon, was jetzt geschah, ein Vorspiel ist,Doch uns das Künft’ge obliegt.
William Shakespeare, Der Sturm
Inhalt
Prolog Die erste Krähe
I Ein umgekehrter faustischer Pakt
II »Manuskripte brennen nicht«
III Das Jahr null
IV Die verhängnisvolle Falle, geliebt werden zu wollen
V »Been Down So Long It Looks Like Up to Me«
VI Warum es unmöglich ist, die Pampa zu fotografieren
VII Eine Fuhre Mist
VIII Mr Morning und Mr Afternoon
IX Seine Millenniums-Illusion
X Im Halcyon Hotel
PrologDie erste Krähe
HINTERHER, ALS DIE WELT um ihn herum explodierte und die todbringenden Krähen sich im Schulhof auf dem Klettergerüst versammelten, wurmte es ihn, dass er den Namen der BBC-Reporterin vergessen hatte, die ihm sagte, sein altes Leben sei vorbei, für ihn beginne eine neue, eine dunklere Existenz. Sie rief ihn unter seiner Privatnummer an, ohne zu erklären, woher sie die hatte. »Wie fühlt man sich«, fragte sie, »wenn man weiß, dass man gerade von Ayatollah Khomeini zum Tode verurteilt wurde?« Es war ein sonniger Tag in London, aber ihre Frage verschattete das Licht. Ohne recht zu wissen, was er redete, hat er Folgendes geantwortet: »Man fühlt sich nicht gut.« Und Folgendes hat er gedacht: Ich bin ein toter Mann. Er fragte sich, wie viele Tage er noch zu leben hatte, und dachte, die Antwort wäre vermutlich eine einstellige Zahl. Dann legte er den Hörer auf und rannte aus dem Arbeitszimmer im oberen Stock des schmalen Reihenhauses in Islington nach unten. Das Wohnzimmer hatte hölzerne Fensterläden, die er absurderweise zuzog und verriegelte. Danach schloss er die Haustür ab.
Es war Valentinstag, nur verstand er sich nicht besonders mit seiner Frau, der amerikanischen Schriftstellerin Marianne Wiggins. Erst sechs Tage zuvor hatte sie erklärt, dass sie nicht glücklich mit ihm sei, dass sie sich in seiner Nähe ›nicht mehr wohl fühle‹, dabei waren sie kaum mehr als ein Jahr verheiratet, und er selbst wusste auch, dass diese Ehe ein Fehler gewesen war. Nun starrte Marianne ihn an, während er nervös durchs Haus tigerte, Vorhänge zuzog, Fensterriegel prüfte, von den Nachrichten so elektrisiert, als pulsierte Strom durch seine Adern, und er musste ihr erklären, was passiert war. Sie trug es mit Fassung und begann, mit ihm zu bereden, was als Nächstes zu tun war. Sie benutzte das Wort wir. Das war mutig.
Vor dem Haus hielt ein Wagen, geschickt von CBS. Er hatte mit dem amerikanischen Fernsehsender einen Termin in den Studios von Bowater House in Knightsbridge, ein Auftritt im Frühstücksfernsehen per Satellitenschaltung. »Ich muss los«, sagte er. »Die senden live. Ich kann nicht einfach hierbleiben.« Später am selben Vormittag sollte in der orthodoxen Kirche in der Moscow Road in Bayswater ein Gedenkgottesdienst für Bruce Chatwin stattfinden. Kaum zwei Jahre zuvor hatte er in Homer End, Bruce’ Haus in Oxfordshire, seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert. Jetzt war Bruce tot, gestorben an Aids, und der Tod hatte auch an seine Tür geklopft. »Was ist mit dem Gottesdienst?«, fragte seine Frau. Er wusste keine Antwort, schloss die Haustür auf, ging nach draußen, stieg ins Auto und wurde fortgefahren. Er konnte es damals nicht ahnen, weshalb ihm dieser Augenblick, als er auf die Straße trat, nicht besonders bedeutsam vorkam, doch sollte er das Haus, in dem er fünf Jahre lang daheim gewesen war, erst drei Jahre später wieder betreten, und dann würde es nicht mehr sein Haus sein.
Die Kinder in der Schule im kalifornischen Bodega Bay singen ein trauriges Unsinnslied. Sie kämmt sich das Haar nur einmal im Jahr, ristle-te, rostle-te, mo, mo, mo. Vor der Schule weht ein kalter Wind. Eine einzelne Krähe fliegt vom Himmel herab und landet auf dem Klettergerüst. Das Kinderlied ist ein Rundgesang; es hat einen Anfang, aber kein Ende. Es dreht sich im Kreis, rundherum und rundherum.Mit jedem Bürstenstrich vergießt sie eine Träne, ristle-te, rostle-te, hey-bombosity, knicketyknackety, retro-quo-quality, willoby-wallaby, mo, mo, mo. Vier Krähen hocken auf dem Gerüst, da kommt eine fünfte. Die Schulkinder singen. Jetzt sind es viele hundert Krähen auf dem Hof, und abertausend verdecken den Himmel wie in der ägyptischen Plage. Ein Lied hat begonnen, ein Lied ohne Ende.
Als die erste Krähe auf dem Klettergerüst landet, wirkt sie besonders, spezifisch, einzigartig. Aus ihrer Anwesenheit eine generelle Theorie abzuleiten, ein Schema der Geschehnisse, ist gänzlich unnötig. Später, als die Plage sich ausbreitet, fällt es den Leuten leicht, in der ersten Krähe einen Vorboten zu sehen. Als sie aber auf dem Klettergerüst landet, ist sie nur ein einzelner Vogel.
In den kommenden Jahren taucht diese Szene in seinen Träumen auf, und er wird begreifen, dass sie eine Art Prolog ist: die Geschichte von dem Augenblick, in dem die erste Krähe landete. Zu Beginn geht es nur um ihn; die Geschichte ist individuell, besonders, spezifisch. Niemand fühlt sich bemüßigt, daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Dutzend Jahre und mehr werden vergehen, ehe die Geschichte den Himmel verdeckt – wie der am Horizont erscheinende Erzengel Gabriel, wie zwei in hohe Gebäude fliegende Flugzeuge, wie die Plage der todbringenden Vögel in Alfred Hitchcocks großartigem Film.
In den Studios von CBS war er die Nachricht des Tages. Die Leute in der Nachrichtenredaktion und an den diversen Monitoren benutzten schon das Wort, das ihm bald wie ein Mühlstein um den Hals hängen würde. Sie benutzten es, als wäre es synonym mit ›Todesurteil‹, und er wollte rebellieren, sie pedantisch korrigieren, das sei es nicht, was das Wort besage. Von jenem Tag an aber sollte es dies für die meisten Menschen auf der Welt bedeuten. Auch für ihn.
Fatwa.
›Ich informiere das stolze muslimische Volk der Welt, dass der Autor des Buches Die satanischen Verse, welches sich gegen den Islam, den Propheten und den Koran richtet, sowie alle, die zu seiner Publikation beigetragen haben, zum Tode verurteilt sind. Ich bitte sämtliche Muslime, die Betroffenen hinzurichten, wo immer sie auch sein mögen.‹ Während er zum Interview ins Studio geführt wurde, drückte ihm irgendwer den Text in die Hand. Wieder wollte sein altes Ich korrigieren, diesmal das Wort ›verurteilt‹. Bei der Fatwa handelte es sich um kein Urteil von einem Gericht, das er anerkannte oder das Gerichtsbarkeit über ihn besaß. Sie war das Edikt eines grausamen alten, im Sterben liegenden Mannes. Doch er wusste, die Angewohnheiten seines alten Ichs nutzten ihm nichts mehr. Er besaß jetzt ein neues Ich. Er war der Mensch im Auge des Sturms, nicht mehr der Salman, den seine Freunde kannten, sondern Rushdie, Autor der satanischen Verse – dieses Buches mit dem auf subtile Weise durch das Fortlassen des Artikels Die entstellten Titels. Die satanischen Verse war ein Roman. Satanische Verse waren Verse, die satanisch waren, und er war ihr satanischer Verfasser, ›Satan Rushdy‹, eine gehörnte Kreatur auf Plakaten, die von Demonstranten durch die Straßen ferner Städte getragen wurden, der Gehängte mit langer roter Zunge auf primitiven hochgehaltenen Bildern. Hängt Satan Rushdy. Wie leicht es doch war, eines Menschen Vergangenheit auszulöschen und eine neue Version von ihm zu schaffen, eine überwältigende Version, gegen die anzukämpfen unmöglich schien.
König Karl I. hatte die Legitimität des gegen ihn verhängten Urteils angezweifelt. Oliver Cromwell konnte das nicht aufhalten; er ließ ihn trotzdem köpfen.
Er war kein König. Er war der Verfasser eines Buches.
Er sah die Journalisten an, die ihn ihrerseits ansahen, und fragte sich, ob Menschen so Verurteilte sahen, die zum Galgen, zum elektrischen Stuhl oder zur Guillotine geführt wurden. Ein Auslandskorrespondent wirkte freundlich. Er fragte ihn, was er seiner Meinung nach von Khomeinis Worten halten sollte. Wie ernst war das Ganze? War es nur eine rhetorische Floskel oder wirklich gefährlich?
»Ach, machen Sie sich keine allzu großen Sorgen«, antwortete der Journalist. »Khomeini verurteilt den Präsidenten der Vereinigten Staaten jeden Freitagnachmittag zum Tode.«
Als er auf Sendung war, wurde er gefragt, wie er auf die Drohung reagiere, und er antwortete: »Hätte ich doch nur ein kritischeres Buch geschrieben.« Dass er dies gesagt hatte, darauf war er stolz, damals wie heute. Es war die Wahrheit. Er hatte nicht den Eindruck, dass sich sein Buch besonders kritisch mit dem Islam auseinandersetzte, doch, und das sagte er auch an diesem Morgen im amerikanischen Fernsehen, eine Religion, deren Führer sich auf derartige Weise verhielt, hätte ein wenig Kritik wohl durchaus nötig.
Als das Interview vorbei war, wurde ihm gesagt, seine Frau wolle ihn sprechen. Er rief zu Hause an. »Komm nicht hierher zurück«, sagte sie. »Auf dem Bürgersteig warten gut zweihundert Journalisten auf dich.«
»Ich fahre zur Agentur«, erwiderte er. »Pack eine Tasche; und wir treffen uns da.«
Das Büro seiner Literaturagentur Wylie, Aitken & Stone befand sich in einem weißen Stuckhaus in der Fernshaw Road in Chelsea. Draußen kampierten keine Journalisten – offenbar rechnete die Weltpresse nicht damit, dass er an einem solchen Tag seinen Agenten aufsuchen würde –, doch als er das Gebäude betrat, klingelten sämtliche Telefone, und bei jedem Anruf ging es um ihn. Gillon Aitken, sein britischer Agent, sah ihn erstaunt an. Er telefonierte gerade mit Keith Vaz, dem britisch-indischen Parlamentsabgeordneten für Ost-Leicester, hielt den Hörer zu und wisperte: »Willst du mit dem Kerl reden?«
Vaz sagte in diesem Telefongespräch, was passiert sei, sei »entsetzlich, absolut entsetzlich«, und versprach seine »volle Unterstützung«. Einige Wochen später war er einer der prominentesten Redner während einer Demonstration gegen Die satanischen Verse, an der über dreitausend Muslime teilnahmen; dieser Marsch, sagte er, mache »den heutigen Tag zu einem der größten Tage in der Geschichte des Islam und Großbritanniens«.
Er merkte, dass er nicht vorausdenken konnte, dass er keine Ahnung hatte, wie er sein Leben jetzt gestalten, welche Pläne er machen sollte. Er konnte sich nur auf das Nächstliegende konzentrieren, und das war im Augenblick der Gedenkgottesdienst für Bruce Chatwin. »Mein Lieber«, sagte Gillon, »meinst du wirklich, du solltest dahin gehen?« Er traf seine Entscheidung. Bruce war ein enger Freund gewesen. »Scheiß drauf«, sagte er, »gehen wir.«
Marianne kam, in den blitzenden Augen ein leicht gestörter Blick, empört, weil sie, als sie das Haus in der St. Peter’s Street 41 verließ, von Fotografen bedrängt worden war. Am nächsten Tag würde dieser Blick auf dem Titelblatt aller Zeitungen im Land zu sehen sein. Eines der Blätter gab diesem Blick einen Namen in fünf Zentimeter großen Lettern: DASGESICHTDERANGST. Marianne sagte nicht viel. Er auch nicht. Sie stiegen in ihr Auto, einen schwarzen Saab, und er fuhr durch den Park nach Bayswater. Hinten saß Gillon Aitken mit besorgter Miene, sein langer Leib lässig über den Rücksitz drapiert.
Seine Mutter und seine jüngste Schwester waren in Karatschi. Was würde aus ihnen werden? Seine mittlere Schwester, längst mit der Familie auseinandergelebt, wohnte im kalifornischen Berkeley. War sie dort sicher? Seine älteste Schwester, Sameen, sein ›irischer Zwilling‹, wohnte mit ihrer Familie im Norden Londons, in Wembley, nicht weit vom berühmten Stadion. Was war nötig, um sie zu beschützen? Sein Sohn, Zafar, gerade mal neun Jahre und acht Monate alt, lebte mit seiner Mutter Clarissa in der Burma Road, Hausnummer 60, ganz in der Nähe von Green Lanes und Clissold Park. Zafars zehnter Geburtstag schien ihm in diesem Moment weit, weit weg zu sein. »Dad«, hatte Zafar gefragt, »warum schreibst du keine Bücher, die ich lesen kann?« Das ließ ihn an eine Zeile aus ›St. Judy’s Comet‹ denken, einen Song, den Paul Simon als Schlaflied für seinen kleinen Sohn geschrieben hatte. If I can’t sing my boy to sleep, well, it makes your famous daddy look so dumb – Wenn ich meinen Jungen nicht in den Schlaf singen kann, tja, dann steht dein berühmter Vater wohl ziemlich blöd da. »Gute Frage«, hatte er geantwortet. »Lass mich das Buch fertig machen, an dem ich gerade arbeite, und dann schreibe ich eins für dich. Abgemacht?« – »Abgemacht.« Also hatte er das Buch zu Ende geschrieben, und es war veröffentlicht worden, aber jetzt blieb ihm vielleicht nicht mehr genug Zeit, noch ein Buch zu schreiben. Niemals, dachte er, soll man ein Versprechen brechen, das man einem Kind gegeben hat, und dann hängte sein konfuser Kopf den idiotischen Zusatz an, wäre aber der Tod des Autors eine akzeptable Entschuldigung?
Sein Verstand sann auf Mord.
Vor fünf Jahren war er mit Bruce Chatwin durch Australiens ›rote Mitte‹ gereist, hatte sich in Alice Springs ein Graffito notiert: Stell dich, weißer Mann, deine Stadt ist umzingelt, und sich mühsam den Ayers Rock hinaufgehievt, während Bruce, der stolz darauf war, es vor kurzem bis zum Mount-Everest-Basislager geschafft zu haben, an ihm vorbeihüpfte, als liefe er einen sanften Hang hinauf, hatte gehört, was sich die Einheimischen über den sogenannten ›Dingo-Baby-Fall‹ erzählten, und in einer lausigen Bruchbude namens Inland Motel gehaust, in dem man im Jahr zuvor einem sechsunddreißigjährigen Trucker namens Douglas Crabbe einen Drink verweigert hatte, weil er schon zu besoffen war, woraufhin er die Leute hinterm Tresen beschimpfte und dann, nachdem man ihn rausgeworfen hatte, mit seinem Truck in vollem Tempo auf die Bar zuhielt und fünf Menschen umbrachte.
In einem Gericht in Alice Springs machte Crabbe seine Aussage, und sie fuhren hin, um sie anzuhören. Der Trucker war unauffällig gekleidet, der Blick gesenkt, die Stimme tief und eintönig. Er beharrte darauf, nicht zu jener Sorte Mensch zu gehören, die zu Derartigem fähig war, und als man ihn fragte, weshalb er sich da so sicher sei, antwortete er, dass er bereits seit vielen Jahren auf der Straße fahre und sich um die Lastwagen kümmere, als wären sie »seine eigenen« (an dieser Stelle schwieg er kurz, und das unausgesprochene Wort in diesem Moment der Stille hätte ›Kinder‹ sein können), weshalb es seinem Naturell völlig widerspreche, einen Truck zuschanden zu fahren. Als die Geschworenen dies hörten, erstarrten sie sichtlich, und es war klar, dass der Mann den Prozess verloren hatte. »Dabei«, murmelte Bruce, »hat er natürlich nur die Wahrheit gesagt.«
Diesem Mörder bedeuteten Lastwagen mehr als Menschen. Und fünf Jahre später waren offenbar Menschen unterwegs, die einen Schriftsteller wegen seiner gotteslästerlichen Worte umbringen wollten, und der Glaube, zumindest eine bestimmte Auslegung dieses Glaubens, war ihr Lastwagen, den sie mehr als ein menschliches Leben liebten. Dabei war das, wie er sich nun in Erinnerung rief, gar nicht seine erste Blasphemie gewesen. Mit Bruce war er auf den Ayers Rock gestiegen, und das hatte man inzwischen auch verboten. Der den Aborigines zurückgegebene Rock, der wieder seinen alten Namen Uluru trug, war heute geheiligtes Terrain, auf dem Bergsteiger nicht länger geduldet wurden.
Auf dem Rückflug von dieser australischen Reise im Jahre 1984 begann er zu verstehen, wie Die satanischen Verse geschrieben werden konnten.
Die Andacht in der griechisch-orthodoxen Kathedrale der heiligen Sophia der Erzdiözese von Thyateria und Großbritannien, hundertzehn Jahre zuvor als ein Prunkbau errichtet, der an die großen Kathedralen des alten Byzanz gemahnen sollte, wurde ganz in sonorem, salbungsvollem Griechisch abgehalten. Die Rituale waren so wortreich wie mysteriös. Bla, bla, bla Bruce Chatwin, intonierten die Priester, bla, bla Chatwin bla, bla. Sie standen auf, sie setzten sich, sie knieten sich hin, sie erhoben sich und setzten sich wieder. Es stank nach heiligem Räucherwerk. Er musste daran denken, wie ihn sein Vater in Bombay als Kind einmal mitgenommen hatte, um am Tag des Ramadanfestes zu beten. Auf dem Gebetsplatz wurde nur Arabisch geredet, und es gab jede Menge Mit-der-Stirn-Aufschlagen und Herumstehen mit ausgestreckten Händen, die Handflächen nach oben, dazu ewiges Gemurmel unbekannter Worte in einer Sprache, die ihm fremd war. »Mach mir einfach alles nach«, hatte sein Vater gesagt. Sie waren keine religiöse Familie und gingen fast nie zu solchen Zeremonien. Gebete und deren Bedeutung hatte er nicht gelernt. Alles, was er konnte, war, dieses eine Gebet nachzuplappern, es auswendig vor sich hin zu murmeln. Und deshalb kam ihm die bedeutungslose Zeremonie in der Moscow Road so vertraut vor. Er saß mit Marianne neben Martin Amis und dessen Frau Antonia Phillips. »Wir haben uns Sorgen um dich gemacht«, sagte Martin, als er ihn umarmte. »Ich auch um mich«, hatte er geantwortet. Bla Chatwin bla Bruce bla. Der Schriftsteller Paul Theroux saß in der Bank hinter ihm. »Salman«, sagte er, »bestimmt sitzen wir nächste Woche deinetwegen hier.«
Als er eintraf, standen einige Fotografen auf dem Gehweg. Normalerweise ziehen Schriftsteller keine Scharen von Paparazzi an, doch drangen im Laufe der Andacht immer mehr Journalisten in die Kirche. Eine unverständliche Religion war Gastgeber für eine Sensationsmeldung, die der unverständliche Gewaltangriff einer anderen unverständlichen Religion ausgelöst hatte. Zu denschlimmsten Folgen dessen, was geschehen ist, sollte er später schreiben, gehört, dass das Unverständliche verständlich wurde, das Unvorstellbare vorstellbar.
Die Andacht endete, und die Journalisten drängten zu ihm. Gillon, Marianne und Martin versuchten, sie aufzuhalten. Ein hartnäckiger, grauhaariger Kerl (grauer Anzug, graues Haar, graues Gesicht, graue Stimme) schaffte es durch die Menge, hielt ihm ein Tonband unter die Nase und stellte die naheliegenden Fragen. »Tut mir leid«, erwiderte er. »Dies ist eine Andacht zum Gedenken an meinen Freund, da wäre es ungehörig, Interviews zu geben.« – »Sie verstehen nicht«, sagte der graue Kerl und klang verwirrt. »Ich bin vom Daily Telegraph. Die haben mich extra hergeschickt.«
»Gillon, ich brauche deine Hilfe«, sagte er.
Gillon beugte sich aus seiner beachtlichen Höhe zu dem Reporter hinab und sagte mit fester Stimme und hochnäsigstem Akzent: »Verpiss dich!«
»So können Sie nicht mit mir reden«, erwiderte der Mann vom Telegraph. »Ich war auch auf dem Internat.«
Danach war Schluss mit lustig. Als er auf die Moscow Road trat, umschwärmten ihn Journalisten wie Drohnen auf der Suche nach der Königin, Fotografen nahmen einander huckepack, taumelnde Leiberberge, aus denen Blitzgewitter zuckten. Blinzelnd und orientierungslos stand er da und wusste einen Moment lang nicht, was er machen sollte.
Es schien kein Entkommen zu geben. Zum Auto zu laufen, das nicht mehr als hundert Meter entfernt stand, war unmöglich, ohne von Kameras verfolgt zu werden, von Mikrofonen und Männern, die auf welches Internat auch immer gegangen und extra seinetwegen geschickt worden waren. Rettung kam durch seinen Freund Alan Yentob von der BBC, Filmemacher und Vorstandsmitglied des Senders, den er acht Jahre zuvor kennengelernt hatte, als Alan für Arena einen Dokumentarfilm über einen jungen Schriftsteller drehte, dessen frisch publizierter Roman mit dem Titel Mitternachtskinder von der Öffentlichkeit wohlwollend aufgenommen wurde. Alan besaß einen Zwillingsbruder, doch behaupteten die Leute oft: »Salman sieht wie dein Zwilling aus.« Diese Ansicht hielt sich, obwohl sie beide anderer Auffassung waren. Heute dürfte für Alan allerdings wohl kaum ein Tag sein, an dem er gerne mit ihm verwechselt werden wollte.
Alans Wagen von der BBC hielt direkt vor der Kirche. »Steig ein«, sagte er, und dann ließen sie die tobenden Journalisten hinter sich. Eine Weile fuhren sie kreuz und quer durch Notting Hill, bis sich die Menge vor der Kirche schließlich auflöste und sie dort halten konnten, wo er den Saab abgestellt hatte.
Er stieg mit Marianne ins Auto, und mit einem Mal waren sie allein; die plötzliche Stille bedrückte sie beide. Sie schalteten das Radio nicht ein, da sie wussten, dass es in den Nachrichten nur um Hass gehen würde. »Wohin sollen wir fahren?«, fragte er, obwohl sie beide die Antwort kannten. Marianne hatte vor kurzem eine kleine Souterrainwohnung in der südwestlichen Ecke des Lonsdale Square in Islington gemietet, nicht weit vom Haus in der St. Peter’s Street, angeblich, um sie als Arbeitswohnung zu nutzen, in Wahrheit aber wegen der wachsenden Spannung in ihrer Ehe. Nur wenige Leute wussten von diesem Apartment. Es würde ihnen Raum und Zeit geben, zu sich zu kommen und Entscheidungen zu treffen. Schweigend fuhren sie nach Islington. Es schien nichts weiter zu sagen zu geben.
Marianne war eine ausgezeichnete Schriftstellerin und eine schöne Frau, doch hatte er so manches herausgefunden, was ihm an ihr nicht gefiel.
Als sie zu ihm zog, hinterließ sie auf dem Anrufbeantworter seines Freundes Bill Buford, des Herausgebers der Zeitschrift Granta, die Nachricht, dass sich ihre Telefonnummer geändert habe. »Die neue Nummer kennst du bestimmt«, fuhr sie fort, um dann nach einer, wie Bill fand, erschreckenden Pause hinzuzusetzen: »Ich hab ihn.« In der aufgewühlten Zeit unmittelbar nach dem Tod seines Vaters im November 1987 hatte er sie gefragt, ob sie ihn heiraten wolle, doch war es mit ihrer Beziehung nicht lange gutgegangen. Seine engsten Freunde, Bill Buford, Gillon Aitken und dessen amerikanischer Kollege Andrew Wylie, die guyanische Schriftstellerin Pauline Melville und seine Schwester Sameen, die ihm stets näher als irgendjemand sonst gestanden hatte, sie alle eröffneten ihm, dass sie Marianne nicht besonders mochten, was Freunde natürlich tun, wenn eine Ehe zerbricht, weshalb er sich sagte, dass er nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen durfte. Allerdings hatte er seine Frau selbst bei einigen Lügen ertappt, und das machte ihn ziemlich betroffen. Was hielt sie nur von ihm? Oft schien sie verärgert zu sein und hatte so eine Art, über seine Schulter hinweg in die Luft zu starren, wenn sie mit ihm redete, beinahe als unterhielte sie sich mit einem Gespenst. Ihren scharfen Verstand, ihren Humor hatte er stets gemocht, und beides gab es noch, auch die körperliche Anziehung war noch da, das wogende, rotbraune Haar, die vollen Lippen, das offene, amerikanische Lächeln. Dennoch war sie ihm ein Rätsel geworden, und manchmal glaubte er, eine Fremde geheiratet zu haben. Eine Frau mit einer Maske.
Es war früh am Nachmittag, und an diesem Tag schienen ihre privaten Zwistigkeiten bedeutungslos. An diesem Tag marschierte eine Menschenmenge durch die Straßen Teherans, in den Händen Poster mit seinem Gesicht, dem die Augen ausgestochen waren, so dass er an eine der Leichen in Die Vögel erinnerte mit ihren schwarz angelaufenen, blutigen, leergehackten Augenhöhlen. Das war das Thema des heutigen Tages: seine gar nicht komische Valentinspost von bärtigen Männern, verschleierten Frauen und vom todkranken Alten, der sterbend in seinem Zimmer lag und mit letzter Kraft nach düsterem, mörderischem Ruhm strebte. Sobald der Imam an die Macht gekommen war, hatte er viele von denen umgebracht, die ihm zur Macht verholfen hatten, auch alle, die ihm missfielen. Gewerkschafter, Feministen, Sozialisten, Kommunisten, Homosexuelle, Prostituierte, sogar seine ehemaligen Statthalter. In Diesatanischen Verse gibt es das Porträt eines ihm ähnlichen Imams, der zum Ungeheuer wird, dessen gigantisches Maul die eigene Revolution frisst. Der wahre Imam hatte sein Land in einen sinnlosen Krieg gegen seinen Nachbarn geführt, und eine ganze Generation junger Menschen war gestorben, Hunderttausende Jugendliche, ehe der Alte dem ein Ende setzte. Er sagte, Frieden mit dem Irak zu schließen sei, als würde er Gift nehmen, aber er hat es geschluckt. Danach empörten sich die Toten gegen den Imam, und die Revolution wurde unpopulär. Er suchte eine Möglichkeit, die Gläubigen wieder hinter sich zu vereinen, und er fand, dass ihm ein Buch und dessen Autor ebendiese Möglichkeit boten. Das Buch war des Teufels Werk, der Autor war der Teufel, und sie lieferten ihm den Feind, den er brauchte. Dieser Autor, der in einer Souterrainwohnung in Islington zusammen mit seiner Frau kauerte, von der er sich bereits halb getrennt hatte. Das war der Teufel, den der sterbende Imam brauchte.
Die Schule war zu Ende, und er wollte unbedingt Zafar sehen. Er rief Pauline Melville an und bat sie, Marianne Gesellschaft zu leisten, während er sich mit seinem Sohn traf. Anfang der Achtziger war Pauline in Highbury Hill seine Nachbarin gewesen, eine lebhaft gestikulierende, warmherzige Frau mit strahlenden Augen, eine Schauspielerin aus Guyana, voller Geschichten darüber, wie einer ihrer Vorfahren Evelyn Waugh kennengelernt hatte und, so vermutete sie, das Vorbild für Mr Todd wurde, diesen wunderlichen alten Kauz, der Tony Last im Regenwald gefangen nahm und ihn in Eine Handvoll Staub zwang, endlos laut Dickens vorzulesen; Geschichten auch darüber, wie sie ihren Mann Angus vor der Fremdenlegion rettete, indem sie sich vor die Tore des Forts stellte und schrie, bis man ihn freiließ; oder darüber, wie es war, Adrian Edmondsons Mum in der erfolgreichen TV-Comedyserie The Young Ones zu spielen. Sie trat als Stand-up-Komikerin auf und schuf sich eine männliche Figur, die für sie »so gefährlich und beängstigend wurde, dass ich aufhören musste, ihn zu spielen«. Sie schrieb mehrere ihrer Guyana-Geschichten auf und zeigte sie ihm. Sie waren sehr, sehr gut, und als sie sie in ihrem ersten Buch Shape-Shifter veröffentlichte, wurden sie allgemein gelobt. Pauline war stark, gewitzt, loyal, und er vertraute ihr bedingungslos. Sie kam sofort und ohne ein überflüssiges Wort, obwohl sie Geburtstag und manche Vorbehalte gegen Marianne hatte. Er genoss es, Marianne in der Souterrainwohnung am Lonsdale Square zurücklassen und allein zur Burma Road fahren zu können. Der schöne sonnige Tag, dessen erstaunlicher Winterglanz ihm wie ein Vorwurf gegenüber den unschönen Nachrichten vorgekommen war, ging zu Ende. London im Februar, die Schulkinder machten sich im Dunkeln auf den Heimweg. Als er zum Haus von Clarissa und Zafar kam, war die Polizei bereits dort. »Da sind Sie ja«, sagte ein Beamter. »Wir haben uns schon gefragt, wo Sie abgeblieben sind.«
»Was ist los, Dad?« Sein Sohn hatte einen Blick, wie man ihn bei keinem neunjährigen Jungen sehen möchte. »Ich habe ihm erklärt«, sagte Clarissa fröhlich, »dass man auf dich aufpasst, bis dieser Sturm sich legt, und dass bald alles wieder in Ordnung sein wird.« Dann umarmte sie ihn, wie sie ihn seit fünf Jahren, seit dem Ende ihrer Ehe, nicht mehr umarmt hatte. Sie war die erste Frau, die er je geliebt hatte. Am 26. Dezember 1969, fünf Tage vor dem Ende der Sechziger, lernten sie sich kennen, er war damals zweiundzwanzig, sie einundzwanzig. Clarissa Mary Luard. Sie hatte lange Beine, grüne Augen, trug an jenem Tag einen Hippie-Schaffellmantel, ein Stirnband im dicht gelockten, rotbraunen Haar und strahlte etwas aus, das jedes Herz erhellte. Freunde in der Welt der Popmusik nannten sie Happily (doch ebenso happily verschwand dieser Name mit dem schrulligen Jahrzehnt, das ihn hervorbrachte). Ihre Mutter trank zu viel, und ihr Vater war völlig verstört aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt, in dem er eine Pathfinder geflogen hatte; als sie fünfzehn Jahre alt war, sprang er von einem Hochhaus in den Tod. Ihr gehörte ein Beagle namens Bauble, der in ihr Bett pinkelte.
Es gab so manches, was sie hinter ihrem strahlenden Lächeln verbarg; so mochte sie es nicht, wenn man die Schatten in ihr sah, und sobald die Melancholie sie überkam, ging sie auf ihr Zimmer und verschloss die Tür. Vielleicht spürte sie dann den Gram ihres Vaters und fürchtete, er könnte sie ebenfalls von einem Gebäude springen lassen, weshalb sie sich einkapselte, bis es ihr wieder besser ging. Sie trug den Namen der tragischen Titelheldin eines Romans von Samuel Richardson und war unter anderem in Harlow auf die Technische Hochschule gegangen. Clarissa aus Harlow, ein seltsames Echo der fiktiven Clarissa Harlowe, die noch einen Selbstmord in ihr Umfeld brachte, diesmal allerdings einen, der nur auf dem Papier geschah; ein weiteres, gefürchtetes Echo, das sie mit strahlendem Lächeln auszublenden suchte. Ihre Mutter, Lavinia Luard, die gleichfalls einen Spitznamen hatte, einen etwas peinlichen, wurde Lavvy-Loo genannt, Lokus-Klo, doch rührte sie die Familientragödie in ein Glas Gin, um sie darin aufzulösen und die fröhliche Witwe vor Männern spielen zu können, die dies auszunutzen wussten. Zuerst war da ein verheirateter Ex-Wachoberst namens Ken Sweeting, der von der Isle of Man kam und ihr den Hof machte, seine Frau aber nie verließ und auch nie die Absicht hatte. Als Lavinia später nach Andalusien ins Dorf Mijas zog, folgte eine Reihe kontinentaleuropäischer Tunichtgute, die willens waren, auf ihre Kosten zu leben und ihr Geld mit vollen Händen auszugeben. Lavinia war strikt dagegen, dass ihre Tochter mit ihm zusammenlebte und sich dann auch noch entschied, diesen seltsamen, langhaarigen indischen Schriftsteller zu heiraten, über dessen familiären Hintergrund sie nichts Genaues wusste und der nicht besonders viel Geld zu haben schien. Sie war mit der Familie Leworthy aus Westerham in Kent befreundet und plante, ihre schöne Tochter mit dem Sohn der Leworthys zu verehelichen, mit Richard, einem blassgesichtigen, hageren Buchhalter mit warholeskem weißblondem Haar. Ihre Tochter und Richard gingen miteinander aus, doch traf sich Clarissa insgeheim auch mit dem langhaarigen indischen Autor, und sie brauchte zwei Jahre, um sich zwischen den beiden Männern zu entscheiden, doch eines Abends im Januar 1972, als er eine Einweihungsparty in seiner frisch gemieteten Wohnung in Cambridge Gardens in Ladbroke Grove gab, kam sie und hatte ihren Entschluss gefällt; danach waren sie beide unzertrennlich. Es sind stets die Frauen, die sich entscheiden; den Männern bleibt nur, dankbar zu sein, wenn sie die Glücklichen sind, für die sie sich entschieden haben.
All die Jahre des Begehrens, der Liebe, der Ehe, Elternschaft, Untreue (meist seinerseits), Scheidung und Freundschaft schwangen an diesem Abend in ihrer Umarmung mit. Die Ereignisse des Tages hatten den Schmerz fortgespült, und darunter kam etwas Altes, Tieferes zum Vorschein, das nicht zerstört worden war. Außerdem waren sie natürlich die Eltern dieses prächtigen Jungen, und als Eltern waren sie stets vereint und einer Meinung. Zafar wurde im Juni 1979 geboren, als die Arbeit an Mitternachtskinder dem Ende zuging. »Kneif die Beine zusammen«, hatte er gesagt, »ich schreibe, so schnell ich kann.« Eines Nachmittags gab es falschen Alarm, und er hatte gedacht: Das Kind wird um Mitternacht geboren, aber es sollte dann doch anders kommen, die Geburt war am 17. Juni, nachmittags um Viertel nach zwei. Er schrieb dies als Widmung ins Buch: Für Zafar Rushdie, der, entgegen aller Erwartung, an einem Nachmittag geboren wurde. Und der nun neuneinhalb Jahre alt war und besorgt fragte: Was ist denn los?
»Wir müssen wissen«, sagte der Polizeibeamte, »was Sie nun vorhaben.« Er überlegte, ehe er schließlich antwortete: »Wahrscheinlich fahre ich gleich nach Hause« – und die erstarrenden Mienen der Männer in Uniform bestätigten seinen Verdacht. »Nein, Sir, davon raten wir Ihnen dringend ab.« Daraufhin erzählte er, was er von Anfang an erzählen wollte, dass nämlich Marianne in einer Souterrainwohnung am Lonsdale Square auf ihn wartete. »Die Wohnung ist nicht als Ort bekannt, an dem Sie sich regelmäßig aufhalten, Sir?« Nein, Officer, ist sie nicht. »Das ist gut. Wenn Sie hinfahren, Sir, gehen Sie heute Abend bitte nicht mehr aus, falls das für Sie in Ordnung ist. Zurzeit finden Beratungen statt, und man wird Sie morgen so früh wie möglich wissen lassen, was dabei herausgekommen ist. Bis dahin sollten Sie in der Wohnung bleiben.«
Er redete mit seinem Sohn, drückte ihn fest an sich und beschloss in diesem Moment, ihm so viel wie möglich zu erzählen, dabei aber das, was geschah, ins bestmögliche Licht zu rücken. Am ehesten konnte er Zafar helfen, mit den Geschehnissen fertig zu werden, wenn er ihm das Gefühl gab, unmittelbar daran beteiligt zu sein, wenn er ihm seine väterliche Version gab, der er glauben und an die er sich halten konnte, falls man ihn mit anderen Versionen bombardierte, etwa über das Fernsehen oder auf dem Schulhof. Die Schule verhalte sich hervorragend, sagte Clarissa, sie hatte Fotografen und einem TV-Team den Zugang verweigert, die den Sohn des bedrohten Mannes filmen wollten, und die Mitschüler seien ebenfalls ganz fantastisch. Ohne jede Diskussion hatten sie sich vor Zafar gestellt und ihm so einen normalen oder doch fast normalen Schultag ermöglicht. Auch die Eltern seien nahezu ausnahmslos hilfsbereit gewesen, und die ein oder zwei, die verlangt hatten, dass man Zafar von der Schule nehme, da seine Anwesenheit eine Gefahr für ihre Kinder bedeuten könnte, waren vom Direktor gerügt worden und hatten beschämt den Rückzug angetreten. Es tat gut, an diesem Tag Mut, Solidarität und Prinzipientreue zu erleben, die besten aller menschlichen Werte, die sich in ebenjener Stunde, in der es fast unmöglich schien, der wachsenden Flut der Dunkelheit zu widerstehen, gegen Gewalt und Bigotterie wandten, gegen die düsteren Seiten der menschlichen Rasse. Was bis zu diesem Tag unvorstellbar gewesen war, war vorstellbar geworden, in der Hall School in Hampstead aber hatte der Widerstand bereits begonnen.
»Sehe ich dich morgen, Dad?« Er schüttelte den Kopf. »Aber ich rufe dich an«, sagte er. »Ich rufe dich jeden Abend um sieben Uhr an. Und wenn du nicht da sein solltest«, fuhr er an Clarissa gewandt fort, »hinterlass bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wann ich stattdessen anrufen soll.« Das war Anfang 1989. So etwas wie PC, Laptop, Handy, Mobiltelefon, Internet, Wi-Fi, SMS und E-Mail war entweder noch unbekannt oder ziemlich neu, jedenfalls besaß er keinen Computer und kein Handy. Allerdings gehörte ihm ein Haus, auch wenn er die Nacht dort nicht verbrachte, und in diesem Haus gab es einen Anrufbeantworter, und er konnte anrufen und sich das Band vorspielen lassen, konnte die Nachricht hören, nein, sie abrufen, wie man jetzt sagte. »Sieben Uhr«, wiederholte er. »Jeden Abend, okay?« Zafar nickte mit ernster Miene. »Okay, Dad.«
Er fuhr allein nach Hause, und das Radio brachte keine guten Nachrichten. Zwei Tage zuvor hatte am US-amerikanischen Kulturzentrum im pakistanischen Islamabad eine ›Rushdie-Demo‹ stattgefunden. (Es blieb unklar, warum man die Vereinigten Staaten für Die satanischen Verse verantwortlich machte.) Die Polizei feuerte in die Menge, und es gab fünf Tote und sechzig Verletzte. Die Demonstranten trugen Plakate, auf denen stand: RUSHDIEDUBISTTOT. Durch das Edikt aus dem Iran war die Gefahr nun vervielfacht. Denn bei Ayatollah Khomeini handelte es sich nicht bloß um einen mächtigen Geistlichen; er war das Oberhaupt eines Staates, das die Ermordung des Bürgers eines anderen Staates befahl, eines Mannes, der nicht unter seine Gerichtsbarkeit fiel; und diesem Oberhaupt waren Attentäter unterstellt, die schon öfter zum Einsatz gegen ›Feinde‹ der iranischen Revolution gekommen waren, auch gegen Feinde, die außerhalb des Iran gelebt hatten. Im Radio fiel ein weiteres neues Wort, das er lernen musste: Extraterritorialität, auch bekannt als staatlich geförderter Terrorismus. Voltaire hatte einmal gesagt, dass es für einen Schriftsteller günstig sei, in der Nähe einer Landesgrenze zu wohnen, könne er dann doch, sollte er einmal mächtige Menschen verärgern, rasch über die Grenze in Sicherheit fliehen. Voltaire selbst verließ Frankreich in Richtung England, nachdem er den Chevalier de Rohan, einen Aristokraten, beleidigt hatte; er blieb sieben Jahre im Exil. Heutzutage aber bedeutete es keine Sicherheit mehr, nicht im Land seiner Verfolger zu leben. Schließlich gab es die extraterritoriale Aktion. Mit anderen Worten: Sie jagen dich und spüren dich auf.
Die Nacht am Lonsdale Square war kalt, dunkel und klar. Zwei Polizisten standen auf dem Platz, doch als er den Wagen verließ, taten sie, als würden sie ihn nicht beachten. Sie machten kurze Kontrollgänge und patrouillierten die Straße vor der Wohnung hundert Meter weit in jede Richtung; noch im Haus konnte er ihre Schritte hören. Er begriff in dieser von Schritten heimgesuchten Stille, dass er sein Leben nicht mehr verstand, dass er nicht mehr wusste, was werden würde, und zum zweiten Mal an diesem Tag dachte er daran, dass ihm vielleicht nicht mehr viel Leben blieb, das er verstehen müsse. Pauline fuhr nach Hause, und Marianne ging früh zu Bett. Es war ein Tag zum Vergessen. Es war ein Tag zum Erinnern. Er legte sich neben seine Frau ins Bett; sie drehte sich zu ihm um, und sie umarmten sich ungelenk wie das unglücklich verheiratete Paar, das sie nun einmal waren. Dann lagen sie getrennt da, hingen ihren je eigenen Gedanken nach und fanden keinen Schlaf.
Schritte. Winter. Eine Krähe flattert auf ein Klettergerüst. Ich informiere das stolze muslimische Volk der Welt ristle-te, rostle-te, mo, mo, mo, die Betroffenen hinzurichten, wo immer sie sein mögen. Ristle-te, rostle-te, hey bombosity, knickety-knackety, retro-quo-quality, willoby-wallaby, mo, mo, mo.
IEin umgekehrter faustischer Pakt
ALS ER EIN KLEINER JUNGE WAR, hatte sein Vater ihm zur guten Nacht die wundersamen Geschichten des Ostens erzählt, sie erzählt und ausgeschmückt und auf seine Weise umerzählt, neu erzählt – die Geschichten von Scheherazade aus Tausendundeine Nacht, gegen den Tod erzählte Geschichten, die bewiesen, dass Geschichten zivilisieren und selbst mörderische Tyrannen zu überwinden vermögen. Er hatte ihm die Tierfabeln aus dem Panchatantra und all das Wundersame erzählt, das sich wie ein Wasserfall aus dem Kathasaritsagara ergoss, dem ›Meer der Erzählströme‹, diesem gewaltigen See der Geschichten in Kaschmir, dort, wo seine Vorfahren geboren worden waren, aber auch die Sagen von mächtigen Helden, gesammelt im Hamzanama und den Abenteuern des Hatim Tai (Letztere wurden auch verfilmt, und die dafür vorgenommenen zahlreichen Veränderungen der ursprünglichen Erzählungen fügte sein Vater ebenfalls den Gutenachtgeschichten zu). Mit diesen Geschichten aufzuwachsen bedeutete, zwei unvergessliche Lektionen zu lernen: Zum einen die, dass Geschichten nicht wahr waren (es gab keine ›echten‹ Dschinns in Flaschen, keine fliegenden Teppiche, keine Wunderlampen), nur konnte ihre Unwahrheit ihn Wahrheiten fühlen und wissen lassen, die ihm die Wahrheit selbst nicht zu vermitteln vermochte; und zum Zweiten lernte er, dass ihm alle Geschichten gehörten, so wie sie auch seinem Vater Anis und allen übrigen Menschen gehörten, sie waren so sehr seine wie die seines Vaters, fröhliche Geschichten, düstere Geschichten, heilige und weltliche Geschichten, die er nach Gefallen ändern, erneuern, beiseitelegen und erneut aufgreifen durfte, um darüber zu lachen, sich an ihnen zu erfreuen und in ihnen zu leben, mit ihnen und durch sie, um die Geschichten mittels seiner Liebe lebendig werden und sich durch sie im Gegenzug das eigene Leben bereichern zu lassen. Der Mensch ist das Geschichten erzählende Wesen, die einzige Kreatur auf Erden, die sich Geschichten erzählt, um zu begreifen, was für ein Geschöpf sie ist. Die Geschichte war sein Geburtsrecht, und niemand konnte ihm das nehmen.
Negin, seine Mutter, kannte ebenfalls Geschichten. Negin Rushdie wurde als Zohra Butt geboren. Für ihre Heirat mit Anis änderte sie nicht nur den Nachnamen, sondern auch den Vornamen, erfand sich für ihn neu, ließ die Zohra hinter sich, an die er sich nur ungern erinnerte, hatte sie doch einmal einen anderen Mann von Herzen geliebt. Ob sie in ihrem Innersten Zohra oder Negin war, sollte der Sohn nicht herausfinden, da sie niemals über den Mann sprach, den sie verlassen hatte; lieber als ihre eigenen verriet sie anderer Leute Geheimnisse. Sie war ein Plappermaul der Spitzenklasse, und wenn er, ältestes Kind und einziger Sohn, auf ihrem Bett saß und ihre Füße massierte, wie sie es gernhatte, nahm er die köstlichen, oft auch zotigen Klatschgeschichten in sich auf, die sie in ihrem Kopf herumtrug, diesen gigantischen, sich verzweigenden und verästelnden Wald miteinander flüsternder Familienstammbäume, der in ihr wuchs, behangen mit den saftigen, verbotenen Früchten des Skandals. Und auch diese Geheimnisse, das lernte er, gehörten ihm, denn einmal erzählte Geheimnisse gehören nicht mehr dem, der sie erzählt, sondern dem, der sie hört. Will man nicht, dass ein Geheimnis verraten wird, gibt es nur eins: Erzähl es keiner Menschenseele. Auch diese Lehre sollte ihm im späteren Leben nützlich sein. Und in diesem späteren Leben, als er bereits Schriftsteller geworden war, sagte ihm seine Mutter: »Ich höre auf, dir solche Geschichten zu erzählen, weil du sie in deine Bücher packst und mich damit in Schwierigkeiten bringst.« Womit sie recht hatte, und vielleicht wäre sie gut beraten gewesen, wirklich damit aufzuhören, nur war der Tratsch ihre Droge und sie kam davon nicht los, noch weniger, als ihr Mann die Finger vom Alkohol lassen konnte.
Windsor Villa, Warden Road, Bombay 26. Ein Haus auf einem Hügel mit Blick aufs Meer und auf die Stadt, die sich zwischen Hügel und Meer ausbreitet, und ja, sein Vater war reich, doch brachte er sein Leben damit zu, all das Geld auszugeben, und er starb verarmt, blieb seine Schulden schuldig und hatte ein Bündel Rupienscheine in der oberen linken Schublade seines Schreibtisches, mehr an Bargeld war ihm nicht geblieben. Anis Ahmed Rushdie (›B. A. Cambridge, Barrister‹ stand stolz auf der an die Wand neben der Eingangstür festgeschraubten Messingplatte) erbte ein Vermögen von seinem Vater, einem Textilmagnaten, dessen einziger Sohn er war, verprasste es, verlor es und starb, was die Geschichte eines glücklichen Lebens hätte sein können, es aber nicht war. Seine Kinder wussten so manches über ihn: dass er morgens fröhlich war, bis er sich rasierte, aber dann, nachdem der Philishave sein Werk getan hatte, wurde er reizbar, und sie achteten darauf, ihm aus dem Weg zu gehen; dass er, wenn er am Wochenende mit ihnen zum Strand ging, auf dem Hinweg aufgedreht und lustig sein konnte, aber griesgrämig auf dem Rückweg war; dass ihre Mutter, wenn sie im Willingdon Club mit ihm Golf spielte, verlieren musste, obwohl sie die bessere Spielerin war, da das Gewinnen ihr nichts brachte; und dass er, wenn er betrunken war, grässliche Fratzen ziehen und sein Gesicht auf bizarre, grausige Weise verziehen konnte, womit er ihnen schreckliche Angst einjagte, Grimassen, die kein Außenstehender je sah, weshalb niemand verstand, was sie damit meinten, wenn sie sagten, ihr Vater ›mache Gesichter‹. Doch als sie noch klein waren, waren da die Geschichten und dann der Schlaf, und wenn sie laute Stimmen im Nebenzimmer, wenn sie ihre Mutter weinen hörten, gab es nichts, was sie dagegen tun konnten. Sie zogen die Bettdecke über ihre Köpfe und träumten.
Im Januar 1961 nahm Anis seinen dreizehnjährigen Sohn mit nach England, und ehe seine Schulzeit an der Rugby School begann, teilten sie sich etwa eine Woche lang ein Zimmer im Londoner Cumberland Hotel unweit von Marble Arch. Tagsüber gingen sie shoppen und kauften die von der Schule verlangten Kleider; Tweedjacken, graue Flanellhosen, Van-Heusen-Hemden mit abnehmbaren, halbsteifen Kragen, weshalb Kragenknöpfe unumgänglich waren, die im Nacken drückten und das Atmen erschwerten. Sie tranken Schokoladenshakes im Lyons Corner House in der Coventry Street und gingen ins Odeon Marble Arch, um sich den Film The Pure Hell of St. Trinian’s anzusehen, und er wünschte sich, es gäbe Mädchen im Internat. Abends kaufte sein Vater Brathähnchen vom Kardomah Takeaway in der Edgware Road, und der Junge musste das Essen unter seinem neuen doppelreihigen Mackintosh aus blauem Serge aufs Hotelzimmer schmuggeln. Abends betrank sich Anis, und in den frühen Morgenstunden schüttelte er seinen verängstigten Sohn wach, um ihn mit derart derben Flüchen zu beschimpfen, dass der Junge gar nicht glauben konnte, sein Vater kenne solche Ausdrücke. Dann fuhren sie nach Rugby, kauften einen roten Sessel und sagten einander Lebewohl. Anis machte vor dem Internat ein Foto von seinem Sohn, der die blauweiß gestreifte Hauskappe trug und den nach Hähnchen stinkenden Mackintosh, und wenn man den Kummer in den Augen des Jungen sah, konnte man glauben, dass er traurig war, so weit fort von daheim zur Schule gehen zu müssen. Dabei konnte er es gar nicht erwarten, dass sein Vater ging, damit er endlich versuchen konnte, die Nächte voller Flüche und unvermittelter, rotäugiger Wut zu vergessen. Er wollte den Kummer in der Vergangenheit zurücklassen und seine Zukunft beginnen, weshalb er sein Leben wohl zwangsläufig so weit fort wie nur möglich von seinem Vater lebte und Ozeane zwischen ihnen beließ. Als er den Abschluss an der Universität Cambridge machte und seinem Vater sagte, er wolle Schriftsteller werden, entfuhr Anis ein unbeherrschter, schmerzlicher Aufschrei: »Und was soll ich jetzt meinen Freunden sagen?«
Neunzehn Jahre später schickte Anis Rushdie seinem Sohn zum vierzigsten Geburtstag einen handgeschriebenen Brief, der für den Schriftsteller zum kostbarsten Dokument wurde, das er je erhalten hatte und je erhalten sollte. Der Brief kam, fünf Monate ehe Anis mit siebenundsiebzig Jahren an einem sich rasch ausbreitenden multiplen Myelom starb – an Knochenmarkkrebs. Aus dem Brief wurde deutlich, wie aufmerksam und mit welch profunder Einsicht er die Bücher seines Sohnes gelesen und verstanden hatte, wie begierig er darauf wartete, weitere Werke von ihm zu lesen, und wie tief die väterliche Liebe reichte, die er sein Leben lang nicht auszudrücken vermochte. Er lebte noch lang genug, um sich über den Erfolg von Mitternachtskinder und Scham und Schande freuen zu können, doch als das Buch erschien, dessen Entstehen ihm am meisten verdankte, gab es ihn nicht mehr. Vielleicht war das gut so, schließlich blieb ihm der nachfolgende Skandal erspart, auch wenn zu dem wenigen, dessen sich sein Sohn vollkommen sicher war, die Überzeugung gehörte, dass sein Vater ihn im Kampf um Die satanischen Verse rückhaltlos und unnachgiebig unterstützt hätte. Ohne die Ideen seines Vaters, ohne sein ermutigendes Beispiel wäre dieser Roman nie geschrieben worden. They fuck you up, your mum and dad, heißt es in einem Gedicht von Philip Larkin, aber darum ging es gar nicht. Sicher, das hatten sie auch getan, vielleicht, vor allem aber hatten sie ihn jenen Mensch und Schriftsteller werden lassen, zu dem er das Zeug in sich trug.
Das erste Geschenk, das er von seinem Vater erhielt, ein Geschenk gleich einer Botschaft in einer Zeitkapsel, einer Botschaft, die er erst verstand, als er erwachsen wurde, war sein Nachname. ›Rushdie‹ hatte Anis sich ausgedacht; der Name seines Vaters war ein ziemlicher Zungenbrecher gewesen: Khwaja Muhammad Din Khaliqi Dehlavi, ein prächtiger Name gewiss, typisch für ein lang vergangenes Delhi, ein Name, der hervorragend zu jenem Gentleman alter Schule passte, der auf dem einzig verbliebenen Foto mit wildem Blick den Betrachter anstierte, ein erfolgreicher Industrieller und Hobbyessayist, der in einem baufälligen haveli in der berühmten alten muhalla wohnte, dem Stadtteil Ballimaran, einem Labyrinth kleiner, gewundener Gassen am Chandni Chowk und Heimstatt des großen Farsi- und Urdu-Dichters Ghalib. Muhammad Din Khaliqi starb jung und hinterließ seinem Sohn ein Vermögen, das bald durchgebracht war, aber auch einen Namen, der für die moderne Welt eine zu schwere Bürde bedeutete. Anis nannte sich in ›Rushdie‹ um aus Bewunderung für Ibn Ruschd, Averroës für den Westen, jenen spanisch-arabischen Philosophen des zwölften Jahrhunderts aus Córdoba, der zum qadi, Richter, von Sevilla aufstieg, den Übersetzer und renommierten Kommentator der Werke von Aristoteles. Sein Sohn trug den Nachnamen zwei Jahrzehnte, ehe ihm aufging, dass sein Vater, ein wahrer Gelehrter des Islam, dem jeder religiöse Glaube abging, sich für diesen Namen entschied, weil er an Ibn Ruschd schätzte, dass er zu seiner Zeit an vorderster Front den rationalen Diskurs gegen eine allzu buchstabengetreue Koranauslegung geführt hatte, und weitere zwanzig Jahren sollten vergehen, ehe die Auseinandersetzung um Die satanischen Verse im zwanzigsten Jahrhundert ein Echo dieses achthundert Jahre alten Streites aufkommen ließ.
»Wenigstens«, sagte er sich, als der Sturm über ihn hereinbrach, »ziehe ich mit dem passenden Namen in diese Schlacht.« Von jenseits des Grabes hatte sein Vater ihm die Flagge gereicht, unter der er zum Kampf bereit war, die Flagge des Ibn Ruschd, die für Intellekt stand, für Argumente, Analyse, Fortschritt, für die Befreiung der Philosophie und der Bildung von den Fesseln der Theologie, für Verstand und gegen blinden Glauben, Unterwerfung, Duldsamkeit und Stagnation. Niemand will in den Krieg ziehen, doch wenn ein Krieg des Weges kommt, dann möge es der rechte Krieg sein, in dem es um das Wichtigste auf der Welt geht, damit man, wenn man denn schon kämpfen muss, ebenso gut auch ›Rushdie‹ heißen und dort sein könne, wohin einen der Vater stellte, nämlich in die Tradition des großen Aristotelikers Averroës, Abu I-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Ruschd.
Sie hatten ähnliche Stimmen, sein Vater und er. Ging er daheim ans Telefon, begannen Anis’ Freunde mit ihm zu reden, als wäre er sein Vater, und er musste sie unterbrechen, ehe sie etwas sagten, was ihnen unter Umständen peinlich war. Sie sahen sich auch ähnlich, und wenn sie während der ruhigeren Abschnitte ihrer holprigen Reise als Vater und Sohn einmal an einem warmen Abend gemeinsam auf der Veranda saßen, den Duft der Bougainvillea in der Nase, und angeregt über die Welt diskutierten, wussten sie beide, dass sie in vielerlei Hinsicht unterschiedlicher Meinung waren, letztlich aber dieselbe Gesinnung hatten. Und der Unglaube war, was sie am stärksten verband.
Anis war ein gottloser Mensch – in den Vereinigten Staaten noch heute eine schockierende Aussage, in Europa nichts Besonderes, und in einem Großteil der übrigen Welt ein fast unverständlicher Gedanke, ist dort die Vorstellung, nicht zu glauben, doch kaum in Worte zu fassen. Aber das war er nun einmal, ein gottloser Mensch, der viel über Gott wusste und viel über ihn nachgedacht hatte. Die Geburt des Islam faszinierte ihn, da der Islam die einzige der großen Weltreligionen war, die entstand, als es bereits Geschichtsschreibung gab, weshalb deren Prophet keine Legende war, über den ›Evangelisten‹ Hunderte von Jahren nach Leben und Tod des realen Menschen geschrieben hatten, ein Brei, vom heiligen Paulus, diesem genialen Bekehrer, zum problemlosen globalen Verzehr wieder aufgewärmt, sondern ein Mensch, über dessen Leben Zeugnisse existierten, dessen soziale wie ökonomische Verhältnisse genau bekannt waren; ein Mensch, der einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel durchlebte, vom Waisenkind zu einem erfolgreichen Kaufmann mit mystischen Neigungen heranwuchs und der eines Tages auf dem Berg Hira nahe Mekka den Erzengel Gabriel am Horizont sah, wie er den Himmel verdunkelte und ihn anwies, seine Worte ›zu rezitieren‹, um so, nach und nach, jenes Buch zu schreiben, das als ›Rezitierung‹, als al-Qur’an, Koran, bekannt werden sollte.
Dies wurde vom Vater an den Sohn weitergegeben: die Auffassung, dass die Geschichte vom Beginn des Islam faszinierend sei, weil es sich um ein Ereignis innerhalb der Geschichte handelte, weshalb es als solches offenkundig von den Geschehnissen, den Problemen und Ideen der Zeit seiner Entstehung beeinflusst worden war, dass darüber hinaus die Historisierung der Geschichte, der Versuch, zu verstehen, wie eine große Idee von diesen Kräften geformt wurde, die einzig sinnvolle Herangehensweise war und dass man Mohammed als einen genuinen Mystiker akzeptieren kann – so wie man akzeptieren kann, dass Johanna von Orléans tatsächlich Stimmen gehört hat oder dass die Offenbarungen des heiligen Johannes die ›realen‹ Erfahrungen einer gequälten Seele sind – ohne akzeptieren zu müssen, dass man, hätte man an jenem Tag neben dem Propheten des Islam auf dem Berg Hira gestanden, gleichfalls den Erzengel gesehen hätte. Offenbarung sollte als ein inneres, subjektives Erlebnis verstanden werden, nicht als objektive Realität, und ein offenbarter Text sollte wie jeder andere Text mit all den literarischen, historischen, psychologischen, linguistischen und soziologischen Instrumenten eines Kritikers untersucht werden. Kurzum, man sollte diesen Text als menschliches Artefakt behandeln, das, wie alle derartigen Artefakte, menschlicher Fehlbarkeit und Unvollkommenheit ausgesetzt war. Der amerikanische Kritiker Randall Jarrell nennt den Roman in seiner berühmten Definition ›ein langes Stück Text, mit dem irgendwas nicht stimmt‹, Anis Rushdie meinte zu wissen, was mit dem Koran nicht stimmt; der Text war an einigen Stellen durcheinandergeraten.
Laut Überlieferung begann Mohammed, kaum vom Berg herabgestiegen, das Offenbarte zu rezitieren und – er selbst war vermutlich Analphabet – wer immer von seinen Vertrauten gerade in der Nähe war, schrieb seine Worte auf dem Material nieder, das er gerade zur Hand hatte (Pergament, Stein, Leder, Blätter und manchmal, heißt es, sogar auf Knochen). Diese Niederschriften wurden bis nach Mohammeds Tod in seinem Haus in einer Truhe aufbewahrt; dann kamen die Gefährten zusammen, um die korrekte Abfolge der Offenbarungen festzulegen; und diese Festlegung ergab den heutigen kanonischen Text des Koran. Damit dieser Text ›vollkommen‹ sei, musste der Leser annehmen, dass a) der Erzengel die Worte Gottes ohne irgendeinen Lapsus übermittelt hat – was eine akzeptable Annahme sein dürfte, da Erzengel angeblich gegen Errata immun sind, dass b) der Prophet oder, wie er sich selbst nannte, der ›Gesandte‹ jedes Wort fehlerlos erinnerte, dass c) die hastige Niederschrift seiner Gefährten dieser über dreiundzwanzig Jahre währenden Offenbarungen ebenso fehlerfrei war und dass schließlich d) ihr kollektives Gedächtnis, als sie den Text in seine endgültige Form brachten, gleichfalls perfekt und fehlerlos funktionierte.
Anis Rushdie neigte nun keineswegs dazu, die Annahmen a), b) und c) in Frage zu stellen, allerdings fiel es ihm deutlich schwerer, sich mit Annahme d) abzufinden, denn wie ein jeder, der den Koran liest, ohne Weiteres feststellen kann, enthalten mehrere Suren oder Kapitel extreme Brüche, wechseln sie doch abrupt das Thema, das dann manches Mal ohne jede Vorankündigung in einer späteren Sure wieder auftaucht, die bis dahin von etwas völlig anderem gehandelt hat. Es war nun Anis’ lang gehegter Wunsch, diese Brüche zu glätten und so einen klareren und einfacher zu lesenden Text zu schaffen. Übrigens war dies kein geheimer, verschwiegener Plan; sein Vater redete offen mit Freunden beim Essen darüber. Der Gedanke, dieses Unterfangen könne ein Risiko für den revisionistischen Gelehrten bedeuten, kam gar nicht erst auf; es fehlte jede Andeutung von Gefahr. Vielleicht waren es schlicht andere Zeiten, und solche Ideen konnten erwogen werden, ohne dass man Angst vor irgendwelchen Repressalien haben musste, vielleicht war sein Freundeskreis auch besonders vertrauenswürdig, oder aber Anis war ein naiver Narr. Jedenfalls erzog er seine Kinder in einer solchen Atmosphäre offener Neugierde und Wissbegier. Nichts war unantastbar; es gab keine Tabus. Alles, auch die Heilige Schrift, konnte untersucht und vielleicht sogar verbessert werden.
Er hat es nie getan. Als er starb, wurde unter seinen Papieren kein entsprechender Text gefunden. Alkohol und schlecht gehende Geschäfte hatten seine letzten Jahre überschattet, weshalb er nur wenig Zeit oder Muße für die mühselige Kleinarbeit gewissenhafter Koran-Forschung fand. Doch selbst wenn seine Idee stets nur ein haltloser Traum oder leere, vom Whiskey beseelte Großsprecherei gewesen war, hinterließ sie beim Sohn ihre Spuren. Dies nämlich war das zweite große Geschenk von Anis an seine Kinder: ein anscheinend furchtloser Skeptizismus, gepaart mit einer fast völligen Freiheit von jeglicher Religion. Allerdings wurde ein gewisser Anschein gewahrt. Das ›Fleisch vom Schwein‹ kam im Hause Rushdie nicht auf den Tisch, auch keine ›Aasfresser der Erden und der See‹, für sie gab es kein Krabbencurry aus Goa. Und nur selten ging man fürs rituelle Auf und Nieder der Gebete zum Gebetsplatz der Moschee. Ein- oder zweimal im Jahr wurde in jener Zeit gefastet, die von den eher Urdu als Arabisch sprechenden Muslimen Indiens Ramzán, nicht Ramadan, genannt wurde. Und einmal, wenn auch nur für kurze Zeit, stellte Negin einen maulvi an, einen Religionsgelehrten, der ihren heidnischen Kindern die Grundlagen des Glaubens beibringen sollte. Doch die Heidenkinder rebellierten gegen den maulvi, gegen dieses wie Ho Chi Minh aussehende Wichtelmännchen, und trieben so gnadenlos ihren Spott mit ihm, dass er sich bei den Eltern bitterlich über ihren mangelnden Respekt für alles Heilige beklagte; doch Anis und Negin lachten nur und hielten zu ihren Kindern. Verwünschungen gegen die Ungläubigen murmelnd, verschwand der maulvi, um niemals wiederzukehren, und der Religionsunterricht wurde nicht wieder aufgenommen. Die Heidenkinder wuchsen heidnisch auf, und zumindest in der Windsor Villa fand man das so ganz in Ordnung.
*
Als er sich mit der blauweiß gestreiften Kappe von Bradley House und dem Mackintosh aus Serge von seinem Vater abwandte, um sich ins englische Leben zu stürzen, wurden ihm als Erstes die Sünden der Fremdheit aufgezeigt. Bis zu diesem Augenblick hatte er sich nie für irgendwie fremdartig gehalten. Nach Rugby aber sollte er die dort gelernte Lektion nicht mehr vergessen: dass es immer Menschen geben würde, die ihn nicht mochten, für die er so fremd wie ein grünes Männchen vom Mars oder Glibber aus dem Weltall blieb; und es war witzlos, ihre Ansichten ändern zu wollen. Entfremdung, eine Lektion, die er später unter dramatischeren Umständen aufs Neue zu lernen hatte.
Schnell fand er heraus, dass man in einem englischen Internat Anfang der sechziger Jahre drei Fehler machen konnte; beging man allerdings nur zwei der drei, mochte einem noch verziehen werden. Man durfte kein Ausländer, nicht klug und nicht schlecht in Sport sein. Kluge Ausländer, die in Rugby dennoch eine gute Zeit verlebten, waren meist elegante Kricketspieler; oder man war, wie im Fall eines seiner Mitschüler, des Pakistani Zia Mahmood, im Kartenspiel so gut, dass man einmal zu einem der weltbesten Bridgespieler werden sollte. Wer in Sport nicht gut war, musste darauf achten, nicht allzu klug zu sein und, wenn möglich, nicht allzu ausländisch, was der schlimmste aller Fehler war.
Er machte sich aller drei Fehler schuldig. Er war Ausländer, klug und unsportlich, weshalb er eine überwiegend unglückliche Schulzeit verbrachte, obwohl er gute Noten bekam und Rugby mit der Gewissheit verließ, ausgezeichneten Unterricht genossen zu haben – außerdem mit der erhebenden Erinnerung an großartige Lehrer, die einem, hat man Glück, für den Rest des Lebens bleibt. Da war P. G. Lewis, natürlich nur ›Pig‹ genannt, der in ihm die Liebe zur französischen Sprache weckte, so dass er von einem der Klassenletzten zu einem der Klassenbesten aufstieg, und dann waren da seine Geschichtslehrer, J. B. Hope-Simpson, alias ›Hope Stimulus‹, und J. W. ›Gut‹ Hele, dank deren sachkundigem Unterricht er ein kleines Stipendium für Geschichte an der alten Alma Mater seines Vaters gewann, für das King’s College in Cambridge, wo er E. M. Forster kennenlernen und ersten Sex erleben sollte, wenn auch nicht zur selben Zeit. (Weniger schätzte er, dass ›Hope Stimulus‹ ihn auch mit Tolkiens Herrn der Ringe bekannt machte, einem Werk, das sich in seinem Verstand wie eine Krankheit ausbreitete, eine Infektion, von der er nie wieder vollständig genas.) Sein alter Englischlehrer Geoffrey Helliwell trat am Tag nach der Verkündigung der Fatwa im britischen Fernsehen auf, und man konnte ihn sehen, wie er bekümmert das Haupt schüttelte und im liebenswerten, unbestimmten, leicht verblödeten Ton fragte: »Wer hätte gedacht, dass so ein netter, stiller Junge mal solchen Ärger macht?«
Niemand hatte ihn gezwungen, auf ein englisches Internat zu gehen. Negin war dagegen gewesen, ihren einzigen Jungen über Meere und Kontinente zu schicken. Anis hatte ihm die Gelegenheit geboten und ihn ermuntert, die Aufnahmeprüfung abzulegen, doch selbst nachdem er sie mit Auszeichnung bestanden und einen Platz in Rugby zugesprochen bekommen hatte, blieb es allein seine Entscheidung, ob er ging oder blieb. Später sollte es ihn wundern, welche Wahl der dreizehnjährige Junge traf, ein Junge, der Liebling seiner Eltern, der in seiner Stadt verwurzelt war, gute Freunde hatte und gern zur Schule ging (an der es für ihn nur ein einziges kleines Problem gab, das mit der Sprache Marathi zusammenhing). Warum beschloss der Junge, dies hinter sich zu lassen und um die halbe Welt ins Unbekannte zu reisen, weit fort von allen, die ihn liebten, von allem, was er kannte? War womöglich die Literatur schuld (schließlich war er zweifelsohne ein ziemlicher Bücherwurm)? In diesem Falle gehörten zu den Schuldigen gewiss die geliebten Jeeves und Bertie aus den Geschichten von P. G. Wodehouse, womöglich auch dessen Earl of Emsworth mit seiner prächtigen Zuchtsau, der ›Kaiserin von Blandings‹. Vielleicht hatte ihn zu diesem Schritt auch die zweifelhafte Faszination für die Welt der Agatha Christie bewegt, obwohl Christies Miss Marple gewiss im mörderischsten Dorf Englands lebte, im tödlichen St. Mary Mead? Dann war da noch Arthur Ransomes Buchreihe, die mit Der Kampf um die Insel begann und von Kindern erzählte, die sich auf Booten im Lake District herumtrieben, und viel, viel schlimmer noch, die grässlichen Eskapaden von Billy Bunter, der »Eule der Untersekunda«, diesem dicken Jungen in Frank Richards’ Grayfriars School, in dessen Klasse es mindestens einen Inder gab, Hurree Jamset Ram Singh, jenen »dunkelhäutigen Nabob von Bhanipur«, der ein bizarres, pompöses, syntaktisch verzerrtes Englisch sprach (›die Verzerrtheitung war phänomenal‹, hätte der dunkelhäutige Nabob vermutlich gesagt). Mit anderen Worten: War es die Entscheidung eines Kindes, in ein imaginäres England zu reisen, das allein in Büchern existierte? Oder war sein Entschluss vielmehr ein Hinweis darauf, dass unter der Oberfläche des ›netten, stillen Jungen‹ ein fremdes Wesen lauerte, ein ungewöhnlich abenteuerlustiger Bursche, der genügend Chuzpe besaß, den Sprung ins Dunkle zu wagen, gerade weil dies einen Schritt ins Unbekannte bedeutete – ein Heranwachsender, der intuitiv bereits die Fähigkeit seines künftigen erwachsenen Ichs erahnte, dort überleben, gar gedeihen zu können, wohin ihn seine Wanderungen führten, ein Jugendlicher, der zu leicht, vielleicht gar ein wenig zu skrupellos dem Traum von der ›Ferne‹ folgte, was natürlich auch hieß, der Langeweile des vertrauten ›Daheim‹ zu entkommen und sich ohne allzu großes Bedauern von der betrübten Mutter, den Schwestern zu verabschieden. Vielleicht ein wenig von allem. Jedenfalls machte er den Sprung, und vor seinen Füßen gabelte sich der Weg der Zukunft. Er folgte dem westlichen Pfad und hörte auf, der zu sein, der er hätte sein können, wäre er zu Hause geblieben.