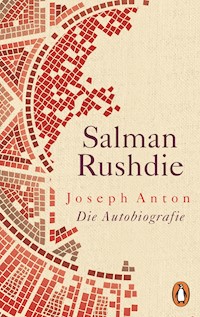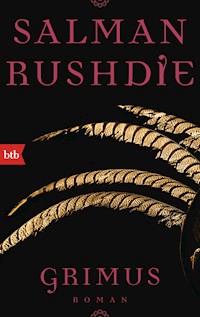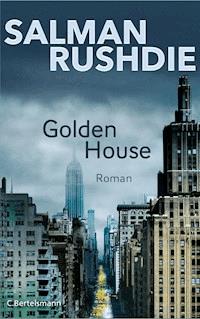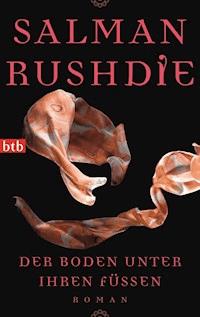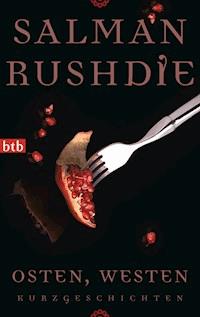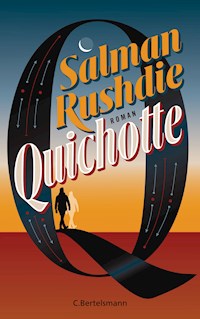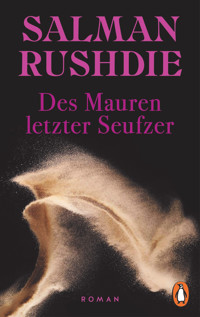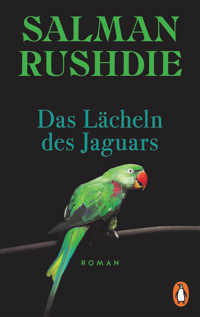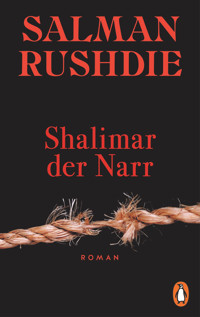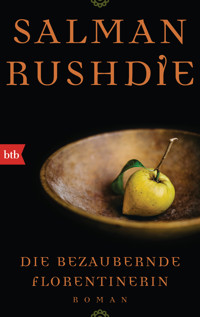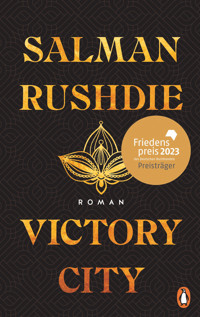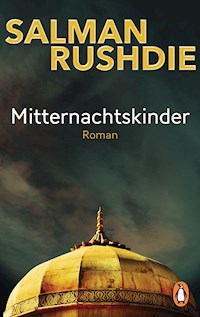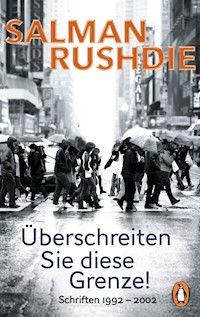10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Weltereignis: Salman Rushdie erzählt die Geschichte des Attentats auf ihn und schafft daraus große Literatur
Im August 2022 wird Salman Rushdie während einer Lesung auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Mehr als dreißig Jahre nachdem das iranische Regime wegen seines Romans »Die satanischen Verse« eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen hat, holt ihn die Bedrohung ein. Salman Rushdie überlebt den Anschlag und hält seinem Angreifer das schärfste Schwert entgegen: Er verarbeitet diese unvorstellbare Tat, die die ganze Welt in Atem hielt, zu einer Geschichte über Angst, Dankbarkeit und den Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung.
»Knife« ist Salman Rushdies persönlichstes Werk, dringlich und unerschütterlich ehrlich. Eine lebensbejahende Hymne an die Macht der Literatur, dem Undenkbaren einen Sinn zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Knife ist Salman Rushdies persönlichstes Werk, dringlich und unerschütterlich ehrlich. Eine lebensbejahende Hymne an die Macht der Literatur, dem Undenkbaren einen Sinn zu geben.
Im August 2022 wird Salman Rushdie während einer Lesung in New York auf offener Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Mehr als dreißig Jahre nachdem das iranische Regime wegen seines Romans Die satanischen Verse eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen hat, holt ihn die Bedrohung ein. Salman Rushdie überlebt den Anschlag und hält seinem Angreifer das schärfste Schwert entgegen: Er verarbeitet diese unvorstellbare Tat, die die ganze Welt in Atem hielt, zu einer Geschichte über Angst, Dankbarkeit und den Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung.
Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, ging mit vierzehn Jahren nach England und studierte später in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman Mitternachtskinder, für den er den Booker Prize erhielt, wurde er weltberühmt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2007 schlug ihn Königin Elisabeth II. zum Ritter. 2022 ernannte ihn das deutsche PEN-Zentrum zum Ehrenmitglied. 2023 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.
»Literatur, das ist für Salman Rushdie immer die Möglichkeit gewesen, der Welt, wie sie ist, andere Welt-Möglichkeiten entgegenzuhalten. Die Welt neu zu erfinden.« DIEZEIT, Volker Weidermann
www.penguin-verlag.de
Salman Rushdie
Knife
Gedanken nach einem Mordversuch
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Die Originalausgabe erschien 2024
unter dem Titel Knife
bei Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2024 by Salman Rushdie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © FAVORITBUERO, München, nach einem Entwurf von Arsh Raziuddin
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31338-8V001
www.penguin-verlag.de
Dieses Buch ist jenen Männern und Frauen gewidmet, die mein Leben gerettet haben.
Wir sind nicht länger das, was wir waren,bevor das Unheil namens gestern eintrat.
Samuel Beckett
Teil einsDer Engel des Todes
1 Messer
Am 12. August 2022, einem sonnigen Freitagmorgen um Viertel vor elf, wurde ich von einem jungen Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet, nachdem ich gerade die Bühne des Amphitheaters in Chautauqua betreten hatte, um darüber zu reden, wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen.
Ich trat zusammen mit Henry Reese auf, der mit seiner Frau Diane Samuels das Pittsburgher Projekt City of Asylum gegründet hatte und dank dieser Stadt des Asyls eine Zuflucht für mehrere Autoren schaffen konnte, deren Leben in ihrem eigenen Land gefährdet war. In der Geschichte, die Henry und ich in Chautauqua erzählen wollten, sollte es um Folgendes gehen: die Gründung sicherer Orte in Amerika für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus fremden Ländern und meine Beteiligung an den Anfängen dieses Projekts. Unser Auftritt war Teil einer Veranstaltungswoche der Chautauqua Institution zum Thema: »Mehr als nur eine Zuflucht: Amerikas Haus und Heimat, eine Neubestimmung«.
Zu unserem Gespräch ist es nie gekommen. Wie ich schon bald herausfinden sollte, war das Amphitheater an diesem Tag kein sicherer Ort für mich.
Dieser Moment läuft noch immer wie in Zeitlupe vor mir ab. Mein Blick folgt dem Mann, der im Publikum aufspringt, losrennt und rasch näher kommt. Ich beobachte jeden einzelnen Schritt seines ungestümen Laufs, und ich sehe, wie ich mich aufrichte und zu ihm umdrehe. (Ich bleibe ihm zugewandt. Ich habe ihm nie den Rücken zugekehrt. Mein Rücken weist keine Verletzungen auf.) Um mich zu schützen, hebe ich die linke Hand. Er stößt das Messer hinein.
Danach folgen noch viele Stiche – in meinen Nacken, meine Brust, in mein Auge, überallhin. Ich spüre, wie meine Beine nachgeben, und ich falle.
*
Donnerstag, der 11. August, war mein letzter unbeschwerter Abend. Sorglos spazierten Henry, Diane und ich durch die Anlagen der Chautauqua Institution zu einem angenehmen Abendessen im 2 Ames, einem Restaurant am Rand eines grünen Parks genannt Bestor Plaza. Wir erinnerten uns an die Rede, die ich achtzehn Jahre zuvor in Pittsburgh über meine Rolle bei der Gründung des internationalen Netzwerks Cities of Refuge gehalten hatte. Henry und Diane hatten meine Rede gehört und wurden durch sie inspiriert, auch in Pittsburgh eine Stadt des Asyls zu schaffen. Sie begannen damit, ein kleines Haus zu finanzieren und Huang Xiang zu sponsern, einen chinesischen Dichter, der die Außenmauern seiner neuen Unterkunft unübersehbar mit einem Gedicht in großen weißen chinesischen Lettern bemalte. Nach und nach erweiterten Henry und Diane ihr Projekt, bis es schließlich eine ganze Straße mit Häusern des Asyls gab, den Sampsonia Way im Norden der Stadt. Ich freute mich darauf, in Chautauqua mit ihnen ihren Erfolg feiern zu können.
Dass sich der Mann, der mich töten wollte, bereits auf dem Gelände der Chautauqua Institution befand, konnte ich nicht wissen. Er hatte sich mit einem gefälschten Ausweis Zutritt verschafft, sein Deckname eine Zusammensetzung der Namen einiger bekannter Schia-Islamisten; und bereits während wir zum Abendessen und später zurück zum Gästehaus gingen, in dem wir übernachteten, war er auch da, irgendwo, bereits seit mehreren Nächten, streifte durch die Anlage, schlief im Freien, erkundete den Tatort für den geplanten Angriff, schmiedete Pläne und blieb von Sicherheitspersonal und Überwachungskameras unbemerkt. Wir hätten ihm jederzeit zufällig über den Weg laufen können.
In diesem Bericht will ich seinen Namen nicht nennen. Mein Angreifer, mein Attentäter, der Affenblöde, der Annahmen über mich machte, mit dem ich ein beinahe tödliches Aufeinandertreffen hatte … Ich ertappe mich dabei, dass ich ihn in Gedanken, man möge es mir nachsehen, nur »Arschloch« nenne. Im Rahmen dieses Textes aber soll er schicklicherweise »A.« heißen. Welche Namen ich ihm gebe, wenn ich allein zu Hause bin, geht nur mich etwas an.
Dieser »A.« scheute die Mühe, sich über den Mann zu informieren, den er töten wollte. Seinen eigenen Worten zufolge hatte er kaum zwei Seiten aus meinen Büchern gelesen, sich aber einige Filme auf YouTube über mich angesehen – mehr war nicht nötig. Was die Schlussfolgerung zulässt: Worum auch immer es bei diesem Attentat ging, es ging nicht um Die satanischen Verse.
Worum es tatsächlich ging, das versuche ich in diesem Buch herauszufinden.
*
Am Morgen des 12. August frühstückten wir zeitig mit den Sponsoren der Veranstaltung auf der Außenterrasse des großartigen Institutionshotels Athenaeum. Ich bin kein Freund ausgiebigen Frühstückens und gab mich mit einem Kaffee und einem Croissant zufrieden. Bei mir saß Sony Ton-Aime, der Michael I. Rudell Director of the Literary Arts von Chautauqua. Es folgte ein wenig büchernärrischer Small Talk unter anderem darüber, wie verwerflich oder tugendhaft es sei, Bücher bei Amazon zu bestellen. (Ich gestand, es hin und wieder zu tun.) Dann gingen wir durch die Hotellobby und über einen kleinen Platz zum Backstage-Bereich des Amphitheaters, wo Henry mich seiner neunzigjährigen Mutter vorstellte, die ich sehr nett fand.
Kurz bevor ich die Bühne betrat, wurde mir ein Umschlag mit einem Scheck ausgehändigt – mein Honorar. Ich steckte ihn in die Innentasche meiner Jacke, dann war Showtime. Sony, Henry und ich gingen auf die Bühne.
Das Amphitheater hat viertausend Plätze. Es war nicht ausverkauft, aber doch ziemlich voll. Sony trat auf ein Podium auf der linken Bühnenseite und stellte uns vor. Ich saß auf der rechten Bühnenseite. Das Publikum spendete wohlwollenden Beifall. Ich weiß noch, dass ich eine Hand hob, um mich für den Applaus zu bedanken. Dann sah ich aus dem rechten Augenwinkel – das Letzte, was mein rechtes Auge je sehen würde – aus der rechten Seite des Sitzbereichs einen Mann in Schwarz auf mich zurennen. Schwarze Kleidung, schwarze Maske. Er kam so schnell und geduckt auf mich zu wie ein gedrungenes Geschoss. Ich erhob mich und sah ihn näher kommen. Ich habe nicht versucht fortzulaufen. Ich war wie erstarrt.
Dreiunddreißigeinhalb Jahre waren vergangen seit Ajatollah Ruhollah Chomeinis berüchtigter Todesdrohung gegen mich und all jene, die zur Veröffentlichung der Satanischen Verse beitrugen; und ich gestehe, während dieser Jahre habe ich mir manches Mal vorgestellt, wie mein Attentäter sich aus diesem oder jenem Publikum löst und auf ebendiese Weise mir entgegeneilt. Als ich nun die mordlüsterne Gestalt auf mich zustürzen sah, war mein erster Gedanke daher: Da bist du ja. Du bist es also. Man sagt, Henry James’ letzte Worte seien gewesen: »So ist es also doch gekommen, dieses ganz besondere Etwas.« Der Tod kam auch auf mich zu, aber ich fand nichts Besonderes daran. Ich fand ihn nur anachronistisch.
Das war mein zweiter Gedanke: Warum heute? Echt jetzt? Es ist so lang her. Warum heute? Warum nach all den Jahren? Die Welt hatte sich doch gewiss weitergedreht, dieses Kapitel war längst abgeschlossen. Was da kam und sich so rasch näherte, war jedoch eine Art Zeitreisender, ein mörderischer Geist aus der Vergangenheit.
An diesem Morgen gab es im Amphitheater keine Security – warum nicht? Keine Keine Ahnung –, er hatte also freie Bahn. Ich stand einfach nur da und starrte ihn an, stand da wie angewurzelt, ein Kaninchendepp im Scheinwerferlicht.
Dann hatte er mich erreicht.
Das Messer habe ich nie gesehen, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, ob es lang war oder kurz, ein Messer mit breiter Bowieklinge oder schmal wie ein Stilett, gezackt wie ein Brotmesser, ein Krummdolch, das Klappmesser eines Straßenkids oder gar ein ganz gewöhnliches Tranchiermesser aus der Küche seiner Mutter. Es interessiert mich auch nicht. Sie war jedenfalls brauchbar, diese unsichtbare Waffe, und sie tat, was sie tun sollte.
*
Zwei Nächte vor meinem Flug nach Chautauqua habe ich geträumt, ich würde von einem Mann mit einem Speer attackiert, einem Gladiator in einem römischen Amphitheater, wenn auch ohne brüllendes, blutrünstiges Publikum. Ich rollte auf dem Boden hin und her, wich den Stößen des Gladiators aus und schrie. Diesen Traum hatte ich nicht zum ersten Mal. Zweimal zuvor hatte sich mein Traum-Ich bereits so verzweifelt hin und her gewälzt, dass das wahre, schlafende, gleichfalls schreiende Ich den Leib – meinen Leib – aus dem Bett warf und ich schmerzhaft auf dem Schlafzimmerboden landete, wovon ich wach wurde.
Diesmal fiel ich nicht aus dem Bett. Eliza, meine Frau – die Romanautorin, Dichterin und Fotografin Rachel Eliza Griffiths –, weckte mich gerade noch rechtzeitig. Der Traum war so lebendig, so gewalttätig gewesen, dass ich mich zitternd im Bett aufsetzte. Ein Traum wie eine Vorahnung (obwohl Vorahnungen zu dem gehören, woran ich nicht glaube), schließlich sollte die Veranstaltung in Chautauqua, auf der ich sprechen würde, in einem Amphitheater stattfinden.
»Ich will da nicht hin«, habe ich zu Eliza gesagt. Doch so viele Menschen rechneten mit mir – Henry Reese rechnete mit mir, für die Veranstaltung war seit geraumer Zeit geworben worden, man hatte Eintrittskarten verkauft –, und für mein Erscheinen würde ich gut bezahlt werden. Wie es nun mal so geht, hatten wir einige größere Rechnungen zu begleichen, die Klimaanlage im gesamten Haus war veraltet, drohte zusammenzubrechen und musste erneuert werden, das Geld käme uns also sehr zupass. »Ich sollte wohl besser hinfahren«, sagte ich.
Chautauqua, die Stadt, ist nach dem See Chautauqua benannt, an dessen Ufer sie liegt. »Chautauqua« ist ein Wort der Erie-Sprache, die vom Volk der Erie gesprochen wurde, Volk und Sprache aber gibt es nicht mehr, die Bedeutung des Wortes ist daher unklar. Es könnte »zwei Mokassins« heißen oder »ein in der Mitte geschnürter Beutel«, ebenso gut aber auch etwas völlig anderes. Vielleicht beschreibt dieses Wort die Kontur des Sees, vielleicht aber auch nicht. Es gehört zu dem, was verloren ging in der Vergangenheit, dort, wo wir alle enden, die meisten von uns vergessen.
1974 stieß ich zum ersten Mal auf dieses Wort, etwa zu jener Zeit also, da ich die Arbeit an meinem ersten Roman beendete. Ich las es in dem Kultbuch jenes Jahres, in Robert M. Pirsigs Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Über das Buch weiß ich kaum noch etwas – ich habe weder für Motorräder noch für Zen-Buddhismus viel übrig –, aber ich erinnere mich, dass mir dieses seltsame Wort gefiel und auch das Besondere der »Chautauquas«, jener Treffen, bei denen Ideen in einer Atmosphäre der Toleranz, Offenheit und Freiheit diskutiert wurden. Von der Stadt am See breitete sich die Chautauqua-Bewegung über das ganze Land aus, und Theodore Roosevelt nannte sie »das Amerikanischste in Amerika«.
Ich war schon mal in Chautauqua aufgetreten, fast genau zwölf Jahre zuvor, im August 2010. Ich erinnerte mich noch gut an die behagliche, abgeschiedene Atmosphäre der Chautauqua Institution, an die ordentlichen, sauberen, baumgesäumten Straßen rund um das Amphitheater. (Zu meiner Überraschung erwartete mich allerdings ein anderes Amphitheater, das alte war 2017 abgerissen und neu aufgebaut worden.) Innerhalb der Mauern der Institution versammelten sich silberhaarige, weltoffene Menschen zu einer idyllischen Gemeinschaft, lebten in komfortablen Holzhäusern und fanden es unnötig, abends die Türen zu verschließen. Dort Tage zu verbringen, fühlte sich an wie ein Schritt zurück in der Zeit, in eine frühere, unschuldigere Welt, wie es sie vielleicht nur in Träumen gab.
An jenem letzten unbeschwerten Abend des 11. August stand ich vorm Gästehaus und schaute hoch zum Vollmond, der hinab auf den See leuchtete. Allein, von der Nacht umhüllt, nur der Mond und ich. In meinem Roman Victory City behaupten die ersten Könige des südindischen Reiches Bisnaga, vom Mondgott abzustammen, sie beanspruchen also die »lunare Erbfolge« für sich, der auch Gott Krishna angehört oder der mächtige, Achilles nicht unähnliche Krieger Arjuna aus dem Mahabharata. Mir gefiel der Gedanke, dass keine schlichten Erdlinge in einem seltsamerweise nach dem griechischen Sonnengott Apollo benannten Schiff zum Mond flogen, sondern dass die Götter des Mondes vom Trabanten auf die Erde herabgestiegen waren. So stand ich eine Weile im Mondlicht, hing Mondgedanken nach und dachte auch an jene apokryphe Geschichte, laut der Neil Armstrong, als er den Mond betrat, »Genießen Sie es, Mr. Gorsky« gemurmelt haben soll, da er als Junge in Ohio gehört hatte, wie seine Nachbarn, die Gorskys, sich stritten, weil Mr. G unbedingt einen Blowjob wollte. »Den bekommst du erst, wenn der Junge von nebenan auf dem Mond spazieren geht«, hatte Mrs. Gorsky erwidert. Leider ist die Geschichte nicht wahr, aber meine Freundin Allegra Huston hat darüber das Drehbuch zu einem lustigen Film geschrieben.
Und ich dachte an »Die Entfernung des Mondes« in Italo Calvinos Cosmicomics, eine Geschichte über eine Zeit, in der unser Mond der Erde viel näher als heute war und Liebespärchen für ein romantisches Stelldichein zu ihm hinaufhüpfen konnten.
Und ich dachte an Tex Averys Zeichentrickfilm Billy Boy über eine kleine Ziege, die den Mond gefressen hat.
Auf derart frei assoziierende Weise funktioniert mein Verstand.
Schließlich musste ich auch an Georges Méliès’ vierzehnminütigen Film Le Voyage dans la Lune denken, diesen frühen Kinoklassiker aus dem Jahre 1902 über die ersten Menschen auf dem Mond, die mit einer ungeheuer langen Kanone in einer kugelförmigen Kapsel hinaufgeschossen werden und Zylinder, Gehröcke sowie Regenschirme tragen. Das folgende Bild zeigt die wohl berühmteste Aufnahme aus diesem Film – die Landung auf dem Mond:
Als mir dieses Bild vom Raumschiff durch den Sinn ging, das den Mond im rechten Auge verletzt, konnte ich nicht ahnen, was am nächsten Morgen mit meinem rechten Auge passieren würde.
Ich denke zurück an diesen glücklichen Mann, der sich da an jenem Donnerstagabend im sommerlichen Mondlicht badete. Er ist glücklich, weil sich ihm ein schöner Anblick bietet und weil er verliebt ist und weil er mit seinem jüngsten Roman fertig ist – gerade hat er ihm den letzten Schliff gegeben, hat die Fahnen Korrektur gelesen –, und die ersten Leser sind begeistert. Sein Leben fühlt sich gut an. Wir aber wissen, was er nicht weiß. Wir wissen, dieser glückliche Mann am See schwebt in Lebensgefahr. Doch davon ahnt er nichts, was unsere Angst um ihn nur umso größer macht.
Dieses literarische Stilmittel nennt man epische Vorausdeutung. Eines der berühmtesten Beispiele ist der Beginn von Hundert Jahre Einsamkeit: »Viele Jahre später, vor dem Erschießungskommando […]« Wenn wir Leserinnen und Leser wissen, was die literarischen Figuren nicht wissen können, möchten wir sie warnen: Lauf, Anne Frank, morgen werden sie dein Versteck entdecken. Während ich an diesen letzten sorgenfreien Abend zurückdenke, fällt der Schatten der Zukunft über meine Erinnerungen, aber ich kann mich nicht warnen. Dafür ist es zu spät. Ich kann nur noch die Geschichte erzählen.
Hier ist ein Mann, allein im Dunkeln, nicht ahnend, wie nah die Gefahr ist.
Hier ist ein Mann, der früh zu Bett geht. Am nächsten Morgen wird sich sein Leben ändern. Davon weiß er nichts, der arme Unschuldige. Er schläft.
Und während er schläft, stürzt die Zukunft auf ihn ein.
Seltsamerweise ist es jedoch die Vergangenheit, die zurückkehrt, meine eigene Vergangenheit, die auf mich einstürzt, kein Traumgladiator, sondern ein maskierter Mann mit einem Messer, der einen drei Jahrzehnte alten Mordaufruf ausführen will. Im Tod gehören wir alle dem Gestern, sind wir auf immer in der Vergangenheitsform gefangen. Das war der Käfig, in den mich das Messer zwingen wollte.
Nicht die Zukunft. Die wiederkehrende Vergangenheit, die mich in der Zeit zurückversetzen wollte.
*
Warum habe ich nicht gekämpft? Warum bin ich nicht weggelaufen? Ich stand einfach nur da wie eine Piñata und ließ ihn auf mich einstechen. Bin ich denn so schwach, dass ich nicht den geringsten Versuch unternehmen konnte, mich zu wehren? War ich so fatalistisch, dass ich mich einfach meinem Mörder ergab?
Warum habe ich nicht reagiert? Andere, Familie und Freunde, haben versucht, diese Frage für mich zu beantworten. »Du warst fünfundsiebzig, als es passierte, er vierundzwanzig. Du hattest keine Chance.« »Vielleicht bist du in Schockstarre gefallen, noch ehe er dich erreicht hat.« Und immer wieder: »Wo zum Teufel war die Security?«
Ich weiß nicht, was ich darüber denke oder wie ich darauf antworten soll. An manchen Tagen ist es mir peinlich, und ich schäme mich sogar, weil ich mich nicht gewehrt habe. An anderen Tagen ermahne ich mich, nicht dumm zu sein: Was hätte ich denn tun sollen?
Folgendes habe ich mir zu meiner Tatenlosigkeit zusammengereimt: Für die Opfer von Gewalt gerät das Verständnis von Realität ins Wanken. Kinder gehen zur Schule, Gläubige in eine Synagoge, Käufer in einen Supermarkt, ein Mann betritt die Bühne eines Amphitheaters; sie alle bewegen sich gewissermaßen in einem stabilen Weltbild. Eine Schule ist ein Ort der Bildung, eine Synagoge ein Ort der Andacht, ein Supermarkt ein Ort zum Einkaufen, eine Bühne ein Ort zum Auftreten. Das ist der Rahmen, in dem sie sich selbst sehen.
Gewalt zerschlägt dieses Bild. Plötzlich kennt man die Regeln nicht mehr – weiß nicht, was man sagen, wie man sich benehmen, welche Wahl man treffen soll. Man erkennt die äußere Gestalt der Dinge nicht länger. Die Wirklichkeit löst sich auf und wird durch Unverständliches ersetzt. Furcht, Panik und Lähmung verdrängen das rationale Denken. »Klar denken« wird unmöglich, denn wer mit Gewalt konfrontiert wird, weiß nicht mehr, was »klar denken« heißen soll. Man reagiert – wir reagieren – verunsichert, gar gestört. Unser Verstand versteht nicht, wie er noch funktionieren kann.
An jenem schönen Morgen in jener wunderbaren Umgebung rannte die Gewalt auf mich zu, und meine Realität zerfiel. Es wird vielleicht nicht sonderlich überraschen, dass ich in den wenigen Sekunden, die mir blieben, nicht wusste, was ich tun sollte.
*
Während der ersten Tage nach dem Attentat, als ich in meinem Krankenhausbett lag und diverse Teile meines Körpers durch Metallklammern zusammengehalten wurden, verkündete ich jedem, der bereit war, mir zuzuhören, voller Stolz: »Ich habe in keinem Moment mein Bewusstsein verloren; ich kann mich an alles erinnern.« Heute weiß ich, dass das nicht stimmt. Richtig ist, dass ich meine Umgebung verschwommen wahrnahm und nicht völlig bewusstlos wurde, doch es stimmt nicht, dass meine Beobachtungsgabe normal funktioniert hätte, nicht einmal ansatzweise. Die Gewissheit meiner Behauptung rührte vermutlich von den Schmerzmitteln her, die ich damals bekam – Fentanyl, Morphium, was auch immer. Das Folgende ist daher eine Collage, Bruchstücke meiner Erinnerung, ergänzt um die Aussagen einiger Augenzeugen sowie um einige Auszüge aus den Nachrichten.
Ich erhielt einen heftigen Schlag gegen den Kiefer, und ich weiß noch, dass ich dachte: Er hat ihn gebrochen. Mir werden alle Zähne ausfallen.
Dann dachte ich, der Kerl kann wirklich zuschlagen. (Später erfuhr ich, dass er Boxunterricht genommen hatte.) Heute weiß ich, dass er außerdem ein Messer in der Faust hielt. Blut lief mir über den Hals. Und während ich fiel, spürte ich, dass etwas auf mein Hemd spritzte.
Eine Reihe von Dingen passierte gleich darauf sehr schnell, und ich bin mir über die genaue Abfolge im Unklaren. Da war die tiefe Stichwunde in meiner linken Hand, die sämtliche Sehnen und die meisten Nerven durchtrennt hatte. Und es gab mindestens zwei weitere Messerhiebe in meinen Nacken – einer quer über den Hals, eher rechts, eine weitere Schnittwunde vor allem oben im Gesicht, gleichfalls rechts. Blicke ich heute auf meine Brust, sehe ich in der Mitte von oben nach unten eine Reihe von Wunden, zwei Einstiche auf der unteren rechten Seite sowie einen Schnitt im oberen rechten Schenkel. Außerdem ist da noch eine Wunde links am Mund und auch eine am Haaransatz.
Und da war der Messerstich ins Auge. Der brutalste Hieb, eine tiefe Wunde. Die Klinge durchtrennte den optischen Nerv, was bedeutete, dass man die Sehfähigkeit nicht retten konnte. Das Auge war verloren.
Er stach wie verrückt um sich, stach und schlitzte; das Messer hieb auf mich ein, als besäße es ein Eigenleben, und ich fiel nach hinten, fort vom Angreifer, prallte heftig mit der linken Schulter auf den Boden.
*
Einige in der Menge – die ihr Bild von der Welt nicht aufgeben und nicht sehen wollten, was wirklich geschah – glaubten, der Angriff sei inszeniert, eine Performance, die unterstreichen sollte, wie wichtig das Thema Sicherheit für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist, über das wir reden wollten.
Selbst Henry Reese in seinem Sessel neben mir brauchte einen Moment, um seine Realitätswahrnehmung anzupassen. Dann aber sah er, dass der Mann förmlich an mir klebte, und er sah mein Blut.
Was dann geschah, war reines Heldentum.
Henry behauptet, er habe »instinktiv« gehandelt, aber da bin ich mir nicht so sicher. Henry war wie ich über siebzig, A. vierundzwanzig und auf Mord aus. Henry hastete über die Bühne zu ihm und packte ihn. Meiner Meinung nach wäre eine bessere Beschreibung: Er handelte entsprechend seiner besten Charaktereigenschaft. Mit anderen Worten: im Einklang mit seiner Persönlichkeit. Sein Mut ist eine Konsequenz dessen, wer er ist.
Und dann handelten auch Leute aus dem Publikum entsprechend ihrer besten Charaktereigenschaft. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute auf die Bühne stürmten, um zu helfen, aber von meiner Lage auf dem Boden war ich mir eines Gedränges von Menschen bewusst, die sich abmühten, den mordlüsternen Mann zu bändigen, obwohl er jung war, stark, ein blutiges Messer in der Hand hielt und nicht leicht zu bändigen war. Wären Henry und das Publikum nicht gewesen, würde ich heute nicht hier sitzen und diese Worte schreiben.
Ich habe ihre Gesichter nicht gesehen und kenne ihre Namen nicht, aber sie sind die Ersten, die mein Leben retteten. Und so begegnete mir an jenem Morgen in Chautauqua nahezu gleichzeitig das Schlimmste und das Beste am Menschen. So aber sind wir als Spezies: In uns steckt die Möglichkeit, nahezu grundlos einen alten Fremden zu ermorden – jene Fähigkeit in Shakespeares Jago, die Coleridge »unmotivierte Bösartigkeit« nannte –, in uns findet sich aber auch das Gegenmittel zu dieser Krankheit – Mut, Selbstlosigkeit und die Bereitschaft, das eigene Leben zu riskieren, um einem alten, am Boden liegenden Fremden zu helfen.
Soweit mir bekannt ist, tauchte irgendwann ein Gesetzeshüter auf und nahm den Attentäter in Gewahrsam. Davon habe ich aber nichts mitbekommen. Ich hatte andere Sorgen.
*
Eine Pistole kann aus der Distanz abgefeuert werden. Eine Kugel kann über eine weite Strecke fliegen, um eine tödliche Brücke zwischen Mörder und Ermordetem zu schlagen.
Ein Schuss ist eine Aktion aus der Ferne, ein Angriff mit dem Messer, einer Nahkampfwaffe, etwas geradezu Intimes; und die Verbrechen, die mit einem Messer begangen werden, sind Resultat intimer Begegnungen. Hier bin ich, du Dreckskerl, flüstert das Messer seinem Opfer zu. Ich habe auf dich gewartet. Siehst du mich? Ich bin gleich vor deinen Augen, versenke meine Attentäterschärfe in deinen Hals. Spürst du’s? Hier, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen. Ich bin bei dir. Direkt vor dir.
Laut Nachrichtenmeldungen griff mich A. siebenundzwanzig Sekunden lang an. In siebenundzwanzig Sekunden könnte man – sofern religiös gesinnt – das Vaterunser aufsagen. Oder man könnte, hat man es nicht so mit der Religion, laut ein Sonett von Shakespeare lesen, vielleicht jenes über den Sommertag, eines meiner Lieblingssonette, Nummer 130: »Die liebsten Augen sind mir kein Gestirn1.« Vierzehn Zeilen jambische Pentameter, Oktett und Sextett: So lang waren wir zusammen in diesem einen intimen Moment, den wir je miteinander hatten und haben sollten. Die Intimität von Fremden. Eine Formulierung, mit der ich manchmal jenes freudige Geschehen beschrieb, zu dem es beim Akt des Lesens kommt, dieser glücklichen Vereinigung der Innenleben von Autor und Leser.
An unserer Vereinigung aber war nichts glücklich. Nun, für A. war sie es vielleicht. Schließlich hatte er sein Opfer gefunden, die Klinge drang in den Leib seines Opfers ein, wieder und wieder, und er hatte jeden Grund, anzunehmen, mit seinem Bemühen erfolgreich zu sein, auf der Bühne der Geschichte zu stehen und jener zu sein, der die alte Bedrohung in die Tat umsetzte.
Ja, ich glaube, er könnte in diesem Moment unserer Intimität wirklich glücklich gewesen sein.
Dann aber wurde er von mir abgezogen und festgehalten, seine siebenundzwanzig Sekunden Ruhm waren vorbei. Und er war wieder ein Niemand.
*
Ich erinnere mich, dass ich auf dem Boden lag und sah, wie sich mein Blut in einer Lache um mich herum ausbreitete. Das ist eine Menge Blut, dachte ich. Und dann: Ich sterbe. Ich fand mich nicht dramatisch, fühlte mich auch nicht besonders schrecklich. Es war eben nur durchaus möglich. Ja, es war sogar sehr wahrscheinlich.
Es kommt selten vor, dass jemand eine Nahtoderfahrung beschreiben kann. Gleich zu Anfang möchte ich jedoch festhalten, was nicht passiert ist. Es gab nichts Übernatürliches, keinen »Lichttunnel«, kein Gefühl, als würde ich meinen Körper verlassen. Im Gegenteil, ich habe mich selten so fest mit meinem Körper verbunden gefühlt. Mein Körper starb, und er nahm mich mit. Das war eine enorm physische Erfahrung. Als ich mich später außer Lebensgefahr befand, habe ich mich gefragt, wer oder was dieses »mich« denn sein sollte, dieses »Ich«, dieses Selbst, das in meinem Körper steckte, aber nicht der Körper war, dieses Wesen, das Gilbert Ryle einmal den »Geist in der Maschine« nannte. Ich habe nie an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt, und meine Erfahrung in Chautauqua scheint das zu bestätigen. Dieses »mich«, wer oder was es auch immer sein mochte, befand sich jedenfalls am Rand des Todes, zusammen mit dem Körper, in dem es enthalten war. Früher habe ich manchmal halb im Scherz gesagt, unsere Empfindung eines unkörperlichen »mich« oder »ich« könnte bedeuten, dass wir eine sterbliche Seele besitzen, eine Wesenheit oder ein Bewusstsein, das zusammen mit unserer physischen Existenz endet. Heute denke ich, dass es vielleicht doch nicht nur ein Scherz war.
Nichts von dem dachte ich, als ich auf dem Boden lag. Vielmehr ging mir durch den Kopf, und dieser Gedanke war schwer zu ertragen, dass ich unter Fremden starb, weit fort von den Menschen, die ich liebte. Mehr als alles andere fühlte ich eine tiefe Einsamkeit. Ich würde Eliza nie wiedersehen. Ich würde meine Söhne nie wiedersehen oder meine Schwester und deren Töchter.
Irgendwer sollte ihnen Bescheid geben, wollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob mich jemand gehört oder verstanden hat. Meine Stimme klang wie weit entfernt, heiser, stockend, vernuschelt, ungenau.
Ich sah wie durch einen Spiegel. Undeutlich hörte ich Geräusche. Es gab jede Menge Lärm. Und ich war mir bewusst, dass sich eine Gruppe von Menschen über mich beugte, die alle zugleich schrien. Eine gezackte Menschenkuppel, die meine liegende Gestalt umschloss. Eine Servierglocke, um es mit einem Wort aus der Küche zu sagen. Als sei ich der Hauptgang auf einem Teller – blutig serviert, saignant – und man hielt mich warm, hielt mich gleichsam unterm Deckel.
Ich muss über Schmerzen reden, denn was den Schmerz betrifft, unterscheiden sich meine Erinnerungen deutlich von denen der Menschen um mich herum, zu denen mindestens zwei Ärzte aus dem Publikum gehörten. Einige aus dieser Gruppe hatten Journalisten erzählt, ich hätte vor Schmerz geschrien, hätte immer wieder gefragt: Was ist mit meiner Hand? Warum tut die so weh? In meiner Erinnerung gibt es eigenartigerweise kaum Schmerz. Vielleicht wurde die Fähigkeit meines Geistes, Qualen wahrzunehmen, durch Schock und Verwirrung außer Kraft gesetzt. Ich weiß es nicht. Es ist, als wäre die Verbindung zwischen meinem »äußeren«, immer noch schreienden In-der-Welt-Sein, von meinem »in mir drinnen«-Selbst abgekoppelt gewesen, jenem Selbst, das sich, wie ich heute glaube, fast im Delirium befand.
Murder rückwärts gelesen ergibtRed Rum – Red Rum hieß das Pferd, das dreimal den Grand-National-Hindernislauf gewann – 1973, 1974 und 1977. Es war eher wahlloser Unsinn wie dieser, der mir durch den Kopf ging. Einiges von dem aber, was hoch über mir gesagt wurde, habe ich doch gehört.
»Schneiden Sie den Anzug auf, damit wir die Wunden sehen können«, schrie irgendwer.
Oh, dachte ich, doch nicht meinen schönen Ralph-Lauren-Anzug.
Dann war da eine Schere – vielleicht auch ein Messer, ich weiß es wirklich nicht –, und man befreite mich von meiner Kleidung; es gab da das ein oder andere, um das man sich dringend kümmern musste. Aber es gab auch das ein oder andere, das ich unbedingt zu sagen hatte.
»In der Tasche sind meine Kreditkarten«, murmelte ich, ohne zu wissen, ob mir jemand zuhörte. »Und in der anderen Tasche ist der Hausschlüssel.«
Ich hörte eine Stimme sagen: Ist jetzt nicht wichtig.
Dann eine zweite Stimme: Natürlich ist das wichtig! Wissen Sie nicht, wer das ist?
Ich lag wohl im Sterben, also war es vielleicht wirklich nicht wichtig. Ich würde meinen Hausschlüssel und meine Kreditkarten bestimmt nicht mehr brauchen.
Wenn ich aber jetzt daran zurückdenke, wie ich mit brüchiger Stimme auf diesen Dingen beharrte, auf Dingen meines alltäglichen Lebens, glaube ich, dass ein Teil von mir – irgendetwas, das tief in mir kämpfte – schlicht nicht daran dachte, zu sterben, und durchaus vorhatte, Schlüssel und Karten künftig wieder zu gebrauchen, in einer Zukunft, auf der etwas in mir mit aller Kraft bestand.
Lebe!, flüsterte es in mir. Lebe!
*
Nur um es hier festzuhalten: ich habe alles zurückbekommen – die Karten, den Schlüssel, meine Uhr, ein bisschen Kleingeld. Alles. Nichts wurde gestohlen. Den Scheck, der in meiner Innentasche steckte, bekam ich nicht zurück. Er war mit Blut befleckt, und die Polizei behielt ihn als Beweismittel. Aus demselben Grund behielt man auch meine Schuhe. (Man hat mich gefragt, warum es mich so überraschte, dass nichts abhandenkam. Warum sollte irgendwer in einem so schrecklichen Moment etwas stehlen wollen? Ich fürchte, ich bin von der menschlichen Natur enttäuschter als jene, die diese Fragen stellten, aber ich bin froh, dass mein Misstrauen sich als grundlos erwies.)
*
Ein Daumen drückte sich in meinen Nacken. Für mich fühlte es sich wie ein großer Daumen an. Er drückte auf die größte Wunde und verhinderte, dass ich zu viel Blut verlor. Der Besitzer des Daumens stellte sich jedem vor, der ihm zuhören wollte. Er sei, sagte er, ein pensionierter Feuerwehrmann und heiße Mark Perez. Vielleicht auch Matt Perez. Er ist der Nächste in der Reihe der vielen Menschen, die mein Leben gerettet haben. In dem Moment aber dachte ich an ihn nicht als an einen pensionierten Feuerwehrmann. Für mich war er der Daumen.
Irgendwer – vermutlich ein Arzt – sagte: Legt die Beine hoch. Wir müssen dafür sorgen, dass das Blut zu seinem Herzen strömt. Dann waren da Arme, die meine Beine anhoben. Ich lag auf dem Boden, der Anzug aufgeschnitten, und meine Beine wedelten in der Luft. Ich fürchte, ich war wie König Lear »nicht recht bei Sinnen«, war aber doch so bei Verstand, dass ich mich … genierte.
In den nächsten Monaten sollten noch viele solcher körperlicher Demütigungen folgen. Ist man ernsthaft verletzt, gibt es für den Körper keine Privatsphäre mehr, man verliert die Autonomie über das körperliche Selbst, über das Gefährt, in dem man segelt. Man lässt es zu, weil man keine Wahl hat. Man gibt das Kommando übers Schiff ab, um nicht unterzugehen. Anderen wird gestattet, nach Belieben mit dem eigenen Körper umzuspringen – hier anstupsen, dort drainieren, injizieren, nähen, die Nacktheit inspizieren – weil man leben will.
*
Ich wurde auf eine Trage gehoben, die man wiederum auf eine Transportliege hob. Dann schob man mich rasch aus dem Backstage-Bereich ins Freie zu einem wartenden Hubschrauber. Während dieser ganzen Prozedur blieb der Daumen, genannt Matt oder Mark Perez, an Ort und Stelle, drückte auf die Wunde in meinem Nacken. Vorm Helikopter aber mussten Daumen und ich uns trennen.
Wie viel wiegen Sie?
Ich begann das Bewusstsein zu verlieren, aber ich verstand die an mich gerichtete Frage. Selbst in meiner fürchterlichen Verfassung war mir die Antwort peinlich. In den letzten Jahren war mein Gewicht geradezu explodiert, und ich wusste, ich sollte zwanzig oder dreißig Kilo abnehmen, nur war das eine Menge, und ich hatte mir keine besondere Mühe gegeben. Jetzt also musste ich für jeden in Hörweite die beschämende Zahl bekannt geben.
Ich schaffte es, einzelne Silben auszustoßen. Eins. Zwei. Null.
Die Maschine war ein kleiner türloser weißer Hummelhubschrauber mit gelb-schwarzen Streifen und striktem Maximalgewicht. An Bord gab es keinen Platz für den Daumen namens Mark oder Matt Perez. Ein zweiter Daumen – oder irgendwas in der Art – rückte an seine Stelle. Ich nahm nichts mehr deutlich wahr.
Wir sind geflogen. Daran kann ich mich erinnern. Ich spürte die Luft unter uns, die Bewegung, die hektische Aktivität um mich herum. Die Landung war so sanft, dass ich nichts davon mitbekam. Der Eindruck rennender Menschen. Ich nehme an, mir wurde eine Betäubungsmaske über Mund und Nase gestülpt. Und danach … nichts mehr.
*
Vier Tage später veröffentlichte die Chautauqua Institution ein Statement, aus dem ich im Folgenden zitiere: »Es wird am Institut künftig eine erheblich verstärkte Präsenz der Strafverfolgungsbehörden geben. Darüber hinaus werden umfangreiche Sicherheitsprotokolle aktiviert, von denen die Besucher und Bewohner größtenteils aber nichts mitbekommen werden. Das Institut arbeitet mit unseren professionellen Sicherheitsberatern und mehreren Strafverfolgungsbehörden an zusätzlichen Sicherheitsverbesserungen und an Verbesserungen der Risikobewältigung.« (Zehn Monate später, am 15. Juni 2023, wurden die versprochenen neuen Sicherheitsmaßnahmen der Presse vorgestellt.)
Schaden macht klug, könnte man da denken, nur leider zu spät.
Doch wie dem aufmerksamen Leser kaum entgangen sein dürfte, habe ich überlebt. In Machado de Assis’ wundervollem brasilianischem Roman Die nachträglichen Memoiren des Bras Cubas bekennt der titelgebende Held, dass er seine Geschichte von jenseits des Grabes erzählt. Wie, das erklärt er nicht, und ich habe diesen Trick nie gelernt.
Da ich also noch lebe – wozu noch so vieles mehr zu sagen wäre –, gebe ich gern der Vorliebe meines Verstandes zur freien Assoziation nach.
Messer. Messer in meinen Lieblingsfilmen, in Polanskis Das Messer im Wasser, einer Fabel über Gewalt und Untreue. Messer in Lieblingsbüchern, Philip Pullmans »magisches Messer«, das Öffnungen zwischen Welten schneiden kann und seinem Besitzer gestattet, zwischen verschiedenen Realitäten zu reisen. Und natürlich das Fleischermesser, mit dem Kafkas Protagonist in Der Prozess auf der letzten Seite ermordet wird. »›Wie ein Hund!‹, sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.«
Und noch zwei eher persönliche Messer.
Das erste: Nachdem ich 1968 in Cambridge meinen Abschluss gemacht hatte, fuhr ich zu meinen Eltern nach Karatschi, um in Pakistan darüber nachzudenken, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Damals brachte das relativ neue städtische Fernsehen jeden Abend eine englischsprachige Sendung, meist eine neue Folge von Columbo oder Ähnliches. Aslam Azhar, jener Gentleman, der damals Karachi TV leitete, war ein Freund meiner Tante Baji (Begum Amina Majeed Malik, die ältere Schwester meiner Mutter und eine angesehene Pädagogin). Sie verschaffte mir einen Termin bei ihm, und ich unterbreitete ihm einen Vorschlag. Wenn er schon jeden Abend eine kleine englischsprachige Sendung bringe, sagte ich, warum dann nicht gelegentlich eigenes Material statt der ständigen Wiederholungen von Hawaii Fünf-Null? Ich schlug eine Inszenierung von Edward Albees Einakter Die Zoogeschichte vor. »Mit fünfzig Minuten«, sagte ich, »so lang wie Columbo, passt also exakt in den Sendeplatz. Nur zwei auftretende Personen und als Set nichts Teureres als eine Parkbank. Es wäre also auch billig.« Ich konnte ihn überzeugen, begann mit der Produktion und trat selbst auch im Stück auf. Es war erbärmlich schlechtes Theater und hat zum Glück nicht überdauert.
Auf dem Höhepunkt des Stücks musste sich meine Figur in ein Messer stürzen, das vom Mitspieler gehalten wurde. Das Messer, das man mir gegeben hatte, war keine Requisite. Die Klinge ließ sich nicht im Griff versenken. Es war ein echtes, kompromissloses Messer mit einer scharfen, fünfzehn Zentimeter langen Klinge. »Was soll ich denn damit?«, habe ich den Requisitenmeister gefragt.
»Schauspielern«, lautete seine Antwort.
Das zweite: Vor zwanzig Jahren wurde jener Roman, der zu Shalimar der Narr