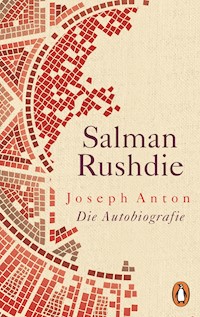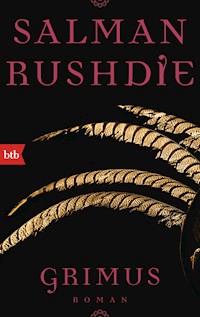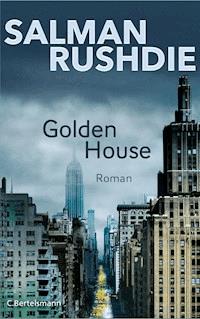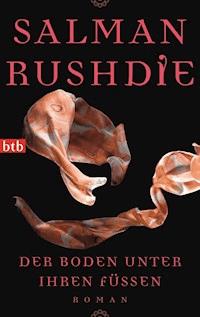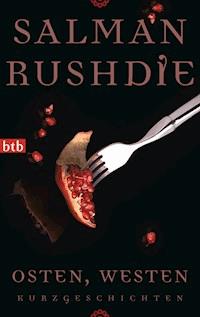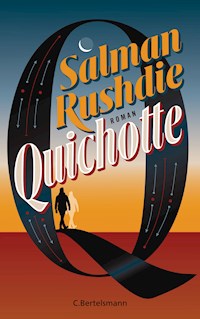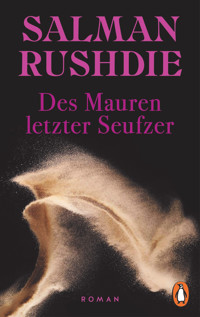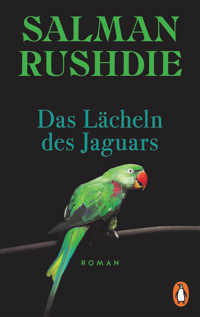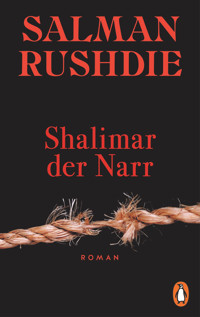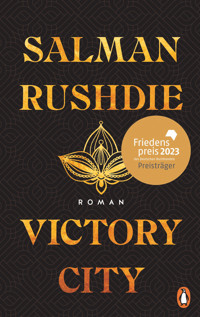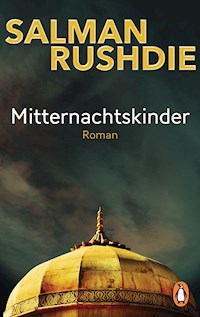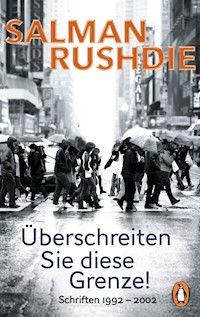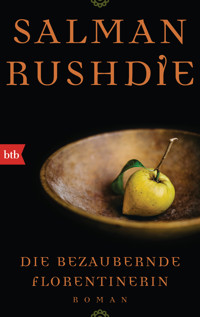
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist das Jahr 1572, als ein junger blonder Italiener nach einer beschwerlichen Reise an den Hof des indischen Großmoguls Akbar gelangt. Er behauptet, über verschlungene Pfade mit dem Mogul verwandt zu sein. Zum Beweis erzählt der Fremde die schier abenteuerliche Geschichte ihrer gemeinsamen Abstammung – eine Geschichte, die sich vom Florenz der Renaissancezeit bis in das fabelhafte indische Großreich erstreckt, die von den Medicis, von Machiavelli, dem Entdecker Vespucci und einer geheimnisvollen Schönheit berichtet – ihrer beider Vorfahrin und, so sagt man, die schönste Frau der Welt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Es ist das Jahr 1572, als ein junger blonder Italiener nach einer beschwerlichen Reise an den Hof des indischen Großmoguls Akbar gelangt. Er behauptet, über verschlungene Pfade mit dem Mogul verwandt zu sein. Zum Beweis erzählt der Fremde die schier abenteuerliche Geschichte ihrer gemeinsamen Abstammung – eine Geschichte, die sich vom Florenz der Renaissancezeit bis in das fabelhafte indische Großreich erstreckt, die von den Medicis, von Machiavelli, dem Entdecker Vespucci und einer geheimnisvollen Schönheit berichtet – ihrer beider Vorfahrin und, so sagt man, die schönste Frau der Welt …
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman »Mitternachtskinder« wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2008 schlug ihn die Queen zum Ritter.
Salman Rushdie
Die bezauberndeFlorentinerin
Roman
Deutsch von Bernhard Robben
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel The Enchantress of Florence bei Jonathan Cape, London.
Der Verlag dankt dem Deutschen Taschenbuch Verlag für die Abdruckrechte der beiden hier verwendeten Gedichte von Francesco Petrarca in der Übersetzung von Karlheinz Stierle.
Francesco Petrarca: Ich bin im Sommer Eis, im Winter Feuer. Zweisprachige Ausgabe. Ausgewählt und übersetzt von Karlheinz Stierle. Copyright © der deutschen Übersetzung 2004 by Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2022
Copyright © 2008 Salman Rushdie
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Lauren Mitchell/Gallery Stock
MP · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-30815-5V001
www.btb-verlag.de
Für Bill Buford
Nicht wie die Sterblichen ging sie einher,nein, wie die Engel leicht. Ihr Reden klang,als käm es nicht aus eines Menschen Munde,ein Bild des Himmels, eine Sonne sprangmir in das Aug’ ...
FRANCESCO PETRARCA, CANZONIERE
Gibt es hier einen Sprachenkundigen, holt ihn her;Ein Fremder ist in der StadtUnd vieles hat er zu erzählen.
MIRCA GHALIB
Teil eins
1.Im letzten Licht des Tages gleißte der See …
Im letzten Licht des Tages gleißte der See vor der Palaststadt wie ein Meer aus Gold. Ein Reisender, der bei Sonnenuntergang dem Weg folgte — ebenjener Reisende, der jetzt diesem Weg folgt, dem Weg vom Meer hierher —, könnte meinen, sich dem Thron eines Monarchen zu nähern, dessen märchenhafter Reichtum es ihm erlaubte, einen Teil seiner übervollen Truhen in ein gewaltiges Loch in der Erde zu schütten, nur um seine Gäste zu blenden und sie mit Ehrfurcht zu erfüllen. Doch so riesig der See aus Gold auch sein mochte, war er gewiss bloß ein Tropfen aus dem Meer eines weitaus größeren Schatzes, dem eigentlichen Hort, dem Mutterozean, dessen enorme Ausmaße die Phantasie des Reisenden kaum erahnen konnte! Auch standen keine Wachen am Rande des flüssigen Goldes: War denn der König so freigebig, dass er es all seinen Untertanen und gar Besuchern und Fremden wie dem Reisenden selbst erlauben durfte, sich ungehindert an der Unerschöpflichkeit des Sees zu bedienen? Das musste wahrlich ein Fürst unter den Menschen sein, ein rechter Priesterkönig Johannes, dessen verlorenes Reich der Lieder und Legenden die unwahrscheinlichsten Wunder beheimatete. Vielleicht (mutmaßte der Reisende) lag innerhalb der Stadtmauern ein Brunnen ewiger Jugend — oder befand sich gar das sagenhafte Tor zum Paradies auf Erden in unmittelbarer Nähe? Doch da verschwand die Sonne jenseits des Horizonts, das Gold sank unter die Wasseroberfläche und war verloren. Meerjungfrauen und Schlangen würden es bis zur Wiederkehr des Tageslichtes hüten. So lange aber blieb das Wasser selbst der einzige Schatz, der dargeboten wurde, eine Gabe, deren sich der durstige Reisende dankbar bediente.
Der Fremde fuhr in einem Ochsenkarren, doch statt auf den grob gepolsterten Sitzen zu hocken, stand er aufrecht wie ein Gott und hielt sich unbekümmert mit einer Hand am Geländer des hölzernen Gitterwerks fest. Eine Fahrt im Ochsenkarren ist weder sanft noch gemütlich, das zweirädrige Gefährt rumpelt und rattert im Takt mit dem Trott des Zugtieres und wird zum Spielball jeder Unwegsamkeit. Wer steht, der kann leicht fallen und sich den Hals brechen. Und doch stand der Reisende und schaute sorglos und zufrieden drein. Der Kutscher hatte es längst aufgegeben, ihn anzuschreien, hielt er den Fremden doch anfangs für einen Narren — wenn er unterwegs sterben wollte, dann sollte es wohl so sein, und keinen Menschen in diesem Land würde es kümmern! Rasch aber war sein Zorn einer widerwilligen Bewunderung gewichen. Der Mann mochte ein Narr sein, man könnte gar behaupten, er trage auch das allzu gefällige Gesicht eines Narren und dessen unpassende Kleider — einen Mantel aus bunten Lederflicken, bei dieser Hitze! —, doch musste man staunen, wie tadellos er das Gleichgewicht hielt. Der Ochse trottete voran, die Karrenräder krachten in Schlaglöcher und rumsten gegen Steine, der Mann aber schwankte kaum und machte bei alldem irgendwie noch einen recht anmutigen Eindruck. Ein anmutiger Narr, dachte der Kutscher, vielleicht aber auch gar kein Narr. Vielleicht jemand, den man nicht unterschätzen sollte. Wenn etwas an ihm auszusetzen war, dann höchstens sein großspuriges Gehabe, sein Versuch, nicht nur er selbst zu sein, sondern auch ein Schauspiel seiner selbst zu bieten, aber, dachte der Kutscher, ein wenig sind alle Menschen hier in der Gegend so, also ist uns der Fremde vielleicht doch gar nicht derart fremd. Als sein Passagier meinte, er habe Durst, eilte der Kutscher, ohne nachzudenken, beflissen ans Ufer des Sees, um in einer ausgehöhlten, lackierten Kalebasse einen Schluck Wasser zu holen und ihn vor aller Welt dem Fremden darzubieten, als wäre er ein Adliger, dem solch Gebaren gebührte.
«Ihr steht da wie ein großer Herr, und ich springe und eile, um Euch zu Diensten zu sein», sagte stirnrunzelnd der Kutscher. «Ich weiß nicht, warum ich Euch so gefällig bin. Wer gab Euch das Recht, mich herumzukommandieren? Was seid Ihr überhaupt? Kein Edelmann, so viel ist sicher, sonst führet Ihr nicht in meinem Karren. Und doch tut Ihr vornehm. Also seid Ihr gewiss ein Gauner.» Der Mann nahm einen kräftigen Schluck aus der Kalebasse. Das Wasser lief ihm aus den Mundwinkeln und hing wie ein flüssiger Bart am rasierten Kinn. Schließlich reichte er das leere Gefäß zurück, stieß einen zufriedenen Seufzer aus und wischte sich den Bart fort. «Wer ich bin?», sagte er, als redete er mit sich selbst, wenn auch in des Kutschers Sprache. «Ich bin ein Mann mit einem Geheimnis, das bin ich — mit einem Geheimnis, das allein für die Ohren des Königs bestimmt ist.» Der Kutscher fand sich bestätigt: Der Kerl war wirklich ein Narr. Es war also nicht nötig, ihm Respekt zu erweisen. «Behaltet Euer Geheimnis», sagte er. «Geheimnisse sind für Kinder — und für Spione.» Vor der Karawanserei, wo alle Reisen enden und ihren Anfang nehmen, stieg der Fremde aus dem Karren. Er war überraschend groß gewachsen und hielt eine Reisetasche in der Hand. «Und für Zauberer», sagte er dem Karrenkutscher. «Auch für Liebende. Und für Könige.»
Großer Trubel herrschte in der Karawanserei. Pferde, Kamele, Ochsen, Esel und Ziegen wurden getränkt und gefüttert, und auch ungezähmte Tiere liefen wild durch die Gegend: kreischende Affen, Hunde, die keinem Menschen gehörten. Krächzende Papageien stoben wie grünes Feuerwerk über den Himmel. Schmiede waren an der Arbeit und Zimmerleute; und an allen vier Seiten des riesigen Platzes planten Männer an den Ständen der Karawanenausrüster ihre Reisen, stockten Vorräte auf, Kerzen, Öl, Seife und Seile. Pausenlos liefen Turban tragende Kulis mit Lendentuch und rotem Hemd hin und her, mit unglaublich großen, schweren Bündeln auf dem Kopf. Überall wurden Waren be- und entladen. Ein Bett für die Nacht war billig zu haben, Holzgestelllager mit borstigen Pferdehaarmatratzen standen in Reih und Glied auf den Dächern der einstöckigen Gebäude rund um den gewaltigen Hof der Karawanserei bereit, Betten, aus denen man in die Himmel hinaufsehen und sich selbst für gottgleich halten konnte. Weiter draußen, im Westen, lagen die raunenden Zeltstädte der kaiserlichen Regimenter, die erst kürzlich aus den Kriegen zurückgekehrt waren. Den Soldaten war es nicht gestattet, den Palastbereich zu betreten; sie mussten am Fuße des königlichen Hügels verharren. Eine tatenlose Armee, gerade erst aus der Schlacht zurück, da war Vorsicht ratsam. Der Fremde dachte an das alte Rom. Ein Kaiser traute keinem Soldaten, höchstens seinen Prätorianern. Und auch er selbst würde auf die Frage, ob man ihm vertrauen konnte, eine überzeugende Antwort vorbringen müssen, das wusste der Reisende. Gelang ihm das nicht, war sein Leben verwirkt.
Unweit der Karawanserei markierte ein mit Stoßzähnen bestückter Turm den Weg zum Palasttor. Alle Elefanten gehörten dem Kaiser, und wenn er einen Turm mit ihren Zähnen bespießte, bewies er damit seine Macht. Habt acht, mahnte der Turm, Ihr betretet das Reich des Elefantenkönigs, eines an Dickhäutern so reichen Souveräns, dass er die Stoßerchen von abertausend Tieren verprassen konnte, nur um sich selbst zu schmücken und zu zieren. Der Turm war zur Schau gestellte Macht, und der Reisende erkannte darin die gleiche Art von Eigensinn, die auch auf seiner Stirn brannte wie eine Flamme, vielleicht gar wie ein Zeichen des Teufels, doch hatte der Erbauer des Turms jene Eigenschaft in eine Stärke verwandelt, die bei dem Reisenden oft für Schwäche gehalten wurde. Ist Macht die einzige Rechtfertigung für eine Persönlichkeit, die sich nach außen kehrt, fragte sich der Reisende und fand keine Antwort, hoffte aber, Schönheit könne eine weitere Entschuldigung dafür sein, denn schön war er gewiss, und er wusste, sein Aussehen übte eine Macht aus, die ihresgleichen suchte.
Jenseits des Turms der Zähne befand sich ein großer Brunnen und darüber eine rätselhafte, komplizierte Maschinerie, die den vielkuppeligen Palast auf dem Hügel mit Wasser versorgte. Ohne Wasser sind wir nichts, dachte der Reisende. Selbst ein Herrscher würde ohne Wasser alsbald zu Staub zerfallen. Wasser ist der wahre Monarch, und wir sind seine Sklaven. Daheim in Florenz hatte er einst einen Mann gesehen, der Wasser verschwinden lassen konnte. Der Magier füllte einen Krug bis an den Rand, murmelte einige Zauberworte und drehte das Gefäß um, doch statt Flüssigkeit ergoss sich ein Strom bunter Seidenschals. Es war natürlich ein Trick, und ehe der Tag zur Neige ging, hatte der Reisende diesem Kerl das Geheimnis entlockt und seinen eigenen Mysterien einverleibt. Er war ein Mann vieler Geheimnisse, doch nur eines davon geziemte einem König.
Rasch stieg der Weg zur Stadtmauer an, und während der Reisende mit jedem Schritt an Höhe gewann, erkannte er, wie weitläufig der Ort war, zu dem ihn seine Reise geführt hatte. Dies hier war offenkundig eine der größten Städte der Welt, größer, so fand er, als Florenz, Venedig oder Rom, größer mithin als alle Städte, die er je gesehen hatte. Einmal war er sogar in London gewesen, aber auch jene Stadt war eine kleinere Metropole als diese hier, welche noch zu wachsen schien, als das Tageslicht verblasste. Ganze Stadtviertel drängten sich vor den Mauern zusammen, Muezzine riefen von Minaretten herab, und in der Ferne waren die Lichter der großen Landhäuser zu sehen. Feuer flammten wie Warnlampen im Dämmerlicht auf. Und aus der schwarzen Schüssel der Nacht antwortete das Gezüngel der Sterne. Als wären Himmel und Erde feindliche Heere, die sich zur Schlacht rüsten, dachte er. Als ruhten ihre Lager still in der Nacht und warteten auf den nahenden Krieg des Tages. Doch in all dem Straßengewirr, in all den Häusern der Mächtigen drüben in der Ebene war kein Mensch, der je seinen Namen gehört hatte, niemand, der bereit wäre, die Geschichte zu glauben, die er zu erzählen wusste. Aber erzählen musste er sie. Dafür hatte er die Welt umreist, also würde er es tun.
Er ging mit langen Schritten und zog manch neugierigen Blick auf sich, allein wegen seiner Körpergröße, aber auch wegen des gelben Haars, jener langen und zugegebenermaßen recht schmutzigen gelben Haare, die sein Gesicht wie goldenes Wasser aus dem See umflossen. Der Pfad schlängelte sich am Turm der Zähne vorbei, hinauf zu einem steinernen Tor, auf dem sich zwei Elefanten im Basrelief gegenüberstanden. Durch dieses Tor, das geöffnet war, drang der Lärm einer spielenden, trinkenden, essenden und zechenden Menschenmenge. Soldaten hielten am Hatyapul-Tor Wache, doch nahmen sie es mit ihrem Dienst nicht allzu genau. Die eigentlichen Schranken kamen später. Dies hier war ein öffentlicher Ort, ein Ort, um sich zu treffen, um Handel zu treiben und sich zu vergnügen. Menschen hasteten am Reisenden vorüber, getrieben von Hunger und Durst. Auf beiden Seiten der gepflasterten Straße zwischen dem äußeren und dem inneren Tor gab es Herbergen, Wirtshäuser, Essensstände und fliegende Händler aller Art. Hier fand das ewige Geschäft des Kaufens und Gekauftwerdens statt. Kleider, Gerätschaften, Flitterkram, Waffen und Rum. Der eigentliche Markt lag hinter dem wenig imposanten Südtor. Dort gingen die Stadtbewohner einkaufen, während sie die Gegend zwischen den Toren mieden, denn die war nur für unwissende Neuankömmlinge gedacht, welche den eigentlichen Preis der Dinge nicht kannten. Hier war der Schwindlermarkt, der Diebesmarkt, lärmend laut, überteuert und verpönt. Doch müden Reisenden, die sich in der Stadt noch nicht auskannten und zudem zögerten, den weiten Weg rund um die Außenmauer zum größeren und wohlfeileren Basar zu machen, blieb kaum eine andere Wahl, als sich mit den Händlern am Elefantentor abzugeben. Ihr Bedarf war so dringlich wie schlicht.
Lebende Hühner, gackernd vor Angst, hingen kopfüber herab und harrten flatternd, die Füße zusammengebunden, des Kochtopfs. Auf den, der Fleisch verschmähte, warteten andere, stillere Töpfe; Gemüse machte keinen Lärm. Und waren das etwa Frauenstimmen, die der Wind dem Reisenden zutrug? Klagende, spöttische, lockende Stimmen von Frauen, die ungesehenen Männern zulachten? Waren es Frauen, deren Duft er in der Abendbrise erschnupperte? Heute war es sowieso zu spät, den Kaiser aufzusuchen. Der Reisende hatte Geld in der Tasche und eine lange, an Umwegen reiche Reise hinter sich. Das war nun einmal seine Art: sich auf indirekte Weise, mit vielen Abstechern und Abschweifungen, dem Ziel zu nähern. Seit er in Surat an Land gegangen war, hatte ihn sein Weg über Burhanpur, Handia, Sironj, Narwar, Gwalior und Dholpur nach Agra geführt, und von Agra hierher, zur neuen Hauptstadt. Jetzt wollte er das bequemste Bett, das für Geld zu haben war, und eine Frau, am liebsten eine ohne Schnurrbart, und zu guter Letzt noch ein Quäntchen Vergessen, die Flucht vor dem Selbst, das nie in den Armen einer Frau, sondern nur mit Hilfe eines guten, starken Tropfens zu finden war.
Später, als seine Begierde befriedigt war, lag er fröhlich schnarchend im duftgeschwängerten Hurenhaus neben einem schlaflosen Freudenmädchen und träumte. In sieben Sprachen konnte er träumen: Italienisch, Spanisch, Arabisch, Persisch, Russisch, Englisch und Portugiesisch. Die vielen Zungen waren ihm zugefallen, wie sich die meisten Seeleute Krankheiten holen; Sprachen waren sein Tripper, seine Syphilis, sein Skorbut, seine Malaria und seine Pest. Kaum war er eingenickt, brabbelte die halbe Welt in seinem Hirn und erzählte ihm phantastische Geschichten von fernen Reisen. In dieser halbentdeckten Welt brachte ihm jeder Tag Neuigkeiten von unbekanntem Zauber. Die bilderreiche, enthüllende Traumpoesie des Alltäglichen war noch nicht von der engstirnigen, nüchternen Wirklichkeit erdrückt. Es waren wundersame Geschichten gewesen, die ihn, den Geschichtenerzähler, zur Tür hinausgetrieben hatten, vor allem jene eine, und die mochte sein Glück bedeuten oder ihn das Leben kosten.
2.An Bord des schottischen Piratenschiffes Scathath ...
An Bord des schottischen Piratenschiffes Scathath, benannt nach einer sagenhaften Kriegergöttin der Insel Skye, einem Schiff, dessen Mannschaft sich mitsamt ihrem Kapitän, einem schottischen Lord, viele Jahre lang fröhlich überall in der Karibik herumgetrieben hatte, um zu rauben und zu plündern, das sich gegenwärtig aber in Staatsgeschäften unterwegs nach Indien befand, war es dem blinden Passagier, jenem lässigen Florentiner, nur mit Mühe gelungen, nicht Hals über Kopf in die schaumigen Fluten vor Südafrika geworfen zu werden, indem er eine lebende Wasserschlange aus dem Ohr des erschrockenen Bootsmannes zog und sie an seiner statt über Bord schleuderte. Sieben Tage nachdem man Cape Agulhas an der Spitze des afrikanischen Kontinents umrundet hatte, war er unter einer Koje in der Back des Schiffes gefunden worden, mit senffarbenem Wams, einer Hose gleicher Farbe und einem langen Harlekinmantel aus leuchtend bunten Flicken, im Arm eine kleine Reisetasche; so lag er fest schlafend und laut schnarchend da, als kümmerte es ihn nicht im Mindesten, ob er entdeckt würde. Er schien sogar durchaus willens, sich auffinden zu lassen, und legte ein verblüffendes Vertrauen in seine Fähigkeit an den Tag, alle Welt zu betören, zu blenden und für sich einzunehmen. Immerhin hatten sie ihn bereits ein weites Stück des Wegs mitgenommen. Und tatsächlich erwies er sich als wahrhafter Zauberer, verwandelte er doch Goldmünzen in Rauch und gelben Rauch zurück in Gold. Ein Krug mit frischem Wasser wurde umgekippt, und es ergoss sich ein Strom von Seidentüchern. Mit einigen schwungvollen Handbewegungen vervielfachte er die Zahl der Fische und Brotlaibe, was fraglos gotteslästerlich war, doch hatten ihm die hungrigen Seeleute bald vergeben. Hastig bekreuzigten sie sich, um sich vorsichtshalber gegen den Zorn Jesu Christi zu wappnen, dem es nicht gefallen mochte, dass ihm dieser neuartige Wundertäter seinen Platz streitig machte, um dann das unerwartet üppige, wenn auch theologisch nicht ganz einwandfreie Mittagsmahl zu verzehren.
Auch George Louis Hauksbank, der schottische Lord höchstpersönlich — genauer, nach schottischer Sitte, Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens, nicht zu verwechseln mit weniger edlen Trägern dieses Titels von weit unedlerer Herkunft —, faszinierte alsbald dieser harlekineske Eindringling, den man in seine Kabine gebracht hatte, auf dass er sein Urteil über ihn verkünde. Zum damaligen Zeitpunkt nannte sich der junge Schlingel «Uccello»: «Uccello di Firenze, Zauberer und Gelehrter, zu Euren Diensten», verkündete er in perfektem Englisch mit tiefer, weit ausladender Verbeugung von nahezu aristokratischer Anmut, und Lord Hauksbank lächelte und schnüffelte an seinem parfümierten Taschentuch. «Was ich Euch fast geglaubt hätte, Gaukler», erwiderte er, «würde ich nicht zufällig den Maler Paolo gleichen Namens und gleicher Herkunft kennen, der im Duomo Eurer Stadt ein trompe-l’œil-Fresko zu Ehren von Sir John Hauksbank geschaffen hat, einem meiner Vorfahren, bekannt als Giovanni Milano, ein Glücksritter und einstmals General von Florenz, Sieger in der Schlacht von Polpetto — und wäre dieser Maler unglückseligerweise nicht bereits seit vielen Jahren tot.» Der junge Schlingel erzeugte mit seiner Zunge einen frechen, glucksenden Schnalzlaut des Protests. «Ganz offensichtlich bin ich nicht der verstorbene Künstler», bekannte er und warf sich zugleich in Pose. «Ich habe mir dieses pseudonimo di viaggio gewählt, weil das Wort in meiner Sprache ‹Vogel› bedeutet, und Vögel sind unter allen Lebewesen die eifrigsten Weltenbummler.»
Hier pflückte er einen Kapuze tragenden Falken aus seiner Brust, griff sich aus leerer Luft einen Beizhandschuh und reichte beides dem erstaunten Herrn. «Einen Falken für Lord Hauksbank», sagte er mit vollendeter Höflichkeit, um, kaum hatte sich Lord Hauksbank den Handschuh mit darauf hockendem Vogel übergestreift, laut «Uccello» zu rufen und wie eine Frau, die einem Mann ihre Liebe entzieht, mit den Fingern zu schnippen, woraufhin zu des schottischen Lords beträchtlichem Missfallen beide wieder verschwanden, Handschuh wie Kapuzenvogel. «Außerdem», hob der Magier erneut an, sich über seinen Namen auszulassen, «gilt dieses verschleiernde Wort, dieser verborgene Vogel, in meiner Stadt als ein auf delikateste Weise euphemistischer Ausdruck fürs männliche Glied, und ich bin stolz auf das, was mir diesbezüglich zu Eigen ist, wenn auch nicht so taktlos, Besagtes hier zur Schau zu stellen.»
«Haha!», rief Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens, der mit beachtlicher Behändigkeit seine Fassung wiedererlangte. «Na, da haben wir beide ja etwas gemeinsam.»
Weit gereist war er, dieser Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens, und älter, als er aussah. Seine Augen strahlten, die Haut war rein, doch lag sein vierzigster Geburtstag bereits sieben Jahre oder länger zurück. Seine Fechtkunst galt als legendär; er war stark wie ein weißer Bulle und auf einem Floß den Gelben Fluss bis zur Quelle im Kar-Qu-See hinabgeschifft, wo er aus goldener Schale geschmorten Tigerpenis verspeist hatte; auch jagte er im Ngorongoro-Krater das weiße Nashorn und hatte alle zweihundertvierundachtzig Gipfel der schottischen Munros bestiegen, vom Ben Nevis bis zum Inaccessible Pinnacle des Sgurr Dearg auf der Insel Skye, der Heimat von Scathath, der Schrecklichen. Lang war es her, da hatte er sich im Schlosse Hauksbank so sehr mit seiner Frau gestritten, einem kleinen, kläffenden Weib mit lockig rotem Haar und einer Kieferlade, so mächtig wie die eines holländischen Nussknackers, dass er sie in den Highlands zurückließ, wo sie fortan schwarze Schafe hütete, während er selbst sich wie seine Vorfahren aufmachte, das Glück in der Ferne zu suchen und Kapitän eines Schiffes im Dienste von Francis Drake zu werden, mit dem er in der Karibik die Spanier um das Gold der Amerikas erleichterte. Zur Belohnung war ihm von seiner dankbaren Königin jene diplomatische Mission anvertraut worden, auf der er sich gegenwärtig befand; er sollte nach Hindustan fahren, wo er alle Reichtümer einsammeln und behalten dürfe, die er auffinden könne, seien es Geschmeide, Opium oder Gold, solange er dem Herrscher einen persönlichen Brief der Gloriana überreiche und die Antwort des Moguls heimbringe.
«In Italien wird er Mogor genannt», sagte ihm der junge Prestidigitateur. «Aber wer weiß schon», erwiderte Lord Hauksbank, «wie das Wort in den unaussprechlichen Zungen des Landes selbst entstellt, verzerrt und verdreht wird.»
Ein Buch besiegelte ihre Freundschaft: der Canzoniere von Petrarch, denn wie stets lag ein Exemplar dieses Werkes in Reichweite von des schottischen Lords Hand auf einem kleinen Tisch aus pietra dura. «Ach, der prächtige Petrarca», rief «Uccello». «Das ist nun wahrlich ein echter Zauberer.» Und in der Rednerpose eines römischen Senators begann er zu deklamieren:
«Benedetto sia ’l giorno, et ’l mese, et l’anno,
et la stagione, e ’l tempo, et l’ora, e ’l punto,
e ’l bel paese, e ’loco ov’io fui giunto
da’ duo begli occhi che legato m’ànno ...»
Woraufhin Lord Hauksbank den Faden aufgriff und in der Übersetzung fortfuhr:
«Gepriesen sei die erste süße Qual
der Strahlen ihres Blicks, die mich bezwangen,
die Pfeile Amors, die mein Herz durchdrangen,
die Herzenswunden tief und ohne Zahl.»
«Wer immer dieses Gedicht so liebt wie ich, dem will ich untertan sein», sagte «Uccello» und verbeugte sich.
«Und wer immer bei diesen Worten empfindet, was ich empfinde, muss mein Trinkkumpan werden», gab der Schotte zurück. «Ihr habt den Schlüssel zu meinem Herzen gefunden. Also muss ich Euch jetzt ein Geheimnis anvertrauen, das Ihr niemals verraten dürft. Kommt mit.»
In einem hölzernen Kästchen, verborgen hinter einem Gleitfach im Schlafquartier, verwahrte Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens eine Kollektion «tugendsamer Pretiosen», herrlichste kleine Kostbarkeiten, ohne die ein ständig auf Reisen befindlicher Mensch rasch die Orientierung verlieren mochte, konnte sich doch, wie Lord Hauksbank sehr wohl wusste, durch zu viele Reisen, durch zu viel Fremdheit und Neuartigkeit, die Seele aus ihrer Verankerung lösen. «Diese Dinge gehören mir nicht», gestand er seinem neuen florentinischen Freund, «aber sie erinnern mich daran, wer ich bin. Eine Zeitlang bin ich ihr Hüter, und wenn diese Zeit vorüber ist, lasse ich sie weiterziehen.» Er entnahm dem Kästchen eine Anzahl Juwelen von staunenswerter Größe und Reinheit, die er jedoch mit einem abschätzigen Schulterzucken beiseitelegte, dann einen Barren spanischen Goldes, der es jedem Menschen, der ihn fand, erlauben würde, bis ans Ende seiner Tage in Glanz und Reichtum zu leben — «Tand ist das, nichts als Tand», murmelte er —, um erst dann seine wahren Schätze hervorzuholen, ein jeglicher sorgsam in ein Tuch gewickelt und in ein Nest aus Papierknäueln und Lumpenfetzen gebettet: das seidene Tuch einer heidnischen Göttin des alten Sogdien, einstmals das Pfand ihrer Liebe für einen längst vergessenen Helden; ein Walknochen mit dem herrlichen Schnitzbild einer Hirschjagd; ein Medaillon mit dem Porträt Ihrer Majestät, der Königin; ein in Leder gebundenes, hexagonales Buch aus dem Heiligen Land, auf dessen winzigen Seiten, verziert mit außergewöhnlicher Kalligraphie, der gesamte Koran in Miniaturschrift zu lesen war; ein Steinkopf aus Mazedonien mit gebrochener Nase, vorgeblich eine Büste, die Alexander den Großen darstellte; eines der kryptischen «Siegel» einer uralten Zivilisation aus dem Tal des Indus, in Ägypten gefunden, verziert mit dem Bild eines Bullen und einer Reihe von Hieroglyphen, die nie entschlüsselt worden waren, ein Gegenstand, dessen Verwendungszweck kein Mensch kannte; ein flacher, blankpolierter Stein aus China mit einem scharlachroten I-Ging-Hexagramm und einer dunklen, natürlichen Markierung, die einem Bergrelief im Dämmerlicht glich; ein bemaltes Porzellanei; ein Schrumpfkopf von den Bewohnern des Regenwaldes am Amazonas; und ein Wörterbuch der verlorenen Sprache jenes Volkes an der Landenge von Panama, dessen Sprecher allesamt ausgestorben waren, eine alte Frau ausgenommen, die wegen fehlender Zähne kein Wort mehr verständlich hervorzubringen vermochte.
Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens öffnete ein Kabinett mit kostbaren Gläsern, die wundersamerweise die zahllosen Fahrten über die vielen Meere heil überdauert hatten, entnahm ihm ein Paar opalisierender Murano-Schwenker und schenkte einen reichlich bemessenen Schluck Branntwein ein. Der blinde Passagier näherte sich und hob das Glas. Lord Hauksbank genoss das schwere Aroma, dann trank er. «Ihr seid aus Florenz», sagte er, «also seid Ihr mit der Majestät des allerhöchsten Souveräns vertraut, des menschlichen Ichs, und auch mit seinen Begierden, die es zu stillen sucht, der Sehnsucht nach Schönheit, nach Wertvollem — und nach der Liebe.» Der Mann, der sich «Uccello» nannte, wollte antworten, doch hob Hauksbank eine Hand. «Lasst mich ausreden», fuhr er fort, «denn es gibt Dinge zu besprechen, von denen Eure fähigsten Philosophen nichts wissen. Das Ich mag in seiner Majestät königlich sein, doch hungert es wie der Ärmste der Armen. Einen Moment lang mag der Anblick solch heimlicher Wunder wie diese hier es sättigen, doch bleibt es ein notleidendes, hungerndes, dürstendes Ding. Darüber hinaus ist es ein bedrohter Monarch, ein auf ewig der Gnade vieler Insurgenten ausgesetzter Souverän, der Angst etwa oder der Sorge, der Einsamkeit wie der Konfusion, zudem eines seltsam unaussprechlichen Stolzes und einer wilden, stummen Scham. Das Ich ist von Geheimnissen umlagert, immerzu nagen sie an ihm, Geheimnisse führen zum Untergang seines Reiches und werfen sein Zepter zerbrochen in den Staub. Ich sehe, ich verwirre Euch», seufzte er, «also will ich mich deutlich zu erkennen geben. Das Geheimnis, das Ihr niemals verraten dürft, ist keineswegs in diesem Kästchen verborgen. Es liegt — nein, liegen tut es nun wirklich nicht — hier drinnen!»
Der Florentiner, der das Geheimnis des Lord Hauksbank bereits seit einer Weile erraten hatte, bekundete mit ernster Miene angemessenen Respekt vor Länge und Umfang des fleckigen Gliedes, das dort vor ihm auf Seiner Lordschaft Tisch lag und zart nach Fenchel roch, beinahe wie eine finocchiona-Wurst, die darauf wartete, zerteilt zu werden. «Wolltet Ihr die See aufgeben und in meiner Heimatstadt wohnen», sagte er, «hätten Eure Schwierigkeiten bald ein Ende, denn unter den jungen Galanen von San Lorenzo fände sich gewiss, was Ihr sucht. Ich aber, bedauerlicherweise ...»
«Trinkt aus», befahl der schottische Lord mit dunkelrotem Gesicht und richtete sich wieder züchtig her. «Verlieren wir kein Wort mehr darüber.» Da war ein Glitzern in seinem Auge, das sein Gegenüber dort lieber nicht gesehen hätte. Und die Hand war dem Schwertknauf näher, als es dem Florentiner lieb sein konnte, das Grinsen fratzenhaft starr.
Es folgte ein langes, einsames Schweigen, und der blinde Passagier begriff, dass sein Schicksal an einem seidenen Faden hing. Gleich darauf leerte Hauksbank das Glas und stieß ein hässliches, gequältes Lachen aus. «Sir», rief er, «nun kennt Ihr mein Geheimnis, jetzt aber müsst Ihr mir Eures anvertrauen, denn Ihr tragt gewiss eines in Euch, das ich närrischerweise für mein eigenes hielt. Also heraus damit!»
Der Mann, der sich «Uccello de Firenze» nannte, wollte das Thema wechseln. «Mylord, mögt Ihr mir nicht die Ehre erweisen, mir zu erzählen, wie Ihr unter Drake die Schatzgaleone Cacafuego aufgebracht habt? Und wart Ihr nicht — bestimmt wart Ihr das — mit Drake bei Valparaiso und Nombre de Dios, als er verwundet wurde ...?» Hauksbank zerschmetterte sein Glas an der Kajütenwand und zog das Schwert. «Schurke», rief er. «Sterbt oder antwortet mir auf der Stelle!»
Der blinde Passagier wählte seine Worte mit Bedacht. «Mylord», sagte er, «erst jetzt verstehe ich, dass mein Weg mich hierher führte, damit ich Euch meine Dienste als Euer Faktotum andiene. Doch ist auch wahr», fügte er rasch hinzu, als die blanke Klinge über seine Kehle strich, «dass ich noch ein anderes Ziel verfolge. Ich bin gewissermaßen, was Ihr einen Mann auf der Suche nennen mögt — mehr noch, ein Mann auf einer geheimen Suche —, doch muss ich Euch zur Warnung mitteilen, dass meinem Geheimnis ein Fluch anhaftet, der Fluch der mächtigsten Zauberin ihrer Zeit. Nur einem einzigen Mann kann ich dieses Geheimnis anvertrauen, ohne dass er sein Leben verliert, und ich möchte für Euren Tod nicht verantwortlich sein.»
Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens lachte erneut, doch war es diesmal kein hässliches Lachen, sondern ein Lachen sich verflüchtigender Wolken und wiederkehrenden Sonnenscheins. «Ihr amüsiert mich, kleiner Vogel», sagte er. «Glaubt Ihr etwa, ich fürchte mich vor dem Fluch Eurer grüngesichtigen Hexe? Habe ich nicht am Tag der Toten mit Baron Samedi getanzt und sein Voodoo-Gebrüll überlebt? Ich würde es als große Unhöflichkeit auffassen, wenn Ihr mir nicht stante pede alles erzähltet.»
«Dann soll es so sein», begann der blinde Passagier. «Es lebte dereinst im Fernen Osten ein Fürst namens Argalia, auch Arcalia genannt, ein großer Krieger, der Zauberwaffen sein Eigen nannte und zu dessen Gefolge vier schreckliche Riesen gehörten; außerdem war eine Frau bei ihm, Angelica ...»
«Haltet ein», rief Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens und hielt sich die Stirn. «Mir dreht sich schon jetzt der Schädel.» Doch sagte er nach einer kleinen Pause: «Fahrt fort.»
«... Angelica, eine Prinzessin aus dem königlichen Geblüt des Dschingis Khan und Tamerlan ...»
«Schweigt still, nein, macht weiter.»
«... die allerschönste ...»
«Hört auf.»
Woraufhin Lord Hauksbank bewusstlos zu Boden sank.
*
Der Reisende, dem es schon fast peinlich war, wie leicht er seinem Gastgeber Laudanum ins Glas hatte tröpfeln können, legte das Holzkästchen sorgsam ins Versteck zurück, zog den kunterbunten Mantel fest um sich und eilte hilferufend auf das Hauptdeck. Er hatte den Mantel bei einem Kartenspiel gewonnen, einer Partie scarabocion gegen einen erstaunten venezianischen Diamantenhändler, der einfach nicht glauben wollte, ein dahergelaufener Florentiner könne an den Rialto kommen und Ortsansässige in ihrem eigenen Spiel schlagen. Der Händler, ein Bart und Ringellöckchen tragender Jude namens Shalach Cormorano, hatte sich den Mantel eigens bei Venedigs berühmtestem Schneider machen lassen, der allgemein nur als Il Moro Invidioso bekannt war, da das Schild über der Tür einen grünäugigen Araber zeigte; und dieser Mantel war wahrlich ein okkultisches Wunderwerk, denn seine Säume bargen einen Katakombenwirrwarr geheimer Taschen und verborgener Falten, in denen der Diamantenhändler seine wertvollen Waren verstecken konnte. Für einen Luftikus wie «Uccello di Firenze» ließ er sich ausgezeichnet für allerlei Tricks gebrauchen. «Rasch, meine Freunde, rasch», rief der Reisende nun mit überzeugend gespielter Sorge. «Seine Lordschaft braucht uns.»
Falls es inmitten dieser rauen Schar von zu Diplomaten gewandelten Freibeutern einige engstirnige Zyniker gab, die angesichts des plötzlichen Schwächeanfalls ihres Anführers misstrauisch wurden und den Neuankömmling folglich mit Blicken maßen, die seiner Gesundheit abträglich zu sein versprachen, wurden sie halbwegs durch die offenkundige Fürsorge beruhigt, die «Uccello di Firenze» für Lord Hauksbanks Wohlergehen an den Tag legte. Er half, den Bewusstlosen in die Koje zu tragen, entkleidete ihn, mühte sich mit seinem Schlafgewand ab, legte ihm heiße und kalte Kompressen auf die Stirn und wollte nicht essen und nicht ruhen, ehe es um das Befinden des schottischen Lords wieder besser bestellt war. Der Schiffsarzt nannte den blinden Passagier eine unschätzbare Hilfe, und als die Mannschaft dies hörte, begab sie sich murrend und achselzuckend wieder auf ihre Posten.
Kaum waren sie allein mit dem besinnungslosen Mann, gestand der Arzt «Uccello», wie sehr es ihn verblüffe, dass der Aristokrat sich weigere, aus diesem plötzlichen Koma wieder zu erwachen. «Soweit ich sehen kann, ist mit dem Mann gottlob alles in Ordnung, nur will er eben nicht wieder zu sich kommen», sagte er, «wiewohl es in dieser lieblosen Welt weiser sein mag zu träumen, als zu wachen.»
Der Arzt war ein einfacher, gefechterprobter Mann namens Lobegott Hawkins, ein gutherziger Knochenflicker mit beschränktem medizinischem Sachverstand, der es eher verstand, spanische Kugeln aus den Leibern seiner Schiffsgefährten zu polken und nach einem Handgemenge mit den Spaniern klaffende Säbelhiebwunden zu vernähen, als mysteriöse Schlafkrankheiten zu heilen, die ebenso unerwartet aus dem Nichts auftauchten wie blinde Passagiere oder Gottesurteile. Hawkins hatte ein Auge in Valparaiso gelassen, ein halbes Bein in Nombre de Dios, und Nacht für Nacht sang er zum Lobe einer Maid auf einem Balkon im Ribeira-Viertel von Oporto schwermütige portugiesische fados, wozu er sich selbst auf einer Art Zigeunerfiedel begleitete. Dabei vergoss Lobegott stets ausgiebig Tränen, und «Uccello» begriff, dass der Arzt sich ausmalte, wie ihn seine Liebste betrog, dass er solcherlei Gedanken heraufbeschwor, um sich zu martern, Bilder von der Portwein nippenden Geliebten im Bett mit körperlich unversehrten Männern, nach ihrem schuppigen Fang stinkenden Fischern oder lüsternen Franziskanermönchen, den Geistern längst verstorbener Seefahrer und lebenden Männern jeder Farbe und Spielart, Welsche wie Engländer, Chinamänner wie Juden. Ein Mann im Banne der Liebe, dachte sich der blinde Passagier, ist so leicht zu lenken wie abzulenken.
Während die Scathath das Horn von Afrika umsegelte, vorbei an der Insel Socotra, und während sie in Maskat Vorräte auffüllte und die persische Küste backbord liegenließ, um, von den Monsunwinden getrieben, in Richtung Südost zum portugiesischen Hafen Diu am südlichen Gestade einer Gegend zu fahren, die Dr. Hawkins «Guzerat» nannte, lag Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens in friedlichem Schlummer, «einem gottlob derart ruhigen Schlaf», so der ratlose Hawkins, «dass bewiesen ist, welch reines Gewissen der Kapitän hat, seine Seele also immerhin bei guter Gesundheit ist, allezeit bereit, vor ihren Schöpfer zu treten.»
«Der Herr bewahre», sagte der blinde Passagier.
«Gottlob hat er ihn noch nicht zu sich gerufen», pflichtete der Arzt ihm eifrig bei. Während der langen Krankenwache hatte «Uccello» sich bei dem Arzt ausgiebig nach dessen portugiesischer Herzensdame erkundigt. Um über dieses Thema zu reden, brauchte Hawkins stets nur wenig Ermunterung. Geduldig hatte der blinde Passagier den überschwänglichen Lobgesängen auf die Augen der Dame gelauscht, auf ihre Lippen, ihren Busen, ihre Hüften, ihren Bauch, ihr Gesäß und ihre Füße. Er lernte die geheimen Koseworte kennen, die sie im Akt der Liebe sprach, Worte, die nun nicht länger geheim waren, er hörte ihre Treueversprechen und die gemurmelten Schwüre ewiger Verbundenheit. «Ach, aber sie ist eine falsche Schlange», weinte der Arzt. Als der Reisende jedoch fragte: «Seid Ihr Euch da sicher?», schüttelte Lobegott tränenüberströmt das Haupt und antwortete: «Es ist schon so lang her, und ich bin nur noch ein halber Mann, also muss ich wohl das Schlimmste fürchten.»
«Uccello» aber gelang es, ihn wieder ein wenig aufzuheitern: «Ach was, Lobegott, lasset uns Gott preisen, denn Ihr weint grundlos! Sie ist Euch treu, da bin ich mir sicher; sie wartet auf Euch, daran zweifle ich keinen Augenblick; und wenn Ihr ein Bein weniger habt, nun denn, da hat sie doch ein bisschen Liebe übrig, die Liebe, die sie fürs Bein hegte, kann sie nun Eurem übrigen Körper zugutekommen lassen; und wenn Euch ein Auge fehlt, wird sich das andere doppelt an ihr erfreuen, die Euch treu geblieben ist und Euch liebt, so wie Ihr sie liebt! Genug, Lobegott! Frohlockt und weint nicht länger.»
Auf diese Weise beschwichtigte er allabendlich Lobegott Hawkins und versicherte ihm, die Mannschaft wäre höchst betrübt, könnte sie seine Lieder nicht mehr hören, und allabendlich, sobald er mit dem besinnungslosen Lord allein war und einige Augenblicke gewartet hatte, nahm er eine gründliche Durchsuchung der Kapitänskajüte vor und erforschte all ihre Geheimnisse. Ein Mann, der eine Kabine mit einem Geheimfach baut, baut auch eine Kabine mit zwei oder drei Geheimfächern, sagte er sich, und als der Hafen von Diu in Sichtweite kam, hatte er Lord Hauksbank wie ein Hühnchen gerupft und hinter den Wandpaneelen sieben geheime Fächer aufgespürt, sodass nun alle Juwelen aus allen Holzkästchen wohlbehütet in ihren neuen Verstecken im Mantel des Shalach Cormorano lagen, ebenso wie die sieben Goldbarren, und doch trug sich der Mantel leicht wie eine Feder, denn der grünäugige Mohr von Venedig kannte das Geheimnis, wie jedwede Ware gewichtlos wurde, die man im Zaubermantel verbarg. Was nun die übrigen «tugendsamen Pretiosen» betraf, so interessierten sie den Dieb nicht weiter. Er beließ sie in ihren Nestern, auf dass schlüpfte, welche Vögel sie auch hervorbringen mochten. Doch selbst am Ende dieses ausgiebigen Beutezuges war «Uccello» nicht zufrieden, denn noch fehlte ihm der allergrößte Schatz. Kaum vermochte er seine Erregung zu kaschieren. Das Schicksal bot ihm eine einmalige Gelegenheit, er durfte sie nicht versäumen. Wo aber war die Kostbarkeit? Sie blieb ihm verborgen, obwohl er jeden Zoll der Kajüte absuchte. Zur Hölle! Verbarg ein Zauberfluch diesen Schatz? War er unsichtbar gemacht worden, konnte er ihn deshalb nicht finden?
Nach kurzem Zwischenhalt in Diu segelte die Scathath weiter nach Surat (eine Stadt, die erst kürzlich von Akbar zum Ziel eines Straffeldzugs erkoren worden war). Von hier aus hatte Lord Hauksbank ursprünglich die Landreise zum Hofe des Moguls antreten wollen, doch in dieser Nacht nun, in der sie Anker vor Surat warfen (das noch in Trümmern lag, rauchend vom Zorn des Herrschers), in dieser Nacht, in der Lobegott Hawkins sich aufs Neue das Herz aus dem Leibe sang und die Mannschaft trunken von Rum das Ende der langen Seereise feierte, fand der Sucher unter Deck endlich, wonach er gefahndet hatte: das achte Geheimfach, eines mehr, als die magische Zahl Sieben erahnen ließ, eines mehr, als nahezu jeder Dieb erwartet hätte. Hinter jener Schiebetür lag die erhoffte Beute. Nach einem letzten Zugreifen gesellte er sich schließlich zu den Feiernden an Deck und sang lauter und trank reichlicher als jeder andere Mann an Bord. Da er die Gabe besaß, selbst dann noch wach zu bleiben, wenn außer ihm kein Mensch mehr die Augen aufhalten konnte, kam in den frühen Morgenstunden der Moment, da er sich in einem Beiboot an Land schlich und wie ein Gespenst unbemerkt im Innern Indiens verschwand. Lange ehe Lobegott Hawkins Alarm schlug, weil er Lord Hauksbank vom Orte gleichen Namens blaulippig in seiner letzten Meeresruhestätte fand, erlöst von der Qual aller finocchiona-Sehnsucht, war «Uccello di Firenze» spurlos verschwunden; nur sein Name blieb zurück wie eine abgestreifte Schlangenhaut. Dicht über dem Herzen des namenlosen Reisenden ruhte wohlbehütet der Schatz der Schätze, ein Brief, von Elizabeth Tudor selbst geschrieben und eigenhändig versiegelt, das Sendschreiben der Königin von England an den Herrscher von Indien, das «Sesam-öffne-dich» des Reisenden, sein Passepartout für den Hof des Moguls. Jetzt war er Englands Botschafter.
3.Im Morgendämmer wirkten die berückenden Sandsteinpaläste ...
Im Morgendämmer wirkten die berückenden Sandsteinpaläste der neuen «Siegesstadt» Akbar des Großen, als bestünden sie nur aus rotem Rauch. Die meisten Städte erwecken gleich bei ihrem Entstehen den Eindruck, sie seien für die Ewigkeit gemacht, doch Sikri würde immer einer Fata Morgana gleichen. Und während die Sonne in den Zenit aufstieg, drosch die Hitze des Tages gleich einer großen Keule auf die Steinplatten ein, machte das menschliche Ohr für alle Geräusche taub, brachte die Luft wie eine verschreckte Hirschziegenantilope zum Zittern und ließ die Grenze zwischen Vernunft und Delirium verschwimmen, zwischen dem, was erdacht, und dem, was wirklich war.
Sogar der Herrscher gab sich Hirngespinsten hin. Wie Geister schwebten Königinnen durch seine Paläste, rajputische und türkische Sultaninnen spielten miteinander Fangen. Eines dieser königlichen Geschöpfe jedoch existierte tatsächlich nicht. Es war eine nur erdachte Frau, von Akbar erträumt, so wie sich einsame Kinder Freunde erträumen, und trotz der Anwesenheit so vieler, wenn auch schwebender Gespielinnen, war der Herrscher der Ansicht, die wirklichen Königinnen seien geisterhaft, die bloß eingebildete aber sei die reale Sultanin. Er hatte ihr den Namen Jodha gegeben, und kein Mensch wagte ihm zu widersprechen. In der Abgeschiedenheit der Frauengemächer und der seidenverhangenen Flure ihres Palastes wuchs Jodhas Einfluss, ihre Macht. Tansen besang sie in seinen Liedern, und in Atelier und Skriptorium wurde ihre Schönheit mit Versen und Bildnissen gefeiert. Meister Abdus Samad, der Perser, malte sie höchstpersönlich nach der Erinnerung an einen Traum, ohne je ihr Gesicht gesehen zu haben, und als der Herrscher einen Blick auf seine Arbeit warf, musste er angesichts der vom Blatt aufleuchtenden Schönheit laut in die Hände klatschen. «Wie genau Ihr sie getroffen habt, so lebensecht», rief er, woraufhin Abdus Samad sich entspannte, plagte ihn doch mit einem Mal nicht mehr das Gefühl, sein Kopf sitze nur locker auf dem Hals. Als dieses visionäre Werk des obersten Künstlers schließlich in der Galerie des Herrschers ausgestellt wurde, begriff der ganze Hof, dass Jodha real war, und selbst die wichtigsten Höflinge, die Navratna oder Neun Sterne, erkannten nicht nur ihre Existenz an, sondern lobten auch ihre Schönheit, ihre Weisheit, die Anmut ihrer Bewegungen, die Sanftheit ihrer Stimme. Akbar und Jodhabai! Ach, ach, die Liebesgeschichte des Jahrhunderts.
Gerade rechtzeitig zum vierzigsten Geburtstag des Königs wurde die Stadt endlich fertig. Zwölf heiße Jahre hatte ihre Fertigstellung gedauert, doch hatte man dem Herrscher lange Zeit den Eindruck vermittelt, sie steige Jahr um Jahr mühelos wie durch Zauberkraft aus der Ebene empor. Sobald der Mogul in der neuen Hauptstadt weilte, ließ sein Bauminister die Arbeit ruhen. War der Monarch anwesend, verstummten die Werkzeuge der Steinmetze, schlugen die Zimmerleute keine Nägel ein, verschwanden die Anstreicher, die Einlegearbeiter, die Tuchaufhänger und Wandschirmschnitzer aus dem Blickfeld. Gestattet, so hieß es, sei nur noch durch Kissen gedämpftes Vergnügen, und einzig Laute der Verzückung waren genehmigt. Liebreizend hallten die Glöckchen der Tänzerinnen wider, plätscherten die Springbrunnen, und einer Brise Schwingen trugen die sanfte Musik des Genies Tansen heran. Gedichte wurden ins herrscherliche Ohr geflüstert, und donnerstags spielte man im Pachisi-Hof träge gar manches Spiel, dienten Sklavenmädchen auf dem Schachbrettboden als lebende Figuren. Unter riesigen Schwingfächern bot sich an verhangenen Nachmittagen verschwiegene Gelegenheit für stille Schäferstündchen. Und die sinnliche Beschaulichkeit verdankte sich ebenso sehr der Manneskraft des Monarchen wie der Hitze des Tages.
Keine Stadt besteht aus Palästen allein. Der eigentliche Ort, erbaut aus Holz und Lehm, Dung, Ziegeln und auch aus Stein, schmiegte sich von unten an die Mauern des mächtigen roten Steinsockels, auf dem die königlichen Residenzen standen. Die Herkunft und Religion der Bewohner prägten die Stadtviertel ebenso wie das Handwerk, das sie betrieben. Hier erstreckte sich die Straße der Silberschmiede, dort klirrten Waffenschmieden hinter glühenden Toren, und da, in der dritten Gasse, wurden Kleider und Flitterkram feilgeboten. Gen Osten lag die Hindu-Kolonie, und dahinter, eng an die Stadtmauern gekauert, das persische Viertel, jenseits davon das Quartier der Turani und noch weiter, in der Nähe des gigantischen Tores der Freitagsmoschee, die Heimstätten jener Muslime, die in Indien geboren worden waren. Weiter draußen, am Rande der Stadt, standen die Villen der Reichen und Vornehmen sowie Atelier und Skriptorium, deren Ruhm sich bereits im ganzen Land verbreitet hatte, außerdem ein Pavillon der Musik und einer, der Tanzaufführungen vorbehalten war. In den meisten dieser am Fuße des Hügels gelegenen Viertel Sikris hatte man nur wenig für Trägheit und Faulheit übrig, und so senkte sich der Stillebefehl wie ein erstickendes Tuch über die Lehmstadt, wenn der Herrscher von den Kriegen heimkehrte. Hühnern musste man beim Schlachten den Schnabel halten, da man fürchtete, ansonsten die Ruhe des Königs der Könige zu stören. Ein knarrendes Karrenrad mochte für den Fuhrmann die Peitsche bedeuten, und wenn er unter den Schlägen aufschrie, wurde die Strafe womöglich noch verschärft. Frauen in den Wehen versiegelten ihre Lippen, damit kein Schrei nach draußen drang, und die Pantomime des Markttreibens kam einem Irrsinn gleich. «Ist der Herrscher daheim, ist jedermann verrückt», sagten die Leute, fügten aber, da überall Spitzel und Verräter lauerten, rasch noch ein «vor Freude» an. Die Lehmstadt liebte ihren Herrscher, darauf beharrte man ohne Worte, denn Worte waren aus ebenjenem Stoff gemacht, der verboten war — aus Lauten. Wenn dann der Herrscher erneut zu einem seiner Feldzüge aufbrach — zu den niemals endenden (doch immer siegreichen) Schlachten gegen die Armeen von Gujarat und Rajasthan, von Kabul und Kaschmir —, öffneten sich die Tore des Gefängnisses der Stille, Trompeten erschallten und Jubelrufe, und endlich konnte man sich all das wieder sagen, was man über Monate hatte verschweigen müssen. Ich liebe dich. Meine Mutter ist tot. Deine Suppe schmeckt gut. Wenn du deine Schulden nicht endlich zahlst, breche ich dir beide Arme. Mein Schatz, ich liebe dich auch. Einfach alles.
Es war ein Glück für die Lehmstadt, dass ihr Herrscher oft durch militärische Angelegenheiten ferngehalten wurde; eigentlich war Akbar sogar die meiste Zeit fort, und in seiner Abwesenheit quälte das lärmende Gewusel der Armen, der höllische Spektakel der wieder rührigen Handwerker die machtlosen Königinnen, Tag für Tag. Sie ruhten beieinander und klagten, doch was sie trieben, um sich gegenseitig abzulenken, welchen Vergnügungen sie in ihren verhängten Quartieren nachgingen, welchen Genuss sie aneinander fanden, das soll hier nicht beschrieben werden. Rein blieb nur die Königin aus Akbars Phantasie, und sie war es auch, die ihm von den Entbehrungen berichtete, welche seine Untertanen erdulden mussten, weil irgendeine übereifrige Hofschranze seinem Gebieter jene Zeit zu versüßen trachtete, die er daheim verbrachte. Kaum hatte Akbar davon erfahren, hob er den Befehl auf, ersetzte den Bauminister durch einen nicht gar so griesgrämigen Kerl und bestand darauf, durch die Straßen seines unterdrückten Volkes zu reiten und laut zu rufen: «Macht so viel Lärm, wie ihr wollt! Lärm ist Leben, und ein Übermaß an Lärm verrät, dass das Leben gut ist. Wir haben noch Zeit genug, still zu sein, wenn wir erst einmal tot sind.» Die Stadt brach in freudiges Getöse aus. Dies war der Tag, an dem deutlich wurde, dass ein wahrhaft neuer Herrscher auf dem Thron saß und dass nichts auf der Welt mehr bleiben würde, wie es gewesen war.
*
Endlich herrschte Friede im Land, doch des Herrschers Gedanken fanden niemals Ruhe. Gerade kehrte er von seinem letzten Feldzug zurück, bei dem er einen Emporkömmling in Surat unterworfen hatte, doch während der langen Tage des Marschierens und Kriegführens hatte er im Geiste ebenso mit philosophischen Problemen und Fragen der Sprachkunde gerungen wie mit militärischen Themen. Der Herrscher Abul-Fath Jalaluddin Muhammad, König der Könige, seit Kindertagen als Akbar bekannt, was «der Große» bedeutet, welcher neuerdings aber, trotz der Tautologie, auch Akbar der Große genannt wurde, der große Große also, groß in seiner Größe, doppelt groß, so groß, dass die Wiederholung im Titel nicht nur angemessen, sondern notwendig schien, um dem Ruhmesreichtum seines Ruhmes angemessenen Ausdruck zu verleihen, der große Mogul, also der staubige, schlachtenmüde, siegreiche, nachdenkliche, zu Übergewicht neigende, Schnurrbart tragende, poetische, sexbesessene und absolute Herrscher, der insgesamt zu groß, zu weltumspannend und summa summarum einfach zu viel zu sein schien, um nur ein einziges Wesen sein zu können — diese allumfassende Flut eines Herrschers, dieser Weltenverschlinger, dieses mehrköpfige Ungeheuer, das von sich selbst in der ersten Person Plural sprach —, hatte während der langen, mühseligen Heimreise, begleitet von den Köpfen seiner besiegten Feinde, die in ihren versiegelten, irdenen Pökelfässern auf und ab schaukelten, über die verstörenden Möglichkeiten der ersten Person Singular nachgedacht, über das «Ich».
Die schier endlosen Tage zu Pferde, an denen man nur langsam vorankam, konnten einen Mann von spekulativem Temperament zu manch trägem Sinnieren verleiten, und so grübelte der Herrscher beim Reiten über so mannigfaltige Angelegenheiten wie die Veränderlichkeit des Universums, die Größe der Sterne, die Brüste seiner Frauen und das Wesen Gottes. Heute beschäftigte ihn zudem die grammatische Frage nach dem Selbst und seinen drei Personen, der ersten, der zweiten sowie der dritten, den Singularen und Pluralen der Seele. Er, Akbar, hatte von sich nie als «ich» gedacht, nicht insgeheim, nicht mal im Ärger oder im Traum. Er war — wie könnte es anders sein? — «wir». Er war die Definition, die Inkarnation von «wir». Er war in die Pluralität hineingeboren. Wenn er «wir» sagte, meinte er natürlich und wahrhaftig sich selbst als Verkörperung all seiner Untertanen, seiner Städte und Länder, Flüsse, Berge und Seen, ebenso wie der Tiere, Pflanzen und Bäume innerhalb seiner Grenzen, auch der Vögel am Himmel, der stechenden Mücken im Dämmerlicht und der namenlosen Ungeheuer in ihren Unterwelthöhlen, die gemächlich an der Dinge Wurzel nagten; er verstand sich als Summe all seiner Siege, als derjenige, der die Charaktere, die Fähigkeiten, vielleicht gar die Seelen der enthaupteten oder auch bloß befriedeten Gegner in sich barg; und darüber hinaus verstand er sich als Inbegriff der Vergangenheit und Gegenwart seines Volkes, als treibende Kraft der Zukunft seines Volkes.
Dieses «wir» war es, was es bedeutete, König zu sein — doch gewöhnliche Menschen, so erlaubte er es sich nun im Interesse der Gerechtigkeit und zum Zwecke der Debatte einzugestehen, dachten zweifellos dann und wann auch im Plural über sich nach.
Irrten sie? Oder (welch ketzerischer Gedanke!) irrte er? Vielleicht bedeutete die Vorstellung von sich selbst als einer Gemeinschaft nur, dass man ein Seiender in der Welt war, ein Seiender schlechthin, denn schließlich und unweigerlich war solch ein Seiender ein Seiender unter Seienden, also Teil des Seins aller Dinge. Vielleicht blieb die Pluralität nicht allein dem König vorbehalten, vielleicht war sie gar kein gottgegebenes Vorrecht. Da sich die Überlegungen eines Monarchen gewisslich, wenn auch in weniger erhebender und kultivierter Form, in den Grübeleien seiner Untertanen spiegelten, ließe sich weiterhin behaupten, es sei unvermeidlich, dass die Frauen und Männer, über die er herrschte, sich selbst ebenfalls als ein «wir» wahrnahmen. Vermutlich sahen sie sich auch als plurale Entitäten, bestehend aus ihnen selbst plus der Kinder, Mütter, Tanten, Arbeitgeber, Mitgläubigen, Kollegen, der ferneren Verwandtschaft und der Freunde. Dann war für sie ihr «ich» gleichfalls eine multiple Wesenheit, ein Selbst, das zum einen etwa Vater seiner Kinder, zum anderen aber auch Kind seiner Eltern war; sie wussten, dass sie sich von ihren Arbeitgebern unterschieden, dass sie sich bei ihren Frauen daheim fühlten — kurz und gut, genau wie er waren sie alle gleichsam Beutel voller unterschiedlicher Ichs, die barsten vor Pluralität. Gab es denn keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Herrscher und den Beherrschten? Nun aber stellte sich die ursprüngliche Frage in neuer, verblüffender Weise: Wenn seine Untertanen mit ihren vielen Selbstverkörperungen von sich im Singular statt im Plural zu denken vermochten, konnte er dann auch ein «ich» sein? Konnte es ein «ich» geben, das einfach nur er selbst war? Lagen solch nackte, einsame «ich» unter den übervölkerten «wir» dieser Erde begraben?
Es war eine Frage, die ihm Angst machte, wie er da auf seinem Schimmel nach Hause ritt, furchtlos, unbesiegt, doch auch, wie zugegeben werden muss, mit leichtem Fettansatz; eine Frage, die ihn, kam sie ihm nachts in den Sinn, kaum mehr schlafen ließ. Was sollte er sagen, wenn er seine Jodha wiedersah? Würde sie ihn, falls er es mit einem simplen «Ich bin zurück» oder «Ich bin’s» versuchte, in der zweiten Person Singular anreden können, mit jenem «du», das Kindern, Liebhabern und Göttern vorbehalten war? Und was würde es bedeuten? Dass er wie ein Kind war, ein Gott oder einfach ein Liebhaber, von dem auch sie geträumt hatte, den sie so sehnsüchtig ins Sein träumte, wie er sie einst erträumte? Könnte sich dieses kleine Wort, das «du», als das erregendste Wort der Sprache erweisen? «Ich», übte er mit verhaltener Stimme. Hier bin «ich». «Ich» liebe dich. Komm zu «mir».
Ein letztes Gefecht störte seine Überlegungen auf dem Weg nach Hause, denn es galt, einen weiteren fürstlichen Emporkömmling zu unterwerfen. Der Abstecher führte ihn zur Halbinsel Kathiawar, wo er den störrischen Rana von Cooch Naheen bezwingen wollte, einen jungen Mann mit großem Mundwerk und noch größerem Schnauzbart (der Herrscher bildete sich allerhand auf den eigenen Schnauzbart ein, weshalb er für Konkurrenten nicht viel übrighatte), einen feudalen Gebieter, der mit absurder Vorliebe von Freiheit faselte. Freiheit für wen und von was, grummelte der Herrscher lautlos vor sich hin. Freiheit war das Hirngespinst von Kindern, ein Spiel für Weiber. Kein Mensch war jemals frei. Wie eine Heimsuchung, die sich lautlos nähert, marschierte seine Armee unter den weißen Bäumen des Waldes von Gir dahin, und als man auf der kümmerlich kleinen Burg von Cooch Naheen an den schwankenden Baumgipfeln das Nahen des Todes erkannte, sprengte man die eigenen Türme, zog die weiße Flagge auf und bat ergebenst um Gnade. Statt besiegte Gegner hinzurichten, heiratete der Herrscher oft eine ihrer Töchter und verlieh dem unterlegenen Schwiegervater ein Amt, denn ein neues Familienmitglied war ihm lieber als ein verfaulender Leichnam. Diesmal jedoch riss er dem anmaßenden Rana den Schnauzbart aus dem hübschen Gesicht und zerhackte den schwächlichen Träumer in grausige Stücke. Er tat es höchstpersönlich mit dem eigenen Schwert, genau wie sein Großvater es getan hätte, und zog sich dann in sein Quartier zurück, um zu zittern und zu trauern.
Mit großen Mandelaugen blickte der Herrscher in die Unendlichkeit wie eine verträumte junge Dame, wie ein Matrose auf der Suche nach Land. Die vollen Lippen waren zu einem weibischen Schmollmund geschürzt, doch war er trotz dieser mädchenhaften Note ein mächtiges Mannsbild, riesenhaft und stark. Als Junge hatte er mit bloßen Händen ein Tigerweibchen getötet, um dann, bekümmert über die eigene Tat, jeglichem Fleischverzehr auf immer abzuschwören und Vegetarier zu werden. Ein muslimischer Vegetarier, ein Krieger, der nur Frieden wollte, ein Philosoph und König: ein Widerspruch in sich. Das war der größte Herrscher, den das Land je gekannt hatte.
In den trübsinnigen Stunden nach der Schlacht, als sich der Abend auf die seelenlosen Toten herabsenkte und unterhalb der zerstörten Burg in Blutfarben zerlief, lauschte der Herrscher dem leisen Nachtigallenlied eines kleinen Wasserfalls — bul-bul, bul-bul machte er —, nippte in seinem Brokatzelt an mit Wasser verdünntem Wein und gedachte mit Wehmut seiner blutrünstigen Ahnenschar. Er wollte nicht wie seine barbarischen Vorfahren sein, auch wenn sie die größten Menschen in der Geschichte gewesen waren. Ihn bedrückten die Namen mitsamt ihrer räuberischen Vergangenheit, die Namen, aus denen sich inmitten von Kaskaden menschlichen Blutes sein eigener Name ableitete: Großvater Babar, der Kriegsherr von Ferghana, der dieses neue Reich erobert hatte, dieses «Indien» mit seinem zu großen Reichtum und den zu vielen Göttern, das er sein Leben lang verfluchen sollte, Babar, die Kriegsmaschine mit der unverhofften Gabe für den treffenden Ausdruck, und vor Babar der mörderische Fürst von Transoxanien und der Mongolei, der mächtige, alle überragende Temüdschin — Genghis, Changez, Jenghis oder Dschingis Khan —, dank dessen er, Akbar, den Namen eines Mughal annehmen musste, obwohl er doch gar kein Mongole war oder sich zumindest nicht als solcher verstand. Er sah sich als ... Hindustani. Seine Horden waren keine Goldenen Horden, auch keine Blauen, keine Weißen. Allein das Wort «Horde» klang schweinisch grob in seinen empfindlichen Ohren. Er wollte keine Horden. Er wollte kein geschmolzenes Silber in die Augen besiegter Gegner träufeln oder sie unter der Plattform zerquetschen, auf der er zu Abend aß. Er war der Kriege müde und erinnerte sich an seinen Lehrer aus Kindertagen, den Perser Mir, der ihm gesagt hatte, wer in Frieden mit sich selbst leben wolle, müsse mit allen anderen Menschen in Frieden leben. Sulh-i-kul, vollständiger Friede. Kein Khan begriff eine solche Idee. Er wollte kein Khanat. Er wollte ein Land.
Dabei ging es nicht um den Temüdschin allein. Er entsprang in direkter Linie ebenfalls den Lenden eines Mannes, dessen Name «Eisen» bedeutete. Das Wort für Eisen lautete timur in der Sprache seiner Vorväter. Timur-e-lang, der hinkende Eisenmann. Timur, der Zerstörer von Damaskus und Bagdad, der Delhi in Ruinen zurückließ, verfolgt von fünfzigtausend Geistern. Akbar wäre es lieber gewesen, Timur nicht zu seinen Vorfahren zählen zu müssen. Er hatte aufgehört, Tschagatai zu sprechen, Timurs Sprache, benannt nach einem der Söhne von Dschingis Khan; stattdessen hatte er erst Persisch angenommen und später dann das Bastardgemisch der vorrückenden Armee, urdu, eine Lagersprache, gezeugt von einem halben Dutzend halbverstandener, plappernder, pfeifender Dialekte, die zu jedermanns Überraschung einen wunderbaren neuen Klang ergaben: die Sprache eines Dichters, geboren aus dem Mund der Soldaten.
Der Rana von Cooch Naheen, jung, schlank und dunkelhäutig, kniete mit haarlosem, blutigem Gesicht zu Akbars Füßen und wartete auf den ersten Schlag. «Die Geschichte wiederholt sich», sagte er. «Vor siebzig Jahren hat Euer Großvater meinen Großvater ermordet.»
«Unser Großvater», erwiderte der Herrscher und benutzte traditionsgemäß den königlichen Plural, denn dies war wohl kaum der rechte Moment für ein Experiment mit dem Singular; der elende Wurm hatte sich das Privileg nicht verdient, Zeuge einer solch historischen Tat zu werden. «Unser Großvater war ein Barbar mit der Sprache eines Poeten. Wir dagegen sind ein Dichter mit der Geschichte eines Barbaren und einem barbarischen Geschick in der Kriegsführung, was uns durchaus nicht gefällt. Somit ist bewiesen, dass die Geschichte sich keineswegs wiederholt, sondern voranschreitet, und dass der Mensch fähig ist, sich zu ändern.»
«Welch eigenartige Bemerkung für einen Scharfrichter», sagte der junge Rana leise, «doch bringt es nichts, mit dem Tod zu streiten.»
«Eure Zeit ist gekommen», pflichtete ihm der Herrscher bei. «Ehe Ihr uns aber verlasst, sagt uns wahrheitsgemäß, was für ein Paradies Ihr zu entdecken hofft, sobald Ihr den Schleier durchschreitet?» Der Rana hob sein übel zugerichtetes Gesicht und schaute dem Herrscher in die Augen. «Im Paradies haben Anbetung und Auseinandersetzung die gleiche Bedeutung», verkündete er. «Der Allmächtige ist kein Tyrann. Im Hause Gottes steht es jedem frei, nach Belieben zu reden, denn ebendies versteht man dort unter Andacht.» Er gehörte zu einer aufreizenden, selbstgerechten Sorte von jungen Leuten, das stand außer Frage, doch fand sich Akbar trotz seiner Verärgerung gerührt. «Wir versprechen Euch», sagte der Herrscher, «dass wir dieses Haus der Anbetung hier auf Erden schaffen werden.» Und mit einem Schrei — Allahu Akbar, Gott ist groß, vielleicht aber auch: Akbar ist Gott — hackte er dem kleinen, aufgeblasenen Blödmann den frechen, belehrenden und deshalb nun gänzlich unnötigen Kopf ab.
Kaum hatte er den Rana getötet, überfiel den Herrscher der altbekannte Dämon der Einsamkeit. Sprach ein Mensch mit ihm wie mit seinesgleichen, trieb es ihn in den Wahnsinn, und das war ein Fehler, so viel wusste er bereits; eines Königs Ärger war immer übel, denn ein verärgerter König war wie ein Gott, der Fehler macht. Und hier zeigte sich in ihm ein weiterer Widerspruch. Er war nicht nur ein barbarischer Philosoph und Mörder von Heulsusen, sondern auch ein der Unterwürfigkeit und Speichelleckerei verfallener Egoist, den es dennoch nach einer anderen Welt verlangte, einer Welt, in der er ebenjenen Menschen fand, der ihm ebenbürtig war und ihm wie ein Bruder begegnete, mit dem sich unbeschwert reden ließ, den er belehren und von dem er lernen, dem er Freude bereiten und der ihm Genuss verschaffen konnte, eine Welt, in der er die selbstgefällige Befriedigung der Eroberungen durch die sanfteren, doch anspruchsvolleren Freuden des Diskurses ersetzen konnte. Gab es eine solche Welt? Auf welchem Weg ließ sie sich erreichen? Lebte irgendwo auf Erden ein solcher Mensch? Oder hat er ihn gerade umgebracht? Was, wenn der Rana mit dem Schnauzbart der Einzige gewesen war? Hatte er gerade den einzigen Mann auf Erden erschlagen, den er hätte lieben können? Der Herrscher wurde weinselig und gefühlsduselig, unter Tränen verschwamm sein Blick.
Wie vermochte er jener Mensch zu werden, der er sein wollte? Dieser Akbar der Große? Wie? Da war niemand, mit dem er reden konnte. Seinen stocktauben Leibdiener Bhakti Ram Jain hatte er aus dem Zelt befohlen, um in Ruhe bechern zu können. Ein Leibdiener, der das Gebrabbel seines Herrn nicht hören konnte, war ein Segen, doch hatte Bhakti Ram Jain in letzter Zeit gelernt, von den Lippen abzulesen, was seinen Nutzen beträchtlich verringerte und ihn wie alle Welt zu einem Lauscher, einem Mithörer machte. Der König ist verrückt. So hieß es: Jeder sagte das. Seine Soldaten, sein Volk, seine Frauen. Vielleicht sogar Bhakti Ram Jain. Doch sie sagten es ihm nicht ins Gesicht, denn er war ein Riese von einem Mann und, gleich den Helden aus alten Sagen, ein gewaltiger Krieger, außerdem war er der König der Könige, weshalb niemand etwas dagegen einzuwenden wagte, wenn er ein bisschen bekloppt sein wollte. Nur war der König eben nicht bekloppt. Der König gab sich bloß nicht damit zufrieden, nur zu sein. Er strebte danach, zu werden.
*