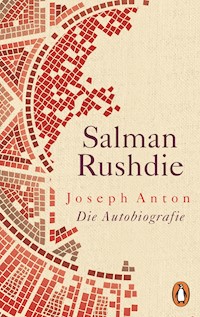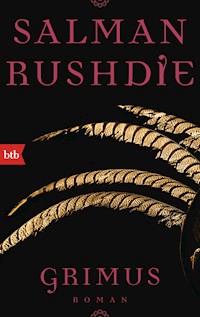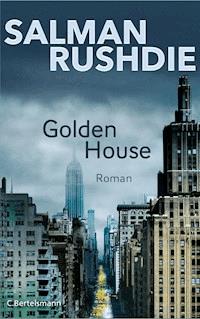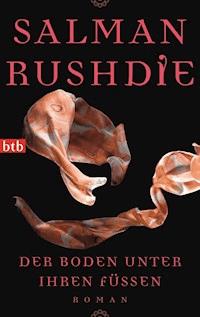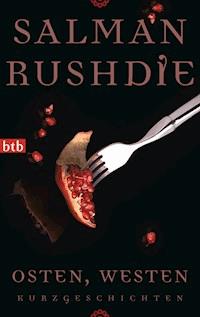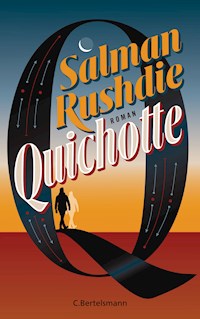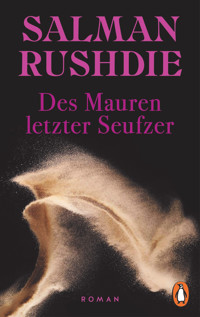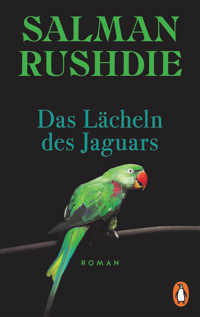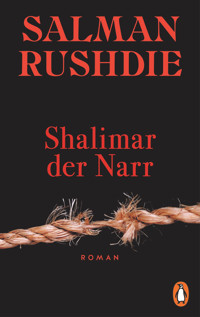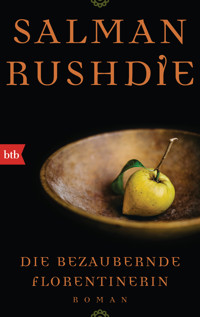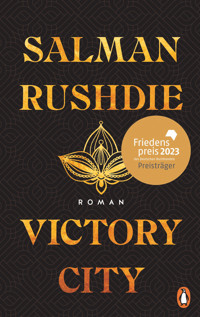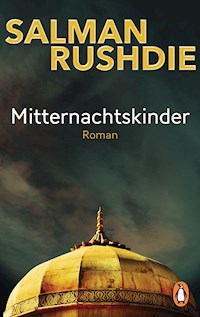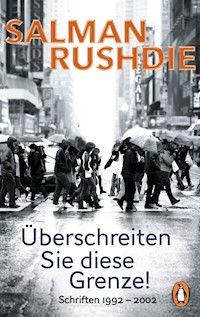14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Leben und Schreiben, Wirklichkeit und Fantasie sind bei kaum einem Autor so eng, so schicksalhaft miteinander verknüpft wie bei Salman Rushdie. Ob in seinem Weltbestseller »Mitternachtskinder«, in seinem jüngsten, hochgelobten Roman »Quichotte« oder in den vielzähligen Essays, die er über die Jahre vorgelegt hat – in jeder Zeile steckt er selbst: seine Suche nach einer allgemeingültigen Sprache, sein Glaube an die Kraft des Erzählens, seine Erfahrung als Verfolgter und Emigrant und damit verbunden seine radikale Absage an Unterdrückung und Diskriminierung. Das zeigen alle seine Werke eindrücklich. Klug und differenziert beleuchtet Rushdie in seinen Essays, Glossen und Reden die aktuelle Weltpolitik von Osama bin Laden bis Donald Trump, gibt Einblick in seine Ideenwelt und sein künstlerisches Schaffen. Gerade in seinen brillanten Literaturkritiken wird deutlich, wer ihn inspiriert: Shakespeare, Borges, auch sein Freund Harold Pinter.
Die in »Sprachen der Wahrheit« erstmals versammelten und zum Teil bisher unveröffentlichten Texte aus den vergangenen zwei Jahrzehnten veranschaulichen, wie ernst Salman Rushdie seine Verantwortung als Weltautor nimmt. So sind seine geistreichen Schriften immer auch ein Plädoyer für das vielstimmige Miteinander der Kulturen.
»Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten.« Arno Widmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
»Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten.« Arno Widmann
Leben und Schreiben, Wirklichkeit und Fantasie sind bei kaum einem Autor so eng, so schicksalhaft miteinander verknüpft wie bei Salman Rushdie. Ob in seinem Weltbestseller Mitternachtskinder, in seinem jüngsten, hochgelobten Roman Quichotte oder in den vielzähligen Essays, die er über die Jahre vorgelegt hat – in jeder Zeile steckt er selbst: seine Suche nach einer allgemeingültigen Sprache, sein Glaube an die Kraft des Erzählens, seine Erfahrung als Verfolgter und Emigrant und damit verbunden seine radikale Absage an Unterdrückung und Diskriminierung. Das zeigen alle seine Werke eindrücklich. Klug und differenziert beleuchtet Rushdie in seinen Essays, Glossen und Reden die aktuelle Weltpolitik von Osama bin Laden bis Donald Trump, gibt Einblick in seine Ideenwelt und sein künstlerisches Schaffen. Gerade in seinen brillanten Literaturkritiken wird deutlich, wer ihn inspiriert: Shakespeare, Borges, auch sein Freund Harold Pinter. Die in Sprachen der Wahrheit erstmals versammelten und zum Teil bisher unveröffentlichten Texte aus den vergangenen zwei Jahrzehnten veranschaulichen, wie ernst Salman Rushdie seine Verantwortung als Weltautor nimmt. So sind seine geistreichen Schriften immer auch ein Plädoyer für das vielstimmige Miteinander der Kulturen.
Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Sein Roman Mitternachtskinder wurde 1981 mit dem Booker Prize ausgezeichnet und machte ihn weltberühmt. Seine bislang 14 Romane erhielten renommierte internationale Preise und sind in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 2007 schlug ihn die Queen zum Ritter. 2019 wurde er mit dem WELT-Literaturpreis ausgezeichnet. Neben seinen literarischen Arbeiten veröffentlichte Salman Rushdie immer auch Essays in namhaften internationalen Medien, die ihn als brillanten Literatur- und Gesellschaftskritiker zeigen. In Sprachen der Wahrheit sind seine Texte aus den Jahren 2003 bis 2020 versammelt.
»Gebt Salman Rushdie den Nobelpreis!«FAZ
»Salman Rushdie verdient es, als einer der großen Geschichtenerzähler unserer Zeit bezeichnet zu werden, als magischer Realist in der Tradition von Grass, Calvino, Borges und vor allem García Márquez.« The Observer
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
SALMANRUSHDIE
Sprachen
der Wahrheit
Texte 2003–2020
Aus dem Englischen von
Sabine Herting und Bernhard Robben
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2021
unter dem Titel Languages of Truth. Nonfiction 2003–2020
bei Penguin Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © Salman Rushdie, 2021
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: bürosüd, München
Umschlagabbildung: Jeremy Sutton-Hibbert/Getty Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-25725-5V002
www.cbertelsmann.de
Für die nächste Generation
Nabeelah
und
Rose
Inhalt
Teil eins
Wundersame Geschichten
Proteus
Heraklit
Die Anfänge eines anderen Schriftstellers
Teil zwei
Philip Roth
Kurt Vonnegut und Schlachthof 5
Samuel Becketts Romane
Cervantes und Shakespeare
Gabo und ich
Harold Pinter (1930–2008)
Vorwort zu den Paris-Review-Interviews, Vol. IV
Autobiografie und Roman
Adaption
Anmerkungen zur Trägheit: Von Saligia zu Oblomow
Hans Christian Andersen
King of the World von David Remnick
Nun gut, so widersprech ich mir selbst
Teil drei
Wahrheit
Mut
Texte für den PEN
1. Der Pen und das Schwert: Der internationale Pen-Kongress 1986
2. Die Entstehung von Pen World Voices
3. Die Arthur Miller Lecture, Pen-World-Voices-Festival 2012
4. Eröffnungsabend des Pen-World-Voices-Festivals 2014
5. Eröffnungsabend des Pen-World-Voices-Festivals 2017
Christopher Hitchens (1949–2011)
Der Freiheitsinstinkt
Osama bin Laden
Ai Weiwei und andere: Chinas Crackdown im Jahre 2011
Der Halbfraugott
Rede vor den Absolventen der Nova Southeastern University, 2006
Rede vor den Absolventen der Emory University, 2015
Teil vier
Der vielhändige Künstler: Der Mogulkaiser Akbar und die Entstehung des Hamzanama
Amrita Sher-Gil: Briefe
Bhupen Khakhar (1934–2003)
Being Francesco Clemente: Selbstporträts
Taryn Simon: Ein amerikanisches Verzeichnis des Verborgenen und Ungewohnten
Kara Walker im Hammer Museum, Los Angeles, 2009
Sebastião Salgado
Weihnacht des Ungläubigen
Carrie Fisher
Pandemie
Der Proust-Fragebogen: Vanity Fair
Über diese Texte
Zitatnachweise
Teil eins
WUNDERSAME GESCHICHTEN
I
Ehe es Bücher gab, gab es Geschichten. Anfangs wurden die Geschichten nicht niedergeschrieben. Manchmal wurden sie sogar gesungen. Kinder wurden geboren, und ehe sie sprechen konnten, sangen ihnen ihre Eltern Lieder vor, vielleicht ein Lied über ein Ei, das von einer Mauer fiel, oder über einen Jungen und ein Mädchen, die auf einen Hügel stiegen und hinunterpurzelten. Als die Kinder älter wurden, verlangten sie fast genauso oft nach Geschichten wie nach etwas Essbarem. Nun gab es eine Gans, die goldene Eier legte, oder einen Jungen, der die Kuh der Familie für eine Handvoll Zauberbohnen verkaufte, oder ein unartiges Häschen, das unerlaubt den Gemüsegarten des bedrohlichen Farmers betrat. Die Kinder liebten diese Geschichten und wollten sie wieder und wieder hören. Dann wuchsen sie heran und fanden diese Geschichten in Büchern. Und andere Geschichten, die sie nie zuvor gehört hatten, über ein Mädchen, das in einen Kaninchenbau fiel, oder einen dummen alten Bären, ein etwas ängstliches Ferkel und einen trübsinnigen Esel oder über Milos ganz und gar unmögliche Reise oder über einen Ort, wo die wilden Kerle wohnten. Sie hörten und lasen Geschichten und verliebten sich in sie, in Micky in der Nachtküche mit den Zauberbäckern, die alle wie Oliver Hardy aussahen, und in Peter Pan, der dachte, der Tod würde ein ungeheuer großes Abenteuer sein, und in Bilbo Beutlin, der unter einem Gebirge einen Rätselkampf gegen eine merkwürdige Kreatur gewann, die ihren Schatz verloren hatte, und das Sich-in-Geschichten-Verlieben weckte etwas in den Kindern, das sie ihr ganzes Leben lang nähren sollte: ihre Fantasie.
Die Kinder verliebten sich leicht in Geschichten und lebten auch in Geschichten, Geschichten, die sie jeden Tag in Spiele umsetzten, sie erstürmten Burgen, eroberten Länder und segelten über das blaue Meer, und in der Nacht tummelten sich Drachen in ihren Träumen. Nun waren sie alle Geschichtenerzähler, Erfinder von Geschichten ebenso wie Zuhörer von Geschichten. Doch sie wurden größer, und allmählich fielen die Geschichten von ihnen ab, die Geschichten wurden in Kisten verpackt und auf dem Dachboden verstaut, und für die einstigen Kinder wurde es schwieriger, Geschichten zu erzählen oder ihnen zu lauschen, und leider auch schwieriger, sich in sie zu verlieben. Für einige von ihnen wurden Geschichten offenbar unbedeutend, überflüssig: Kinderkram. Das waren traurige Leute, und wir müssen sie bedauern und uns bemühen, sie nicht für dumme, langweilige, spießige Verlierer zu halten.
Ich glaube, dass die Bücher und Geschichten, in die wir uns verlieben, uns zu dem machen, was wir sind; oder, um nicht zu übertreiben, dass der Akt des Sichverliebens in ein Buch oder in eine Geschichte uns auf eine bestimmte Weise verändert und die geliebte Geschichte zu einem Teil unserer Weltsicht wird, einem Teil der Art und Weise, wie wir in unserem täglichen Leben Dinge verstehen, Urteile fällen und Entscheidungen treffen. Als Erwachsene, die sich weniger leicht verlieben, enden wir vielleicht mit nur einer Handvoll Bücher, von denen wir aufrichtig sagen können, dass wir sie lieben. Vielleicht fällen wir darum so viele Fehlurteile.
Diese Liebe ist weder bedingungslos noch für die Ewigkeit. Ein Buch sagt uns vielleicht nichts mehr, wenn wir älter werden und unser Gefühl für es verblasst. Oder wir sind mit einem Mal, wenn sich unser Leben formt und unser Verständnis hoffentlich wächst, in der Lage, ein Buch wertzuschätzen, über das wir früher hinweggegangen sind, wir sind vielleicht mit einem Mal in der Lage, seiner Musik zu lauschen, sind hingerissen von seinem Lied. Als ich als Collegestudent zum ersten Mal Günter Grass’ großen Roman Die Blechtrommel las, war ich unfähig, ihn zu Ende zu lesen. Ganze zehn Jahre stand er im Regal, bis ich ihm eine zweite Chance gab, woraufhin er mein Lieblingsroman aller Zeiten wurde: eines der Bücher, von dem ich sagen würde, dass ich es liebe. Es ist interessant, sich die Frage zu stellen: Welche Bücher liebst du wirklich? Versuch es. Die Antwort wird dir eine Menge darüber sagen, wer du im Augenblick bist.
Ich bin in Bombay, Indien, aufgewachsen, in einer Stadt, die heute gar nicht mehr die Stadt ist, die sie einmal war, und die sogar ihren Namen in den sehr viel weniger wohlklingenden Namen Mumbai geändert hat; in einer Zeit, die so ganz anders war als die Gegenwart, weshalb sie unglaublich fern, ja sogar unwirklich erscheint: eine echte Version des mythischen Goldenen Zeitalters. Die Kindheit, so erinnert uns A. E. Housman in dem Gedicht »Das Land versunkener Geborgenheit«, im Englischen auch oft die Blue Remembered Hills genannt, ist das Land, zu dem wir alle einst gehörten und das wir alle letztendlich verlieren:
Die Weise tötet, die in meinem Herzen singt:
Wo kommt sie her? Sie kommt von weit;
von Hügeln, blauend in Erinnerung; sie klingt
von Giebeln, Türmen und Tälern breit.
Das ist das Land versunkener Geborgenheit.
Ich seh die Straße meines Glücks,
vor mir wie in der Jugendzeit;
doch niemals finde ich den Weg zurück.
In diesem fernen Bombay erschienen mir die Geschichten und Bücher, die mich aus dem Westen erreichten, wie wahrhaft wundersame Geschichten. Hans Christian Andersens Märchen »Die Schneekönigin«, in dem Splitter des Zauberspiegels in den Blutkreislauf der Leute eindrangen und ihr Herz in einen Eisklumpen verwandelten, war für einen Jungen aus den Tropen, wo es Eis nur im Kühlschrank gab, sogar noch erschreckender. »Des Kaisers neue Kleider« waren für einen Jungen, der unmittelbar nach dem Ende des Britischen Empire aufwuchs, eine ganz besondere Freude. Und da war Huckleberry Finn, unwiderstehlich für einen Jungen aus Bombay wegen des außergewöhnlichen Handlungsspielraums des Helden (obwohl ich mir den Kopf darüber zerbrach, warum der entlaufene Sklave Jim, wenn er schließlich versuchte, der Sklaverei zu entkommen und in den sklavenfreien Norden zu fliehen, auf einem Floß auf dem Mississippi saß, der doch nach Süden fließt).
Vielleicht empfindet man Geschichten von anderswo immer als Märchen, und sicher ist es eines der großen Wunder der Literatur, dass sie uns viele »Anderswo« eröffnet, von der Unterwasserwelt der kleinen Seejungfrau bis hin zu Dorothys Oz, und sie zu unseren macht. Doch für mich lagen die wahrhaft wundersamen Geschichten näher an meinem Zuhause, und ich habe es immer für mein großes Glück als Schriftsteller erachtet, von ihnen durchdrungen aufgewachsen zu sein.
Manche dieser Geschichten waren sakralen Ursprungs, aber da ich in einem nichtreligiösen Haushalt aufwuchs, habe ich sie einfach als wunderschöne Geschichten aufgenommen. Das bedeutete nicht, dass ich sie nicht glaubte. Als ich von dem Samudra Manthan hörte, der Geschichte, wie der große Gott Indra die Milchstraße schüttelte und dabei den sagenhaften Berg Mandara als seinen Quirl benutzte, um den riesigen Milchozean am Himmel zu zwingen, seinen Nektar, amrita, den Nektar der Unsterblichkeit, herzugeben, sah ich plötzlich die Sterne mit neuen Augen. In dieser unglaublich fernen Zeit, in meiner Kindheit, in einer Zeit, ehe die Lichtverschmutzung die meisten Sterne für die Stadtbewohner unsichtbar machte, konnte ein Junge in einem Bombayer Garten noch in den Nachthimmel hinaufschauen, der Sphärenmusik lauschen und mit demütiger Freude den breiten galaktischen Streifen betrachten. Ich stellte mir vor, er triefe vor magischem Nektar. Vielleicht öffnete ich den Mund, damit ein Tropfen hineinfalle und auch ich unsterblich würde.
Die Schönheit der wundersamen Geschichte und ihres Abkömmlings, der Fiktion, ist: Man weiß, dass die Geschichte ein Werk der Fantasie ist, das heißt, sie ist unwahr, und zugleich glaubt man, sie enthalte eine tiefere Wahrheit. Die Grenze zwischen dem Magischen und dem Realen existiert in diesen Momenten nicht mehr.
Wir waren keine Hindus, aber meine Familie war der Ansicht, die großen Geschichten des Hinduismus seien auch für uns von Bedeutung. Am Tag des alljährlichen Ganpati-Fests, wenn große Menschenmengen ein Bildnis der elefantenköpfigen Gottheit Ganesha an den Chowpatty Beach trugen, um den Gott im Meer zu versenken, hatte ich das Gefühl, Ganesha gehöre auch mir; er sei das Symbol für eine kollektive Freude und, ja, für die Gesamtheit der Stadt, statt nur ein Mitglied des Pantheons eines »konkurrierenden« Glaubens. Als ich erfuhr, dass Ganeshas Liebe zur Literatur so groß war, dass er zu Füßen des indischen Homer, des weisen Vyasa, saß und zum Schreiber wurde, der das große Mahabharata-Epos notierte, gehörte er noch inniger zu mir; und als ich erwachsen war und einen Roman über einen Jungen namens Saleem mit einer ungewöhnlich großen Nase schrieb, schien es mir nur natürlich – obwohl Saleem aus einer muslimischen Familie stammte –, den Erzähler der Mitternachtskinder mit dem literarischsten Gott zu assoziieren, der zufällig auch eine große Rüsselnase hat. Das Verschwimmen der Grenzen zwischen den religiösen Kulturen in diesem alten, wirklich säkularen Bombay erscheint heute als ein weiteres Element, das die Vergangenheit von Indiens bitterer, unterdrückter, strenger, sektiererischer Gegenwart trennt.
Das Mahabharata und sein Nebenstrang, das Ramayana, zwei der längsten wundersamen Geschichten von allen, sind in Indien noch lebendig, lebendig in den Köpfen der Inder und bedeutsam für ihr tägliches Leben, ebenso wie die Götter der Griechen und Römer einst in der westlichen Fantasie lebendig waren. Früher einmal, und vor nicht allzu langer Zeit, war es in den Ländern des Westens möglich, auf die Geschichte von Nessos’ Hemd anzuspielen, und die Menschen wussten, dass der sterbende Kentaur Nessos Deïaneira, die Frau des Herakles oder Herkules, überlistete, indem er ihrem Mann sein Hemd zukommen ließ, wohl wissend, dass es vergiftet war und ihn töten würde. Einst wusste ein jeder, dass nach dem Tod Orpheus’, des größten Dichters und Sängers, sein abgetrennter Kopf weitersang. Diese Bilder und viele andere standen den Menschen als Metaphern zur Verfügung, um ihnen zu helfen, die Welt zu verstehen. Die Kunst stirbt nicht, auch wenn der Künstler stirbt, sagte Orpheus’ Kopf. Das Lied überlebt den Sänger. Und das Nessoshemd warnte uns, dass selbst ein ganz besonderes Geschenk gefährlich sein kann. Ein anderes derartiges Geschenk war natürlich das Trojanische Pferd, das uns alle lehrte, die Griechen zu fürchten, selbst wenn sie Geschenke mitbringen. Einige Metaphern aus den wundersamen Geschichten des Westens haben es geschafft, lebendig zu bleiben.
Aber im Indien meiner Kindheit und Jugend waren alle wundersamen Geschichten lebendig und sind es noch immer. Heute ist es nicht einmal notwendig, das ganze Ramayana oder Mahabharata zu lesen; mancher mag dankbar sein für diese Nachricht, denn das Mahabharata ist das längste Poem der Weltliteratur, über 200 000 Verse lang, das heißt, zehnmal länger als die Ilias und die Odyssee zusammen, während das Ramayana etwa 50 000 Verse umfasst, lediglich zweieinhalbmal so viel wie die Werke Homers zusammen. Zum Glück für jüngere Leser bietet die ungemein beliebte Comicbuchreihe Amar Chitra Katha, »unsterbliche Bildergeschichten«, versierte Darstellungen aus beiden Epen. Und zum Glück für die Erwachsenen brachte eine 94 Episoden umfassende Fernsehversion des Mahabharata die Nation jede Woche zum Innehalten, als nämlich die ursprünglich 1990 gedrehte Serie Hunderte Millionen Zuschauer erreichte.
Man muss zugeben, dass der Einfluss dieser Geschichten nicht immer positiv ist. Die sektiererische Politik der hindunationalistischen Parteien wie der BJP nutzt die Rhetorik der Vergangenheit, um über eine Rückkehr zum »Ram Rajya«, dem »Reich des Gottes Rama«, zu fantasieren, über ein angeblich goldenes Zeitalter des Hinduismus ohne solche Unannehmlichkeiten wie Anhänger anderer Religionen, die die Sache verkomplizieren. Die Politisierung des Ramayana und des Hinduismus im Allgemeinen ist in den Händen skrupelloser sektiererischer Anführer zu einer gefährlichen Sache geworden. Der Angriff auf das Buch The Hindus von einer der besten Sanskritforscherinnen der Welt, Wendy Doniger, ein Werk vollendeter Gelehrsamkeit, und die bedauerliche Entscheidung von Penguin India, dieses Buch als Reaktion auf fundamentalistische Kritik zurückzuziehen und vorhandene Exemplare zu vernichten, ist eine deutliche Veranschaulichung dieser Tatsache.
Probleme können sich auch über die Politik hinaus ausdehnen. In einigen späteren Versionen des Ramayana lassen eines Tages der verbannte Gott Rama und sein Bruder Lakshmana Sita allein in ihrem Exil in den Wäldern zurück, während sie einen goldenen Hirschen jagen, ohne zu wissen, dass der Hirsch eigentlich ein rakshasa ist, eine Art verkleideter Dämon. Um Sita während der Abwesenheit der Brüder zu schützen, zieht Lakshmana einen rekha oder einen Zauberkreis um ihre Hütte; jeder mit Ausnahme von Rama, Lakshmana und Sita, der versucht, ihn zu überschreiten, wird in den Flammen, die von der Linie aufsteigen, verbrennen. Doch der Dämonenkönig Ravana verkleidet sich als Bettler und bittet an Sitas Tür um Almosen, und sie selbst überschreitet die Linie, um ihm das Gewünschte zu geben. So kann er sie ergreifen und zaubert sie in sein Königreich Lanka, woraufhin Rama und Lakshmana einen Krieg führen müssen, um sie zurückzubekommen. Den Lakshman rekha zu übertreten ist zu einer Metapher geworden, die für das Überschreiten von Grenzen des Erlaubten oder Richtigen steht oder für das Zuweitgehen, für das törichte Dem-Bildersturm-Erliegen und für entsetzliche Konsequenzen, die man dadurch auf sich zieht.
Vor einigen Jahren ereigneten sich in Delhi der heute berüchtigte Überfall und die Gruppenvergewaltigung einer dreiundzwanzigjährigen Studentin, die wenig später an ihren grauenhaften Verletzungen starb. Einige Tage nach diesem entsetzlichen Ereignis äußerte ein Staatsminister, hätte die betreffende junge Frau nicht den Lakshman rekha überschritten – mit anderen Worten, hätte sie nicht mit einem Freund am Abend den Bus genommen, statt sittsam zu Hause zu bleiben –, wäre sie nicht angegriffen worden. Wegen des öffentlichen Aufschreis nahm er diese Bemerkung später zurück, aber der Gebrauch dieser Metapher zeigte, dass noch immer zu viele Männer in Indien glauben, es gebe Grenzen, die Frauen nicht überschreiten sollten. Es sollte erwähnt werden, dass in den meisten traditionellen Fassungen des Ramayana, einschließlich der Originalfassung des Dichters Valmiki, die Geschichte des Lakshman rekha nicht enthalten ist. Jedenfalls kann eine apokryphe Wundergeschichte manchmal ebenso mächtig sein wie eine kanonische.
Doch ich möchte zu diesem Kinder-Ich zurückkehren, das sich von Geschichten bezaubern ließ, deren ausdrücklicher und einziger Zweck die Bezauberung war. Ich möchte von den großen religiösen Epen übergehen zu dem großen Schatz von skurrilen, augenzwinkernden, geheimnisvollen, aufregenden, komischen, wunderlichen, surrealen und sehr häufig ausnehmend erotischen Narrativen, die sich außerdem noch in der Fundgrube des Ostens befinden, weil sie – nicht nur, aber durchaus auch – zeigen, wie viel Freude aus Literatur zu gewinnen ist, sobald Gott im Bild fehlt. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Geschichten, die auf den Seiten von Tausendundeine Nacht versammelt sind, um nur ein Beispiel zu nennen, ist die nahezu vollkommene Abwesenheit von Religion. Viel Sex, viel Ausgelassenheit, eine Menge Unaufrichtigkeit; Ungeheuer, Dschinn, der Riesenvogel Roch; bisweilen gigantische Mengen flüssigen und geronnenen Bluts; aber kein Gott. Und genau darum lehnen strenge Islamisten dieses Buch so vehement ab.
In Ägypten bekam im Mai 2010, gerade einmal sieben Monate vor der Revolte gegen Mubarak, eine Gruppe islamistischer Juristen Wind von einer Neuausgabe der Alf Lailah wa-Lailah (so der arabische Originaltitel) und initiierte eine Aktion mit der Forderung, die Ausgabe solle zurückgezogen und das Buch geächtet werden, denn es sei ein »Aufruf zum Laster und zur Sünde« und beinhalte mehrfache Erwähnungen von Sex. Zum Glück hatte sie keinen Erfolg, und kurz darauf waren die ägyptischen Köpfe mit größeren Problemen beschäftigt. Aber Fakt ist, die Juristen hatten recht. Tatsächlich wird in diesem Buch mehrfach Sex erwähnt, und die Charaktere scheinen viel mehr damit beschäftigt, Sex zu haben, als fromm zu sein, was tatsächlich, wie die Juristen anführten, ein Aufruf zum Laster sein könnte, wenn man die Welt auf diese verzerrt puritanische Weise sieht. Meiner Auffassung nach ist dieser Aufruf eine hervorragende Sache und wahrhaft wert, dass man ihm nachgeht, aber es zeigt sich, wie Menschen, die eine Abneigung gegen Musik, Scherze und Freuden hegen, sich darüber aufregen. Es ist wunderbar, dass dieser alte Text, diese wunderbare Sammlung von wundersamen Geschichten, noch immer die Macht in sich birgt, über zwölfhundert Jahre nachdem die Erzählungen zum ersten Mal in die Welt kamen, die Fanatiker der Welt aufzuregen.
Das Buch, das wir heute im Englischen für gewöhnlich Arabian Nights nennen, stammt übrigens gar nicht aus der arabischen Welt. Womöglich ist es indischen Ursprungs; auch Sammlungen indischer Erzählungen haben eine Vorliebe für Rahmengeschichten, für Geschichten innerhalb von Geschichten im Stil russischer Puppen und für Tierfabeln. Etwa im 8. Jahrhundert fanden diese Geschichten den Weg nach Persien, und laut erhaltener Informationsbruchstücke war die Sammlung als Hazar Afsaneh, »tausend Erzählungen«, bekannt. Es existiert ein Dokument aus dem 10. Jahrhundert aus Bagdad, das die Hazar Afsaneh beschreibt und ihre Rahmengeschichte über einen bösen König erwähnt, der jede Nacht eine Konkubine tötet, bis es einer dieser dem Untergang geweihten Frauen gelingt, ihre Hinrichtung dadurch abzuwenden, dass sie ihm Geschichten erzählt. An dieser Stelle begegnet uns zum ersten Mal der Name Scheherazade. Unglücklicherweise ist von den Hazar Afsaneh kein einziges Exemplar erhalten. Dieses Buch ist der bedeutende Missing Link der Weltliteratur, der legendenumwobene Band, durch den die indischen Wundergeschichten nach Westen reisten, um schließlich auf die arabische Sprache zu treffen und zu dem Buch derTausend Nächte und der einen Nacht zu werden, ein Buch mit vielen Fassungen und keiner einheitlichen kanonischen Form, und um weiter nach Westen vorzudringen, erst in das Französische, in der Version des 18. Jahrhunderts durch Antoine Galland, der eine Reihe von Erzählungen hinzufügte, die in der arabischen Fassung nicht vorhanden waren, so etwa die Geschichten »Aladin und die Wunderlampe« und »Ali Baba und die vierzig Räuber«. Und aus dem Französischen gelangten die Erzählungen ins Englische, und vom Englischen reisten sie nach Hollywood, was eine ganz eigene Sprache ist, und dann ist alles fliegender Teppich und Robin Williams ein Dschinn. (Im Übrigen ist es beachtenswert, dass in Tausendundeine Nacht keine fliegenden Teppiche vorkommen. Fliegende Teppiche gibt es woanders in der östlichen Tradition. Zum Beispiel besagt eine Legende, König Salomon habe einen besessen, der seine Ausmaße habe verändern können und groß genug gewesen sei, um eine ganze Armee zu befördern: die erste Luftwaffe der Welt. Aber in Tausendundeine Nacht bleiben alle Teppiche reglos und schlaff.)
Diese große Migration des Narrativs hat vielfach Weltliteratur inspiriert, bis hin zum magischen Realismus der südamerikanischen Fabulierer, sodass ich, als ich meinerseits einige dieser Einfälle verwendete, das Gefühl hatte, ich schlösse einen Kreis und brächte diese Erzähltradition den ganzen weiten Weg zurück nach Hause, in das Land, in dem sie ihren Anfang nahm. Doch ich trauere um den Verlust der HazarAfsaneh, die, würde man sie wiederentdecken, die Geschichte der Erzählungen vervollständigen würde, und welch ein Fund wäre das. Vielleicht würde er ein Geheimnis in der Mitte der Rahmengeschichte lösen oder eher ganz an ihrem Ende und eine Frage beantworten, die ich mir seit Jahren stelle: Wurden Scheherazade und ihre Schwester Dinharazade letztlich nach mehr als tausendundeins Nächten zu Mörderinnen und brachten ihre blutrünstigen Ehemänner um?
Ich gestehe, es war der blutige Aspekt der Rahmenhandlung, der mich anfangs zu Tausendundeine Nacht hinzog. Stellen wir eine kleine Rechnung auf.
Wie viele Frauen töteten sie eigentlich, dieser König, dieser Schahriyar, der Monarch der Sassaniden, auf »der Insel oder Halbinsel zwischen Indien und China«, und sein Bruder Schahsaman, souveräner Herrscher über das barbarische Samarkand? Es begann damit, oder so erzählt es die Geschichte, dass Schahsaman seine Frau in den Armen eines Palastkochs überraschte, dessen Haupteigenschaften waren, dass er a) schwarz, b) riesig und c) vor Küchenfett triefend war. Trotz oder vielleicht gar wegen dieser Eigenschaften beglückte er die Königin von Samarkand offensichtlich viel zu sehr, sodass Schahsaman sie und ihren Liebhaber in Stücke schlug, sie auf dem Bett ihrer Freuden zurückließ und sich zu seinem Bruder begab; wo er nur wenig später zufällig seine Schwägerin, Schahriyars Königin, in einem Garten bei einem Brunnen in Begleitung von zehn Hofdamen und zehn weißen Sklaven heimlich beobachtete. Die zehn und die zehn fielen freudig übereinander her; die Königin jedoch rief ihren eigenen Geliebten von dem Wipfel eines Baumes zu sich herab. Dieser abscheuliche Kerl war, ja!, a) schwarz, b) riesig und c) sabbernd. Welch einen Spaß sie hatten, die zehn und die zehn und die Königin und ihr »Mohr«! Ach, die Tücke und Niedertracht der Frauen und die unermessliche Anziehungskraft der riesigen, hässlichen, sabbernden schwarzen Männer! Schahsaman erzählte seinem Bruder, was er gesehen hatte; woraufhin die Hofdamen, die weißen Sklaven und die Königin das Schicksal ereilte, von Schahriyars Premierminister, seinem Wesir oder wazir, persönlich hingerichtet zu werden. Der sabbernde schwarze Liebhaber von Schahriyars toter Königin entkam, jedenfalls scheint es so; wie sonst ließe sich sein Fehlen auf der Totenliste erklären?
König Schahriyar und König Schahsaman nahmen gehörig Rache an den treulosen Frauen. Drei Jahre lang heirateten sie beide Nacht für Nacht eine neue Jungfrau, deflorierten sie und befahlen dann deren Hinrichtung. Es ist nicht klar, wie Schahsaman in Samarkand seinem blutrünstigen Geschäft nachging, aber über Schahriyars Methoden lässt sich einiges berichten. So ist zum Beispiel bekannt, dass dem Wesir – Scheherazades Vater, Schahriyars weisem Premierminister – die Pflicht auferlegt war, die Hinrichtungen eigenhändig auszuführen. All diese enthaupteten, wunderschönen, jungen Leiber; all diese fallenden Köpfe und blutspritzenden Hälse. Der Wesir war ein kultivierter Edelmann: nicht nur ein Mann mit Macht, sondern auch eine Person mit Urteilsvermögen, ja, sogar von zarter Empfindsamkeit – das muss er doch gewesen sein, um so eine vorbildliche, so eine wundersam begabte, vielfach vollkommene, heldenhaft mutige, selbstlose Tochter wie Scheherazade aufgezogen zu haben? Und auch Dinharazade, vergessen wir nicht die jüngere Schwester Dinharazade. Auch ein gutes, kluges, ehrbares Mädchen. Was machte es mit der Seele des Vaters so feiner Mädchen, wenn er gezwungen war, Hunderte junge Frauen hinzurichten, Mädchenkehlen aufzuschlitzen und deren Lebensblut fließen zu sehen? Welch geheime Wut mag in seiner edlen Brust aufgekeimt sein? Das sagt man uns nicht. Doch wir wissen, dass Schahriyars Untertanen ihrem König mächtig grollten und mit ihren Frauen aus seiner Hauptstadt flohen, sodass nach drei Jahren keine Jungfrauen mehr in der Stadt zu finden waren.
Keine Jungfrauen außer Scheherazade und Dinharazade.
Drei Jahre bereits: tausendfünfundneunzig Nächte, tausendfünfundneunzig tote Königinnen für Schahriyar, tausendfünfundneunzig weitere für Schahsaman oder tausendsechsundneunzig jeweils, sollte ein Schaltjahr darunter gewesen sein. Gehen wir auf Nummer sicher, einigen wir uns auf die niedrigere Zahl. Tausendfünfundneunzig jeder. Und vergessen wir nicht die anfänglichen dreiundzwanzig. Bis Scheherazade in der Geschichte auftaucht, den König Schahriyar heiratet und ihre Schwester Dinharazade auffordert, sich an das Hochzeitsbett zu setzen, und von ihr nach vollzogener Entjungferung gebeten wird, sie möge ihr eine Gutenachtgeschichte erzählen … bis dahin waren Schahriyar und Schahsaman bereits für zweitausendzweihundertdreizehn Tote verantwortlich. Nur elf dieser Toten waren Männer.
Als Schahriyar sich mit Scheherazade vermählte und von ihren Geschichten in Bann geschlagen war, hörte er auf, Frauen zu töten. Schahsaman, nicht von der Literatur gezähmt, führte sein rachsüchtiges Werk weiter und schlachtete jeden Morgen die Jungfrau, die er in der Nacht zuvor geschändet hatte, er zeigte damit dem weiblichen Geschlecht die Macht der Männer über die Frauen, die Fähigkeit der Männer, den Geschlechtsakt von der Liebe zu trennen, und die unausweichliche Verknüpfung, soweit es Frauen betraf, von Sexualität und Tod. In Samarkand setzte das Gemetzel sich mindestens weitere tausendundeins Nächte fort, denn erst am Schluss des gesamten Erzählzyklus von Scheherazade – als diese größte aller Geschichtenerzählerinnen flehte, verschont zu bleiben, nicht als Anerkennung für ihr Talent, sondern nur um der drei Söhne willen, die sie Schahriyar während der Erzähljahre geboren hatte, und als Schahriyar ihr seine Liebe gestand, ihr, der letzten seiner tausendachtundneunzig Frauen, und seine mörderische Absicht aufgab – endete auch Schahsamans Vorhaben; letztlich von der Mordlust geläutert, bat er um die Hand der süßen Dinharazade, sie willigte ein, und sie heirateten.
Die Gesamtzahl der Toten bis dahin beträgt meiner Rechnung nach mindestens dreitausendzweihundertundvierzehn. Nur elf der Toten waren Männer.
Betrachten wir Scheherazade, deren Name »die Stadtgeborene« bedeutet und die ohne Zweifel ein Großstadtmädchen war, klug, gewitzt, gelegentlich sentimental und zynisch, als eine zeitgenössische großstädtische Erzählerin, die kennenzulernen man sich nur wünschen konnte. Scheherazade, die den König mit ihrer unendlichen Geschichte umgarnte. Scheherazade, die Geschichten erzählte, um ihr Leben zu retten, die wortwörtlich gegen den Tod anfabulierte, eine Freiheitsstatue nicht aus Metall, sondern aus Worten. Scheherazade, die gegen den Willen ihres Vaters darauf beharrte, ihren Platz in der Prozession hinein in das tödliche Boudoir des Königs einzunehmen. Scheherazade, die sich selbst die heldenhafte Aufgabe stellte, den König zu zähmen und dadurch ihre Schwestern zu retten. Die Vertrauen hatte, die Vertrauen gehabt haben musste, in den Mann hinter dem mörderischen Ungeheuer und in ihre eigene Fähigkeit, ihm durch das Erzählen von Geschichten seine wahre Menschlichkeit zurückzugeben.
Welch eine Frau! Man versteht leicht, wie und warum König Schahriyar sich in sie verliebte. Denn gewiss verliebte er sich, als er der Vater ihrer Kinder wurde und im Laufe der Nächte verstand, dass seine Drohung, sie hinzurichten, hohl geworden war und dass er nicht mehr seinen Wesir, ihren Vater, bitten konnte, sie auszuführen. Seine Grausamkeit war durch den Genius der Frau besänftigt worden, die tausendundeins Nächte lang ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatte, um das Leben anderer zu retten, die darauf vertraute, dass ihre Fantasie der Brutalität standhalten und sie besiegen würde, nicht durch Gewalt, sondern erstaunlicherweise indem sie sie zivilisierte.
Glücklicher König! Aber warum (das ist die größte unbeantwortete Frage in Tausendundeine Nacht), warum um alles in der Welt verliebte sie sich in ihn? Und warum willigte Dinharazade, die jüngere Schwester, die tausendundeins Nächte am Fuße des Ehebetts saß, die zusah, wie ihre Schwester von dem mörderischen König beschlafen wurde, und ihren Geschichten lauschte – Dinharazade, die ewige Zuhörerin, aber auch Voyeurin –, warum willigte sie ein, Schahsaman zu heiraten, einen Mann, an dessen Händen noch mehr Blut klebte als an denen seines von den Geschichten bezauberten Bruders?
Wie können wir diese Frauen verstehen? Es steckt ein Schweigen in der Geschichte, das danach schreit, besprochen zu werden. So viel bekommen wir erzählt: Nach dem Ende der Geschichten wurden Schahsaman und Dinharazade verheiratet, aber Scheherazade stellte eine Bedingung: Schahsaman müsse sein Königreich verlassen und bei seinem Bruder leben, sodass die Schwestern nicht getrennt würden. Dies tat Schahsaman freudig, und Schahriyar ernannte ebenden Wesir, der nun auch sein Schwiegervater war, anstelle seines Bruders zum Herrscher über Samarkand. Als der Wesir in Samarkand eintraf, wurde er von den Stadtleuten freudig begrüßt, und all die örtlichen Granden beteten, er möge sie lange regieren. Was er tat.
Wenn ich die alte Geschichte betrachte, stellt sich mir folgende Frage: Gab es eine verschwörerische Vereinbarung zwischen Tochter und Vater? Hatten Scheherazade und der Wesir womöglich einen geheimen Plan ausgeheckt? Denn dank Scheherazades Strategie war Schahsaman nicht mehr länger König von Samarkand. Dank Scheherazades Strategie war ihr Vater nicht mehr Höfling und Scharfrichter wider Willen, sondern ein eigenständiger König, ein viel geliebter König, und was noch wichtiger war, ein weiser Mann, ein Mann des Friedens, der einem blutrünstigen Scheusal auf dem Thron nachfolgte. Und dann ohne Erklärung kam der Tod, für Schahriyar und Schahsaman zur selben Zeit. Der Tod, der »Zerstörer der Freuden und der Vernichter jeglicher Gemeinschaft, der Verwüster von Wohnungen und der Sammler von Friedhöfen«, kam zu ihnen, und ihre Paläste lagen in Trümmern, und sie wurden von einem weisen Herrscher abgelöst, dessen Namen man uns nicht nennt.
Aber wie und warum kam der Zerstörer der Freuden? Wie geschah es, dass beide Brüder gleichzeitig starben, wie der Text es eindeutig besagt, und warum lagen danach ihre Paläste in Trümmern? Und wer war ihr Nachfolger, der Unbenannte und Weise?
Wir bekommen es nicht erzählt. Aber stellen wir uns noch einmal den zornerfüllten Wesir vor, der jahrelang gezwungen war, all dieses unschuldige Blut zu vergießen. Stellen wir uns die jahrelange Furcht des Wesirs vor, die tausendundeins Nächte der Furcht, während seine Töchter, Fleisch von seinem Fleisch, Blut von seinem Blut, in Schahriyars Schlafzimmer gesperrt sind und ihr Schicksal am Faden einer Geschichte hängt.
Wie lange wartet ein Mann auf seine Rache? Wartet er länger als tausendundeine Nacht?
Hier meine Theorie: Der Wesir, nun Herrscher über Samarkand, war der weise König, der zurückkehrte, um Schahriyars Königreich zu regieren. Und die Könige starben zur selben Zeit entweder durch die Hand ihrer Ehefrauen oder durch die des Wesirs. Es ist nur eine Theorie. Vielleicht liegt die Antwort in dem großen verloren gegangenen Buch. Vielleicht auch nicht. Wir können uns nur … verwundert fragen.
Jedenfalls belief sich am Ende die Gesamtzahl der Toten auf dreitausendzweihundertundsechzehn.
Dreizehn Tote waren Männer.
Als ich meine Autobiografie Joseph Anton abgeschlossen hatte, verspürte ich einen großen Hunger nach Fiktion. Und nicht nach irgendeiner alten Fiktion, sondern nach einer Fiktion, die so wild fantastisch sein sollte, wie die Autobiografie entschieden realistisch war. Meine Stimmung schwang von einem Ende des literarischen Pendels zum anderen Extrem. Und ich erinnerte mich wieder an die Geschichten, die ursprünglich dazu geführt hatten, dass ich mich in die Literatur verliebte, Geschichten voll schöner Unmöglichkeit, die nicht wahr waren, aber durch ihre Nichtwahrheit die Wahrheit erzählten, oft schöner und eindrücklicher als Geschichten, die sich auf die Wahrheit beriefen. Auch diese Geschichten mussten nicht unbedingt irgendwann einmal geschehen sein. Sie konnten genau jetzt geschehen. Gestern, heute oder übermorgen.
Eine dieser wundersamen Geschichten gehört zu der Sanskrit-Sammlung aus Kaschmir, dem Kathāsaritsāgara oder dem »Ozean der Geschichtenströme«, dessen Titel mich zu meinem Kinderbuch Harun und das Meer der Geschichten inspirierte. Ich gestehe, ich habe diese Geschichte gestohlen und sie in einem Roman verwendet. Sie geht in etwa so:
»Es war einmal in fernen Zeiten ein Kaufmann, der einem Edelmann des Ortes Geld geliehen hatte, eine wirklich ungeheure Menge Geld, und dann starb der Edelmann ganz überraschend, und der Kaufmann dachte, das ist schlecht, ich bekomme mein Geld nicht zurück. Aber ein Gott hatte ihm die Gabe der Seelenwanderung geschenkt, das war in einem Teil der Welt, wo es viele Götter gab, nicht nur einen, darum kam der Kaufmann auf die Idee, seine Seele in den Leib des toten Edelmanns wandern zu lassen, damit der Tote von seinem Totenbett aufstehen und ihm seine Schulden zurückzahlen könne. Der Kaufmann ließ seinen Leib an einem sicheren Ort zurück, so dachte er zumindest, und seine Seele hüpfte in die Haut des Toten, doch als er im Leib des toten Mannes zur Bank ging, musste er den Fischmarkt überqueren, und ein großer toter Dorsch, der auf einer Platte lag, sah ihn vorbeigehen und fing an zu lachen. Als die Leute den toten Fisch lachen hörten, wussten sie, dass an dem vorübergehenden toten Mann etwas faul war, und griffen ihn an, weil sie meinten, er sei von einem Dämon besessen. Rasch war der Leib des toten Edelmanns nicht mehr bewohnbar, und die Seele des Kaufmanns musste ihn aufgeben und zu seiner eigenen verlassenen Hülle zurückkehren. Doch andere Leute hatten den verlassenen Leib des Kaufmanns entdeckt, und da sie ihn für den Leib eines Toten gehalten hatten, hatten sie ihn in Brand gesetzt, wie es in diesem Teil der Welt dem Brauch entsprach. So hatte der Kaufmann keinen Leib mehr, und die Schulden waren ihm auch nicht zurückbezahlt worden, und seine Seele wandert womöglich noch immer auf dem Markt umher. Oder er war am Ende vielleicht in einen toten Fisch geschlüpft und in das Meer der Geschichtenströme getaucht. Und die Moral von der Geschichte ist, fordere dein verdammtes Glück nicht heraus.«
Tierfabeln – darunter Fabeln von sprechenden toten Fischen – gehören zu den beständigsten Geschichten des östlichen Kanons, und die besten von ihnen, ganz anders als etwa die von Äsop, sind unmoralisch. Sie zielen nicht darauf ab, zu Demut, Bescheidenheit, Mäßigung, Ehrlichkeit oder Entsagung zu mahnen. Sie garantieren nicht den Triumph der Tugend. Darum wirken sie bemerkenswert modern. Die Bösen gewinnen manchmal.
Die Sammlung, die in Indien als das Panchatantra bekannt ist, schildert zwei sprechende Schakale: Karataka, den Guten oder den Besseren der beiden, und Damanaka, den bösen Intriganten. Zu Anfang des Buchs stehen sie im Dienst des Löwenkönigs, doch Damanaka missfällt die Freundschaft des Löwen mit einem anderen Höfling, einem Stier, und er überzeugt den Löwen mit einer List davon, der Stier sei sein Feind, und bringt ihn dazu, das unschuldige Tier zu töten, und die Schakale sehen zu.
Ende.
In den Erzählungen von Karataka und Damanaka lesen wir auch von einem Krieg zwischen Krähen und Eulen, in dem eine Krähe vortäuscht, sie sei eine Verräterin, und sich den Eulen anschließt, um die Höhle ausfindig zu machen, in der sie leben. Dann entzünden die Krähen an allen Eingängen der Höhle Feuer, und alle Eulen ersticken.
Ende.
In einer dritten Geschichte lässt ein Mann sein Kind in der Obhut seines Freundes, eines Mungos, und als er heimkehrt, sieht er das blutverschmierte Maul des Mungos und tötet ihn, da er glaubt, er habe sein Kind angegriffen. Dann entdeckt er, dass der Mungo eine Schlange getötet und sein Kind gerettet hat. Doch unglücklicherweise ist der Mungo jetzt tot.
Ende.
Viele von Äsops kleinen Fabeln, sei es über den Sieg beharrlicher Langsamkeit (die Schildkröte) über hochmütige Schnelligkeit (der Hase) oder über die Torheit, »Wolf« zu schreien, wenn doch gar kein Wolf da ist, oder über das Töten der Gans, die goldene Eier legte, wirken ohne jeden Zweifel rührselig, wenn man sie mit dieser Quentin-Tarantino-Grausamkeit vergleicht. So viel zum Klischee des friedlichen mystischen Orients.
Da ich selbst Migrant bin, hat mich schon immer die Migration von Geschichten fasziniert, und die Schakalgeschichten reisten fast genauso weit wie die Narrative von Tausendundeine Nacht, sodass es zu arabischen und persischen Versionen kam, in denen die Namen der Schakale sich in Kalila und Dimna verwandelten. Sie fanden den Weg auch ins Hebräische und Lateinische und schließlich als The Fables of Bidpai ins Englische und Französische. Doch im Gegensatz zu den Geschichten von Tausendundeine Nacht sind sie aus dem Bewusstsein des modernen Lesers verschwunden, vielleicht weil ihr unzureichendes Augenmerk aufs Happy End sie für die Walt Disney Company unattraktiv machte.
Und doch hat ihre Kraft Bestand; meines Erachtens deshalb, weil diese Geschichten mit all ihren Ungeheuern und ihrer Magie ganz und gar wahrheitsgetreu die Natur des Menschen abbilden (und sei es in der Form vermenschlichter Tiergestalten). Das ganze menschliche Leben findet sich hier, tapfer und feige, ehrenhaft und unehrenhaft, geradlinig oder hinterhältig, und die Geschichten stellen die bedeutendste und beständigste Frage der Literatur: Wie reagieren normale Leute, wenn das Außergewöhnliche in ihr Leben tritt? Und sie antworten: Manchmal verhalten wir uns nicht so gut, aber ein anderes Mal finden wir Kräfte in uns, von denen wir nicht einmal ahnten, dass wir sie besitzen, und so wachsen wir mit der Herausforderung, wir besiegen das Ungeheuer, Beowulf tötet Grendel und auch Grendels noch furchterregendere Mutter, Rotkäppchen tötet den Wolf, oder die Schöne findet die Liebe bei dem Biest, und dann ist das Biest kein Biest mehr. Und das ist gewöhnliche Magie, menschliche Magie, das wahre Wunder der wundersamen Geschichten.
Ich versuche, Argumente aufzuführen für etwas, das heute ziemlich altmodisch ist. Laut allgemeinem Konsens leben wir in einem Zeitalter der Non-Fiction. Jeder Verleger, jeder Buchverkäufer wird das bestätigen. Und außerdem scheint sich die Fiktion von der Fiktion abgewendet zu haben. Ich spreche jetzt von ernsthafter Fiktion, nicht von der anderen. In der anderen Fiktion ist die Fiktivität lebendig und wohlauf, es herrscht immer Twilight, Leute spielen Hunger Games (Die Tribute von Panem), und Leonardo da Vinci ist lediglich ein Code. Die ernsthafte Fiktion hat sich dem Realismus in der Art von Elena Ferrante und Knausgård zugewandt, Fiktion, die uns auffordert zu glauben, sie stamme von einem Ort, der der persönlichen Erfahrung des Autors sehr nahe liegt, wenn er nicht gar mit ihr identisch ist, und sei von Magie gleichsam weit entfernt. Vor vielen Jahren erklärte der große tschechische Schriftsteller Milan Kundera in einem berühmten Essay, der Roman habe zwei Eltern, Tristram Shandy und Clarissa Harlowe. Von Samuel Richardsons Clarissa leite sich die große Tradition des realistischen Romans ab, während aus Sternes Leben undAnsichten von TristramShandy, Gentleman, nur ein kleineres Rinnsal, nun ja, eigenartiger Bücher tröpfele. Es seien Clarissas Kinder, die die literarische Welt erfüllt hätten, sagte Kundera, und doch bleibe seiner Meinung nach auf der Shandy-Seite – auf der grotesken, spielerischen, komischen, exzentrischen Seite – die neueste, originellste Arbeit zu tun. (Ernest Hemingway wählte bekanntlich einen anderen literarischen Vorläufer. »Die gesamte moderne amerikanische Literatur stammt von einem Buch von Mark Twain ab, das Huckleberry Finn heißt.« Das ist ein freieres und mythischeres Werk als Clarissa, aber es ist auch ein weitgehend realistischer Roman. Es muss außerdem gesagt werden, dass Kundera mit seiner Wahl des Tristram Shandy das Werk ignoriert, in dessen tiefer Schuld es steht: Cervantes’ Don Quijote. Sternes Onkel Toby und Corporal Trim sind ganz eindeutig Quijote und Sancho nachempfunden.)
Kundera wies darauf hin, dass die Möglichkeiten des realistischen Romans von so vielen Autoren so gründlich erkundet seien, dass nur noch sehr wenig Neues zu entdecken bleibe. Sollte er recht haben, ist die Tradition des Realismus zu einer Art endloser Wiederholung verurteilt. Für Innovation, für Neuheit – und denken wir daran, dass das Wort novel die Idee von Neuheit beinhaltet – müssen wir uns dem Irrealismus zuwenden und neue Wege entdecken, uns der Wahrheit durch Lügen anzunähern. Die wundersamen Geschichten meiner Kindheit lehrten mich nicht nur, dass solche Herangehensweisen möglich sind, sondern auch, dass sie mannigfaltige, nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten bieten und Spaß bedeuten. Wie gesagt, die Lieferanten von Schundfiktion in Büchern und ebenso in Filmen haben die Macht des Fantastischen verstanden, aber alles, was sie zu liefern imstande sind, ist das Fantastische reduziert auf die Zweidimensionalität des Comicstrips. Für mich ist das Fantastische stets ein Weg gewesen, um dem Realen weitere Dimensionen hinzuzufügen, eine vierte, fünfte, sechste und siebte Dimension zu den üblichen drei; ein Weg, unsere Erfahrung des Realen zu bereichern und zu intensivieren, statt ihm in einem Fantasieland der Superhelden und Vampire zu entfliehen.
Die Schriftsteller des Westens, die ich am meisten bewundere, Schriftsteller wie Italo Calvino und Günter Grass, Michail Bulgakow und Isaac Bashevis Singer, haben alle in reichem Maße in ihrer jeweiligen Tradition der wundersamen Geschichten geschwelgt und Möglichkeiten gefunden, dem Realen das Fabelhafte zu injizieren, um es lebendiger und sonderbarerweise auch wahrhaftiger zu machen. Grass’ Vereinnahmung von Tierfabeln, sein umfangreicher Gebrauch von sprechenden Butten, Ratten und Kröten entwächst seiner tiefen Beschäftigung mit den deutschen wundersamen Geschichten, wie sie die Brüder Grimm sammelten. Calvino sammelte selbst italienische Wundergeschichten, und vielleicht erfand er sie auch zum Teil für seinen Klassiker Italienische Märchen, und sein ganzes Werk war getränkt mit der Sprache der italienischen Fabel. In Bulgakows unsterblicher Geschichte des Teufels, der nach Moskau kommt, Meister undMargarita, und in Isaac Singers köstlichen jiddischen Geschichten mit ihren Golems und Dibbuks, ihren Besessenheiten und Beklemmungen, erkennen wir wie in der Kunst Chagalls eine tiefe Faszination für die wundersamen Geschichten der russischen, jüdischen und slawischen Welt und wie sehr sie Quelle der Inspiration waren. Viele der größten Werke der etwa letzten hundert Jahre, von Hans Christian Andersens Märchen über das Werk von Ursula K. Le Guin bis hin zu Franz Kafkas tiefschwarzen Albträumen, rühren von dieser Verschmelzung des Realen mit dem Surrealen, der natürlichen mit den übernatürlichen Welten.
Viele junge Autoren heute, die zu schreiben beginnen, haben offenbar das Mantra »Schreibe über das, was du kennst« an der Wand hinter ihremSchreibtisch hängen, und wie jeder bezeugen kann, der Kurse in creative writing belegt hat, resultiert daraus eine Menge Stoff über die Angst vorstädtischer Jugendlicher. Mein Rat wäre ein etwas anderer. Schreibe nur über das, was du kennst, wenn du überzeugt bist, es sei wirklich interessant. Wenn du in einer Nachbarschaft lebst, die der von Harper Lee oder William Faulkner ähnelt, dann fühle dich absolut frei, die hitzigen Geschichten deines eigenen Yoknapatawpha zu erzählen, und womöglich stellst du fest, es sei völlig überflüssig, von zu Hause wegzugehen. Aber wenn das, was du kennst, nicht wirklich interessant ist, schreibe nicht darüber. Schreibe über das, was du nicht kennst. Das kann auf zwei Arten geschehen. Die eine Art ist, das Zuhause zu verlassen und dich woanders auf die Suche nach einer guten Geschichte zu begeben. Melville und Conrad fanden ihre Geschichten am Meer und in fernen Ländern, und auch Hemingway und Fitzgerald mussten von zu Hause aufbrechen, um ihre Stimmen in Spanien, an der Riviera oder am East und West Egg zu finden. Die andere Lösung besteht darin, dich zu erinnern, dass Fiktion fiktional ist, und in dem Versuch, dir etwas auszudenken. Wir alle sind träumende Wesen. Träume auf Papier. Und wenn es sich als etwas wie Twilight oder die Hunger Games herausstellt, zerreiße es und versuche, einen besseren Traum zu träumen.
Madame Bovary und der fliegende Teppich sind beide unwahr, und hinzu kommt, dass sie auf die gleiche Weise unwahr sind. Jemand hat sie sich ausgedacht. Ich bin sehr dafür, sich weiterhin Dinge auszudenken. Nur wenn wir der Fiktionalität der Fiktion freien Lauf lassen, der Vorstellungskraft der Fantasie, dem Traumlied unserer Träume, können wir darauf hoffen, uns dem Neuen anzunähern und eine Fiktion zu schaffen, die – noch einmal – interessanter sein mag als Fakten.
II
In dem Roman, den ich für meinen damals zehnjährigen Sohn schrieb, Harun und das Meer der Geschichten, raunzt ein gelangweilter Zehnjähriger seinen geschichtenerzählenden Vater an: »Wozu sind Geschichten gut, die nicht einmal wahr sind?« Das daraus folgende Buch war ein Versuch, diese Frage zu beantworten und herauszufinden, warum wir solche Geschichten brauchen und wie sie uns ansprechen, auch wenn wir wissen, dass sie erfunden sind. Das ist ein Thema, über das ich wohl fast mein ganzes schriftstellerisches Leben nachgedacht habe: das Verhältnis zwischen der Welt der Fantasie und der sogenannten wirklichen Welt und wie wir uns zwischen den beiden hin- und herbewegen. Fünf Jahre vor Harun schrieb ich über N. F. Simpsons Theaterstück One Way Pendulum (Die Welt der Groomkirbys), einen der raren kompetenten britischen Beiträge zum absurden Theater. In diesem Stück erhält ein Mann per Paketpost den 1:1-Modellbausatz eines Gerichtssaals im Central Criminal Court in London, bekannt als Old Bailey; er baut ihn in seinem Wohnzimmer auf, und schon kurz darauf findet er sich darin in einem Prozess wieder. Ein Gerichtsschreiber legt dar, der Beklagte, unser Held, sei an einem bestimmten Tag »nicht in seiner Welt« gewesen. »In welcher Welt war er denn?«, fragt der Richter, und die Antwort lautet: »Es scheint, er hat eine eigene.«
(Im Übrigen: Wer Harun und das Meer der Geschichten nicht gelesen hat, wird zweifellos beeindruckt sein zu erfahren, dass dieser Roman in der TV-Serie Lost vorkam, wo er die Rolle des Buchs spielte, das von der Figur Desmond auf dem Oceanic-Flug 815 auf der Flash-Sideways-Zeitachse gelesen wird. Ich hoffe sehr, dass einige Leser verstehen, was dieser Satz bedeutet, denn ich tue es nicht. »Wozu sind Geschichten gut, die nicht einmal wahr sind?«, ist eine Frage, die sicherlich den Ausgangspunkt eines interessanten Vortrags über Lost bilden könnte.)
Selbst wenn wir nicht gänzlich in unserer Fantasie leben, gehen wir gerne in ihr auf Reisen. In Jean-Luc Godards Film Alphaville reist der Held, der Privatdetektiv Lemmy Caution, in seinem Ford Galaxy durch den interstellaren Raum. Dorothy Gale gelangt, davongetragen von einem Wirbelwind, nach Oz. Wie und warum machen wir anderen die Reise?
Wenn wir zur Welt kommen, brauchen wir Nahrung, Schutz, Liebe, Gesang und Geschichten. Unser Bedürfnis nach den letzten beiden ist nicht geringer als nach den ersten drei. Einer meiner Freunde, der Recherchen über die grauenhafte Behandlung von Waisenkindern in Ceaușescus Rumänien anstellte, hat herausgefunden, dass diese Kinder, denen man Nahrung und ein Dach bot, die auf das Übrige aber verzichten mussten, sich nicht normal entwickelten. Ihr Gehirn bildete sich nicht richtig aus. Vielleicht besitzen wir, die wir Sprachwesen sind, einen Instinkt für Gesang und Geschichten; wir brauchen Geschichten und Lieder und streben nach ihnen, nicht weil man es uns beigebracht hätte, sondern weil es in unserer Natur so angelegt ist. Und während es andere Wesen auf der Erde gibt, die man als singend beschreiben könnte – ich denke an das Trillern der Singvögel, das Heulen der Wölfe, den langen, langsamen Gesang der Wale in den Tiefen des Meeres –, erzählt nichts, das schwimmt, krabbelt, läuft oder fliegt, Geschichten. Einzig der Mensch ist ein geschichtenerzählendes Wesen.
Gesang ist die menschliche Stimme, die man auf unnatürliche Art nutzt – eine Nutzung, die nicht allen menschlichen Wesen, mich inbegriffen, gegeben ist –, um die Sorte von Empfindung zu wecken, die uns Schönheit einflößt. Die Geschichte ist das unnatürliche Mittel, das wir nutzen, um über menschliches Leben zu sprechen, unser Weg, durch Erfundenes zur Wahrheit zu gelangen. Und wir sind die einzige Spezies, die seit Anbeginn mit Geschichten versucht hat, sich selbst zu erklären. In Platons Höhle erzählten Menschen Geschichten über die Schatten an der Höhlenwand, um die äußere Welt zu erahnen. Da sie nicht fähig waren, ihren Ursprung zu verstehen, erzählten Menschen einander Geschichten über Himmelsgötter und Sonnengötter, über Ahnengötter und Erlösergötter, über unsichtbare Väter und Mütter, Geschichten, die eine Antwort auf die bedeutende Frage unseres Ursprungs gaben und Richtlinien boten für die ebenso bedeutende Frage der Moral. In Mythen und Legenden schufen wir unsere ältesten Wunderländer, Asgard und Walhall, den Olymp und den Berg Kailash, und verankerten darin unsere tiefsten Gedanken über unsere eigene Natur und ebenso unsere Zweifel und Ängste.
Harun und das Meer der Geschichten ist eine Fabel über Sprache und Schweigen, über Geschichten und Antigeschichten, die ich zum Teil geschrieben habe, um meinem kleinen Sohn den Kampf zu erklären, der damals um seinen Vater wegen eines anderen Romans, der Satanischen Verse, toste. Zwanzig Jahre nach Harun fragte mich ein anderer Sohn: »Und wo ist mein Buch?« Auf diese Frage gibt es zwei mögliche Antworten. Die erste Antwort lautet: »Kind, das Leben ist nicht gerecht.« Das ist keine nette Antwort, stimmt. Die andere Antwort ist, das Buch zu schreiben; ich schrieb also Luka und das Lebensfeuer und streifte wieder einmal ausgiebig durch Wunderländer, durch die imaginierten Welten, in denen wir als Kinder und auch als Erwachsene gerne leben.
Als ich zwanzig Jahre nach Harun begann, an Luka zu arbeiten, dachte ich viel über Lewis Carroll nach, den Reverend Charles Lutwidge Dodgson, den Schöpfer des Wunderlands, und das lernte ich von ihm: Das Beste an seinem zweiten Alice-Buch, Alice hinter den Spiegeln, ist, dass es nicht die »Rückkehr ins Wunderland« ist. Sechs Jahre nach der Veröffentlichung von Alice im Wunderland stellte er sich der beachtlichen kreativen Herausforderung, eine vollkommen andere Fantasiewelt mit einer ihr eigenen inneren Logik zu erschaffen.
Geh nicht dahin zurück, wo du bereits gewesen bist. Finde einen Grund, woandershin zu gehen.
Ich beschloss, mich der gleichen Herausforderung zu stellen. Unter kommerziellen Aspekten mag das nicht der klügste Schritt gewesen sein. Schon mein damals zwölfjähriger Sohn Milan gab mir den Rat: »Schreib keine Bücher, Dad. Schreib Serien.« Im Zeitalter von Harry Potter und Twilight hat er ganz eindeutig recht.
Noch einige Worte zu Alice hinter den Spiegeln. Als es erschien, war das erste Alice-Buch bereits ungeheuer populär, somit war die Gefahr, eine Fortsetzung zu veröffentlichen, die die Bewunderer des früheren Werks enttäuschte, sehr groß; und auch Alice selbst, Alice Pleasance Liddell, war herangewachsen und nicht mehr dieses Kind, das am 4. Juli 1862 auf einem Bootsausflug mit seinen beiden Schwestern und dem Reverend Dodgson den Wunsch nach einer Geschichte geäußert hatte und dem man das Märchen von Alice’ Abenteuern unter der Erde erzählt hatte, die Geschichte, die drei Jahre später in deutlich erweiterter Form als das Buch erschien, das wir heute als Alice imWunderland kennen. Viele der größten Werke der Kinderliteratur wurden im Hinblick auf bestimmte Kinder geschrieben: J. M. Barrie schrieb Peter Pan, um den Llewellyn-Davies-Jungen eine Freude zu machen, A. A. Milne schrieb Pu der Bär über das Lieblingsspielzeug seines Sohns Christopher Robin Milne, und Lewis Carroll schrieb Alice für Alice. Doch zu Zeiten von Alicehinter den Spiegeln musste er für die Alice in seiner Erinnerung schreiben, für dieses fordernde kleine Mädchen, das offenbar immerzu Leute ausschimpft, das sich der Regeln des Lebens und des richtigen Benehmens stets sicher ist, selbst in einer Welt, deren Regeln sie nicht kennen kann.
Die Alice, die er für sich erschaffen hatte, erfüllte jedenfalls noch immer seine Träume: »Sie sucht mich oft auch jetzt noch heim«, schrieb er, »Alice, die unterm Himmel geht,/Nie mehr gesehn, im Traum nur mein.«
Meine Aufgabe, als ich Luka und das Lebensfeuer schrieb, war einfacher. Ich hatte ein neues Kind, für das ich schreiben wollte und das mich leitete. Und ich hatte das Glück, ich habe das Glück, dass ich durchtränkt von der Tradition der wundersamen Geschichten aufgewachsen bin, darunter die Heldenmythen des Kriegers Hamza und des Abenteurers Hatim al-Tai, der Wanderer, die Feen heirateten, Goblins bekämpften, Drachen erschlugen und manches Mal Feinden gegenüberstanden, die auf riesigen verzauberten Amphoren durch die Luft flogen. Von frühester Kindheit an war ich – und bin es noch – ein Reisender in Wunderländern.
Ist die Tradition des Realismus die dominierende gewesen, so lohnt es sich dennoch, für einige Momente die Alternative, die andere große Tradition zu verteidigen. Es lohnt sich zu sagen, Fantasie ist keine Grille. Das Fantastische ist weder unschuldig noch eskapistisch. Das Wunderland ist kein Zufluchtsort, nicht einmal notwendigerweise ein ansprechender oder angenehmer Ort. Es kann, tatsächlich ist es das für gewöhnlich, ein Ort des Schlachtens, der Ausbeutung, der Grausamkeit und der Angst sein. Kafkas »Verwandlung« ist eine Tragödie. Captain Hook will Peter Pan töten. Die Hexe im tiefen Wald will Hänsel und Gretel braten. Der Wolf frisst tatsächlich Rotkäppchens Großmutter. Albus Dumbledore wird ermordet, und der Herr der Ringe plant die Versklavung der ganzen Mittelerde. Der fliegende Teppich des Königs Salomon, der laut der Geschichten sechzig Meilen lang und sechzig Meilen breit war, strafte einst den großen König für seinen sündigen Stolz, indem er sich schüttelte, woraufhin die vierzigtausend Menschen, die auf ihm saßen, in den Tod stürzten. (Nicht zum ersten Mal litten normale Menschen für die Sünden ihrer Herrscher. Das Wunderland kann ein ebenso fehlerbehafteter Ort sein wie die Erde.)
Wenn wir diese Märchen hören, wissen wir, dass sie, obwohl sie »nicht real« sind – Teppiche fliegen nicht, und es leben keine Hexen in Lebkuchenhäusern –, auch »real« sind, da sie von realen Dingen handeln, von Liebe, Hass, Angst, Macht, Tapferkeit, Feigheit, Tod. Sie nehmen ganz einfach einen anderen Weg, um zum Realen zu gelangen. Sie sind so, obwohl wir wissen, dass sie nicht so sind.
Vor der modernen Literatur des Fantastischen, vor dem Wunderland, den Märchen und Sagen, gab es die Mythologie. In den Frühzeiten waren die Mythen religiöse Texte. Die griechischen Mythen waren ursprünglich die griechische Religion.
Doch erst als die Menschen aufhörten, an die wortwörtliche Wahrheit dieser Mythen zu glauben, erst als sie nicht mehr an einen tatsächlichen Zeus glaubten, der tatsächliche Blitze schleudert, wurden sie, wurden wir, fähig, auf die gleiche Art an diese Mythen zu glauben, wie wir an Literatur glauben – das heißt tiefgründiger, wissend um den Zwiespalt von Glaube/Unglaube, mit dem wir uns der Fiktion nähern, »es ist so und es ist nicht so«. Und mit einem Mal begannen sie, ihre tiefsten Überzeugungen aufzugeben, Überzeugungen, die zuvor vom Glauben verdeckt waren.
Die großen Mythen, die griechischen, römischen, nordischen, haben den Tod der Religionen, die sie einst trugen, wegen der erstaunlichen Verdichtung ihrer Bedeutung überdauert. Als ich meinen Roman Der Boden unter ihren Füßen schrieb, fesselte mich der Mythos des Orpheus, des größten Dichters, der auch der größte Sänger war, der Gestalt, in der Gesang und Geschichte eins wurden. Der Mythos des Orpheus lässt sich in hundert Worten oder weniger nacherzählen: Seine Liebe zu der Nymphe Eurydike, ihre Verfolgung durch den Imker Aristaios, der Schlangenbiss, durch den sie starb, ihr Abstieg in die Unterwelt, sein Ihr-Nachfolgen bis hinter die Tore des Totenreichs, sein Versuch, sie zu retten, die Erlaubnis des Herrn der Unterwelt, dies zu tun – als Belohnung für seine Begabung als Sänger –, die Möglichkeit, sie zurück ins Leben zu führen, solange er sich nicht umschaut, und sein fataler Blick zurück. Und doch, wenn man beginnt, sich in die Geschichte zu vertiefen, scheint sie nahezu unerschöpflich reich, denn in ihrem Kern schildert sie eine große Spannung zwischen dem Dreigestirn der bedeutendsten Dinge des Lebens: Liebe, Kunst und Tod. Dreht und wendet man die Geschichte, erzählt einem das Dreieck Verschiedenes. Es erzählt, dass die Kunst, die durch die Liebe inspiriert ist, eine größere Macht haben kann als der Tod. Es erzählt andererseits, dass der Tod trotz der Kunst die Macht der Liebe besiegen kann. Und es erzählt, dass einzig die Kunst die Transaktion zwischen Liebe und Tod, die im Mittelpunkt allen menschlichen Lebens steht, ermöglichen kann.
Es gibt eine Geschichte, die in verschiedenen Mythologien auftaucht: die Geschichte des Augenblicks, in dem die Menschen lernen müssen, ohne ihre Götter zurechtzukommen. In Roberto Calassos großer Studie über die griechischen und römischen Mythen, Die Hochzeit von Kadmos und Harmonia, sagt er uns, dass bei diesem Ereignis, den Hochzeitsfeierlichkeiten des Kadmos, des Erfinders des Alphabets, mit der Nymphe Harmonia, die Götter zum letzten Mal vom Olymp herabstiegen, um am menschlichen Leben teilzuhaben. Danach waren wir auf uns allein gestellt. In den nordischen Mythen kämpfen die Götter, wenn der Weltenbaum, die große Esche Yggdrasil, fällt, gegen ihre versammelten Feinde, sie zerstören sie und werden von ihnen zerstört, und danach sind sie tot. Der Tod der Götter erfordert, dass Helden, Menschen, vortreten, um ihre Stelle einzunehmen. Hier im Altgriechischen und im Altnordischen treffen wir auf unsere ältesten Fabeln über das Aufwachsen, über das Begreifen, dass eine Zeit kommen muss, in der unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Wächter uns nicht mehr länger leiten und schützen. Es gibt einen Zeitpunkt, das Wunderland zu verlassen und erwachsen zu werden.
Die Kinder des Tristram Shandy, um Kunderas Begriff aufzugreifen – oder die Kinder des Quijote oder der Scheherazade – mögen vielleicht nicht so reichlich vorhanden sein wie die der Clarissa Harlowe, aber man findet sie in jeder Literatur, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Von dem verhexten Moskau in Bulgakows Meister und Margarita bis zu den von Dibbuks drangsalierten Dörfern des Isaac Bashevis Singer; von den französischen Surrealisten bis zu den amerikanischen Fabulierern; von Jonathan Swift bis zu Carmen Maria Machado, Karen Russell und Helen Oyeyemi, sie sind überall und bilden eine alternative, beschwingte, karnevaleske »große Tradition«, die man neben die realistische stellen kann. Die bekanntesten dieser Schriftsteller in der jüngsten Literaturgeschichte waren die südamerikanischen Autoren des sogenannten magischen Realismus. Der Begriff »magischer Realismus« ist nützlich, nimmt man ihn her, um die Autoren des Lateinamerika-Booms zu beschreiben: Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Manuel Puig, Carlos Fuentes, Isabel Allende und selbstverständlich García Márquez sowie vielleicht ihre Vorläufer Juan Rulfo, Jorge Luis Borges und Machado de Assis. Aber der Begriff ist problematisch, weil ihn die meisten Leute mit dem Genre der Fantasy-Fiction gleichsetzen. Und wie ich versucht habe aufzuzeigen, ist die Literatur des Fantastischen nicht Genre-Fiktion, sondern auf ihre eigene Art so realistisch wie die naturalistische Fiktion; sie betritt das Reale nur durch eine andere Tür. Ein naturalistischer Roman kann vollkommen eskapistisch sein: Lesen Sie ein bisschen »Chick-Lit« und Sie verstehen, was ich meine.
Zur Wahrheit gelangt man nicht durch rein mimetische Mittel. Ein Bild kann mit einer Kamera eingefangen werden oder mit dem Pinsel. Ein Gemälde einer Sternennacht ist nicht weniger wahrheitsgetreu als eine Fotografie; unter Umständen ist es, wenn der Maler van Gogh heißt, weit wahrheitsgetreuer, wenn auch weit weniger »realistisch«. (Ich sage van Gogh, die Englischsprechenden sagen van-Go, als wäre er ein Konkurrent des Umzugsunternehmens U-Haul, aber die Holländer, das sollten Sie wissen, sprechen ihn van Ghogh aus, was sich so anhört, als spucke ein Mann in hohem Bogen Betelsaft in einen Bombayer Rinnstein. Üben Sie das.) Die Literatur des Fantastischen – die wundersame Geschichte, die Fabel, die Sage, der magisch realistische Roman – hat stets tiefe Wahrheiten über die Menschen dargestellt, ihre edelsten Eigenschaften und auch ihre tiefsten Vorurteile: über, um nur ein Beispiel zu nennen, Frauen.
Manche der brillantesten Autoren und Kritiker der modernen Wundergeschichten wie die Romanautorin und Geschichtenschreiberin Angela Carter und die britische Kritikerin und Romanautorin Marina Warner haben wortgewandt die Stellung von Frauen im Wunderland erforscht, wo sie Gefäße höchster Tugend (die eingesperrte Prinzessin) oder höchsten Lasters sind (die Hexe). Da ich persönlich nicht viel Zeit für Prinzessinnen habe, die gerettet werden müssen, konzentriere ich mich hier auf die Hexen. Warner betont, dass die Ikonografie der Hexe immer vollkommen häuslich gewesen sei. Der spitze Hut war die übliche Kopfbedeckung im Mittelalter, den Besenstiel fand man in jedem Haushalt, und sogar der vermutete teuflische, vertraute Geist der Hexe war für gewöhnlich nicht mehr als eine Katze. Das Merkmal für eine Hexe – die angenommene dritte Brustwarze oder »Hexentitte«, an der der Teufel saugen konnte – fand man an den Körpern vieler Frauen zu Zeiten, als Leberflecke und Warzen alltäglich waren. Es brauchte tatsächlich nicht mehr als eine Anklage. Richte den Finger auf eine Frau, nenne sie eine Hexe, und die Beweise dafür finden sich nahezu in jedem Haus.
Das konventionelle Bild der Hexe war das einer hässlichen Frau, eines gebeugten, missgestalteten Weibes oder einer schrulligen Alten, und diese Art Hexe finden wir in den Grimm’schen Märchen. Doch zumindest in einer Grimm’schen Geschichte – in »Schneewittchen« mit der bösen Königin, die in den magischen Spiegel an der Wand blickt und ihm ihre todbringende Frage stellt: »Wer ist die Schönste im ganzen Land?« – sehen wir etwas, das in der Kunst und der Literatur der Renaissance ein häufigeres Motiv werden wird: die schöne Hexe. (Tatsächlich findet man die schöne Hexe auch schon viel früher, zum Beispiel in der griechischen Mythologie, wo die Zauberin Circe Odysseus und seine Männer verführt und viele der Seeleute in Schweine verwandelt. Circe reiste auch nach Indien und zeigte sich im Kathāsaritsāgara