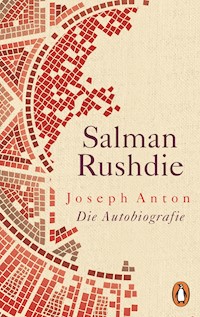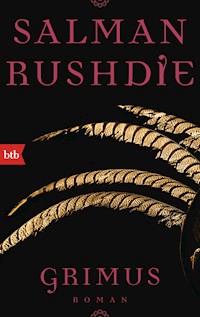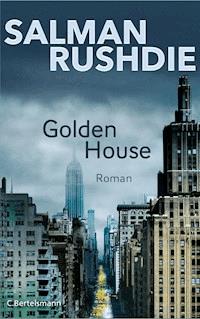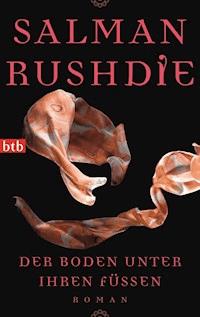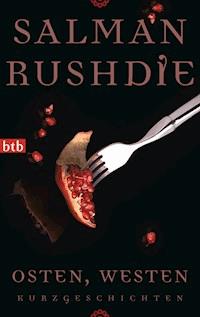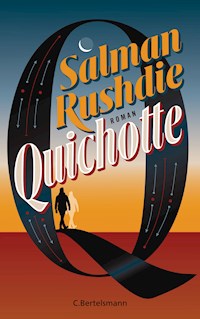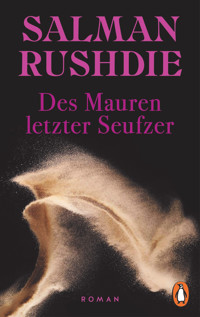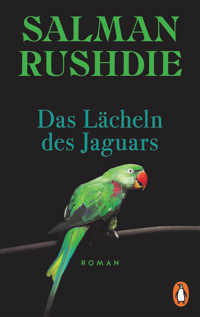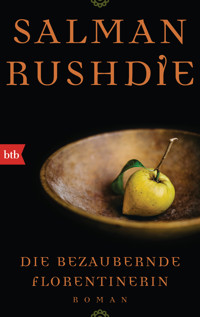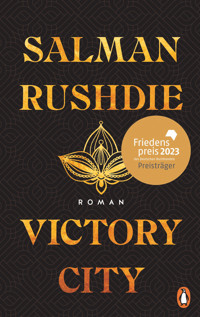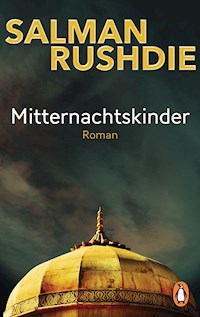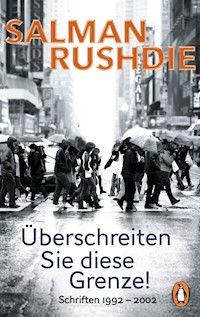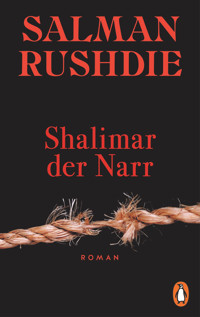
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Vor dem Haus seiner unehelichen Tochter wird Maximilian Ophuls, dem ehemaligen US-Botschafter in Indien, von seinem muslimischen Chauffeur die Kehle durchgeschnitten. Was aussieht wie ein politisch motiviertes Attentat, ist ein zutiefst persönliches Drama. Dies ist die Geschichte von Max, von seinem Mörder und seiner Tochter – und von einer Frau, die am Anfang von allem steht. Die Geschichte einer tiefen Liebe, die verheerend endet. Eine Geschichte, die bis nach Kaschmir führt. Ein verlorenes Paradies auf Erden mit Pfirsichhainen und Honigbienen, Bergen und Seen, grünäugigen Frauen und mörderischen Männern, wo Menschen entwurzelt werden und Namen sich auf einmal ändern – nichts bleibt, wie es ist, und doch ist alles miteinander verbunden.
- »Rushdies ergreifendstes Buch seit ››Mitternachtskinder‹‹. Es ist eine Wehklage, eine Geschichte von Liebe und Vergeltung. Es ist eine Warnung.« (The Observer)
- Über die Unversöhnlichkeit der Menschen und das Ende des Paradieses
- »Ein Psychogramm des globalisierten Bewusstseins. Suggestiv und opulent erzählt.« (Der Tagesspiegel)
- Dieses Buch trifft mitten hinein in das kulturelle Gedächtnis, das globalisierte Bewusstsein und vor allem in das Herz der Leser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vor dem Haus seiner unehelichen Tochter wird Maximilian Ophuls, dem ehemaligen US-Botschafter in Indien, von seinem muslimischen Chauffeur die Kehle durchgeschnitten. Was aussieht wie ein politisch motiviertes Attentat, ist ein zutiefst persönliches Drama. Dies ist die Geschichte von Max, von seinem Mörder und seiner Tochter – und von einer Frau, die am Anfang von allem steht. Die Geschichte einer tiefen Liebe, die verheerend endet. Eine Geschichte, die bis nach Kaschmir führt. Ein verlorenes Paradies auf Erden mit Pfirsichhainen und Honigbienen, Bergen und Seen, grünäugigen Frauen und mörderischen Männern, wo Menschen entwurzelt werden und Namen sich auf einmal ändern – nichts bleibt, wie es ist, und doch ist alles miteinander verbunden.
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman Mitternachtskinder wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2008 schlug ihn die Queen zum Ritter.
Salman Rushdie
Shalimar der Narr
Roman
Deutsch von Bernhard Robben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Shalimar the Clown bei Jonathan Cape, London.
Copyright © 2005 by Salman Rushdie
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 bei btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte an der Übersetzung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg.
Covergestaltung: Favoritbüro nach einem Entwurf von semper smile, München
Covermotiv: © Allison Saltzman; Foto: © Marc Yankus
ISBN 978-3-641-31284-8V001
www.penguin-verlag.de
In liebevoller Erinnerung an meine kaschmirischen GroßelternDr. Ataullah und Amir un nissa Butt(Babajan und Ammaji)
Auf einem Höllenfluss werde ich durch das Paradies gerudert:Erlesener Geist, es ist Nacht.Das Paddel ist ein Herz; es bricht die Wellen aus Porzellan …
… Ich bin alles, was du verloren hast. Du wirst mir nicht vergeben. Meine Erinnerung kommt deiner Geschichte ins Gehege. Es gibt nichts zu vergeben. Du wirst mir nicht vergeben. Selbst vor mir verberge ich meinen Schmerz. Nur mir selbst offenbare ich meinen Schmerz. Alles muss vergeben werden. Du wirst mir nicht vergeben. Hättest du mir doch nur irgendwie gehören können, Was wäre nicht auf dieser Welt möglich gewesen?
Agha Shahid Ali The Country without a Post Office
Zum Teufel beider Sippschaft!
Mercutio in: Romeo und JuliaWilliam Shakespeare
*****
India
***
MIT VIERUNDZWANZIG JAHREN schlief die Tochter des Botschafters in den warmen, ereignislosen Nächten schlecht. Sie wachte oft auf, und selbst wenn der Schlaf sie schließlich überkam, gab ihr Körper nur selten Ruhe, warf sich hin und her und schlug um sich, als versuchte er, sich von grausamen, unsichtbaren Handschellen zu befreien. Manchmal schrie sie ängstlich in einer ihr unbekannten Sprache. Das hatten ihr Männer nervös gestanden. Nicht, dass es vielen Männern erlaubt gewesen wäre, bei ihr zu sein, wenn sie schlief. Die Zahl der Beweise war folglich begrenzt, Übereinstimmungen gab es selten, doch zeichnete sich ein Muster ab. Sie klinge guttural, hieß es in einem Bericht, knacklautig, als spräche sie arabisch. Tausendundeine-Nacht-Arabisch, die Traumzunge Scheherazades, dachte sie. Ein anderer nannte ihre Worte science-fiction-haft, klingonisch, als räusperte sich jemand in einer fernen Galaxie. Wie die von einem Geist besessene Sigourney Weaver in Ghostbusters. Aus einer Forscherlaune heraus beschloss die Tochter des Botschafters eines Abends, ein Tonband neben ihrem Bett laufen zu lassen, doch die vertraute und zugleich fremde Totenkopfhässlichkeit der Stimme auf der Kassette erschreckte sie dermaßen, dass sie die Aufnahme löschte, ohne damit etwas Wichtiges zu zerstören. Die Wahrheit blieb auch weiterhin die Wahrheit.
Diese unruhigen Phasen des Schlafredens waren zum Glück sehr kurz, und sobald sie endeten, versank sie für eine Weile schwitzend und keuchend in traumloser Erschöpfung. Dann schreckte sie wieder hoch und war in ihrer Verwirrung davon überzeugt, dass sich ein Eindringling in ihrem Schlafzimmer befand. Doch es gab keinen Eindringling. Der Eindringling war eine Abwesenheit, ein Negativraum in der Dunkelheit. Sie hatte keine Mutter. Ihre Mutter war bei ihrer Geburt gestorben: So viel hatte ihr die Frau des Botschafters erzählt, und der Botschafter, ihr Vater, hatte es bestätigt. Ihre Mutter war eine Kaschmiri gewesen, und wie das Paradies, wie Kaschmir, war sie in einer Zeit vor aller Erinnerung verloren. (Jeder, der sie kannte, musste sich damit abfinden, dass die Worte «Kaschmir» und «Paradies» für sie identisch waren.) Sie erzitterte vor der Abwesenheit ihrer Mutter, einem leeren Wächterschatten in der Dunkelheit, und wartete auf das zweite Unheil, wartete, ohne zu wissen, worauf sie wartete. Kaum war ihr Vater gestorben – ihr genialer, kosmopolitischer Vater, ein Franko-Amerikaner («wie die Freiheitsstatue», hatte er gesagt), ihr geliebter, unausstehlicher, launischer Vater, dieser oft abwesende, unwiderstehliche Frauenheld –, schlief sie tief und fest, als hätte man sie von ihren Sünden freigesprochen, vielleicht sogar von den seinigen. Die Last der Sünde war weitergegeben worden. Sie glaubte nicht an Sünde.
Bis zum Tode ihres Vaters war sie daher keine Frau, mit der es sich leicht schlafen ließ, doch war sie eine Frau, mit der die Männer schlafen wollten. Sie hingegen fand männliches Begehren ermüdend, und der Drang ihres eigenen Begehrens blieb meist ungestillt. Die wenigen Liebhaber, die sie sich nahm, waren auf die eine oder andere Weise unbefriedigend, weshalb sie sich (als wollte sie das Thema damit beenden) bald für einen durchschnittlich hübschen Kerl entschied und seinen Heiratsantrag sogar ernsthaft in Erwägung zog. Doch dann wurde der Botschafter vor ihrer Haustür wie ein Halal-Hühnchen abgeschlachtet, verblutete an einer tiefen Halswunde, die ihm der Täter mit einem einzigen Hieb seiner Klinge beigebracht hatte. Am helllichten Tag! Was musste die Waffe geglitzert haben in der goldenen Morgensonne, diesem täglichen Segen oder auch täglichen Fluch dieser Stadt. Die Tochter des Ermordeten war eine Frau, die gutes Wetter hasste, doch die meiste Zeit des Jahres bot ihr die Stadt kaum etwas anderes, und sie musste sich mit langen, monotonen Monaten schattenlosen Sonnenscheins und trockener, schrundiger Hitze abfinden. An jenen seltenen Vormittagen jedoch, an denen sie aufwachte und der Himmel sich bedeckt zeigte, an denen eine Ahnung von Feuchtigkeit in der Luft hing, räkelte sie sich verschlafen in ihrem Bett, krümmte den Rücken und war für einen Moment froh, gar voller Hoffnung. Bis zum Mittag aber waren die Wolken unweigerlich fortgebrannt, und dann war es wieder da, dieses unehrliche Kinderzimmerblau des Himmels, das die Welt kindlich und rein aussehen ließ, und das grelle, unhöfliche Gestirn, das sie belästigte wie das zu laute Lachen eines Mannes in einem Restaurant.
In solch einer Stadt, so schien es, konnte es keine Grauzonen geben. Ohne alle Zweideutigkeit waren die Dinge, was sie waren, und nichts sonst, ihnen fehlten die Feinheiten von Nieselregen, Kälte und Schatten. Unter dem prüfenden Blick einer solchen Sonne blieb kein Platz, um sich zu verbergen. Überall waren die Menschen zur Schau gestellt, ihre spärlich bekleideten Körper glänzten im Sonnenlicht und erinnerten an Reklametafeln. Keine Geheimnisse, keine Tiefe, nur Oberfläche und Enthüllungen. Doch lernte man die Stadt erst kennen, entdeckte man, dass diese banale Klarheit einer Illusion gleichkam. Die Stadt war nichts als Verrat und Täuschung, eine sich rasant wandelnde, treibsandige Metropole, die ihre wahre Natur verbarg, die sich bedeckt hielt und trotz aller unübersehbaren Nacktheit verschwiegen gab. An einem solchen Ort brauchten selbst die Kräfte der Zerstörung nicht länger den Schutz der Dunkelheit. Sie brannten aus der morgendlichen Helligkeit heraus, blendeten das Auge und erdolchten die Menschen mit scharfem, tödlichem Licht.
Sie hieß India, Indien also. Und ihr gefiel der Name nicht. Man hieß doch nicht Australien oder Uganda, Inguschetsien oder Peru. Mitte der sechziger Jahre war Max Ophuls, ihr Vater (Maximilian Ophuls, aufgewachsen im französischen Straßburg zu einer früheren Zeit dieser Welt), Amerikas beliebtester und später skandalträchtigster Botschafter in Indien gewesen, doch das war kein Grund; schließlich hießen Kinder nicht Herzegowina, Türkei oder Burundi, nur weil ihre Eltern diese Länder besucht und sich dort womöglich danebenbenommen hatten. Sie war im Osten gezeugt worden – unehelich gezeugt und mitten in jenen Proteststurm hineingeboren, der die Ehe ihres Vaters durcheinander wirbelte und zerstörte und seine diplomatische Karriere beendete –, doch wenn das eine ausreichende Entschuldigung sein sollte, wenn es in Ordnung wäre, einem den Geburtsort um den Hals zu hängen wie einen Albatros, wäre die Welt voll mit Männern und Frauen, die Euphrat, Pisgah, Iztaccihuatl oder Wooloomooloo hießen. Mist, aber in Amerika war diese Art der Namensgebung nicht unbekannt, was ihre Argumente ein wenig verwässerte und sie richtig wütend machte. Nevada Smith, Indiana Jones, Tennessee Williams, Tennessee Ernie Ford: Ihnen allen schleuderte sie mit gestrecktem Mittelfinger lautlose Flüche entgegen.
«India» klang für sie immer noch falsch, exotisch, kolonial, ein Name, der die Aneignung einer Realität andeutete, die ihr nicht gehören konnte; und sie beharrte darauf, dass er sowieso nicht zu ihr passte, dass sie sich nicht wie Indien fühlte, obwohl ihre Haut von satter, tiefdunkler Farbe war, das lange Haar schimmernd und schwarz. Sie wollte nicht riesig sein, nicht subkontinental, exzessiv, vulgär oder explosiv, übervölkert, alt, lärmend, mystisch oder irgendwie Dritte Welt. Ganz im Gegenteil. Sie gab sich diszipliniert, gepflegt, nuanciert, vergeistigt, ungläubig, verhalten und gelassen. Sie sprach mit englischem Akzent, tat nicht heißblütig, sondern kühl. Das war der Charakter, den sie wollte, den sie mit großer Entschlossenheit für sich geschaffen hatte. Und es war die einzige Seite ihrer selbst, die man in Amerika – ihren Vater und jene Liebhaber ausgenommen, die sie mit ihren nächtlichen Neigungen vertrieb – von ihr kannte. Was ihr Innenleben betraf, ihre von Gewalt geprägte englische Geschichte, den unterschlagenen Bericht über gestörtes Verhalten, die Jahre der Kriminalität, die verborgenen Geschehnisse ihrer kurzen, doch ereignisreichen Vergangenheit, so standen diese Dinge nicht zur Debatte und interessierten die breite Öffentlichkeit auch nicht (oder jedenfalls nicht mehr). Heutzutage hatte sie sich fest im Griff. Das Problemkind in ihr wurde durch ihre Freizeitbeschäftigungen sublimiert, durch die wöchentlichen Boxstunden in Jimmy Fishs Boxclub auf dem Santa Monica Boulevard, Ecke Vine Avenue, in dem bekanntermaßen auch Tyson und Laila Ali trainierten und wo die kalte Wut ihrer Schläge dafür sorgte, dass die männlichen Boxer ihr Training unterbrachen, um ihr zuzuschauen; durch die zweiwöchentlichen Stunden mit dem Doppelgänger eines Clouseau attackierenden Burt Kwouk, einem Meister in der Nahkampfkunst Wing Chun; durch die sonnengebleichte, schwarz ummauerte Einsamkeit von Saltzmans Schießstand Moving Target draußen bei Palms 29, mitten in der Wüste, und – das Allerbeste – durch den Unterricht im Bogenschießen in Downtown Los Angeles, unweit vom Elysian Park, dem Geburtsort der Stadt, wo ihre neue Begabung zu rigider Selbstbeherrschung, die sie erlernt hatte, um zu überleben, sich zu verteidigen, zum Angriff eingesetzt werden durfte. Wenn sie ihren goldenen, olympischen Anforderungen genügenden Bogen spannte, den Druck der Sehne an ihren Lippen spürte, gelegentlich den Pfeilschaft mit der Zungenspitze berührte, dann merkte sie, wie eine Erregung sie überkam, und sie fühlte, wie es heiß in ihr aufstieg, während die für diesen Schuss zugestandenen Sekunden der Null entgegentickten, bis sie den Pfeil endlich fliegen ließ, sein lautloses Gift entfesselte und den fernen dumpfen Aufschlag genoss, mit dem das Geschoss ins Ziel traf. Pfeil und Bogen waren ihre Lieblingswaffen.
Ihrer Beherrschung unterwarf sie auch die seltsamen Gesichte, den plötzlich so fremden Blick, der kam und ging. Wenn ihre hellen Augen Dinge anders sahen, machte ihr robuster Verstand die Veränderungen rückgängig. Bei diesen Turbulenzen verweilte sie nicht gern, sie redete auch nie über ihre Kindheit und behauptete, sich an ihre Träume nicht erinnern zu können.
An ihrem vierundzwanzigsten Geburtstag kam der Botschafter an ihre Tür. Er klingelte, und sie schaute von ihrem Balkon im vierten Stock hinab und sah ihn in der Hitze in seinem unmöglichen Seidenanzug wie einen französischen Sugardaddy warten. Noch hielt er Blumen in der Hand. «Man wird dich für meinen Lover halten», rief India zu Max hinunter, «für einen alten Knilch, der sich an kleinen Mädchen vergreift!» Sie brachte den Botschafter gern in Verlegenheit, und ihr gefiel es, wenn er die Stirn in gequälte Falten legte, die rechte Schulter zum Ohr hochzog, während die Hand sich hob, als wollte sie einen Schlag abwehren. Sie sah ihn, wie er durch das Prisma ihrer Liebe in alle Regenbogenfarben gebrochen wurde, sah ihn, wie er unter ihr auf dem Bürgersteig stand und in die Vergangenheit entwich, wie jeder Moment vor ihren Augen vorbeizog, auf immer verloren und nur im Weltall in der Gestalt flüchtiger Lichtstrahlen überdauernd. Das nämlich ist der Verlust, der Tod: eine Flucht in die luminöse Wellenform, in die unfassbare Geschwindigkeit von Lichtjahren und Sternweiten, die ewig sich ausdehnenden Entfernungen des Kosmos. Eines Tages würde am Rande des bekannten Universums ein unvorstellbares Geschöpf das Auge ans Teleskop pressen und Max Ophuls in einem Seidenanzug kommen sehen, Geburtstagsrosen in der Hand, auf immer vorangetragen von den Flutwellen des Lichts. Augenblick um Augenblick verließ er sie, wurde zum Botschafter einer solch unvorstellbar fernen Fremde. Sie schloss die Augen und schlug sie wieder auf. Nein, er war keine Milliarde Meilen weit fort in kreisenden Galaxien. Er war hier, wirklich und wahrhaftig, auf der Straße, in der sie wohnte.
Er fand seine Haltung wieder. Eine Frau im Jogginganzug bog um die Ecke der Oakwood und trabte auf ihn zu, taxierte ihn, fällte, wie heutzutage üblich, ihr schnelles Urteil über Sex und Geld. Er war einer der Architekten der postmodernen Welt, ihrer internationalen Strukturen, ihrer anerkannten ökonomischen und diplomatischen Konventionen. Selbst in seinem fortgeschrittenen Alter war er noch ein beachtlicher Tennisspieler. Die Vorhand aus der Rückhandecke war seine Überraschungswaffe. Die drahtige Gestalt in langer, weißer Hose, kaum mehr als zehn Prozent Körperfett, konnte noch immer den Platz beherrschen. Er erinnerte an den früheren Champion Jean Borotra, jedenfalls jene wenigen Veteranen, die sich noch an Borotra erinnern konnten. Mit unverhohlenem europäischem Vergnügen starrte er auf die amerikanischen Brüste im Sport-BH der Joggerin. Und bot ihr aus dem enormen Geburtstagsstrauß eine einzelne Rose an, als sie an ihm vorbeilief. Sie nahm die Blume, doch dann sprintete sie davon, über seinen Charme, über die Nähe zu seiner forschen, knisternd kraftvollen Erotik ebenso erschrocken wie über sich selbst. Fünfzehn – null.
Mit der unverfrorenen Lüsternheit zahnloser Greisinnen starrte von den Balkonen des Mietshauses auch so manche Dame aus Mittel- und Osteuropa auf Max herab. Sein Eintreffen galt hier als der Höhepunkt dieses Monats, weshalb die Ladys in voller Stärke angetreten waren. Meist versammelten sie sich an den Straßenecken in kleinen Gruppen oder saßen zu zweit und zu dritt am winzigen Swimmingpool im Hof, tratschten und präsentierten sich schamlos in nicht allzu kleidsamer Bademode. Sie schliefen viel, und wenn sie nicht schliefen, dann jammerten sie. Sie hatten ihre Ehemänner begraben, mit denen sie vierzig, gar fünfzig Jahre eines unbeachteten Lebens verbracht hatten. Krumm und vornübergebeugt, beklagten die alten Frauen nun mit ausdruckslosen Mienen das rätselhafte Geschick, das sie hier stranden ließ, eine halbe Welt entfernt von ihren Herkunftsorten. Sie unterhielten sich in seltsamen Sprachen, die Georgisch, Kroatisch oder Usbekisch sein mochten. Durch ihren Tod hatten ihre Gatten sie im Stich gelassen. Ihre Männer waren Säulen gewesen, die eingestürzt waren; sie hatten von ihnen verlangt, dass sie sich auf sie verließen, als sie ihre Frauen ihrer vertrauten Umgebung entrissen und in dieses schattenlose Lotusland voller obszön junger Menschen brachten, in dieses Kalifornien, in dem der Körper ein Tempel und Ignoranz eine Seligkeit war, um sich dann als unverlässlich zu erweisen, indem sie auf dem Golfplatz vornüberkippten oder mit dem Gesicht voran in eine Schale Nudelsuppe fielen, als wollten sie ihren Witwen zu diesem späten Zeitpunkt ihres Lebens die Unverlässlichkeit des Daseins im Allgemeinen und der Ehemänner im Besonderen offenbaren. Abends sangen die Witwen Lieder aus ihrer Kindheit im Baltikum, auf dem Balkan, in den weiten Steppen der Mongolei.
Auch die alten Männer der Gegend waren allein; manche hausten in verschrumpelten Körpersäcken, die allzu sehr unter der Schwerkraft litten, andere ließen sich gehen, ihre Wangen waren mit grauen Stoppeln bedeckt, die Unterhemden schmutzig, die Hose nicht zugeknöpft, während eine dritte Partei sich fesch anzog, gern mit Fliege und Baskenmütze. Diese piekfeinen Gentlemen bemühten sich immer wieder, die Witwen in Gespräche zu verstricken, doch der traurige Anblick der angeklatschten Haarreste unter den gelüpften Käppis, der gelbliche Glanz der falschen Zähne bewirkte, dass man ihre Mühen unweigerlich und verächtlich ignorierte. Für diese alten Beaus war Max Ophuls ein Affront, das Interesse der Damen an ihm eine Beleidigung. Sie hätten ihn umgebracht, wären sie dazu fähig und nicht zu sehr damit beschäftigt gewesen, sich gegen den eigenen Tod zu wehren.
India sah sie alle, die exhibitionistischen, wollüstigen Greisinnen, die flirtend auf den Veranden ihre Pirouetten drehten, die lauernden, gehässigen alten Männer. Die uralte russische Hauswartsfrau Olga Simeonowna, ein knollennasiger, jeansumhüllter Samowar von Frau, grüßte den Botschafter, als käme ein Staatsoberhaupt zu Besuch. Hätte es im Haus einen roten Teppich gegeben, sie hätte ihn für ihn ausgerollt.
«Lässt Sie warten, Herr Botschafter. Was will man machen, die jungen Leute! Ich sag ja nix, aber eine Tochter, das ist heutzutage viel schwieriger. Ich war nämlich selbst eine Tochter, für die der Papa war wie ein Gott. Kein Gedanke daran, ihn warten zu lassen. Aber ach, heute ist es schwer, Töchter aufzuziehen, und dann lassen sie einen einfach so im Stich. Ich, mein Herr, bin selbst Mutter gewesen, aber für mich sind sie jetzt tot, meine Mädchen. Ich spucke auf ihre vergessenen Namen. So sieht’s aus.»
So sprach sie, während sie in der Hand eine knollige Kartoffel drehte. Überall in der Nachbarschaft, ihrer letzten, kannte man sie als Olga-Wolga, und ihren eigenen Auskünften zufolge war sie die einzige noch lebende Nachfahrin der legendären Kartoffelhexen von Astrachan, ganz ehrlich, eine echte Zauberin, die mit der sanften Nachhilfe des Kartoffelzaubers Liebe, Wohlstand oder Eiterbeulen hervorrufen konnte. An jenen fernen Orten und in lang vergangenen Zeiten hatten Menschen sie bewundert und gefürchtet, doch heute saß sie, dank der Liebe eines mittlerweile dahingeschiedenen Matrosen, in West-Hollywood fest, trug überdimensionierte Jeans-Overalls und auf dem Kopf einen feuerroten, weiß gepunkteten Schal, der ihr schütteres weißes Haar bedeckte. In der Hüfttasche steckten Schraubenschlüssel und Kreuzschlitzschraubenzieher. Damals konnte sie deine Katze verfluchen, dich fruchtbar machen oder deine Milch sauer werden lassen. Heute tauschte sie Glühbirnen aus, stierte in kaputte Backöfen und trieb monatlich die Miete ein.
«Was mich angeht, mein Herr», bestand sie darauf, den Botschafter wissen zu lassen, «lebe ich heutzutage nicht in dieser und nicht in der letzten Welt, nicht in Amerika und nicht in Astrachan. Aber auch nicht, das muss ich sagen, in dieser oder der nächsten Welt. Eine Frau wie ich, die lebt dazwischen. Irgendwo zwischen den Erinnerungen und dem Alltagskram. Zwischen gestern und morgen, im Land verlorener Glückseligkeit und Harmonie, dem Ort abhanden gekommener Ruhe. Das ist nun mal unser Schicksal. Früher habe ich gefunden, alles ist okay. Das finde ich heute nicht mehr. Seitdem kenne ich auch keine Angst mehr vor dem Tod.»
«Auch ich selbst bin Bürger dieses Landes, Madame», unterbrach er sie mit ernster Stimme. «Auch ich habe lang genug gelebt, um mir in ihm ein Wohnrecht zu erwerben.»
Sie war in Sichtweite des Kaspischen Meeres einige Meilen östlich vom Mündungsdelta der Wolga geboren. Was sie davon erzählte, wurde zur Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, gefärbt von Kartoffelmagie. «Harte Zeiten, natürlich», sagte sie zu den alten Frauen auf ihren Balkonen, zu den alten Männern am Pool, zu India, wann immer und sooft sie das Mädchen zu packen bekam, und jetzt dem Botschafter Max Ophuls am vierundzwanzigsten Geburtstag seiner Tochter. «Armut, natürlich, auch Unterdrückung, Vertreibung, Soldaten, Knechtschaft; heutzutage die Kinder haben es leicht, sie wissen nix, aber Ihnen seh ich an, Sie sind ein Mann von Bildung, der ordentlich herumgekommen ist. Vertreibung, natürlich, Überleben, man muss gewitzt sein wie eine Ratte. Hab ich nicht Recht? Natürlich war da auch ein Mann, der Traum vom Anderswo, eine Ehe, Kinder; sie bleiben nicht, ihr Leben gehört ihnen, sie nehmen es von dir und gehen. Krieg, natürlich, einen Mann verloren, fragen Sie mich nicht, was Kummer ist. Vertreibung, gewiss, Hunger, Betrug, Glück, ein neuer Mann, ein guter Mann, ein Seemann. Dann eine Reise über das Wasser, die Verlockungen des Westens, eine Reise über Land, zum zweiten Mal Witwe, Männer machen’s nicht lang, Anwesende ausgeschlossen, sind eben nicht von Dauer. In meinem Leben die Männer waren wie Schuhe. Ich hatte zwei und habe sie beide abgenutzt. Und dann habe ich gelernt, wie man barfuß läuft, könnt man sagen. Aber nie habe ich die Männer gebeten, dass sie was möglich machen. Nein, darum hab ich sie nie gebeten. Was ich wollte, hab ich bekommen durch das, was ich wusste. Meine Kartoffelkunst, genau. Ob was zu essen, Kinder, Reisepapiere oder Arbeit. Meine Feinde haben verloren, und ich, ich hab glorreich triumphiert. Die Kartoffel ist mächtig, durch sie lässt sich alles erreichen. Aber jetzt kommt das Alter, und selbst die Kartoffel kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wir kennen die Welt, stimmt’s? Wir wissen, wie es ausgeht.»
Er schickte den Fahrer mit den Blumen nach oben und wartete unten auf India. Der neue Fahrer. Auf ihre achtsame, leidenschaftslose Art bemerkte India, dass er ein attraktiver, gar ein schöner Mann war, um die vierzig, in den Bewegungen so geschmeidig wie der unvergleichliche Max. Er hatte einen Gang, als liefe er auf einem Hochseil. Schmerz lag in seinem Gesicht, und er lächelte nicht, obwohl Lachfalten um die Augenwinkel lagen. Als er sie – unvermutet intensiv – musterte, traf sein Blick sie wie ein Stromschlag. Uniformen waren dem Botschafter nicht wichtig, und der Fahrer trug ein offenes weißes Hemd und Chinos, die Anti-Uniform der Sonnengesegneten in Amerika. In riesigen, bedauernswerten Herden strömten die Schönen in diese Stadt, um zu leiden, sich demütigen zu lassen und zu erleben, dass die mächtige Währung ihrer Schönheit entwertet wurde wie der russische Rubel, der argentinische Peso; um als Hotelpage zu arbeiten, als Bardame, als Müllmann oder als Zimmermädchen. Die Stadt war eine Klippe, und sie waren eine Herde kopflos dahinjagender Lemminge. Am Fuße der Klippe aber lag das Tal der zerbrochenen Puppen.
Mühsam wandte der Fahrer den Blick von ihr ab und schaute zu Boden. Er komme, erwiderte er stockend auf ihre Frage, aus Kaschmir. Ihr Herz tat einen Sprung. Ein Fahrer aus dem Paradies. Sein Haar war ein Gebirgsbach, Narzissen von den Ufern rauschender Flüsse und Pfingstrosen von den Gebirgswiesen wuchsen auf seiner Brust, lugten aus seinem offenen Kragen. Um ihn herum erscholl der raue Klang der swarnai. Nein, das war doch lächerlich. Und lächerlich war sie nicht, nie würde sie sich erlauben, in Phantastereien zu versinken. Diese Welt ist real. Die Welt ist, wie sie ist. Sie schloss die Augen und schlug sie wieder auf, und da war der Beweis, der Sieg der Normalität. Der deflorierte Fahrer wartete geduldig am Aufzug, hielt ihr die Tür auf. Sie neigte den Kopf, um ihm zu danken. Ihr fiel auf, dass seine geballten Hände zitterten. Die Tür schloss sich, und sie fuhren nach unten.
Der Name, auf den er hörte, der Name, den er auf ihre Nachfrage nannte, lautete Shalimar. Sein Englisch war nicht besonders gut, kaum hinreichend. Vermutlich hätte er den Ausdruck nicht mal verstanden – kaum hinreichend. Seine Augen waren blau, seine Haut heller als die ihre, das Haar grau mit einer letzten Spur blond. Sie musste seine Geschichte nicht hören, nicht heute. Ein andermal würde sie ihn vielleicht fragen, ob er blaue Kontaktlinsen trug, ob es seine natürliche Haarfarbe war, ob dies seinem persönlichen Stil entsprach oder ob er von ihrem Vater zu diesem Stil gedrängt worden war, hatte der doch sein Leben lang gewusst, wie man sich anderen aufdrängte, und das mit solchem Charme, dass jedermann seine Vorschläge stets für eigene Ideen gehalten hatte. Ihre verstorbene Mutter kam ebenfalls aus Kaschmir. So viel wusste sie immerhin über ihre Mutter, über die sie sonst so wenig wusste (aber allerhand vermutete). Ihr amerikanischer Vater hatte nie einen Führerschein gemacht, kaufte sich aber gern Autos. Daher die Fahrer. Sie kamen und gingen. Natürlich wollten sie berühmt werden. Einmal war der Botschafter ein, zwei Wochen lang von einer hinreißenden jungen Frau gefahren worden, die ihn verließ, um in Fernsehserien aufzutreten. Andere Fahrer erlangten als Tänzer in Musikvideos kurzzeitigen Ruhm. Mindestens zwei von ihnen, ein Mann und eine Frau, machten Karriere beim pornographischen Film, und dann und wann hatte India spätabends in irgendwelchen Hotelzimmern Bilder ihrer nackten Körper gesehen. In Hotelzimmern sah sie sich Pornos an. Es half ihr einzuschlafen, wenn sie unterwegs war. Auch daheim sah sie sich Pornos an.
Shalimar aus Kaschmir begleitete sie nach unten. Hielt er sich legal im Land auf? Besaß er die nötigen Papiere? Hatte er einen Führerschein? Warum hatte man ihn eingestellt? War sein Penis groß, so groß, dass es sich lohnte, ihn sich spät abends im Hotel genauer anzuschauen? Ihr Vater hatte sie gefragt, was sie sich zum Geburtstag wünschte. Sie schaute den Fahrer an und wünschte sich kurz, eine jener Frauen zu sein, die ihm pornographische Fragen stellen konnten, gleich hier im Aufzug, nur Sekunden nach ihrer ersten Begegnung; eine, die diesem schönen Mann schmutzige Dinge sagte, weil sie wusste, dass er kaum ein Wort verstand und er das zustimmende Lächeln eines Angestellten aufsetzen würde, ohne zu wissen, was er bejahte. Ob er es gern im Arsch hatte? Sie wollte ihn lächeln sehen. Sie wusste nicht, was sie wollte. Sie wollte Dokumentarfilme drehen. Der Botschafter hätte wissen müssen, was sie sich wünschte, hätte sie nicht fragen sollen. Er hätte ihr einen Elefanten besorgen können, um über den Wilshire Boulevard zu reiten, hätte sie zum Fallschirmspringen einladen sollen, nach Angkor Wat, Macchu Picchu oder Kaschmir.
Sie war vierundzwanzig. Sie wollte Fakten, keine Träume. Wahre Gläubige, diese albtraumhaften Träumer, begrabschten den Leichnam von Ayatollah Khomeini, so wie sich einst andere wahre Gläubige in einem anderen Land, in Indien, dessen Namen sie trug, Stücke vom Leichnam des heiligen Franz Xaver abgebissen hatten. Ein Stück landete in Macao, ein anderes in Rom. Sie wollte Schatten, Chiaroscuro, Nuancen. Sie wollte hinter das Oberflächliche sehen, vorbei am Meniskus blendender Helligkeit, wollte das Hymen der Helligkeit durchstoßen und vordringen zur verborgenen, blutigen Wahrheit. Was nicht verborgen lag, was offen zutage trat, konnte nicht wahr sein. Sie wollte ihre Mutter. Sie wollte hören, wie ihr Vater von ihrer Mutter erzählte, wollte, dass er Briefe und Fotos zeigte, dass er ihr Neuigkeiten von der Toten brachte. Sie wollte, dass ihre verlorene Geschichte gefunden wurde. Sie wusste nicht, was sie wollte. Sie wollte zu Mittag essen.
Das Auto war eine Überraschung. Gewöhnlich bevorzugte Max große, klassische englische Wagen, doch dies hier war etwas völlig anderes, ein silberner Luxusflitzer mit Fledermaustüren, dasselbe futuristische Gefährt, mit dem man im Film in diesem Jahr in die Zukunft flog. Sich von einem Chauffeur in einem Sportwagen herumkutschieren zu lassen, dachte sie enttäuscht, war eines großen Mannes unwürdig.
«In dieser Rakete ist kein Platz für drei Leute», sagte sie laut. Der Botschafter drückte ihr die Schlüssel in die Hand, und der Wagen umschloss sie beide, protzig, potent, verlogen. Der gut aussehende Fahrer, Shalimar aus Kaschmir, blieb auf dem Bürgersteig stehen, vom Rückspiegel zu einem Insekt verkleinert, die Augen blitzende Schwerter. Er war ein Silberfischchen, eine Heuschrecke. Olga-Wolga, die Kartoffelhexe, stand neben ihm, und ihre in der Ferne schwindenden Körper sahen wie Ziffern aus. Zusammen ergaben sie die Zahl 10.
Im Aufzug hatte sie gespürt, dass der Fahrer sie berühren wollte, hatte sein schmerzliches Verlangen empfunden. Seltsam. Nein, seltsam war es nicht. Seltsam war nur, dass sein Verlangen kein sexuelles Verlangen zu sein schien. Sie sah sich in etwas Abstraktes verwandelt. Als hoffte er, wenn er die Hand nach ihr ausstreckte, jemand anderen zu fassen, über unbekannte Dimensionen trauriger Erinnerung und vergessener Ereignisse hinwegzureichen. Als wäre sie nur eine Stellvertreterin, ein Zeichen. Sie aber wollte die Art Frau sein, die einen Fahrer fragen konnte, wen er eigentlich berühren mochte, wenn er sie berühren wollte. Wer wird nicht von dir berührt, wenn du es dir bei mir untersagst? Fass mich an, wollte sie in sein verständnisloses Lächeln hinein sagen, ich bin dein Kanal, deine Kristallkugel. Wir können Sex in Aufzügen haben und nie ein Wort darüber verlieren. Sex in Transitbereichen, an Orten wie dem Aufzug, zwischen hier und dort. Sex in Autos. Bei Transitzonen denkt man gemeinhin an Sex. Wenn du mich vögelst, vögelst du sie, und wer sie auch ist oder war, ich will es nicht wissen. Ich werde gar nicht hier sein, bin nur der Kanal, das Medium. Und ansonsten vergiss es, du bist Angestellter meines Vaters. Es wird wie im Letzten Tango sein, natürlich ohne Butter. Sie sagte kein Wort zu dem sich verzehrenden Mann, der sowieso nichts verstanden hätte, falls er es nicht doch verstanden hätte, denn sie wusste wirklich nichts über seine sprachlichen Fähigkeiten, warum also stellte sie Vermutungen an, warum dachte sie sich das alles aus? Sie klang lächerlich. Sie ging aus dem Aufzug, ließ ihr Haar herab und trat nach draußen.
Dies war der letzte Tag, den sie mit ihrem Vater verbringen sollte. Wenn sie ihn das nächste Mal sah, würde es anders sein. Dies war das letzte Mal.
«Das ist für dich», sagte er, «das Auto; so eine Puritanerin kannst du nicht sein, dass du den Wagen nicht willst.» Weltraumzeit ist wie Butter, dachte sie, rasend schnell, und dieses Auto durchschneidet sie wie ein warmes Messer. Sie wollte den Wagen nicht. Sie wollte mehr fühlen, als sie empfand. Sie wollte, dass jemand sie schüttelte, ihr ins Gesicht schrie, sie schlug. Sie war wie betäubt, als wäre Troja schon gefallen. Dabei stand es gut um sie. Sie war vierundzwanzig. Es gab einen Mann, der sie heiraten wollte, und andere Männer, die das nicht wollten, die weniger wollten. Sie kannte das Thema ihres ersten Dokumentarfilms, und Geld war auch da, genug, um mit der Arbeit anzufangen. Und ihr Vater saß gleich neben ihr auf dem Beifahrersitz, während der DeLorean durch den Canyon sauste. Es war der erste Tag von etwas; es war der letzte Tag von etwas anderem.
Sie aßen im Canyon hoch oben in einem Waldhaus, saßen unter einer Reihe von Geweihen. Vater und Tochter, ähnlicher Appetit, gute Verbrennung, die Vorliebe für Fleisch, eine schlanke, stolze Figur. Sie entschied sich für Wild, den beobachtenden Schädeln toter Hirsche zum Trotz.
«Na, du Tier, ich esse deinen Arsch.»
Das rief sie laut, um ihn zum Lächeln zu bringen. Er wählte ebenfalls Wild, doch aus Respekt, wie er sagte, um den abwesenden Leibern Bedeutung zu verleihen. «Das Fleisch, das wir verzehren, ist zwar nicht ihr Fleisch gewesen, doch es ist das Fleisch von ihresgleichen, durch das ihre verblichene Gestalt heraufbeschworen und geehrt werden mag.» Noch mehr Stellvertreter, dachte sie. Mein Körper im Aufzug, jetzt das Fleisch auf meinem Teller.
«Dein Fahrer macht mir zu schaffen», sagte sie. «Er sieht mich an, als wäre ich jemand anderes. Kannst du ihm vertrauen? Hast du ihn überprüfen lassen? Was ist das überhaupt für ein Name – Shalimar? Klingt wie ein Club in La Brea mit exotischen Tänzerinnen. Oder wie ein billiges Strandhotel, wie ein Trapezkünstler im Zirkus. Ach, bitte», sagte sie und hob ungeduldig eine Hand, ehe er sich herablassen konnte, ihr das Offensichtliche zu sagen, «erspare mir die Erklärung mit dem Garten.» Sie stellte sich das andere Shalimar vor, den großen Mogulgarten in Kaschmir, wie er in grünen, feuchten Terrassen zu einem glitzernden See abfiel, den sie nie gesehen hatte. Der Name bedeutete «Sitz der Freude». Sie schob den Unterkiefer vor. «Klingt für mich immer noch wie ein Schokoriegel. Außerdem, da wir gerade schon mal bei Namen sind, möchte ich dir endlich klipp und klar sagen, dass mein Name eine Last für mich ist, ein fremdes Land, das du mich auf den Schultern tragen lässt. Ich will einen anderen Namen und weiterhin so lieblich duften. Vielleicht nehme ich mir deinen», schloss sie, ehe er etwas erwidern konnte. «Max, Maxine, Maxie. Perfekt. Nenn mich von jetzt ab Maxie.»
Er schüttelte abwehrend den Kopf, aß sein Fleisch und begriff nicht, dass sie ihn in Wirklichkeit anflehte, nicht länger um den Sohn zu trauern, den er nie gehabt hatte, und jene altmodische Traurigkeit aufzugeben, die ihn auf Schritt und Tritt begleitete und sie zugleich schmerzte und verletzte, denn wie konnten sich seine Schultern krümmen unter dem Gewicht des ungeborenen Sprösslings, der dort oben hockte und über sein Versagen lästerte, wie konnte er sich von diesem böswilligen Inkubus quälen lassen, da sie doch voller Liebe direkt vor ihm stand? War sie denn nicht sein lebendes Spiegelbild, war sie keine schönere, würdigere Kreatur als ein nicht vorhandener Junge? Der Ton ihrer Haut und die grünen Augen könnten von ihrer Mutter sein, die Brüste waren es bestimmt, doch nahezu alles andere, sagte sie sich, hatte sie vom Botschafter geerbt. Wenn sie redete, konnte sie das andere Erbteil nicht vernehmen, die anderen, unvertrauten Kadenzen; sie hörte nur die Stimme ihres Vaters, deren Eigenarten und Tonfall, ihr Auf und Ab. Wenn sie in den Spiegel schaute, verschmolz sie mit dem Schatten des Unbekannten und erkannte nur Max’ Gesicht, seinen Körperbau, seine lässige Eleganz in Auftreten und Benehmen. Eine Wand ihres Schlafzimmers nahmen verspiegelte Schrankschiebetüren ein, und wenn sie auf dem Bett lag und ihren nackten Körper bewunderte, sich hin und her drehte, zum eigenen Entzücken die unterschiedlichsten Posen einnahm, regte sie oft der Gedanke auf, ja, erregte sie sogar, dass dies der Körper ihres Vaters sein könnte, wenn er denn eine Frau gewesen wäre. Das kräftige Kinn, der lang geschwungene Hals. Sie war eine groß gewachsene junge Frau, und ihre Größe war ebenfalls sein Geschenk, ihr zugeteilt in seinen Proportionen: der vergleichsweise kurze Oberkörper, die langen Beine. Die Skoliose, die leichte Krümmung ihrer Wirbelsäule, die ihren Kopf vorbeugte, wodurch sie etwas Falkenhaftes, Raubvogelhaftes bekam: Auch das war von ihm.
Nachdem er gestorben war, sah sie ihn weiterhin im Spiegel. Sie war der Geist ihres Vaters.
Die Sache mit dem Namen sprach sie nie wieder an. Durch sein Verhalten aber gab ihr der Botschafter zu verstehen, dass er ihr einen Gefallen tat, als er ihr peinliches Benehmen vergaß, dass er ihr durch Vergessen verzieh, so wie man einem urinierenden Baby verzeiht oder einem Teenager, der nach bestandenem Examen besoffen und kotzend nach Haus torkelt. Solche Vergebung war ärgerlich, doch fand sie sich damit ab und machte sich sein Verhalten zum Vorbild. Sie erwähnte nichts mehr, das sie wurmte oder wichtig war, weder die Jahre der Kindheit in England, als sie dank ihres Vaters die eigene Geschichte nicht kannte, noch die Frau, die nicht ihre Mutter war, jene zugeknöpfte Frau, die sie nach dem Skandal aufgezogen hatte, oder gar jene Frau, ihre Mutter, über die zu reden verboten gewesen war.
Sie beendeten das Mittagessen und gingen eine Weile in den Bergen spazieren, wanderten über den Himmel wie die Götter. Sie brauchten nicht zu reden. Die Welt redete. India war das Kind seiner alten Tage. Er war fast achtzig, zehn Jahre jünger als das verruchte Jahrhundert. Sie bewunderte, wie er ausschritt, ohne jede Andeutung von Schwäche. Er mochte ein Halunke sein, war auch oft genug ein Halunke gewesen, aber er besaß den Willen zur Selbstüberwindung, war davon besessen, von dieser inneren Kraft, die es Bergsteigern erlaubt, achttausend Meter hohe Gipfel ohne Sauerstoff zu erklimmen, oder Mönchen, sich durch Meditation in einen künstlichen Tiefschlaf zu versetzen, der unglaublich viele Monate lang anhält. Er ging wie ein Mann im besten Alter, als wäre er, sagen wir, fünfzig. Wenn die Hornisse des Todes irgendwo in der Nähe umherschwirrte, würde diese Demonstration zeittrotzender körperlicher Fitness ganz gewiss ihren Stachel hervorlocken. Bei Indias Geburt war er siebenundfünfzig Jahre alt gewesen. Er ging, als wäre er jünger geworden. Dieser Wille machte ihn für sie liebenswert, und denselben Willen fühlte sie wie ein Schwert in sich selbst ruhen, abwartend, von ihrem Körper umhüllt. Er war ein Halunke gewesen, solange sie sich erinnern konnte. Für die Vaterrolle war er nicht gemacht. Er war der Hohepriester des goldenen Zweiges, hauste in seinem verwunschenen Hain und wurde vergöttert, bis ihn sein Nachfolger ermordete. Doch um dieser Priester zu werden, hatte er seinen Vorgänger ermorden müssen. Vielleicht war sie selbst auch ein Halunke. Vielleicht war auch sie fähig, jemanden zu ermorden.
Seine Gutenachtgeschichten, die er zu jenen unvorhersehbaren Gelegenheiten erzählte, wenn er einmal an ihrem Kinderbett saß, waren eigentlich keine Geschichten. Sie waren eher Gleichnisse, wie sie Sun Tse, der Philosoph des Krieges, seinen Nachkommen dargelegt haben mochte. «Der Palast der Macht ist ein Labyrinth miteinander verbundener Säle», erzählte Max einmal der schläfrigen Kleinen. Sie stellte sich diesen Palast vor, ging ihm entgegen, halb träumend, halb wach. «Er hat keine Fenster», sagte Max, «und keine sichtbare Tür. Deine erste Aufgabe besteht darin, den Eingang zu finden. Hast du das Rätsel gelöst und gelangst du als Bittsteller in den ersten Vorraum der Macht, wirst du darin einen Mann mit dem Kopf eines Schakals antreffen, der dich wieder hinauszujagen versucht. Wenn du bleibst, wird er dich verschlingen. Kannst du dich an ihm vorbeimogeln, betrittst du den zweiten Raum, der diesmal von einem Mann mit dem Kopf eines tollwütigen Hundes bewacht wird, und in dem nächsten Raum wartet ein Mann mit dem Kopf eines hungrigen Bären und immer so weiter. Im vorletzten Raum ist dann ein Mann mit einem Fuchskopf. Dieser Mann wird nicht versuchen, dich vom letzten Raum fern zu halten, dem Saal der wahren Macht. Stattdessen wird er dich davon überzeugen wollen, dass du bereits am Ziel bist und dass er selbst der gesuchte Mann ist.
Wenn es dir gelingt, den Schwindel des Fuchsmannes zu durchschauen, und du an ihm vorbeigelangst, befindest du dich im Saal der Macht. Der Saal der Macht ist nicht sonderlich beeindruckend, und darin mustert dich der Mann der Macht über einen leeren Tisch hinweg. Er wirkt klein, unbedeutend und ängstlich, denn jetzt, da du all seine Wachen überwunden hast, muss er dir gewähren, was dein Herz begehrt. Auf dem Weg nach draußen jedoch sind der Fuchsmann, der Bärenmann, der Hundemann und der Schakalmann verschwunden. Stattdessen sind die Räume voll von halbmenschlichen fliegenden Monstern, geflügelten Menschen mit Vogelköpfen, Adlermännern und Geiermännern, Männertölpeln und Falkenmännern. Sie stürzen sich auf dich herab und wollen dir deinen Schatz entreißen. Mit ihren Klauen holen sie sich alle ein Stück davon zurück. Wie viel wirst du davon noch aus dem Palast der Macht herausbringen? Du schlägst nach den Vogelmännern, sie zerfetzen dir mit ihren glitzernden blauweißen Krallen den Rücken. Doch dann hast du es geschafft, du bist wieder draußen, blickst blinzelnd ins blendend helle Licht, drückst die armseligen, zerrissenen Überbleibsel an dich und musst jetzt die skeptische Menge – die neidische, ohnmächtige Menge – davon überzeugen, dass du mit allem zurückgekehrt bist, was du haben wolltest. Schaffst du das nicht, bist du für immer als Versager gebrandmarkt.
Solcherart ist das Wesen der Macht», erzählte er ihr, während sie in Schlaf versank, «und das sind die Fragen, die sie aufwirft. Der Mann, der beschließt, ihre Räume zu betreten, kann sich freuen, wenn er ihnen lebend wieder entrinnt. Die Antwort auf die Frage der Macht übrigens», fügte er wie einen nachträglichen Einfall hinzu, «lautet: Betritt das Labyrinth nicht als Bittsteller. Komme mit Fleisch und einem Schwert. Gib dem ersten Wächter das Fleisch, nach dem es ihn verlangt, denn er ist immer hungrig, dann schlag ihm den Kopf ab, während er frisst: Schwups! Biete danach seinen abgeschlagenen Kopf dem Wächter im nächsten Raum an, und wenn er ihn verschlingt, enthaupte auch ihn. Schwaps! Et ainsi de suite. Wenn der Mann der Macht sich jedoch bereit erklärt, deine Forderungen zu erfüllen, darfst du ihm den Kopf nicht abschlagen. Achte darauf, dass es nicht so weit kommt! Die Enthauptung eines Herrschers ist eine extreme Maßnahme, die kaum je nötig und nur selten ratsam ist. Sie gibt ein schlechtes Beispiel. Denk stattdessen daran, nicht nur um das Gewünschte, sondern auch um einen Sack Fleisch zu bitten. Mit dem frischen Fleischvorrat lockst du dann die Vogelmänner in ihr Verhängnis. Runter mit den Köpfen! Schnipp, schnapp! Hack, hack, bis du frei bist. Freiheit ist kein Kaffeekränzchen, India. Freiheit ist Krieg.»
Noch immer suchten die Träume sie heim, wie sie schon ihr kindliches Ich heimgesucht hatten: Visionen von Schlachten und von Siegen. Im Schlaf warf und wand sie sich hin und her und führte den Krieg, den er in ihr gesät hatte. Dies war das Erbe, dessen sie sich sicher war, ihre Kriegerzukunft. Ihr Körper war sein Körper, ihr Verstand sein Verstand, ihr Excalibur-Geist, seinem gleich, ein aus dem Stein gezogenes Schwert. Er war durchaus imstande, ihr weder Geld noch Gut zu hinterlassen, durchaus imstande zu behaupten, ihre Enterbung sei das letzte Wertvolle, das er ihr zu geben habe, das Letzte, was er ihr beibringen könne und was sie lernen müsse. Sie wandte sich von den Gedanken an den Tod ab und schaute über die blauen Berge hinüber zum späten, orangeroten Nachmittagshimmel, der träge mit dem warmen, stillen Meer verschmolz. Eine kühle Brise verfing sich in ihrem Haar. 1769 hatte der Franziskaner Fray Juan Crespi irgendwo dort unten eine Süßwasserquelle entdeckt und sie Santa Monica genannt, da sie ihn an die Tränen erinnerte, die die Mutter des heiligen Augustinus vergoss, als ihr Sohn sich von der christlichen Kirche lossagte. Augustinus kehrte natürlich in den Schoß der Kirche zurück, doch in Kalifornien fließen noch immer die Tränen der heiligen Monica. India hatte für Religionen nur Verachtung übrig, war doch ihre Verachtung einer der vielen Belege dafür, dass sie nicht Indien war. Religion war dumm, aber religiöse Geschichten rührten sie, und das fand sie verwirrend. Hätte ihre tote Mutter wie eine Heilige um sie geweint, wenn sie von ihrer Gottlosigkeit gehört hätte?
Auf Madagaskar zog man die Toten regelmäßig aus ihren Gräbern und tanzte mit ihnen die ganze Nacht. In Australien und Japan gab es Menschen, denen die Toten jede Verehrung wert waren, die ihre Vorfahren für geheiligte Wesen hielten. Überall auf der Welt gab es einige Tote, über die geforscht wurde, an die man sich erinnerte, und das waren die besten Toten, jene, die am wenigsten tot schienen, die im Gedächtnis der Welt fortlebten. Nicht so gefeierte, nicht so bevorzugte Tote waren es zufrieden, in einigen wenigen liebenden (oder auch hassenden) Herzen am Leben gehalten zu werden, und sei es auch nur in einer einzigen menschlichen Brust, in deren gegebenen Grenzen sie lachen und schwatzen konnten, sich lieben, sich gut oder schlecht benehmen, Hitchcock-Filme ansehen und Urlaub in Spanien machen, sich peinlich kleiden, Gartenarbeit genießen, widersprüchliche Ansichten vertreten, unverzeihliche Verbrechen begehen und ihren Kindern erzählen, dass sie sie mehr liebten als das Leben. Indias Mutter jedoch war auf die schlimmste und toteste Weise tot. Der Botschafter hatte die Erinnerung an sie unter einer Pyramide des Schweigens begraben. India wollte ihn über sie ausfragen, wollte nichts sehnlicher, sooft sie sich trafen, und in jedem Augenblick, den sie gemeinsam verbrachten. Der Wunsch saß wie ein Speer in ihrem Bauch. Doch nie brachte sie es über sich. Die tödlich tote Frau, zu der ihre Mutter geworden war, verschwand im Schweigen des Botschafters, wurde davon ausgelöscht. Sie war tot wie Stein, von der ägyptischen Grabkammer seines Schweigens ummauert, beerdigt mit ihren Einfällen, ihren Eigenarten und allem, was ihr ein kleines Maß an Unsterblichkeit ermöglicht hätte. India könnte ihren Vater für diese Verweigerung hassen, doch dann hätte sie niemanden mehr gehabt, den sie lieben konnte.
Sie sahen die Sonne durch die herrlich schmutzige Luft im Pazifik versinken, und der Botschafter murmelte lautlos Verse vor sich hin. Zwar war er den größten Teil seines Lebens Amerikaner gewesen, doch Stärkung suchte er noch immer in französischen Gedichten.
Homme libre, toujours tu chériras la mer! La mer est ton miroir … Nachdem er ihr Leben gerettet hatte, wurde ihre Lektüre von ihm festgelegt, und inzwischen wusste sie, was er sie hatte wissen lassen wollen. Sie wusste: Du freier Mensch, du liebst das Meer voll Kraft/dein Spiegel ist’s. In seiner Wellen Mauer,/Die hoch sich türmt, wogt deiner Seele Schauer. Also dachte auch er an den Tod. Sie vergalt ihm Baudelaire mit Baudelaire. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;/ Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige. Und noch einmal: Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige … Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir! Der Himmel, ernst und schön, wie ein großes, ein großes Was, irgendeine Art Altar. Die Sonne versinkt in ihrem gerinnenden Blut. Die Sonne versinkt in ihrem gerinnenden Blut. Die Erinnerung an dich leuchtet in mir wie ein, verdammt, ostensoir. Ach ja, richtig, wie eine Monstranz. Noch eine religiöse Metapher. Neue Bilder müssen her. Bilder für eine gottlose Welt. Bis die Sprache der Unreligion mit diesem heiligen Zeugs nicht gleichgezogen hat, bis es nicht genügend Lyrik und eine ausreichende Ikonographie der Gottlosigkeit gibt, werden diese heiligen Echos nie verstummen und ihre zweifelhafte Macht behalten, selbst über sie.
Sie sagte es ihm noch einmal auf Englisch: «Die Erinnerung an dich leuchtet in mir.»
«Lass uns heimfahren», murmelte er und küsste sie auf die Wange. «Es wird kühl, und wir wollen es nicht übertreiben. Ich bin jetzt ein alter Mann.»
Es war das erste Mal, dass sie ihn seine Gebrechlichkeit erwähnen hörte, ihres Wissens überhaupt das erste Mal, dass er die Macht der Zeit anerkannte. Und warum hatte er sie spontan geküsst, obwohl dazu doch keine Notwendigkeit bestand? Auch das ein Hinweis auf seine Schwäche, eine Fehleinschätzung, genau wie sein Geschenk, dieses vulgäre Auto. Ein Anzeichen nachlassender Kontrolle. Sie waren es längst nicht mehr gewohnt, einander ihre Zuneigung anders zu zeigen als auf höchst beiläufige Weise, bewiesen sich ihre Liebe durch völlige Zurückhaltung, wie die Samurai.
«Meine Zeit wird fortgeschwemmt», sagte der Botschafter. «Nichts bleibt.» Er hatte das beschleunigte Ende des Kalten Krieges vorausgesehen, den Einsturz des Kartenhauses Sowjetunion. Er wusste, dass die Mauer fallen würde, dass man die Vereinigung Deutschlands nicht aufhalten konnte, die mehr oder weniger über Nacht passieren würde. Er hatte die Invasion Westeuropas durch die begeisterten, arbeitshungrigen Ossis in ihren Trabbis vorausgesehen, ebenso Ceaus¸escus mussolinihaftes Ende und die elegischen Präsidentschaften der Schriftsteller Václav Havel und Arpad Goncz. Von anderen, weniger angenehmen Möglichkeiten wollte er hingegen nichts wissen. Er redete sich ein, die globalen Strukturen, die er mitgeschaffen hatte, die Kanäle von Einfluss, Geld und Macht, die multinationalen Konglomerate, die Handelsorganisationen, das Rahmenwerk von Gesetz und Kooperation, dessen Aufgabe es gewesen war, mit einem heißen Krieg fertig zu werden, der zu einem kalten Krieg geworden war, all dies, redete er sich ein, würde noch in einer Zukunft funktionieren, die jenseits dessen lag, was er vorhersehen konnte. India spürte in ihm die verzweifelte Hoffnung darauf, dass seine Zeit glücklich zu Ende gehen würde und dass die neue Welt, die darauf folgte, besser wäre als jene, die mit ihm starb. Europa, frei von sowjetischer Bedrohung, und Amerika, frei von dem Zwang zu permanenter Kampfbereitschaft, würden diese Welt in Freundschaft erbauen, eine Welt ohne Mauern, ein grenzenloses, neu gefundenes Land unbegrenzter Möglichkeiten. Dann wäre es auf der Uhr des Jüngsten Tages nicht mehr sieben Sekunden vor Mitternacht. Die aufstrebenden Wirtschaftsmächte Indien, Brasilien und ein weltoffeneres China würden die neuen Machtzentren sein, ein Gegengewicht zur amerikanischen Hegemonie, die er als Internationalist stets missbilligt hatte. Als sie ihn diesem utopischen Trugbild anheim fallen sah, dem Mythos vom verbesserungsfähigen Menschen, wusste India, dass er nicht mehr lang zu leben hatte. Er erinnerte sie an einen Seiltänzer, der das Gleichgewicht zu halten versuchte, obwohl er kein Seil mehr unter den Füßen hatte.
Die Last des Unvermeidlichen drückte sie nieder, als hätte sich die Schwerkraft der Erde plötzlich vervielfacht. In ihren jüngeren Jahren hatten sie sich oft berührt. Er konnte an jeder Stelle ihres Körpers, auf der Hand, der Wange oder dem Rücken, mit seinem Mund einen Vogel aufstöbern und ihn zum Singen bringen. Durch den magischen Druck seiner Lippen brach unter ihrer Haut Vogelzwitschern hervor, stieg jubilierend in die Lüfte auf. Noch im Alter von acht Jahren konnte sie ihn wie den Everest besteigen. Und auf seinen Knien hatte sie die Geschichte des Himalaja gelernt, die Geschichte der gigantischen Proto-Kontinente, hatte von dem Augenblick gehört, als Indien sich vom Gondwanaland löste und über die Proto-Meere auf Laurasia zu bewegte. Sie schloss die Augen und sah die gewaltige Kollision, die mächtige Gebirge zum Himmel hinaufpresste. Er lehrte sie eine Lektion über die Zeit, über die Langsamkeit der Erde: Die Kollision findet immer noch statt. Wenn also er der Himalaja war, wenn auch er selbst durch die Kollision großer Kräfte entstanden war, durch einen Zusammenprall der Welten, dann war er auch immer noch am Wachsen. Dann fand die Kollision immer noch in ihm statt. Er war der gebirgige Vater und sie seine Bergsteigerin. Er nahm ihre Hand, und sie stieg an ihm hinauf, bis sie auf seinen Schultern saß, ihr Schoß in seinem Nacken. Er küsste ihren Bauch, und sie schlug einen Purzelbaum rückwärts auf den Boden. Eines Tages sagte er dann, Schluss damit. Sie wollte weinen, beherrschte sich aber. Die Kindheit war vorbei? Na gut, war sie eben vorbei. Mit kindischen Dingen würde sie sich nicht mehr abgeben.
Der Freeway war leer, so schockierend leer, als ginge die Welt unter, und während sie über die Asphaltwüste dahinglitten, begann der Botschafter erneut, geschwätzig zu erzählen, die Worte strömten ihm aus dem Mund wie endloser Verkehr, beinahe, als müsste er für die fehlenden Autos aufkommen. Geschwätzigkeit fiel Max Ophuls leicht, doch war sie eine seiner vielen Methoden des Verbergens, und nie verbarg er sich besser als dann, wenn er am offensten zu sein schien. Die meiste Zeit seines Lebens war er jemand gewesen, der vergrub, ein Mann mit Geheimnissen, zu dessen Aufgaben es zählte, die Geheimnisse anderer Leute aufzudecken, die eigenen jedoch zu schützen, und wenn er freiwillig oder gezwungenermaßen das Wort ergriff, gehörte seit langem das Paradoxon zu seinen bevorzugten Täuschungsmitteln. Sie fuhren so rasch über den leeren Freeway dahin, dass sie stillzustehen schienen, der Ozean zu ihrer Rechten, während links die Stadt aufglitzerte, und über diese Stadt beschloss Max zu erzählen, da er wusste, dass er wie ein Amateur schon zu viel über sich gesagt, schon zu viel von sich gezeigt hatte. Also hob er zu einem Lob über die Stadt an, pries sie wegen ebenjener Eigenschaften, die gemeinhin für ihren größten Nachteil gehalten wurden. Er bekannte, es enorm zu bewundern, dass die Stadt keinen Brennpunkt habe. Die Idee eines Zentrums war in seinen Augen überholt, oligarchisch, ein arroganter Anachronismus. An derlei zu glauben hieße, einen Großteil des Lebens an die Peripherie zu verbannen, es zu marginalisieren und dadurch zu entwerten. Die dezentrale, promiskuitive Wucherung dieses gigantischen, wirbellosen Klumpens, dieser Qualle aus Licht und Beton, mache sie zur wahrhaft demokratischen Stadt der Zukunft. Während India ihren Weg über die verlassenen Freeways suchte, lobte ihr Vater die bizarre Anatomie der Stadt, die von vielen solcher Arterien gespeist und genährt wurde, in denen das Blut stockte oder strömte, ohne dass sie ein Herz brauchte, um es durch seine Adern zu pumpen. Dass sie eine verkappte Wüste war, ließ ihn den Genius des Menschen loben, seine Fähigkeit, die Erde mit seinen Phantasien zu formen, Wasser in die Wildnis zu bringen und die Leere zu füllen; doch die Wüste räche sich an der Haut ihrer Eroberer, trockne sie aus, grabe Falten und Furchen in sie ein, erteile diesen triumphierenden Sterblichen die heilsame Lektion, dass kein Sieg absolut war, dass der Kampf zwischen den Erdlingen und der Erde niemals zugunsten einer Seite entschieden werden konnte, sondern in alle Ewigkeit hin und her wogte. Am meisten behagte ihm, dass sie eine verborgene Stadt war, eine Stadt der Fremden. In der Verbotenen Stadt des chinesischen Kaisers hatte das Privileg, unerkannt bleiben zu dürfen, allein den Mitgliedern der kaiserlichen Familie zugestanden. In dieser prächtigen Festung jedoch war Heimlichkeit für alle Ankömmlinge frei zu haben. Die moderne Obsession für Intimität, dafür, anderen sein Innerstes zu offenbaren, war nicht nach Max’ Geschmack. Eine offene Stadt glich einer nackten Hure, die einladend auf dem Rücken lag, um sich ihrem Freier hinzugeben, während dieser verschleierte, rätselhafte Ort, diese erotische Kapitale obskurer Kniffe und Tricks genau wusste, wie sie unsere metropolitischen Gelüste wecken und steigern konnte.
Sie war solche Monologe gewohnt, seine Fugen über dieses und jenes, gewöhnt auch an seine nur halb ernst gemeinten Absonderlichkeiten. Doch diesmal schien sein Lobgesang eine Grenze zu überschreiten und ihn von ihr fort ins Schattenhafte zu führen. Wenn er behauptete, die mächtigen Banden der Stadt wegen der erregenden Beiläufigkeit ihrer Gewalt zu bewundern, die Sprayer für ihre rätselhaften, flüchtigen Graffiti, wenn er die erhabene Wucht der Erdbeben pries, jene Zurechtweisung, die Erdrutsche den eitlen Menschen erteilten, wenn er ohne erkennbare Ironie amerikanisches Junkfood lobte und poetisch die neue Banalität der Diät-Cola verklärte, wenn er die Einkaufszentren wegen ihrer Neonreklame rühmte und die Ladenketten wegen ihrer Allgegenwärtigkeit, wenn er es ablehnte, die Ware in den Frischemärkten zu kritisieren, die köstlich aussehenden Äpfel, die wie Wattebällchen schmeckten, die Bananen aus Pappe, die geruchlosen Blumen, die er Symbole des unvermeidlichen Triumphs der Illusion über die Realität nannte, jener einen, höchst offenkundigen Wahrheit über die Geschichte der menschlichen Rasse, wenn er, der in seinem öffentlichen (nicht in seinem privaten) Leben selbst ein Vorbild an Tugendhaftigkeit gewesen war, bekannte, einen städtischen Beamten insgeheim wegen der extravaganten Kühnheit seiner Korruption zu bewundern, und – sich widersprechend – einen zweiten Beamten zynisch wegen der hinterhältigen, jahrzehntelangen Raffinesse seiner Vergehen lobte, dann begriff India, dass er mitten im hohen Alter, dessen Folgen er heroisch sogar vor ihr verborgen hatte, den Zugang zur Freude verlor und dass ihn sein Versagen von innen verzehrte, die Fähigkeit zu Unterscheidungen und moralischen Urteilen schwächte, und dass er, sollte sich dies so weiterentwickeln, bald nicht mehr in der Lage sein würde, auch nur die geringste Entscheidung zu treffen; Speisekarten in Restaurants würden zu Rätseln werden, und selbst die Wahl, am Morgen aufzustehen oder die Tagesstunden im Bett zu verbringen, wäre ihm dann zu viel. Und wenn ihn erst die letzte Wahl verblüffte, die Wahl zwischen atmen und nicht mehr atmen, dann würde er gewiss sterben.
«Ich habe mir immer gewünscht, dass du eine gute Meinung von mir hast», sagte sie, um ihn zum Schweigen zu bringen, «aber wenn ich sie mit dem ganzen Mist teilen muss, weiß ich nicht mehr, ob mir noch daran gelegen ist.»
Sie kehrten zum Mietshaus zurück, vor dem der Fahrer noch immer mit funkelnden Augen wartete und genau dort stand, wo India ihn zuletzt gesehen hatte, als hätte er sich den ganzen Tag nicht von der Stelle gerührt. Blumen wuchsen aus dem betonierten Bürgersteig zu seinen Füßen, und seine Hände und Kleider waren rot von Blut. Was? Wie bitte? Sie blinzelte, kniff die Augen zusammen, und natürlich stimmte nichts davon, blumenlos war er, fleckenlos und wartete geduldig, wie es einem guten Angestellten anstand. Außerdem war er während ihrer Abwesenheit fleißig gewesen, hatte sich zum Woodrow Wilson Drive aufgemacht und den Bentley des Botschafters geholt. Sieh doch, da stand er, in voller Lebensgröße. Warum hatte sie den nicht gleich entdeckt? Warum überfielen sie solche Augenblicke, seit wann litt sie unter diesem halluzinatorischen Fluch? Hatte sie Olga Simeonowna verärgert und einen Kartoffelzauber auf sich gezogen, der zum ersten Mal vor Jahrhunderten im Flussdelta der Wolga angewandt worden war, als noch Kobolde die Erde bevölkerten? Doch auch an Kartoffelmagie glaubte sie nicht. Sie war übermüdet, sonst nichts. Es würde sich schon alles wieder finden, wenn sie nur eine Nacht lang durchschlafen konnte. Sie versprach sich eine Tablette am Abend. Sie versprach sich ein sauberes, ordentliches Leben. Sie versprach sich Leichtigkeit, ein Ende aller Unruhe. Sie versprach, mit den eintönigen Tröstungen des Alltäglichen zufrieden zu sein.
«Wo hast du ihn aufgetrieben, deinen Mogul-Gärtner?», fragte sie ihren Vater, der ihr nicht zuzuhören schien. «Shalimar», drängte sie. «Der Fahrer mit dem unechten Namen, dem kläglichen Englisch. Hat er die schriftliche Prüfung bestanden?»
Der Botschafter machte eine abfällige Handbewegung. «Um den brauchst du dir keine Sorgen zu machen», sagte er, woraufhin sie sich erst recht Sorgen zu machen begann. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag», setzte er noch hinzu und beendete damit das Thema. «Un bisou.»
Nach dem Meuchelmord sah India fern, und Gorbatschow stieg in Moskau aus einem Flugzeug, hatte den kommunistischen Putschversuch überstanden. Er sah mitgenommen aus, unscharf, an den Rändern verwaschen, wie ein vom Regen fleckiges Aquarellbild. Jemand fragte ihn, ob er plane, die kommunistische Partei abzuschaffen, und an seiner schockierten Reaktion, der Verwirrung und Unentschlossenheit erkannte sie seine Schwäche. Die Partei war Gorbatschows Wiege gewesen, sein Leben. Und jetzt erwartete man von ihm, sie abzuschaffen? Nein, rief sein ganzer Körper, zitternd, verschwommen, wie könnte ich, das werde ich nicht; und in diesem Augenblick wurde er unwichtig, Geschichte rauschte an ihm vorbei, er wurde zu einem mittellosen Tramper am Rande des Freeways, den er selbst in glorreichen Tagen erbaut hatte, und sah den rasenden Autos hinterher, den Jelzins, die an ihm vorbei der Zukunft entgegenbrausten. Auch für den Mann der Macht kann der Palast der Macht ein trügerischer Ort sein. Am Ende musste auch er sich den Weg nach draußen erkämpfen, vorbei an den Vogelmännern, die sich auf ihn stürzten. Mit leeren Händen tauchte er auf, und die Menge, die grausame Menge, verlachte ihn. Gorbatschow sieht wie Moses aus, dachte sie, der Prophet, der das Gelobte Land nicht betreten darf. Und in diesem Augenblick glich er ihrem Vater, als der den Sonnenuntergang betrachtet hatte.
An einem anderen Tag, einem jener zeitlosen Tage nach Max’ Ermordung, hatte sie eine weitere Vision. In Südafrika spazierte ein Mann aus dem Gefängnis, nachdem man ihn ein Leben lang vor den Blicken der Öffentlichkeit versteckt hatte. Niemand wusste genau, wie dieser Lazarus eigentlich aussah. Das einzige je in der Presse veröffentlichte Foto war Jahrzehnte zuvor aufgenommen worden. Und der Mann auf dem Foto sah schwergewichtig aus, ein wütender Bulle, ein Mike-Tyson-Klon. Ein heißblütiger Revolutionär. Doch dieser Mann hier war hoch und schlank gewachsen, und er schritt mit sanfter Anmut aus. Als sie die Silhouette sah, lang und schlaksig wie ein Spielberg-Alien, der im Schein der Jupiterlampen der Freiheit entgegenging, da wusste sie, dass sie ihren von den Toten auferstandenen Vater vor sich hatte. Gefühle überkamen sie, doch Wiederauferstehungen gibt es nicht, wirklich nicht, und es war auch nicht ihr Vater. Als die Scheinwerfer nicht mehr in das Kameraobjektiv leuchteten, begriff India, dass sie eine Allegorie der Zukunft sah, jener Zukunft, die sich ihr Vater nicht mehr hatte vorstellen wollen. Mandela, vom Hitzkopf zum Friedensapostel gewandelt, und neben ihm die verruchte Winnie. Tugend und Untugend Seite an Seite; gemeinsam gingen der Gesegnete und die Korrupte auf die Kameras zu, Hand in Hand und verliebt.
*
In der Hauptstadt der milliardenschweren Film-, Fernseh- und Musikindustrie ging Max Ophuls nie ins Kino. Er verabscheute Spielfilme wie Lustspiele im Fernsehen, besaß keine Stereoanlage und sagte frohgemut das Ende dieser temporären Perversionen voraus, deren Anhänger, so prophezeite er, sie in Kürze aufgeben würden zugunsten der unendlich überlegenen Faszination einer jeden Livevorstellung mit ihrer Unmittelbarkeit, ihrer Spontaneität und Kontinuität und der erregenden Kraft der körperlichen Präsenz des Schauspielers. Trotz dieser melancholisch-puristischen Haltung stieg der Botschafter häufig herab von seinem Elfenbeinturm an der Gipfelstraße, die nach jenem Präsidenten benannt war, der über dem Traum von einem Bund vereinter Nationen gestorben war, und betrat wie der Assyrer in dem Gedicht, der einem Wolf gleich in die Schafherde fuhr, unter dem Deckmantel der Nacht das Penthouse eines der besten Hotels der Stadt, in dem er eine angemietete Suite hatte. Es wurde weithin angenommen, dass viele Damen mit einer großartigen Karriere in dem verachteten Gewerbe dort bei ihm zu Gast waren. Wenn sie ihn fragten, warum er sich weigere, ihre Filme anzuschauen, erwiderte er hingebungsvoll, stattdessen genieße er die erregende Kraft ihrer körperlichen Präsenz, und nichts, was sie auf der Leinwand trieben, könne dem gleichkommen, was sie mit solcher Unmittelbarkeit, Spontaneität, Kontinuität und Gegenwart in diesem berühmten Hotel vollbrächten.
Am Tag vor Max’ Tod zeigte sich das erste schlechte Omen in Gestalt eines Malheurs mit einer indischen Filmschauspielerin. Anfangs hatte Max nicht einmal gewusst, dass sie Schauspielerin war, dieses Mädchen mit einer Haut wie verbrannte Erde, dem wohl verhüllten Körper und der unterwürfigen Art einer Adeptin, die in die Fußstapfen eines großen rishi