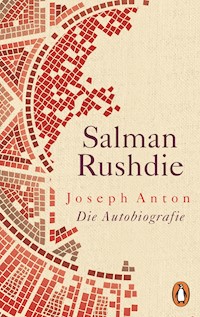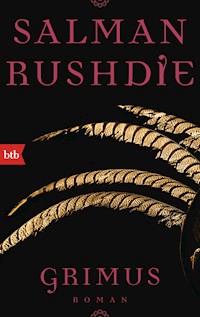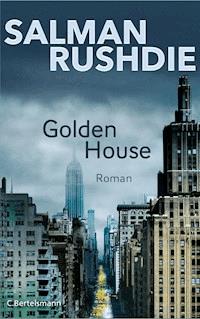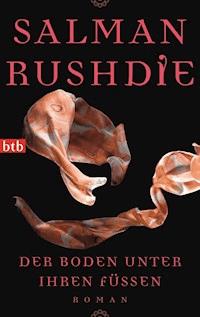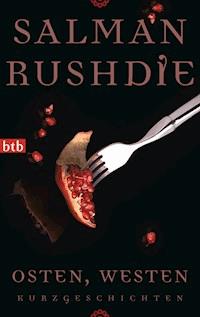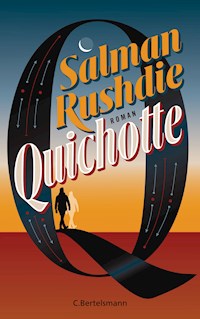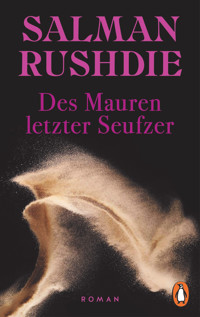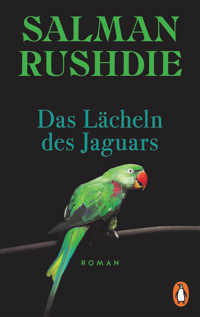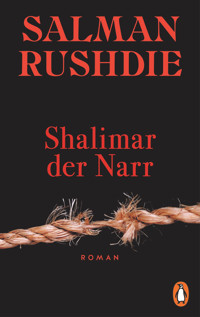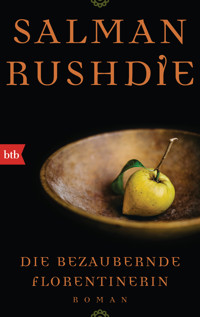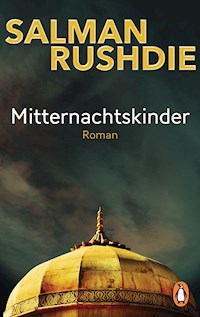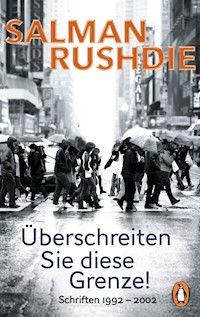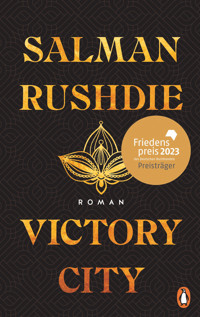
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der neue große Roman über Liebe, Macht und die Kraft des Erzählens von Booker-Preisträger Salman Rushdie
Südindien im 14. Jahrhundert: Die neunjährige Waise Pampa Kampana wird von einer Göttin auserkoren, ihre menschliche Hülle und ihr Sprachrohr in die Welt zu sein. In ihrem Namen erschafft Pampa aus einer Handvoll Samen eine Stadt: Bisnaga – Victory City, das Wunder der Welt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat: den Frauen in einer patriarchalen Welt eine gleichberechtigte Rolle zu geben. Aber die Schöpfungsgeschichte Bisnagas nimmt mehr und mehr ihren eigenen Lauf. Während die Jahre vergehen, Herrscher kommen und gehen, Schlachten gewonnen und verloren werden und sich Loyalitäten verschieben, ist das Leben von Pampa Kampana untrennbar mit dieser Stadt verbunden. Von seinem Aufstieg zu einem Weltreich bis zu seinem tragischen Fall.
Mit »Victory City« kehrt der große Erzähler Salman Rushdie nach Indien zurück, mit einem modernen epischen Roman über Macht, Liebe und darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Ähnliche
Südindien im 14. Jahrhundert: Die neunjährige Waise Pampa Kampana wird von einer Göttin auserkoren, ihre menschliche Hülle und ihr Sprachrohr in die Welt zu sein. In ihrem Auftrag erschafft Pampa aus einer Handvoll Samen eine Stadt: Bisnaga – Victory City, das Wunder der Welt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat: den Frauen in einer patriarchalen Welt eine gleichberechtigte Rolle zu geben. Aber die Schöpfungsgeschichte Bisnagas nimmt mehr und mehr ihren eigenen Lauf. Während die Jahre vergehen, Herrscher kommen und gehen, Schlachten gewonnen und verloren werden und sich Loyalitäten verschieben, ist das Leben von Pampa Kampana untrennbar mit dieser Stadt verbunden. Von ihrem Aufstieg zu einem Weltreich bis zu ihrem tragischen Fall.
Mit »Victory City« kehrt der große Erzähler Salman Rushdie nach Indien zurück, mit einem modernen epischen Roman über Macht, Liebe und darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman »Mitternachtskinder« wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2007 schlug ihn die Queen zum Ritter.
»Literatur, das ist für Salman Rushdie immer die Möglichkeit gewesen, der Welt, wie sie ist, andere Welt-Möglichkeiten entgegenzuhalten. Die Welt neu zu erfinden.« Die Zeit
»Mit seiner eindringlichen, unheimlichen, vorausschauenden Kraft zeigt ›Victory City‹ einmal mehr, warum Salman Rushdies Werk immer von Bedeutung sein wird« The New York Times Book Review
»Ein Epos über die Kraft menschlicher Kreativität und die Fähigkeit der Kunst, die Welt zu gestalten.« The Guardian
www.penguin-verlag.de
SALMAN RUSHDIE
VICTORYCITY
ROMAN
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Victory City bei Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Salman Rushdie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
Penguin Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Kristine Kress
Covergestaltung: Favoritbuero
Coverabbildung: ©Shutterstock/moj0j0; ©Shutterstock/Olga Sabo
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30051-7V004
www.penguin-verlag.de
für Hanan
teil eins GEBURT
teil zwei EXIL
teil drei RUHM
teil vier UNTERGANG
teil eins GEBURT
1
Am letzten Tag ihres zweihundertsiebenundvierzig Jahre währenden Lebens beendete die blinde Poetin, Wundertätige und Prophetin Pampa Kampana ihr gewaltiges Prosagedicht über Bisnaga und begrub es in einem wachsversiegelten Tonkrug im Herzen des verfallenen Königsbezirks, eine Botschaft an die Zukunft. Viereinhalb Jahrhunderte später fanden wir diesen Krug und lasen zum ersten Mal ihr unsterbliches Meisterwerk, genannt Jayaparajaya, was so viel wie »Sieg und Niederlage« bedeutet, mit vierundzwanzigtausend Versen lang wie das Ramayana und verfasst in Sanskrit, ein Buch, in dem sie uns all jene Geheimnisse des Reiches verriet, die sie mehr als einhundertsechzigtausend Tage vor der Geschichte verborgen gehalten hatte. Wir kannten nur die übrig gebliebenen Ruinen, und auch unsere Erinnerung an die Geschichte des Reiches lag in Trümmern, zerstört vom Lauf der Zeit, den Unzulänglichkeiten der Erinnerung, den Verfälschungen der Nachgeborenen. Durch die Lektüre von Pampa Kampanas Buch aber wurde die Vergangenheit zurückgewonnen, das Reich Bisnaga so wahrhaft wiedergeboren, wie es einst gewesen war, mit seinen Kriegerinnen, den Goldbergen, der Großmut des Geistes und seinen Zeiten der Kleingeistigkeit, seinen Schwächen und Stärken. Zum ersten Mal vernahmen wir die vollständige Kunde jenes Königreichs, das begann und endete mit einem Brand und einem abgeschlagenen Kopf. Dies hier nun ist seine Geschichte, in schlichterer Sprache nacherzählt von einem Autor, der weder Gelehrter ist noch Poet, nur jemand, der gern Fäden spinnt und diese Version zur schlichten Unterhaltung und vielleicht auch zur Erbauung heutiger Leser darbietet, der alten wie der jungen, der gebildeten und nicht so gebildeten, jenen, die auf der Suche nach Weisheit sind, und jenen, die Narreteien kurzweilig finden, jenen aus dem Norden und jenen aus dem Süden, den Anhängern diverser Götter oder auch keines Gottes, den Weitherzigen und Engstirnigen, Männern und Frauen sowie allen Geschlechtern dazwischen und darüber hinaus, adligen Nachkommen und einfachen Bürgern, guten Menschen und Bösewichten, Scharlatanen und Ausländern, genügsamen Weisen und selbstsüchtigen Trotteln.
Bisnagas Geschichte begann im vierzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung im Süden dessen, was wir heute Indien nennen, Bharat oder auch Hindustan. Der alte König, dessen von den Schultern kullernder Kopf alles in Gang setzte, machte als Monarch nicht viel her, war er doch einer vom Schlag jener minderen Herrscher, wie sie zwischen dem Niedergang eines großen Königreichs und dem Aufstieg des nächsten den Schauplatz der Geschichte betreten. Er hieß Kampila, stammte aus dem winzigen Fürstentum Kampili und war »Kampila Raya«, wobei mit raya die regionale Form von raja, also König, gemeint ist. Diesem zweitklassigen raya blieb auf seinem drittklassigen Thron gerade mal genügend Zeit, eine viertklassige Burg an den Ufern des Flusses Pampa zu bauen, darin einen fünftklassigen Tempel zu errichten und in den Fels eines steinigen Bergs einige vollmundige Inschriften meißeln zu lassen, ehe die Armee aus dem Norden nach Süden zog und ihn sich vorknöpfte. Die nachfolgende Schlacht war eine recht einseitige Angelegenheit und so unbedeutend, dass sich niemand die Mühe machte, ihr einen Namen zu geben. Kaum hatten die Soldaten aus dem Norden Kampila Rayas Truppen besiegt und einen Großteil seiner Armee niedergemetzelt, packten sie sich den Möchtegernkönig und schlugen ihm das ungekrönte Haupt ab, stopften es mit Stroh aus und schickten es nach Norden dem Sultan von Delhi zum Pläsier. An der namenlosen Schlacht war weiter nichts erwähnenswert, auch nicht am Kopf. Schlachten waren in jenen Tagen ein alltägliches Vorkommnis, weshalb es vielen Leuten nicht der Mühe wert schien, ihnen einen Namen zu geben; und abgeschlagene Köpfe reisten immerzu kreuz und quer durch unser großartiges Land, um diesem oder jenem Fürsten eine Freude zu machen. Der Sultan in der Hauptstadt im Norden besaß davon bereits eine beachtliche Sammlung.
Nach der unbedeutenden Schlacht kam es jedoch überraschenderweise zu einem Ereignis, das den Lauf der Geschichte ändern sollte. Man erzählt sich, die Frauen des winzigen besiegten Königreichs, viele nach der namenlosen Schlacht frisch verwitwet, hätten die viertklassige Burg verlassen, nachdem ein letztes Mal im fünftklassigen Tempel ein Opfer dargebracht worden war, um dann in kleinen Booten den Fluss zu überqueren, dem aufgewühlten Wasser zu trotzen, so unwahrscheinlich dies auch klingen mag, am Südufer eine Weile gen Westen zu wandern, einen großen Scheiterhaufen anzuzünden und in den Flammen Massenselbstmord zu begehen. Feierlich und klaglos verabschiedeten sie sich voneinander und schritten ohne zu zaudern ins Feuer. Als das Fleisch zu brennen begann und der Gestank des Todes sich verbreitete, wurden keine Schreie laut. Sie verglühten in aller Stille; nur das Knistern der Flammen war zu hören. Pampa Kampana hat dies gesehen. Es war, als schickte das Universum selbst ihr eine Botschaft, die besagte: Spitz deine Ohren, atme und lerne. Sie war neun Jahre alt, schaute mit Tränen in den Augen zu und hielt die Hand ihrer trockenäugigen Mutter so fest wie nur möglich, während all die vielen Frauen, die sie kannte, ins Feuer gingen und im Herzen der Glut hockten, standen oder lagen, wobei ihnen Feuerlohen aus Augen und Mündern spien: die alte Frau, die alles gesehen, und die junge Frau, deren Leben gerade erst begonnen hatte; das Mädchen, das ihren Vater hasste, den toten Soldaten; und die Frau, die sich für ihren Ehemann schämte, weil er sein Leben nicht auf dem Schlachtfeld hingegeben hatte; die Frau mit der schönen Stimme, die Frau mit dem Angst einflößenden Lachen und die Frau dürre wie ein Ästchen und die Frau dick wie eine Melone. Ins Feuer gingen sie, und Pampa würgte vom Gestank des Todes, als sie plötzlich mit Entsetzen bemerkte, wie ihre Mutter Radha Kampana sich sanft von ihrer Hand löste und langsam, aber mit unbeirrbarer Überzeugung voran ins Feuer der Toten schritt, ohne sich von ihrer Tochter auch nur zu verabschieden.
Pampa Kampana, die ihren Namen teilte mit dem Fluss, an dessen Ufern dies geschah, sollte den Geruch vom brennenden Fleisch der Mutter für den Rest ihres Lebens in der Nase behalten. Errichtet wurde der Scheiterhaufen aus duftendem Sandelholz, dem man reichlich Nelken, Knoblauch, Kreuzkümmelsamen und Zimtstangen beigegeben hatte, als wollte man aus den brennenden Frauen ein gut gewürztes Gericht zubereiten, das den siegreichen Generälen des Sultans zu deren kulinarischem Genuss vorgesetzt werden sollte, doch diesen Düften – dazu noch Kurkuma, die großen Kardamomkapseln und auch die kleinen – gelang es nicht, das einzigartig pikante, kannibalische Aroma bei lebendigem Leib gebackener Frauen zu überdecken, was ihren Duft letztlich noch unerträglicher machte. Pampa Kampana sollte nie mehr Fleisch essen, und sie brachte es auch nie wieder über sich, in der Küche zu verweilen, wenn Fleisch zubereitet wurde, da all die Gerichte Erinnerungen an ihre Mutter weckten; und wenn irgendwer totes Tier aß, musste Pampa Kampana den Blick abwenden.
Pampas Vater war jung gestorben, lang vor der namenlosen Schlacht, folglich gehörte ihre Mutter nicht zu den frisch Verwitweten. Arjuna Kampana war bereits vor so vielen Jahren gestorben, dass Pampa sich kaum an sein Gesicht erinnern konnte. Was sie von ihm wusste, hatte Radha Kampana ihr erzählt, nämlich dass er ein gütiger Mann gewesen war, der allseits beliebte Töpfer der Stadt Kampili, und dass er seine Frau ermuntert hatte, gleichfalls das Töpfern zu lernen, weshalb sie nach seinem Tod das Geschäft übernehmen und sich ihm mehr als ebenbürtig erweisen konnte. Radha wiederum leitete die kleine Pampa an, und so war schon das Kind überaus geschickt im Formen von Schalen und Gefäßen auf der Töpferscheibe, was sie eine wichtige Lektion lehrte, nämlich die, dass es kein Handwerk gab, das nur Männer auszuüben vermochten. Pampa Kampana hatte geglaubt, das wäre ihr Leben und sie würde Seite an Seite mit ihrer Mutter schöne Dinge herstellen. Dieser Traum war nun ausgeträumt. Die Mutter hatte ihr die Hand entzogen und sie ihrem Schicksal überlassen.
Lange hatte Pampa sich eingeredet, Radha habe sich der Gruppe nur angeschlossen, weil sie sich nicht ausgrenzen wollte, war sie doch seit jeher eine Frau, der viel an der Freundschaft anderer Frauen lag. Pampa sagte sich, dass die flammende Feuerwand nur ein Vorhang war, hinter dem sich die Frauen auf einen Plausch trafen, und dass sie bald wieder hervorkommen würden, womöglich ein wenig angesengt, womöglich nach Küchengerüchen duftend, die aber gewiss bald wieder verflogen. Und dann würde Pampa mit ihrer Mutter nach Hause gehen.
Erst als sie die letzten gebratenen Hautfetzen von Radha Kampanas Knochen fallen und darunter den nackten Schädel sah, begriff sie, dass ihre Kindheit vorbei war und dass sie sich von nun wie eine Erwachsene benehmen musste, die niemals den letzten Fehler ihrer Mutter begehen durfte. Sie würde dem Tod ins Gesicht lachen und sich dem Leben zuwenden. Sie würde ihren Körper nicht opfern, bloß um toten Männern ins Jenseits zu folgen. Sie würde sich weigern, jung zu sterben, und stattdessen leben und in ihrem Trotz über die Maßen alt werden. Und es war ebendies der Moment, da sie den himmlischen Segen erhielt, der alles ändern sollte, der Augenblick, da die Stimme der Göttin Pampa, alt wie die Zeit selbst, aus ihrem neunjährigen Mund ertönte.
Es war eine Stimme so gewaltig wie der Donner eines hohen Wasserfalls in einem Tal sanfter Echos. Darin klang eine nie zuvor gehörte Musik an, der sie später den Beinamen Güte gab. Natürlich war sie erschrocken, aber auch beruhigt, denn von einem Dämon war sie jedenfalls nicht besessen. Die Stimme verriet Wohlwollen und Majestät. Radha Kampana hatte ihr einmal erzählt, die beiden wichtigsten Götter des Pantheons hätten die ersten Tage ihres Liebeswerbens hier verbracht, am wütenden Wasser des dahineilenden Stroms. Vielleicht sprach durch sie die Königin der Götter höchstselbst, die in einer Zeit des Todes an jenen Ort zurückgekehrt war, an dem ihre Liebe begonnen hatte. Wie der Fluss wurde auch Pampa Kampana nach der Göttin benannt – »Pampa« lautete einer der ortsüblichen Namen der Göttin Parvati, der Shiva, ihr Geliebter, der mächtige Herr des Tanzes, in seiner dreiäugigen Inkarnation hier erschienen war –, und so ergab alles einen Sinn. Mit einem Gefühl abgeklärter Gelassenheit begann Pampa, das Mädchen, den Worten von Pampa, der Göttin, zu lauschen, Worten, die aus ihrem Mund strömten und über die sie so wenig Kontrolle hatte wie jemand in einem Theaterpublikum, der dem Monolog eines berühmten Schauspielers lauscht, und so begann ihr Leben als Prophetin und Wundertätige.
Körperlich fühlte sie keinen Unterschied. Es gab keine unangenehmen Nebenwirkungen. Sie zitterte nicht, fühlte sich nicht schwach, spürte keine Hitzewallungen, und ihr brach kein kalter Schweiß aus. Auch trat ihr kein Schaum vor den Mund, und sie bekam keinen epileptischen Anfall, was, wie man sie hatte glauben lassen, unter ähnlichen Umständen nicht selten geschah und andere Menschen in vergleichbaren Fällen bereits erlebt haben sollten. Eigentlich umgab sie eher eine große Ruhe wie ein weicher Mantel, der ihr das beruhigende Gefühl verlieh, dass die Welt noch ein guter Ort war und am Ende alles seinen rechten Gang nehmen werde.
»Blut und Feuer«, sprach die Göttin, »gebären Leben und Macht. Und an ebendiesem Ort wird eine große Stadt entstehen, ein Weltenwunder, ein Reich, das über zwei Jahrhunderte währt. Und du«, die Göttin sprach Pampa Kampana direkt an, was dem jungen Mädchen die einzigartige Erfahrung bescherte, von einem übernatürlichen Wesen durch den eigenen Mund angesprochen zu werden, »du wirst mit all deiner Kraft dafür sorgen, dass sich Frauen nie wieder auf diese Weise verbrennen und dass Männer lernen, Frauen mit neuem Blick zu sehen, und du wirst lang genug leben, um Zeugin deines Erfolgs und deines Scheiterns zu werden, um alles sehen und die Geschichte erzählen zu können, doch hast du sie einmal erzählt, wirst du auf der Stelle sterben, und vierhundertfünfzig Jahre lang wird sich niemand mehr an dich erinnern.« So erfuhr Pampa Kampana, dass die Großzügigkeit einer Gottheit stets ein zweischneidiges Schwert ist.
Sie lief, ohne zu wissen, wohin sie ging. Hätte sie in unserer Zeit gelebt, hätte sie sagen können, das Land um sie herum gliche der Oberfläche des Mondes, die sandigen Täler, die Felshaufen, das Nichts, die Ahnung einer melancholischen Leere, wo aufkeimendes Leben sein sollte. Doch sie hatte keinen Schimmer, wie es auf dem Mond aussah. Für sie war der nur ein strahlender Gott am Himmel. Weiter und immer weiter lief sie, bis sie einige Wunder sah. So entdeckte sie eine Kobra, die mit ihrem Nackenschild einen trächtigen Frosch vor der Hitze der Sonne schützte. Sie sah, wie ein Kaninchen hakenschlagend kehrtmachte und sich dem Hund stellte, der es jagte, ihm in die Nase biss und so dafür sorgte, dass er davonrannte. Diese Wunder ließen Pampa Kampana ahnen, dass Außerordentliches bevorstand. Bald nach den Visionen, die ihr gewiss als ein Zeichen der Götter gesandt worden waren, stieß sie in Mandana auf eine kleine mutt.
Statt mutt könnte man auch Peetham sagen, aber lasst uns, um Verwirrungen zu meiden, schlicht erklären: Sie kam zu einer Mönchsbehausung. Später, als das Reich wuchs, wurde die Mandana mutt zu einer prachtvollen Stätte, die sich bis hinab an die Ufer des rauschenden Flusses erstreckte, eine gewaltige Anlage, die mehreren Tausend Priestern ein Heim bot, Dienstboten, Kaufleuten, Hauswarten, Elefantenpflegern, Affenhändlern, Stallburschen sowie den Arbeitern auf den weiten Reisfeldern, eine mutt, die verehrt wurde als ein heiliger Ort, an dem selbst Kaiser um Rat nachsuchten, doch in jenen frühen Tagen, bevor der Beginn begann, war die mutt eher bescheiden, kaum mehr als Höhle und Gemüsebeet jenes Asketen, der damals noch ein junger Mann war, ein fünfundzwanzigjähriger Gelehrter mit langem lockigem Haar, das ihm über den Rücken bis hinab zur Hüfte wallte, ein Mann, der auf den Namen Vidyasagar hörte, was bedeutete, dass es in seinem großen Kopf einen Ozean des Wissens gab, einen vidya-sagara. Als er das Mädchen kommen sah, Hunger auf der Zunge und Irrsinn in den Augen, begriff er gleich, dass die Kleine Schreckliches gesehen hatte, und er gab ihr Wasser zu trinken und das bisschen Essen, was er hatte.
Danach lebten sie, zumindest laut Vidyasagars Version der Geschichte, ganz unbeschwert miteinander, schliefen auf dem Höhlenboden in unterschiedlichen Ecken und verstanden einander prächtig, nicht zuletzt, weil der Mönch feierlich geschworen hatte, sich allen Gelüsten des Fleisches zu enthalten, weshalb er, selbst als Pampa Kampana zur vollen Blüte ihrer Schönheit heranreifte, nie Hand an sie legte, und das, obwohl es sich um keine besonders große Höhle handelte und sie im Dunkeln allein waren. Für den Rest seines Lebens erzählte Vidyasagar dies jedem, der danach fragte – und es gab durchaus Menschen, die danach fragten, ist die Welt doch ein zynischer, argwöhnischer Ort, an dem man, voller Lügner, wie sie ist, gern alles für eine Lüge hält. Was Vidyasagars Geschichte ja auch war.
Fragte man Pampa Kampana, blieb sie eine Antwort schuldig. Schon mit jungen Jahren erwarb sie die Fähigkeit, Schreckliches, das ihr im Leben zuteilwurde, aus dem Bewusstsein zu tilgen. Die Macht der Göttin, die ihr innewohnte, hatte sie noch nicht verstanden, und sie wusste sie nicht zu bändigen, weshalb sie sich nicht schützen konnte, als der angeblich keusch lebende Gelehrte die unsichtbare Grenze zwischen ihnen überschritt und ihr antat, was immer er auch tat. Er tat es nicht oft, da ihn das Gelehrtendasein zu sehr ermüdete, um öfter der Lust zu frönen, doch tat er es oft genug, und jedes Mal löschte Pampa Kampana sein Tun mit einem Willensakt aus ihrem Gedächtnis. Sie löschte auch die Erinnerung an ihre Mutter, deren Selbstaufgabe die Tochter zu einem Opfer auf dem Altar der Lust dieses Asketen gemacht hatte, und lange Zeit versuchte sie sich zudem einzureden, bei dem, was in der Höhle geschah, handle es sich um eine Illusion und dass sie überhaupt keine Mutter gehabt hatte.
Auf diese Weise vermochte sie ihr Schicksal schweigend zu erdulden, doch wuchs in ihr eine wütende Macht heran, eine Stärke, aus der die Zukunft geboren werden sollte. Im Lauf der Zeit. Ganz recht, alles zu seiner Zeit.
Die nächsten neun Jahre redete sie kein einziges Wort, weshalb Vidyasagar, der doch so vieles wusste, nicht einmal ihren Namen kannte. Er beschloss, sie Gangadevi zu nennen, ein Name, mit dem sie sich klaglos abfand, und sie half ihm, Beeren zu sammeln und essbare Wurzeln, den Boden ihrer kärglichen Behausung zu fegen und Wasser vom Brunnen zu holen. Ihre Stille kam ihm zupass, da er sich an den meisten Tagen der Meditation hingab, um über die Bedeutung der heiligen, auswendig gelernten Texte zu sinnieren und Antworten auf zwei große Fragen zu suchen: Gab es Weisheit oder doch nur Torheit? Sowie die damit verwandte Frage, ob es denn vidya gab, wahres Wissen, oder bloß diverse Arten von Unwissen, weshalb nur die Götter über jenes wahre Wissen verfügten, nach dem er selbst benannt worden war. Zudem grübelte er über den Frieden nach und fragte sich, wie er dafür sorgen könne, dass in dieser gewaltsamen Zeit die Gewaltlosigkeit obsiegte.
So sind die Menschen, dachte Pampa Kampana. Ein Mann philosophiert über den Frieden, dabei befand er sich, wie er das hilflose, in seiner Höhle schlafende Mädchen behandelte, keineswegs im Einklang mit seiner Philosophie.
Auch wenn das Mädchen stumm blieb, während es zur jungen Frau heranwuchs, schrieb es doch vieles nieder, und dies mit kräftiger, schwungvoller Hand, was den Weisen verblüffte, da er es für ungebildet gehalten hatte. Als Pampa Kampana schließlich zu sprechen begann, gestand sie, selbst nicht gewusst zu haben, dass sie schreiben konnte, weshalb sie das Wunder ihrer Schriftkundigkeit auf die wohlwollende Vermittlung der Göttin zurückführte. Sie schrieb nahezu jeden Tag und gestattete Vidyasagar, das Verfasste zu lesen, und so kam es, dass der von Ehrfurcht ergriffene Weise in diesen neun Jahren zum ersten Zeugen des Erblühens ihres lyrischen Genies wurde. Pampa Kampana verfasste damals, was man heute als Vorwort zu Jayaparajaya kennt. Der Hauptteil ihres Gedichts hat die Geschichte Bisnagas von der Entstehung bis zum Untergang zum Thema, Geschehnisse, die noch in der Zukunft lagen. Das Vorwort aber handelt vom Altertum und erzählt die Geschichte des Affenkönigreichs Kishkindha, das lang zuvor in noch mythischer Zeit seine Blüte erlebte; und es enthält zudem einen lebhaften Bericht vom Leben und Wirken des Affenkönigs Hanuman, der groß wie ein Berg werden und über Meere springen konnte. Gelehrte wie einfache Leser sind sich einig, dass Pampa Kampanas Verse es hinsichtlich ihrer Qualität durchaus mit der Sprache des Ramayana aufnehmen können, falls sie diese nicht sogar übertreffen.
Die neun Jahre waren um, da kamen die beiden Brüder Sangama auf Besuch: der eine, groß gewachsen, grauhaarig, gut aussehend, war sehr still und sah einem tief in die Augen, als könnte er Gedanken lesen, sein viel jüngerer Bruder aber, der kleine, rundliche, umschwirrte ihn und alle Welt wie eine Biene. Sie waren Viehhirten aus der Bergstadt Gooty, die Krieg führte, und da Krieg damals die Wachstumsbranche schlechthin war, schlossen sich die Brüder einem der regionalen Duodezfürsten an, blieben in der Kunst des Tötens aber Amateure, weshalb sie schon nach kurzer Zeit von den Truppen des Sultans von Delhi gefangen genommen und in den Norden geschickt wurden, wo sie, um die eigene Haut zu retten, vorgaben, zur Religion ihrer Eroberer konvertieren zu wollen, doch vermochten sie bald darauf zu entkommen, streiften den angenommenen Glauben ab wie einen ungewollten Schal und türmten, ehe man sie beschneiden konnte, was zu den Anforderungen jener Religion zählte, an die sie eigentlich doch nicht glaubten. Sie seien aus dieser Gegend, erklärten sie jetzt, und hätten von der Klugheit des Weisen gehört, aber auch, um ehrlich zu sein, von der Schönheit der stummen jungen Frau, die mit ihm zusammenlebte, und nun seien sie hier und hofften auf guten Rat.
Sie kamen nicht mit leeren Händen. Sie brachten Körbe mit frischem Obst, einen Sack Nüsse und einen Krug mit der Milch ihrer Lieblingskuh; außerdem hatten sie einen Sack Saatgut dabei, was, wie sich später zeigte, ihr Leben verändern sollte. Sie hießen, so sagten sie, Hukka und Bukka Sangama – Hukka, der attraktive Ältere, und Bukka, die junge Biene –, und nach ihrer Flucht aus dem Norden suchten sie neue Bahnen, in die sie ihr Leben lenken wollten. Kühe hüten genügte ihnen nicht länger, denn ihre militärischen Eskapaden, so sagten sie, hätten ihren Horizont erweitert und ihren Ehrgeiz gestärkt, weshalb sie nun für jeden Rat dankbar seien, für jede Woge, die über den Ozean des Wissens heranrollte, für jedes Wispern aus den Tiefen der Gelehrtheit, das der Weise ihnen zuflüstern wolle, einfach für alles, was ihnen den Weg weisen mochte. »Ihr seid als bedeutsamer Apostel des Friedens bekannt«, sagte Hukka Sangama. »Und nach unseren jüngsten Erfahrungen haben wir es nicht mehr so mit dem Soldatenleben. Also macht uns bitte die Früchte der Gewaltlosigkeit schmackhaft.«
Zu jedermanns Überraschung ergriff nicht der Mönch, sondern seine achtzehnjährige Gefährtin das Wort und sprach in gewöhnlichem Plauderton mit einer kräftigen, tiefen Stimme, der man nicht anmerkte, dass sie neun Jahre lang ungenutzt geblieben war. Es war eine Stimme, der die Brüder auf der Stelle verfielen. »Mal angenommen, ihr hättet einen Sack Saatgut dabei«, sagte sie. »Und weiter angenommen, ihr könntet die Saat aussäen und eine Stadt wachsen lassen und zugleich mit ihr deren Bewohner, so als wären Menschen Pflanzen, die im Frühjahr knospen und erblühen, nur um im Herbst wieder zu verwelken. Weiterhin angenommen, diese Saat ließe Generationen wachsen und eine Historie, eine neue Realität, ein Reich. Und darüber hinaus einmal angenommen, sie, die Saat, könnte euch zu Königen machen, ebenso eure Kinder und Kindeskinder.«
»Klingt gut«, sagte der junge Bukka, der freimütigere der beiden Brüder, »aber wo sollten wir solche Saat finden? Wir sind zwar bloß Viehhirten, aber deshalb glauben wir noch lange nicht an Märchen.«
»Sangama, euer Name, ist ein Zeichen«, sagte sie. »Sangam bedeutet ›Zusammenfluss‹, etwa wie jener, bei dem der Fluss Pampa beginnt, dort, wo die Flüsse Tunga und Bhadra zusammenfinden, Flüsse, die von jenem Schweiß gebildet wurden, der Gott Vishnu beidseits vom Kopf strömte, weshalb Sangam den Zusammenfluss verschiedener Teile meint, aus denen ein neues Ganzes entsteht. Das ist eure Bestimmung. Geht zu dem Ort, an dem die Frauen sich opferten, zu dem heiligen Platz, an dem meine Mutter starb, der zugleich jener Platz ist, wo sich in alter Zeit Gott Ram und sein Bruder Lakshman mit dem mächtigen Gott Hanuman von Kishkindha zusammenschlossen, um in die Schlacht gegen den vielköpfigen Ravana von Lanka zu ziehen, der die Göttin Sita entführte. Ihr seid ebenso Brüder, wie Ram und Lakshman es waren. Errichtet dort eure Stadt.«
Jetzt ergriff der Weise das Wort. »Kein schlechter Start für Viehhirten«, sagte er. »Auch das Sultanat Golconda wurde von Hirten gegründet, und der Name, wie ihr wisst, bedeutet ›Schafshügel‹. Jenen Hirten aber war das Glück nicht hold, entdeckten sie doch, dass ihr Ort reich an Diamanten war, und so sind sie heute die Diamantenprinzen, Besitzer der Mine dreiundzwanzig, Besitzer damit der meisten rosa Diamanten der Welt sowie des Großen Tafeldiamanten, den sie im tiefsten Verlies ihrer Bergfeste verwahren, der unzugänglichsten Burg des Landes, noch schwerer einzunehmen als Mehrangarh oben in Jodphur oder Udayagiri gleich hier ein Stück die Straße runter.«
»Eure Saat aber ist besser als Diamanten«, sagte die junge Frau und gab den Brüdern den Sack zurück, den sie ihr überreicht hatten.
»Was? Diese Samen?«, fragte Bukka höchst überrascht. »Aber das ist eine ganz gewöhnliche Mischung, gedacht fürs Gemüsebeet, nur Okra, Bohnen, Schlangengurke.«
Die Prophetin schüttelte den Kopf. »Jetzt nicht mehr«, sagte sie. »Jetzt ist dies die Saat der Zukunft. Eure Stadt wird daraus erwachsen.«
Die zwei Brüder begriffen in diesem Moment, dass sie sich beide wahrhaft, zutiefst und auf immerdar in diese seltsame Schöne verliebt hatten, die ganz offenkundig eine große Zauberin war oder doch zumindest eine von Gott berührte und mit außergewöhnlichen Gaben gesegnete Person. »Man erzählt sich, Vidyasagar hätte Euch den Namen Gangadevi gegeben«, sagte Hukka, »aber wie heißt Ihr wirklich? Das würde ich gern wissen, denn dann kann ich mich mit jenem Namen an Euch erinnern, den Eure Eltern für Euch vorgesehen haben.«
»Geht hin und erschafft die Stadt«, sagte sie. »Sobald sie aus Fels und Stein hervorgesprossen ist, kommt zurück und fragt mich erneut nach meinem Namen. Vielleicht werde ich ihn dann verraten.«
2
Kaum waren die beiden Brüder Sangama am beschriebenen Platz angelangt, verstreuten sie den Samen, im Herzen große Ratlosigkeit mit nur einem kleinen Funken Hoffnung. Anschließend stiegen sie auf einen Berg gewaltiger Findlinge und dornigen, an ihrer Bauerntracht zerrenden Gestrüpps, um sich bei später Nachmittagssonne hinzusetzen und die Augen offen zu halten. Nach wenig mehr als einer Stunde sahen sie die Luft schimmern wie an den heißesten Stunden der heißesten Tage, und da wuchs die Wunderstadt vor ihrem erstaunten Blick heran, aus felsigem Grund keimten die steinernen Gebäude der Stadtmitte, der majestätische Königspalast und auch der erste große Tempel. (Da er aus einem Ort unter der Erdoberfläche auftauchte, wurde er von da an nur der Untergrundtempel genannt, manchmal auch der Affentempel, denn seit dem Moment seines Aufstiegs wimmelte es in ihm von langschwänzigen grauen Tempelaffen jener als Hanuman-Languren bekannten Art, die lauthals schwatzten und die vielen Tempelglocken läuteten; zudem war mit dem Tempel gleich vor dem Tor der Stadt eine gigantische Statue von Gott Hanuman aus dem Boden getrieben.) All dies und mehr wuchs unweit vom Palast und dem Königsbezirk am anderen Ende der langen Marktstraße in altmodischer Pracht heran, während am Rande der Stadt die bescheidenen Lehm-, Holz- und Kuhfladenhütten der einfachen Menschen aus dem Boden sprossen.
(Eine Anmerkung über Affen. Es mag von Nutzen sein, an dieser Stelle zu erwähnen, dass Affen in Pampa Kampanas Erzählung eine wichtige Rolle spielen. Bei diesen frühen Versen fällt der gütige Schatten des mächtigen Gottes Hanuman über die Seiten, und seine Macht und sein Mut kennzeichnen das Reich Bisnaga, den realen Nachfolger des mythischen Kishkindha. Später aber wird man sich anderen, übelwollenden Affen stellen müssen, doch sollen die entsprechenden Ereignisse hier nicht vorweggenommen werden. Wir möchten einzig auf die dualistische, binäre Natur des Affenmotivs in diesem Werk verweisen.)
Zu Anfang war die Stadt noch nicht richtig lebendig. Sich im Schatten der kargen Findlingsberge erstreckend glich sie einer schimmernden, von ihren Bewohnern im Stich gelassenen Metropole. Die Villen der Reichen standen unbewohnt, Anwesen mit steinernem Fundament, auf dem sich anmutige säulengeschmückte Bauten aus Ziegel und Holz erhoben; die überdachten Marktstände waren leer und harrten der Ankunft der Floristen, Fleischer, Schneider, Bader und Weinhändler; im Rotlichtbezirk gab es Bordelle, aber keine Huren, jedenfalls noch nicht. Der Fluss strömte dahin, und die Ufer, an denen man Wäscherinnen und Wäscher vermuten würde, schienen gespannt darauf zu warten, dass etwas geschah, dass Bewegung aufkam, die diesem Ort Bedeutung verlieh. Im Königsbezirk sah das große Elefantenhaus mit seinen elf Gewölbebogen der Ankunft von Stoßzähnen und Dunghaufen entgegen.
Und dann begann das Leben, und Hunderte – nein, Tausende – erwachsene Frauen und Männer wuchsen aus brauner Erde, klopften Sand von ihren Kleidern und strömten in der abendlichen Brise auf die Straßen. Streunende Hunde und knochige Kühe streunten umher, an Bäumen sprossen Blatt und Blüte, und am Himmel schwärmten Papageien und, ja, auch Krähen. Am Ufer wurde gewaschen, königliche Elefanten trompeteten in ihrem Gehege, und an den Toren zum Königsbezirk standen bewaffnete Wachen – Frauen! Jenseits der Stadtgrenze war ein Lager der Armee auszumachen, ein gewaltiges Quartier, in dem sich eine beeindruckende Truppe mehrerer Tausend Frischgeborener aufhielt, mit Waffen und klirrender Rüstung behängt und ausgestattet mit Belagerungsgerät, also mit Sturmböcken, Katapulten und Ähnlichem, sowie mit einer erklecklichen Anzahl von Pferden, Kamelen und Elefanten.
»So muss es sich anfühlen, ein Gott zu sein«, sagte Bukka Sangama mit zittriger Stimme zu seinem Bruder. »Den Schöpfungsakt zu vollziehen, das Einzige, was nur Götter können.«
»Und wir müssen jetzt zu Göttern werden«, sagte Hukka, »damit uns die Menschen verehren.« Er sah zum Himmel auf. »Siehst du«, er zeigte hinauf. »Da ist unser Vater, der Mond.«
»Nein.« Bukka schüttelte den Kopf. »Das kauft uns keiner ab.«
»Der große Mondgott, unser Vorfahr«, sagte Hukka, der ihre Abstammung im Erzählen ersann, »hatte einen Sohn mit Namen Budha. Und ein Familienzweig brachte nach vielen Generationen den Mondkönig der mythologischen Zeit hervor. Pururavas, so hieß er. Der wiederum hatte zwei Söhne, Yadu und Turvasu. Manche behaupten, er hätte fünf gehabt, aber ich finde, zwei sind mehr als genug. Wir jedoch sind die Söhne der Söhne von Yadu und damit Teil jener illustren lunaren Erbfolge, der sogar Gott Krishna höchstpersönlich und auch der große Krieger Arjuna im Mahabharata entstammt.«
»Wir sind gleichfalls fünf«, sagte Bukka. »Fünf Sangamas, genau wie die fünf Söhne des Mondkönigs. Hukka, Bukka, Pukka, Chukka und Dev.«
»Mag sein«, erwiderte Hukka. »Aber ich sage, zwei sind mehr als genug. Unsere Brüder sind keine vortrefflichen Menschen. Sie sind verrufen. Sie sind unwürdig. Und ja, wir müssen uns überlegen, was mit ihnen werden soll.«
»Gehen wir hinab und sehen uns den Palast an«, schlug Bukka vor. »Ich hoffe, es gibt jede Menge Diener und Köche, nicht bloß einen Haufen leerer Staatskammern. Und ich hoffe, es gibt Betten weich wie Wolken und vielleicht sogar einen Frauentrakt mit erwachsenen Gespielinnen von unvorstellbarer Schönheit. Wir sollten feiern, meinst du nicht? Schließlich sind wir keine Kuhhirten mehr.«
»Aber Kühe werden für uns wichtig bleiben«, erklärte Hukka.
»Metaphorisch gesprochen?«, fragte Bukka. »Ich habe jedenfalls nicht vor, je wieder zu melken.«
»Ja«, antwortete Hukka Sangama, »natürlich metaphorisch gesprochen.«
Sie schwiegen beide eine Weile, überwältigt von dem, was sie in Gang gesetzt hatten. »Wenn wie hier etwas aus nichts entstehen kann«, sagte Bukka schließlich, »dann ist in dieser Welt vielleicht alles möglich; und wir könnten wirklich bedeutsame Menschen sein, nur sind dafür auch bedeutsame Gedanken nötig, und für die haben wir keinen Samen.«
Hukkas Überlegungen bewegten sich in eine andere Richtung. »Wenn wir Menschen wie Süßkartoffeln wachsen lassen können«, sinnierte er, »ist es egal, wie viele Soldaten wir in einer Schlacht verlieren, denn wo die herkommen, gibt es noch viele mehr. Folglich werden wir unbesiegbar sein und können die Welt erobern. Diese Tausende sind nur der Anfang. Wir können Aberhunderttausend Bürger nachwachsen lassen, vielleicht eine Million und dazu eine Million Soldaten. Wir haben reichlich Samen übrig, der Sack ist noch mehr als halb voll.«
Bukka dachte über Pampa Kampana nach. »Sie hat viel vom Frieden geredet, nur warum ließ sie uns eine Armee heranziehen, wenn sie Frieden will?«, überlegte er. »Will sie wirklich Frieden? Oder Rache? Für den Tod ihrer Mutter, meine ich.«
»Das liegt nun an uns«, sagte Hukka. »Eine Armee kann ebenso für den Frieden wie für den Krieg sein.«
»Ich frage mich noch etwas«, sagte Bukka. »Diese Menschen da unten, unsere neuen Bürger – ich rede von den Männern –, was glaubst du, sind die beschnitten?«
Hukka dachte über seine Frage nach. »Was willst du machen?«, fragte er schließlich. »Willst du sie bitten, ihre lungis zu öffnen, die Pyjamas runterzuziehen, die Sarongs aufzuwickeln? Hältst du das für einen guten Anfang?«
»Ehrlich gesagt«, erwiderte Bukka, »mir ist es eigentlich egal. Bestimmt gibt es von beidem, und was soll’s.«
»Genau«, erwiderte Hukka. »Was solls.«
»Wenn es dich nicht kümmert, dann kümmert es mich auch nicht«, sagte Bukka.
»Mir doch egal«, erwiderte Hukka.
»Also, wie gesagt, was solls«, bestätigte Bukka.
Sie schwiegen erneut, starrten hinab auf das Wunder und bemühten sich, seine Unbegreiflichkeit zu akzeptieren, seine Schönheit, die Folgen. »Wir sollten runter und uns vorstellen«, meinte Bukka nach einer Weile. »Sie müssen wissen, wer hier das Sagen hat.«
»Nur nichts überstürzen«, erwiderte Hukka. »Ich finde, wir sind beide gerade ein wenig wie von Sinnen, befinden wir uns doch inmitten einer großen Widersinnigkeit. Wir brauchen einen Moment, um das hier zu verkraften und zu Verstand zu kommen. Und zweitens …« Er verstummte.
»Ja?«, drängte Bukka. »Und zweitens?«
»Und zweitens«, fuhr Hukka bedächtig fort, »müssen wir entscheiden, wer von uns beiden zuerst König sein wird und wer an zweiter Stelle kommt.«
»Tja«, sagte Bukka, »ich bin der Klügere.«
»Darüber ließe sich streiten«, sagte Hukka. »Ich aber bin der Ältere.«
»Und ich der Liebenswertere.«
»Auch darüber ließe sich streiten. Doch ich wiederhole: Ich bin der Ältere.«
»Stimmt, du bist alt, dafür habe ich mehr Schwung.«
»Schwungvoll ist nicht dasselbe wie königlich«, sagte Hukka. »Und ich bin immer noch der Ältere.«
»Du sagst das, als wäre es ein göttliches Gebot«, protestierte Bukka. »Der Ältere kommt zuerst. Aber wer sagt das? Wo steht das geschrieben?«
Hukka langte nach dem Knauf seines Schwerts. »Hier«, sagte er.
Ein Vogel flog über die Sonne. Die Erde selbst holte tief Luft. Die Götter, falls es denn welche gab, hielten in ihrem Treiben inne und merkten auf.
Bukka lenkte ein. »Schon gut, schon gut«, sagte er und hob, klein beigebend, die Hände. »Du bist mein älterer Bruder, und ich habe dich lieb, also fängst du an.«
»Danke«, sagte Hukka. »Ich liebe dich auch.«
»Das Nächste aber«, fügte Bukka hinzu, »darf ich entscheiden.«
»Einverstanden«, sagte Hukka Sangama, der jetzt König Hukka war – Hukka Raya I. »Du darfst die Schlafzimmer im Palast aussuchen.«
»Und die Konkubinen«, beharrte Bukka.
»Ja, ja, von mir aus«, sagte Hukka Raya und winkte genervt ab. »Auch die Konkubinen.«
Nach einem Moment der Stille wagte Bukka sich mit großen Gedanken vor. »Was ist der Mensch?«, überlegte er. »Ich meine, was macht uns zu dem, was wir sind? Haben wir alle als Saatgut angefangen, und waren – gehen wir nur weit genug zurück – unsere Vorfahren Gemüse? Oder haben wir uns aus Fischen entwickelt, die Luft zu atmen lernten? Sind wir gar Kühe, die ihre Euter und zwei Beine verloren? Nichts finde ich so verstörend wie das mit dem Gemüse. Ich will nicht herausfinden müssen, dass mein Urgroßvater eine Aubergine war oder eine Erbse.«
»Und doch sind unsere Untertanen Samenkörnern entsprungen«, sagte Hukka kopfschüttelnd. »Also ist die Gemüsevariante wohl die wahrscheinlichste.«
»Für Gemüse ist vieles einfacher«, grübelte Bukka. »Man hat seine Wurzeln, weiß also, wo man hingehört. Man wächst heran und erfüllt seinen Lebenszweck, wenn man sich fortpflanzt und verzehrt wird. Wir aber haben keine Wurzeln, und wir wollen nicht gegessen werden. Wie also sollen wir leben? Was macht das Leben eines Menschen aus? Was ist ein gutes Leben? Was nicht? Wer oder was sind die Tausende, die wir gerade ins Dasein gerufen haben?«
»Die Frage des Ursprungs«, erklärte Hukka bestimmt, »sollten wir den Göttern überlassen. Die Frage aber, auf die wir eine Antwort finden müssen, lautet wie folgt: Jetzt, da wir uns hier oben befinden – und sie, unsere Samenmenschen, dort unten –, wie sollen wir leben?«
»Wären wir Philosophen«, sagte Bukka, »könnten wir darauf philosophisch antworten. Wir sind aber bloß Kuhhirten, die erfolglose Soldaten wurden und plötzlich über sich hinausgewachsen sind, weshalb wir besser daran täten, uns hinabzubegeben und Antworten zu finden, indem wir in dieser neuen Stadt leben und so vielleicht begreifen, wie die Dinge sich entwickeln. Eine Armee ist eine Frage, und die Antwort darauf ist der Kampf. Eine Kuh ist auch eine Frage, und die Antwort darauf besteht darin, die Kuh zu melken. Da unten liegt eine aus dem Nichts aufgetauchte Metropole, und diese Frage ist größer als alle, die uns je gestellt wurden. Vielleicht aber findet sich die Antwort auf die Frage der Stadt, wenn man in ihr wohnt.«
»Also«, sagte Hukka, »sollten wir uns ans Werk machen, ehe unsere Brüder eintreffen und uns womöglich zuvorkommen.«
Dennoch blieben sie wie betäubt auf dem Berg sitzen, schauten regungslos den neuen Menschen in den Straßen der neuen Stadt unter ihnen zu und schüttelten oft ungläubig den Kopf. Fast als fürchteten sie, sich auf jene Straßen zu begeben, ja als hätten sie Angst, das Ganze erwiese sich als eine Art Halluzination, die, gingen sie hinab, verflöge, sodass sie zurückkehren müssten zum Nichts ihres früheren Lebens. Ihr benommener Zustand mag erklären, warum sie nicht bemerkten, dass die Menschen in den neuen Straßen und auch im dahinterliegenden Militärbezirk sich eigenartig verhielten, fast, als wären auch sie ein wenig von Sinnen infolge der Unbegreiflichkeit ihrer plötzlichen Existenz sowie ihrer Unfähigkeit, mit dem abrupten Übergang aus dem Nirgendwo ins Dasein fertigzuwerden. Geschrei wurde laut und Wehklagen, und manch einer wälzte sich am Boden und strampelte mit den Beinen, trat gleichsam Löcher in die Luft, als wollte er sagen: Wo bin ich? Lasst mich hier raus! Auf dem Obst- und Gemüsemarkt bewarfen sich die Menschen mit Ware, und es blieb unklar, ob sie spielten oder ihrer sprachlosen Wut Ausdruck verliehen. Sie waren offenbar nicht in der Lage, das zu fordern, was sie brauchten, ob nun Lebensmittel, eine Zuflucht oder jemanden, der ihnen die Welt erklärte und dafür sorgte, dass sie sich darin sicher fühlten, jemanden, dessen sanfte Worte ihnen die glückliche Illusion gewährte zu verstehen, was sie nicht verstehen konnten. Die Kämpfe im Militärbezirk, wo die neuen Menschen Waffen trugen, waren brutaler, und es kam zu Verletzungen.
Die Sonne sank bereits dem Horizont entgegen, als Hukka und Bukka schließlich vom felsigen Berg hinabstiegen. Abendschatten krochen über die vielen rätselhaften Findlinge, die zuhauf ihren Weg säumten, und beiden war es, als bekämen die Steine menschliche Gesichter und musterten sie wachsam mit leeren Augen, während sie sich zugleich fragten: Was? Diese unscheinbaren Personen wollen eine ganze Stadt zum Leben erweckt haben? Hukka, der bereits königliche Attitüden zeigte wie ein Junge, der die neuen Geburtstagssachen anprobiert, die seine Eltern, während er schlief, ans Fußende seines Bettes gelegt haben, Hukka also zog es vor, die starrenden Steine zu ignorieren, Bukka hingegen bekam Angst, schienen ihnen die Steine doch keineswegs freundlich gesinnt zu sein. Außerdem konnten sie leicht eine Lawine auslösen, die die beiden Brüder unter sich begrub, ehe sie ihre ruhmreiche Zukunft auch nur betreten hatten. Die neue Stadt war von felsigen Bergen dieser Art umringt, bloß entlang des Flussufers nicht, und all die Findlinge auf den Höhen glichen riesigen Köpfen, im Gesicht ein feindseliges Stirnrunzeln, die Münder kurz davor, etwas zu sagen. Doch gaben sie nie ein Wort von sich, Bukka aber machte sich im Geiste eine Notiz. »Wir sind von Feinden umringt«, dachte er, »und wenn wir nicht bald anfangen, für unsere Verteidigung zu sorgen, werden sie auf uns herabdonnern und uns zerquetschen.« Laut aber sagte er seinem Bruder, dem König: »Weißt du, was diese Stadt nicht hat, aber so rasch wie möglich braucht? Mauern. Hohe, dicke Mauern, stark genug, jedem Angriff zu widerstehen.«
Hukka nickte zustimmend. »Lass sie bauen«, sagte er.
Dann gelangten sie in die Stadt und fanden sich, als die Nacht anbrach, in der Morgendämmerung der Zeit wieder, mitten in jenem Chaos, welches der anfängliche Zustand aller neuen Universen ist. Inzwischen war ein Großteil ihrer Zucht eingeschlafen, auf der Straße, auf den Türstufen zum Palast, im Schatten des Tempels. Überall. Außerdem hing ein übler Geruch in der Luft, denn Aberhundert Bürger hatten ihre Kleider beschmutzt. Jene, die nicht schliefen, wirkten wie Schlafwandler, leere Menschen mit leeren Augen, die gleich Automaten durch die Straßen zogen, Obst an Obstständen erstanden, ohne sich dafür zu interessieren, was sie in ihre Taschen packten, oder Früchte präsentierten, ohne auch nur zu wissen, wie die Früchte hießen, oder die an Ständen, welche religiöse Belanglosigkeiten feilboten, Emailleaugen kauften oder verkauften, rosafarben und weiß mit schwarzer Iris, Händler, die diese und viele andere Kleinigkeiten verhökerten, wie man sie bei der täglichen Andacht im Tempel darbringt, obgleich niemand wusste, welche Gottheit diese Opfergaben gern empfing oder warum. Es war jetzt Nacht, selbst im Dunkeln aber kauften und verkauften die Schlafwandler, zogen durch die wirren Straßen, und ihre glasäugige Anwesenheit war beunruhigender als die der stinkenden Schläfer.
Hukka, der neue König, war bestürzt angesichts der Verfassung seiner Untertanen. »Die Hexe hat uns offenbar ein Königreich voller Untermenschen geschenkt«, rief er aus. »Diese Leute sind so hirnlos wie Kühe und haben nicht mal Euter, um uns Milch zu geben.«
Bukka, der Fantasievollere der beiden, tröstete Hukka und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Beruhige dich«, sagte er. »Auch menschliche Babys brauchen Zeit, um auf die Welt zu kommen und eigenständig mit dem Atmen zu beginnen. Und wenn sie denn geboren sind, haben sie keine Ahnung, was sie anfangen sollen, also weinen sie, lachen sie, pinkeln und kacken und warten darauf, dass ihre Eltern sie umsorgen. Ich nehme an, die Ereignisse hier verraten uns, dass die Geburt für unsere Stadt noch nicht abgeschlossen ist und dass all diese Menschen, selbst die Erwachsenen, noch Babys sind, weshalb wir nur hoffen können, dass sie schnell erwachsen werden, da wir keine Mütter haben, die sich um sie kümmern können.«
»Aber wenn du recht hast, was fangen wir dann an mit dieser halbgeborenen Menge?«, wollte Hukka wissen.
»Wir warten«, sagte Bukka, da ihm nichts Besseres einfiel. »Das ist die erste Lektion deiner neuen Königswürde: Geduld. Wir müssen unseren neuen Bürgern – unseren neuen Untertanen – die Zeit lassen, real zu werden und zu ihren neuen Persönlichkeiten heranzureifen. Kennen sie überhaupt schon ihre Namen? Was glauben sie, wo sie herkommen? Wir haben da ein Problem. Vielleicht entwickeln sie sich schon bald. Vielleicht sind sie morgen früh bereits Männer und Frauen, mit denen wir über alles reden können. Bis dahin bleibt uns nichts weiter zu tun.«
Der Vollmond brach aus den Wolken hervor wie ein herabschwebender Engel und badete die neue Welt in seinem milchigen Licht. In dieser mondgesegneten Nacht zu Beginn des Beginns begriffen die Brüder Sangama, dass der Schöpfungsakt nur der erste von vielen notwendigen Akten war, dass auch die machtvolle Magie des Saatgutes nicht ein jedes bewirken konnte, was benötigt wurde. Sie selbst aber waren erschöpft, ermattet von all dem, was sie hervorgebracht hatten, und so machten sie sich auf den Weg in den Palast.
Hier schienen andere Regeln zu gelten. Als sie sich dem gewölbten Tor zum ersten Hof näherten, bemerkten sie ein vollständiges Ensemble von Dienstboten, die wie Statuen verharrten, Stallmeister und Stallknechte stocksteif neben reglosen Pferden, Musiker auf einer Bühne über ihre stummen Instrumente gebeugt und jede Menge Diener und Domestiken, herausgeputzt, wie es sich für jene geziemt, die einem König dienen – kokardierte Turbane, brokadierte Mäntel, Schuhe mit emporgeschwungenen Spitzen, Halsketten und Ringe. Kaum aber hatten Hukka und Bukka das Tor durchschritten, erwachten sie zum Leben, und ein hektisches Treiben setzte ein. Höflinge eilten auf die Brüder zu, um sie zu geleiten, und diese Höflinge waren keine großen Babys wie auf den Straßen der Stadt, sondern erwachsene Männer und Frauen, wortgewandt und klug, die kompetent ihren Pflichten nachkamen. Ein Lakai näherte sich Hukka mit einer Krone auf einem roten Samtkissen, die Hukka sich frohgemut auf den Kopf setzte, wobei er wohlwollend bemerkte, dass sie wie angegossen passte. Er genoss die Aufmerksamkeit des Palastpersonals, als stünde sie ihm zu und sei sein gutes Recht. Bukka aber, der ein, zwei Schritte hinter ihm ging, hing anderen Gedanken nach. Offenbar hat selbst das magische Saatgut Regeln für Regierende und andere für Regierte, grübelte er. Bleiben aber die Regierten renitent, wird es nicht einfach, sie zu regieren.
Die Schlafsuiten waren so prunkvoll, dass die Frage, wer wo schlief, ohne lange Diskussion geklärt werden konnte. Zudem gab es Großkämmerer des Schlafgemachs, die ihnen ihr Nachtgewand reichten und Schränke voll mit herrschaftlicher, ihrer Stellung angemessener Kleidung öffneten. Die beiden Brüder aber waren zu müde, um ihr neues Zuhause genauer in Augenschein zu nehmen oder sich für Konkubinen zu interessieren. Schon nach kurzer Zeit waren sie fest eingeschlafen.
Am Morgen standen die Dinge anders. »Wie gehts der Stadt heute?«, fragte Hukka den Höfling, der in sein Schlafgemach kam, um die Vorhänge zurückzuziehen. Das Individuum drehte sich um, verbeugte sich tief und erwiderte: »Ausgezeichnet, mein Herr, wie seit ihrem Anbeginn. Die Stadt gedeiht prächtig unter Euer Majestät Regierung, heute und immerdar.«
Hukka und Bukka saßen auf und ritten aus, um sich selbst ein Bild von der Lage der Dinge zu machen. Erstaunt sahen sie eine Metropole, die eifrig ihren Geschäften nachging, in der es von Erwachsenen wimmelte, die sich wie Erwachsene benahmen, und Kindern, die ihnen um die Füße rannten, wie man es von Kindern erwartet. Es war, als lebte jedermann schon seit Jahren hier, als wären die Erwachsenen an diesem Ort einst Kinder gewesen, wären herangereift und hätten geheiratet, hätten selbst wiederum Kinder großgezogen und verfügten über Erinnerungen sowie eine Geschichte und wären Teil einer lange bereits bestehenden Gemeinschaft, einer Stadt der Liebe und des Todes, der Tränen und des Gelächters, der Treue und des Verrats oder was immer sonst die menschliche Natur hervorbringt, all dessen, was zusammengenommen die Bedeutung des Lebens ergibt, aus dem Nichts heraufbeschworen durch magisches Saatgut. Der Lärm der Stadt – Straßenhändler, Pferdehufe, das Rattern der Karren, Gesang und Streit – erfüllte die Luft. Im Militärbezirk stand eine formidable Armee bereit und harrte der Befehle ihrer Oberkommandierenden.
»Wie ist das geschehen?«, fragte Hukka seinen Bruder erstaunt.
»Da hast du deine Antwort«, sagte Bukka und zeigte voraus.
In schlichtes, asketisches Safrangelb gewandet, einen hölzernen Stab in der Hand, bahnte sich Pampa Kampana einen Weg durch die Menge, jene Frau, in die sie beide verliebt waren. In ihren Augen loderte ein Feuer, das über zweihundert Jahre lang nicht erlöschen würde.
»Wir haben die Stadt wachsen lassen«, sagte Hukka. »Ihr habt gesagt, sobald das getan sei, könnten wir Euch nach Eurem wahren Namen fragen.«
Also sagte Pampa Kampana ihnen ihren wahren Namen und beglückwünschte sie zugleich. »Ihr habt wohlgetan«, sagte sie. »Die Bewohner der Stadt brauchten nur noch jemanden, der ihnen ihre Träume ins Ohr flüsterte.«
»Sie haben eine Mutter gebraucht«, sagte Bukka. »Jetzt haben sie eine, und alles klappt wie am Schnürchen.«
»Die Stadt braucht eine Königin«, sagte Hukka Raya I. »Pampa wäre ein guter Name für eine Königin.«
»Ich kann keine Königin einer namenlosen Stadt sein«, erwiderte Pampa Kampana. »Wie soll sie also heißen, diese eure Stadt?«
»Ich will sie Pampanagar nennen«, sagte Hukka. »Denn Ihr habt sie erschaffen, nicht wir.«
»Das wäre eitel«, sagte Pampa Kampana. »Wählt einen anderen Namen.«
»Na gut, dann Vidyanagar«, sagte Hukka. »Nach dem großen Weisen. Die Stadt der Weisheit.«
»Er würde das gleichfalls ablehnen«, sagte Pampa Kampana. »Ich spreche mich in seinem Namen dagegen aus.«
»Dann weiß ich nicht weiter«, sagte Hukka Raya I. »Vielleicht Vijaya?«
»Sieg«, sagte Pampa Kampana. »Die Stadt ist ein Sieg, wohl wahr. Nur weiß ich nicht, ob es wirklich klug ist, sich damit zu brüsten.«
Und so blieb die Frage des Namens ungelöst, bis der stammelnde Fremde in die Stadt kam.
3
Der portugiesische Besucher traf am Ostersonntag ein. Sein Name lautete passenderweise gleichfalls Sonntag – Domingo Nunes –, und er war schön wie das Licht des Tages, die Augen grün wie das Gras zur Morgendämmerung, das Haar rot wie die untergehende Sonne; außerdem hatte er einen Sprachfehler, der ihn für die Bewohner der Stadt noch liebenswerter machte, erlaubte ihm dieses Handicap doch, jene Arroganz der Weißen zu meiden, die diese gewöhnlich an den Tag legten, sobald sie es mit Dunkelhäutigen zu tun bekamen. Er verdiente sein Geld mit Pferden, die aber eigentlich nur einen Vorwand lieferten, da seine wahre Liebe dem Reisen galt. Er hatte die Welt gesehen, von Alpha bis Omega, von oben bis unten, hatte gegeben und genommen, verloren und gewonnen, aber auch gelernt, dass, wo immer er hinkam, die Welt eine Illusion war und dass das gut so war. Er hatte Fluten und Feuer überstanden und war manches Mal nur um Haaresbreite mit dem Leben davongekommen; er hatte Wüsten gesehen, Steinbrüche, Felsen und Berge so groß, dass sie den Himmel berührten. Zumindest behauptete er das. Er war in die Sklaverei verkauft und daraus befreit worden, nur um gleich wieder auf Reisen zu gehen und die Geschichte seiner Fahrten all jenen zu erzählen, die sie hören wollten, und es waren beileibe keine Geschichten der langweiligen, gewöhnlichen Art, keine Berichte über die Alltäglichkeit der Welt, sondern über ihre Wunder, ja Geschichten, die darauf beharrten, dass das menschliche Leben nicht banal, sondern außergewöhnlich war. Und als er diese neue Stadt betrat, wusste er gleich, sie war eines der größten Wunder, eines, das sich nur mit den ägyptischen Pyramiden vergleichen ließ, mit den Hängenden Gärten von Babylon, dem Koloss von Rhodos. Und so kam es, dass er sich, kaum waren die Pferde verkauft, die er dem Stallmeister im Militärbezirk aus dem Hafen von Goa gebracht hatte, dorthin begab, wo vor ungläubigen Blicken die goldene Stadtmauer erstand – über diesen Besuch schrieb er später in sein Tagebuch, aus dem Pampa Kampana in ihrem Werk zitiert. Vor seinen Augen erwuchs die Mauer aus der Erde, höher von Stunde zu Stunde, glatt geschliffene Steine tauchten aus dem Nichts auf und fügten sich nahtlos ein und makellos übereinander, ohne dass irgendwo Steinmetze oder Arbeiter zu sehen gewesen wären, was doch gewiss nur dank eines nahen großen Okkultisten möglich sein konnte, der die Befestigung mit einem gebieterischen Wink seines Zauberstabs ins Dasein rief.
»Fremder! Komm her!« Domingo beherrschte die Sprache des Landes gut genug, um zu verstehen, dass er angesprochen wurde, verächtlich, mit kaum einem Hauch von Höflichkeit. Im Schatten des Torhauses, das sich zwischen Stadt und Militärbezirk erhob und dessen Zwillingstürme sich höher und höher hinauf in den Himmel schraubten, teilte ein kleiner Mann die Vorhänge seiner hochherrschaftlichen Sänfte und rief: »Du da! Fremder! Zu mir!«
Der Mann war entweder ein ungehobelter Klotz oder ein Fürst oder beides, dachte Domingo Nunes und beschloss, auf Nummer sicher zu gehen. Also vergalt er Unhöflichkeit mit Höflichkeit, sagte: »Euer Die-Die-Diener, mein Herr«, und verbeugte sich tief, was Kronprinz Bukka sehr beeindruckte, war er es doch noch nicht gewohnt, jemand zu sein, vor dem sich Fremde verneigten.
»Ist Er dieser Pferdekerl?«, fragte Bukka nicht minder ungehobelt. »Mir wurde gesagt, es sei ein Rosstäuscher in der Stadt, der nicht richtig reden könne.«
Domingo Nunes gab eine verblüffende Antwort. »Ich verdiene mein Gell-Gell-Geld mit Klä-Klä-Kleppern«, sagte er, »bin aber i-i-insgeheim wer, de-de-der sich genö-nö-nötigt fühlt, die Welt zu berei-rei-reisen und von ihr ku-ku-kund-zu-tun, damit andere erfahren, wie sie so ist.«
»Keine Ahnung, wie Er Geschichten erzählen will«, sagte Bukka, »wenn Er kaum seine Sätze zu Ende bringt. Komm Er, setze Er sich zu mir. Mein Bruder, der König, und ich, wir würden nichtsdestotrotz gern Seinen Geschichten lauschen.«
»Vorher aber«, wagte Nunes einzuwerfen, »mu-mu-muss ich das Geheimnis dieser ma-ma-magischen Mauer erfahren, des grö-grö-größten Wunders, das ich je sah. Wer ist der Zau-Zau-Zauberer, der dies zuwege bringt? Ich möchte ihm die Ha-Ha-Hand schütteln.«
»Steig Er ein«, sagte Bukka und rückte beiseite, um in der Sänfte Platz für den Fremden zu machen, während die Sänftenträger versuchten, sich nicht anmerken zu lassen, was sie von dieser zusätzlichen Last hielten. »Ich stelle Ihn der Stadtflüsterin vor, der Spenderin des Saatgutes. Ihre Geschichte verdient es, nah und fern erzählt zu werden. Und Er wird sehen, dass auch sie ein Garn zu spinnen weiß.«
Es war ein kleiner Raum, anders als alle übrigen Räume im Palast, nicht im Mindesten bequem, nur nackte Wände, weiß verputzt, und bis auf einen schlanken, schlichten Holzklotz unmöbliert. Ein schmales hohes Fenster gestattete einem einzigen Sonnenstrahl, in steilem Winkel auf die junge Frau herabzufallen und sie in ein Licht engelsgleicher Anmut zu hüllen. In dieser kargen Umgebung also saß sie, erhellt von einem Schaft verblüffenden Lichts, saß da mit überkreuzten Beinen, die Augen geschlossen, die Arme ausgestreckt, ruhend auf ihren Knien, Daumen und Zeigefinger der Hände zu einem Kreis geschlossen, die Lippen leicht geöffnet: Pampa Kampana, versunken in der Ekstase der Kreation. Sie schwieg, doch für Domingo Nunes, den Bukka Sangama vor sie brachte, war es, als entströmte ihren geöffneten Lippen eine große Woge geflüsterter Worte, überflutete ihr Kinn, ihren Hals, rann ihr über die Arme und über den Boden, ihr entsprungen wie ein Fluss der Quelle entspringt, um sich hinaus in die Welt zu ergießen. Die geflüsterten Worte waren so leise, dass sie kaum verständlich waren, und einen Moment lang sagte sich Domingo Nunes, er bilde sie sich ein oder wolle sich selbst nur eine okkulte Geschichte erzählen, um dem Unmöglichen, das er sah, einen Sinn zu verleihen.
Dann flüsterte Bukka Sangama ihm ins Ohr. »Er kann es hören, ja?«
Domingo Nunes nickte.
»So sitzt sie zwanzig Stunden am Tag«, sagte Bukka. »Dann öffnet sie die Augen, isst ein wenig, trinkt auch, schließt erneut die Augen und schläft drei Stunden. Anschließend erhebt sie sich und beginnt von vorn.«
»Aber was ma-ma-macht sie de-de-denn da?«, fragte Domingo Nunes.
»Er kann sie fragen«, sagte Bukka leise. »Denn dies ist die Stunde, in der sich ihre Augen öffnen.«
Prompt schlug Pampa Kampana die Augen auf und sah den schönen jungen Mann, der sie glühend vor Bewunderung betrachtete. Im selben Moment wurde die Sache mit ihrer bevorstehenden Heirat, erst mit Hukka Raya I. und nach dessen Tod womöglich mit Kronprinz Bukka (je nachdem, wer von den beiden wen überlebte), um einiges komplizierter. Er brauchte nichts zu sagen. »Ja«, gab sie zur Antwort auf seine ungestellte Frage, »ich erzähle Euch alles.«
Sie hatte endlich die Tür zu jenem geschlossenen Raum geöffnet, der die Erinnerungen an ihre Mutter und an ihre frühe Kindheit enthielt; und alles war hinausgeströmt und hatte sie mit Kraft gefüllt. Sie erzählte Domingo Nunes von Radha Kampana, der Töpferin, die ihr beigebracht hatte, dass Frauen in der Kunst des Töpferns so gut wie Männer sein können, dass sie in allem so gut wie Männer sein können; und sie erzählte, wie der Tod ihrer Mutter in ihr eine Leere hinterließ, die sie nun zu füllen suchte. Sie beschrieb das Feuer und die Göttin, die durch ihren Mund gesprochen hatte. Sie erzählte von dem Saatgut, das am Ort ihres Unglücks diese Stadt wachsen ließ. Doch für jede neue Gegend, an der Menschen zu leben beginnen, braucht es eine Weile, bis sie sich real anfühlt, sagte sie, das kann eine Generation oder länger dauern. Die ersten Menschen tragen Bilder der Welt in ihrem Gepäck, Dinge von anderswo füllen ihren Kopf, die neue Gegend aber fühlt sich seltsam an, und es fällt ihnen schwer, daran zu glauben, auch wenn sie nirgendwo anders hinkönnen und nirgendwo anders sein wollen. Sie machen das Beste draus, und sie beginnen zu vergessen; manches erzählen sie der nächsten Generation, den Rest vergessen sie, und die Kinder vergessen noch mehr und ändern das eine oder andere in ihrem Kopf, doch wurden sie hier geboren, und darauf kommt es an, sie sind von diesem Ort, sie sind dieser Ort und der Ort ist sie, und ihre sich verzweigenden Wurzeln geben dem Ort die Nahrung, die er braucht für die Blumen, die Blüten, die Leben, sodass dann, wenn die Ersten wieder gehen, sie zufrieden in dem Wissen dahinziehen, etwas begonnen zu haben, was fortdauern wird.
Den kleinen Bukka erstaunte ihre Redseligkeit. »Sie sagt sonst nie so viel«, erklärte er perplex. »Als sie noch klein war, hat sie neun Jahre lang nicht gesprochen. Pampa Kampana, warum redet Ihr plötzlich so viel?«
»Wir haben einen Gast«, sagte sie und sah dabei in die grünen Augen von Domingo Nunes, »und wir sollten dafür sorgen, dass er sich hier zu Hause fühlt.«
Alle entstammten einem Samenkorn, erzählte sie. Männer pflanzten ihren Samen in Frauen, schon klar, das hier aber war anders. Eine ganze Stadt, Menschen aller Art und jeden Alters, am selben Tag der Erde entsprossen, solche Blumen haben keine Seele, sie wissen nicht, wer sie sind, denn in Wahrheit sind sie nichts. Diese Wahrheit aber ist kaum hinnehmbar. Es wurde notwendig, sagte sie, etwas zu tun, um diese Vielzahl von ihrer Unwirklichkeit zu heilen. ›Fiktion‹ lautete die Lösung. Sie erfand ihre Leben, ihre Kaste, ihren Glauben, sagte ihnen, wie viele Geschwister sie hatten, welche Spiele sie als Kinder spielten; und flüsternd schickte sie ihre Geschichten durch die Straßen in die Ohren jener, die sie hören mussten, schrieb das große Narrativ der Stadt, schuf ihre Historie, nachdem sie ihr Leben geschaffen hatte. Manche Geschichten entstammten ihren Erinnerungen an das verlorene Kampili, an die abgeschlachteten Väter, die verbrannten Mütter, und sie versuchte, jenen Ort an diesem Ort wiederzubeleben, die alten Toten in den neuen Lebenden wiederauferstehen zu lassen, aber Erinnerungen allein genügten nicht, es gab zu viele Leben, die belebt werden mussten, und so übernahm die Fantasie, wo die Erinnerung versagte.
»Meine Mutter hat mich verlassen«, sagte sie, »ich aber werde die Mutter aller sein.«
Domingo Nunes verstand nicht viel von dem, was sie ihm sagte. Plötzlich aber hörte er ein Flüstern, hörte es nicht mit den Ohren, sondern irgendwie mit dem Hirn, ein Wispern, das sich um seine Kehle wand, das Knoten in ihm löste, ordnete, was verknäult gewesen war, und seine Zunge befreite. Es war zugleich beglückend und erschreckend, und er merkte, wie er sich mit der Hand an die Kehle fuhr, sie umklammerte und wie er schrie: Aufhören. Weitermachen. Aufhören.
»Das Geflüsterte weiß, was Ihr braucht«, sagte Pampa Kampana. »Die neuen Menschen brauchen Geschichten, die ihnen sagen, was für Menschen sie sind, ob ehrlich, unehrlich oder beides zugleich. Bald wird die ganze Stadt Geschichten haben, Erinnerungen, Freundschaften, Rivalitäten, denn wir können keine ganze Generation lang warten, bis die Stadt ein realer Ort wird. Wir müssen jetzt handeln, damit ein neues Reich entsteht, damit die Stadt des Sieges über das Land herrschen und dafür sorgen kann, dass es nie wieder ein Gemetzel gibt, vor allem auch dafür, dass keine Frauen mehr in Feuerwände gehen müssen und dass alle Frauen besser behandelt werden als Waisen im Dunkeln, ausgeliefert der Gnade der Männer. Ihr aber«, fügte sie hinzu, und es klang wie ein Nachsatz, dabei war es das, was sie eigentlich sagen wollte, »Ihr habt anderes gebraucht.«
»Heute ist der Tag der Wiederauferstehung«, sagte Domingo Nunes, ohne zu stocken. »Ele ressuscitou, wie wir in meiner Sprache sagen. Er ist auferstanden. Doch ich sehe, dass die Person, die Ihr wiederauferstehen lassen wollt, jemand anderes ist, jemand, die Ihr geliebt habt und die ins Feuer ging. Ihr gebraucht Magie, um eine ganze Stadt zum Leben zu erwecken, und das in der Hoffnung, dass dieser Mensch zurückkehrt.«
»Sein Sprachfehler«, sagte Bukka Sangama. »Wo ist er hin?«
»Sie hat mir ins Ohr geflüstert«, sagte Domingo Nunes.
»Willkommen in Vijayanagar«, sagte Pampa Kampana. Sie sprach das v fast wie ein b aus, so wie es öfter passiert.
»Bizana …?«, wiederholte Domingo Nunes. »Tut mir leid. Wie habt Ihr sie genannt?«
»Sagt erst vij-aya, Sieg«, wies Pampa Kampana ihn an. »Dann sagt nagar, Stadt. Ist gar nicht so schwierig. Nag-gar. Vijayanagar. Stadt des Sieges.«
»Meine Zunge kann diese Laute nicht bilden«, gestand Domingo Nunes. »Und das nicht länger wegen eines Sprachfehlers. Aus meinem Mund klingt es einfach nur nicht so wie aus Eurem.«
»Wie möchte Eure Zunge denn die Stadt nennen?«, fragte Pampa Kampana.
»Bij… Biz… das vorweg, Bis… und danach, an zweiter Stelle … nagá«, sagte Domingo Nunes. »Was zusammen – und besser bekomme ich es nicht hin – Bisnaga ergibt.«