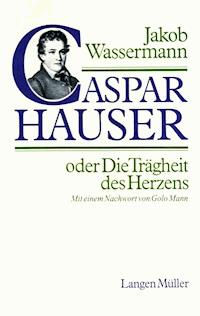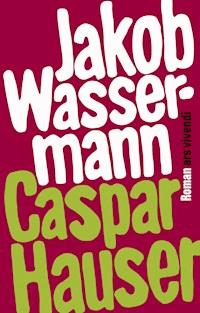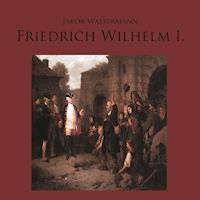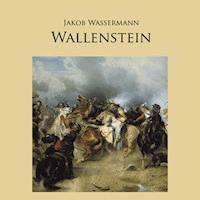Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchem Leser ist der Arzt und Psychiater Joseph Kerkhoven aus dem Roman "Etzel Andergast" bekannt. Kerkhovens Geschichte wird hier bis zu seinem Lebensende weitererzählt. Nachdem Kerkhovens Ehefrau Marie dem Gatten untreu gewesen war, kommt es zu der erneuten Annäherung und Versöhnung des Paares. Kerkhoven, dessen ehrgeiziges Forschungsprojekt die Untersuchung menschlicher Wahnwelten ist, zählt zu seinen Patienten auch den Schriftsteller Alexander Herzog. Kerkhoven hat ein Rezept gegen die schwere Nervenkrise Herzogs: Der Autor soll seine Ehegeschichte aufschreiben. Daraus wird ein umfänglicher Roman im Roman. Mit dem Text kann Herzog das Nervenleiden aber nicht überwinden. Der Patient zieht mit der zweiten Ehefrau Bettina in Kerkhovens Anstalt ein. Herzog und Marie einerseits sowie Kerkhoven und Bettina andererseits kommen einander menschlich näher. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 974
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Kerkhovens dritte Existenz
Jakob Wassermann
Inhalt:
Joseph Kerkhovens dritte Existenz
Erstes Buch - Das biologische Gewissen
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Zweites Buch - Alexander und Bettina
Ganna oder die Wahnwelt
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Drittes Buch - Joseph und Marie
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Nachwort
Joseph Kerkhovens dritte Existenz, Jakob Wassermann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849619398
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Jakob Wassermann – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 10. März 1873 in Fürth, gestorben am 01.01.1934 in Altaussee/Steiermark. Wassermann machte nach Absolvierung der Realschule notreiche Wanderjahre durch und lebte lange in Wien, dem Kreise Schnitzlers und Hofmannsthals nahe stehend. Er schrieb die Romane: »Melusine« (Münch. 1896), »Die Juden von Zirndorf« (das. 1897, neubearbeitete Ausg. 1906), »Die Geschichte der jungen Renate Fuchs« (Berl. 1900, 9. Aufl. 1906), »Der Moloch« (das. 1902), »Alexander in Babylon« (das. 1904) und »Caspar Hauser« (Stuttg. 1908); ferner die Novellen: »Schläfst du, Mutter?« (Münch. 1897), »Die Schaffnerin« u. a. (das. 1897). »Der niegeküßte Mund. Hilperich« (das. 1903), »Die Schwestern« (Berl. 1906) und die theoretische Schrift »Die Kunst der Erzählung« (das. 1904). Weitere Werke sind z.B. "Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens" (Roman, 1908), "Das Gänsemännchen" (Roman, 1915), "Christian Wahnschaffe" (Roman, 1919), "Laudin und die Seinen" (Roman, 1925) und "Der Fall Maurizius" (Roman, 1928). W. zeichnet sich durch moderne Auffassung und scharfe Beobachtung des Lebens aus.
Joseph Kerkhovens dritte Existenz
Erstes Buch - Das biologische Gewissen
1
Als Joseph Kerkhoven an dem tragischen Frühherbsttag des Jahres 1929 hilflos zusammenbrach, weil er entdeckt hatte, daß die Frau, die er liebte, ihn mit dem jungen Freund und Schüler Etzel Andergast, dem er ungemessenes Vertrauen geschenkt, hintergangen hatte, daß also die beiden teuersten Menschen der Welt zu Betrügern an ihm geworden waren, sah er zunächst keine Möglichkeit, das gewohnte Leben weiterzuführen.
Was ihn so grausam hinwarf, war der unerwartete Überfall auf seine Person, die er seit einer Reihe von Jahren den Angriffen des Schicksals entzogen wähnte. Tagtäglich bedrängt von unendlicher Menschennot, hatte er seiner selbst nach und nach vergessen. Daß es auch ihn einmal packen und niederschlagen könne, war im Programm nicht vorgesehen. Das Schicksal war ihm zu einem Kollektivbegriff geworden. Damit war eine starre und, wie er jetzt zu spät erfuhr, trügerische Sicherheit über ihn gekommen, wie wenn privates Unglück, persönliches Leiden, individueller Schmerz für ihn nicht mehr existierten. Für andere Menschen wirkend und ihnen ausschließlich hingegeben, hatte er sich so weit von sich entfernt, daß der Mann und Mensch Kerkhoven zuletzt nur noch vom äußerlichen Mechanismus des Daseins bewegt wurde. Er hatte so lange über den Geschicken gelebt und sie regiert, daß er nicht mehr wußte, wie es ist, wenn man selber unter die Räder kommt. Er hatte nun Gelegenheit, über den Unterschied nachzudenken, der zwischen einer Wunde besteht, die man als Arzt behandelt, und einer, an der man verblutet.
2
Es klingt unglaubhaft, dennoch war es so: Erst im Augenblick der Katastrophe erkannte er, daß das, was ihn mit Marie verband, an die Wurzeln seiner Existenz ging. So, als ob Marie und das Verhältnis zu ihr mit seinem vorzeitlichen Sein zu tun und er ahnungslos darüber hinweggelebt habe. Aber ist dies nicht eine der gewöhnlichsten Unterlassungen, deren sich die Menschen schuldig machen? Sollte man sich deswegen schon als Missetäter fühlen? Man muß sich mit den Umständen vertragen und die Geschehnisse als Folgeerscheinungen des eigenen Charakters betrachten.
Desungeachtet hätte es vielleicht ein schlimmes Ende mit ihm genommen, wäre er in den Tagen des ersten Schocks allein gewesen. Nicht als hätte er Hand an sich gelegt, dazu waren sein Selbsterhaltungsinstinkt, seine Gabe, Werte gegeneinander abzuwägen, zu groß; jedoch eine innere Zersetzung, etwas wie Fäulnis des Lebensmarks, wäre sicherlich eingetreten. Aber die Frage: wie soll man weiterleben, wie soll man es überleben, solchen Verrat, solchen Einsturz alles Vertrauens, diese Frage führte ihn unmittelbar zu Marie zurück. Es war, wie wenn man bei einer Wanderung den Genossen verloren hat und erschrocken umkehrt, ihn zu suchen, auch wenn man bemerkt, daß einen dieser in einen Hinterhalt gelockt hat. Zudem: man war Arzt; man hatte, ohne Rücksicht auf sich selbst, an Hilfeleistung zu denken. Denn das Bild, das ihm Marie darbot, war das der vollkommenen Zerrüttung.
3
Er wollte nicht richten, er wollte wissen. Zunächst erfüllte ihn nur die qualvolle Begierde, zu erfahren, wie und wann sie sich verloren hatte. Diese Auffassung des Sichverlorenhabens wirft ein bezeichnendes Licht auf die Gemütslage eines Mannes, der unter anderen Umständen nicht daran gedacht hätte, sich moralisch aufzulehnen. Sie war der Beginn eines verhängnisvollen inneren Konflikts. Und Marie, verwirrt in Herz und Seele, empfand die Geständnisse, zu denen er sie fanatisch drängte, als Erleichterung und als Vergeltung.
Es muß aus ihr heraus, sonst vergeht sie in Scham, Bitterkeit, Zerknirschung und Verzweiflung. Und in Sehnsucht, das ist das Schreckliche, in Sehnsucht nach dem, der sie verlassen hat und geflüchtet ist, man weiß nicht wohin. Nicht dem Gatten erschließt sie sich mit der Schonungslosigkeit der Selbstzüchtigerin, dem Freund wirft sie sich hin, dem einzigen Menschen auf der Welt, der das Geschehene begreifen muß. Das verlangt sie von ihm mit der Naivität, die allen Seelenkranken eigen ist: Daß er nicht mit ihr rechte, daß er sich selbst und seinen Schmerz hintanstelle, daß sie zu ihm aufsehen und sich alles vom Herzen reden kann, was sie peinigt und bedrückt. Sie ist schuldig, maßlos schuldig, aber sie kann es nur zugeben, wenn er sie nicht für schuldig erklärt.
Es ist nicht mehr die Marie, die er kennt oder zu kennen geglaubt hat. Es ist eine Frau, die ihr einmaliges, unwiderrufliches Sinnen- und Blutserlebnis gehabt hat, und dieses gibt sie nicht preis. Ihre Person gibt sie preis; gut, du kannst mit mir machen, was du willst, scheint sie zu sagen, jag mich auf und davon, nimm mir die Kinder weg, nenn mich Betrügerin und Lügnerin: ja, ja, ja: das Erlebte gibt sie hingegen nicht preis.
Kerkhoven steht vor einem Rätsel. Er meint doch einigen Einblick zu haben in die Dämonien der Seele, aber was hier vorgeht, kann er nicht ergründen. Es ist wohl die Gebundenheit an sie, die Liebesnähe, die unsichtbare Nabelschnur zwischen ihr und ihm, die ihn so ratlos machen. Sie ist zu tief hinuntergestürzt, denkt er, ich kann sie nicht erreichen. Den eigenen Sturz nimmt er plötzlich nicht mehr wahr oder vergißt ihn, weil es ihn tröstet, daß er die Haltung dessen vortäuschen kann, der sich hinabbeugt. Und sie läßt sich auf das Spiel ein und fleht mit gefalteten Händen zu ihm empor, er möge sie hinaufziehen. Er hat nicht die Kraft. Noch nicht. Er will wissen. Zuerst muß er alles wissen. Im Wissen steckt eine erlösende Mitverschuldung.
4
Auch jetzt verschmäht Marie alles, was nach Sündenbekenntnis aussieht.
Hat er nicht bemerkt, wie sie in ihrer Ehe vereinsamt ist, wie ihr das Gefühl abhanden kam, einen Gefährten zu haben? Wie sie neben ihm gegangen ist, hinter ihm, um ihn herum, immer in der Hoffnung, er werde sich ihr wieder zuwenden? Wie sie sich von einem Monat auf den andern vertröstet hat, von einem Jahr aufs andere, und wie das ungestillte Bedürfnis nach und nach ihr Gemüt in Aufruhr gebracht hat? Hat er es wirklich nicht geahnt? Wo ist er denn um Gottes willen gewesen? Tausendmal hat sie sich gefragt, wo er denn sei, hat sich Unbescheidenheit und Selbstsucht vorgeworfen, hat sich seiner großen Aufgaben erinnert, des Helferberufs, der ihn aufgefressen, so daß nichts mehr von ihm übrig war als ein Name und eine Funktion, ein Logiergast im Hause, für dessen Mahlzeiten und gemachtes Bett man sorgen muß und der allem Leben Einlaß in sein Inneres gewährt, dem unwertesten noch, nur dem einen nicht, das dicht neben ihm verkümmert. Wie war das möglich?
Kerkhoven kann nicht leugnen, daß es so gewesen ist. Er war ihrer zu sicher. Die Sicherheit hat bewirkt, daß ihm Marie zu einem lebendigen Hausrat geworden war, der unverrückbar an seinem Platz verbleibt und keiner besonderen Mühewaltung mehr bedarf. Die Anklage besteht zu Recht. Es wird ihm klar, daß es in jedem wahrhaften menschlichen Bund die Todsünde ist, sich sicher zu fühlen und mit der Sicherheit zu beruhigen. Immerhin glaubt er Anspruch auf Milderungsgründe zu haben. Seinen Pflichten und Erfüllungen war eine Grenze gesetzt. Ein strenges Leben. Die Gewalt der Tatsachen hat den Gatten wie auch den Vater daraus verdrängt. Unseliger Irrtum, daß er sich eingebildet hat, von Marie gebilligt und gestützt zu sein. Daß er sie willens geglaubt, auf Privatleben und Privatglück zu verzichten.
5
Das ist die Gegenanklage. Sie enthält Bitterkeit genug, obgleich sie schonend verhüllt ist. Was nützt aber die Verhüllung, wenn jedes Wort bedeutet: Du hast mich verraten ...? Das trifft Marie schwer. Wenn es wahr wäre, könnte sie sich nie mehr entsühnen. Es ist nicht wahr. Bis zum letzten Augenblick hat sie sich mit aller Kraft gegen diese Leidenschaft gewehrt. »Verrat! Joseph! Wenn du wüßtest!« – »Wenn ich was wüßte?« – »Es hat nichts mit dir und mir zu tun. Hat nie mit meiner Liebe zu dir zu tun gehabt.« – »Das sagst du dir vor. Es erscheint dir jetzt so.« – »Nein. Du warst unser Schutzgeist, meiner und seiner, von Anfang an, auf Schritt und Tritt.« – »Ich weiß, ich weiß. Es hat ihm beliebt, eine Heiligenfigur aus mir zu machen, um sich aus seinen menschlichen Verpflichtungen herauszuschwindeln. So wie manche Einbrecher beten, bevor sie einbrechen. Aber du, Marie, du!«
Sie vermag zunächst nicht zu antworten. Es dünkt ihr zu töricht, was er sagt. Es ist so entgegen seinem Sinn und seiner Art, daß sie ihn erstaunt anschaut. Dann erinnert sie ihn schüchtern daran, wie sie auf ihn gewartet hat. Wie sie ihm Zeichen gegeben und er nichts gesehen hat. Wie sie ihn gerufen und er nicht gehört hat. Nicht nur nicht gehört, ihn hat er geschickt, eben diesen Etzel, statt selber zu kommen – »hast du es vergessen?« – hat er den Brief vergessen, worin sie ihm schrieb, sie wolle nicht mehr allein sein, sie wolle den Mann haben, den ihr das Schicksal zugedacht, nicht den Arzt, nicht sein Werk, nicht seinen Ruhm, nicht seine abgegeizten Viertelstunden, nicht seine umwölkte Stirn und seine anderswo weilenden Augen, ihn, ihn ganz, mit Haut und Haar und Herz und Atem. »Joseph, Joseph, hast du's denn vergessen, war's nicht deutlich genug, daß ich dir schrieb, es ist was in mir, das verzehrt mich, ich streck' die Arme aus, zu fassen, zu halten, an mich zu drücken, ich verdurste, ich verbrenne ... ? Verzeih, wenn man es laut wiederholt, klingt es vielleicht geschraubt, aber so hab' ich's gefühlt, und es war eine Krise. Und was hast du getan? Nicht vom Fleck hast du dich gerührt. Und als dann dein Beauftragter kam, dein Jünger, um mich – ja, was sollte er – auf andere Gedanken sollte er mich wahrscheinlich bringen. – Ja, Mann, Mensch, hab' ich da nicht glauben müssen, du wolltest Ruhe haben vor mir und meiner Liebe? Hast du mich denn nicht mit aller Gewalt hineingestoßen? War's ein Verbrechen, zu denken, du wünschtest dir, was weder er noch ich zu denken gewagt hatten?«
Sie zittert am ganzen Körper. Ihre Beredsamkeit ist entschieden krankhaft. Sie kämpft um ihn und kämpft um sich. Das Gesicht zwischen den Händen, sieht sie ihn verstört an. Kerkhoven versucht, den harten Griff ihrer Hände zu lockern, die Finger von den Wangen abzulösen. »Ich dachte, du hättest die Kinder«, bringt er mühselig heraus; »du bist doch Mutter. Ich hielt dich für eine richtige Mutter ...« Ihr Aufschluchzen erschreckt ihn. »Daß man Mutter ist, kann nicht für alles herhalten«, erwidert sie mit verzweifeltem Halblachen; »du weißt so gut wie ich, daß daraus der Zwinger wird, in den man eine Frau steckt, um sie unschädlich zu machen. Mutter, Hausfrau, Wirtschafterin, was du willst, aber man kann doch nicht als Witwe leben mit siebenunddreißig Jahren und einem Mann aus Fleisch und Blut. Das mußt du doch verstehen.«
Er versteht nur allzu gut, obschon er eine so hemmungslose Offenheit nie von ihr erwartet hat. Er ist wie vor den Kopf geschlagen. Was hätte es genützt, zu sagen: Hundert Leidende haben mir den Weg zu dir verrammelt, die Nöte, die sie mir ins Ohr schrien, haben deine Stimme übertönt ...? Und wären es tausend, wären's Millionen gewesen, da lag der eine Mensch zertrümmert vor ihm, der ihn vergeblich gerufen hatte und der auf der Waage der Geschicke auf einmal schwerer wog als eine Welt.
6
Hauptsächlich muß er ihr die Überzeugung einflößen, daß er Zeit für sie hat, unbeschränkt viel Zeit. Er sagt seine Ordinationen ab, läßt mitteilen, er sei krank, läßt Arbeit Arbeit sein, antwortet widerwillig auf Telegramme und Telefonalarm, kurz, was ihm noch vor wenigen Tagen als undurchführbar erschienen wäre, ist selbstverständlich geworden: Er hat für nichts und niemand mehr Interesse als für Marie; wenn er sich in einem dringenden Fall entschließt, einem Ruf zu folgen und nach Berlin zu fahren, ist er nach zwei Stunden wieder zurück.
Vom Morgen bis in die Nacht ist er bei ihr. Verläßt er das Zimmer so bekommt sie Anfälle von Schwindel, Übelkeit und Frost, und zwar in einem Grad, daß ihr die Zähne im Mund klappern wie Steine in einer Schachtel und die Eingeweide sich winden wie Würmer. Nur nicht allein sein; laß mich nicht allein, bettelt sie mit aufgehobenen Händen, und folgt ihm in sein Schlafzimmer, sein Bücherzimmer, in den Garten, obwohl sich beim Gehen alles um sie dreht. Wenn er sie beschwört, zu Bett zu gehen, tut sie es erst, nachdem er versprochen hat, bei ihr zu bleiben. Auch des Nachts will sie nicht allein sein. Sie läßt sein Bett neben ihres stellen. Sie hängt mit den Blicken an ihm. Ihr ist, als dürfe sie ihn nicht eine Sekunde lang aus den Augen verlieren. Nur so lange sie ihn im Auge behält, dünkt ihr, kann er nicht etwas tun oder denken oder empfinden, was ihn von ihr entfernt. Am meisten bangt ihr vor seinen heimlichen Gedanken.
Ohne Schlafmittel kann sie nicht schlafen. Der Schrecken der Schrecken ist das Erwachen am Morgen. Mit dem Erwachen kommt die Angst. Angst ist ein Wort, das den Menschen locker auf der Zunge sitzt, aber wenige kennen sie wirklich. Man muß zu grellen Bildern greifen, um sie zu malen. Der Leib wird von Krötenfüßen bekrochen, aus der Haut schwitzen schleimige Bänder, die sich ins Gehirn schlingen, das Herz ist ein wild hinrasendes Tier, der Magen ein quälender Fremdkörper, der Kopf eine gallertige, verkrampfte Masse, Licht tut weh, Riechen und Schmecken sind ein Abscheu, das liebkosende Flüstern und Fragen der Kinder eine Marter, und wenn eines Menschen Fußspitze an den Pfosten des Bettes stößt, möchte man aufschreien vor Schmerz.
Kerkhoven weiß, was es mit dieser Angst auf sich hat. Sie ist sein spezielles Studium gewesen, und er hat ihr viele Namen in allen ihren Abstufungen verliehen. Die Erfahrungen, die er gewonnen, hier sind sie kein Behelf, sie lähmen ihn. Sie lassen ihn etwas erkennen, was er nicht in sein Bewußtsein aufnehmen möchte und doch aufnehmen muß: sinnliche Verstrickungen und Bindungen, Abgründe sinnlicher Aufgelöstheit, von denen die erschöpften Nerven Kunde geben, denn in ihnen wohnt noch die Erinnerung, wie in einem künstlich zum Schlagen gebrachten Herzen auf dem Seziertisch die Erinnerung an das ehemalige Leben. Es ist der Pendelausschlag nach der andern Seite, die Zuckungen der Glut rückwirkend in die Kälte, das Grauen als Metamorphose der Lust. Diese ärztlich-analytische Einsicht wird für ihn zum zentralen Unheil. Sie treibt seine Phantasie in die Richtung der Selbstzerfleischung. Sie erzeugt zwanghaft jene Folge von Bildern, die ihn besessen machen von dem Wunsch, zu morden, dem Menschen das Messer in die Brust zu stoßen, den er nicht mehr anders sehen und denken kann als in der Umarmung mit Marie. Nur das eine könnte ihn befreien und ihm die innere Ruhe wiedergeben: wenn er den Menschen morden könnte. Bestialische Anwandlung; verächtlicher Trieb; aber was soll er dagegen tun? Es ist ein Gefühl wie Heißhunger, er kann nicht Herr darüber werden, es macht ihn verrückt, er wird zu einer mitleidswürdigen Kreatur.
Und Marie schickt sich darein, ihm in allem Rede zu stehen, was er zu wissen begehrt. Es ist das nie versagende Mittel, ihn in ihrer Nähe zu halten. So lange er bei ihr ist, kommt die Angst nicht ganz an sie heran. Deshalb nimmt sie die Pein auf sich, die ihr die unablässige Inquisition bereitet. Auch ist in der Pein ein tiefer verhohlener Reiz. Sie spürt instinktiv, daß er nicht geschont sein will, folglich schont sie ihn auch nicht. Wenn sie sich genügend mit Worten gezüchtigt hat, irren ihre Träume und ihr Verlangen hinüber in den Bereich des gewesenen Glücks, und sie spricht davon mit den Zeichen der Euphorie und Trunkenheit. Ihre verworrenen Erzählungen bewegen sich in Fieberkurven. Bald schildert sie ihre moralischen und seelischen Leiden unter dem Zwang zur Lüge und Verstellung und unter der tyrannischen Herrschsucht ihres Geliebten, bald will sie von keiner Schuld und Verfehlung hören und verficht trotzig die sogenannten Rechte der Persönlichkeit. Hat sie eben noch Haß und Bitterkeit auf den Namen des Menschen gehäuft, dem sie sich in unbändiger Verschwendung geschenkt, und damit dem beklommen lauschenden Kerkhoven die Seele noch tiefer zerwühlt, so redet sie einen Atemzug später mit einer geradezu schaurigen Zärtlichkeit von ihm wie von einem vergötterten Toten.
Es ist eine völlig fremde Marie. Es ist nicht mehr die Frau, die ihm zwei Kinder geboren und ihn auf seinem schweren Weg als Kamerad begleitet hat. Er entsinnt sich, vor sechzehn Jahren hat sich etwas Ähnliches zugetragen, damals, als er sie kennengelernt, als sie sich, ihres Körper- und Seelengesetzes nicht achtend, an einen gewissenlosen Abenteurer hingegeben hatte. Aber damals hatte er begriffen, denn er hatte eben angefangen, sich selbst zu begreifen und zu erleben. Jetzt steht ein Mensch mit einem unzugänglichen Geheimnis vor ihm. Und vor dem Geheimnis hängt ein schwarzer Vorhang, die Angst. Und er, Kerkhoven, soll der Wächter des schwarzen Vorhangs sein. Während ihn die Begierde verbrennt, zu erfahren, was dahinter ist, soll er um jeden Preis verhüten, daß der Vorhang sich hebe und das Geheimnis enthülle. Dabei soll er so tun, als kenne er es, denn es hat ja immerfort den Anschein, als erschließe ihm Marie die verborgensten Winkel ihres Innern.
Eine unmögliche Situation. Er ist nicht mehr Arzt, nicht mehr Heiler, nicht mehr Beichtiger, nicht mehr Retter. Die Ungeduld, den Vorhang zu zerreißen, macht ihn seinem Wächteramt abspenstig. Er wird zum Unarzt, zum Widerarzt, zum Wundenaufreißer. Das Geschlecht in ihm ist beleidigt, der Mann ist gedemütigt, das Männchen wehrt sich und tobt. Eine Stufe der Erniedrigung, auf der er Gestalt und Wesen einbüßt. Man kann sich also nicht wundern, daß er mit Marie gemeinsam in die Tiefe stürzt. War Etzel Andergast der Verführer oder der Verführte? Diese Frage scheint dem Manne Kerkhoven vor allem der Klärung bedürftig. Marie will sich darauf nicht einlassen. Die Unterscheidung bedeutet ihr nichts. Es war ja einer über ihnen, der sie zueinander getrieben hat, der Meister. Der Meister weiß es, der Meister billigt es, das war die Losung und die Schuldaufhebung. Kerkhoven, dem zornige Regungen ungewohnt sind, würgt seinen Grimm hinunter. Schöner Meister, der nun dasteht als Hopf. Schöne Großmut, mit der man zum Hahnrei gemacht wird.
Marie ist entsetzt: Was für Worte, was für Begriffe! Sind Geistesfreiheit und ärztliches Verstehen nur Larven, die man außer Haus trägt? Bedenk doch, wer du bist, Joseph! Verführt oder nicht verführt, sie wünscht, er möge verstehen, wodurch sie so hingerissen worden ist, daß alle Schranken in ihr fielen. Die Aufmerksamkeit ist es gewesen, die zarteste, ritterlichste, die ihr je begegnet, von deren Umstrickungsgewalt sie so wenig geahnt, daß sie erst gespürt, wie sehr sie sie entbehrt hatte, als sie ihr erlegen war. Und mit der fieberhaften Erregung, die sie jedesmal ergreift, wenn sie von Andergast spricht, verbreitet sie sich über das Wesen dieser Aufmerksamkeit. Kerkhoven hat dabei eine Empfindung wie ein Mensch, hinter dessen Rücken etwas Gespenstisches vorgeht. Das Immer-Dasein, Immer-Zeit-Haben, Keinen-Schlaf-Kennen, Keine-Mühe-Scheuen, das unvergleichliche Erraten von Stimmungen, Wünschen, Gedanken ... Dazu das berückende Gefühl einer Frau, die erfährt, daß sie die erste ist, das erste große Erlebnis, die Erweckerin ...
Kerkhoven nickt. Das alles könne er ohne weiteres begreifen, aber dem widerspreche doch, was sie über die Härte und Rücksichtslosigkeit des jungen Menschen gesagt, seine anmaßende Tyrannei. Welchem ihrer Geständnisse solle er Glauben schenken, wo sei das wahre Gesicht? Marie antwortet hastig, die Tollheit habe ihn erst befallen, als sich das Verhängnis über ihnen beiden zusammengezogen habe; vom bösen Gewissen gejagt, von krankhaften, fast unverständlichen Rivalitätsgefühlen gegen seinen Meister wie behext, habe er sie zur Flucht und zur Heirat überreden wollen; anfangs sei ihr dies vollkommen wahnsinnig erschienen, und sie habe ihn ausgelacht, aber da habe er sie bis aufs Blut gepeinigt und sie auf raffinierte Manier eifersüchtig gemacht und mit Worten mißhandelt, ja geradezu mißhandelt; schließlich sei es zu dem gekommen, was sie ihr »In-die-Knie-Brechen« nannte, die bedingungslose Kapitulation. Das war das letzte, da sei dann Joseph endlich, endlich erschienen ...
»Wieso in die Knie gebrochen?« fragt Kerkhoven verblüfft. »Was nennst du Kapitulation?« – »Ich wollte ihm den Willen tun. Ich wollte mit ihm fliehen. Ich wollte ihn wirklich heiraten. Ich war ja selber wahnsinnig ...«
8
Marie in die Knie gebrochen vor einem halben Knaben, die stolze Marie, seine Marie, das Bild wird Kerkhoven nicht los; es verfolgt ihn und schraubt sich ihm ins Hirn. Wie konnte sich dies ereignen, was für eine Bezauberung war da am Werk, er muß es wissen, sie muß ihm Rede stehen, schon beim nächsten Gespräch fragt er sie danach. Es ist spät am Abend, sie sind im Wohnzimmer, alles schläft im Hause, Marie sitzt im Lehnsessel, er kauert auf einem Schemel vor ihr und hält ihre eiskalte Hand in seiner, sie blickt lange stumm in sein Gesicht, dann kommt wieder die schreckliche euphorische Trunkenheit über sie, die ihre Züge so verändert, als spiele sie eine eingelernte Rolle, und sie sagt: »Verstehst du denn nicht? Die Kraft ... die Unberührtheit, die Anmut in allem ... man kann's nicht beschreiben ... hauptsächlich die Anmut ... in der Liebe ist das ja so selten ... bei einem Mann ... versteh doch ... wenn einer so ... so intakt ist ...«
Schwer zu ergründen, warum ihn gerade der Ausdruck »intakt« so verletzt und erschreckt, wenn auch zugegeben werden muß, daß ihn jeder andere genauso empfindlich getroffen hätte. Es hängt wohl mit den eingerosteten Vorstellungen zusammen, die wir vom Charakter eines Menschen haben, daß gewisse unerwartete Äußerungen zu aufgerissenen Fenstern werden können, durch die ein blendendes Licht auf Dinge fällt, die wir ein Leben lang übersehen haben. Plötzlich wird etwas Anschauung, was wir vorher nur dumpf gewußt haben. Der Mann, der die aufbauende Macht der Phantasie verkündet und sie als wesentliche Hilfe in seine Heilmethode einzubeziehen getrachtet hat, muß jetzt ihre Unlenkbarkeit und Willkür am eigenen Leib erfahren, da sie ihm Szenen ausmalt, an denen er leidet wie an einem unauslöschlichen Schimpf. Er muß sehen, sehen, ohne die geringste Möglichkeit, die Bilder vom inneren Auge wegzutun, ohne vergessen zu können. Er muß sehen, wie sie einander in die Arme stürzen; wie sie mit begehrlichen Blicken einander betrachten; wie sie der Liebkosungen nicht satt werden; wie sie die verabredeten heimlichen Wege gehen ... aber das sind nur die Vorspiele. In einer seltsamen Art umgekehrter Lust und Lüsternheit weiß er, sieht er zu, wie sie die Kleider vom Leib streifen, wie sie einander umschlingen, erlebt das Nach und Nach ihrer Entflammung, Gipfel und Mattigkeit, Anklammerung und wollüstigen Krampf; ein gehässiges, häßliches Wort bietet sich ihm dafür an: hecken, sie hecken; sie wühlen sich ins ehebrecherische Nest und hecken. Alle diese Gesichte, einzeln und zusammen, umlagern, verhöhnen, vergiften, erdrosseln ihn; sein Geist, sein Herz, was an ihm nur irgend lebt, saugt sich mit einer rasenden Eifersucht voll, die sich vom Vergangenen nährt, die ihn ruhelos macht wie einen Verrückten und den Geist mit Finsternis schlägt.
9
Der Ernst dieses Zustands blieb Marie nicht verborgen. Sie erriet, was in dem Mann vorging. Sie kannte ihn besser, als er selbst sich kannte. Sie wußte seine entlegensten Gefühle zu deuten, mit visionärer Sicherheit oft. Sich an ihm aufrichten zu können, war der einzige Hoffnungsstrahl in ihrer Verzweiflung gewesen. In mystischer Zuversicht hatte sie der Kraft seiner Natur vertraut, der felsenhaften Unerschütterlichkeit, die er so häufig und unter den schwierigsten Lebensumständen bewiesen hatte. Nun, da sie ihn wanken und einem Phantom nachjagen sah, haltsuchend bei ihr, die selber keinen Halt mehr hatte, waren ihre Betrübnis und Enttäuschung grenzenlos.
Statt Hilfe zu empfangen, hatte sie Hilfe zu spenden. Welche Hilfe? Naturgemäß eine, die das Leiden aufhob in seinem Kern. Sie spürte, wonach er begehrte. Der weibliche Instinkt in ihr war so entwickelt, daß sie trotz der Erschöpfung ihrer Sinne, dem tödlichen Schweigen jedes erotischen Verlangens den Aufruhr in seinem Innern rhythmisch mitempfand, diese bohrende Sucht, sich als Mann zu bewähren, die, wenn sie nicht gestillt wird, zu einer Erkrankung des Selbstbewußtseins führt und das Geschlechtswesen in seinen Wurzeln angreift. Ihr war es nicht um körperliche Liebe zu tun; ihr Blut war unbewegt wie das Wasser in einem Schacht; nur dienen konnte sie dem Freund und Gefährten, sich ihm hingeben wie einem Freund eben, mit dem man alles zu teilen vermag, und ihn so, mit List und Selbstopferung, aus der verderblichen Spannung lösen. Das bißchen Verstellung, das sie hierzu anwenden mußte, kostete keine große Mühe; als Frau beherrscht man das Spiel, und sich davon nicht betrügen zu lassen, sind nur wenige Männer imstande.
Der heroische Entschluß war aber nicht bloß vergeblich, sondern steigerte das Unheil noch. Es geschah, was dem verblendeten Willen immer geschieht, wenn er sich eine Fähigkeit zutraut, die ihm der Körper verweigert. Der Reiz überwog die Kraft. Der Zweck lähmte die Funktion. Die Folge war Niederlage auf Niederlage. Die ganze Schmach war nun offenbar. Jetzt war er als Mann endgültig geschlagen. Doch wollte er sich nicht für geschlagen erklären, und das gab seiner Ohnmacht einen Zug ins Selbstmörderische. Er glich einem Ringer, der sich mit hohem Fieber zum Zweikampf anschickt und das Fieber für einen besonderen Beweis seiner Unbesiegbarkeit hält. Das Schauerliche war, daß er das Gefühl nicht los wurde, sich mit einem Gegner messen zu müssen, von dem er sich wie von einem Spion beobachtet wähnte und von dessen Stärke er, durch Maries Andeutungen aufs höchste irritiert, förmliche Wahnvorstellungen hegte. Er, der Neunundvierzigjährige, wollte den Dreiundzwanzigjährigen herausfordern und es ihm gleichtun, dem spurlos von der Bildfläche verschwundenen, feig geflüchteten Rivalen; denn so sah er ihn, so dachte er über ihn. Aber das Bestreben, seinen Charakter zu verkleinern und zu verzerren, half nicht dazu, seiner Herr zu werden und ihn aus dem Gedächtnis und aus dem Blut Maries zu tilgen. Das war die zugrunde liegende fixe Idee; als ob es erreicht werden könnte, daß Marie von dem Tausch nichts bemerkte, als ob das leidenschaftliche Erlebnis ihrer Sinne einfach mit ihm, dem Gatten, fortgesetzt werden könnte, wie man eine Kartenpartie mit einem neuen Partner fortsetzt und Marie nicht nur dazu bereit wäre, sondern auch sich nichts Besseres wünsche. Ein Irrtum immer kläglicher als der andere.
Es war eine unsägliche Folter für Marie. Sie nahm sie auf sich. Während sie die zärtlich Liebende vorzutäuschen hatte, war sie Samariterin. Wenn alle Kunst ihrer Liebkosungen erfolglos geblieben war, tröstete sie ihn. Sein verstörtes Erstaunen zerschnitt ihr das Herz. Sein jagender Puls erfüllte sie mit banger Sorge. Sie schlang die Arme um ihn und flüsterte ihm zu: »Laß doch, sei doch ruhig, hab Geduld, dein Körper ist weiser als du ...« Sie hatte einen Knaben im Arm, einen unglücklichen Sohn, ein törichtes, beschämtes, schluchzendes Kind.
Tiefer konnte man nicht sinken. Es war ihm nichts mehr verblieben von seinem inneren Besitz, von seiner Person und Würde, von seinem Wissen und Wirken, von der Schätzung der Welt. Leer. Fertig. Ausgeplündert. Eines Abends nahm er im Laboratorium im Stadthaus eine Tube mit schnellwirkendem Gift aus einem Behälter und steckte sie in die Westentasche. Als er dann nach Lindow zurückkam, fand er eine Depesche vom holländischen Kolonialministerium vor. Sie enthielt die Anfrage, ob es ihm möglich sei, sechs Monate nach Java zu gehen, um eine endemische Gehirnkrankheit zu studieren, die unter den Eingeborenen wütete. Ein Fingerzeig? Weisung der höheren Mächte? Er zuckte die Achseln. Eine halbe Stunde später trat er zum offenen Kaminfeuer, warf die Tube hinein und sah trüben Blickes zu, wie sie in der Flamme mit lautem Knall zerplatzte.
10
Zwei Menschen, die sich krampfhaft aneinander festhalten in der Hoffnung, daß sie vereint dem saugenden Strudel eher entkommen werden als jeder für sich: das ist der Vorgang. Marie läßt sieben gerade sein; der Haushalt auf Gut Lindow verwahrlost ein wenig. Ihr graut vor dem Winter. Jeder werdende Tag schiebt eine Ödnis vor sich her. Jede einzelne Stunde der Nacht hat ihr besonderes Schreckensgesicht. Warum kann man nicht verlöschen wie eine niedergebrannte Kerze? fragt sie sich. So zu leben ist ein Verbrechen an der Natur. Wenn das seltsame, alles Augenscheinliche umlügende Delirium über sie kommt, flackern die Blutgeister empor, und das Verrückteste hat einen Schimmer von Möglichkeit, daß er plötzlich an der Tür steht, der geliebte Flüchtling, und um Einlaß bittet; daß das Telefon läutet und sie hingeht und seine Stimme hört; daß Joseph ihn ruft, vielleicht nur, um mit ihm abzurechnen, ihn gewissermaßen vor Gericht zu laden und sie ihn einmal noch, ein einziges Mal, sehen kann. Darein mischen sich, wenn es wieder finster in ihr wird, aufregende Rachegelüste. Sehnsucht schlägt um in Haß. So durfte er sie nicht sich selber überlassen. So durfte er nicht seinem Meister entlaufen, dem Mann, der ihn geformt, ihn erst richtig auf zwei Beine gestellt, ihm den Begriff gegeben hat, was eine menschliche Seele ist.
Eines Nachts, sie sind in der Philharmonie gewesen, wo der Donkosakenchor gesungen hat, sagt sie: »Ein Brief von dir, Joseph ... wenn du ihm ein paar Zeilen schreiben würdest ... es wäre eine Erleichterung ... für dich, für ihn, für mich ...« – Kerkhoven verfärbt sich. Er starrt düster auf seinen Teller. »Schreiben? Ihm?« stößt er mit brüchiger Stimme hervor. »Komische Idee. Was versprichst du dir davon? Was für eine Erleichterung meinst du?« – Marie greift über den Tisch mit beiden Händen nach seiner Rechten. »Daß du ihm verzeihst«, sagt sie kaum hörbar und sieht ihm inständig flehend ins Gesicht; »es wäre das einzige, was uns retten könnte.« Sie sagt »uns«, sie wollte sagen »dich«; der Gedanke ist ihr während des Konzerts gekommen, und im selben Moment hatte sie aufgeatmet als wäre ihr ein Block von der Brust gefallen. Sie muß diesen Mann dem Leben wieder zurückgeben. Sie muß ihn zu sich selbst zurückführen und ihre ganze Macht einsetzen, damit er sich aus der Verstörung erhebe. Es ist ihre Pflicht, ist ihre dringlichste Schuldigkeit, und der Weg, der sich ihr beim Anhören der ergreifenden Gesänge gezeigt, erscheint ihr als der einzig gangbare. »Ich sehe in der Tat nicht, wie es sonst mit dir oder mit mir wieder aufwärts gehen soll«, sagt sie. – Kerkhoven ist aufgestanden und marschiert wie ein Automat um den runden Tisch herum. »Wie soll ich ihm denn schreiben, da ich gar nicht weiß, wo er ist?« murrt er unwillig. »Niemand weiß es. Niemand.« Widerstrebend spürt er, wie er dem Einfluß von Maries Worten und Wesen erliegt; es ist bereits eine vollendete Form der Hörigkeit, denkt er unzufrieden. – »Du warst doch einmal mit seiner Mutter in Verbindung«, tastet sich Marie zaghaft vor. – »Als ich ihr zuletzt schrieb, wohnte sie in Baden-Baden«, antwortet er. Dann: »Es ist sinnlos, Marie. Es geht gegen den Stolz. Ich kann das nicht. Man vergibt sich zuviel.« – »Wirklich? Vergibt man sich etwas, wenn man vergibt? Du überschätzt alle diese Dinge. Du bist nicht mehr du. Wärst du's noch, alles wäre anders.« – In einem sonderbaren Anfall von Bewußtlosigkeit redet Kerkhoven vor sich hin: »Eines könnt' ich tun ... müßt' ich tun ... ihn suchen ... Schließlich müßte man ja erfahren können, wo ...« Seine Züge verzerren sich, er ballt die Faust. – »Schau mich doch an«, bittet Marie mit gefalteten Händen. Sie sitzt in der Ecke, in einem blausamtenen Schlafrock vor der purpurrot tapezierten Wand, ihr Gesicht mit den geschlossenen Augen ist so weiß wie gefrorene Milch. – »Auch ich sehe keinen Schritt weiter, Marie«, sagt Kerkhoven hart, und seine tiefe Stimme tönt wie in einer Kirche; »ich stehe vor dem Nichts.«
Plötzlich tritt er dicht an sie heran und legt seine mächtige Hand auf ihren Scheitel. Ihre Haare sind wunderbar warm, wie Heu in der Sonne. Sie blickt matt lächelnd zu ihm empor, schüchterne Erwartung in ihren Augen, den »blassen Blumen«. Und da sagt er das Wort, das wie der erste Strahl eines neuen Tages ist: »Du bist im Element getroffen worden, Marie. Soviel weiß ich jetzt. Dort, wo die allerdunkelsten Kräfte wohnen. In der Urnacht könnte man sagen. Das geschieht selten. Die meisten Menschen bleiben davor bewahrt. Wir müssen trachten ... man muß die lichten Kräfte versammeln, damit sich die Einbruchstelle wieder schließt. Wie eine Wunde sich schließt. Denn mit ihr weiterleben können wir nicht.«
Dies hören und aufspringen und die Arme ausbreiten und mit einem Schrei des Dankes den Mann an sich pressen ist für Marie das Tun zweier Sekunden. »Joseph«, seufzt sie und drückt das zuckende Gesicht an seine Schulter.
11
Immerhin ist es eine Brandstätte. Man muß den Schutt wegräumen und sehen, was sich von den Trümmern für den Neuaufbau verwenden läßt. Eine Generalrevision. Die Gespräche, die sie führen, bewegen sich nicht mehr in den Abgrund hinunter, sie nehmen allmählich die Richtung nach oben. Der unterste Punkt scheint überwunden, obwohl sich ringsum noch überall die Weglosigkeit des Nachtbezirks ausbreitet.
Sie sind schier unzertrennlich. Nie haben sie in so herzlicher Vereinigung gelebt. Es ist, als lernten sie einander erst kennen. Sie machen die lehrreiche Erfahrung, daß ihre Ehe ein zehnjähriger Entfremdungsprozeß war. Sie werden einander neu. Das schafft eine neue Fremdheit, aber eine fruchtbare. Es gelingt Marie, ihn zu Entschlüssen zu bekehren, bei denen er die Illusion hat, als habe er sie aus eigener Kraft gefaßt. Er bezwingt die selbstzerstörenden und Marie zerstörenden Begierden. Ohne den Frieden der Nerven und der Sinne sind alle Rettungsversuche kindisches Bemühen. Der Frevel, den er begangen hat, wird ihm bewußt. Das Gebot der Entsagung formt sich als erste Stufe des Aufstiegs. Marie geht nicht von ihrer Überzeugung ab, daß man eine Frau, die man liebt, vor allem einmal freigeben muß. Er denkt lange darüber nach und gibt es endlich zu. Er fragt, ob es, in seinem und ihrem Fall, nicht zu spät sei. Nein, dazu ist es nie zu spät. Er ist also willens, es zu tun. Sie soll so frei sein, daß kein Gedanke von ihm, kein Wunsch sie mehr bindet und verpflichtet. Als wenn er selber unsichtbar wäre, nur noch als Schutzgeist vorhanden. Schwer. Aber gibt es wahrhafte Entsagung, die leicht ist?
So könnte er möglicherweise die Überlegenheit wiedergewinnen, um sie aus der Verstrickung zu lösen. Könnte die Angst von ihr nehmen. Könnte die Leidenschaftserinnerungen vermauern. Es müßte freilich mit äußerster Behutsamkeit geschehen. Sie dürfte die Absicht nicht merken. Es wäre ein Anfang. Dann müßte er ihr allerdings frische Lebensspeise geben, etwas, wovon sie sich seelisch nähren und sättigen könnte, eine Spannung, eine tragende Bewegung, denn so weit ist er ja nun in der Kenntnis ihrer Natur gelangt, daß er in diesem Liebeserlebnis nicht mehr etwas Zufälliges und Gesetzloses sieht, den leichtfertigen Treubruch einer ihm zugehörigen Frau, sondern einen Akt der Herzensnot, eine dämonische Entfaltung. Das muß man wissen, sagt er sich, sonst kann man einen solchen Menschen nicht verstehen.
Aber Marie, deren Inneres alle seine Regungen seismographisch registriert, findet, daß er dabei nach der entgegengesetzten Seite übers Ziel schießt. Warum es denn so schwer nehmen, fragt sie, warum es mit Zentnergewichten beladen? Er möge sich doch, unbeeinflußt von seinem persönlichen Anteil, vorstellen, was tatsächlich und wirklich passiert sei. Nichts, nichts, nichts. Ihm nämlich nicht: der sich aufführe wie ein Mann, dem das bitterste Unrecht widerfahren ist. Er solle es doch natürlich und vernünftig betrachten, Joseph-Kerkhovenisch, nicht mit dem Pathos eines Leidtragenden, der seine Liebe bestatten muß, denn gerade diese Liebe sei in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen. Das alles sei nicht mehr wahr, es sei sogar ein wenig mauvais genre, sehe er das nicht ein?
Immer wieder kommt sie darauf zurück, und obwohl ihr durchaus nicht scherzhaft zumute ist, bemüht sie sich, um ihn heller und leichter zu machen und weil sie nur aufzuatmen vermag, wenn er nicht wie die verkörperte Düsternis durchs Haus wandelt, sein Verhalten ins Komische zu ziehen, und manchmal lacht sie ihn direkt aus. Sie hat so viel Humor, und wo es eine Gelegenheit zu spotten gibt, läßt sie sie schwerlich vorübergehen, auch wenn sie zwei Minuten vorher nicht gewußt hat, wie sie sich aus ihrem Jammer retten soll. Bisweilen lächelt Kerkhoven auch wirklich; es erscheint ihm nicht ausgeschlossen, daß er sich mit der Zeit in die souveräne Haltung würde hineinleben können, die Marie mit der Ungeduld einer nervös Ermüdeten von ihm fordert. Jedoch es ist der Körper, der Widerstand leistet, der dumpfe, plumpe, schwunglose Mannsleib, dem seit Jahrhunderten und Generationen die unerschütterliche Vorstellung vom garantierten Besitz einer Frau innewohnt, so daß er es als Mneme in sich trägt und sich grimmig wehrt gegen Raub und Entehrung. Das liegt im Blut, keine Wandlung der Sitte und der Zeiten macht es alt und überlebt. Eine Frau ist kein Versatzobjekt und kann nicht ausgeliehen werden und nicht dem ersten besten Wegelagerer als vorübergehendes Eigentum zufallen, das verwüstet die Ordnung, greift ein in heilige Form, entzieht der Familie und wahren Ehegemeinschaft den Boden; und die angenehm temperierte Gewohnheit der Sinnenliebe, Palliativ gegen alle Gelüste und Abenteuer, einem wohlbehüteten Herdfeuer zu vergleichen, wird zum fragwürdigen und umstrittenen Recht. Das ist nicht erlaubt, das darf nicht sein, es ist eine mißverstandene Freiheit.
Marie schüttelt trostlos den Kopf. Dieses ewige Bohren im Vergangenen – zum Verzweifeln! Sie reden tagelang, nächtelang; kein Fertigwerden, man dreht sich im Kreis. Doch umgibt er sie dabei mit einer unvergleichlich zarten Sorgfalt. Er findet Mittel, sie abzulenken, die äußerlich scheinen, aber auf listige Weise ins Innere wirken. Sie unternehmen gemeinsame Fahrten in die Landschaft, Wanderungen durch die Wälder. Kerkhoven läßt seltene Früchte, seltene Blumen aus der Stadt kommen, alte Stiche, alte Drucke, die Marie liebt. Er, dem es immer ein Mißbehagen verursacht hat, an die Überflüssigkeit des Lebens zu denken, das Schmückende und Verschönende, erkennt auf einmal ihre Bedeutung an und ist unermüdlich in der Herbeischaffung. Es macht manchmal den Eindruck, als wolle er sich in der Obsorge betäuben. Aber es liegt eine tiefere Absicht dahinter. Er hat erfahren müssen (bei einem ganz bestimmten Fall, wir werden gleich davon zu sprechen haben), daß die geschlechtliche Ohnmacht auf das ganze geistige und seelische Gebiet übergegriffen hat, und er sieht in dem inneren Wiederaufbau, den er an Marie vornimmt, die einzige Möglichkeit, wie er wieder Arzt werden kann. Von der Liebe aus. Von einer Halluzination des Herzens aus. Sonst geht es auf keine Weise mehr, alle andern Wege hat er bis zum Ende abgeschritten.
12
An einem dieser Tage war ein Mann zu ihm gekommen, der bereits in der Stadtwohnung mehrmals dringend nach ihm gefragt, sodann einen seitenlangen, höchst verworrenen Brief geschrieben hatte, worin er bat, ihn in Lindow besuchen zu dürfen, die Unterredung sei seine letzte Hoffnung. Obschon Kerkhoven den Ton kannte, Hunderte sprachen und schrieben so, hatte er nicht den Mut, den Mann abzuweisen, und so erschien er eines Vormittags zur bezeichneten Stunde.
Er hieß Karl Buschmann und war ein schmächtiger, phthisisch aussehender Mensch von achtundzwanzig Jahren. Er war vor ein paar Wochen aus dem Zuchthaus entlassen worden, wo er sechs Jahre wegen Hochverrats verbüßt hatte. Er und sein jüngerer Bruder Erich hatten einer staatsfeindlichen Organisation angehört, beide waren am selben Tag verurteilt worden. Es schien, daß ein Falscheid dabei eine Rolle gespielt hatte. Der Bruder war nach anderthalb Jahren in der Strafanstalt gestorben. Karl hatte außer ihm keinen Menschen auf der Welt gehabt und auch keinen geliebt. Beide waren wie eine einzige Person gewesen, das Leben hatte sie zu einer Art von Identität verschweißt. Sie stammten aus guter Familie, der Vater war Hüttendirektor und im Krieg gefallen, sie hatten dieselben Schulen besucht, Gymnasium und Technikum; schon mit siebzehn Jahren waren sie Mitglieder einer radikalen politischen Gruppe geworden und hatten sich an den Spartakuskämpfen beteiligt. Sie hatten dieselben Anschauungen und Ziele, lasen dieselben Bücher, schliefen im selben Bett, nichts unterschied sie voneinander als der Taufname. Als Karl den Tod des Bruders erfuhr, lag er vierzehn Tage lang starr auf seiner Pritsche, erbrach alle Nahrung und war vorübergehend blind. Tatsächlich, nicht bloß eingebildet. Nachher verlor er das Zeitgefühl, litt an Zählmanie und schweren Nervenkrisen. Einmal wurde er von einem Zellengenossen körperlich mißbraucht, und als er es anzeigte, wurde er in einer Nacht halbtot geprügelt. Aber alles das war nicht der Grund seines Kommens. Sondern was sich seit seiner Entlassung mit ihm ereignet hatte. Er könne es nicht anders bezeichnen denn als eine völlige Verkümmerung seiner Sinne und Organe. Die Speisen blieben ihm im Schlund stecken, Verdauung habe er fast keine, vor Wasser graue ihm genau wie vor Alkohol, Farben sehe er nicht, die Haut sei wie ertaubt, Geräusche könne er nicht differenzieren, die Stimmen der Menschen klängen ihm wie Trompetengeschmetter, Papierrascheln wie Klirren von Glas, eine ungeheure, gräßliche Angst vor der Welt habe sich seiner bemächtigt, und diese Angst weiche nur von ihm, wenn er ein Weib in den Armen halte; davon allerdings könne er nie genug bekommen, es sei das einzige Gefühl und die einzige Kraft, die ihm geblieben, es sei damit rein zum Tollwerden und quäle ihn wie ein ununterbrochener brennender Durst; die Frauenzimmer schienen es zu wittern, sie würfen sich alle nur so hin an ihn, aber lange könne er es nicht mehr machen, auch da drohe bereits das Grausen, und wenn man so ohne jede Beziehung zu sich selber lebe, ohne die Spur von höherem Trieb und Interesse, nur mit einer ungefähren Erinnerung an das, was früher war, daß man einmal ein ganzer Mensch gewesen und jetzt nur ein halber, seit sie den Erich umgebracht ... was solle man denn noch, man versteht ja nichts mehr von dieser Schweinewelt, die so bedreckt sei wie ein Stiefel im Schlamm. Herrgott, Herrgott, könne ihm der Herr Professor nichts geben, was ihm helfen könne?
Kerkhoven schaute den Mann still prüfend an. Er hatte eigentlich immer darauf gewartet, daß ihm die Zeit eines Tages einen richtigen Golem vor Augen führen würde. Da war einer. Jedenfalls ein golemnaher Mensch, Erzeugnis gott- und schöpfungswidriger Mächte. Es mußte so kommen. Was sollte man da sagen und raten? Dieses Extremste mußte eintreten, um ihm die endliche Gewißheit seiner Impotenz zu geben, ihn erkennen zu lassen, daß er mit den bequem gewordenen Methoden in Gefahr war, zum Betrüger und Selbstbetrüger zu werden. Es war falsch, es vereitelte den Heilzweck in einem höheren Sinn als dem individuellen, wenn man einem Menschen sein Schicksal abnahm und auf sich nahm; damit stürzte man ihn nur in den Wahn, als ob eine mechanische und äußerliche Hilfe möglich wäre, als ob er ohne sein Zutun und den härtesten, sittlich-physischen Kampf gerettet werden könne, ohne den Kampf jedes Organs, jedes Nervenstrangs, jeder Hirnzelle um eine wahrere Existenz. Hineinstellen mußte man ihn in sein Geschick, hineinpressen, ihm die Verantwortungen grausam eröffnen, den Willen schulen, zu Selbstentscheidungen über das Nein und Ja erziehen, zu denen die Todesneigung oder die Erneuerungsbereitschaft der eigenen Natur ihn nötigten.
Das war ein Umsturz des Systems. Aber vorläufig konnte man noch nichts damit anfangen. Es fehlten die Grundlagen und die Erfahrung, die ohne geduldige Arbeit und Selbstverwandlung nicht zu erreichen waren. Und ohne Entsagung nicht, auch hier. Als sein forschender Blick den glitzernden Augen des Mannes begegnete, sagte er sich: Es liegt eine Pupillenstörung vor. Aber was es auch sein mochte, es kam nicht in Betracht. Er fragte dies und jenes, befühlte den Puls, maß den Blutdruck, prüfte die Reflexe, dann verschrieb er ein Mittel, eine Drüsenmischung, es hätte ebensogut ein anderes Mittel sein können, er sah nichts, er empfand nichts, er wußte nichts, er entließ den keineswegs Beruhigten mit üblichen Redensarten, und als er ihn zur Tür begleitete und seinen schwankenden Gang wahrnahm, dünkte ihn eine Sekunde lang, als gehe sein Doppelgänger von ihm weg, ein gestorbener anderer Kerkhoven, der Golem. Er blieb den Tag über abgekehrt und schweigsam.
13
Der letzte Oktobertag. Sie hatten den Nachmittag im Freien verbracht, am Abend, nach dem Essen, sagte Kerkhoven: »Ich muß über etwas Bestimmtes mit dir sprechen.« – Marie sah ihn erwartungsvoll an. – »Du hast dich wahrscheinlich gewundert, daß ich meine ganze gewohnte Arbeit aufgesteckt habe«, sagte er und korrigierte sich, als Marie den Kopf schüttelte, »na vielleicht nicht, vielleicht warst du froh darüber, aber du hättest dich doch wundern müssen.« – »Schön, nimm an, ich hätte mich gewundert.« – Er schaute blinzelnd in die Höhe, den Kopf schräg, wie ein Vogel. »Es wäre eben in keinem Fall länger gegangen. Das Stück war abgespielt. Ich habe immer deutlicher gespürt, daß ich in den Leerlauf gerate.« – »Was nennst du Leerlauf? Man hört das Wort jetzt so oft, aber was war es bei dir?« – »Das Mißverhältnis zwischen dem Wirkungsfeld und der inneren Dynamik.« – Marie wurde immer aufmerksamer. »Ich verstehe ... innere Dynamik ... du meinst, was im Widerspruch zum Praktischen steht, zu den praktischen Aufgaben?« – »Ja, zum Betrieb ganz einfach. Man verfällt der Wiederholung des Gleichartigen. Eine unendliche Reihe ohne Summe. Selbstwiederholung. Jede Handfertigkeit, jede Geistfertigkeit läuft auf Selbstwiederholung hinaus.« – »Gut, aber anders kann man doch nicht in die Breite wirken, und du willst doch in die Breite wirken.« – »Ich weiß nicht. Früher vielleicht wollte ich es. In die Breite wirken heißt darauf verzichten, in die Höhe und in die Tiefe zu wirken. Es ist das große Problem heute. Wir kämpfen sozusagen um eine neue Dimension. Beim Ausbau der alten haben wir das Edelmetall des Lebens zugesetzt und nichts dafür hereinbekommen als wertlose Schlacken.« – »Was willst du aber tun?« – »Schluß machen. Von vorn anfangen. Umkehren und den Punkt suchen, wo man in die falsche Bahn eingebogen ist.« Er sagte das alles scharf betont und auffallend hastig. – »Ich kann mir noch nichts Greifbares darunter vorstellen«, gestand Marie zögernd. – »Paß auf und erschrick nicht über das, was ich dir jetzt sage, Marie«, er nahm ihre Hand zwischen seine beiden; »man muß die Praxis für eine Weile an den Nagel hängen. Mit allem Bisherigen brechen. Man darf nicht vom Beruf leben wollen, wenn man nicht mehr die Überzeugung hat, daß man ihn so restlos ausfüllt wie ein Körper seine Haut. Man muß der Herr des Metiers sein, nicht sein Knecht, nicht sein Hund. Das ist alles so einfach, wie wenn du guten Tag sagst; sieht man näher zu, so ist es eine Frage auf Leben und Tod.« – Marie blickte so heftig interessiert in sein Gesicht, als wolle sie eine Geheimschrift entziffern. »Es wäre ja nicht das erstemal, daß du alles über den Haufen wirfst«, bemerkte sie nachdenklich; »schon vor fünfzehn Jahren hast du es getan. Nicht zu deinem Schaden. Es ist offenbar dein Gesetz.« – Er nickte. »Auch damals ist es im Zusammenhang mit dir geschehen. Das gibt zu denken ... Machst du dir auch klar, was ein solcher Entschluß von uns fordert?« – »Ich glaube, ja.« – »Wir haben in den letzten Jahren gelebt wie Börsenspekulanten.« – »Ich bin zu allem bereit, Joseph. Ich bin keine Henne, die um den Brutplatz zittert.« – »Das sagt sich so leicht ... Überlege einen Augenblick ... Du hast gewisse Neigungen ... Liebst es, dich elegant zu kleiden, hast dich an die Sorglosigkeit im Geldausgeben gewöhnt.« – »Ich bin nicht davon abhängig, Joseph. Ich kann mich jeden Tag umstellen. Es muß nur etwas da sein, wofür ich es tue, und offengestanden: ich warte darauf.« – »Schön. Wir müssen Lindow verkaufen. Das Haus in Berlin verkaufen. Die Anstalt abgeben. Was vom Erlös bleibt, nach Tilgung aller Verpflichtungen, muß erstens verwendet werden, um dich und die Kinder vor Mangel zu schützen; ich selber bringe mich durch, wie, das gehört in einen anderen Teil unserer Unterhaltung, und zweitens schwebt mir seit langer Zeit ein Projekt vor, über das ich aber jetzt nicht reden möchte. Nur damit du ungefähr im Bild bist ... Es handelt sich um die Errichtung einer Heilstätte, wie ich sie mir träume, im kleinsten Stil vorläufig, irgendwo im deutschen Süden ... Aber bis dahin hat es jedenfalls gute Wege.« – »Warum?« fragte Marie. »Warum es aufschieben?» – »Weil, ...« er stockte; »ich habe eine weitläufige Arbeit vor. Ich habe dir davon erzählt. Ein Buch über den Wahn.« – Sie warf ihm einen durchdringenden Blick zu. »Das ist nicht der wirkliche Grund, Joseph. Du verbirgst etwas.« – »Stimmt. Aber ich weiß nicht, Marie, weiß nicht, ob du ... es ist das Schwerste von allem, was ich dir zu sagen habe.«
Ein leichter Schauer lief über Maries Schultern. Sie ahnte es. Sie mochte ihn aber nicht bedrängen. Sie ließ kein Auge von ihm. Seine Haltung, der leicht zurückgelehnte Oberkörper, das mächtige Haupt ruhig dem Licht zugekehrt, das machte plötzlich einen großen Eindruck auf sie. Prachtvoll sieht er aus, mußte sie denken. Keine innere Besetztheit, keine andersgerichtete Beschäftigung konnte sie daran hindern, das Sinnfällige wahrzunehmen und vom Standpunkt der Schönheit aus zu beurteilen. Diejenigen, die sie nicht genau kannten, nahmen bisweilen sogar Anstoß daran und nannten sie eine hoffnungslose Ästhetin.
14
Aus tiefem Schweigen heraus sagte sie: »Auch ich ... du begreifst, ich kann nicht zuschauen, bis mir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. In all den Jahren hab' ich nicht viel Ersprießliches geleistet. Ja, das Gut ... Aber wenn man bloß zu befehlen braucht ... Nicht einmal um meine Kinder hab' ich mich richtig gekümmert. Es ist so, glaub' mir. Ich hab' sie wachsen lassen, das war alles. Wie lang wird's dauern, und man muß sie hinausschicken. Sie sind nicht vorbereitet für das, was kommt. Eines Tages werden sie einem vor die Hunde gehen, und man hat sie in der Watte aufgezogen.« – »Du hast nicht unrecht. Es kommt eine finstere Zeit. Seit einem Jahrtausend war keine ähnliche.« – »Und ich selber«, fuhr Marie fort, »ich hab' gelebt wie eine Prinzessin. Es gibt Aufgaben. Schön, was du vom Wiederanfangen gesagt hast, Joseph. Es gilt auch für mich. Was ich tun will ... ich weiß noch nicht genau. Ich hab' nur ein dunkles Bild davon. Darf ich dir erzählen, was mir letzte Nacht geträumt hat? Ich bin geflogen. Immer höher und höher. Dabei war mir angst und bang, weil ich das Gefühl hatte, ich sollte dich nie wiedersehen. Auf einmal war ich so hoch oben, daß ich wußte, jetzt bin ich nah bei Gott. Und ich hatte nur die einzige Sehnsucht, daß mich sein Blick treffen sollte. Es erschien mir wichtiger als das Leben, daß er mich sah, und ich wechselte immerfort den Platz, um seinen Blick zu erhaschen, es war aber umsonst, und in meinem Kummer darüber fing ich entsetzlich zu weinen an. Im selben Moment fiel ich wieder herunter, ganz langsam, und darüber war ich selig, ich fühlte, Gottes Blick hielt mich jetzt, sonst hätte ich nicht so langsam fallen können. Je näher ich der Erde kam, desto glücklicher wurde ich; und dann wachte ich auf ... wie in einem Rausch von Glück, immer noch mit dem Gefühl: sein Blick hält mich jetzt. Sonderbarer Traum, nicht?« »Ja, sonderbar«, sagte Kerkhoven kopfschüttelnd.
Nach einer Weile begann Marie wieder: »Jetzt mußt du mir auch gestehen ... Was ist denn das Schwere, was du mir zu sagen hast? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich werde nicht feig sein.« – Kerkhoven beugte sich so weit vor, daß die zwischen den Schenkeln gefalteten Hände fast den Teppich streiften; es war die Haltung, die er oft bei entscheidenden Mitteilungen annahm. »Es ist allerdings schwer«, gab er zu, »sehr schwer. Doch ist es das einzige Mittel um ... Wenn du mir nicht mit allen deinen Kräften dabei hilfst, Marie, geht es wohl kaum ... Ich dachte es mir ziemlich einfach, es dir zu sagen ... indessen ...« Mit einem Ruck warf er den Kopf hoch, sein Gesicht war fahl geworden. »Wir müssen uns trennen, Marie. Und zwar für lange Zeit.« – Marie, ebenfalls blaß, schaute ihn stumm an. – »Wenn du mich nach den Gründen fragst«, führ er fort, »kann ich dir keinen einzigen nennen, der vollauf zureichend wäre. Es ist ein Entschluß, zu dem du nur ja oder nein sagen kannst.« – Auf den Ellbogen gestützt, schaute ihn Marie regungslos an. Nur die Haut des Halses bebte wie von krampfhaftem Schlucken. – »Wir haben etwas mitsammen durchgelebt, Marie ... Na, erspar mir den Kommentar. Ich kann nicht als Ruine eines Mannes bei dir bleiben. Dazu bist du mir zu viel. Diese Liebe ... Ich habe sie ja erst jetzt entdeckt. Sie war natürlich da, aber von ihrem Ausmaß hatte ich keinen Begriff. Das muß vorausgeschickt werden, damit du besser überblickst, worum es sich handelt. Nicht bloß um unsere Beziehung ... obgleich ... in ihr liegt der Schlüssel. Es hilft nichts, es zu verhehlen ... Ich bin ein Entmannter auch als Arzt. Weiterschustern würde das Übel irreparabel machen. Da heißt es: Abstinenz. Alle Bindungen müssen für eine Weile zerschnitten werden. Ein Mensch wie ich kann sich kaum mehr vorstellen, was das praktisch bedeutet. Möglich, daß ich diesen Andergast suche. Erschrick nicht, Liebste, es ist vielleicht eine Wahnidee. Ich habe zuviel seelisches Kapital in den Menschen gesteckt. Damit ist er durchgegangen wie ein Defraudant. Kann sein, ich brauche ihm nur drei Sekunden in die Augen zu sehen, und ich hab' ihn, wo ich ihn haben will.« – »Nein«, rief Marie mit einer kalten, wehen Stimme, »denk nicht mehr daran!«
Kerkhoven erhob sich und ging mit großen Schritten zwischen Wand und Wand auf und ab. »Gut, gut, gut«, sagte er vor sich hin, »das sind Velleitäten. Aber ich habe nicht die Absicht, etwas zu unterlassen, was mir den Rücken frei macht. Es geht ums Ganze. Um die Probe auf Blut und Nieren. Wenn man seinen Impulsen stets ausgewichen ist, lohnt sich sogar mal eine Dummheit. Als Namenloser kann ich mir das unter Umständen leisten. Verstehst du, was ich will? Namenlos werden, hauslos. Wo hab' ich das Wort her, das mir beständig durch den Kopf geht, vom Gang in die Wüste? Erinnerst du dich noch an die Flucht des achtzigjährigen Tolstoi? Wie er in einer kleinen Bahnstation in der Steppe starb? Du warst schon ein erwachsener Mensch damals, du mußt dich erinnern. Grandiose Sache. Ein Memento. Gelebte Prophetie. Na ... sterben werd' ich nicht gerade. Nein, will ich gar nicht. Man hat ein untrügliches Gefühl vom Sinn dessen in sich, was mit einem geschieht. Die biologische Sicherheit; fundamental. Nur fordert es vom andern unbedingtes Vertrauen; in diesem Fall von dir. Hast du das Vertrauen, so erschaffst du mit, was aus mir wird.«
Er hatte ziemlich erregt gesprochen, und auf Maries scheue Frage »Ich werde also nicht wissen, wo du bist?« antwortete er, die Hand an die Stirn pressend: »Ich kann's noch nicht sagen. Das Schlimmste sind Halbheiten. Zunächst will ich mich treiben lassen. Ohne Programm. Vor ein paar Tagen hab' ich einen Antrag der holländischen Regierung bekommen. Ich soll einer Studienkommission beitreten, die nach Java geht. Ich überlege noch. Ich habe vier Wochen Zeit, mich zu entscheiden, und viereinhalb Monate bis zur Reise. Es garantiert wenigstens die äußere Existenz. Aber du darfst mir nicht nachforschen, was immer passiert. Es ist hart, aber es muß sein. Es muß ganzer unabänderlicher Ernst sein, Marie. Eines Tages werde ich dir schreiben. Bist du dann so bereit wie ich, dann steht kein Hindernis mehr zwischen uns.«
15
Von der Stehuhr im Nebenzimmer schlug es eins. Marie stand auf, trat ans Fenster, schob den Vorhang beiseite und sah in die Nacht hinaus. Ihr Gefühl war heillos verwirrt. Das Vernommene dünkte sie so abenteuerlich, so drohend und finster überraschend, daß sie Mühe hatte, an die Worte zu glauben. Der Mann, der hinter ihr noch immer in gleichmäßigem Rhythmus auf und ab ging, erschien ihr als ein anderer denn der, den sie kannte. Einer, der nie brüderlich und liebend ihr Leben geteilt, der so fremd, so streng, so ungeahnt entschlossen war, daß sie auf einmal schmerzliche Sehnsucht nach ihm verspürte, wie wenn er bereits Abschied genommen und unerreichbar weit weg wäre. Konnte sie ertragen, was er ihr auferlegen wollte? Das war die Frage. Und wenn sie der Prüfung nicht standhielt und zerbrach? Wenn die innere Aufgabe, die sie auch ihrerseits sich gestellt und die sie bis jetzt nur in allgemeinen Umrissen sah, bloß ein Wunschtraum war? Wenn sie gar nicht fähig war, als Frau allein ihr Leben zu gestalten? Wenn die schmeichelhaften Stimmen, die ihr eine Eigenentfaltung versprachen, selbstverliebte Täuschung waren? Wenn sie die Kraft, die sie sich zugetraut, gar nicht besaß, auch nicht die Kraft, zu warten? Und wo war die Gewähr dafür, daß er nicht stürzte und an sich und seinem Ziel endgültig verzweifelte? Konnte sie wissen, ob er je zu ihr zurückkehrte? Wissen, wohin es ihn verschlug? Eine ungeheure Natur, ja, ein Baum, aber gerade solche werden oft jäh gefällt, und was dann?
Während sie die Stirn an die kühle Scheibe drückte, irrte ihr Blick zur Höhe, und sie sah einen Stern fallen. Es war wie das Aufblitzen einer feurigen Lanze. Sie fuhr zusammen. Sie dachte an ihren Traum. Sie neigte den Kopf: War das Gottes Blick? Da spürte sie Kerkhovens Hände auf ihren Schultern. Sie lehnte sich gegen ihn zurück. Sie tastete nach seinen Händen, und als er ihre Gelenke umgriff, sagte sie leise, im Ton der Gelobung: »Ja, Joseph, ja.«
16
Die Ordnung seiner Angelegenheiten nahm ihn zwei Wochen in Anspruch. Er hatte mit den Behörden zu tun, mit der Ärztekammer, hatte lange Besprechungen mit seinen Assistenten, die Forderungen mußten beglichen, die Außenstände eingetrieben werden. Die Auflösung beider Haushalte besorgte Marie. Für den Verkauf von Lindow wurde ein Sachwalter bestellt. Sie hatte das Gut in den letzten Jahren ausgezeichnet bewirtschaftet, es meldeten sich auch alsbald mehrere Interessenten. Nach Kerkhovens Abreise wollte sie mit den Kindern eine kleine Wohnung in Berlin beziehen, aber nur für ein halbes Jahr, später gedachte sie an den Bodensee zu übersiedeln, wo sie für Johann, ihren älteren Knaben, eine passende Lehranstalt ausfindig machen wollte. Das war auch der Wunsch Kerkhovens, der nicht nach Berlin zurückkehren wollte.
Nicht ein einziges Mal, weder mit Mienen noch mit Andeutungen, versuchte sie seinen Entschluß zu erschüttern. Sie fragte ihn nicht aus, sie verriet keine Schwäche, sie ließ den Kopf nicht hängen, und das stille Einverständnis, das sie ihm zeigte, täuschte ihn über die nagende Sorge hinweg, gegen die sie nur wehrlos wurde, wenn sie allein war.
Ein Handkoffer und eine Ledertasche waren sein ganzes Gepäck. An jedes Stück, das er einpackte, knüpfte er die Überlegung, ob er es wirklich brauche oder ob er sich nur einbilde, es zu brauchen. »Der viele Plunder, den man durchs Leben schleppt, nimmt einem innerlich Platz weg«, sagte er; »besitzen heißt besetzt sein.« – »Ich will mir's merken«, sagte Marie und verkaufte ein paar Tage später den größten Teil ihres Schmucks.