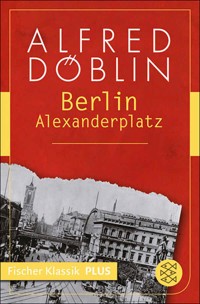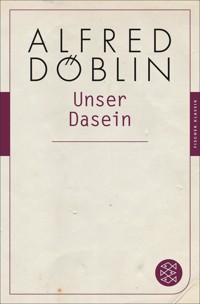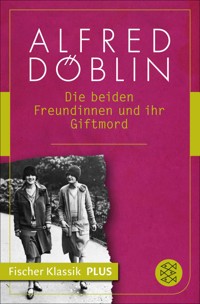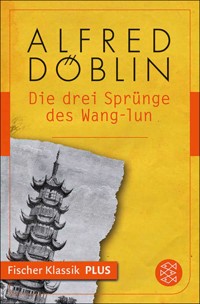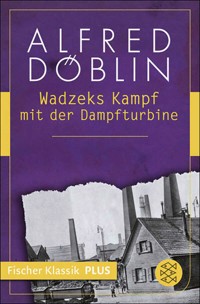5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Alfred Döblin über sich selbst »Wer ich bin, was ich bin, was mit mir ist, das weiß ich nicht.« Alfred Döblin hat dem Begriff des ›Ich‹ zutiefst misstraut. Gerade deshalb aber umkreist er sich selbst und seine Arbeit in immer neuen Versuchen und Annäherungen. Autobiographisches Erzählen wird dadurch wie jedes Erzählen und Reflektieren bei Döblin zu einem großen, offenen Experiment. Einer der zentralen autobiographischen Texte ist das ›Journal 1952/53‹ aus den letzten Lebensjahren Döblins.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alfred Döblin
Journal 1952/53
FISCHER E-Books
Inhalt
Journal 1952/53
Eingang
Es mag sich in bezug auf Entstehung und Art dieser Welt verhalten, wie es will – ich bin da, zusammen mit dem, was den Himmel und die Erde erfüllt. Wer ich bin, was ich bin, was mit mir ist, das weiß ich nicht. Ich finde m[i]ch so und so ausgestattet, eingelagert und angepaßt vor, wie ein Rädchen in einer unübersehbaren Ma[s]chinerie. Ich stelle fest: manches ist mir mitgegeben, manches nicht, – auch daß ich einiges erkenne, ist mir mitgegeben, aber nicht vieles. Immerhin besagt dieses, daß ich denke und mir einiges bewußt mache, daß ich doch nicht bloß ein Rädchen in einem Uhrwerk bin, oder daß dies ein besonderes Rädchen in der Uhr ist, und daß dieses Ganze, worin einem Rädchen Erkennen selbst in beschränktem Umfang mitgegeben ist, daß dies eine besondere Ma[s]chine ist. Was meine Rolle und Funktion hier anlangt, so wäre besonders zu fragen, ob mir allein dies mitgegeben ist, zu erkennen und erkennen zu wollen, – oder ob vielleicht noch anderen Gliedern des Ganzen und mit mir Verbundenen Erkenntnis als Eigenschaft zukommt.
Wenn diese Welt da ist und ich in ihr und mit ihr, und zwar so wie ich p[er]sönlich und privat bin, – wie hänge ich und meine Art und mein Schicksal, mein Tun und Treiben, Gedeihen und Verderben mit dem Schicksal, mit Ursprung und Wesen dieser Welt zusammen? Ich muß mir aber im [v]ornherein darüber klar sein, daß man sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann.
Der Frager gesteht, daß er sich sofort in doppelter Beleuchtung sieht: einmal im Rahmen der großen Zusammengehörigkeit, der gesamten Welt und dessen, was man Natur nennt. Das andere Mal findet er sich hier in einer Ecke dieser Natur, teilnehmend an ihren Abläufen, – und das andere Mal sieht sich der Frager durch seine Gabe des Erkennens unnatürlich und gegennatürlich.
Der Hinweis darauf, daß man sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, ist immer und allemal nützlich, aber man muß ihn mit Reserve gebrauchen. Wenn einer sagt, der Mensch könne aus sich heraus kein Gegenüber der Welt werden, so gilt dieser Satz nur, wenn man den Menschen als einzelnes Naturobjekt gelten läßt. So aber hat man das, was Mensch heißt, sofort tödlich eingeengt und mit Voreingenommenheit betrachtet. Er fühlt, denkt, will und erlebt sich aber, – ich möchte sagen: Brust an Brust mit dem Ganzen. Denn er erlebt ja nicht die Natur der Wissenschaftler, objektiv, sondern in seinem Schicksal, und selbst wenn er sich in einer Höhle versteckt, erlebt er sie als Ensemble von Erfahrungen, von Schönheiten und Herrlichkeiten, Erwartungen und Enttäuschungen, beladen mit unverständlichen, ungeheuerlichen Schrecknissen, mit zauberhaften Reizen, die hier emporschießen, die er nicht an sich kennt. Ja, er steht, geht, schwimmt und fliegt in einem traumhaft wechselnden Ablauf.
Ein regnerischer Septembertag
In diesen Monaten war ich, da das Gehen mir schwerfällt, sehr viel an das Zimmer gebunden. Ich sitze in der Nähe des Fensters. Eine Reihe von Kakteen h[än]gt da auf schmalen Brettchen und will Licht. Zwischen den kleinen Töpfen vermag ich auf die Straße zu blicken.
Dies ist nun ein grauer regnerischer Septembertag. Die Stadt heißt Mainz. Die Frauen unten haben Schirme aufgespannt. Es bewegt sich da unten nicht viel. Ich versäume nichts. Versunken dämmere ich und lasse es passieren.
Dies alles, so erlebe ich es, zusammen mit der Stube, ist da und geht vor. Ich habe den Sinn für den Alltag verloren. Ein anderer Sinn hat sich vorgedrängt. Was ist das für ein Sinn? Wie sehe ich die Straße jetzt mit ihren Figuren? Die Frauen wandern auf dem [s]piegelglatten Asphalt, mit Kindern an der Seite und an der Hand. Die Frau und die Kinder bewegen sich. Sie geschehen. Es geschehen die Frau und die Kinder auf dem spiegelnden Asphalt im Regen. Gewiß denkt diese und jene da, die mit der schwarzen Markttasche, sie will einholen und das ist ihr Plan, an der Ecke bei dem Kaufmann, der jeden Morgen seine Schiefertafeln recht[s] und links mit neuen Zeichen bemalt und aushängt, er nennt die Waren, die er vorrätig hat, die Preise wechseln. Die Frau steht vor seiner Tür, sie wirft einen Blick auf die Tafel links und rechts, rafft ihren nassen Rock und tritt über die Schwelle. Sie verschwindet im Laden. Es ist ein Vorgang wie der Regen, der fortdauert. Schwere Lastwagen mit Anhängern rollen über den Damm und erschüttern das Haus. Es ist vorbei. Jetzt ist es bald 6 Uhr nachmittags. Der Himmel wird dunkler und dunkler. Die Wolkenmassen oben verlieren ihre Weiße, sie werden von einer unsichtbaren Sonne angestrahlt.
Und so geschieht das Vorrücken, das man Tag nennt. Er wird davongegangen sein, der Tag, der jetzt noch ist. Er wird geschehen sein. Aber er war nicht da als Tag, – es geschah Tag. Und das geht nun in den sogenannten Abend über und schwimmt ein in Nacht, um dann langsam wieder vom Licht, von der Morgendämmerung überholt zu werden.
Und inzwischen werden von der Straße die Wagen und die Frau und die Kinder verschwunden sein. Der Kaufmann drüben hat seine Krei[d]etafeln von der Tür abgenommen, die Jalousieen vor den Fenstern herabgelassen und den Laden geschlossen. Und die Ruhe ist da und die Schwärze. Große elektrische Glocken brennen noch eine Weile. Ich werde dann nicht mehr am Fenster hinter den Kakteen sitzen.
Mein Körper liegt im Bett, und das, was man Schlaf nennt, hat mir Be[w]ußtsein und Willen genommen.
Ein anderer Tag. Ich habe meinen Sitz geändert, der Stuhl wurde mir zu hart. Ich sitze im Nebenzimmer auf einem Fauteuil an der Wand und bl[i]cke in den Raum. Mögen andere Schreiber dramatische Erlebnisse berichten, ich berichte, was ich von meinem Fauteuil aus an der Wand im Raume hier sehe. Das Radio unter mir spielt alte Tanzweisen. Viele Kakteen haben sich hier angesiedelt, kleine Töpfe, große Töpfe. Sie besetzen den Mitteltisch. Drüben an der Wand steigen sie an einer mehrstöckigen Etagere hoch. Oben auf dem Buffet streckt eine zierliche Zimmerpalme ihre Wedel in die Höhe. Auch auf dem Boden Pfl[a]nzen. Sie wollen in diesem Raum die Oberhand haben. Aber sie sagen nichts und tun nichts. Ihre Blätter, ihr Körper atmet. Ihre Wurzeln saugen.
Sie stehen in verschiedenen Lebensaltern, diese Pflanzen und Pflänzchen. Eines ist wie das [a]ndere gut oder böse. Sie sind alle etwas, drücken etwas aus. Jedes Gewächs in seinem Topf hat seine Art. Einige tragen Blüten, tiefes Rot. Jedes führt ein Dasein, breitet sich aus. Es weiß nicht, was ihm geschieht, und wenn es soweit ist, wird es verdorren.
Kein allgemeines Geschehen in der Welt. Das Geschehen hat sich zu diesen Gewächsen zusammengezogen, es ist individuell geworden. Kein grenzenloses Hinfließen, keine inhaltlose Zeit, sondern Leben in Abschnitten, [K]ei[m], Jugend und Entwicklung, Reife, neue Keime, langsames Verdorren und Welken. Das ist das Geschehen dieser einzelnen Gewächse. Immer bemächtigen sich welche der Gegenwart und verdrängen andere.
Aber der Himmel, der Regen, die Wolken und die ungeheure Gleichmäßigkeit der Gestirne, was ist das, was hat das für ein Gesicht, hat es eins? Spricht es etwas? Ich kann nur fragen. Gewisse Zeichen nehme ich als Antwort hin. Die Pflanzen sind wie Engel aus dem Himmel gefallen, sie sprechen von ihm, und Sonne, Mond und Sterne äußern sich dazu. Sie sind eine Botschaft von weither, und sind so wie wir Menschen und dazu in mancher Hinsicht mehr. Da schreibt ein Etwas keine Bücher, sondern stellt Pflanzen und Tiere hin, und das ist eine Sprache mit vielen Dialekten.
Es ist alles miteinander, füreinander und gegeneinander da. Und da muß ich wieder denken: es fließt aus einer einzigen großen Wesenheit und es bildet ein einziges Wesen.
Für manchen Zweck soll man sich damit begnügen, aphoristisch zu bleiben. Das Geschehen, die körperlichen und mit Sinnen erfaßbaren Dinge anlangend, so geschehen sie und die seelischen und geistigen Vorgänge eng an einander geschlossen. Sie in den wahren Zusammenhang zu bringen, bemühen sich die Religionen. Skepsis kann sich aus der Angriffslust ergeben, und dann geht und rutscht man weiter und endet in einer bequemen und unwürdigen Existenz. Der lähmende Pessimismus hängt mit der Skepsis zusammen und hat verschiedene Wurzeln. Mir scheint die Form des Pessimismus, die ihre Wurzeln in der christlichen und jüdischen Sündhaftigkeit hat, zu überwiegen. Aber man ist schon längst überchristianisiert und entchristianisiert.
20. September
Dieses notierte ich im Herbst 52.
Schon lagen Schatten auf mir. Ich fuhr wie immer in das Bureau gegen 9 Uhr vormit[t]ags, zur Zitadelle hinauf und hatte begonnen, nach Durchsicht einiger Briefe etwas zu diktieren. Die Sekretärin saß seitlich an ihrem Tisch mit dem Rücken gegen mich. Da fängt sie plötzlich an zu sprechen. Ich höre es. Und wie sie sich umdreht, sitze ich, berichtet sie später, in mich gesunken auf meinem Stuhl, habe ein eingefallenes bläulich weißes Gesicht. Und wie sie sich nähert, kann ich ihr zuflüstern, sie möchte den Doktor, den ich ihr nenne, anrufen, er möchte zu mir in die Wohnung kommen, mir wäre nicht gut, ich würde bald da sein. Ich murmelte auch: »kalt kalt«. Kalter Schweiß fließt in Strömen von meiner Stirn und rieselt am Hals herunter. Sie nimmt ihr Taschentuch und sucht mich abzutrocknen, aber es läßt nicht nach.
Was war mir? Traumhaft verschwommen erschien mir alles, und ein eigentümlicher Druck und Schmerz meldete sich hinter dem Brustbein und stieg in den Hals hinauf. Ich war nicht bei vollem Bewußtsein. Man schleppte mich die kleine Treppe hinunter in das Auto, bald lag ich auf meinem Bett und wurde notdürftig entkleidet. Wenige Minuten später erschien meine Frau, der Arzt war grade gekommen. Sie begriff beim Eintreten die Situation sogleich. Die Sekretärin und der Chauffeur lehnten an meinem Bett, sie verschwanden jetzt. Und nun fingen der Arzt und meine Frau an, fieberhaft an mir zu arbeiten. Er gab mir Injektionen und ließ sie elektrische Heizkissen und auch Wasserheizkissen bringen. Sie machten Kompressen auf die Brust. Wärme, Wärme überall. Spritzen brachten den zunächst völlig aussetzenden, dann fadenförmigen Puls zurück. Da bat meine Frau den Arzt, der den Zustand für ernst hielt, doch unverzüglich einen Spezialisten hinzuzuziehen.
Ich hatte keine Beschwerden. Es hatte gleich im Beginn des Zustandes etwas eingesetzt, was mich überraschte: ein Wohlbehagen. Ich fühlte mich zufrieden, die Schmerzen waren nicht erheblich, ich war froh, zu liegen. Ich dachte an Todesschweiß, aber mir war nicht ängstlich zu[m]ute. Stark lief der Schweiß mir noch immer vom Gesicht, von der Stirn den Hals herunter. Schwierig, das Schweiß zu nennen, es war eisiges Wasser, das ohne Grund meinen Körper verließ. Und während ich so lag, freute ich mich darüber, daß meine Frau da war und sprach. Während sie mich betastete, küßte ich zärtlich ihre Hand und war eigentlich wie nie. Später hörte ich, der Arzt hatte ein Kampherdepot angelegt, der Spezialist, der Internist spritzte Strophantin.
Von dem, was an den folgenden Tagen mit mir geschah, weiß ich nichts zu melden. Es ist alles verwaschen und verworren, eins in das andere geronnen. Nicht ein einziges Datum aus diesen drei Tagen weiß ich mit Sicherheit. Es handelte sich um den Bruch eines Kranzgefäßes im Herzen, der Herzmuskel und eine Partie seiner Hinterwand war paralysiert, mein Geh[i]rn anämisch.
Sonderbar, wie da Erinnerungen und Vorstellungen durcheinanderlaufen. Als ich am dritten oder vierten Tag in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert wurde, hatte ich die Vorstellung in Californien zu sein und sagte, man möchte doch den armen indianischen Kindern draußen etwas zu essen geben.
Und dann lange Wochen einsames Liegen, bewegungslos im Krankenhaus. Aus den erst angegebenen 6 Wochen wurden 10. Ich war ganz appetitlos und blieb es noch viele Wochen. Mein Magen und Darmapparat wollte nicht funktionieren. Und wie immer bei länger dauernden Krankheiten, stellten sich neue Übel ein. Eine äußerst schmerzhafte Cystitis entwickelte sich, während in meiner Brust das Herz sich schon beruhigte. Die Schmerzen der Blase, krampfhaft, lokalisiert am Schließmuskel, waren so stark und durch kein Medikament zu beeinflussen, daß man Morphiumspritzen verabfolgte. Sie wirkten zauberhaft, sie und die Hitze und dazu noch Spritzen und Peniz[il]lin.
Währenddessen lag ich und lag, mein Kopf wurde wieder heller aber es war etwas neues in mich eingezogen. Ich konnte liegen ohne zu denken, gewissermaßen vollkommen von der Materie verschluckt. Ich ließ mir dann aus der Zeitung vorlesen und schlug wenigstens für ein und zwei Stunden eine Brücke zwischen mir und der Außenwelt. Ich brachte aber die Außenwelt niemals ganz mit mir zusammen und vergaß immer wieder wo ich war. Nach Wochen durfte ich mich aufsetzen, ja einige Schritte versuchen, und schon erfolgte ein Rückfall der Cystitis.
Ein merkwürdiger Krankenhausaufenthalt. Es war ein Hospital der Hildegardisnonnen. Wer Hildegardis war, hatte ich vorher nicht gewußt. Ich hörte, sie war eine Heilige und starb auf dem Rupertusberg bei Bingen. Man feiert sie am 17. September. Im Benediktinerinnenkloster wurde sie erzogen, wurde Priorin und verlegte ihr Kloster nach dem Rupertusberg. Sie war Seherin und eiferte für eine Annäherung von Clerus und Volk. Groß waren auch ihre Kenntnisse der Medizin. 81 Jahre war sie alt, als sie im Jahre 1179 starb. Nonnen, Krankenschwestern dieses Ordens umgaben mich jetzt. Unverwechselbar der Geist in dies[e]m Hause, das wir Kranke bevölkern, als Gäste, wenn ich so sagen soll, der Nonnen. Bete und arbeite heißt die allgemeine Parole, aber diese Nonnen hier, regelrecht medizinisch ausgebildet, ackern nicht und bebauen nicht den Erdboden. Sie haben es mit Menschen zu tun. Diese Arbeiten an Kranken zu verrichten, ist ihr religiöser Dienst. Ihre freundliche, vertieft herzliche Art, mit Kranken umzugehen, ihre Geduld, ihr sanftes Lächeln fiel mir auf, sobald ich überhaupt hier um mich blickte. Welch Unterschied zu den weltlichen Schwestern, die ja auch erfahren sind. Diese können medizinisch gut und äußerlich freundlich sein, hier kommt die mehr als herzliche Vertiefung des Gefühls hinzu, mit der sie sich bewiesen. Indem sie mit uns Leidenden, Geschlagenen umgehen, sprachen und verhandelten, arbeiteten sie ja an sich und für sich. Da waren jüngere und ältere Nonnen, sie hatten alle, welch ungeheurer Entschluß, auf die Freuden und Zerstreuungen dieser Welt verzichtet. Sie gingen nicht aus, sie tanzten nicht, besuchten kein Kino, – sie pflegten ihre Kranken und beteten zu Gott. Ja, sie beteten viel, frühmorgens um 5 Uhr kamen die ersten drei Glockenschläge, die sie weckten, bis 8 Uhr abends verlief der Tag, eine heilsame bildende Monotonie, und kein Geschwätz. Sie hatten eine sichere Antwort auf alle Fragen, ich bin bei keiner auf Zweifel gestoßen, sie waren dabei ohne große allgemeine geistliche Kenntnisse. Aber Glauben war da, und herzlich und siegreich hatte er ihre Seelen in Besitz und teilte sich anderen mit. So sah ich sie in Gruppen gehen, in ihre schöne Kapelle wandern, leicht und ruhig, da waren sie zu Haus. Vor dem Altar lag ihr Jerusalem. Welch schönes Beispiel. So zu fühlen, so aufgehoben zu sein.
Ich lag und grübelte.
Ich finde bestätigt, was ich draußen sah: Ich bin da, mit dem, was Himmel und Erde erfüllt, zusammen mit Himmel und Erde. Ich stehe aber in einer doppelten Beleuchtung: einmal zugehörig zu der Natur, das andere Mal ihr gegenüber. Aber wo fängt die Natur an, bei mir, der hier liegt, und wo hört sie auf, wo fange ich an? Mein Körper, das Fleisch, die Knochen, das Blut, wie weit bewegt sich hier die Natur hinein und wo findet sich mein Ich[?] Rätselhafte Dinge, nein, allbekannte, natürlich wie Geburt, reifen und welken, geschehen auch an mir. Draußen gibt es Tag und Nacht, Kriege und Gewitter, an mir arbeiten Krankheiten, wie durchschaue und erkenne ich sie[?] Ich spekuliere darüber, wie diese Herzattaque zusammenhängt mit meine[n] alten Nerven- und Knochenleiden, mit denen ich mich schleppe. Was geschieht da an mir? Was arbeitet, was vollzieht sich an mir, an diesem fleischernen und knöchernen Ding, mit dem ich hingestellt bin?
Da na[gt] seit vielen Jahren etwas schmerzhaft an meinen Nerven. Sie haben es mit meinem rechten Arm zu tun. Wir fuhren einmal in die Pyrenäen, nach dem schönen Luchon, Dampfbäder linderten die Schmerzen, aber in Amerika plagten sie mich wieder. Jetzt wurde an eine Nervenwurzel gedacht und auf die Halswirbelsäule wurden wohltätige Röntgenstrahlen gerichtet, Grenzstrahlen. In Europa aber, in Baden-Baden fing das Gespenst an, von Neuem sich mit mir zu befassen und nun mit einer besonderen Herzlichkeit. Jetzt begannen die Finger meiner Hände zu vertauben, die ganze rechte Hand, dann [schlief] die linke Hand ein. Das Gespenst ging systematisch vor, immer eins nach dem andern. Ich hatte ja auch noch Beine, jetzt wurden sie erfaßt. Wie war das alles gemeint? Mit Staunen sah ich den sogenannten positiven Befund im Röntgenbild. Die Schatten der Knochenwucherungen. Die Abläufe draußen folgten Gesetzen, welche die Wissenschaft feststellte. Man kann große Zusammenhänge herstellen. Aber hier? Es ging weiter seinen Weg. Ich hatte das Gefühl bei dem Einschlafen und Vertauben des Ertrinkens. Und nun das Herz. Es ist ein Stück Natur. Es ist ein starker Muskel, aber Muskel ist nicht bloß Fleisch. Umsponnen werden die Muskelzellen von Nervenfasern, die Muskeln sind Erfolgsorgane. Und was die Nerven anlangt: das vielleicht äußerlich ruhige Leben eines Schreibers b[irg]t Gefahren in sich. Ich erinnere mich während der Arbeit an meinem Buch »Berge Meere und Giganten« in einen fast neurotischen Zustand geraten zu sein, der mich zwang, die Arbeit zu unterbrechen: die Phantasien waren zu wild und mein Gehirn gab mich nicht frei. Und so ging es eigentlich Jahr um Jahr mit kleinen Unterbrechungen. Dann kam 1933 der äußere Schlag und nach 1940 die Schicksalsreise, die uns über die Pyrenäen, über Spanien und Portugal nach Amerika führte. Und unbemerkt begleitete uns alle der Schatten des Knochenmanns, das Alter, der immer dichtere Schatten des Alters.
Meine Toten
Am Tode war ich vorbeigeglitten. Mich beschäftigten die Toten.
Da sind größere und kleinere Kreise, einige, die aus der Tiefe auftauchen, andere die mich nur rasch berühren. Zuerst – mein eigenes Blut. Ich kann davon sprechen.
Noch vor unserer Rückkehr nach Europa erfuhren wir von seinem Tod, dem Tod unseres zweiten Sohnes Wolfgang. Er war französischer Soldat, 25 Jahr[e] alt, schon Doktor der Mathematik, hatte wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und stand im Briefwechsel mit Professoren des Auslands. 1945 mußte ich zuerst die Dienststelle aufsuchen, bei der ich arbeiten wollte, meine Frau aber, die Mutter, reiste in die Vogesen und suchte sein Grab. Und dann erhielt ich in Baden-Baden von ihr einen Brief. Sie schrieb, sie habe sein Grab, sein armes ungepflegtes Grab, das kahle nackte Grab gefunden. Dort oben, dort hinten, lag er auf einem Dorffriedhof, zwischen Gräbern, die den Stahlhelm mit Hakenkreuz trugen. Das also war sein Ende, die letzte irdische Ruhestätte. Ich betete damals in Baden[-]Baden Tag um Tag für ihn, morgens und abends. Ich bat ihn, der so entsetzlich rasch und ohne Wort verschwunden war, um Verzeihung für alles, worin ich ihm gegenüber versagt hatte, nochmal um Verzeihung, nochmal um Verzeihung. Ja, so betete ich und warb um ihn und rief ihn morgens und abends, auch nachts, wenn ich erwachte. Ich habe als Erwachsener selten in meinem Leben geweint, auch der Tod meiner Mutter griff mich nicht so an. Jetzt, bei dem Schwinden dieses Sohnes kamen mir oft Tränen, ich konnte mich lange nicht beruhigen. Er war in den vergangenen Wochen wegen seines Muts und seiner Tapferkeit ausgezeichnet worden. Als Akademiker sollte er zur Ausbildung ins Inland geschickt werden, aber grade als die Anweisung dazu kam, hielt er sich zu seinem letzten Urlaub bei uns auf. Es war für diesmal zu spät, und für das nächste Mal im Herbst, war es nun ganz zu spät, er hatte keine Ausbildung mehr nötig. Er hatte mehrmals den Rückzug seiner Abteilung allein mit dem Maschinengewehr gedeckt und seine Truppe wieder gefunden. Diesmal kehrte er nicht zurück.
Wolfgang, du warst der zweite unter den Brüdern, der ernsteste, reifste, [k]lügste und tiefste, auch der verschlossenste. Deine Mutter brach in Hollywood auf dem Bett zusammen, als nach den langen Jahren des Wartens endlich ein Wort über dich kam. Der Brief war von einer Studienfreundin von dir. Nach einem einzigen Blick auf die Zeilen hatte deine Mutter das Wort »tué« gesehen, und wie ein Schuß traf es sie selbst mitten ins Herz. Er war hin. Er hatte alles kommen sehen. Beim Heranrollen der Nazihorden befiel ihn wohl dasselbe Staunen, die dumpfe Beklemmung und die lähmende Beängstigung, die über mich von Zeit zu Zeit fiel, gemischt mit Ekel, in den Wochen der Flucht. Ein teuflisches, schon nicht bloß physisches Verhängnis. Der Teufel machte sich ungehindert an uns heran, schon war uns das Ich genommen. So ging es dir. Du sahst die Übermacht. Du fielst, du strecktest die Waffen nicht vor jenen. Was magst du erlebt und erlitten haben in diesen Tagen[?]
Meine Toten. Nur wenn ich an den Schöpfer denke, treten Eure Bilder vor mich und fügen sich in mich ein und wir sind wieder beieinander. Jetzt, ich noch am Leben, jetzt frage ich: was war das mit uns? Waren wir Teile eines Spektrums, muß ich mich wieder unter Euch mischen?
Ein anderer Kreis. Meine Mutter. Ja, kommt hervor, zeigt Euch alle, die ich in mir trage, taucht aus Eurer Tiefe auf, laßt auf mein Bewußtsein ein kurzes Licht fallen.
Meine Mutter, mein Vater. Wieviel lebte in Euch noch von dem Adel des biblischen Volkes? Der Vater riß sich von seinen Eltern los, dann trennte er sich von seiner eigenen Familie. Es war etwas Spielerisches und Unernstes in ihm. Da war Leichtigkeit, Leichtigkeit und oberflächliche Freude an der natürlichen Existenz. Man kann Leichtsinn auch als Rohheit lesen, wenn es dazu kommt, daß ein erwachsener Mann seine Familie, seine Frau mit fünf Kindern verläßt, um mit einem zwanzigjährigen Mädchen davonzugehen. Damit war er seinem Trieb gefolgt, und an dem Punkt blieb er stehen, es ging nicht weiter mit ihm, weder in die Breite noch in die Tiefe, und er hockte für den Rest seines noch langen Lebens dort hinten in Hamburg mit ihr. Dann kam der Kehlkopfkrebs, und das Spiel hatte seinen natürlichen Abschluß gefunden. Der flüchtigen Natur hatte er sich verschrieben. Hätte er doch einmal nach dem Buch der Propheten gegriffen und gelesen, was sie sagen. Aber ich weiß, sie drangen auch bei ihrem Volk in alter Zeit nicht durch. Etwas anderes mußte kommen, und es kam.