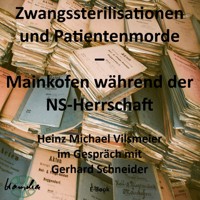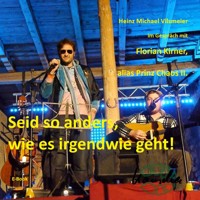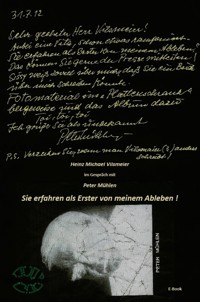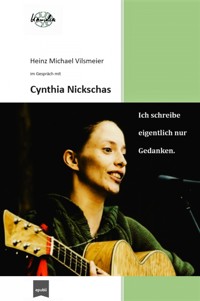Judith Bernstein - Ich wehre mich dagegen, dass das Schicksal meiner Großeltern zum Kampf gegen die Palästinenser herhalten muss. E-Book
Heinz Michael Vilsmeier (D)
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Judith Bernsteins Eltern verließen wenige Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Deutschland. Da ihnen eine Emigration in die USA verwehrt wurde, flüchteten sie in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina und ließen sich, wie viele deutsche Juden in der Siedlung Rehavia vor den Toren Jerusalems nieder. In der "Gartenstadt" Rehavia erblickte Judith Bernstein 1945 das Licht einer Welt, die von der Kultur der deutschstämmigen Bewohner und Bewohnerinnen, den Jeckes, geprägt war. Judith Bernstein wurde in diese deutsch-jüdische Gesellschaft hineinsozialisiert – und obwohl ihre Großeltern zwei Jahre vor ihrer Geburt in Auschwitz ermordet worden waren, zog es sie mit Macht in die alte Heimat ihrer Eltern. Als sie ein Stipendium der Stadt München erhielt, kam sie 1966 zum Studium nach Deutschland. Den Sechstagekrieg des Jahres 1967, der weitreichende Folgen für das Denken vieler Israelis und somit für die Politik Israels haben sollte, verfolgte sie von der bayerischen Hauptstadt aus. Judith Bernstein kehrte zwar nach Israel zurück, heiratete und brachte dort 1973 und 1976 ihre Töchter Sharon und Shelly zur Welt, doch irgendwann stellte sie fest, dass Israel aufgehört hatte, ihr zu gefallen. Ende 1976 kehrte sie nach Deutschland zurück, dieses Mal für immer. – Judith Bernstein lebt nun seit Jahrzehnten in München, wo sie durch ihre Mitarbeit in der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe für einen Ausgleich und ein friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern eintritt. Auch ihr vor wenigen Jahren verstorbener Ehemann Reiner Bernstein bestärkte sie in diesem Kampf. Über die Erfahrungen, die Judith und Reiner Bernstein wegen ihres Engagements machen mussten, berichtet Judith Bernstein in dem nachfolgenden Gespräch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz Michael Vilsmeier
im Gespräch mit
Judith Bernstein
Ich wehre mich dagegen,
dass das Schicksal meiner Großeltern
zum Kampf gegen die Palästinenser herhalten muss.
E-Book
Impressum
HAMCHA art integration
Heinz Michael Vilsmeier
Spiegelbrunn 11
D-84130 Dingolfing
Erste deutschsprachige Ausgabe als E-Book:
© Copyright by Heinz Michael Vilsmeier, 2024
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Fotosammlung Judith Bernstein, mit freundlicher Genehmigung.
https://interview-online.blog
Einleitung
Judith Bernsteins Eltern verließen wenige Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Deutschland. Da ihnen eine Emigration in die USA verwehrt wurde, flüchteten sie in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina und ließen sich, wie viele deutsche Juden in der Siedlung Rehavia vor den Toren Jerusalems nieder. In der „Gartenstadt“ Rehavia erblickte Judith Bernstein 1945 das Licht einer Welt, die von der Kultur der deutschstämmigen Bewohner und Bewohnerinnen, den Jeckes, geprägt war. Judith Bernstein wurde in diese deutsch-jüdische Gesellschaft hineinsozialisiert – und obwohl ihre Großeltern zwei Jahre vor ihrer Geburt in Auschwitz ermordet worden waren, zog es sie mit Macht in die alte Heimat ihrer Eltern. Als sie ein Stipendium der Stadt München erhielt, kam sie 1966 zum Studium nach Deutschland. Den Sechstagekrieg des Jahres 1967, der weitreichende Folgen für das Denken vieler Israelis und somit für die Politik Israels haben sollte, verfolgte sie von der bayerischen Hauptstadt aus. Judith Bernstein kehrte zwar nach Israel zurück, heiratete und brachte dort 1973 und 1976 ihre Töchter Sharon und Shelly zur Welt, doch irgendwann stellte sie fest, dass Israel aufgehört hatte, ihr zu gefallen. Ende 1976 kehrte sie nach Deutschland zurück, dieses Mal für immer. – Judith Bernstein lebt nun seit Jahrzehnten in München, wo sie durch ihre Mitarbeit in der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe für einen Ausgleich und ein friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern eintritt. Auch ihr vor wenigen Jahren verstorbener Ehemann Reiner Bernstein bestärkte sie in diesem Kampf. Über die Erfahrungen, die Judith und Reiner Bernstein wegen ihres Engagements machen mussten, berichtet Judith Bernstein in dem nachfolgenden Gespräch. – Dafür danke ich ihr aus tiefstem Herzen.
Heinz Michael Vilsmeier
„Dort ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern." (Numeri. 23,9)
Vorwort von Judith Bernstein
Abbildung 1 Judith Bernstein, 2024
הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzen den Vers so: „Da, ein Volk, einsam wohnt es, unter die Erdstämme rechnet sich's nicht".
Angefangen von dem ersten israelischen Premierminister David Ben Gurion, der von einem jüdischen Staat sprach und dementsprechend die Palästinenser während des israelischen „Unabhängigkeitskriegs“ vertrieben hat bis zum jetzigen Premierminister Benjamin Netanjahu, der versucht, Israel und die 1967 eroberten Gebiete „palästinenserfrei" zu machen (Endnote I), hat sich eine Politik durchgesetzt, die keine echte Friedenslösung zulässt.
Abbildung 2 Konfrontation palästinensische Zivilisten mit Soldaten der IDF 1948
Aber kann ein Volk ein Land für sich beanspruchen, das schon bewohnt ist? Ich meine nicht. Das haben schon die Mitglieder von Brit Shalom (Bund des Friedens) erkannt. Es waren vorwiegend jüdische Intellektuelle aus dem deutschsprachigen Raum wie u. a. Martin Buber, Gershom Scholem und Judah Magnes, die sich als die „Spätkommenden" sahen. In ihrem Manifest von 1929 schrieben sie: „Dem Brith Schalom schwebt ein binationales Palästina vor, in welchem beide Völker in völliger Gleichberechtigung leben, beide als gleich starke Faktoren das Schicksal des Landes bestimmend, ohne Rücksicht darauf, welches der beiden Völker an Zahl überragt. Ebenso wie die wohlerworbenen Rechte der Araber nicht um Haaresbreite verkürzt werden dürfen, ebenso muss das Recht der Juden anerkannt werden, sich in ihrem alten Heimatlande ungestört nach ihrer nationalen Eigenart zu entwickeln und eine möglichst große Zahl ihrer Brüder an dieser Entwicklung teilnehmen zu lassen." (Endnote II)
Dieses Manifest wäre die Chance für die Juden gewesen, im Nahen Osten anzukommen. Leider haben die Israelis es aber vorgezogen, ihren Staat mit Gewalt zu erobern, anstatt ihn gemeinsam mit der dort ansässigen Bevölkerung zu gründen. War es notwendig, die palästinensischen Orte zu zerstören und die Bevölkerung zu vertreiben? Damit begann für die Palästinenser die bis heute anhaltende Nakba (Katastrophe). Sämtliche israelische Regierungen haben damit in Kauf genommen, dass Israel immer ein Fremdkörper in der Region bleibt.
Das Schicksal der vertriebenen Palästinenser interessierte nach 1948 niemanden.
Letztlich hat das Versagen der Weltgemeinschaft während der Nazizeit und ihr entsprechend schlechtes Gewissen einen wesentlichen Beitrag zur Gründung des Staates Israel geleistet. Für Israel war die Zeitspanne zwischen 1945, als Jüdinnen und Juden aus den KZ kamen, bis zur Gründung des Staates im Jahr 1948 zu kurz. Die Opfer des Holocaust hatten kaum Zeit, ihre Traumata zu überwinden und sahen sich plötzlich in einer Situation, in der ihr Kampf um eine sichere Heimat zu anderem Unrecht führte. Es gelang ihnen nicht, anzuerkennen, dass die dort lebende Bevölkerung die „Spätkommenden" zunächst wohlwollend aufgenommen hatte, obwohl sie auf einen Teil ihres Landes verzichten musste. Die Zerstörung von Häusern und ganzen Dörfern belegt, dass es der jüdischen Bevölkerung nicht um ein Zusammenleben ging. Man suchte keine Lösung für beide Völker, sondern hatte nur die Sicherheit des neuen jüdischen Staates im Sinn.
Im Laufe der Jahre haben die Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft immer wieder gezeigt, dass sie bereit waren, mit den Israelis zusammenzuleben. Heute, nach diesem grauenhaften Krieg in Gaza, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein vertrauensvolles Miteinander überhaupt noch möglich ist.
Deshalb ist die Rede von der Zwei-Staaten-Lösung oder der Ein-Staaten-Lösung nur ein Mantra, das der Westen aus Verlegenheit vor sich herträgt, weil er sich nie ernsthaft mit einer richtigen Lösung des Konflikts beschäftigt hat. Nach diesem brutalen Krieg sehe ich keine Lösung mehr. Israel trägt jetzt ein Kainszeichen auf der Stirn.
Noch unterstützt der Westen Israel aus eigenen Interessen. Aber es zeigt sich, dass schon heute z. B. der Globale Süden eine andere Politik im Nahen Osten einschlagen würde.
Meine Befürchtung ist, dass sich die jüdische Geschichte ein weiteres Mal wiederholen wird. Es gab immer wieder Versuche von Juden, im Heiligen Land zu siedeln, doch sind sie damit letztlich immer gescheitert - wie beispielsweise unter den Griechen und Römern. Es drängt sich der Gedanke auf, dass es ein jüdisches Schicksal ist, keine dauerhafte friedliche Heimat zu finden. Das Judentum hat in der Geschichte nur überlebt, weil es irgendwo in der Welt immer eine Gruppe gab, die das Judentum weitergetragen hat. Als Minderheit wurden sie verfolgt, und als Mehrheit wurden sie im Heiligen Land von Opfern zu Tätern.
Abbildung 3 Gefangennahme palästinensischer Zivilisten durch IDF 1948
Vielleicht stimmt der biblische Satz tatsächlich: „ein Volk, es wohnt für sich - es zählt sich nicht zu den Völkern".
Ich hoffe jedoch, dass diejenigen Israelis, die sich seit vielen Jahren um ein Zusammenleben mit den Palästinensern bemühen und sogar Repressalien von der eigenen Bevölkerung und Regierung dafür in Kauf nehmen müssen, nicht vergessen werden.
Der jetzige Gazakrieg hat auch innerhalb Israels zu einer Radikalisierung und Abkehr von demokratischen Prinzipien geführt. So klären nicht nur die Regierung und das Militär ihre eigene Bevölkerung nicht darüber auf, was in Gaza passiert, auch die Medien (bis auf die liberale Zeitung „Haaretz") berichten kaum über den Tod und die Zerstörung im Gazastreifen. Konsequenterweise hat die israelische Regierung den Sender AI Jazeera zum Sender der Hamas deklariert und ihn in Israel verboten. Der katarische Sender hatte berichtet, was der israelischen Bevölkerung vorenthalten werden soll.
Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung interessiert sich nur für ihre eigenen Opfer, nicht aber für die mittlerweile über 35.000 toten Palästinenserinnen und Palästinenser und die Zerstörung ihrer Häuser, Krankenhäuser, Universitäten und Moscheen.
Deshalb kann man von der Mehrheit der Juden in Israel nicht als „Licht für die Völker" sprechen, (Jesaja 49,6). Vielmehr passt hier das Zitat: „Ein Volk, es wohnt für sich. Es zählt sich nicht zu den Völkern".
Judith Bernstein im Gespräch
HMV: Liebe Judith, die Kamera läuft – ich bin sehr froh, dass wir nach vielen, vielen Monaten, in denen wir darüber gesprochen haben, dass wir ein Interview zusammen machen könnten, nun heute endlich zusammensitzen und dass es geklappt hat und dass wir einfach einmal über die Fragen, die ich mir überlegt habe, sprechen können.
Ich habe zwei Interessen. Das eine Interesse, das ganz große, ist an dir, an deiner Person.
Das andere Interesse gilt den ewig aktuellen und leider nie gelösten Problemen des Zusammenlebens zwischen Israelis und Palästinensern. Wir erleben gerade den schrecklichen Krieg in Gaza und da kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum, auch darüber zu sprechen.
Judith Bernstein: Natürlich.
HMV: Aber meine erste Frage ist auf deine familiäre Geschichte bezogen. Deine Eltern sind vor den Nazis aus Nazi-Deutschland geflüchtet, wurden weder in den USA noch in irgendeinem anderen Land dieser Erde damals aufgenommen.
Und es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als nach Palästina, also in das damalige „Britische Mandatsgebiet“ zu gehen und dort eine neue Zukunft aufzubauen. Wie ist das damals abgelaufen?
Judith Bernstein: Also meine Eltern waren weder religiös noch waren sie Zionisten. Und sie sind wirklich, wie du sagst, nach Israel gegangen oder damals Palästina, weil kein anderes Land sie aufnehmen wollte. Man brauchte damals dieses Affidavit, das hatten sie nicht.
Abbildung 4 Affidavit (lat.: er oder sie hat zugesichert) ist eine vereidigte Versicherung für andere LänderBeispiel: Affidavit für Paul Dessau
Und nolens volens sind sie dann damals nach Palästina gegangen. Meine Mutter hat noch Hitler in Bayreuth gehört und dann hat sie gesagt, sie geht weg.
Ihre Eltern, typisch, haben gesagt: „Nein, das geht so vorbei und wir bleiben. Später hat sie versucht, ihre Eltern auch nach Palästina zu bringen. Aber da ist der Krieg ausgebrochen und da war es zu spät. - Und dann sind sie in Auschwitz gelandet.
Abbildung 5 Lotte Strauss, geb. Stein, zwischen 1940 und 1944
HMV: Aber zu diesem Zeitpunkt, als der Krieg ausbrach, da waren deine Eltern schon …?
Judith Bernstein: … die sind 1935, unabhängig voneinander, beide 1935, nach Palästina gegangen.
HMV: Haben sie sich dort kennengelernt?
Judith Bernstein: Nein, sie kannten sich schon als Kinder. Ich habe sogar ein Foto, wo meine Mutter, glaube ich, 3 ist und mein Vater 7. Und zwar, die Mutter meiner Mutter kam wie mein Vater aus Gelnhausen … in Hessen – dem Ort, der sich rühmte, der erste judenfreie Ort in Hessen zu sein. Und mein Vater und die Familie, die wohnten in Gelnhausen, die Familien kannten sich. Und dann ist meine Mutter manchmal zu ihren Großeltern, die dort gewohnt haben, und hat sie besucht – und da hat sie auch meinen Vater und seine Brüder kennengelernt.
Abbildung 6 Judith Bernsteins Eltern Lotte Stein und Kurt Strauss als Kinder in Gelnhausen