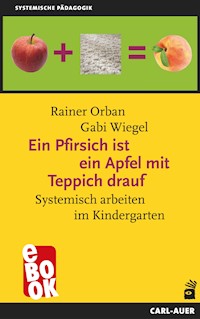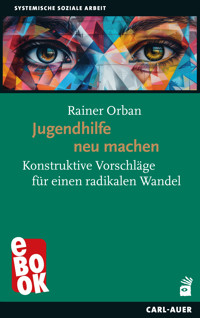Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soziale Arbeit
- Sprache: Deutsch
Geld ist nicht das Problem Das System der Kinder- und Jugendhilfe, wie man es seit Jahrzehnten kennt, ist am Ende. Die stetig steigenden Fallzahlen und die zunehmende Komplexität der Fälle sind mit den bestehenden Strukturen nicht zu bewältigen. Darunter leiden neben der Qualität der Sozialen Arbeit vor allem die betreuten Familien und ihre professionellen Helfer:innen. Dabei wäre prinzipiell ausreichend Geld im System, es wird jedoch falsch eingesetzt. Rainer Orban fordert mit diesem Buch dazu auf, Jugendhilfe komplett neu zu denken. Anhand der Kinder- und Jugendhilfestatistik und seiner eigenen jahrzehntelangen Erfahrung nimmt er eine schonungslose Bestandsaufnahme vor und bewertet die aktuellen Konzepte vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ausgehend von der aktuellen Datenlage stößt Orban zunächst eine kritische Diskussion über gesellschaftliche Fehlentwicklungen infolge des Neoliberalismus an. Im zweiten Teil des Buches geht es dann darum, ein Gesamtverständnis des Menschen als biopsychosoziales Wesen zu entwickeln. Auf der Basis von Otto Scharmers Theorie U formuliert Orban eine schlüssige Idee, wie Kinder- und Jugendhilfe neu zu konzipieren ist. Der Autor: Rainer Orban, Diplom-Psychologe; Systemischer Therapeut (SG, DGSF), Systemischer Supervisor (SG) und Coach sowie Video Home Trainer. Er ist als Fort- und Weiterbilder, Unternehmensberater, Supervisor und Therapeut tätig und Leiter des DGSF-Instituts n.i.l. in Osnabrück. Außerdem ist er Autor mehrerer Bücher und Fachartikel. Veröffentlichungen u. a.: "Ein Pfirisch ist ein Apfel mit Teppich drauf. Systemisch arbeiten im Kindergarten" (6., vollst. überarb. Aufl. 2023).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
Systemische Soziale Arbeit
»Sozialarbeiterische Minimalethik: Steigere Alternativität!«
Peter Fuchs
Soziale Arbeit, als Einheit von Sozialarbeit und Sozialpädagogik, kann inzwischen als etablierte Profession und als aufstrebende Disziplin der Sozialwissenschaften gelten. Hinsichtlich der Profession lässt sich die Soziale Arbeit als systemische Praxis beschreiben und erklären sowie mit den vielfältigen Handlungsoptionen systemischer Methodik anreichern. In der Wissenschaft der Sozialen Arbeit sind Systemtheorie und Konstruktivismus als Paradigmen anerkannt.
Systemische und systemtheoretische Konzepte entsprechen den komplexen Aufgabenfeldern und Herausforderungen der Sozialen Arbeit in besonderer Weise. Sie erlauben es, einen Blick zu schulen und zu vertiefen, den die Soziale Arbeit seit jeher einzunehmen versucht: einzelne Menschen bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Lebensführung nicht mit ihren Problemen zu verwechseln. Vielmehr geht es Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in ihrer Unterstützungsarbeit darum, die sozialen Verhältnisse, die systemischen Kontexte einzublenden, die die Verhaltensweisen von Menschen, ihre Eigenschaften und Probleme herausfordern, verfestigen und auch lösen können. Die klassische These, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, lässt sich mit der Systemtheorie nicht nur postulieren, sondern wissenschaftlich darstellen und methodisch so nutzen, dass überraschende Potenziale des Denkens und Handelns kreiert werden können.
Die Reihe Systemische Soziale Arbeit verfolgt das Ziel, die Potenziale und Grenzen der systemischen Sozialarbeitspraxis und Sozialarbeitstheorie auszuloten und weiterzuentwickeln. Dabei sollen das gesamte Spektrum der Sozialen Arbeit, ihre Vielschichtigkeit, ihre zahlreichen Arbeitsfelder und Rahmenbedingungen ausgeleuchtet und methodisch fundiert werden. Damit bieten die Bücher der Reihe praktizierenden Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen sowie Studierenden und Lehrenden Perspektiven an, die den Möglichkeitsraum des Denkens und Handelns nachhaltig erweitern.
Prof. Dr. Heiko Kleve Herausgeber der Reihe Systemische Soziale Arbeit
Rainer Orban
Jugendhilfe neu denken
Eine konstruktive Streitschrift
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Systemische Soziale Arbeit«
hrsg. von Heiko Kleve
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagfoto: © gassh – stock.adobe.com
Redaktion: Markus Pohlmann
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN: 978-3-8497-0580-0 (Printausgabe)
ISBN: 978-3-8497-8523-9 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +4962216438-0 • Fax +4962216438-22
Inhalt
Vorwort
Dank
Kurzüberblick über dieses Projekt
1 Ein »Weiter so« wird nicht funktionieren – Die aktuelle Situation in der Kinder- und Jugendhilfe
1.1 Zahlen, Daten, Fakten zur Jugendhilfe – Mit einigen subjektiven Reflexionen
1.1.1 Zahlen, Daten und Fakten
1.1.2 Die Jugendämter erheben ihre Stimme
1.1.3 Ein Blick nach vorn
1.1.4 Ein Blick über den Tellerrand
1.2 Was ist los in unseren westlichen Gesellschaften? Wie der Neoliberalismus die Demokratie schleift
1.2.1 Kinderarmut ist kein Schicksal
1.2.2 Ist der Neoliberalismus unkaputtbar?
1.2.3 Die Euro-Finanzkrise – Neoliberalismus at its best
1.2.4 Die Berliner Erklärung
1.2.5 Die Unfähigkeit, in Deutschland über Geld und Armut zu reden
1.2.6 Politik – zurück in die Realität, bitte!
1.2.7 Jugendhilfe kann was – mit klarem Bewusstsein und offenem Herzen: das FipS-Projekt
1.2.8 Frühe Interventionen rechnen sich
1.2.9 Die Welt steht nicht still, nur weil uns dies vielleicht lieber wäre
1.2.10 Gerechtigkeit und die Wiederentdeckung des Gemeinwohls
1.2.11 Und nun: Was ist bei all dem die Aufgabe Sozialer Arbeit?
1.3 Eine subjektive Istzustandsbeschreibung – mit einigen objektiven Daten
1.3.1 Einleitung
1.3.2 Ergebnisqualität: Heimerziehung – Mehr als 50% Abbrüche – Ist das wirklich unser Anspruch?
1.3.3 Eingangsqualität: Vor die Welle kommen!
1.3.4 Prozessqualität: Fehlende Motivation ist nicht das Problem
1.3.5 Mangelnde Fachlichkeit auf allen Ebenen
1.3.6 Zusammenarbeit mit den Familien, Arbeit am Thema Familie Aus der aus Steuergeldern finanzierten Forschung wissen wir: Einer der wichtigsten Wirkfaktoren für gelingende Jugendhilfeverläufe ist die gelingende Kooperation mit der Familie.
1.3.7 Unter Profis: Konkurrenz und Misstrauen statt Kooperation
1.3.8 Kinderschutz – Gewalt gegen Kinder
1.3.9 Strukturqualität: Konzepte und Leistungsbeschreibungen – meist mehr Schein als Sein
1.3.10 Haben Sie Rückführungskonzepte? Haben wir nicht, rechnet sich nicht!
1.3.11 Frühintervention statt Prävention und das Gießkannenprinzip
1.3.12 Führungskräfte, die managen, aber nicht führen
1.3.13 Ausbildung der Fachkräfte – im Ergebnis ein Trauerspiel
1.3.14 Die unheimliche Macht der Verwaltung – Plädoyer für eine neue Form der Kooperation
1.3.15 Fazit
2 Grundlage einer neuen Jugendhilfe
2.1 Der Mensch – das biopsychosoziale Wesen
2.1.1 Es braucht ein ganzheitliches, biopsychosoziales Verständnis des Menschen
2.1.2 Das Gehirn ist nicht zum Denken da!
2.1.3 Die Bindungstheorie, eine systemische Theorie
2.1.4 ACE-Studie
2.1.5 Belastete Familien in Deutschland
2.1.6 Familien, die Kinder in diese Welt setzen, benötigen sichere Rahmenbedingungen.
2.2 Theorie U – Von der Zukunft her führen
2.2.1 Theorie U
2.2.2 Krise als Chance zum Wandel
Nachwort
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Über den Autor
Vorwort
»Nö ist das neue Basta.« Der Beginn eines sehr erhellenden Essays zur Krise der SPD von Bernd Ulrich in Die Zeit im Sommer 2024. »Nö«, das war die Antwort des Bundeskanzlers auf die Frage, ob er Lust habe, sich an der demokratischen Debatte über die Krise von SPD und Regierung zu beteiligen.
Basta – der autoritäre Schlag ins Gesicht, ausgeführt durch frühere Generationen. Das Wörtchen »Nö« aus dem Mund eines Erwachsenen hingegen spiegelt den gestreckten Mittelfinger wider. Garniert mit Desinteresse und einem Hauch Arroganz.
Es mag en vogue sein, sich unbeeindruckt gegenüber essenziellen Fragen zu geben und gelassen an ihnen vorbeizuschlendern. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Reaktion auch nur im Ansatz angemessen ist.
Seien Sie an dieser Stelle vorgewarnt: Das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, ist zugleich wissenschaftlich fundiert und persönlich: Nach 23 Jahren in leitenden Funktionen in der Jugendhilfe bringen mich die dahingerotzten Nös zum Würgen.
Krise bedeutet Wendepunkt. Eine Zeitenwende auszurufen und es sich dann in der Komfortzone des Nichtagierens bequem zu machen ist eine Frechheit. Reden wir Klartext: Wir befinden uns in einem epochalen Umbruch. Für mich die angemessene Beschreibung unserer Zeit. Für rhetorische Weckrufe, die generell wenig sinnstiftend sind, haben wir keine Zeit mehr. Kein bedeutungsschwangeres Sinnieren mehr. Empörung beim Latte-macchiato-Genuss im gentrifizierten Szenebezirk reicht nicht. Es ist fünf nach zwölf, und es stellt sich nicht mehr die Frage, wann wir beginnen zu handeln.
Die aktuellen Krisen sind fundamental und gefährlich. Euphemismus ist fehl am Platz. Viele die Gesellschaft tragende soziale Prozesse und Strukturen befinden sich in einem Zustand vergleichbar dem des Multiorganversagens. Im politischen Raum existiert keine wahrnehmbare Stimme, die all das in den Blick nimmt. Die die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen schonungslos benennt und die vor allem entsprechend handelt.
Das Gesundheitswesen siecht vor unseren Augen dahin. Krankenhäuser schließen, Entbindungsstationen werden wegrationalisiert. Pflegekräfte, speziell in der Intensivpflege, fehlen an allen Ecken und Enden.
Kindertagesstätten und Krippen schreien nach Hilfe und werden mit beschwichtigenden symbolischen Gesten abgefrühstückt. Zu wenig Plätze; Betreuungsschlüssel, die vor Kinderfeindlichkeit nur so triefen; ständig wechselnde Schließzeiten aufgrund von Personalmangel; Fachkräfte, die physisch und psychisch am Ende ihrer Kräfte sind; Eltern, die sich zwischen Arbeit und Kinderbetreuung zerreißen müssen; kleine Kinder, die eher verwahrt als gesehen und ins Leben begleitet werden.
Der Jugendhilfe, der ich dieses Buch widme, stürzen seit Jahren tragende Säulen ein. Ihr Zustand ist an vielen Stellen desaströs. Der Personalmangel ist – wer hätte es vermutet? – ein grundlegendes Problem. Wer davon überrascht ist, hat die letzten Jahre intellektuell auf Durchzug geschaltet.
Die immer wieder dahingepöbelte Antwort: Nö. So schnell geht das nicht.
Es ist ein fataler Irrglaube, Schnelligkeit sei der einzige Faktor, den es zu bedenken gäbe. Wir müssen zu Aktivisten werden, die dazu bereit sind, radikal neu zu denken, wenn wir die Frage, ob wir unsere gesellschaftlich relevanten Systeme als Ganzes erhalten wollen – und somit unsere Leistungsfähigkeit, bejahen.
Albert Einstein brachte es mit dem Gedanken treffsicher auf den Punkt: »Probleme kann man nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.«
Bis hierher sollte deutlich geworden sein, dass dieses Buch persönlich ist. Meine Passion sowie die Betrachtung von Fakten tragen mich seit Jahrzehnten durch meine Tätigkeiten im sozialen Bereich. Mein Weg führte mich vor meinen Leitungstätigkeiten in viele Bereiche: angefangen als Aushilfe in der Altenpflege, später als Betreuer von geflüchteten bosnischen Kindern in einem Grenzdurchgangslager bis zur Jugendhilfe als pädagogische Aushilfskraft.
Ich schreibe also zum einen aus der Perspektive desjenigen, der nahezu 24 Jahre Leitungserfahrung in den Feldern der Kinder- und Jugendhilfe hat und der unter anderem als Vorstand einer Jugendhilfeeinrichtung mit 180 Mitarbeitenden Verantwortung trägt.
Zudem schreibe ich als Freiberufler. Als Leiter eines Instituts für Systemische Fort- und Weiterbildungen gebe ich seit knapp 18 Jahren Fortbildungen in diesem Bereich, biete Supervisionen an, begleite Fachkräfte in mehrjährigen Weiterbildungen, arbeite als Coach und Berater von Führungskräften im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich und in der Wirtschaft. All diese Erfahrungen und Perspektiven sind in das vorliegende Buch eingeflossen.
Ich liebe die Arbeit in der Jugendhilfe, denn sie ist Sinnstiftung pur. Mit großem Respekt betrachte ich, wie die oftmals schwer verletzten Kinder und Jugendlichen mit so viel Kraft und Energie dennoch etwas vom Leben wollen. Ihre Eltern, die fast alle, mitunter auf ungewöhnliche Weise, ihre Kinder lieben und oft vom Leben überfordert und gezeichnet sind. Das Brennen der sozialen und pädagogischen Fachkräfte für ihre unfassbar herausfordernde Arbeit löst in mir Hochachtung aus.
Diese Kinder, Eltern und Fachkräfte spielen in vielen gesellschaftlichen Diskursen unserer Zeit keine Hauptrolle. Wir degradieren sie zu Komparsen, die nicht wahrgenommen werden. Sie werden nicht gesehen, weil wir als Gesellschaft uns ganz offensichtlich nicht mit den möglichen Verlierern1 des neoliberalen Denkens der letzten 40 Jahre auseinandersetzen wollen. Nö. Keine Lust.
Ich bin kein Geschichtenerzähler, der nach 30 Jahren ein echauffiertes Publikum sucht, um sich Luft zu machen. Dieser Band – das erste von zwei aufeinander aufbauenden Büchern – hat den Anspruch, den Finger in die Wunde zu legen. Darunter mache ich es nicht mehr. Meine Perspektive ist vergleichbar damit, die Tiefsee mit einer Taschenlampe zu erkunden. Das Buch ist ein Anfang, dem sich hoffentlich viele anschließen, um gemeinsam, ganz im Sinne Einsteins, Problemen mit frischen Denkansätzen zu begegnen und endlich zu handeln. Gemeinsam können wir die Tiefsee hell erleuchten.
Osnabrück, im Januar 2025
Rainer Orban
1In gesamten Text nutze ich für Personenbezeichnungen abwechselnd die männliche und weibliche Form. Sofern nicht explizit kenntlich gemacht, sind immer alle Menschen jeglichen Geschlechts gemeint.
Dank
Mein Dank gilt den wunderbaren Menschen bei Carl-Auer. Mit jedem ist der Kontakt einfach wohlwollend und fachlich großartig. Matthias Ohler danke ich sehr dafür, dass er mich ermutigt hat, dieses Buch zu schreiben. Ralf Holtzmann gilt, nach all den Jahren, die wir uns kennen, mein Dank für die erneute unterstützende Neugier und den Mut, dieses Projekt anzupacken. Dem Lektor dieses Buches, Markus Pohlmann, danke ich sehr für seinen präzisen, mutigen Blick, der meinem Buch sehr gutgetan hat.
Mein tief empfundener Dank gilt meiner Frau Gabi Wiegel für ihre Unterstützung. Ohne ihr Verständnis, was dieses Projekt für mich bedeutet, wäre das vorliegende Buch nicht entstanden.
Meinem Kollegen Stefan Jacobsen danke ich für sein Vertrauen und seine Geduld auf unserem gemeinsamen Weg in den letzten zehn Jahren. Ohne deine Begleitung wäre ich heute nicht der, der ich bin.
Ali Tumani, meinem Kollegen und Freund. Sein kontinuierlicher Support sowohl im Vorfeld als auch während des Schreibprozesses war von großem Wert.
Ein außergewöhnlicher Dank geht an Inga Kröger. Ihre Leidenschaft für Sprache und ihr tiefes Verständnis für den Inhalt haben nicht nur das Endprodukt verfeinert, sondern mich auch inspiriert und motiviert.
Kurzüberblick über dieses Projekt
Dies hier ist mehr als ein Buch. Es ist tatsächlich ein Projekt. In den Vorgesprächen mit dem Team vom Carl-Auer Verlag war schnell deutlich: Dies soll mehr sein als ein kurzer Schrei des Protests. Eine Beschreibung der Situation allein würde meinem Anspruch nicht gerecht.
Geplant sind zwei Bände. Der vorliegende erste Band fokussiert zunächst in Kapitel 1 auf die aktuelle Situation in der Kinder- und Jugendhilfe. In Kapitel 2 geht es dann darum, die theoretische Basis für eine neue Jugendhilfe zu legen. Den Ausgangspunkt bilden die beiden Fragen: Wie wird der Mensch zum Menschen? Was bedeutet das für den Kontext der Sozialen Arbeit? Die allgemeine Leitfrage lautet: Wie können wir in disruptiven Zeiten Zukunft gestalten?
Bei uns im Institut für Systemische Fort- und Weiterbildungen in Osnabrück hängt eine Postkarte, die ein Teilnehmender mitgebracht hat. Darauf steht: »Wer Pommes holt, muss anderen welche mitbringen.« So ist es. Und wer den Finger in die Wunde legt, der muss Vorschläge machen, wie es denn anders und besser gehen kann. Zum Teil werden solche Ideen in diesem ersten Band schon durchschimmern. Der zweite Band, der im Herbst 2025 erscheinen soll, wird genauere Antworten geben sowie einen Einblick in Modelle gelingender Praxis. Das System, wie wir heute Kinder- und Jugendhilfe organisieren, mag zwar am Ende sein. Engagierte Fachkräfte mit wunderbaren Ideen gibt es allerdings vielerorts.
1 Ein »Weiter so« wird nicht funktionieren – Die aktuelle Situation in der Kinder- und Jugendhilfe
Dieses Kapitel ist der Kern des vorliegenden Bandes. Ich werde die gegenwärtige Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachten und Ihnen so einen umfassenden Blick auf die derzeitige Lage verschaffen.
Zunächst erläutere ich diese in Kapitel 1.1 mit aktuellen Zahlen. Es gibt aussagekräftige Zahlen zu den Investitionen in die Kinder- und Jugendhilfe. Diese werde ich Ihnen ebenso präsentieren wie Fallzahlen und Prognosen möglicher Bedarfe. Zudem werde ich aus öffentlichen Stellungnahmen von Betroffenen in der Kinder- und Jugendhilfe zitieren. Es kann tatsächlich niemand sagen, er oder sie wüsste nicht um die Situation.
Daran schließt, aus einer systemtheoretischen Perspektive sehr passend, in Kapitel 1.2 eine Analyse der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu dieser Situation geführt haben, an. Dass wir in einer solch katastrophalen Situation sind, ist kein Zufall. Diese Situation ist politisch gemacht. Sie ist das Ergebnis von ideologischen Entscheidungen. Falschen Entscheidungen. Das können wir heute sehr klar konstatieren.
Wir wissen um die Situation, es passiert nichts. Im neuesten Buch von Fritz B. Simon mit dem aufschreckenden Titel Die kommenden Diktaturen. Ein Worst-Case-Szenario, zitiert er Bruno Latour und Nicolaj Schultz (Simon 2024, S. 23; aus Latour u. Schultz 2022, S. 28):
»Bis zum Überdruss ist von ›Revolution‹, von ›radikaler Transformation‹, von ›Kollaps‹ die Rede, aber es ist nur zu sichtbar, dass nichts diese Ängste in ein mobilisierendes Aktionsprogramm, das den Herausforderungen entspräche, umsetzt.«
So ist es. Die vorliegenden Daten zur Kinder- und Jugendhilfe sind alarmierend. Viele Experten äußern sich öffentlich in der hier angedeuteten Richtung. Es fehlt ein wirkliches Aktionsprogramm. Die Vorschläge zur Veränderung bleiben, systemtheoretisch gesprochen, alle in derselben Ordnung. Ich sehe keine wirkliche Bereitschaft, etwas von Grund auf zu ändern. Die Vorschläge, so gut sie gemeint sind, dienen meist der Stabilisierung des bestehenden Systems, ohne anzuerkennen, dass das System als solches gescheitert ist.
Eines bereits vorweg. Ich bin sicher: Es ist genug Geld im System, sicherlich mehr als in den meisten Ländern dieser Welt. Die Frage ist, darauf werden wir dann in Kapitel 1.3 eingehen: Wie steht es denn um die Qualität der Umsetzung der Arbeit? Innerhalb dieses Buches ist dies der persönlichste und intensivste Abschnitt.
Zutrauen und Zumutung sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Ich vertraue den Kolleginnen und Kollegen, die in den Feldern der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, sehr. Ich werde einigen hier vieles abverlangen und auch sicherlich vieles zumuten.
1.1 Zahlen, Daten, Fakten zur Jugendhilfe – Mit einigen subjektiven Reflexionen
Während ich Ende Juli 2024 an diesem Text sitze, erreicht mich über einen Newsfeed der folgende Kommentar aus der FAZ vom 27.07.2024, betitelt mit »Zu viel Geld für die Gesundheit«. Ich bin kein ausgewiesener Leser dieser Zeitung. Um mich außerhalb meiner Blase zu bewegen, schaue ich immer wieder gerne in Artikel, die nicht hinter einer Paywall liegen. Ich möchte verstehen, wie Menschen mit anderen Überzeugungen die Welt betrachten. Der Kommentator, Sebastian Balzter (2024), schreibt dort:
»Die vielen Milliarden Euro, die den Statistiken zufolge in das Gesundheitssystem fließen, gibt es tatsächlich. Aber auch die Patienten bilden sich ihre Schwierigkeiten im Alltag nicht bloß ein. Wie passen diese beiden Befunde zusammen? […] Aufwand und Ertrag passen nicht mehr zusammen […] denn das viele Geld, das Beitrags- und Steuerzahler aufbringen, wurde in der Vergangenheit zu oft dafür eingesetzt, Besitzstände zu wahren und tiefer liegende Missstände zu kaschieren.«
Ich pflichte dem Autor bei und korrigiere ihn minimal fragend: Wieso »in der Vergangenheit«? Bis heute geht es darum, Besitzstände zu wahren und tiefer liegende Missstände zu kaschieren. Nicht nur im Gesundheitssystem, sondern auch in den Arbeitsfeldern, um die es hier geht.
1.1.1 Zahlen, Daten und Fakten
Beim Thema Geld angelangt, schauen wir, wie es in Deutschland in der Kinder- und Jugendhilfe gemäß den vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2022 aussieht (Abb. 1, siehe S. 16), veröffentlicht unter anderen im Onlinemagazin KomDat (Rauschenbach 2023).
Die Ausgaben im kompletten Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2022, inklusive Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung (HzE), sonstigen Einzelfallhilfen, Kinder und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit und weiterer Ausgaben, betrugen 66 Mrd. Euro. Allein im Bereich Hilfen zur Erziehung verzeichnen wir seit 2010 eine Verdopplung der Ausgaben.
Halten wir kurz inne. Volkswirtschaftlich bewertet, sind die hier als Ausgaben bezeichneten Zahlen Unsinn. Ausgaben beziehen sich, volkswirtschaftlich betrachtet, auf den Einsatz von finanziellen Mitteln für den Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Sie besitzen typischerweise keinen langfristigen Mehrwert, sondern befriedigen unmittelbare Bedürfnisse und Wünsche. Investitionen beziehen sich, davon abgegrenzt, auf den Einsatz von finanziellen Mitteln mit dem Ziel, zukünftige Erträge zu generieren. Investitionen sollen langfristige Werte schaffen, zur Produktivitätssteigerung und zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen.
Reden wir Tacheles: Die Gelder, die in die vielfältigen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe fließen, von den Frühen Hilfen mit Beginn der Schwangerschaft bis hin zur Berufsausbildung von älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sind eindeutig Investitionen. Was sonst?
Klaus Roos, Diplom-Psychologe und Diplom-Volkswirt, publizierte bereits 2005 dazu eine bahnbrechende Studie im Rahmen seiner Dissertation mit dem Titel »Kosten-Nutzen-Analyse von Jugendhilfemaßnahmen«. Er zeigte folgende Kosten-Nutzen-Relation im Sinne des SROI (Social Return on Investment) auf: Bei Männern konnte er belegen, dass ein in Heimerziehung eingesetzter Euro sich im weiteren Lebensverlauf gesamtwirtschaftlich mit 2,95 Euro auszahlt. Bei Frauen ergab sich eine positive Nutzen-Kosten-Relation von 2,005 Euro.
Dies wird auch im auf S. 17 zitierten Positionspapier des Bundesverbands Caritas Kinder- und Jugendhilfe e. V. vom 03.06.2024 angeführt (BVkE 2024, S. 3).
Abb. 1: Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand in Deutschland für die Kinder- und Jugendhilfe im Zeitraum 2000–2022, gegliedert nach Leistungsbereichen, mit Angabe der prozentualen Veränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren; absolute Angaben in Milliarden Euro (aus Onlinemagazin Komdat, Juni 2023, Heft 2+3, 26. Jg.; Rauschenbach 2023)
»Daten zum Social Return on Investment (SROI) belegen eindeutig, dass jede investierte Ressource in die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen langfristige positive Auswirkungen hat, die sich in vielfältiger Weise auszahlen.
Eine umfassende Analyse von SROI-Daten zeigt, dass die richtige Investition in die Kinder- und Jugendhilfe nicht nur die individuelle Lebensqualität der jungen Menschen verbessert, sondern auch langfristige wirtschaftliche und soziale Vorteile für die Gesellschaft insgesamt bietet. Durch die Bereitstellung angemessener Bildung, Betreuung und Unterstützung in der Kindheit und Jugend werden die Grundlagen für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft gelegt.
Investitionen in die Kinder- und Jugendhilfe tragen dazu bei, Probleme wie Armut, Kriminalität, Arbeitslosigkeit und psychische Erkrankungen zu reduzieren, was langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen in anderen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Justiz und den sozialen Sicherungssystemen führt. Darüber hinaus stärken sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale wie berufliche Teilhabe, was wiederum das Wirtschaftswachstum und die Innovation fördert. Ebenso schaffen die sozialen Unternehmen vor Ort Wirtschaftskraft, welche durch Sozialabgaben und Sekundäreffekte kommunale Wirtschaftsstrukturen stärkt, Steuereinnahmen für den Bund generiert und Beiträge für die Sozialkassen liefert. Dabei entsteht ein Ungleichgewicht von Finanzierung durch die Kommunen einerseits und dem Rückfluss von Finanzmitteln auf Bundesebene andererseits. Dies spiegelt sich nicht in den oben dargestellten Ausgaben wider.«
Meines Erachtens ist die Angelegenheit noch deutlich komplexer. Die Kinder- und Jugendhilfe ist mit 70 Mrd. Euro, die hier investiert werden, ein enormer Wirtschaftsfaktor. Ich teile die fordernde Sicherheit der Autoren dieses Positionspapiers nach weiteren massiven Investitionen nicht. Stattdessen ist ein Systemwechsel notwendig. Geld ist meines Erachtens mehr als genug da.
Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang noch differenzierter auf die Investitionen gucken.
Bezogen auf die gesamten Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe, also inklusive der Bereiche Kindertagesbetreuung etc., ist es zunächst interessant zu analysieren, wie sich je nach Bundesländern die Investitionen pro Kopf (geförderten Minderjährigen) unterscheiden. Abb. 2 und die Abb. 3 bis Abb. 8 stammen aus dem Kinder- und Jugendhilfe Report 2024 (Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024).
Abb. 2 verdeutlicht, dass es enorme Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern gibt. Die Autoren des Reports schreiben dazu (ebd., S. 47):
»Diese reichen von 3611 EUR pro einer unter 18-jährigen Person in Baden-Württemberg und 3692 EUR in Thüringen am unteren Ende der Skala bis zu höchsten Ausgabenwerten von 5367 EUR in Berlin sowie von 8677 EUR pro U18 in Bremen, ein insgesamt untypisch hoher Wert. In den ostdeutschen Ländern – mit Ausnahme von Thüringen – und den Stadtstaaten sind zudem die Ausgaben deutlich höher als in den westlichen Flächenländern, was vor allem mit dem ungleichen Ausbau der Kindertagesbetreuung zu tun haben dürfte.«
Bei der Diskussion der Ursachen und Hintergründe für diese Diskrepanzen, die ich in Kapitel 1.2 vorstellen werde, kommen wir hier bereits nicht daran vorbei zu erkennen, dass wirtschaftliche und soziale Faktoren eine große Rolle spielen. Es existieren robuste Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Bezug sozialer Leistungen auf der einen Seite und den notwendigen kompensatorischen Investitionen auf der anderen Seite.
Dass die Forscherinnen und Forscher dies so sehen, macht auch folgende Einschätzung deutlich (ebd., S. 97):
»Sozioökonomisch belastende Lebenslagen und damit einhergehende ökonomische Ungleichheiten mit der Folge von sozialen Ausgrenzungsprozessen können sich auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber auch das Erziehungsverhalten von Eltern auswirken. Obwohl noch nicht umfassend erforscht, so sind in diesem Zusammenhang doch die Folgen von prekären Lebenslagen auf Bildungserfolg, Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Freizeitgestaltung, delinquentes Verhalten, Sozialkontakte oder auch familiäres Zusammenleben bis hin zu Erziehungsstilen und Kindesvernachlässigungen belegbar […] In der KJH-Statistik kann der Bezug von monetären Transferleistungen als Kennzahl für prekäre Lebenslagen abgebildet werden. Im Ergebnis bestätigen die Daten auf der Ebene der Einzelfälle die Hypothese, dass es einen Zusammenhang von Armutslagen und einem erhöhten Bedarf an HzE gibt. Anders formuliert: Adressat:innen der HzE sind überdurchschnittlich stark von sozioökonomisch prekären Lebenslagen betroffen […] Die Auswertungen der amtlichen Statistik zeigen, dass 29,8 % der Familien, denen 2021 eine HzE neu gewährt wurde, auf Transferleistungen angewiesen waren […] Betrachtet man nur die über den ASD organisierten Hilfen, steigt der Anteil auf 54,0 %.«
Abb. 2: Reine Ausgaben der öffentlichen Hand pro Minderjährigen inder Bevölkerung (Länder; 2006 und 2021; Angaben in EUR; Differenz absolut und prozentual) (aus Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024, S. 47)
Wir diskutieren in Deutschland über einen Miniprozentsatz von Menschen, die womöglich Betrug beim Bürgergeld begehen oder sich weigern, eine Arbeit aufzunehmen. Ernsthaft? Sollte das unser thematischer Fokus sein?
Wir statten Familien mit Kindern chronisch mit zu wenig Geld aus. Wir wissen um die daraus resultierenden Risikofaktoren und kompensieren dies mit Milliardenbeträgen in den Hilfen zur Erziehung. Wir packen das Übel nicht bei der Wurzel, sondern behandeln die Symptome.
Ist das die Politik, die wir im 21. Jahrhundert erwarten sollten?
Bevor ich vollends eskaliere, machen wir weiter:
Zusätzlich spielt, wie von den Autoren des Reports erwähnt, es auch eine Rolle, wie hoch die öffentlichen Investitionen in Kindertagesbetreuung sind.
Verweilen wir noch einen Moment bei den gesamtdeutschen Zahlen über alle Bereiche der Kinder und Jugendhilfe. Schauen wir uns an, wie hoch der Anteil der Investitionen verglichen mit anderen Positionen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind (Abb. 3).
Es ist schnell ersichtlich, dass sich dieser Anteil in den letzten 15 Jahren von 2006 bis 2021, die hier erfasst sind, fast verdoppelt hat von ehemals 0,9% auf nun 1,7% des Bruttoinlandsprodukts. Damit gaben wir 2021 in dem Bereich prozentual mehr aus als für Verteidigung. Dies wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der Weltlage mit Sicherheit ändern.
Wir verfeinern daher den Blick und schauen auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE): Wie haben sich die Investitionen allein in diesem Bereich in den vergangenen knapp 15 Jahren entwickelt? Dazu blicken wir auf Abb. 4 (siehe S. 22), die ebenfalls dem Kinder- und Jugendhilfereport 2024 entnommen ist.
Wir sehen auch hier einen kontinuierlichen Anstieg: Seit 2008 haben sich die Zahlen nahezu verdoppelt. Das gilt für die absoluten Zahlen sowie für die Investitionen pro Kopf. Selbst inflationsbereinigt verzeichnen wir noch einen Anstieg von circa 65 %.
Das illustriert eindeutig, dass sich der enorme Anstieg über alle Hilfeformen der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung erklären lässt. Vielmehr gab es auch bei den Hilfen zur Erziehung enorme Anstiege der Investitionen durch die öffentliche Hand.
Abb. 3: Prozentualer Anteil ausgewählter Ausgabenpositionen amBruttoinlandsprodukt (BIP) (Deutschland; 2006, 2019 und 2021) (aus Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024, S. 48)
Abb. 4: Ausgaben für Hilfen zur Erziehung (0 bis U27) (Deutschland; 2008–2021; Angaben in 1000 EUR) (aus Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024, S. 110)