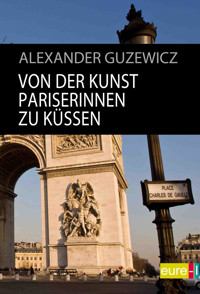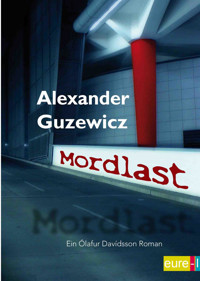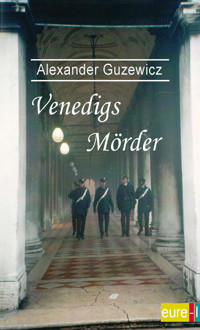5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eure-l verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Toter in einer Berliner Vorstadtvilla. Nichts Besonderes für einen Fallanalytiker. Aber warum ist das Opfer nackt? Und was hat es mit dem merkwürdigen Raum auf sich, in dem der Junge gefunden wird? Die Nachforschungen haben einen größeren Einfluss auf die Zukunft der Ermittler als zunächst angenommen. Ólafur Davídsson sieht sich immer wieder mit seiner eigenen Jugend konfrontiert, die alles andere als perfekt war. Plötzlich steht die Welt auf dem Kopf und eine zweite Jugend ist für ihn scheinbar zum Greifen nahe. Erst als der Fall schon fast gelöst ist, erkennt der Fallanalytiker, wer die Kosten für den Schönheitswahn und den Traum von einer ewigen Jugend tragen muss. Spätestens jetzt steht jeder vor der Frage: Wie weit würde ich dafür gehen, in einem jungen und makellosen Körper neu anfangen zu können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Alexander Guzewicz
Jugendrausch
eure-l.com
Vollständige eBook-Ausgabe der beim
eure-l verlag, Oldenburger Straße 30 in 10551 Berlin
erschienen Taschenbuchausgabe
Copyright © 2023 by eure-l verlag, Berlin
Umschlaggestaltungeure-l software, Berlin
UmschlagfotoDavid Marée, Frencharme, Leverkusen
UmschlagmotivJan (Taylor) Müller, Köln
DatenkonvertierungBook Designs, Potsdam
01 550-0231-23
ISBN978-3-939984-92-4
für
Martina Kowalewska
Wenn man jung ist, beruhigt man sich damit, dass die Alten früher sterben als man selbst – wenn man alt ist, weiß man, dass die Jungen auch alt werden.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Der Raum war zu klein. Sie konnten nicht alle Platz darin finden. Noch wartete Ólafur Davídsson in dem engen kühlen Gang, bis jemand heraustrat und ihm das Feld überließ.
Der Kellerflur verströmte den Geruch von trockener Dunkelheit. Die vielen Männer, denen er immer wieder Platz machen musste, hatten den Staub aufgewirbelt, der sich im Laufe der Jahre in jede Ritze dieses Kellers gelegt hatte.
Geduld war nicht gerade einer seiner Stärken, zumal es oft genug vorkam, dass einer der beteiligten Kriminalkommissare nichts mit einem Fallanalytiker anfangen konnte. Die Methode war einfach noch zu neu für die deutschen Kollegen.
Sie kannten sie nur aus amerikanischen Kino-und Fernsehfilmen und empfanden es meistens als Unfug, einen Profiler, wie sie in diesen Filmen fälschlicherweise genannt wurden, zurate zu ziehen.
Vielleicht gab es deshalb auch nur sechzehn Fallanalytiker in ganz Deutschland, die zusammen gerade einmal um die fünfzig Fälle im Jahr betreuten.
Selbst wenn sie sich irgendwann einmal damit abfanden, war allein der isländische Name ein Problem für die meisten. Die Tatsache, dass damit auch das Bundeskriminalamt an dem Fall beteiligt war, wurde wenigstens damit zur Nebensache. Auch wenn das nicht immer hilfreich war, verhinderte es die immer gleichen Fragen und Kompetenzrangeleien, die es zu Beginn der Ermittlungen sonst immer wieder gab.
Kriminalhauptkommissar Engbers war der Erste, der aus dem Raum trat und direkt auf Davídsson zusteuerte. Davídsson war erleichtert, dass offensichtlich Engbers die Ermittlungen leitete. Sie kannten sich von einem anderen Fall, an dem sie vor fast zwei Jahren zusammengearbeitet hatten. Auch wenn sie sich nicht immer gut verstanden und sehr oft unterschiedliche Ansichten vertraten, waren sie sich doch vertraut und er musste sich nicht erst mit langwierigen Erklärungen ein gewisses Ansehen verschaffen.
Das war ihm bereits vor zwei Jahren gelungen.
Engbers, der in den letzten Jahren scheinbar um keinen Tag gealtert war, streckte ihm wortlos die Hand hin, schüttelte sie und steckte sich anschließend völlig automatisch eine Zigarette an.
»Das hier ist der ungewöhnlichste Fundort einer Leiche, den ich je gesehen habe«, sagte er, nachdem er tief inhaliert hatte und jetzt den Rauch langsam so entweichen ließ, dass er nicht in Ólafur Davídsson Richtung zog.
»Wann kann ich ihn mir ansehen?«
»Die Kollegen von der Spurensicherung brauchen bestimmt noch eine Stunde, wenn nicht länger.« Er sah zu dem Eingang hinüber, als wolle er seine Einschätzung noch einmal überprüfen, bevor er Davídsson mit einem Stirnrunzeln ansah. »Die werden nichts finden. Da drinnen ist es sauberer als in jedem OP. Wir können ja kurz nach oben gehen, dann erzähle ich dir schon einmal ein paar Details, oder hat der Dauerdienst das schon gemacht?«
Davídsson war vor knapp einer Stunde auf dem Weg nach Hause von seinem Chef angerufen und, weil er an diesem Wochenende Bereitschaft hatte, mit dem Fall beauftragt worden.
Der Kriminaldauerdienst hatte ihm dann lediglich mitgeteilt, dass er in die Welfenallee nach Frohnau fahren solle.
Bis Engbers aus dem Raum trat, wusste er nicht einmal, wer die Ermittlungen leitete. Er wusste auch nicht, um welche Art von Verbrechen es sich handelte, auch wenn er vermutete, dass es um einen Mord ging. Das war meistens der Fall, wenn er hinzugezogen wurde.
Bisher hatte er es nur zweimal mit einem anderen Verbrechen zu tun gehabt und das war nicht in Deutschland, sondern in Island gewesen, wo man diese Art der Tätersuche schon längere Zeit einsetzte. Auch wenn es sich um Vergewaltigungen oder Entführungen handelte.
Er folgte Engbers über ein enges Treppenhaus mit kahlen Betonwänden, die lediglich weiß angestrichen waren, nach oben, wo es deutlich wärmer war.
Sie standen in einem großen Wohnzimmer, das etwas Behagliches hatte. Ein offener Kamin, in dem noch einige Holzscheite glimmten, gab wohlige Wärme ab, die sich, bis auf den Keller, in alle Räume des Hauses ausgebreitet hatte.
Sofort fiel Ólafur Davídsson die penible Ordnung auf, die hier herrschte. Nichts lag einfach nur herum, nicht einmal eine Zeitung oder ein Buch.
Selbst die offene Küche war ordentlich und wirkte völlig ungenutzt. Engbers, der sich anscheinend schon auskannte, ließ sich auf einer altweißen Ledercouch in einer Raumecke nieder.
»Hier war die Spurensicherung schon. Wir können uns im Wohnzimmer völlig frei bewegen«, sagte er und bedeutete Davídsson mit dem Kopf, dass er Platz nehmen solle. »Als wir hierhergerufen wurden, war es draußen noch hell.« Er sah kurz auf seine Armbanduhr, bevor er weiterredete. »Das ist jetzt schon viereinhalb Stunden her. Der Kampfmittelräumdienst musste erst eine Bombe entschärfen, bevor wir überhaupt bis in diesen merkwürdigen Raum vordringen konnten.«
»Eine Bombe?«, fragte Ólafur Davídsson, der mit allem anderen gerechnet hatte, nur nicht damit.
»Ja, mitten in Berlin. Ich sagte dir ja, dass es der ungewöhnlichste Fundort einer Leiche ist, den ich je hatte. Es war auch nicht eine normale Bombe, wie wir sie von terroristischen Aktivitäten her kennen oder eben Sprengstoff, mit dem die Typen normalerweise versuchen, Tresore aufzubrechen. Die vom Kampfmittelräumdienst haben gesagt, dass sie so etwas bisher nur aus Lehrbüchern kennen. Diese Bombe hatte einen chemischen Zünder.« Engbers legte eine kurze Pause ein, wohl um zu überlegen, ob er hier rauchen konnte oder nicht. Schließlich entschied er sich dagegen und steckte die Packung wieder zurück in die Hemdtasche unter seinem Pullover.
»Wo befand sich die Bombe und wie seid ihr überhaupt darüber informiert worden?« Davídsson war aufgestanden und zu einer Regalwand gegangen, die einer großen Fensterfront gegenüberstand.
»Das ist noch absurder als in jedem billigen Krimi. Gegen fünfzehn Uhr ging ein Notruf ein. Eine digital verzerrte Stimme berichtete in knappen Sätzen von einer Bombe in der Welfenallee in Frohnau. Auf Fragen wurde nicht geantwortet und schließlich wurde einfach aufgelegt. Die Techniker vom Landeskriminalamt sind schon dabei, die Stimme kenntlich zu machen. Ich habe sie gleich darauf angesetzt, als wir die Bombe gefunden haben.«
Davídsson hörte ihm zu, während er langsam mit den Fingern über die Buchrücken strich. Er blieb bei einem Physikschulbuch stehen, nahm es heraus und blätterte es interessiert durch.
Schließlich fragte er zu Engbers gewandt: »Wie sieht der Raum da unten eigentlich aus? Vorhin wollten die Uniformierten mir nicht einmal einen kurzen Blick gestatten.«
»Das sieht denen mal wieder ähnlich. Typisch Schnittlauch – innen hohl und außen grün. Das ändert sich auch durch die neuen blauen Uniformen nicht. Ich habe nur noch nicht den passenden Spruch dazu.«
Engbers machte kein Geheimnis daraus, dass er den uniformierten Kollegen keine guten kriminalistischen Fähigkeiten zutraute. Er war der Ansicht, dass sie nur dazu zu gebrauchen waren, den Verkehr zu regeln, Besoffene in die Ausnüchterungszelle zu bringen und Tatorte vor neugierigen Blicken zu schützen.
Schließlich meinte er: »Beschreiben kann ich dir das eigentlich nicht. Das muss man selbst gesehen haben.«
Sie schwiegen eine ganze Weile. Davídsson überflog ein Kapitel, in dem man auf ein paar Seiten die Spezielle Relativitätstheorie abhandelte und dabei versuchte, dies so einfach und unwissenschaftlich wie möglich zu formulieren. Er war auf das Buch gestoßen, weil es zu den Restlichen überhaupt nicht passte.
Engbers saß auf der Couch und schien nachzudenken, bis sich die Tür zum Treppenhaus, das zum Keller führte, öffnete und die junge Gerichtsmedizinerin den Raum betrat. Es war unübersehbar, dass ihn nicht nur das Ergebnis der ersten Untersuchungen interessierte.
Sie reichte Davídsson ihre weiche, schlanke Hand und musterte ihn dabei aus blaugrauen Augen, was ihm ein wenig unangenehm war. Sie war kaum älter als Davídsson und hatte neben einem freundlichen Gesicht auch eine sehr vorteilhafte Figur.
»Dr. Franziska Bürling. Ich bin die Gerichtsmedizinerin, die für diesen Fall zuständig ist.«
Engbers nickte ihr nur kurz zu, während er ihr Ólafur Davídsson vorstellte.
»Der Junge ist höchstens seit acht Stunden tot. Ich habe wegdrückbare Totenflecke vorgefunden. Außerdem trat die Totenstarre nach gewaltsamer Lösung wieder auf. Über die Ursache kann ich erst nach einer genauen Obduktion etwas sagen. Äußerlich ist jedenfalls außer ein paar Knochenbrüchen nichts Auffälliges feststellbar. Hätte man ihn nicht unter diesen Umständen gefunden, hätte man vermutlich nicht einmal auf eine außergewöhnliche Todesursache geschlossen und ihn einfach so freigegeben.«
Sie löste den Mundschutz, den sie zuvor einfach nach unten gezogen hatte, und steckte ihn in die Jeanstasche, aus der bereits die Handschuhe herausragten.
»Wenn Sie mich nicht mehr benötigen, würde ich jetzt gerne nach Hause fahren.«
»Ich würde mir gerne den Fundort der Leiche zusammen mit Ihnen ansehen, wenn das möglich ist. Vielleicht brauche ich noch Ihr Fachwissen. Außerdem brauche ich natürlich noch den Bericht, wenn er fertig ist«, sagte Davídsson, der sie eigentlich nur ungern vom Feierabend abhalten wollte.
Engebers nickte beipflichtend, was sie jedoch bewusst übersah.
Es war für alle Anwesenden unübersehbar, dass sie sein unangenehm aufdringliches Verhalten und die Art, wie er sie ansah, hasste. Für alle war das sichtbar, nur anscheinend nicht für Engbers, dachte Davídsson, der es registrierte, aber nicht weiter darüber nachdenken wollte.
Sie hatte schon mehrmals mit Engbers beruflich zu tun gehabt und wartete nur darauf, dass dieser sie wegen einer Verabredung ansprechen würde – dann würde sie ihm gehörig die Meinung sagen. Bisher hatte er sich dazu noch nicht durchringen können, vielleicht, weil sie ihn zu deutlich abblitzen ließ, vielleicht aber auch nur, weil er noch andere Verabredungen in der wenigen Freizeit unterbringen musste, die er zur Verfügung hatte.
Jedenfalls war das der Ruf, der ihm vorauseilte.
»Ich glaube, die Kollegen von der Spurensicherung sind gleich durch. Wir können ja schon mal wieder nach unten gehen«, schlug sie vor.
Ólafur Davídsson konnte an ihren Augen ablesen, dass sie den Tod gesehen hatte. Er hatte immer wieder beobachtet, wie diese Bilder sich in den Augen derer widerspiegelten, die einen leblosen Körper gesehen hatten. Es machte nachdenklich und besorgt, auch wenn es die Arbeit dieser Leute war – die Arbeit mit dem Tod.
Die Kollegen von der Spurensicherung hatten sich in dem engen Kellerflur versammelt. Einige rauchten, andere räumten die Gerätschaften in große silberne Koffer. Die meisten von ihnen hatten noch ihre Ganzkörper-Schutzanzüge an und der Mundschutz war einfach vom Mund gezogen worden und hing jetzt etwas verloren um den Hals.
Die eigentliche und sehr zeitaufwendige Arbeit wartete erst im Labor auf sie. Dort wurden die sichergestellten Spuren untersucht und ausgewertet und ein Leichenbefundbericht musste in enger Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin geschrieben werden – und das alles in kürzester Zeit, um die Kollegen von der gerade erst eingerichteten Mordkommission, zu der nun auch der hinzugezogene Fallanalytiker gehörte, bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Davídsson betrat den Raum, nachdem Engbers den leitenden Sachbearbeiter der Spurensicherung gefragt hatte, ob sie fertig seien, und dieser seine Frage bejaht hatte.
Die Spurensicherer hatten zwei Lampen aufgestellt, die jetzt ihr dünnes bläuliches Licht verteilten. Davídsson wäre beinahe über ein Verlängerungskabel gestolpert, das quer durch den Raum verlief, der offenbar über keine eigene Lichtquelle verfügte. Das Licht ließ die Dinge zerbrechlich wirken und es erinnerte ihn an die Insektenvernichter, die in Großküchen hingen.
Er versuchte, alles gleichzeitig zu erfassen.
Sein Blick fiel auf das Opfer, das in einer ungewöhnlichen Körperhaltung nackt auf dem Boden lag und ihn direkt anzustarren schien. Der linke Arm war unnatürlich hinter den Rücken verdreht und auch die Füße waren so abgewinkelt, dass Davídsson davon ausging, dass sie gebrochen sein mussten.
Er fragte Bürling, die ihm direkt in den Raum gefolgt war, ob das die Auffindesituation darstellte. Ohne ihr Nicken zu sehen, wusste er, dass dies der Fall war. Sie widersprach nicht und er wusste genug über die Tatortarbeit der Gerichtsmedizin, um zu erkennen, wenn die Lage verändert worden wäre.
Er ging direkt vor dem Toten in die Hocke und betrachtete den höchstens zwanzigjährigen Jungen aus der Nähe. Seine dunkelbraunen Augen starrten ins Leere. Sie schienen nicht angsterfüllt zu sein, aber irgendetwas stimmte trotzdem nicht mit ihnen. Ein schwacher Schimmer des bläulichen Lichtes spiegelte sich in diesen Augen.
»Er sieht verdammt gut aus, fast wie ein Model oder wie ein männlicher Engel«, sagte die Gerichtsmedizinerin, mit einem Unterton, der in Engbers Richtung zielte.
Davídsson, der sich normalerweise nur dafür interessierte, wie die Opfer aussahen, wenn daraus Muster oder Gemeinsamkeiten erkennbar wurden, die Rückschlüsse auf den Täter zuließen, musterte den Körper des jungen Mannes und nickte zustimmend.
Seine feinporige Haut glänzte ein wenig, als hätte er geschwitzt, aber er roch stattdessen nach irgendeinem sportiven Duschgel. Über einer der beiden kleinen dunklen Brustwarzen waren drei schwarze, kaum sichtbare Muttermale in einem Dreieck angeordnet und darunter bildete ein Sixpack sanfte Konturen um einen nach innen gerichteten Bauchnabel. Sein Oberkörper war athletisch und unbehaart und auch seine Oberarme waren muskulös, aber nur gerade soviel, dass sie zu dem jugendlichen Körper passten. Die Finger gehörten zu schmalen Händen, denen die darauf sichtbaren Adern einen kraftvolles Aussehen verliehen.
Davídsson musterte die Gesichtszüge des Jungen, die tatsächlich etwas Engelhaftes hatten. Es war ein schmales gleichmäßiges Gesicht, das ihn an Aufnahmen von einer Modenschau erinnerte. Über den Augen bildeten leicht geschwungene Augenbrauen ein harmonisches Bild mit den ebenfalls ausdrucksstarken vollen Lippen, die jetzt halb geöffnet weiße Zähne zum Vorschein brachten, die jeden Zahnarzt wegen ihrer gleichmäßigen Anordnung erfreut hätten. Er schätzte die Größe des toten Jungen, obwohl in gebeugter Haltung liegend, auf etwa hundertneunzig Zentimeter.
Die Gerichtsmedizinerin hatte sich neben Davídsson in die Hocke begeben und streichelte dem Opfer sanft über die dunklen, wild abstehenden Haare.
»Warum musste so ein hübscher junger Mann wie du sterben? Du hattest doch noch dein ganzes Leben vor dir. Wer hat dir das angetan?«
Ólafur Davídsson holte aus seinem Portemonnaie zwei Zehn-Krónur-Münzen und legte sie beide mit der Seite, die die vier Kapelane zeigte, auf die Stirn des Opfers.
»Gehört das zu Ihrer Arbeit als Fallanalytiker?«, fragte Dr. Bürling erstaunt, die mit diesem Brauch nichts anfangen konnte.
Engbers grinste.
»Das ist für den Fährmann. Er macht das bei jedem Mordopfer. Es ist wohl seine Art, den Ermordeten eine letzte Ehre zu erweisen. Ich glaube, es hat etwas mit der griechischen Mythologie zu tun.«
»Eigentlich muss es eine Münze sein, die dem Toten unter die Zunge gelegt wird«, murmelte Davídsson, den Blick auf das vor ihm liegende Opfer geheftet. »Styx ist ein Fluss in der Unterwelt und die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich. Die Seelen der Toten werden von Charon, dem Fährmann, über den Styx gefahren. Deshalb wurde den Toten der alten Griechen ein Obolus unter der Zunge mitgegeben, damit sie Charon für die Überfahrt ins Reich des Totengottes Pluton bezahlen konnten.«
Er sah zu der Gerichtsmedizinerin herüber und sagte jetzt mit fester Stimme: »Es hat zwar nichts mit den isländischen Sagas zu tun, aber ich finde es trotzdem ein schönes Ritual, um von den Toten Abschied zu nehmen.«
Ólafur Davídsson richtete sich wieder auf, um dazu überzugehen, den Raum um sich herum zu studieren, der nicht weniger interessant war.
»Er ist bestimmt bei den Mädels in seiner Altersgruppe gut angekommen«, meinte Engbers, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen, aber keiner reagierte darauf.
Der Raum war bei genauerer Betrachtung kein gewöhnlicher, sondern ein Kubus, jedenfalls soweit Davídsson das ohne eine exakte Vermessung sagen konnte.
Er arbeitete sich zunächst mit den Augen von einer Wand zur anderen vor und betrachtete ihre Oberflächen, bis er sich schließlich einmal um die eigene Achse gedreht hatte.
Alle Wände schienen den gleichen Flächeninhalt zu haben und sie waren alle aus einem edelstahlähnlichen Material gefertigt worden.
Davídsson tastete jetzt eine der Wände mit den Kunststoffhandschuhen ab, die er sich übergezogen hatte, bevor er den Raum betrat, und die, wenn man der Verpackung Glauben schenken durfte, gefühlsecht waren. Die Oberfläche der Wand war kalt und glatt wie die einer sehr präzise gearbeiteten Stahlplatte oder eines Spiegels – nur gab sie das Licht viel matter zurück, so schwach, dass es nicht reichte, um an der anderen Seite des Würfels reflektiert zu werden.
Er zog seine Hand zurück und betrachtete das Muster, das an den vier Wänden eingearbeitet worden war. Es bestand aus kleinen, höchstens einen Zentimeter hohen Strichen und Kreisen. Soweit Davídsson das erkennen konnte, wiederholte es sich nicht mehr in den darunterliegenden Reihen. Die Zeilen hatten alle den gleichen Abstand und waren genauso weit voneinander entfernt, wie das Muster selbst hoch war.
Er trat einen Schritt näher heran und untersuchte die Wand genauer. Die Vertiefungen schienen mit einem Laser in die Wände graviert worden zu sein. Davídsson bemerkte, dass sie so präzise und so gleichmäßig waren, dass sie unmöglich per Hand angebracht worden sein konnten, und dabei waren die Kanten weder scharf noch ausgefranst.
Er versuchte sich eine Folge des Musters einzuprägen, weil er sich sicher war, dass sie auf den Fotos, die die Spurensicherer davon gemacht hatten, nicht so deutlich zu erkennen waren, wie er sie jetzt sah. Sicher war es durch die Bildbearbeitungssoftware, die das LKA in solchen Fällen einsetzte, möglich, die Konturen wieder sichtbar zu machen, aber er wusste auch, wie lange die KTU dafür brauchen würde – nämlich für seine Zwecke viel zu lange.
Erst jetzt, als er einen Schritt von der Wand zurückgetreten war, die er sich gerade näher angesehen hatte, bemerkte er, dass der gesamte Würfel aus einem Guss zu sein schien. Er konnte auch bei genauerem Hinsehen keine Naht erkennen, die eine Platte mit der anderen verband.
»Das ist ja merkwürdig. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?«, fragte er mit Blick auf Engbers und Bürling.
Beide schüttelten den Kopf.
»Ich wüsste auch nicht, wer so etwas herstellt und was für einen Zweck dieser … Würfel erfüllt«, stellte Engbers fest.
»Das müssen wir herausfinden. Haben wir die genauen Maße?« Ólafur Davídsson wandte sich zunächst an Engbers und als der die Schultern zuckte, fragte er den leitenden Sachbearbeiter der Spurensicherung.
Andreas Rach, der sich mittlerweile aus seinem Tyvek-Anzug geschält hatte und nun nicht mehr wie ein Astronaut, sondern wie ein normaler Bürger aussah, zeigte ihm seine Notizen, aus denen hervorging, dass alles gründlich aufgezeichnet und vermessen worden war. Dabei fiel Davídsson auf, dass es drei metallene Bügel gab, die an der Decke des Würfels befestigt waren.
»Was haben wir bisher über das Opfer?«, Davídsson widmete den Bügeln an der Decke seine ganze Aufmerksamkeit. Er fragte sich, was für eine Funktion sie in diesem Würfel hatten. War das eine Art Folterkeller?
Engbers musterte die Gerichtsmedizinerin so lange, bis Davídsson den Blick von der Decke nahm und ihn scharf ansah. Engbers zog einen Notizblock aus seiner Hosentasche und blätterte beleidigt darin, bevor er antwortete.
»Er heißt Janik Enzer und ist neunzehn Jahre alt. Laut Pass, den wir in einer Schublade im Wohnzimmer gefunden haben, ist er hundertdreiundachtzig Zentimeter groß und hatte vor gerade einmal vier Tagen Geburtstag. Laut Melderegister wohnt er in diesem edlen Haus alleine. Mehr haben wir noch nicht herausfinden können.«
»Ein Neunzehnjähriger in einer Villa am Stadtrand Berlins, in der er alleine wohnt?«, wiederholte Bürling langsam mit hochgezogenen Augenbrauen und sprach damit aus, was alle dachten.
»Kann ich mit dem Einsatzleiter vom Kampfmittelräumdienst sprechen? Mich interessiert der Aufbau der Bombe und die Sprengkraft«, fragte Davídsson, der sich den Raum noch einmal einzuprägen versuchte.
»Ich gebe dir Morgen die Nummer. Der Typ ist aber nicht besonders kooperativ. Ich habe vorhin, als er noch da war, mein Glück versucht und da hat er nur rumgedruckst.«
Engbers steckte das Notizbuch zurück und rieb sich die Hände, was nichts anderes zu bedeuten hatte, als dass er für den Moment genug gesehen hatte und nun gehen wollte.
2
Ólafur Davídsson verließ als Vorletzter die Villa, nur noch gefolgt von einem Uniformierten, der hinter ihnen die Tür mit Polizeisiegeln versah, nachdem er nochmals kontrolliert hatte, ob die Tür fest verschlossen war.
An den Wänden der umliegenden Häuser hallte stumm das Blaulicht der Polizeiwagen, die den breiten Gehweg säumten. Es war trotzdem menschenleer auf der Straße, so, als sei es ganz normal, dass ein Polizeiaufgebot vor einer Villa stand.
»Gab es eigentlich Einbruchspuren?«, fragte Davídsson Engbers, der sofort die Gelegenheit genutzt hatte, um sich wieder eine Zigarette anzuzünden.
»Die Kollegen vom Kampfmittelräumdienst mussten die Tür aufbrechen.« Der weiße Rauch, den Engbers langsam durch Mund und Nase entweichen ließ, schwebte in den pechschwarzen Himmel, der nur von dem grellen Mondlicht durchschnitten wurde. Schließlich fragte er ziemlich unvermittelt: »Hast du schon eine Ahnung?«
Davídsson schüttelte langsam den Kopf, während er beobachtete, wie nach und nach alle Uniformierten in ihre Wagen stiegen und davonfuhren, bis schließlich nur noch er und Engbers übrig blieben, die jetzt alleine vor dem großen schmiedeeisernen Tor der Villa standen.
»Ich werde auch mal fahren, schließlich habe ich Wochenenddienst und ich habe das ungute Gefühl, dass der Fall nicht in einer Woche als erledigt zu den Akten gelegt werden kann.«
»Ach komm, das ist doch genau das, was du brauchst. Wenn du nichts zu tun hast, dann bekommst du doch eine Depression«, sagte Engbers mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Er schnalzte seine fertig gerauchte Zigarette zu Boden und trat anschließend darauf, bis das Glimmen erloschen war.
»Soll ich dich ein Stück mitnehmen?«, fragte Davídsson, der Engbers Wagen nirgendwo entdecken konnte.
»Mein Wagen steht gleich um die Ecke, aber danke für dein Angebot.«
Sie verabschiedeten sich mit einem kurzen Händedruck und Davídsson beobachtete, wie wieder eine kleine Flamme aufflackerte, die die nächste Zigarette anzündete.
Insgeheim war Davídsson froh, dass er Engbers nicht mitnehmen brauchte. Selbst wenn er nicht in seinem Schmuckstück, einem Citroën DS21Pallas seine Zigaretten rauchte, roch es doch nach abgestandenem Zigarettenrauch, der den angenehmen Duft der Ledersitze für einige Tage überlagern würde.
Er hatte die schwarze Göttin aus den 1970er-Jahren in einer Seitenstraße namens ›An der Buche‹ parken müssen, weil alle Zufahrten zur Welfenallee gesperrt gewesen waren, als er vorgefahren war.
Um ihn herum brannten nur die gelblich leuchtenden Gaslaternen zwischen hohen Bäumen, die mit ihrem diffusen Schein das Kopfsteinpflaster erhellten. Hinter den meisten Fenstern der großzügig angelegten Villen brannte noch Licht oder zumindest war das bläuliche Flackern des Fernsehers zu sehen.
Er saß hinter dem einspeichigen Lenkrad und dachte darüber nach, was Engbers zuletzt gesagt hatte.
Er war tatsächlich nicht der Typ, der ruhig zu Hause sitzen konnte, um in den Tag hinein zu leben. Er war zu unruhig, zu ungeduldig und zu unglücklich, wenn es nichts gab, womit er den Tag ausfüllen konnte. Umgekehrt hasste er es aber, wenn seine freie Zeit schon verplant war und er sich nicht spontan für das entscheiden konnte, wozu er Lust hatte. Vielleicht verspürte er deshalb diese schleichende Einsamkeit, wenn er zur Ruhe kam. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er es das letzte Mal geschafft hatte, diesen Teufelskreis zu verlassen, um das Leben einfach so zu genießen, wie es kam, ohne dass er diese innere Unruhe verspürte, die ihn ständig zu Taten antrieb.
Der Motor begann zu schnurren, als er den Citroën startete. Er wartete, bis sich seine Göttin erhob, und entschloss sich dazu, noch nicht nach Hause, sondern noch ein bisschen durch das ihm völlig unbekannte Frohnau zu fahren.
Er interessierte sich immer für die Umgebung, aus der die Menschen gerissen wurden, wenn sie zu einem Fall für die Mordkommission wurden, auch wenn erstere meistens nicht einmal große Notiz davon nahm, dass ein Bestandteil von ihr fehlte. Auf diese Weise hatte er zwar noch nie einen Fall lösen können, aber es erleichterte ihm doch die Arbeit, wenn er wusste, wie die Opfer gelebt hatten, und ein Stück weit half es ihm auch, mit seinem eigenen Leben klarzukommen.
Er selbst war schon zu oft aus einer vertrauten Umgebung gerissen worden. Als Kind hatte er seine eigentliche Heimat im Nordwesten Islands verlassen müssen, als sein Vater beschlossen hatte, von Siglufjörður nach Reykjavík zu ziehen, weil er als Fischer nicht mehr genug Geld verdiente, um seine fünfköpfige Familie zu ernähren. Das war zu der Zeit des ersten Kabeljaukrieges, als Island die Schutzzone auf fünfzig Seemeilen erweiterte. Es kam damals zum Streit zwischen Island und England, denn die Engländer waren nicht bereit, die erweiterte Schutzzone zu akzeptieren. Der Streit eskalierte und britische Trawler wurden von Kriegsschiffen begleitet. Als der Streit auf dem Verhandlungsweg beigelegt wurde, hatten sie bereits das Haus in Reykjavík bezogen.
Der Strákagöng war gerade ein paar Jahre zuvor in Betrieb genommen worden und das vierhundert Kilometer entfernte Reykjavík war auf dem Landweg längst nicht mehr so schwer erreichbar wie vor der Eröffnung des Tunnels.
Damals wurde eine islandweite Landflucht ausgelöst, die allein die Einwohnerzahl von Siglufjörður halbierte. Das war längst vor dem heutigen Boom der Fischereiindustrie, der vor einigen Jahren eingesetzt hatte, weil man in Europa asiatische Küche als neue Mode entdeckt hatte und Sushi beinahe an jeder Straßenecke verkauft wurde.
In Reykjavík hatte sich sein Vater eine Verbesserung versprochen, die jedoch ausblieb. Er hatte es deshalb nie verwunden, diesen Schritt gewagt zu haben. Er starb schon sehr früh an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums – ein Problem, mit dem viele Isländer zu dieser Zeit zu kämpfen hatten.
Nur drei Jahre später war Ólafur Davídssons Mutter gestorben.
Er hatte immer den Verdacht, dass ihre Krankheit auch mit den Sorgen, die sie sich wegen ihres Mannes machte, zusammenhing. Der Krebs war nur wenige Monate nach dem Tod seines Vaters festgestellt worden und obwohl er sie alle, auch seine Frau, immer in Ruhe gelassen hatte, wenn er betrunken nach Hause kam, war sie es doch gewesen, die sich ständig um das Wohl der Familie gesorgt hatte.
In den letzten Jahren war es für sie die reinste Hölle gewesen, wenn er immer öfter mit schwerem Atem und dem intensiven Geruch von Hákarl vermischt mit Brennivin nach Hause gekommen war und sich einfach nur ins Bett hatte fallen lassen, ohne nur ein einziges Wort mit seiner Familie zu wechseln.
Seit dem Umzug nach Reykjavík hatte sein Vater niemanden mehr in den Arm genommen. Selbst wenn er sie ansah, waren seine Blicke kalt und leer. Gefühle gab es nicht mehr, auch nicht für Davídssons Mutter.
Sie musste sich um alle Arbeiten kümmern, die anfielen. Sie kaufte ein, hielt das Haus in Schuss, erledigte die Behördengänge, die ihnen das bisschen Lebensgrundlage, dass sie vom Staat erhielten, sicherte und sie kümmerte sich um die Kinder, bis sie schließlich daran zerbrach.
Es war sicher nicht die Belastung, die sie krank machte – sie konnte damit gut fertig werden und war es von ihrem Elternhaus gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Es war vielmehr das Zugrundegehen der Familie und die Wesensveränderung ihres Mannes und letztlich auch die der Kinder, die sie langsam zerstörte.
Als seine Mutter starb, war er gerade einmal einundzwanzig Jahre alt. Er blieb damals mit seinen beiden jüngeren Geschwistern in dem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus in der Barmahlíð in Hlíðar Suður wohnen.
Das Viertel gehörte nicht zu dem noblen Reykjavík, das heute von den Touristen bevölkert wurde und in dem sie sich bei ihren Islandbesuchen vorwiegend aufhielten. Hier war die Armut der Menschen von vorneherein unbestritten erkennbar und die Menschen, die hier lebten, gingen sehr direkt miteinander um, so, wie es ihnen ihre Umgebung beigebracht hatte.
Sein Studium der Psychologie und Anglistik an der Háskóli Íslands finanzierte er sich durch Aushilfsjobs bei den in Island verhassten amerikanischen Streitkräften.
Damals arbeiteten noch über tausend US-Soldaten und mehr als sechshundert Isländer bei der Icelandic Defense Force in Keflavík, die während des Kalten Krieges auf Bitten der isländischen Regierung nach Eintritt des Landes in die NATO geschaffen worden war.
Später, als er sein Studium beendet hatte und seine Geschwister für sich selbst sorgen konnten, bekam er dann ein Stipendium für die FBI Academy in Quantico, eine der größten Streitkräftebasen des United States Marine Corps in der Nähe von Fredericksburg im US-Bundesstaat Virginia. Er war damals begeistert von der Chance, die er durch das Stipendium erhalten hatte.
Es war das erste Mal, dass er von Island wegkam und es war auch das erste Mal, dass er so etwas wie Heimweh verspürte.
Er sehnte sich nach der Geborgenheit, die er in Siglufjörður verspürt hatte, nach der vertrauten Umgebung und nach der würzigen Brise des Meeres und dem Gestank von Fisch, der manchmal in der Luft lag, wenn am Hafen Heringsreste zu Fischmehl verarbeitet wurden. Er vermisste seine Mutter, um die er nie richtig trauern konnte, weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, sich um seine jüngeren Geschwister zu kümmern und ihre Trauer zu lindern.
Er dachte an seinen ersten Tag in Quantico und wie ihn die Größe des Campus überwältigt hatte. Die zwölftausend Menschen, die dort lebten und arbeiteten und das über hundert Quadratkilometer große Areal, auf dem nicht nur die FBI Academy, sondern auch die Trainingsakademie der Drogenfahndungsbehörde, die Offiziersschule des Marine Corps und der Liegeplatz des für den Hubschraubertransport des US-Präsidenten verantwortlichen ersten Hubschraubergeschwaders der Marine stationiert waren. Es gab eine ganze Übungsstadt und verschiedene Laboratorien und Ausrüstungstestgelände, die dem FBI als Trainingsgelände zur Verfügung standen. Er brauchte länger als die meisten anderen Kommilitonen, um sich mit diesen Dimensionen abzufinden, und er sehnte sich sehr lange nach dem kleinen beschaulichen Siglufjörður, in dem er aufgewachsen war.
Über die FBI-Dienststelle in der amerikanischen Botschaft kam er schließlich zum Bundeskriminalamt, das in Treptow eine Dependance unterhielt und bei dem er eine für Deutschland damals noch völlig unbekannte Form der Verbrechensaufklärung aufbaute – die kriminalistische Fallanalyse.
Es hatte zuvor eine ganze Weile und einiges an Überzeugungskraft gebraucht, bis er für das BKA in seinem Fach arbeiten konnte, da der Erfolg der Täterprofilerstellung in erster Linie von einer breiten Kenntnis der regionalen und gesellschaftlichen Besonderheiten und natürlich auch der polizeilichen Arbeit in Deutschland abhing.
Das Verfahren, wie er es aus den USA kannte, konnte nicht einfach so in Deutschland angewandt werden. Das wusste er selbst von Studien, die sie auf der Akademie besprochen hatten. Selbst dort, in den USA, gab es zu große Unterschiede in den einzelnen Bundesstaaten, als dass jeder Profiler einfach so überall eingesetzt werden konnte.
Es war letztendlich nur der Tatsache zu verdanken, dass er in ganz Deutschland der einzige voll ausgebildete Fallanalytiker mit einem Psychologiestudium war.
Auf Island waren sie anfangs zu zweit gewesen. Mit ihm hatte ein Kommilitone der Háskóli Íslands ein Stipendium für die FBI Academy in Quantico bekommen, aber zwei Fallanalytiker waren für Island zu viel.
Es gab kaum ernst zu nehmende Verbrechen und nur sehr wenige Kapitalverbrechen, zu denen sie zurate gezogen werden konnten, und so hatte man sie vor die Wahl gestellt, entweder als ganz normale Ermittler weiterzuarbeiten oder außerhalb Islands in ihrem Fach.
Davídsson hatte sich für das Ausland entschieden und war zunächst zur Amerikanischen Botschaft in Berlin versetzt worden.
Erst als das schrille Alarmzeichen signalisierte, dass das Rolltor langsam nach oben glitt, bemerkte er, dass er bereits zu Hause angekommen war. Er hatte die gesamte Strecke gedankenversunken zurückgelegt und war nun überrascht, dass der Citroën DS den Weg nach Hause offenbar ganz von allein gefunden hatte. Ólafur Davídsson packte seine Unterlagen, die sich während der Fahrt auf der Rücksitzbank verteilt hatten, zusammen, verließ die Tiefgarage und wartete, noch immer etwas benommen von seinen Gedanken, auf den Aufzug, der fast geräuschlos in die vierte Etage glitt.
Die große, sonst so helle und freundlich wirkende Fensterfront sah jetzt aus wie ein dunkles, nie enden wollendes Loch, das wie ein Sog alles anzuziehen schien, was ihm zu nahe kam. Davídsson hatte den Kaffeevollautomaten angeschaltet und starrte aus dem Fenster in diese schwarze Öffnung. Ein kleines rotes Licht am Regler der Fußbodenheizung signalisierte, dass diese heizte, und im Hintergrund brannten einige Kerzen, die er zuvor angezündet hatte und die sich jetzt in der Fensterfront sanft spiegelten.
Immer noch hing er seinen Gedanken nach und es würde auch noch einige Minuten brauchen, bis er sich aus deren Umklammerung lösen und darüber nachdenken konnte, was er mit dem angebrochenen Abend anfangen sollte.
Das Wochenende war schnell vergangen. Am Samstag hatte Davídsson zunächst mit Engbers und danach mit Dr. Bürling telefoniert, aber beide waren kurz angebunden und konnten nur vage Aussagen machen. Engbers versprach ihm, ihn sofort zu informieren, falls er neue Erkenntnisse auf seinen Schreibtisch bekommen würde, und auch die Gerichtsmedizinerin wollte ihn über eventuelle Neuigkeiten informieren. Sie deutete an, dass die forensische Untersuchung bei diesem Opfer länger dauern würde als sonst, aber den Grund dafür nannte sie noch nicht.
Davídsson, der im Augenblick noch nicht viel Vorarbeit für seine Kriminalanalyse leisten konnte, entschied sich an diesem Wochenende für seine zweite Passion, das Curling. Seitdem er in Berlin wohnte, nahm er mehr oder minder oft an Turnieren oder zumindest am allwöchentlichen Training seiner Mannschaft teil; wenigstens, wenn es seine Arbeitszeit zuließ. In den letzten Wochen hatte er das Training etwas schleifen gelassen, aber seit dem letzten Mittwoch hatte er sich vorgenommen, seine Mannschaft wieder regelmäßig zu unterstützen. Seine Position war der Lead, Marian Zajícek, der so etwas wie sein bester Freund war, obwohl Davídsson diese Bezeichnung hasste, weil sie für ihn etwas zu Abschließendes hatte, war der Teamchef oder Skip, der ihn auch zu diesem Spiel geführt hatte.
Sie hatten am Samstagnachmittag fast zwei Stunden trainiert und hatten sich anschließend im Vereinsheim zur traditionellen Manöverkritik getroffen.
Seine Mannschaft hatte verloren, also wurde sie eingeladen und man diskutierte die einzelnen Durchgänge beim Curling, dem Schach auf dem Eis. Es erfordert vor allem taktisches Geschick und Vorausdenken. Der Curler benötigt während der Steinabgabe eine ruhige Hand, ähnlich dem Golfer beim Putten, sowie die Vorausberechnung von Karambolagen, wie beim Billard. Gleichzeitig braucht der Curler Kraft und Kondition beim Wischen, gepaart mit dem feinen Balancegefühl eines Eistänzers, um sich auf dem Eis richtig zu bewegen.
Davídsson fehlte es an diesem Nachmittag vor allem an Letzterem. Er konnte sich nicht richtig auf das Spiel konzentrieren, weil er immer wieder an seinen Fall denken musste, der alles andere als ein Fall aus dem Lehrbuch war. Dieser Raum, dieser fehlerlose Würfel und der ebenso makellose Junge warfen Fragen auf, die sonst bei keinem Fall aufkamen.
Zu Hause ärgerte sich Ólafur Davídsson, dass er sich wieder einmal zu sehr auf den Fall konzentrierte. Es gab für ihn so gut wie kein Privatleben mehr, wenn er einen Fall hatte, und hatte er keinen Fall, sehnte er sich danach, einen zu haben, um die innere Unruhe und die Langeweile zu betäuben. Er war nie verheiratet gewesen und er hatte auch nur wenige, kurze, dafür meist umso leidenschaftlichere Beziehungen gehabt. Sie waren jedoch gescheitert und je mehr es wurden, desto mehr gab er sich selbst die Schuld dafür.
Zajícek und Engbers waren seine einzigen Freunde. Mit ihnen konnte er über sein Privatleben sprechen. Eigentlich gab er keinem von beiden den Vorzug, aber wenn es um seine gescheiterten Beziehungen ging, hatte er bisher nur Marian in sein Vertrauen gezogen. Er glaubte, dass Engbers für ein derartiges Gespräch nicht der Richtige war, weil er ihn auf diesem Gebiet für unreif und egozentrisch hielt. Er selbst versagte im Privatleben, während er die Karriereleiter immer steiler hinaufkletterte. Er hatte sich entschieden – jedenfalls redete er sich das immer häufiger ein und hatte dabei Angst, wie sein Vater zu werden.
Am Montagmorgen – er war immer einer der Ersten, die im Büro eintrafen – fühlte er sich wie gerädert.
Er hatte schlecht geschlafen und das lag ausnahmsweise nicht daran, dass er über den Fall nachgedacht hatte, sondern an Gliederschmerzen und Kopfschmerzen. Es würde eine ausgewachsene Grippe werden, wenn er sich nicht etwas Ruhe gönnte.
Sein erster Weg führte ihn in die schmale Teeküche, die zwei Flure miteinander verband und die die meisten Kollegen als Abkürzung missbrauchten, um von dem einen zum anderen zu gelangen.
Er brühte sich einen Espresso mit der Macchinetta auf, tat viel Milch in seine Bürotasse, ein Geschenk seiner ehemaligen Kollegen der IDF, das sie ihm zu seinem Abschied vom Stützpunkt inKeflavík gemacht hatten und die er seither immer im Büro benutzte. Nachdem er die Milch kurz in der Mikrowelle aufgewärmt und gewartet hatte, bis der Espresso fertig war, begab er sich in sein Büro, das ziemlich am Ende des einen Flures lag, stellte die Tasse auf einen kleinen freien Fleck neben dem Flachbildschirm seines Computers und ließ sich selbst in seinen Bürodrehstuhl sinken.
Das Erste, was er tat, wenn er einen neuen Fall zu analysieren hatte, war, Platz auf seinem Schreibtisch zu schaffen.
Er brauchte immer alle Unterlagen sofort griffbereit und vor allem unabhängig von Registratoren. Davídsson hatte sein eigenes System, den Überblick zu behalten. Während seine Kollegen die meisten Unterlagen in der Registratur aufbewahrten, um sie bei Bedarf heranholen zu lassen, dauerte ihm das meistens zu lange, was zur Folge hatte, dass sein Schreibtisch meist chaotisch und überfrachtet aussah, während der seiner Kollegen übersichtlich und aufgeräumt wirkte.
Einige hatten ihn anfangs deshalb belächelt, aber nach seinen ersten Erfolgen waren diejenigen, die das taten, immer weniger geworden.
Für Fallanalysen gab es mehrere Methoden, die mit der Zeit weiterentwickelt worden waren. Jeder Fallanalytiker hatte seine Vorlieben dafür ausgebildet, um möglichst koordiniert Zusammenhänge darzustellen und nachvollziehbar zu machen. Für einfach gelagerte Fälle wurde meistens die tabellarische Fallanalyse verwendet. Wenn mehrere Fallanalysten zusammenarbeiteten, nutzte man häufig die Metaplantechnik, eine Art Brainstorming, bei der man im Team Fakten auf Pinnwänden zusammenträgt und damit ein ständig aktualisiertes Lagebild erhält. War man alleine mit einem Fall beschäftigt und wollte trotzdem ähnlich vorgehen, bot sich die Mindmappingmethode nach Tony Buzan an, bei der ebenfalls Fakten anschaulich verknüpft werden. Das Bundeskriminalamt nutzte dafür eine Analysesoftware namens Analyst’s Notebook.
Er entschied sich für letztgenannte Technik, da er den Fall zunächst ohne die Mithilfe seiner Kollegen bearbeiten wollte und in der Regel mit dieser Methode die besten Ergebnisse erzielte.
Davídsson nahm einen Schluck aus der noch dampfenden Tasse und überlegte, wie er vorgehen sollte. Die Grundrichtung war klar – sie war immer gleich: Zunächst musste er alle Daten und Fakten, die offen zugänglich waren, zusammentragen. Der erste Angriff, wie es die Kollegen von der Kripo nannten, bestand aus Zeugenvernehmungen, Tatortberichten und dem Obduktionsergebnis. Danach war er an der Reihe.
Er musste weitere zum Teil verborgene Fakten sammeln, fehlende Gegenstände und Zusammenhänge erkennen und zusammentragen, bis sie miteinander in Beziehung gesetzt werden konnten.
3
Davídsson parkte seinen Citroën DS direkt vor dem Dienstgebäude des LKA in der Keithstraße, zeigte beim Pförtner, der kurz zur Bestätigung nickte, im Vorbeigehen seinen Dienstausweis und lief dann über die breite Treppe in das zweite Obergeschoss, wo Engbers sein Büro hatte.