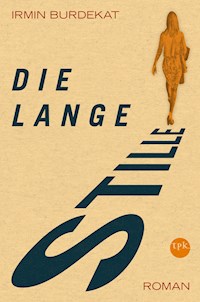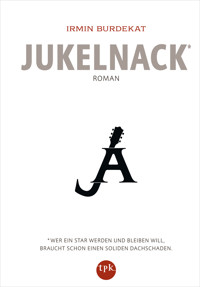
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tpk-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl-Friedrich Jukelnack ist bereits zweiundfünfzig Jahre alt, als er mit Hilfe einiger Gläser Weihnachtspunsch sowie der Zielstrebigkeit von Else Bödicker erstmals zum Vater gemacht wird. Ein Vorgang, der 1955 Aufsehen erregt. Adam Jukelnack wird von einer gnadenlos bohrenden Journalistin gezwungen, Einblicke in seine Kindheit bis Jugend zu gewähren. Ein Zwei-Generationen- Roman über das Werden und Leben eines Stars ... und über die schwarzen Löcher. »Ein wilder Husarenritt durch die Dunkelkammern der Erinnerung.« – Michael Lenkeit, Lektor »Ein Roman, der Stück für Stück menschliche Fassaden zum Einstürzen bringt – eingewickelt in kluge Worte.« – Vivien-Catharina Altenau, Influencerin »Wie Buddenbrooks – bloß mit mehr Gitarre!« – Florian Filsinger, Thinktanker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irmin BurdekatJukelnack
Irmin Burdekat
Jukelnack
© tpk-Verlag, Bielefeld 2023
www.tpk-verlag.de
www.jukelnack.de
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage 2023
Einband: Nicolina Unland
Satz: Christian Andreas
Lektorat: Michael Lenkeit
Korrektorat: Thomas Kiper
Druck: Finidr s.r.o., Tschechische Republik
Schrift: Rufina
Papier: Munken Print Cream 100 g/m2
ISBN: 978-3-910490-00-0
als eBook: ISBN 978-3-910490-01-7
als Hörbuch: ISBN 978-3-910490-02-4
FürAnne-Marie & Walter
Karl-Friedrich Jukelnack ist bereits zweiundfünfzig Jahre alt, als er mithilfe einiger Gläser Weihnachtspunsch sowie der Zielstrebigkeit von Else Bödicker erstmals zum Vater gemacht wird. Ein Vorgang, der im Jahr 1955 Aufsehen erregt.
Jukelnack Teil 1
Jukelnack, 1902 geboren, war als Kanonenfutter für den Ersten Weltkrieg zu jung. Gerade so. Sein Abiturzeugnis spiegelte wider, was andere über ihn dachten: Er war aus Prinzip mittelmäßig, unauffällig und ohne erkennbaren Ehrgeiz. Dumm war er nicht. Er speicherte eingetrichterte Bildung ab, ohne allerdings im Alltag häufig darauf zurückzugreifen. Der Weg des geringsten Widerstands wurde sein Lebenspfad. Nicht anecken, auffallen oder sich einmischen. Für die Rolle des Einzelgängers war Karl-Friedrich zeitlebens eine Idealbesetzung.
Nur bei der Entscheidung zwischen einem Leben mit Hunger im Bauch oder einem gefüllten Teller kam selbst er nicht umhin, sich etwas zu bemühen. Er wollte nicht hungern, dennoch möglichst anstrengungslos sein täglich Brot verdienen. Wie ließ sich das organisieren? Sein Vater, ein glühender Kommunist, gab 1920 den entscheidenden Tipp: »Du musst Lehrer werden. Volksschullehrer. Pädagogisches Seminar, gleich hier in der Stadt. Nach drei Jahren bist du schon fertig. Mit gleichem Zeitaufwand werden andere Bäcker oder Porzellan-Fachverkäufer, arbeiten mehr und verdienen weniger. Überleg es dir.«
1924 saß Karl-Friedrich Jukelnack im Schulamt. Den besser bezahlten Posten als Dorfschullehrer – sieben Jahrgänge in einer Klasse – lehnte er ab. »Viel zu anstrengend!«, glaubte der Beamtenanwärter. Außerdem wollte er die Stadt nicht verlassen und aufs Land ziehen.
Daher war Jukelnack ein Mal pfiffig, zumindest schien es so. Tatsächlich war aber seine Bequemlichkeit die Triebfeder, als er sich erkundigte: »An der Graf-Luckner-Schule ist nicht zufällig eine Stelle zu besetzen?« Eine fast monoton vorgetragene Frage, auf die die Sekretärin des Schulrats gereizt, aber zielorientiert reagierte. Ein anderer Karteikasten musste auf den Schreibtisch gewuchtet werden, bei dessen Durchsicht sie in diesem Moment für einen eben verstorbenen Lehrer Ersatz fand. Jukelnack bekam die Stelle und fühlte sich versorgt, weshalb er umgehend einen Gang runterschaltete. Von der Last, Ehrgeiz zu zeigen, befreit. Ein paar Gehminuten von der Graf-Luckner-Schule entfernt lag sein Elternhaus, sein Kinder-, Jugend- und Studentenzimmer. Hier war die Fensterbank, die Zeit seines Lebens eine wichtige Rolle für ihn spielte, auf der seine Arme lagen, wenn er sich hinaus in die Welt träumte, grübelte, nachdachte oder vielleicht sogar meditierte. Worüber?
Diese Frage wird bis zur letzten Seite dieses Buches unbeantwortet bleiben. Leider.
Das kleine Häuschen in der Reichsbahnersiedlung, in dem Karl-Friedrich mit seiner älteren Schwester und seinen Eltern aufwuchs, war mittlerweile geräumiger. Die Schwester hatte geheiratet und war ins Ruhrgebiet gezogen. Vom Siedlerhausleben mit arbeitsintensivem Gemüsegarten hatte sie die Nase voll. Auch Vater Jukelnack hatte früh die Nase voll, sowohl von seiner Frau, als auch von bürgerlicher Idylle mit regelmäßig zu leerendem Plumpsklo und streitbeladenen Besuchen der Schwiegermutter. Vater Jukelnack war Rangiermeister, aber er pfiff auf den Meister. Titel dieser Art waren ihm suspekt. Er fühlte sich als Arbeiter, forderte seine Kollegen auf, die Reihen »eng geschlossen zu halten«, argumentierte aufrührerisch und beschwor die Macht der proletarischen Solidarität. Er träumte von der Weltrevolution. Vom Aufstand der Massen. Von der Herrschaft der Arbeiterklasse. Träume, die sich mit einer blutjungen Genossin im Arm viel euphorischer und radikaler träumen ließen. Grund genug für ihn, sich zu verdrücken, um so den erwünschten Umsturz zu beschleunigen.
Mutter Jukelnack fühlte sich zur Lebensberaterin berufen und warnte bei jeder Gelegenheit vor dem weiblichen Unwesen im Allgemeinen und der zerstörerischen Kraft durch eine Frau im Leben ihres Sohnes. »Eine Frau, die sich für dich interessiert, will nur dein Geld und unser Haus. So ein Flittchen bringt nichts als Unglück – schau dir deinen Vater an!«
Da widersprach ihr Sohn nie. Hinweise dieser Art wurden Karl-Friedrich in den nächsten zwanzig Jahren ständig eingebläut. Dennoch spürte der junge Mann die Unruhe, die ihn befiel, wenn er sich gedanklich dem anderen Geschlecht näherte. Die Frauen hinterm Bahnhof, die Jukelnack hin und wieder aufsuchte, schienen die Warnungen der Mutter zu bestätigen, nahmen ihm allerdings – für viel zu viel Geld – einigen Druck aus den Lenden. Nebenbei: Vor Begegnungen mit diesen Damen musste er mindestens fünf große Biere trinken, um in die passende Stimmung zu kommen.
Über seinen Lebensweg und -wandel in den nachfolgenden Jahren lässt sich nur wenig berichten. Er war kein engagierter Lehrer und die Balance zwischen Abstand und Nähe zu seinen Schülern – weder gehasst noch geliebt – gelang ihm eher beiläufig. Sein Lebensmotto lautete: »Konflikte sind dazu da, um ihnen aus dem Weg zu gehen.« Jukelnack war nie unfreundlich, insistierte nicht, zeigte keine Erregungen, lachte mit, wenn alle lachten, oder zog die Stirn kraus, wenn es ratsam schien. Er griff die Stimmungen in seinem Umfeld auf und achtete darauf, dem jeweiligen Schwarm zu folgen.
Ab 1933 wurde Jukelnack ein berechnender Mitläufer. Gelangweilt, aber unauffällig. Sein Vater, der Kommunist, war ein schwerer Ballast, den er durch eine frühe Parteimitgliedschaft ausglich. Das Parteibuch der NSDAP wurde ihm ein regenfester Schutzschirm. Wer sich so ein Büchlein nicht besorgte, stand im Regen. Jukelnack hatte es lieber trocken. Zumal von ihm nichts verlangt wurde, was nicht ohnehin tief in seinen Genen verwurzelt war: Mitlaufen, sich nicht einmischen und keinerlei Mühe für die Entwicklung einer eigenen Meinung aufbringen. Die Partei war meinungsstark genug, da musste ein Jukelnack nicht noch seinen Senf hinzufügen. Erst recht keine Widerworte, die nichts als Energieverschwendung gewesen wären. Eine Ideologie mit Defiziten bei der Menschlichkeit – da halfen sowieso keine Argumente. Augen zu und durch! Für Karl-Friedrich die auf den Leib geschnittene Methode.
Jukelnack war weder gesellig noch ungesellig. Wenn man ihn einlud, erschien er. Ansonsten blieb er daheim. Ihn völlig emotionslos zu nennen, würde die Wirkung seiner Trinkgewohnheiten unberücksichtigt lassen. Ab dem dritten Bier begannen seine sonst eher faden Augen ein wenig zu leuchten. Eine Karriere als Alkoholiker wäre ihm sicher gewesen, sofern ihm nach dem zehnten Bier nicht regelmäßig schlecht geworden wäre. Dann musste er sich erbrechen und den nächsten Tag mit einem brummenden Schädel überstehen.
Beim Nachbarschaftsstammtisch im Goldenen Spaten war Jukelnack gern gesehen. Als kopfnickender Zuhörer wurde er von niemandem übertroffen. Er gab einen aus, wenn er dazu aufgefordert wurde, fing keinen Streit an, erzählte schon mal einen Witz, den er im Lehrerzimmer aufgeschnappt hatte, und kicherte mit jedem weiteren Bier lauter und höher. Irgendwann kicherte die Runde über Jukelnacks Eunuchen-Gekicher, kurze Zeit später erlöste ihn sein Würgereiz. Meist verließ er als Erster die Runde und machte den Weg frei für Tratsch und Klatsch auf seine Kosten. Manchmal musste sich Jukelnack direkt vorm Goldenen Spaten übergeben. Besser war es, unterwegs in einen der Gräben zu kotzen, die die Siedlungshäuser von der Schotterstraße trennten. Mit Glück reiherte er erst im heimischen Garten. Eine griffbereite Schaufel brachte das Gewölle unter die Erde, wo es düngte und der Mutter nicht auffiel.
Bis 1942 lief alles rund und ruhig nach Jukelnacks intuitivem Plan für ein unaufgeregtes Leben, denn er blieb an die Heimatfront abkommandiert und machte sich keine Sorgen um gar nichts. Doch dann brauchte der Führer die tatkräftige Mithilfe des Volksgenossen Karl-Friedrich Jukelnack. In Russland galt es den Bolschewismus auszumerzen und Land und Boden für ein wachsendes, allen überlegenes Volk zu arrondieren. Dazu musste wohl oder übel Krieg geführt werden. Kriege benötigen Krieger, am besten gut ausgebildete, unerschrockene und siegessichere Soldaten. Aber Jukelnack war nie Soldat gewesen. Als er es hätte werden können, in den Zwanzigern, durfte Deutschland nur hunderttausend Mann unter Waffen haben. Versailler Diktat, gar nicht so schlecht! Eine Wehrpflicht gab es nicht. Männer, die sich freiwillig meldeten, um entweder der Arbeitslosigkeit zu entgehen oder ihre Rauflust zu befriedigen, mussten mindestens einen Meter achtzig groß sein. Da hätten Jukelnack neben der Rauflust schon mal drei Zentimeter gefehlt.
Mit neununddreißig Jahren steckte man ihn in eine mausgraue Uniform, verordnete ihm drei Monate Landsknechts-Einmaleins und prüfte seine soldatischen Tugenden. Jukelnack konnte marschieren, parieren und salutieren, aber nicht kanonieren. Er schoss höchstens aus Versehen Spatzen von Bäumen, meist aber Löcher in die Luft. Ohne jegliche Aufsässigkeit. Er konnte einfach nicht schießen, weil ihm das Zielen nicht gelang. So einer kam zur Etappe, schleppte sich für den Nachschub den Buckel krumm, fuhr schlingernd durch russischen Matsch und blieb, wie alle, irgendwann darin stecken.
***
Else Bödicker hätte im Dezember 1917 das Licht der Welt erblicken können, wenn es denn bei ihrer Geburt hell genug gewesen wäre. Aber die einzige Vierzig-Watt-Glühbirne in der Wohnküche ihres Elternhauses blieb in jener Nacht dunkel, weil die Stromversorgung auf dem Lande noch unzuverlässiger war als in der Stadt. Lediglich drei Talgkerzen flackerten und rußten bei ihrer Geburt vor sich hin.
Die kleine Bauernkate ihrer Eltern beherbergte bereits acht Kühe, einundzwanzig Schweine und drei Schwestern. So gesellte sich zu der relativen Dunkelheit noch die Enttäuschung, wieder keinen Hoferben geboren zu haben. Die Mutter stöhnte vor Anstrengung, der Vater vor Hoffnungslosigkeit. Erst drei Jahre später würde Else einen Bruder bekommen und der Vater seinen Glauben an die Gerechtigkeit der Welt sowie die Güte des alles lenkenden, himmlischen Herrn zurückerhalten.
Als Vierjährige fing sich Else den Spitznamen ein, der ihren Lebensweg lange kennzeichnen sollte: Der Vater nannte sie »Primelpöttchen«. Sie schien oft in sich gekehrt, wirkte vertrottelt, stieß sich häufig und kam ständig als Letzte, wenn die Bödicker-Kinder gerufen wurden. Ein paar weitere Attribute warteten bereits auf sie: faul, schlafmützig, ungelenkig, doof. »Die doofe Else«. So beschrieb sie der alte Dorfschullehrer seinem jungen Nachfolger, dem er 1925 zu Ostern die Klasse übergab.
Der neue Lehrer war experimentierfreudiger. Er hielt die Prügelstrafe zwar ebenfalls für ein probates Mittel, Kindern zu einer besseren Bildung zu verhelfen, war aber pädagogisch moderner geschult. Bevor er mit dem Lineal auf Finger haute oder mit dem Rohrstock Hinterteile bearbeitete, fragte er die »Bauerntölpel« nach dem Grund ihrer Leistungsverweigerung.
Die doofe Else hatte mal wieder nicht kapiert, was klar und deutlich an der Tafel stand: Eine simple Rechenaufgabe, die sie trotz scharfer Fragetechnik nicht lösen konnte. Der junge Lehrer machte sich auf den Weg in die letzte Reihe, schlug das Lineal schon mal zum Training seiner Treffsicherheit in die eigene, linke Hand und sagte dann bemüht sachlich: »Else, warum bist du nur so doof? Was ist so schwer daran, 31 weniger 15 auszurechnen?« »Ich wusste nicht, wie die Aufgabe lautet. Sie haben es ja nicht gesagt. Nur an die Tafel geschrieben. Aber da kann ich es nicht lesen!« Else begann zu weinen. Ihr Lehrer stutzte. Ein interessanter Fall. Davon hatte er gehört. Nicht alle Kinder konnten gleich gut sehen. Da halfen Experimente. Das war spannend. Sofort vergaß er das Lineal. Da probierte man und ging auf Erkenntnissuche. »Komm mal her!«, befahl er. »So, hier, komm zu mir!« Else stand auf und ging schniefend, verängstigt und langsam auf den Lehrer zu. Der stellte sich hinter sie, griff in ihren Nacken und lief auf die Tafel zu. »Was steht da?« fragte er ein Mal, zwei Mal, drei Mal.
»Ich kann es nicht lesen, ich sehe es wirklich nicht«, schluchzte Else, ihr Kopf starr auf die Tafel gerichtet von einer festen Hand an ihrem Hals. Dann endlich, einen Meter vor der Tafel die Erlösung: »Jetzt sehe ich die Zahlen. 31 weniger 15, das sind 16. Und darüber steht 25 und 7, also 32, jetzt sehe ich alles!« Else wischte sich mit ihrer blau-weiß-karierten Schürze, die sie wie alle anderen Mädchen ständig trug, die Tränen von ihren schamroten Wangen. Ihr rohes Wollkleid unter der Schürze staute die Körperwärme und sorgte für eine feuchte Stirn und einen unangenehmen Körpergeruch.
Ein paar Wochen später hatte Else jene Glasbausteine auf ihrer Nase, die aus ihr Brillenschlange, Glubschauge, Wanderlupe oder schlicht die blinde Else machten. Immer wieder fragten kichernde Kinder, ob ihr Vater Glaser sei oder sie bei Regen Scheibenwischer benutze. Die Neckereien der Kinder, auch ihrer Geschwister, verstärkten ihr introvertiertes Wesen noch mehr. Ein Kind mit Sehschwäche und Brille war auf einem Bauernhof nur begrenzt einsetzbar. Kartoffeln schälen, Schweine füttern, Geschirr abwaschen ging, aber bei Gartenarbeiten, beim Eiersuchen im Hühnerstall oder in der Ernte auf dem Feld war Else eher ein Hindernis. Dabei schien sie keineswegs einfältig zu sein. »Ich glaub sie ist doof, aber nicht dumm.« Genau so sagte es der Vater eines Tages und machte sich seine Gedanken. Gedanken, die Else ein wenig Anerkennung in Aussicht stellten.
Ein paar Jahre später legte die Landwirtschaftskammer ein neues Programm auf. Sie vermittelte lernwillige arme Kinder vom Lande in die Haushalte älterer Stadtbewohner. Meist waren dies ehemalige Großbauern, die sich mit guter finanzieller Ausstattung aufs Altenteil zurückgezogen hatten, dorthin, wo es Ärzte, ein Theater, ein paar Kinos, Cafés und ordentliche Restaurants gab. Diese Edel-Pensionäre nahmen nur zu gerne ein junges Mädchen im Hause auf. Sie waren es gewohnt, Mägde zu beschäftigen und wussten anfallende Arbeiten zu verteilen. Nun gut, die jungen Dinger sollten morgens in die Schule gehen, aber ab Mittag waren sie für allerlei Handreichungen bestens zu gebrauchen. Und am Sonntag standen sie von früh bis spät zur Verfügung.
Else Bödicker wurde zu den Poggenpohls vermittelt, beide noch keine siebzig Jahre alt. Der resoluten Berta Poggenpohl kam es darauf an, anzukommen. Nicht leicht für eine Großbäuerin im neuen, bürgerlichen Milieu. Aber mithilfe der besten Schneiderin am Platze sowie der wöchentlichen Renovierungsleistungen im Salon Blume sah sie inzwischen recht passabel aus und fiel im Foyer des Residenztheaters nicht mehr auf. Jedenfalls solange sie nicht den Mund aufmachte. Ihr Gatte hingegen lehnte Eingriffe an seiner äußeren Erscheinung rundum ab. Für ihn waren Äußerlichkeiten reine Optik, und Optik bezeichnete er schlicht als die Lehre vom Licht. »Mehr is dat nich!«
Frau Poggenpohl war penibel, kontrollsüchtig, besserwisserisch und stolz auf ihre Schulbildung. Nach sieben Jahren Volksschule hatte sie zwei Jahre die Hauswirtschaftsschule besucht und fast mit »gut« abgeschlossen. »Sey wär jo up de Pudding-Akademie« { Sie war ja auf der Pudding-Akademie }, machte sich ihr Mann hinter ihrem Rücken lustig, wenn Berta stolz davon berichtete. Vorteilhafterweise hatte sie aber über dreißig Hektar Land mit in die Ehe gebracht, was sie – nach ihrem Gefühl – ihrem Gatten ebenbürtig machte. Frau Poggenpohl brauchte man nichts von Emanzipation oder Gleichberechtigung erzählen. Die war bei ihr eingebaut und musste nicht erst von außen erweckt werden. Genau genommen fühlte sie sich ihrem Mann überlegen und war damit auf demselben Holzweg wie er, der dasselbe von sich dachte. Berta Poggenpohl wäre unausstehlich gewesen, hätte sie nicht ab Mittag zur Likörflasche gegriffen. Bis siebzehn Uhr stündlich, danach im Dreißigminutentakt. Der Likör förderte eine sanfte Milde in Bertas Wesen, weshalb ihr Gatte den Nachschub im Auge behielt. Im Weinhaus Hoyer bestellte er wöchentlich zu seinen zwölf Flaschen Rheingau Riesling die gleiche Menge an süßem Kräuterlikör. Das Alkoholverhältnis der Flüssigkeiten war eins zu zwei und diente schließlich einem guten Zweck: dem Frieden in der Welt und besonders dem in der Ehe der Poggenpohls.
Heinrich Poggenpohls Fürsorglichkeit zeigte sich nicht nur im Weinhaus Hoyer. Er mochte die Menschen in seiner vertrauten Umgebung und zeigte es ihnen. Man hätte ihn sensibel nennen können, wäre diese Beschreibung für einen Mann im Jahre 1929 schon als positives Attribut in Umlauf gewesen. Er war gemütlich, freundlich, ohne jede Eitelkeit, großzügig und belesen. Man würde ihm seine Herkunft kaum angesehen haben, hätte er nicht die großen, runden, roten und rot geäderten Pausbacken gehabt, die ihn als Landmann kennzeichneten. Außerdem pflegte er sehr zum Ärger seiner Frau die plattdeutsche Sprache und gab sich keinerlei Mühe, Hochdeutsch zu sprechen, wenn die Poggenpohls in gesellschaftlichen Angelegenheiten auf die besseren Kreise der Stadt trafen.
Else Bödicker hätte es schlechter treffen können. Die Poggenpohls sorgten für das Schulgeld, hatten eine nette Kammer auf dem Dachboden und boten geordnete Verhältnisse. Elses Eltern waren gleichfalls sehr einverstanden mit dieser Entwicklung. Als Hilfe auf dem Hof oder im Haushalt blieb sie hinter den Erwartungen zurück und ihre seltenen Wortbeiträge waren der Mutter oft zu kompliziert. Außerdem wusste ihre Familie mit Humor oder gar Ironie nichts anzufangen, denn Else gelang es nicht immer, komische Situationen unkommentiert zu lassen. Blieb nur, in sich hinein zu kichern, was den Nachteil hatte, dass humorvolle Menschen sie nicht auf Anhieb als gleichgesinnt erkennen konnten.
Berta Poggenpohl schrieb täglich vor elf Uhr in die Küchenkladde, was Else »gefälligst« erledigen sollte. Danach benötigte die Hausherrin ihre Konzentration für Wichtigeres und kümmerte sich nicht mehr um »die Deern«. Gut für Else, so blieb genug Zeit zum Lernen, später sogar, um sich in der Stadt umzuschauen. Heinrich Poggenpohl hingegen entwickelte väterliche Gefühle für die »lütte Deern«, freute sich, mit ihr Platt snacken zu können und zeigte seine Sympathie für die Mittelschülerin.
Wenn Else aus der Schule kam, hatten die Poggenpohls bereits gegessen und hielten Mittagsschlaf. Ihr Essen stand – meist lauwarm – auf der holzbefeuerten Küchenhexe. Ein tiefer Teller, von Berta portioniert und abgedeckt mit einem weiteren, umgedrehten tiefen Teller. Essen musste sie im Stehen. Auf den zwei Küchenhockern standen meist schmutzige Töpfe. Else kannte es von zu Hause nicht anders. Alle Bödicker-Kinder standen um den Küchentisch, an dem nur für die Eltern zwei Schemel zum Sitzen einluden. Während dieser Mahlzeiten hatten die Kinder Sprechverbot, lauschten den problemgeladenen Ausführungen des Vaters – von der Mutter häufig mit einem doppelten »jo« bestätigt – und konnten sich so schon mal ein Bild von ihrer düsteren Zukunft machen. Tagtäglich vorgelebte Ausweglosigkeit.
In der Poggenpohlschen Küche gab es kein Sprechverbot, allerdings war auch nie jemand da, mit dem Else hätte sprechen können. Dennoch empfand sie die Atmosphäre als zwanglos und angenehm. Mit sich allein war Else nicht verstockt, nicht auf der Hut, fühlte sich weder beobachtet noch begutachtet. Sie nahm ihren Teller und wanderte zur Balkontür, von wo aus sie in den Garten schauen konnte. Ohne Hast zu essen, ohne die Angst, nicht genug abzubekommen, war eine komfortable Situation, die Else als Glück empfand. Später, mutiger, schlich sie sich schon mal in die Speisekammer und gönnte sich ein wenig Nachschlag. Danach musste sie das Geschirr abwaschen. Frau Poggenpohl türmte alle sonstigen von ihr beim Kochen benutzten Utensilien in eine Zement-Spüle. Neben dem Frühstücksgeschirr standen dort die benutzten Teller und Platten. Das Besteck lag eingeweicht in einem der Töpfe. Eine Stunde dauerte es, bis alles abgewaschen, abgetrocknet und sauber verräumt war. Danach musste sie noch schnell den Fliesenboden in der Küche feucht wischen, »feudeln« nannte es die Dame des Hauses, und Wasser aufsetzen.
Auf ein Tablett stellte sie zwei Teetassen, den Zuckertopf, Löffel und die leere Biskuitschale, die erst später von Frau Poggenpohl aufgefüllt wurde – ohne dass Else auch nur ein Stück davon abbekommen hätte. Wenn sie die aufwendig bemalte Kanne gefüllt hatte, musste der Tee fünf Minuten ziehen, um dann auf einem Stövchen heiß gehalten zu werden. Mit voller Konzentration bugsiert – immer die Stolperkante des dicken Teppichs im Blick – ging es nun ins Wohnzimmer, vorbei an zwei ausladenden, mit Cordstoff bezogenen Sesseln. Danach war sie frei. Frei, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Und ihre Schuhe zu putzen. Und ihre Kammer zu fegen. Und um wöchentlich das Treppenhaus zu wischen, nachdem sie es vorher mit Handfeger und Schippe vorgereinigt hatte. Und um im Garten Unkraut zu jäten, wenn es ihr von Frau Poggenpohl aufgetragen worden war. Und um Wäsche mit der Hand zu waschen. Und um einzukaufen, sofern das gewünscht wurde. Und um zu träumen …
Träumen konnte sie auch bei der befohlenen Gartenarbeit. Für Else keine Arbeit, sondern ein sinnliches Vergnügen. Sie liebte den Geruch der verschiedenen Pflanzen, besonders den der Küchenkräuter. Mit den Händen in der Erde zu wühlen machte ihr Spaß – Regenwürmer herauszuziehen, sie auf den festen Boden der schmalen Wege zu legen und zu beobachten, wie sich Vögel darauf stürzten. Hier roch es wie zu Hause. Und ohne die ständigen Kommandos der Mutter oder von Frau Poggenpohl war die Beschäftigung geradezu ein Steckenpferd – wie man Hobbys damals nannte.
***
Die Jahre bis zum Eintritt in die Armee vergingen für Karl-Friedrich Jukelnack in paradiesischer Langeweile. Keinerlei Aufregungen waren zu verdauen, das Leben verlief gleichförmig. Politik war ein Monster hinter den sieben Bergen. Natürlich passierte was! Man hätte sich aufregen können, streiten, parteiisch werden oder in Unruhe verfallen. Aber wozu? Überall gab es Versammlungen, Aufmärsche, Schreiereien und Schlägereien. Gerne nahm er angebotene Flugblätter entgegen, fragte sogar nach einem zweiten oder dritten Exemplar und steckte sie sanft zustimmend nickend ein. Er las kaum je ein Wort dieser Pamphlete, aber sie eigneten sich hervorragend zum Feuer anmachen. Mit etwas Glück waren die Rückseiten unbedruckt. Schreibpapier konnte man immer gebrauchen. Und irgendwann würde ja auch alles wieder besser werden. Darauf hoffte jeder Zeitgenosse. Das Geld war zwar Ende der Zwanziger Jahre täglich weniger wert, doch der Jukelnacksche Garten mit seiner ergiebigen Gemüseernte nahm davon keine Notiz. Das kleine Beamtengehalt reichte immer für Bier im Goldenen Spaten, Kernseife, Mehl, loses Sauerkraut und sonntags ein Stück Kasseler. Kathreiner Kaffee schmeckte auch ohne Zucker und die Heimatzeitung wurde abbestellt, wenn das Haushaltsgeld knapp wurde. Mutter Jukelnack war ein Spargenie und stopfte Strümpfe noch, wenn vom ursprünglichen Material kaum ein Faden übriggeblieben war. Alle Lehrer in der Schule trugen ausgebeulte Klamotten mit glänzenden Stellen an Ärmeln, Knien und am Revers. Dass Jukelnack noch etwas ärmlicher daherkam, fiel niemandem auf. Den Kindern schon gleich gar nicht. Modefragen waren in jenen Zeiten weder unter Schülern noch im Kollegium ein Gesprächsthema.
1933 war der konträre Rabatz zwischen Roten und Braunen in den Städten vorbei. Der überbordende, gleichgeschaltete Rabatz, der nun auf Straßen und Plätzen vorbeimarschierte oder aus dem Volksempfänger tönte, war immer mit Musik verbunden. Wagner- oder Marschmusik, Volkslieder oder schwülstige Schlager – Jukelnack sortierte nicht. Er mochte Musik. Egal welche. Hauptsache, er hörte Melodien, die sich mitsummen ließen und ablenkten. Wovon? Darüber machte sich Jukelnack keine Gedanken.
Der Kosmos in seinem Kopf blieb lebenslänglich abgeschirmt und undurchlässig. Nie drang auch nur ein winziger Gedankenfetzen heraus. Überlegungen, die er allein in seinem Zimmer spann. Auf einer Fußbank, darauf ein Kissen, kniend, die Arme aufs Fensterbrett gestützt, den Kopf in die Hände gelegt und den Blick scheinbar nach draußen gerichtet. Fantasien in schmutzige Abgründe? Wenn, dann blieben die neuronalen Impulse auf verschlungenen Bahnen in seinem Hirn gefangen. Nie handlungsbestimmend und stets sauber von jeder Realität abgeschottet. Auf eine unbestimmbare Art blieb Jukelnack immer ein Innenmensch. Jedenfalls bis zum zehnten Bier. Und dieses war oft schneller wieder heraus, als es hinuntergespült worden war.
Menschen sind das Produkt ihrer Erziehung. Und Mutter Jukelnack erzog ihren Sohn bis kurz vor ihrem Tod, auf den sie und Karl-Friedrich bis 1952 warten mussten. Ihr Erziehungsprogramm lautete: »Gemacht wird, was ich sage!«
Seine Lebensmaxime »Konflikte sind dazu da, um ihnen aus dem Weg zu gehen« passte sich perfekt dieser Vorgabe an. Mit einem angenehmen Nebeneffekt: Jukelnack war der einzige Lehrer, der seine Schüler nie verhaute. Er kam ohne Prügel genauso gut oder schlecht klar wie mit. Prügelnde Lehrer benötigten zur Ausführung ihrer Tat eine Portion Wut, Aggressivität oder Hinterhältigkeit. Keine dieser Anforderungen war Jukelnack bereit sich abzuringen. Falscher Ehrgeiz ist Energieverschwendung. Ehrgeiz an sich schon mal anstrengend. Aber keinen Ehrgeiz zu haben wird mit Gleichgültigkeit belohnt. Jukelnacks Schüler schätzten das. Sie mochten ihn zwar nicht, waren aber froh, dass er sie mit Schlägen und Anstrengungen verschonte. Bei ihm konnte man sich durchlavieren. Und was wollen Schüler mehr?
Das Siedlerhaus im Dornbuschweg blieb bis ins Jahr 1955 nahezu unverändert. Weder Mutter Jukelnack noch ihr Sohn hatten Ambitionen, ihre Umgebung zu gestalten. Die Wände waren getüncht, ursprünglich weiß. Ein Stück unter der Decke verlief ein brauner Konturstreifen. Fachmännisch mit einer Rolle aufgebracht. Das Muster? Ein Mix aus ostfriesisch-griechischer Simpelgrafik.
Im Haus – nicht in der Küche, aber ansonsten überall wahrnehmbar – ein zarter Hauch Toilettenduft, der sich in seiner Intensität nie veränderte. Egal ob Karl-Friedrich die Jauchegrube frisch entleert hatte oder die träge Masse knapp unter dem Abort-Loch stand. Bis Mitte der Sechzigerjahre, als das Haus an die Kanalisation angeschlossen wurde, blieb dieser spezifische Duft eine Spezialität der Jukelnacks.
Ab Ende 1964 war der Geruch, jedenfalls außerhalb der Toilette, verschwunden. Gelästert wurde trotzdem weiter: »Die Jukies sind zu geizig für den Torf im Klo – die lassen es lieber stinken«, höhnten die Nachbarn. Und lachten.
Wie komfortabel so ein schickes Plumpsklo in Wirklichkeit war, ließ sich erst ermessen, wenn man als Soldat nur noch einen Donnerbalken zur Verfügung hatte. Und wenig später nicht einmal mehr den. Natürlich konnte man darüber klagen, aber die Kameraden, die ihren Frust zu dem Thema schimpfend zum Besten gaben, wurden nur veralbert. »Schisskojenno!«, hieß es dann. Oder: »Scheiß doch mit Gebello in die Hosen von Flanello!« Das Soldatenleben war rau. Selbst für einen geübten Drückeberger wie Jukelnack. Die brutalen Märsche in die Kriegsgefangenenlager überstanden nur Stoiker. Männer, die sich nicht selbst leidtaten, die ihren Kopf im Griff hatten. Wer sich empörte, lebte nicht lange. Wer klagte, verzweifelte oder aufbegehrte, bekam entweder einen Schuss ins Genick oder starb an innerem Unfrieden. Wer überleben wollte, musste sich anpassen. Nicht leicht in einer Atmosphäre der Entmenschlichung. Nur völliges Abstumpfen bis zur Emotionslosigkeit sicherte das Überleben.
Das Lager bei Minsk war lediglich als Zwischenstation gedacht. Für kurze Zeit, um den Straßenbau voranzubringen. Von hier fuhren später Güterzugladungen verfrorener Gefangener in die sibirischen Kohlegruben, sofern sie noch transportfähig waren. Vorher wurde noch eine Auslese getroffen.
Der sowjetische Politoffizier sprach Deutsch und war auf der Suche. Zunächst nach Nazi-Politoffizieren, denn er wusste um die Gefährlichkeit dieser Spezies. Jeder, den er herausfilterte, bekam seine gerechte oder ungerechte Strafe. Immerhin ein schneller Tod.
Genauso wichtig war die Suche nach Spezialisten, die man in der eigenen Kriegswirtschaft gebrauchen konnte, die sich umdrehen ließen, um nützlich zu sein. Hinter mancher ausgemergelten Visage versteckte sich vielleicht ein Ballistiker, ein Ingenieur oder ein Mathematiker mit heiß begehrten Kenntnissen. Zum Beispiel in der Raketentechnik.
Besonders gesucht waren in diesen Tagen jedoch Männer mit der richtigen Gesinnung. In der sowjetischen Besatzungszone sollte ein sozialistischer Bruderstaat entstehen. Ein treuer Satellit als Vorposten gegen den zum Untergang bestimmten Kapitalismus und seine willfährigen, Amerika-hörigen Vasallen.
Im Interview mit dem Mann an der »Rampe« – wo es entweder um Sibirien, russische Waffenschmiede oder Aufbau des Kommunismus in Ostdeutschland ging – erkannte Jukelnack seine Chance. Er bezeichnete sich und seine Familie als glühende Kommunisten, denn er wusste von seinem Vater, wie diese glühten. Er verwies auf seine Vornamen – Karl wie Marx, Friedrich wie Engels – und gab ein paar Stichworte zum Besten, die sein rotes Herz beschrieben. Der Polit-Kommissar kannte Gesinnungssimulanten und bohrte fragend nach. Doch Jukelnack war faktensicher. Er beschrieb einen Teil des Lebenslaufs seines Vaters und gab ihn als den eigenen aus. Zuerst Mitgliedschaft im Spartakusbund, danach Eintritt in die VKPD, Beiträge für die Parteizeitung Rote Fahne und Erlebnisse im revolutionären Kampf, sowohl blutig auf Straßen als auch agitatorisch vor und hinter Fabriktoren. Nach 1933 dann die Konspiration im Kampfbund gegen den Faschismus. Das stete Versteckspiel und die Verhöre bei der Gestapo. Jukelnack redete wie stets fast monoton und ohne zu überzeichnen. Er sah in die Augen seines Gegenübers, sah, wie gut er damit ankam, sah, wie dieser aufsprang und ihn »Genosse Jukelnakow« nannte, die geballte Faust zum Gruß hochreckte, um ihn dann zu umarmen. Jukelnack kam nur ein laues »Freundschaft« über die Lippen, aber immerhin schlug er die Hacken in seinen zerfledderten Filzstiefeln zusammen. Ähnlich wie seinerzeit im Schulamt schaltete er sofort ein paar Gänge zurück, als er den Marschbefehl bekam, denn er war in den Augen des sowjetischen Parteisoldaten genau der richtige Mann, um in Ostberlin Kader zu schmieden. Da war sich der Apparatschik sicher. Er stempelte dessen Papiere und schon einen Monat später betrat Karl-Friedrich Jukelnack wieder deutschen Boden.
Wenige Wochen später – der Staub, aus dem er sich gemacht hatte, hing noch in seinen Kleidern – saß er wieder bei der Mutter im Siedlerhaus und schlürfte eine dünne Steckrübensuppe. Fast so dünn wie im Lager.
***
Die Abendmahlzeit bei den Poggenpohls wurde pünktlich um achtzehn Uhr dreißig eingenommen. Zu dritt. Else kochte Hagebuttentee und deckte im Esszimmer den Tisch. Drei Holzbrettchen, Messer und Gabeln, Teetassen mit kleinen Löffeln und zwei Gläser. Für das »Dessert« der alten Leute noch Weinglas und Likörkelch. Frau Poggenpohl machte schon am Vormittag zwei Aufschnittplatten zurecht, eine mit Käse, die andere mit Wurst und Schinken. Die standen in der Speisekammer parat. Herr Poggenpohl ging in die Küche, nahm das große, gezackte Brotmesser aus einer Schublade, klemmte sich ein kiloschweres Schwarzbrot unter einen Arm, unter den anderen einen Laib Graubrot und schlurfte, mit dem Messer in der Hand, zu Tisch. Ein Schneidebrett brauchte er nicht. Er schnitt die Brote vor dem ausladenden Bauch. So wie es schon sein Großvater getan hatte. Der linke Arm wurde zur Schraubzwinge, die rechte Hand säbelte auf Wunsch halbe oder ganze Scheiben, die er mit breitem Grinsen den Damen auf die Brettchen schmiss. Landete eine Scheibe neben dem Ziel, lachte Poggenpohl und sagte: »Oh, dat givt Schietweer. Use Brod flegt man leeg!« { Oh, das gibt schlechtes Wetter. Unser Brot fliegt so tie! }
An so einem Abend, Else war schon mehr als ein Jahr im Haus, musste Frau Poggenpohl noch schnell auf den Dachboden. Vormittags hatte sie dort Wäsche aufgehängt, unter anderem ein paar Blusen von sich und zwei Hemden ihres Mannes.
Die Flickschneiderin wollte vorbeikommen, und Blusen und Hemden sollten mit. Die hatten Stellen, an denen das Leinen angerissen war. Schuldig war natürlich Else: »Zu viel Stärke, die dösige Deern …« Ein funkelnder, strafender Blick traf das Mädchen. Sie war es inzwischen gewohnt, an allem die Schuld zu haben.
»Zwei Blusen und ein Hemd soll die Gloysteinsche stopfen, auch wenn sie noch nicht ganz trocken sind«, sagte Frau Poggenpohl im Hinausgehen. Nur sie wusste, wo sie die kleinen Löcher entdeckt hatte. Die Flickschneiderin verstand sich aufs Kunststopfen und würde ihr Bestes geben. Frau Poggenpohl war immer auf schnellen Füßen unterwegs, egal, wie viel Likör sie intus hatte. Ihre sechsundsechzig Lebensjahre erahnte man nicht. Ihre flotten Bewegungen ließen sie jünger erscheinen. Schnell war sie im Treppenhaus. Von der ersten Etage, wo Familie Brunken wohnte, führte eine schmale, steile Treppe zur Bodenluke. Die schwere Holzklappe drückte man am besten mit zwei Händen hoch, dann ging es leichter. Else machte das mehrmals täglich – immer, wenn sie in ihre Kammer hochstieg. Die ausgetretenen und manchmal rutschigen Stufen waren für Else kein Problem. Frau Brunken hatte ausgerechnet an diesem Abend frisch gebohnert und das Bohnerwachs mit einem Lappen nachpoliert, damit es hübsch glänzte. Beide Hände über sich an der Luke, keinen Halt am Geländer und nur Pantoffeln an den Füßen – Berta Poggenpohl rutschte aus, verlor den Halt, stürzte die Treppe hinunter und gab noch einen lauten, inhaltlich aber unverständlichen Schrei von sich.
Frau Brunken hörte ihn, Else Bödicker auch. Sie sprang auf und wollte durch die offene Wohnungstür in den Hausflur rennen. Aber Herr Poggenpohl beruhigte das junge Ding. »Set di man wedder dohl. Use Moder krakeelt gern, seij is n beten nervös.« { Setz dich man wieder hin. Unsere Mutter schreit gern, sie ist ein bisschen nervös. }
Der zweite Schrei kam von Frau Brunken. Markerschütternd. Als Amtmannsfrau war sie eigentlich nie nervös, weil man sich schließlich zusammenreißen musste, wie Herr Brunken zu sagen pflegte. Nun rannte Else los, Herr Poggenpohl folgte ihr mit ruhigen Schritten. Frau Brunken und Else erstarrten schockiert, hielten die Hände vor den Mund und schluchzten im Duett. Herr Poggenpohl blieb ohne besondere Aufregung. Vor ihm lag seine Frau, den Hals verdreht, die Augen weit aufgerissen. Bauer Poggenpohl hatte in seinem Leben schon genug Hühnern den Hals umgedreht, um die Situation richtig einzuschätzen. »Nu is sej dod. God erbarme sich ihrer armen Seele. Löp man gau ton Doktor hän. Hej will ja ok wat to don häppen« { Nun ist sie tot. Gott erbarme sich ihrer armen Seele. Lauf man schnell zum Doktor hin. Er will ja auch was zu tun haben }, beauftragte er Else und kniete sich hinunter zu seiner Frau. Seine Hand befühlte den Hals, dann tätschelte er ihre Wange und sagte: »Mog good, Moder. Häs din Läven lebt. Nu is dat ut. Wenn usen Herrgod in sin unergründlichen Radschlog dat so wull, könnt wi nix moken.« { Mach’s gut, Mutter. Hast dein Leben gelebt. Nun ist’s vorbei. Wenn unser Herrgott es in seinem unergründlichen Willen so bestimmt, können wir nichts machen. }
Frau Brunken weinte laut, Else liefen die Tränen still übers Gesicht. »Nu löp tau!« { Lauf zu! }, brummte Herr Poggenpohl nochmal, bevor er sich umdrehte und gemächlich die Treppe hinunterstieg, um sein angefangenes Schinkenbrot zu Ende zu essen. Nachdenklich! Ganz langsam begann er zu trauern. So wie er es von seinem Hof kannte, wenn er einem alten, geliebten, treuen Hund den Gnadenschuss geben musste, weil er von ständigen Schmerzen geplagt wurde.
Die Wohnungstür blieb offenstehen. Frau Gloystein klingelte und war bereits im Flur, als sie rief: »Ich bin’s!« Herr Poggenpohl stand am Fenster des Esszimmers. Sein Blick wanderte schon seit Minuten hinaus, hinüber in den Burggarten-Park. Er mochte den Park, die großen Bäume, die schön angelegten Blumenbeete. Aber er hatte es stets gehasst, dort mit seiner Frau zu promenieren und pausenlos den Hut zu ziehen, wenn von Berta der Knuff in die Seite kam, weil er gefälligst auch einen Gruß erbieten sollte. Zu Menschen, die er meist gar nicht kannte. Herrschaften, die er gefälligst nicht mit Moin-Moin grüßen sollte, sondern ordentlich – »wie es sich gehört!« – mit Guten Tag. »Neumodschen Kroam«, brummelte er dann und tat wie befohlen.
»Ich sollte doch Stopfwäsche abholen, oder?«, fragte die kleine Frau und sah sich unsicher um, auf der Suche nach der Hausherrin.
»Vondage ward dat nix mehr. Mine Froh is nicht good to paas. Kummt sej man nexte Weeke woller.« { Heute wird’s nichts mehr. Meine Frau ist unpässlich. Kommen Sie man in der nächsten Woche wieder. }
Else führte den Doktor sofort hoch in den ersten Stock. Frau Brunken hatte inzwischen eine Wolldecke über die Tote gelegt, die der Arzt nun unwirsch zur Seite zog. Ein Blick genügte auch ihm. Trotzdem ging er auf die Knie und griff nach Bertas Hand. Kein Puls. Kein Glanz mehr in den Augen. »Kein Honorar«, zuckte es kurz durch seinen Kopf, und er begann, die frische Leiche noch ein wenig wiederzubeleben. Freilich erfolglos. Dennoch: Frau Brunken und Else, die ihm dabei zusahen, beruhigten seine Bemühungen sichtlich.
An diesem Abend trank Else Bödicker zum ersten Mal offiziell Alkohol. Vorher hatte sie nur heimlich an den Likörflaschen von Frau Poggenpohl genippt. Süßes Zeugs, das im Hals brannte. Der Wein von Herrn Poggenpohl war dagegen lieblich und kratzte kein bisschen. Dafür tröstete er ungemein. Sie saßen in der guten Stube der Eheleute. Hier war Else bisher nur gewesen, wenn sie den Nachmittagstee auf das kleine Tischchen neben den beiden sperrigen Sesseln gestellt hatte. Jetzt saß sie auf dem dunkelgrünen Feincordstoff, zunächst ganz vorne auf der Kante. Angespannt schaute sie auf das große Ölgemälde an der Wand. Es zeigte einen Mann am Pflug hinter einem Pferd. Im Hintergrund war mit feinen Pinselstrichen eine Bauernkate mit Reetdach und rauchendem Schornstein gemalt. Die Welt auf dem Bild erschien ihr jedenfalls heiler als die Wirklichkeit der Gegenwart. Elses Finger strichen unauffällig über den weichen Stoff mit den kleinen, festen Rillen. Ein schönes Gefühl an den Händen.
»Dat Leven mut jo wieter goan!« { Das Leben muss ja weitergehen! }, meinte Herr Poggenpohl nach einer Weile. Nicht nur ein Mal. Sein Tonfall wirkte gedämpfter als normal. Else war inzwischen fast vierzehn Jahre alt. Dieser Tag würde sich bei ihr einbrennen, würde eine Gabelung im Leben bedeuten. Weg vom Primelpöttchen-Dasein, ganz langsam hin zu einer selbstbestimmten Frau, auch wenn es noch Jahre dauern würde.
Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie einen toten Menschen gesehen, eine Tragödie miterlebt, die ihr immer wieder die Tränen in die Augen trieb. Sie weinte nicht um Frau Poggenpohl, sie weinte, weil sich Ungewissheit und Unsicherheit ihrer bemächtigten.
»Us Leven ward schon wieter goan!« Herr Poggenpohl, ernster als sonst, lächelte kürzer, wenn er sie anschaute. Auch sprach er bedächtiger, schaute zwischendurch immer wieder aus dem Fenster und hing seinen Gedanken nach. Ihm war schon jetzt klar, dass sich nun auch sein Leben verändern würde. Zum Besseren? »Mog di kiene Sörgen. Wi blevt tusomen. Dat Hus is nich to grot for us tweij« { Mach dir keine Sorgen. Wir bleiben zusammen. Das Haus ist nicht zu groß für uns zwei }, sprach er plötzlich, hob sein Glas und zeigte Else, wie man Kristallkelche vorsichtig anstieß, sie zum Klingen brachte, sich in die Augen schaute und nach dem Zuprosten abwartete, bis der Ältere mit seinem Trinkspruch fertig war. »Pack man diene Backbeern und slöp in Moders Tüch-Stuv« { Pack man deine Sachen und schlaf in Mutters Wäschezimmer } lautete sein Vorschlag. Also Umzug vom Boden in die Wohnung im Erdgeschoss. Das sogenannte Wäschezimmer hieß nur so, war aber in Wirklichkeit Berta Poggenpohls Kleine Kneipe und Lesezimmer für Schundromane, die sie vor ihrem Mann versteckte. Da stand eine Chaiselongue, auf der Else prima schlafen würde, und es gab einen Tisch, an dem sie lernen konnte. Der Wäscheschrank würde ihr Kleiderschrank werden. Das Beste an diesem Vorschlag ließ Steine vom Herzen fallen: Sie musste nicht mehr auf den Boden, nicht mehr über die steile Treppe, nicht mehr vorbei an der Stelle, wo Berta Poggenpohls verdrehter Hals die Augen zum Erlöschen gebracht hatte. All diese Neuigkeiten wanderten durch ihren Kopf, während sie gebannt in das gefasste Gesicht ihres Gegenübers blickte. Der Altbauer schien bereits alles durchdacht zu haben. »Morgen bruckst du nich nach School hängoan. Ek pinsel di een Entschuldigungsschrieven. Dese Weeke möt wi good tusomen holten! Da kummt wat up us to. Oaber dat Leven mut jo wieter goan!« {Morgen brauchst du nicht zur Schule gehen. Ich pinsele dir ein Entschuldigungsschreiben. Diese Woche müssen wir gut zusammenhalten! Da kommt was auf uns zu. Aber das Leben muss ja weitergehen! }
Am nächsten Morgen brachte Else schon vor Beginn der ersten Stunde die Entschuldigung ins Schulbüro. In den nächsten vier Tagen wurde sie die »lüttje Fru« { kleine Frau } an der Seite von Heinrich Poggenpohl. Der konnte Beistand gebrauchen. Zum zweiten Frühstück am Tag nach Bertas Tod erschien Gernot, das einzige Kind der Poggenpohls und somit der Hoferbe. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war schon lange angespannt und verbesserte sich durch die Todesnachricht keineswegs. Im Gegenteil. Else hatte im Esszimmer den Tisch für die beiden Männer gedeckt und brachte nur noch den frisch aufgegossenen Tee herein. Das Gespräch verstummte kurz, dann, als Else die Tür hinter sich schloss, polterte Gernot weiter: »Ich bin mitten in der Ernte. Da können wir uns nicht mit einer Beerdigung belasten. Warum suchst du ihr nicht eine Grabstelle in der Stadt? Mudder war doch viel lieber hier als im Dorf!«
»Verdammie nomol – Moder is in Bullenstedt op de Weld kummen un dor weid se ok begroben. Basta!« { Verdammt nochmal - Mutter ist in Bullenstedt zur Welt gekommen und da wird sie auch begraben. Basta! }
Auch beim Thema Leibrente kamen Vater und Sohn sich nicht näher. Den Vorschlag, nun wenigstens die Zahlungen zu kürzen, lehnte Vater Poggenpohl ohne jegliches Entgegenkommen ab. »Nu is sei man noch keenen Dag dod un du wullst mit mie over Finanzen spekoleern? Schäm di wat!« { Nun ist sie noch keinen Tag tot und du willst mit mir über Finanzen spekulieren? Schäm dich! }
Der einzige gemeinsame Nenner von Vater und Sohn waren zwei dicke Zigarren und für jeden ein doppelter Cognac zum Tee. Ansonsten blieben sie sich fremd.
Wenig später düste der mürrische Jungbauer mit seinem Hansa Typ C aus regionaler Produktion davon, in Gedanken mit dem Problem belastet, wie er seiner noch mürrischeren Frau die Sonderbelastung der Beerdigungszeremonie erklären sollte. Sein Vater hatte den üblichen Kaffeeumtrunk nach dem Kirchgang auf der Diele befohlen. So, wie es Sitte war und sich gehörte. Mindestens achtzig Trauernde oder zur Trauer Verpflichtete würden kommen. Kaffee, Butterkuchen und belegte Brote waren der Standard, Korn und Likör ebenfalls. Und das alles während der Ernte!
***
Der »Republikflüchtling« Jukelnack, der sich schon kurz vor der Gründung jener geplanten Deutschen Demokratischen Republik aus dem Staub gemacht hatte und damit den Aufbau des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden konterkarierte, nutzte wie viele die Wirren der Nachkriegszeit. Verschleierung war an der Tagesordnung. Braunste Nazis färbten sich hellbraun, bekamen eine weiße Weste übergehängt und bemächtigten sich wieder der Schaltstellen des Staatsapparates. Sich entnazifizieren zu lassen war Volkssport geworden. Anders erging es da einem einzelnen, aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassenen Mann.
In der kurz vor der Entstehung befindlichen Bundesrepublik Deutschland wollte man möglichst keine Nazis dabeihaben. Wenn überhaupt, dann auf dem Papier geläuterte. Aber das rote Gesindel, Alt- oder Jungkommunisten, sollte auf keinen Fall mitmischen. Da waren die Vorgaben der westlichen Alliierten eindeutig. Entsprechend vorsichtig ging man zu Werke. Zum Beispiel im Schulamt. »Warum hat man Sie aus der Gefangenschaft entlassen?« Jukelnack musste improvisieren. Die Wahrheit sagen? Wahrheit ist zwar ein kostbares Gut, wird aber häufig unter Wert gehandelt. Modifizierte Wahrheiten werden schon eher honoriert, zumal, wenn die Modifikationen den tagesaktuellen Bedürfnissen entsprechen.
So tischte Karl-Friedrich Jukelnack eine perfekte Verwechslungskomödie auf. Er sei im Lager angesprochen worden, ob er Karl Jukelnack sei. Also sein Vater. Dieser würde in Ostberlin gebraucht, stünde auf den konspirativen Mitgliederlisten der später verbotenen KPD und wäre ein hochangesehener Genosse. Daher sei er zum Schein darauf eingegangen und dann quasi Erster Klasse nach Ostberlin gebracht worden. Von dort sei er umgehend geflüchtet, weil er nun mal kein Roter sei.
Ein daraufhin angeordnetes Interview mit einem mittelmäßig Deutsch sprechenden englischen Offizier ergab für jenen ein klares Bild: Jukelnack habe keinerlei Qualitäten, schon gar nicht als Spion. Er sei ein charakterschwacher Dummkopf, den man besser auch nicht auf Schulkinder loslassen sollte.
Immerhin sei er politisch unverdächtig und damit für deutsche Stellen zur weiteren Verwendung freigegeben.
Der so Beschriebene, hätte er denn Kenntnis davon gehabt, würde sich über diese Beschreibung nicht beschwert haben. So verwunderte es nicht, dass der Lehrkörper der Graf-Luckner-Schule jetzt um einen ehemaligen Kollegen erweitert wurde. Jukelnack war wieder in Amt und würdig, Kindern Bildung einzutrichtern. Daher konnte er wie gewohnt einen Gang runterschalten.