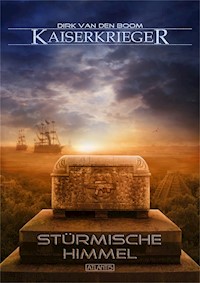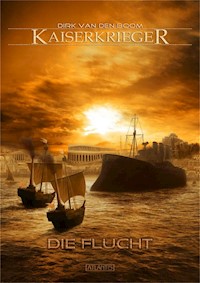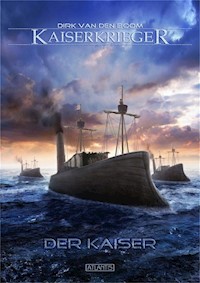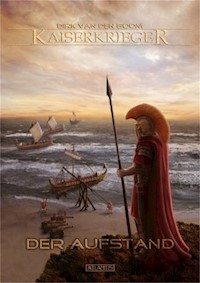
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Zeitenwanderer aus der Zukunft haben kaum im Römischen Imperium Fuß gefasst, da wird auch bereits deutlich, dass ihre Gegner ihre Kräfte gesammelt haben und zum Gegenschlag ausholen. Truppen stehen bereit, Feldzüge werden geplant und Attentate vorbereitet - der Sturm, der sich zusammenbraut, droht, das Reich in seinen Grundfesten zu erschüttern. Alles, was die Zeitreisenden positiv verändern wollten, ist in großer Gefahr. Der umfassende Aufstand gegen alles, wofür Rheinberg und seine Getreuen sich eingesetzt haben, steht unmittelbar bevor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Personenverzeichnis
Weitere Atlantis-Titel
1
»Das ist also der Vorschlag, Herr Marineoberingenieur?«
Es war eigentlich unüblich, dass Rheinberg im engsten Führungskreis die Dienstgrade betonte, aber der leicht ungläubige Unterton, untermalt durch ein belustigtes Kopfschütteln, nahm sogleich die Strenge aus der Anrede. Dahms grinste Rheinberg an. Sie saßen in der engen Messe an Bord der Saarbrücken. Der Kleine Kreuzer war am eigens für das Schiff erbauten Pier der »deutschen Stadt« festgemacht, einer Ansiedlung, die sich mittlerweile zu einem veritablen Stadtviertel Ravennas entwickelt hatte.
Dahms malte mit dem Finger Kreise in die kleine Weinlache, die der ungeschickte Langenhagen verursacht hatte. Der Erste Offizier der Saarbrücken blickte den Ingenieur ebenfalls etwas irritiert an, bemerkte jedoch wie alle anderen den Schalk in den Augen des Mannes. War der Vorschlag also gar nicht ernst gemeint?
»Oh ja, Herr Kapitän«, zahlte Dahms mit gleicher Münze zurück und sein Grinsen wurde breiter. »Das ist der Vorschlag.«
»Ich wünschte, Köhler wäre hier«, murmelte Langenhagen. Der Hauptbootsmann hätte seinem Unwillen über die Idee des Ingenieurs mit durchaus treffenden Worten Luft gemacht.
»Ich fasse das mal so zusammen, wie ich es verstanden habe«, meinte Rheinberg nun betont langsam und hob dozierend einen Zeigefinger. »Sie haben die Absicht, einen reichsweiten Scheiße-Sammeldienst einzurichten!«
Dahms Gesicht wurde ernst. »Genau so ist es. Eigentlich geht es mir weniger um die Scheiße, mit Verlaub. Mir geht es um den Salpeter.«
»Den Sie aus der Scheiße gewinnen wollen?«
Dahms hob die Schultern. »Wir haben noch keine natürliche Salpeterquelle gefunden. Ich bin mir sicher, dass es eine solche im Reich gibt – vielleicht irgendwo in Kleinasien, jedenfalls gab es da zu unserer Zeit Vorkommen. Aber wir können nicht so lange warten, vor allem nicht in der derzeitigen Situation. Wir müssen von den Dampfkatapulten weg und richtige Kanonen bauen, und dazu benötigen wir Schwarzpulver. Was wir bisher haben sammeln können, reicht für den experimentellen Teil unserer Arbeit aus. Aber wenn wir in eine breite Produktion einsteigen wollen, genügt dies nicht. Wir benötigen Salpeter, und viel davon. Die beste Quelle ist Kuhscheiße. Wenn diese lagert, bilden sich Salpeterkristalle an der Unterseite des Dungs. Die brauchen wir. Ich will den Mist selbst gar nicht haben. Was ich möchte, ist eine Organisation von Leuten, die von uns geschult alle Latifundien und Höfe abklappern und mit geeignetem Werkzeug …«
»… die Scheiße durchwühlen«, vervollständigte Langenhagen den Satz. »Der Imperiale Scheiße-Sammeldienst.«
Dahms nickte. »Exakt. Das ist kurzfristig die beste Quelle für einen substanziellen Salpetervorrat – zumindest, bis wir ein natürliches Vorkommen gefunden haben. Ich hoffe, dass dies bald der Fall sein wird. Aber bis dahin …«
Rheinberg sah Dahms noch einen kurzen Moment zweifelnd an, doch dann senkte er resignierend den Kopf. »Also gut«, sagte er leise. »Ich werde deine Bitte an den Kaiser herantragen. Er wird … irritiert sein.«
»Wir tun seit unserer Ankunft viele Dinge, die irritierend wirken«, meinte Langenhagen trocken.
»Ich kann dir nicht widersprechen«, meinte Rheinberg und griff nach seinem Weinglas, ohne es zum Mund zu führen. »Gratian ist so einiges von uns gewöhnt. Das wird ihn sicher nicht allzu lange außer Fassung bringen, auch, wenn es … sehr speziell ist.«
»Ich bin für das Spezielle zuständig«, erinnerte Dahms seinen Vorgesetzten. »Ich stampfe hier die industrielle Revolution aus dem Boden. Und die basiert im Gebiet der Waffentechnik nun einmal auf einem Haufen Mist.«
Rheinberg runzelte lächelnd die Stirn. »Ich bin mir sicher, dass ich mir für mein Gespräch mit Gratian eine andere Formulierung einfallen lassen muss.«
»Das wird wohl besser sein«, bestätigte Dahms. »Aber um zum Ernst der Lage zurückzukehren: Ich stecke mit der Waffenentwicklung jetzt in einer Sackgasse. Wir sind so weit, kleinere Stücke mit gebohrtem Lauf herzustellen und auch erfolgreich testweise abzufeuern. Wenn das alles aber militärischen Sinn ergeben soll, wird es irgendwann Zeit, eine Artilleriekompanie aufzustellen. Die muss ausgebildet werden, und zwar sehr sorgfältig. Und dazu brauche ich einen Haufen Schwarzpulver. Ehe ich keine verlässliche Quelle für Salpeter habe, stecken wir wirklich fest. Ich habe mich jetzt weiter auf die Verfeinerung der Dampfkatapulte gestürzt, aber wir müssen diese Frage bald klären.«
Dahms lehnte sich zurück.
»Große Salpetervorkommen erwarte ich im Nilschlamm. Ich weiß auch, dass es zu unserer Zeit Vorkommen in Ungarn gegeben hat. Wir benötigen aber noch Zeit, die entsprechende Infrastruktur zur Förderung in Gang zu bekommen. Auch darüber sollten wir mit Gratian sprechen. Aber für den unmittelbaren Bedarf ist die von mir vorgeschlagene Lösung sicher die beste und schnellste.«
»Wie gesagt, ich werde es dem Imperator vortragen. Er ist vorgestern in Ravenna angekommen, wenngleich nur für einen kurzen Besuch. Seitdem er hier ist, ist er leichter zu erreichen. Ich treffe ihn morgen zur Lagebesprechung und dann werde ich es zur Sprache bringen, ehe er wieder gen Trier aufbricht.«
Rheinberg hielt inne und blickte für einen Moment aus einem Bullauge ins Freie. Die Saarbrücken war nicht allein in diesem neu errichteten Militärhafen – auch, wenn dieser zurzeit aus nicht viel mehr als einer langen Pier sowie dem immer noch im Bau befindlichen Trockendock befand. Im Wasser dümpelte auch die Valentinian, das erste Dampfkriegsschiff der römischen Flotte, aus dem nördlichen Ägypten zurückgekehrt, ohne Köhler und Neumann, die Rheinberg beide schmerzlich vermisste.
Dafür aber mit einem unerwarteten Gast.
Es handelte sich um einen Offizier dazu, einen jungen Mann, den engsten Gefolgsmann des verräterischen ehemaligen Ersten Offiziers von Klasewitz, von dem sie seit jener verhängnisvollen Nacht nichts mehr gehört hatten. Bis jetzt.
Rheinberg holte tief Luft. Seine Verletzung machte sich bemerkbar, ein Schmerz, der ihn seit dem misslungenen Attentat auf sein Leben im Sommerpalast des Kaisers im Saarland begleitete. Er fragte sich, wie er es geschafft hatte, so schnell wieder zu genesen. Es musste eine Kombination aus guter Konstitution, einem fähigen Arzt und dem unbedingten Willen zur Heilung gewesen sein. Doch obgleich die Wunde mittlerweile ganz ordentlich verheilt war, spürte er sie; manchmal überraschend, mitunter aber genau dann, wenn er es erwartete. Der Schmerz erinnerte ihn auch daran, dass seine Feinde überall waren und vor nichts zurückschreckten. Es war bisher nicht gelungen, die gescheiterten Attentäter mit einem konkreten Auftraggeber in Verbindung zu bringen. Die Männer waren alle vor Ort gestorben und hatten keinerlei verräterische Hinweise bei sich getragen.
Seit jenem Zwischenfall wachte Rheinberg manchmal nachts plötzlich auf, die schweißnasse Hand um die Pistole geklammert, die er immer bei sich trug. Kleine Bewegungen, plötzliche Geräusche, all das reichte bereits, um ihn aus dem Schlaf zu reißen. Er wollte es sich nicht recht eingestehen, aber die seelische Wunde, die der Attentatsversuch gerissen hatte, war offenbar tiefer und dauerhafter als die körperliche.
Rheinberg hatte es mit der Angst zu tun bekommen.
Er schloss die Augen. Wo hatte er angefangen abzuschweifen? Ah ja, von Klasewitz und sein Helfer, der junge Fähnrich …
»Was machen wir mit Tennberg?«, fragte Langenhagen, als hätte er die Gedanken seines Kapitäns erraten. Dahms entfuhr ein verächtliches Grunzen. Rheinberg wusste, was dem Ingenieur bezüglich des Schicksals Tennbergs vorschwebte. Es hatte etwas mit dem Vormast und einem festen Seil zu tun.
»Wir haben ihn so weit wieder aufgepäppelt«, gab Rheinberg zur Antwort. »Ich habe mir ausbedungen, selbst einmal das Verhör vorzunehmen, jetzt, wo er durch die Kameraden schon eine Weile weichgeklopft worden ist. Heute Nachmittag werde ich ihn besuchen.«
»Ich möchte dabei sein«, knurrte Dahms. »Und wenn er bockt, prügle ich ihm die Seele aus dem Leib.«
Rheinberg lächelte und schüttelte gleichzeitig den Kopf.
»Keine Prügel, zumindest jetzt noch nicht.« Ehe der Ingenieur etwas erwidern konnte, hob Rheinberg die Hand und hieß ihn zu schweigen. »Ich habe einmal einen Fehler begangen, mit einem anderen Fähnrich. Ich habe nicht verstanden, was es für manche bedeutet, diese neue Welt betreten zu haben. Ich bedaure es mittlerweile sehr.«
Dahms schnob erneut. Sein Bedauern für Thomas Volkert schien sich in eng bemessenen Grenzen zu halten.
»Wir können Volkerts Fall nicht mit dem von Tennberg vergleichen«, meinte Langenhagen.
»Beide sind Deserteure«, murmelte Dahms.
»Beide sind Deserteure«, bestätigte der Erste Offizier. »Doch Volkert haben wir mehr oder weniger dazu getrieben und er ist ein junger Kerl, der es aus Liebe getan hat. Tennberg wurde nicht dazu gedrängt und er wurde zum Deserteur, weil er ein gescheiterter Meuterer ist. Und dass wir ihn in Ägypten aufgegabelt haben, zeigt zumindest mir, dass er seinen Verrat nur noch fortsetzt.«
Rheinberg lächelte. Es freute ihn ausgesprochen, dass sein neuer Stellvertreter das Maß an Menschenkenntnis besaß, das er selbst in der Vergangenheit hatte vermissen lassen.
Dahms knurrte wieder etwas, widersprach aber nicht. Rheinberg wusste, dass der Ingenieur Volkert vermisste und dass er im Grunde bereit war, ihm zu verzeihen. Aber weit und breit gab es keine Spur des Fähnrichs und es stand zu vermuten, dass er irgendwo im Reich untergetaucht war. Und nicht zuletzt gab es politische Gründe, die derzeit eine allzu schnelle Amnestie nicht ratsam erscheinen ließen.
»Ich werde Tennberg behutsam behandeln«, erläuterte Rheinberg nun. »Er soll eine Chance bekommen.«
»Er hat keine verdient!«, erwiderte Dahms mit Nachdruck. »Volkert, ja, in Ordnung. Aber Tennberg? Niemals!«
»Ich werde ihn nicht wieder in die Mannschaft aufnehmen«, sagte Rheinberg. »Aber ich gebe ihm Aussicht auf ein ehrenvolles Exil. Wenn ich ihm keine Perspektive gebe, ist der Erfolg dessen, was von Klasewitz ausheckt, seine einzige Chance und wird er nicht freiwillig damit herausrücken.«
»Oh doch. Lassen Sie mich ein paar Stunden mit ihm allein. Oder laden Sie unsere römischen Freunde zum Gespräch. Ich habe gehört, die sind auch nicht zimperlich.«
Das war in der Tat korrekt, wie Rheinberg wusste. Folter war eine übliche und kaum hinterfragte Verhörmethode. Doch der junge Kapitän und Heermeister hielt davon absolut nichts. Für ihn war eine solche Vorgehensweise indiskutabel.
Diese Haltung musste sich in seinem Gesichtsausdruck widergespiegelt haben, denn Dahms ließ es dabei bewenden.
Wieder wanderte sein Blick hinaus auf die Valentinian. Zwei weitere Schiffe des gleichen Typs waren bereits im Bau, und Dahms war Tag und Nacht damit beschäftigt, die beiden benötigten Dampfmaschinen aus Bronze für die Neubauten herzustellen. Eigentlich sollte Rheinberg optimistisch und stolz sein. Sie hatten in sehr kurzer Zeit bemerkenswert viel erreicht. Doch seit dem Auftauchen von Tennberg nagte etwas an ihm, eine dunkle Vorahnung.
Er erhob sich schließlich und sah seine Kameraden an.
»Wir sehen uns morgen Abend wieder«, erklärte er. »Dann wissen wir mehr – über Tennbergs Absichten und über die Chancen, Scheiße aus dem ganzen Reich hierher liefern zu lassen.«
Dahms grinste. »Ich brauche nur die Salpeterkristalle. Scheiße hochheben, Kristalle abkratzen, Scheiße liegen lassen.«
Rheinberg hob die Hände.
»Ersparen Sie mir die Details, Herr Marineoberingenieur!«
2
Tribun Sedacius saß vor dem knisternden Lagerfeuer. Alle waren für die tanzenden Flammen dankbar, denn gegen Abend hatte es sich empfindlich abgekühlt. Erminius, der Anführer der Quaden, hockte dem römischen Offizier gegenüber und war schweigsam. Die Stimmung zwischen Rom und dem Volk der Quaden war nicht gut. Erst vor wenigen Jahren hatte Rom, weitgehend unprovoziert, den König des benachbarten Stammes getötet und damit einen militärischen Konflikt heraufbeschworen, den das Imperium gewonnen hatte. Erminius, Nachfolger des getöteten – des ermordeten – Königs, wusste, dass in seinem Volk ein tiefer und wahrlich nicht unberechtigter Hass gegen die Verräter schlummerte. Er wusste aber auch, dass eine noch viel größere Gefahr von Osten her dräute – und dass diese sehr nah gekommen war, näher noch, als die Römer vermutet hatten.
Dekurio Thomas Volkert, wenngleich ihn niemand unter diesem Namen kannte, saß ebenfalls am Feuer. Sedacius hatte darauf bestanden, obgleich Volkert vom Rang nur wenig mehr als ein einfacher Legionär war. Doch dem Tribun war die wache Intelligenz des jungen Mannes keinesfalls entgangen – und auch nicht die Geschichte, die zur schnellen Beförderung des einstmals unfreiwillig in den Dienst gepressten Soldaten geführt hatte. Damals hatte er eine Kolonne grüner Rekruten bei einem überraschenden Angriff der Sarmaten zu einem Sieg geführt, nachdem die eigentlichen Führungsoffiziere gefallen waren. Volkert dachte nicht so gerne daran zurück. Sein Freund Simodes war in jener Schlacht gefallen. Es war schwer, hier Freundschaften zu schließen.
Erminius schwieg, weil er lange gesprochen hatte. In jedem Detail hatte er die bisherigen Begegnungen seines Volkes mit den Hunnen aufgeführt. Ihre Kampfweise, schnell, von den kleinen, rasanten Pferden aus, der die Quaden wenig entgegenzusetzen hatten. Ihren Mut, ihre Rücksichtslosigkeit, ihre Entschlossenheit, die Fähigkeiten ihrer Anführer, die genau wussten, wie und wo die taktischen Vorteile einer mobilen Reiterarmee richtig zum Einsatz gebracht werden konnten. Dass es die Quaden noch gab, hing damit zusammen, dass der Haupttross der Hunnen relativ weit entfernt war und man bisher nur mit weit vorauseilenden, kleineren Reitertrupps zu tun hatte – sowie jenen Gruppen abtrünniger Hunnen, die sich den aktuellen Anführern dieses Volkes verweigert und auf eigene Faust ihr Glück gesucht hatten.
Aber trotzdem. Als es den Quaden gelungen war, einige Gefangene zu machen, war klar geworden, dass irgendetwas nicht stimmte, zumindest für Thomas Volkert, der eine Version der Geschichte kannte, in der die große Masse der Hunnen erst Jahrzehnte später in die Nähe der Grenzen des Römischen Reiches kam. Dies mündete dann in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern, in der Legende des Flavius Aetius, des letzten großen römischen Feldherrn, der den Untergang Roms abwenden konnte, nur, um dann von seinem eigenen Kaiser ermordet zu werden.
Erminius hatte ihnen glaubhaft berichtet, dass sich die Hauptmacht der Hunnen schon jetzt stetig gen Westen bewegte und weitaus früher die Grenzen des Reiches erreichen würde als gedacht. Wahrscheinlich würde man bereits in wenigen Jahren die Grenzen des Reiches mit ernsthaften Angriffen antesten. Die Quaden hatten keine rechte Vorstellung von der Ausdehnung Osteuropas und es kam Volkert so vor, als würden sie die Geschwindigkeit, mit der die Hunnen zu reisen verstanden, trotz all ihrer Erfahrungen aus erster Hand immer noch unterschätzen.
Dem jungen Deutschen wurde bei den Schilderungen heiß und kalt.
Rheinbergs sorgfältig ausgearbeiteter Plan, dem Angriff der Hunnen gegen Rom durch einen Gegenangriff zuvorzukommen, drohte zusammenzufallen wie ein Kartenhaus. Wenn das, was der Quadenkönig hier in bitterer Offenheit preisgab, der Wahrheit entsprach, war auch die große Erkundungsmission, zu der Volkert gehörte, nur noch begrenzt sinnvoll – die Vorwarnzeit hatte sich rapide verringert, der Feind stand näher, als alle dachten und statt weiter in die Tiefe des Ostens zu kundschaften, war es notwendig, das Reich in einen wehrbereiten Zustand zu versetzen.
Volkert musste bei dem Gedanken unwillkürlich lächeln. Er verbarg die missverständliche Mimik hinter einem hölzernen Becher mit Bier, von dem er schon zu viel getrunken hatte.
Das Imperium befand sich seit Jahrzehnten in diesem Zustand. Allerdings würde das nicht reichen, das hatte die Geschichte bewiesen. Doch vielleicht konnten die Deutschen den Unterschied machen, den Unterschied zwischen dem tragischen Sturz Westroms und dem Überleben als staatliche Einheit. In Volkert drängte sich alles, Sedacius zu bitten, so schnell wie möglich eine Nachricht zurück ins Reich zu schicken. Doch er war nur ein Dekurio. So blieb er schweigsam sitzen und wartete auf seine Gelegenheit.
Der Tribun sagte nichts. Auch er hielt einen hölzernen Becher mit Bier in der Hand, drehte ihn langsam zwischen seinen Fingern und betrachtete den Widerschein des prasselnden Feuers in der trüben Flüssigkeit. Er hatte sich als guter Diplomat erwiesen, und er trank das Bier, obwohl jeder wusste, dass er Wein vorzog. Doch Erminius zu beleidigen und dessen Gastfreundschaft auch nur ansatzweise infrage zu stellen, das kam dem Tribun nicht in den Sinn.
Eine Fähigkeit, für die Volkert durchaus dankbar war. Die Quaden waren hier, tief in ihrem Gebiet, in der Überzahl und die römische Kolonne sehr verwundbar, trotz der Anwesenheit deutscher Infanteristen. Volkert musste immer wieder das Gefühl abschütteln, aus der Dunkelheit beobachtet zu werden. Er fühlte sich unwohl, seit sie das große Lager des Erminius betreten hatten, doch war ihm trotz aller Aufmerksamkeit nichts aufgefallen. Es waren auch nicht die Quaden, gegen die sich sein intuitives Misstrauen richtete. Diese waren zurückhaltend, trotzig, mürrisch, aber gerade deswegen wirkten sie ehrlich, und die Motivation ihrer Kooperationsbereitschaft wirkte glaubhaft.
Da war etwas anderes.
Volkert verbarg sein Gesicht wieder im Becher. Immerhin, das Gesöff war einigermaßen genießbar.
»Was habt Ihr Römer also vor?«, stellte der Quadenkönig die alles entscheidende Frage.
Sedacius zögerte sichtlich. Er war nur Tribun und konnte schwerlich die Entscheidungen des Imperators vorwegnehmen. Dennoch musste er eine Antwort finden, denn der gute Wille des Erminius bedurfte einer angemessenen Reaktion, wenn man nicht wieder die Schrecken der Vergangenheit heraufbeschwören wollte. Dem Vorgänger des Erminius hatte sein guter Wille das Leben gekostet. Sedacius verfluchte die Verantwortlichen. Als ob sie nicht bereits genug Probleme hätten.
»Ich kann nicht sagen, was mein Herr entscheiden wird. Dennoch wurden wir ausgesandt, um die Gefahr durch die Hunnen zu erkunden und ihre genaue Verbreitung herauszufinden. Eure Hilfe kommt uns dabei sehr gelegen. Rom wird sich gegen den Ansturm der Gegner wappnen.«
»Was ist mit uns?«, entgegnete Erminius. Volkert wusste sofort, worauf der Quade hinauswollte. Rom mochte sich wappnen – und wo in diesem Spiel war Platz für sein eigenes Volk?
»Ich bin mir sicher, dass sich eine Lösung finden lässt. Vielleicht der Foederatenstatus und eine gemeinsame Verteidigung hier an der Grenze? Ich zweifle weniger an der Möglichkeit eines solchen Angebotes von unserer Seite als vielmehr an Eurer Bereitschaft, es anzunehmen.«
Erminius verzog sein Gesicht zu einem freudlosen Lächeln.
»Als ob wir eine große Wahl hätten, Tribun.«
»Unser guter Wille ist vorhanden.«
»Diesmal wirklich?«
Sedacius hob die Arme. »Ich kann nur das sagen, was ich denke und fühle. Ich bin ein kleiner Tribun.«
Erminius nickte und versank wieder für ein paar Momente in ein grüblerisches Schweigen. Dann nickte er abermals, heftiger und ergriff das Wort.
»Beweist Euren guten Willen, Tribun – und erhascht eine Möglichkeit, noch mehr über unsere gemeinsamen Feinde zu erfahren.«
»Wie das?«
Erminius gestikulierte in die Dunkelheit.
»Unweit von hier, keine 50 römischen Meilen, gibt es ein größeres Reiterlager der Hunnen. Wir beobachten es schon eine Weile. Es scheint, als würde man auf Verstärkung warten. Wir möchten nicht herausfinden, was passiert, wenn diese eintrifft.«
»Keine 50 Meilen?«
»In Richtung des Sonnenaufgangs.«
»Wie viele?«
Erminius schürzte die Lippen. »2000, eher 2500. Alle zu Pferde.«
»Ich habe kaum 1000 Mann zur Verfügung«, gab der Tribun zu bedenken.
»Ich biete 4000 oder 5000 meiner Männer auf, alles, was übrig geblieben ist, nachdem das Imperium mit uns fertig war.«
Die Bitterkeit in der Stimme des Quaden war unüberhörbar. Sedacius tat nicht so, als würde er es nicht bemerken, und nickte mit gefasstem Gesichtsausdruck. Volkert beobachtete den Tribun aufmerksam. Er lernte.
»Also 6000 Mann, wenn es gut geht.« Unausgesprochen blieb, dass die römischen Soldaten eine ganz besondere Verstärkung hatten, die dem Erfolg eines Angriffes durchaus zuträglich sein konnte.
»Der Häuptling der Hunnen soll ein Mann namens Octar sein. Es wird gesagt, er stehe dem derzeitigen Stammesführer sehr nahe, sei einer seiner engsten Berater und Kommandeure. Selbst, wenn wir seiner nicht habhaft werden können, dürften ein paar gefangene Unterführer uns bereits weiterhelfen.« Erminius hatte mit diesem Filetstück bis zuletzt gewartet. Volkert erkannte, dass Sedacius mehr und mehr geneigt war, den Vorschlag des Quaden ernsthaft zu erwägen.
»Woher kennt Ihr Name und Stellung des Octar?«, rutschte es aus Volkert heraus. Sedacius drehte sich zur Seite, warf dem Dekurio einen halb tadelnden, halb anerkennenden Blick zu. Erminius schien es nichts auszumachen, dass jemand anderes als der Tribun die Frage gestellt hatte. Für ihn saßen sie alle am gleichen Feuer.
»Unser Freund hier sprach davon«, sagte er leichthin und wies auf den abgeschlagenen Kopf des Hunnen, der auf einem Holzpflock halb rechts hinter ihm stand und auf dessen leerem Gesicht sich die Flammen widerspiegelten.
»Ich möchte selbst mit Euren Kundschaftern reden«, verlangte Sedacius.
»Kein Problem. Ihr seid also interessiert, Tribun? So ein Angriff muss bald erfolgen. Wer weiß, wann die Verstärkung erscheint. Dann könnte es für unsere gemeinsame Streitmacht zu viel sein.«
Der Tribun kniff die Augen zusammen. Volkert ahnte, was in seinem Kopf vorging. Und als er die folgende Forderung stellte, wusste der junge Deutsche, dass er richtiggelegen hatte.
Sedacius wollte wissen, wie verzweifelt Erminius wirklich war.
»Ich führe das Kommando über den Angriff«, sprach der Tribun seine Forderung aus.
Volkert beobachtete den Quadenkönig genau. In dem Mann tobte ein Widerstreit der Gefühle, das war gut zu erkennen. Stolz, Verzweiflung, aber auch Angst und Unsicherheit … und dann, noch bevor er den Mund öffnete, sah Volkert, dass Erminius sich zu einer Entscheidung durchgerungen hatte.
»Ich selbst habe andere Aufgaben zu erledigen«, sagte der Anführer der Quaden langsam. »Mein älterer Sohn wird das Kommando über unsere Krieger übernehmen. Er ist mit römischen Gebräuchen durchaus vertraut, diente er doch fünf Jahre in den Grenztruppen bis …«
»… bis wir Euch verraten und Euren König ermordet haben«, meinte Sedacius mit ruhiger Stimme. »Dann ist Euer Sohn desertiert und hat gegen unsere Truppen gekämpft.«
Erminius lächelte. »Ihr führt das Kommando. Luvico, mein Sohn, wird darüber nicht begeistert sein, aber er wird Eure Befehle verstehen.«
Der Quadenkönig winkte in die Dunkelheit. »Bringt Luvico und die Kundschafter.«
Er sah Sedacius forschend an. »Wir beginnen sogleich?«
Der Tribun hob seinen Becher. »Nicht, wenn Ihr davon noch etwas habt!«
Erminius grinste.
3
Adulis, so fand Oberbootsmann Köhler, war eine Reise wert. Obgleich ihr Fortkommen nicht unbeschwerlich gewesen war, hatte sich die lange Fahrt trotz ihrer Erlebnisse in Alexandria als weitgehend ereignislos erwiesen. Köhler war darüber nicht traurig. Alexandria hatte ihnen nur allzu eindringlich vor Augen geführt, welche Mächte auch im Verborgenen gegen sie gerichtet waren. Noch wusste niemand, wie gut ihre Gegner tatsächlich organisiert waren – oder wer eigentlich genau dazugehörte. Dass der abtrünnige Offizier von Klasewitz nach seiner gescheiterten Meuterei ihr erbitterter Feind geworden war, gehörte nicht zu den großen Überraschungen. Aber wie tief der Widerstand gegen den Einfluss der Zeitreisenden tatsächlich in der imperialen Machthierarchie verwurzelt war, konnte man letztlich nur erahnen.
Hier, außerhalb des unmittelbaren römischen Herrschaftsbereichs, stellte sich die Situation etwas anders dar – möglicherweise einfacher, vielleicht aber auch komplizierter. Adulis war das ökonomische Zentrum des Reiches Aksum, des Vorgängerstaates dessen, was Köhler aus seiner Zeit als das Kaiserreich Äthiopien kannte, zu dem das Deutsche Reich durchaus freundschaftliche diplomatische Beziehungen pflegte. Neben der Hauptstadt Aksum selbst war Adulis zudem das zweite große urbane Zentrum des nordafrikanischen Reiches, das sich, wenn Köhler sich an die historischen Lektionen Rheinbergs richtig erinnerte, kurz vor dem Erreichen seines Zenits befand. Seine Sonderstellung als christliches Reich eigener Prägung war dabei noch gar nicht von so zentraler Bedeutung. Das römische Nordafrika war zu dieser Zeit ebenfalls weitgehend christianisiert. Den Islam als große, konkurrierende Weltreligion gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Der Hafen von Adulis war natürlich bei Weitem nicht so groß wie der von Alexandria. Doch der Küstensegler, den sie im römischen Clysma nach der Flussfahrt von Alexandria bestiegen hatten, musste sich seine Anlegestelle relativ mühsam suchen. Von hier wurde fast der gesamte Handel Aksums, hinein und heraus, abgewickelt. Die langen Kaimauern waren aufgrund der zahlreichen Schiffe kaum auszumachen. Es herrschte reges Treiben im Hafenbecken und der Lärm eines stark frequentierten Umschlagplatzes war schon in der Einfahrt deutlich vernehmbar. Ihr Kapitän, ein graubärtiger Seemann mit langjähriger Erfahrung, kannte nach eigenem Bekunden Adulis gut, sodass Köhler damit zufrieden war, ihm die nautischen Details gänzlich zu überlassen.
»Beeindruckend, oder?« Unbemerkt waren Behrens und Africanus neben ihn getreten. »Hier gibt es eine ganz neue Welt zu entdecken«, meinte der Infanterist. »Wie es wohl noch weiter im Osten aussieht? Oder im Süden? Wir machen uns von unserer Welt zu dieser Zeit noch gar keine rechte Vorstellung.«
»Es gibt noch viel zu erforschen«, stimmte Köhler ihm zu. »Und wir stecken ja offenbar gerade mittendrin. Africanus, wie sieht unser nächster Schritt aus?«
Der Trierarch hielt eine Pergamentrolle in den Händen. »Dies ist das Geleitschreiben des Statthalters von Ägypten. Mit dem werden wir uns bei Josephus Diderius Latius melden. Er ist so etwas Ähnliches wie der ständige Gesandte Roms in Adulis. Seine Hauptaufgabe gilt zwar eher dem Handel, weniger der Politik, aber er kennt sich aus und wird uns den Kontakt zur aksumitischen Regierung vermitteln können. Außerdem kann er uns helfen, den schnellsten Weg nach Aksum selbst zu finden.«
»Wo residiert dieser Latius genau?«
»Unser Kapitän meint, er wisse es und werde uns durch einen seiner Männer hinführen lassen. Der Gesandte soll ein Stadthaus ganz in der Nähe des Hafens bewohnen.«
»Unsere eigene Unterkunft?«
»Ich hoffe, dass Latius uns beherbergen wird. Ansonsten kann uns der Kapitän sicher eine Unterkunft vermitteln, die nicht zu gefährlich ist.«
»Wir werden schon zurechtkommen.«
Africanus sah Köhler etwas erstaunt an, erwiderte aber nichts. Der Trierarch fand, dass sich die Zeitenwanderer verblüffend gut eingelebt hatten und vor allem Köhler schien so leicht nichts aus der Ruhe bringen zu können. Der römische Seemann vermutete sogar, dass der Germane in alledem ein spannendes Abenteuer erblickte, das er bis zur Neige auskosten wollte. Wahrscheinlich eine bessere Art und Weise, mit dem Schicksal umzugehen, als tagtäglich an verlorene Familienmitglieder oder Freunde zu denken, die für immer im Strom der Zeit verschollen blieben. Da Köhler es bei all seinem Enthusiasmus aber keinesfalls an der notwendigen Vorsicht und Sorgfalt mangeln ließ, konnte Africanus an dieser Einstellung kein Übel finden. Tatsächlich war er selbst auf Aksum sehr gespannt, denn auch für ihn war dies der erste Besuch in diesem Reich. Bisher hatte er sich trotz all seiner See-Erfahrung nur auf dem Mare Nostrum aufgehalten. Er betrat also hier im wahrsten Sinne des Wortes Neuland.
Es dauerte eine weitere Stunde, bis der Küstensegler festgemacht hatte. Der Kapitän hielt sein Versprechen und schickte einen seiner Männer, ihnen den Weg zu weisen. Darüber hinaus versprach er, die mitgebrachten Waren bewachen zu lassen. Sein Schiff würde vier Tage hierbleiben, bis dahin musste die Expedition einen sicheren Ort für die Güter haben.
Sie hatten in Clysma einiges an Gold ausgegeben, um wertvolle römische Produkte zu erstehen, die sie gleichzeitig gut transportieren konnten. Darunter waren vor allem edle Stoffe, aber auch exquisiter Wein sowie einiges an Kunsthandwerk, von dem man wusste, dass es bei reichen Aksumiten zum guten Ton gehörte, derlei Exotisches in die eigenen Stadtvillen zu stellen. Alles in allem waren die Waren weniger dazu gedacht, ihren Lebensunterhalt in Aksum zu bestreiten – römische Münze wurde hier gerne gesehen und problemlos gegen die lokale Währung getauscht –, sondern vielmehr, um dem König in Aksum geeignete Geschenke machen zu können.
Schließlich wollte man etwas von ihm.
Köhler, Behrens und Africanus bildeten die Delegation, die unter Führung eines bulligen Seemannes schließlich den Kai betrat und in das Gewimmel von Adulis eintauchte. Es war heiß und die Sonne brannte von einem fast völlig wolkenlosen Himmel. Die wirbelnde Menschenmenge, der Lärm und die raschen Bewegungen ihres Führers, der sich offenbar bestens in der Stadt auskannte, führten schnell dazu, dass den drei Männern der Schweiß nicht nur auf der Stirn stand und die Tücher, mit denen sie sich in weiser Voraussicht bewaffnet hatten, völlig durchnässt waren.
Obgleich das Anwesen des römischen Gesandten »in der Nähe des Hafens« liegen sollte, waren sie gut eine halbe Stunde unterwegs. Der frühe Nachmittag war angebrochen, und da die drei Männer in ihrem Bestreben, Latius so schnell wie möglich aufzusuchen, ohne einen Imbiss aufgebrochen waren, verspürten sie neben Durst auch noch einen bohrenden Hunger. Doch sie waren voller Zuversicht, die Gastfreundschaft des Latius genießen zu dürfen, und die Aussicht auf gekühlten Wein und eine Mahlzeit beflügelte ihre Schritte nur noch mehr.
Bald waren sie in eine Seitengasse eingebogen. Hier ließ auch das Menschengewimmel nach und die hohen, weißen Mauern spendeten erholsamen Schatten. Sie waren in einem Viertel der Stadt angekommen, in dem offensichtlich wohlhabendere Bürger lebten. In manchen der Vorhöfe erblickten die Reisenden ein paar der gigantischen Stelen, wie die Aksumiten sie zu errichten pflegten, übersät mit Inschriften. Es schien, dass sie die gleiche Leidenschaft für beeindruckende Denkmäler wie die Römer besaßen. Und wie die Deutschen, dachte Köhler bei sich. Manche Dinge währten einfach ewig.
Dann blieb ihrer Führer so abrupt stehen, dass die drei Männer fast in ihn hineingerannt wären. Sie verharrten vor einer weißen Mauer. Die breite Holztür darin stand offen. In einem der beiden Türflügel war ein stolzes »SPQR« kunstvoll hineingeschnitzt worden. Dass dies das Haus des Latius war, daran konnte kein Zweifel bestehen.
»Die Tür ist offen. Das ist nicht normal«, meinte Africanus. Er sah ihren Führer an.
»Ist das üblich?«
Der Seemann zuckte mit den Achseln, wies auf die Tür.
»Ich sollte Euch nur hierher bringen. Alles andere ist nicht meine Sache. Ich habe meine Arbeit getan.«
Er erhob die Hand zum Gruße, wandte sich ohne einen weiteren Kommentar ab und verschwand, seiner Aufgabe entledigt. Was auch immer hier Seltsames vorging, er wollte offenbar nichts damit zu tun haben.
Africanus, Köhler und Behrens sahen sich an.
In ihren Augen stand Misstrauen.
Die Zeitreisenden zogen die Pistolen, die sie bei sich führten. Sie waren für den zufälligen Beobachter nicht als Waffen erkennbar, daher würden sie nicht sofort als Bedrohung gelten, sollte sich die offen stehende Tür nur als Zufall erweisen.
Köhler nickte Behrens zu. Das war sein Gebiet.
Der Wachtmeister stieß die Tür vorsichtig mit der Zehenspitze auf. Sie schwang, ohne zu quietschen, in den Angeln und gab den Blick auf einen Vorhof im römischen Stil frei. Latius hatte sich ein kleines Stück Zuhause in Adulis errichten lassen.
Behrens trat vor, sicherte, seine Blicke wanderten wachsam umher. Nichts rührte sich. Africanus und Köhler folgten ihm auf sein Zeichen.
Eine sanfte Brise wehte von der Seeseite auf den Hof und verschaffte ihnen Kühlung.
Langsam, sich wiederholt umblickend, drangen sie weiter vor, betraten das säulengeschmückte Haupthaus mit den bemalten Wänden und den Mosaikböden, kunstvolle Architektur, die von Reichtum und Geschmack zeugte.
Kein Bediensteter stellte sich ihnen entgegen und fragte nach ihrem Begehr.
Das Haus war wie ausgestorben. Die einzigen Laute drangen von der Straße her zu ihnen vor. Hier jedoch regte sich nichts.
Sie betraten das Atrium und dort erblickten sie Latius, wie er ihnen freundlich entgegenlächelte. Ein stattlicher Mann, die Toga wie ein Senator um den Körper geschwungen, mit einer großen, ausladenden Nase, Lachfalten um die Augen und im römischen Stil kurz geschorenen Haaren. Er hatte die Hand zum Gruß erhoben, ganz das Sinnbild des Römers, der hier der Herr im Hause war.
Und sich daher eine lebensgroße Statue seiner selbst in das Atrium gestellt hatte, sorgsam beschriftet mit Namen und Rang.
Es half ihnen, die geköpfte Leiche, die direkt davor in ihrem Blut lag, eindeutig zu identifizieren. Der Kopf war etwas weiter gerollt, lag unter einem Liegesessel, der Gesichtsausdruck wenig freundlich, eher Ausdruck der Qual und des Entsetzens, das Latius im Augenblick seines Todes empfunden haben musste.
Africanus betrachtete die Leiche mit fachmännischem Blick.
»Ein sauberer, gut geführter Schlag. Dieser Mann hier war kein Krieger. Er war seinem Gegner wehrlos ausgeliefert.«
»Wo sind die Bediensteten?«, fragte Köhler. »Latius wird Sklaven besessen haben.«
Africanus blickte sich um, hielt einen Moment inne, legte lauschend den Kopf zur Neige. »Ich höre etwas.«
In der Tat, Fußschritte näherten sich, eilig. Gleich mehrere Männer. Schwere Schritte.
Dann stürzte ein halbes Dutzend aksumitischer Soldaten, bewaffnet mit Schild und Speer, in das Atrium, angeführt von zwei Männern, die als Sklaven zu erkennen waren; die beiden schienen aufgeregt, ja aufgelöst.
Für einen Moment starrten sich beide Gruppen schweigend an.
Dann fielen die Blicke aller auf die geköpfte Leiche des römischen Gesandten.
Einer der Sklaven hob zitternd den rechten Arm, sein Mund versuchte verzweifelt, die Worte zu formen, die Köhler bereits erahnte. Als sich der Zeigefinger auf die drei Besucher richtete und der zitternde Mann etwas in einer fremden Sprache hervorbrachte, konnte am Inhalt der Botschaft kein Zweifel bestehen.
Die Soldaten hoben die Speere.
4
Petronius betrat die leere Kirche und hielt einen Moment inne. Ein unbeteiligter Beobachter hätte meinen können, der Priester verharre in stiller Andacht, doch stattdessen schaute sich der Mann unmerklich um. Der große Raum war leer, an den Wänden flackerten Öllampen; es wurde bereits Abend in Ravenna und durch die hohen, schmalen Seitenfenster fiel nicht mehr besonders viel Licht. Schließlich heftete sich der Blick des Kirchenmannes auf die zusammengesunkene Gestalt, die, scheinbar im Gebet verharrend, vor dem Altar hockte. Petronius wusste, dass diese Person auf ihn wartete, war er doch durch einen Boten erst heute Morgen auf die baldige Ankunft dieser wichtigen Persönlichkeit hingewiesen worden.
Rasch eilte Petronius nach vorne. Er dachte gar nicht darüber nach, warum nach ihm geschickt worden war und nicht nach seinem Herrn, dem Bischof. Er ahnte, wer da nach ihm verlangte, und es war nur logisch, dass der greise und unzuverlässige Bischof nicht in dieses Gespräch eingebunden wurde.
Als er die Gestalt erreicht hatte, erhob sich diese geräuschlos und schlug die Kapuze ihres Gewandes zurück. Petronius war nicht einen Moment verwundert, als er das Gesicht des Mannes sogleich erkannte, ja, so etwas wie ein Gefühl freudiger Erwartung erfüllte ihn.
Er senkte respektvoll den Kopf. Es war immer gut, Ambrosius, dem Bischof von Mailand, die notwendige Ehrerbietung zuteilwerden zu lassen. Schließlich konnte ihm ein gutes Verhältnis zu diesem Mann in seinem eigenen Bestreben, Bischof von Ravenna zu werden, sobald sein greiser Herr das Zeitliche gesegnet hatte, nur behilflich sein.
»Mein Bruder«, sagte der Bischof leise und ein sanftes Lächeln begrüßte Petronius. Dieser neigte den Kopf und ließ sich segnen. Dann hockte er sich neben Ambrosius und schaute auf die flackernde Talgkerze, die vor ihnen stand. Er sagte nichts. Der Bischof hatte ihn gerufen und er würde sprechen, wenn er es für richtig hielt.
»Wie geht es Liberius?«, erkundigte sich der Bischof von Mailand schließlich nach seinem Amtsbruder aus Ravenna. Petronius horchte auf. Die Frage war nur scheinbar von harmloser Natur.
»Meinem Herrn geht es recht gut, soweit man es in seinem hohen Alter erwarten kann«, erwiderte er schließlich. »Ich habe noch heute Morgen mit ihm gesprochen und eine Andacht abgehalten. Er wirkte … müde.«
»Die Zeiten machen einen müde«, erwiderte Ambrosius, seine schief zueinander stehenden Augen wieder auf den Priester gerichtet. »Und für einen alten Mann wie Liberius ist all dies sicher besonders anstrengend.«
»Er trägt die Bürde tapfer.«
»Du hilfst, sie zu tragen. Ohne deinen Beistand könnte Liberius sein Amt nicht ausfüllen, das sagt jeder.«
»Ich diene dort, wo Gott mich hinbefohlen hat. Diene ich gut, erfreut es mich besonders.«
»Du dienst sehr gut«, bestätigte Ambrosius. »Tatsächlich vermute ich, dass deine Dienste dich dereinst befähigen werden, selbst das höchste Amt in Ravenna auszuüben.«
»An derlei denke ich nicht«, wehrte Petronius bescheiden ab. Beide Männer wussten, dass es eine Lüge war, und beide ließen es dabei bewenden.
»Ich habe Freunde in Ravenna«, erklärte Ambrosius nun.
»Ihr habt überall Freunde«, schmeichelte sein Gegenüber.
»Nicht überall. Derzeit bin ich am kaiserlichen Hofe weniger gut gelitten.«
»Ein sehr bedauerlicher Umstand.«
»In der Tat.«
»Es gilt, dies zu ändern.«
»So ist es.«
Für einen Moment sagte Ambrosius gar nichts und blickte nur auf das träge flackernde Kerzenlicht.
»Sagt, Petronius, was haben wir aus dem gescheiterten Versuch, das metallene Schiff der Dämonenbeschwörer zu entern, gelernt?«
Petronius hatte eine spontane Antwort auf der Zunge, etwas aus dem Gleichgewicht gebracht durch die plötzliche Frage, die doch den Finger auf die noch immer schmerzhafte Wunde seines kürzlichen Scheiterns legte. Doch dann schluckte er die Antwort wieder herunter und überlegte lieber. Der Bischof würde ihn dies nicht fragen, um ihm Schuld zuzuweisen. Der Sinn hinter dieser Frage ging weiter. Es galt, sie auf die richtige Art und Weise zu beantworten.
»Wir dürfen sie nicht unterschätzen«, begann er vorsichtig.
Ambrosius neigte den Kopf. Er sagte nichts.
»Gewalt auszuüben gegen sie hat nur dann Sinn, wenn wir eine Situation geschaffen haben, in der sie klar unterlegen sind«, wärmte sich Petronius an dem Gedanken. Seine nächsten Sätze kamen schneller, eifriger, ohne auf eine mögliche Reaktion seines Gesprächspartners zu warten. »Sie müssen fern ihrer Waffen sein oder die Vorteile ihrer Waffen dürfen nicht mehr so schwer wiegen. Eine deutliche Überzahl der unseren und größere Entschlossenheit würden ebenfalls helfen.«
Ambrosius gestattete sich die Andeutung eines Lächelns. »Ihr denkt wie ein Soldat, mein Bruder.« Ehe dieser etwas entgegnen konnte, hob der Bischof die Hand. »Das war keine Kritik. Wir leben in Zeiten, in denen man auch als Mann der Kirche wie ein Soldat denken muss. Wir sind Soldaten Jesu, Petronius. Wir führen einen großen Feldzug, und der Feinde sind viele. Es sind nicht nur jene Zeitenwanderer, sondern auch alle, die diese unterstützen oder zumindest dulden.«
Petronius flüsterte: »Aber dazu gehört auch der Kaiser …«
»Ja, der Kaiser. Was hast du noch daraus gelernt, mein Freund?«
Petronius dachte einen Moment nach. Obgleich der Bischof ihm gesagt hatte, dass nichts Schlechtes an seiner Argumentation sei, ahnte er doch, dass der noch etwas mehr erwartete.
»Wir sollten andere Wege finden als nur die direkte Konfrontation. Wir müssen erst Verbündete finden, Stimmungen beeinflussen, Gerüchte streuen. Wir müssen die Basis, das Fundament, auf dem die Zeitenwanderer stehen, einreißen oder zumindest ins Wanken bringen. Sie müssen auf sich allein gestellt sein, wenn wir erneut angreifen. Niemand darf ihnen beispringen. Und sind sie geschlagen, soll keiner an Rache oder Vergeltung denken.«
Petronius sah dem Bischof in die Augen und las darin Anerkennung.
Er fühlte die Hand des Mannes auf seiner Schulter, den sanften Druck seiner Finger. Er sah sein Lächeln.
»Petronius, du wirst es noch weit bringen.«
»Ich diene dem Herrn und seiner Kirche.«
»Sehr weit, mein Bruder, sehr weit. Doch bevor wir über Gratifikation und Anerkennung reden, müssen wir uns über das unterhalten, was du eben so richtig beschrieben hast. Sprechen wir über das Dorf, die Siedlung mit all den dämonischen Maschinen, die dort errichtet werden. Reden wir über die Menschen, die dort arbeiten und dem unheilvollen Einfluss der Dämonenbeschwörer hilflos ausgeliefert sind. Unterhalten wir uns darüber, was zu tun ist, um sie aus den Klauen ihres Zugriffs zu befreien, ihre Seelen zu reinigen und sie zum Licht zu führen – und lass uns darüber spekulieren, was die Bevölkerung des schönen Ravenna tun kann, um uns bei unseren Plänen zu helfen.«
Petronius’ Augen glänzten. Woran auch immer der Bischof von Mailand dachte, es war ganz und gar nach dem Geschmack des Priesters.
»Ich bin begierig, Eure Vorschläge zu hören«, erwiderte er beflissen.
Dann steckten sie die Köpfe zusammen.
Wer immer den Altarraum zufällig betrat, würde zwei Priester sehen, die leise und leidenschaftlich beteten, eine beständige, ewige Litanei zu Ehren des Herrn.
Und der Plan nahm langsam Gestalt an.
5
Markus Tennberg wurde gefoltert.
Es war keinesfalls so, dass ihn jemand mit glühenden Eisen piesackte. Der Fähnrich der kaiserlichen deutschen Kriegsmarine – auch wenn er nicht glaubte, dass er diesen Dienstgrad noch lange bekleiden würde – war sich der Tatsache durchaus bewusst, dass der römische Staat höchst fähige und erfahrene Folterknechte in seinen Diensten hatte und dass er auch wenig Skrupel kannte, sie gegen jeden einzusetzen, von dem er sich Informationen erhoffte. Derzeit aber war der junge Mann keiner solchen physischen Tortur ausgesetzt. Das hieß nicht, dass sich das nicht noch ändern könnte, und dieser Gedanke machte ihm ebenso schwer zu schaffen wie die Art der Folter, der man ihn unterzog.
Tennberg saß auf dem Strohsack, der ihm als Liegestatt diente. Er blickte aus dem schmalen, kaum einen Backstein großen Loch in der Wand, durch das Tageslicht in seine Kerkerzelle drang. Es gab nicht viel zu sehen. Er starrte direkt auf eine gegenüberliegende Wand. Die kalte Winterluft drang an seine Nase, vermischte sich mit der Wärme des Feuers, das von der anderen Seite durch die Gitter drang. Die Zelle hatte keine Tür, sondern eine Wand aus Eisenstäben, wie auch die sechs anderen Zellen des kleinen Gefängnisses. Alle Metallwände waren auf einen breiten Korridor hin ausgerichtet, der an einer schweren Holztür endete. Mitten auf dem Korridor brannte in einem halb offenen Kamin ein Feuer und davor saßen die drei Legionäre, die die Gefangenen bewachten.
Tennberg war zurzeit der einzige Insasse. Die Römer ignorierten ihn weitgehend, unterhielten sich leise, kauten auf etwas herum, spielten ein Spiel. Kaum jemals streifte ihn ein Blick. Zweimal am Tag – morgens und abends – wurde ihm eine Mahlzeit gereicht, nichts Besonderes, aber genug, um ihn bei Kräften zu halten. Wasser bekam er den ganzen Tag über. Niemand wollte, dass er hier verhungerte oder verdurstete.
Das war auch nicht die Folter.
Die wahre Tortur bestand aus den Besuchen seiner Kameraden.
Nein, so verbesserte er sich immer bei diesem Gedanken: seiner ehemaligen Kameraden. Meist waren es Unteroffiziere der Infanterie, nicht einmal seine alten Schiffsgefährten. Harte Männer, in ihre Gesichtszüge war Entschlossenheit ebenso eingegraben wie Verachtung. Die Verachtung war es, die ihn schlaflose Nächte erleben ließ. Die Kälte in den Augen, ohne Mitleid. Jeder dieser Männer würde ihn, ohne zu zögern, umbringen, sollte er den Befehl dazu erhalten. Tennberg wusste, warum die Verhöre nicht von den Männern der Saarbrücken durchgeführt wurden. Tennberg war von Klasewitz gefolgt, weil er sich dadurch einen schnellen Aufstieg im Römischen Reich versprochen hatte. Doch er war nie der wütende Schleifer und arrogante Miesling gewesen wie der Adlige, nur ein kleiner Fähnrich, der eine Abkürzung auf dem Weg nach oben hatte nehmen wollen. Diese Abkürzung hatte ihn, nach einigen Umwegen, direkt in eine Kerkerzelle in der kleinen Siedlung vor Ravenna gebracht, die um den Kreuzer entstanden war und in der sich Marineoberingenieur Dahms damit befasste, dem Römischen Reich die industrielle Revolution zu verpassen.
Tennberg versuchte zu erahnen, was mit ihm geschehen würde. Sein Wissen hatte er bisher für sich behalten, still Schläge oder Schlimmeres erwartet, dem Bemühen seiner Besucher entsprechend, dem zurückgekehrten Rheinberg alle notwendigen Informationen über den Verbleib von Klasewitz und über dessen Pläne zu übermitteln.
Niemand hatte ihn geschlagen. Jeden Tag wurden ihm die gleichen Fragen gestellt. Wo ist der Freiherr? Mit wem hat er sich verbündet? Wer hilft ihm? Was hat er vor? Was für ein Wissen gibt er seinen Freunden? Welche Ressourcen stehen ihm zur Verfügung? Was wollte Tennberg in Alexandria?
Kein Wort war über seine Lippen gekommen. Blicke voller Verachtung und Abscheu hatte er geerntet, doch niemand hatte die Hand gegen ihn erhoben. Man gab ihm zu essen und eine warme Schlafstatt. Alle drei Tage wurde heißes Wasser gebracht und er musste sich am ganzen Körper waschen. Er sollte leben und es sollte ihm – den Umständen entsprechend – gut gehen.
Was würde Rheinberg anordnen? Tennberg hatte ihn nicht als besonders grausamen Offizier in Erinnerung. Aber er musste sich verändert haben, jetzt, wo er Heermeister des Reiches war. Politik, das verstand Tennberg auch in seiner Jugend, war oft wichtiger als individuelle Vorlieben und Wünsche. Staatsräson war das Wort. Und manchmal fiel man dieser zum Opfer.
Und es gab gute Gründe dafür, warum er eines dieser Opfer werden könnte.
Tennberg fühlte, wie ein Zittern seinen Körper durchlief.
Er zitterte nicht wegen der kalten Luft.
Er wandte sich um, als jemand die Tür öffnete. Es war ein bekanntes Gesicht, ausdruckslos, mit kalten Augen. Der hochgewachsene Mann trug die Uniform der Infanterie, wie alle seine Gesprächspartner bisher. Seine Abzeichen wiesen ihn als Leutnant aus, ein Zugführer vielleicht. Tennberg konnte sich nicht an seinen Namen erinnern. Der Mann hatte sich ihm nie vorgestellt.
Es war wie ein Ritual. Tennberg wurde bedeutet, sich auf das einzige Möbelstück in seiner Zelle zu setzen, einen grob gezimmerten Hocker. Dann traten zwei Männer ein, der Leutnant und ein Infanterist mit erhobener Waffe, deren Mündung direkt auf Tennbergs Schädel gerichtet war. Der Leutnant ging hinter den Gefangenen und band dessen Hände mit einer Fessel zusammen. Als Tennberg gesichert war, senkte der Infanterist die Waffe und stellte sich wachsamen Blickes in eine Ecke.
Der Leutnant begann seine Umkreisung.
Er schritt gemessen um den dasitzenden Tennberg herum. Kein Wort kam über seine Lippen. Er drehte seine Runden. Tennberg hatte sie zu zählen begonnen. Das Verhör begann normalerweise nicht, ehe der Leutnant seine vierte Runde beendet hatte. Darin war er vorhersehbar, und damit wich auch das Bedrohliche aus diesem Ritual. Es wurde langweilig.
Tennberg würde sich hüten, das zu zeigen. Er stellte sicher, dass er eingeschüchtert, ja verängstigt wirkte. Seine Langeweile war sein Schatz, sein winziger Vorteil, und er hielt an diesem Schatz fest.
»Nun, Fähnrich?« Die kalte Stimme durchschnitt seine Gedanken. Unwillkürlich zuckte Tennberg zusammen. Er musste eingestehen, dass es um sein Nervenkostüm nicht sonderlich gut bestellt war.
»Wie sieht wohl Ihre Zukunft aus?«
Tennberg war für einen Moment verwirrt. War das eine neue Fragetaktik? Darüber hatte noch nie jemand mit ihm sprechen wollen. Er nahm auch nicht an, dass diese Frage aus Fürsorge gestellt wurde.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte der Gefangene wahrheitsgemäß.
»Keine Wünsche, Vorstellungen?«
»Die sind wohl nicht mehr wichtig.«
»Warum?«
»Ich bin gefangen, ein Meuterer und Deserteur. Meine Bestrafung ist klar.«
»Also kennen Sie Ihre Zukunft doch.«
»Soweit es das Ende dieses Prozesses angeht, ja. Mich erwartet die Hinrichtung.«
»Aaah, ja. Die Exekution. Eine einfache und naheliegende Lösung.«
Tennberg sagte nichts. Der Leutnant machte eine Runde, eher er weitersprach.
»Es ist aber nicht so einfach, Fähnrich. Wir sind nicht mehr in unserer Zeit und unserem Land. Die Dinge haben sich verändert.«
»Mir wurde gesagt, dass die Gesetze des Deutschen Reiches auf der Saarbrücken weiterhin Gültigkeit haben. Und selbst die Gesetze Roms beschreiben klar und deutlich, was mit Meuterern zu geschehen hat. Ich sehe nicht, was sich geändert haben soll.«
»Sie haben sich intensiv mit diesen Dingen befasst, ja?«
»Ich bin informiert.«
»Warum haben Sie dann gemeutert?«
»Es schien mir das Richtige zu sein und ein vorgesetzter Offizier hat mich in dieser Auffassung bestärkt.«
Tennberg hatte einen Ausbruch von Häme und Hass auf seine Antwort erwartet, aber nichts dergleichen geschah. Der Leutnant wirkte eher nachdenklich.
»Dennoch hat sich so einiges geändert, Tennberg. Wir kämpfen hier um unser Überleben. Wir sind den Römern keinesfalls so überlegen, wie wir es gerne hätten. Wir müssen überzeugen und beeindrucken.«
Tennberg sagte nichts. Er hatte nicht einmal das Gefühl, dass diese Sätze an ihn gerichtet waren.
»Ich sehe Ihre Zukunft etwas anders als Sie«, meinte der Leutnant schließlich.
Er ging vor Tennberg in die Hocke, sah ihm ins Gesicht.
»Sie rechnen mit Ihrem Tod, Fähnrich?«
Der Gefangene nickte.
»Was ist, wenn ich Ihnen Ihr Leben anbiete?«
Tennberg machte eine umfassende Handbewegung. »Und das hier wäre mein Leben? Es wäre wie ein Tod, nur sehr viel langsamer und qualvoller.«
Der Mann sah ihn forschend an. »Viele Menschen in Ihrer Situation würden die Chance ergreifen und auf spätere Gnade hoffen.«
Tennberg schüttelte den Kopf. »Ich nicht.«
»Sie unterschätzen Kapitän Rheinberg.«
»Das kann sein.«
»Das Angebot könnte besser sein, als Sie es erwarten.«
»Welches Angebot?«
»Ihr Leben und mehr.«
»Mehr?«
»Verbannung. Das Reich ist groß. Eine griechische Insel vielleicht, ein Leben als Bauer oder Fischer. Zurückgezogen, ja, aber als freier Mann auf eigener Scholle. Frau und Kinder, warum nicht? Mit Ihrem Wissen wären Sie bei der lokalen Bevölkerung sogar sehr angesehen, könnten helfen. Niemand muss erfahren, warum Sie sich dort niedergelassen haben. «
Tennberg sah den Leutnant an und konnte die plötzlich aufkeimende Hoffnung nur schwerlich unterdrücken. Was der Mann ihm da eröffnete, erschien durchaus realistisch als Strafe für seine Tat. Aber es war besser, viel besser als Exekution oder ein Leben in der Zelle. Doch war es auch ernst gemeint?
Der Leutnant musste ihm seine Bedenken angesehen haben. Er lächelte ein dünnes, freudloses Lächeln.
»Zweifel, Tennberg?«
»Sicher.«
»Gut. Ich werde Sie Ihnen jetzt nicht nehmen. Vielleicht der Kapitän, wenn er sich Ihrer annimmt, was in Kürze passieren sollte. Vielleicht schafft er das auch nicht. Sie sind so weit außerhalb jedes Vertrauens, jeder Kameradschaft, jeder Sicherheit im Umgang mit uns, die wir nicht gemeutert haben, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Weg zurück für Sie lang ist und schwer und vielleicht gar nicht zu bewältigen.«
Tennberg nickte. Was hätte er sonst entgegnen sollen? Der Mann hatte absolut recht.
Er fühlte, wie ihm die Fesseln gelöst wurden. Er rieb sich die Handgelenke, sah den Leutnant fragend an.
»Das war’s. Denken Sie drüber nach. Überlegen Sie sich, ob Kapitän Rheinberg ein Verräter oder ein Ehrenmann ist. Schließen Sie nicht von sich auf andere.«
Damit wandte sich der Mann ab und die beiden Soldaten verließen die Zelle.
Die Tür schloss sich.
Markus Tennberg war alleine mit seinen Gedanken.
6
Von Klasewitz sah zufrieden auf das Zerstörungswerk. Auf den ersten Blick wirkte es nicht einmal sonderlich beeindruckend: Eine einfache Wand aus Steinen, verbunden mit losem Mörtel, der durch die Witterung auch noch durchfeuchtet war, stand vor ihm. Darin klaffte ein großes Loch, hineingerissen durch eine runde Steinkugel aus festem Granit. Wahrscheinlich wäre die Wand auch beschädigt worden, wenn die beiden Legionäre, die neben dem Freiherrn standen, die Kugel mit Muskelkraft dagegen geworfen hätten. Dennoch waren alle zufrieden. Unter den Beobachtern, römische Offiziere, einige Handwerker sowie weitere Legionäre, die das Waffenzentrum bewachten, herrschte gute Laune. Auch von Klasewitz gestattete sich ein Lächeln.
Es war vollbracht.
Schon liebevoll blickte der Zeitreisende auf das Wunderwerk der Technik, dem er diesen Erfolg zu verdanken hatte. Die Kanone war aus Bronze, der am einfachsten herzustellenden Legierung, und eine zweite, aus Gusseisen, stand direkt daneben. Diese hatte ihre Bewährungsprobe noch nicht bestanden.
Die Bronzekanone war aus einem Stück gegossen worden, ein bauchiges Ungetüm von gut drei Meter Länge, aufgestellt auf einem hölzernen Bock, festgezurrt mit Seilen. Der Rückschlag hatte den Bock erzittern lassen und die Handwerker arbeiteten immer noch an einer stabileren Version, aber die Kanone war statisch genug gewesen, um mit ihr zielen und treffen zu können. Das Pulver hatte sich wie erwartet entzündet, die Steinkugel hatte das Rohr verlassen, das Rohr war nicht gebrochen – diese Waffe würde erneut feuern können.
Die erste römische Kanone. Dessen war sich von Klasewitz sicher. Wenn er sich einer Sache überhaupt sicher war, dann der Erkenntnis, dass er der beste Experte für Artillerie an Bord der Saarbrücken war.
Gewesen war, korrigierte er sich sofort.