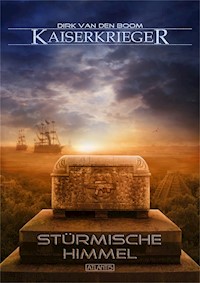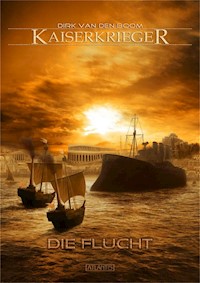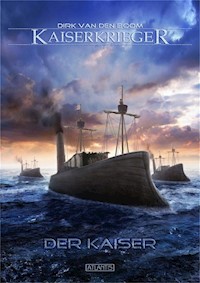8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs: Der Kleine Kreuzer Saarbrücken bricht aus Wilhelmshaven auf, um seine letzte große Fahrt anzutreten, bevor er außer Dienst gestellt wird. Doch auf der Höhe von Portugal gerät das alte Schiff in ein rätselhaftes Phänomen – und der Kreuzer der kaiserlich-wilhelminischen Kriegsmarine findet sich unversehens im Mittelmeer wieder, gut 1500 Jahre in der Vergangenheit, zu einem historischen Zeitpunkt: wir schreiben das Jahr 378, den Anfang des Endes des Weströmischen Reiches, den Beginn der Völkerwanderung… Die Mannschaft der Saarbrücken entschließt sich, die Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern für sich selbst eine sinnvolle Aufgabe in der Vergangenheit zu finden. Sie waren vorher die Krieger des Kaisers, warum sollten sie es nicht auch hier werden…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nachwort
Dirk van den Boom
Kaiserkrieger: Die Ankunft
1
»Schön, dass du gehst.«
Die Worte waren kaum falsch zu verstehen. Die Kälte in Karls Stimme untermauerte den Sinn zusätzlich. Rheinberg beschloss, diese Art von Abschiedsgruß nicht zu erwidern.
Als er das Haus verließ und auf den Bürgersteig trat, spürte er die Blicke in seinem Rücken.
Das Augenpaar von Helga, seiner Schwester, mit der Mischung aus Trauer und Trotz, die ihn bereits den ganzen gestrigen Tag begleitet hatte. Das Augenpaar ihres Mannes Karl, klar gefüllt mit Hass und Verachtung.
Auch das war gestern so gewesen, trotz der dünnen Schale an Höflichkeit, mit der Karl seinen Schwager in seinem kleinen Backsteinhaus in der Werftstraße empfangen hatte. Die Schale war schnell gesprungen, die Risse hatten sich verbreitert, und am Nachmittag, nach einem faden und zerkochten Mittagessen aus Kartoffeln und Fisch, war sie endgültig zerbrochen. Karl hatte wieder mit seinen Monologen begonnen und sich wie stets schnell hineingesteigert.
Das Ausbeutersystem, so wiederholte er wieder und wieder, und der Kapitalismus. Der Feudalismus im Denken und die Verdorbenheit der Monarchie. Freiheit für jene, Vergeltung für dieses – und dann natürlich sein größtes Feindbild: die Lieblinge des Kaisers, die Seeoffiziere. Karl wusste, wovon er sprach, oder zumindest nahm er es an. Er war seit sechs Jahren Werftarbeiter in Wilhelmshaven, und hier gab es ausschließlich Werften, die für die kaiserliche Flotte arbeiteten, die seit dem 2. Flottengesetz unentwegt in Tag- und Nachtschichten die Waffe erschufen, die Seine Allerhöchste Majestät in Auftrag zu geben beliebt hatte. Karl verdiente jede Mark mit seiner Arbeit für das Ausbeutersystem, für das er nur Hass zu empfinden schien, und das musste ihn doppelt und dreifach frustrieren. Als er dann seine Pamphlete hervorholte – Veröffentlichungen der sozialdemokratischen Druckerpressen, mit wehenden Fahnen und Bildern ihrer Führer und Idole, allen voran: Marx, Engels, Lassalle und wie sie noch hießen –, war Korvettenkapitän Jan Rheinberg der Geduldsfaden gerissen.
Helga hatte als Einzige bemerkt, wie es in ihm zu kochen begonnen hatte. Kein Wunder, sie war seine Schwester und gleichzeitig das schwarze Schaf der Familie, mit 18 ausgerissen von zu Hause und verheiratet mit einem Revoluzzer, einem einfachen Arbeiter, einem unsicheren Gesellen. Sein Vater hatte sie seitdem nicht mehr gekannt, der alte, unbeugsame, stocksteife Schuldirektor und Kavallerieoffizier a. D. Lediglich die Mutter schickte ihr hin und wieder Briefe, oft mit Geld, denn daran mangelte es ständig. Selbst während der ersten acht Jahre von Jans Karriere, als seine Eltern ihn noch bezuschussen mussten und Tausende in seine Ausbildung zu stecken hatten, ehe er endlich zum Oberleutnant befördert worden war und so etwas wie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hatte, waren die Briefe gekommen. Genauso jene Bitten seiner Mutter, sich um die Helga zu kümmern.
Jan besuchte sie daher mindestens einmal im Jahr – seit seiner Versetzung nach Wilhelmshaven vor sechs Monaten einmal im Monat, zum höchsten Missfallen ihres Mannes. Jan selbst hatte an diesen Besuchen keine Freude, dennoch erfüllte er seine Pflicht. So, wie er es immer getan hatte, auch dann, als sein Vater ihm eröffnet hatte, dass er seinen einzigen Sohn auf die Seekadettenschule zu entsenden gedachte, da sein Stand zum gewünschten Nachwuchs für das stetig expandierende Offizierskorps gehörte. Das Seeoffizierskorps, der Augapfel Seiner Allerhöchsten Majestät, und damit eine sichere Karriere für einen fleißigen jungen Mann, der gerade das Abitur mit höchsten Auszeichnungen bestanden hatte und eigentlich lieber …
Aber das Eigentliche war, was der Vater verlangte.
Jan hatte seine Pflicht erfüllt. Und als er nun an diesem kühlen Oktobermorgen, es war ein Sonntag, das Haus seines revolutionären Schwagers verließ, erinnerte er sich an die schneidende Kälte in seiner Stimme, mit der er am gestrigen Abend Karl zurechtgewiesen hatte. Seine Worte waren Ehre und Verpflichtung gewesen, Vaterland und Treue sowie die Sinnhaftigkeit von Allerhöchster Autorität, ohne die ein Staatswesen in genau die Anarchie und Beliebigkeit zerfallen würde, die Karl mit den Seinen doch wohl anstrebe. Er hatte sich gehen lassen, war eigentlich gar kein so fanatischer Verfechter der Monarchie – oder, um genauer zu sein, des aktuellen Monarchen. Dennoch: Korvettenkapitän Rheinberg hatte eine gute Exerzierstimme, er hatte sie in Mürwik zur Reife kommen lassen, als Ausbilder, einen Posten, den er bis vor einem halben Jahr innegehabt hatte. Ein gehasster und geliebter Posten, gehasst wegen dessen Eintönigkeit und der schlechten Entlohnung, geliebt, weil er gerne lehrte und Bildung für ihn wichtig war. Jeden Abend las er noch Texte in Latein: Cicero, Sallust, Ambrosius. Latein hatte er eigentlich lieber …
Das Eigentliche lag nun vor ihm. In vier Stunden musste er sich auf dem Kleinen Kreuzer Saarbrücken, einem der ältesten Schiffe der kaiserlichen Flotte melden, vordem im Weißen Schloss vorbeigehen und im Auftrage seines Kommandanten die schriftlichen Befehle abholen. Es ging zur Westafrika-Station, und die Vorfreude in Rheinberg überwog die Frustration, die ihm der vergangene Tag sowie der schweigsame, erbitterte Morgen im Haus seiner Schwester gebracht hatten.
Er hätte nicht laut werden sollen. Karls billige, schädigende Propaganda, die er zwar in der Kneipe und seinem Haus, doch wohlweislich nicht auf der Werft verbreitete, hätte an ihm abperlen sollen wie Gischt am Ölzeug. Jedoch die Wut, der jähe Zorn, der in ihm aufstieg, wenn er auf Dummheit stieß, war nur schwer beherrschbar. Karl und er verstanden einander nicht, ihre Welten waren völlig verschieden, lediglich zusammengehalten durch die Brücke seiner Schwester.
Sie waren beide unnachgiebig gewesen, dickköpfig, ungnädig, mehr von sich selbst überzeugt als von dem, was sie von sich gaben. Es hatte in Streit enden müssen. Es endete immer so.
Es nieselte. Jan zog den Kragen seiner Uniformjacke hoch. Allein die Existenz dieser Uniform in seinem Haus sei ihm eine Beleidigung, hatte Karl heute Morgen noch betont. Daraufhin hatte Rheinberg beschlossen, nicht bis zum Mittag zu warten, sondern gleich zu gehen. Das Offizierscasino war ohne Zweifel ein gastlicherer Ort. Abgesehen davon gab es auf der erst vor fünf Monaten nach allerlei Wartungsarbeiten wieder in Dienst gestellten Saarbrücken mehr als genug zu tun, bevor es auf die große Reise ging.
Allein der Gedanke daran besserte Jans Stimmung merklich auf. Er verzichtete sogar auf die Straßenbahn und ging die Strecke zu Fuß. Er musste nach den wenig erquicklichen Erlebnissen wieder einen klaren Kopf bekommen. Nichts half dabei besser als ein sonntäglicher Spaziergang. Er fühlte mit der rechten Hand das knisternde Papier in seiner Uniformtasche – der Brief von seinem Vater, drei Tage vor dessen Tode abgeschickt, in dem er dem Sohn förmlich und ohne Schnörkel mitteilte, dass er die Kunde von der Beförderung und Ernennung zum Ersten Offizier mit Stolz und Anerkennung vernommen habe. Dann drückte er seine Hoffnung aus, Jan werde dem Kaiser auch weiterhin getreulich dienen und damit die ehrenvolle Tradition seiner Vorväter fortsetzen.
Jans Antwort hatte ihn nicht mehr erreicht.
Er verscheuchte die grüblerischen Gedanken. Den unerwarteten Tod seines Vaters konnte er nicht ungeschehen machen. Ebenso wenig die ärgerliche Existenz des Karl Jansen, und sei es nur seiner Mutter und schließlich seiner Schwester zuliebe, die diesen Mann offenbar tatsächlich liebte. Korvettenkapitän Rheinbergs Opfer waren groß, denn seine Vorgesetzten hatten über die unschickliche Verbindung seiner Schwester an höchste Stellen berichtet; zweimal war er deswegen bei der Beförderung zurückgesetzt worden. Letztlich hatten aber sein Diensteifer und seine unerschütterliche Pflichterfüllung das Ihre getan, und so war er endlich an führender Stellung auf einem großen Schiff der Flotte stationiert worden.
Jan dachte daran und ertappte sich dabei, wie er fröhlich zu summen begann. Als er den Adalbertplatz erreicht hatte, mit den exakten Baumreihen und dem schimmernden Bau der Marinestation an seinem Ende, der gemeinhin nur das »Weiße Schloss« genannt wurde, hatte er fast schon wieder gute Laune. Er prüfte den Sitz seiner Uniform, bevor er die Wachposten passierte. Nach kurzer Meldung und dem Vorbringen seines Anliegens fand er sich im Warteraum wieder. Er musste lange warten, aber das tat ihm nichts. Der Raum war schlicht, dafür der Sessel bequem, und ein Bursche brachte ihm auf Geheiß Kaffee und Gebäck. Normalerweise wurde dies alles nicht so formell gehandhabt, jedoch war es die letzte große Fahrt der Saarbrücken. Danach würde sie ihr Dasein als Wohnschiff fristen. Immer wieder hatten Offiziere und Marine-Ingenieure anderer Einheiten gerade irgendetwas Wichtiges im Ausrüstungshafen zu tun, um einen letzten Blick auf das elegante, kraftvolle Schiff zu werfen, das aus einer anderen Zeit zu stammen schien. Das alte Schlachtross der Bremen-Klasse war 1902, als es erbaut worden war, der Gipfel deutscher Ingenieurskunst gewesen. Obgleich dessen Schwesterschiffe heute, gut 12 Jahre später, mehr und mehr durch moderne Turbinenkreuzer ersetzt wurden, war Rheinberg stolz auf die alte Lady. Kapitän von Krautz lag noch mit einer Grippe im Lazarett. Stationschef Admiral von Herringen persönlich würde Rheinberg in seiner Eigenschaft als Erster Offizier die notwendigen Befehle übergeben, und dies ehrte den Ruf des Kommandanten, der das Schiff die letzten sieben Jahre geführt hatte.
Rheinberg fühlte keinerlei Aufregung oder Angst. Er sah sich dort, wo er hingehörte, und würde er sich erst bewähren, war der Weg nicht mehr weit zu seinem eigenen Kreuzerkommando. Und Bewährung stand bevor, daran gab es keinen Zweifel. Der Krieg, auf den der Kaiser in seiner Weitsicht seine Flotte so sorgsam vorbereitet hatte, stand unmittelbar bevor, das wusste jeder, der über genügend Intelligenz verfügte. Rheinberg hatte an Intelligenz keinen Mangel, und so erwartete er die Zukunft mit Vorfreude. Krieg bedeutete Bewährung, und vor allem Siege, und dass es Siege sein würden, das stand ihn für außer Frage.
»Herr Korvettenkapitän!«
Die Stimme des Adjutanten riss ihn aus seinen Überlegungen. Wenige Augenblicke später fand Rheinberg sich in Gegenwart des Stationschefs wieder. Von Herringen war eine hochgewachsene Gestalt mit einem mächtigen, weißen Backenbart. Er hatte sein Amt erst vor etwa einem Jahr angetreten, allerdings hatte Rheinberg das Gefühl, dass er es nicht mehr lange innehaben würde. Der Mann stand kurz vor dem Pensionierungsalter, und wenn es tatsächlich zu einem Krieg kommen würde, dann bedurfte es eines Offiziers, der gleichzeitig auch in zivilen Angelegenheiten versiert war. Niemand machte sich Illusionen darüber, was ein Kriegsausbruch für die Stadt und das Umland von Wilhelmshaven bedeuten würde. Sie würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Festung erklärt werden, und das würde den Stationschef automatisch zum Gouverneur machen.
»Setzen Sie sich, Herr Korvettenkapitän!«
Rheinberg folgte der Aufforderung. Von Herringen ließ sich hinter seinem breiten Schreibtisch nieder und nickte in Richtung eines Papierbündels, das am vorderen Rande der Tischplatte lag.
»Nehmen Sie das, es sind die Marschbefehle. Sie sind gesiegelt, Fregattenkapitän von Krautz kann sie öffnen, sobald er aus dem Lazarett entlassen ist. Wie sieht es eigentlich damit aus?«
»Herr Admiral, der Kapitän ist bereits recht munter. Er hat die Influenza gut überstanden und wird übermorgen seinen Dienst wieder antreten.«
»Gerade recht, gerade recht. Sie werden es ziemlich eng haben auf der Hinfahrt.«
»Herr Admiral?«
Von Herringen deutete erneut auf das Papierbündel.
»Es hat einige Ergänzungen in letzter Minute gegeben. Sie wissen, dass die internationalen Spannungen kaum zu übersehen sind. Sollte es zum Kriege kommen, wird das unsere Kolonien genauso betreffen wie das Mutterland. Der Gouverneur von Kamerun hat zusätzliche Truppen verlangt. Er wird nicht das bekommen, was er gerne hätte, stattdessen immerhin eine volle Heereskompanie. Sie werden sie auf der Saarbrücken unterbringen müssen.«
»Das wird eng, Herr Admiral!«, gab Rheinberg zu bedenken. Eine volle Kompanie, also etwa vier Züge von je vierzig Mann, samt all der Ausrüstung … Es würde sogar sehr eng werden.
»Ich weiß. Hinzu kommen Munition, zusätzliche Gewehre sowie 25 000 Goldmark, alles abzuliefern beim Gouverneur. Sie werden einiges an Vorräten an Deck festzurren müssen, damit unterdecks Platz ist für die Grauen. Vielen davon wird es sehr schlecht gehen, vor allem, wenn es mal rau wird. Der Kompaniechef, ein Hauptmann Becker, scheint jedoch schon einige Male unser Passagier gewesen zu sein. Er wird sich mit seinen Männern Montagnachmittag an Bord melden, Sie sollten ihn empfangen.«
»Jawohl, Herr Admiral. Wir werden das schon hinkriegen.«
Das war leichter gesagt als getan. Allerdings stand es Rheinberg kaum an, diese Details mit von Herringen zu diskutieren. Warum nicht zusammen mit der Saarbrücken ein Dampfer geschickt wurde, konnte er sich nicht erklären. 25 000 Goldmark. Da musste er besondere Vorsicht walten lassen.
»Davon bin ich überzeugt«, erwiderte der Stationschef. »Sie werden in Portugal kohlen, die dortigen Behörden wissen Bescheid. Wenn Krieg ausbricht, werden Sie Marokko nicht anlaufen können, überhaupt sind die Küsten dann bis Togoland feindlich. Also keine volle Marschgeschwindigkeit, sondern Kohle sparen. Wenn Sie einen Tag später ankommen, ist das nicht so schlimm. Ich möchte nicht, dass die Saarbrücken auf ihrer letzten großen Fahrt in Feindeshand gerät.«
Nun konnte Rheinberg doch nicht an sich halten. Von Herringen hatte so bestimmt und kategorisch geklungen.
»Herr Admiral, ist wirklich schon in Kürze mit einer Kriegserklärung zu rechnen?«
Von Herringen gestattete sich ein dünnes Lächeln.
»Wer bin ich, dass ich den Allerhöchsten Ratschluss aus Berlin vorhersehen kann? Aber was ich höre, ist ermutigend. Ich bin mir sicher, dass in Kürze einige Fragen auf recht eindeutige Art und Weise geklärt werden. Auch Sie müssen sich wappnen. Es steht alles in den Befehlen.«
»Ja, Herr Admiral.«
»Noch etwas. Nein, zwei Dinge. Zum einen bekommen Sie einen neuen Chefingenieur. Marine-Oberingenieur Dahms, ein kurzfristiger Ersatz. Er wird sich morgen melden.«
»Jawohl, Herr Admiral. Und das zweite?«
Von Herringen seufzte. Für einen Moment blickte er etwas gedankenverloren aus dem Fenster. Der Nieselregen war durch einen Schauer abgelöst worden. Der Herbst begann, sich von seiner unangenehmen Seite zu zeigen. Es würde schwere See geben. Rheinberg bedauerte die Grauen schon jetzt.
»Die Berichte über sozialdemokratische Agitation in den Mannschaftsdienstgraden und bei den Unteroffizieren häufen sich. Ich weiß nicht, wie viele Oberheizer und Maaten schon bei den Sozialisten gelandet sind, oft bekennen sie sich nicht offen dazu. Noch eint alle das Band der Liebe zum Kaiser, vor allem hier in der Flotte. Nichtsdestotrotz muss ich gerade Sie auffordern, die Augen offen zu halten.«
Dieses »gerade Sie« konnte Rheinberg zweifach interpretieren. Als Appell an seine genuine Verantwortung als Erster Offizier, für die Disziplin in der Mannschaft direkt verantwortlich zu sein, oder als Hinweis auf seine angeheiratete Verwandtschaft, von deren Existenz von Herringen mit absoluter Sicherheit wusste. Rheinberg beschloss, das nicht zu diskutieren. In jedem Falle hatte er die Botschaft verstanden.
Zum Glück stand ihm mit einem schlichten »Jawohl, Herr Admiral!« eine in jeder Situation passende Antwort zur Verfügung.
Das Gespräch drehte sich noch einige Minuten um Nebensächlichkeiten, dann durfte Rheinberg gehen. Als der junge Offizier das Weiße Schloss verließ, hatte der Regenschauer nachgelassen. Die kalte Luft, die vom Jadebusen herwehte, roch nach Sturm. Nichts, womit ein erprobter Kleiner Kreuzer nicht fertig werden konnte, dennoch nichts, wonach sich ein erfahrener Seemann mit aller Macht sehnte. Gerade ein überladenes Schiff, wie es die Saarbrücken sein würde, konnte ruhiges Fahrwasser gut gebrauchen.
Rheinberg blickte auf die Uhr. Ihm blieben noch drei Stunden, bis er sich auf dem Schiff einzufinden hatte, andererseits gab es mehr zu tun als erwartet. Sein Bursche hatte sein Gepäck schon lange verstaut. Rheinberg machte sich im Geiste bereits Gedanken über ein Rotationsprinzip, mit dem die Raumkapazität der Saarbrücken optimal ausgenutzt werden konnte. Auf dem Fußweg zum Ausrüstungshafen kam er rasch zu dem Schluss, dass er selbst seine bescheidene Kabine mit dem Hauptmann der eingeschifften Infanterie würde teilen müssen. Das wiederum bedeutete, dass er sich für die Nachtwachen einteilen musste, sollte der Infanterist einigermaßen in den Genuss von Schlaf kommen. Es war ein Akt der Höflichkeit – Rheinberg war sich sicher, dass Becker auch jede andere Regelung klaglos akzeptiert hätte –, aber es traf sich, dass Rheinberg die Nachtwachen liebte, denn dann gehörte das Schiff wirklich ihm.
Als er die Saarbrücken erreicht hatte, stand sie unter Dampf. Das bedeute wohl zum einen, dass nunmehr alles an Ausrüstung an Bord war, was noch zu laden gewesen war, zum anderen, dass der Ingenieur die Maschine im Testlauf hatte, nicht zuletzt, um das Stromnetz noch einmal zu überprüfen. Rheinberg wusste, dass der stellvertretende Chef im Maschinenraum, Marineingenieur Dortheim, sich schon lange wieder an Bord befand. Er nahm sich vor, ihn beiseitezunehmen und zum neuen Chef zu befragen, der morgen ankommen würde. Die Marineingenieure kannten einander gut, und es waren Offiziere wie er selbst, wenngleich von niedrigerem Ansehen und geringerem Status. Seit langer Zeit war dies ein Grund für Reibereien, und manche von Rheinbergs Kameraden waren sich nicht zu schade, den Klassenunterschied durch allerlei abfällige Bemerkungen zu betonen. Rheinberg hatte dafür nie Verständnis gehabt und sich immer um ein gutes Verhältnis bemüht, wenngleich er als einfacher Leutnant bei der Schiffsführung selbst über einem altgedienten Oberingenieur stehen würde. Der größte Standesunterschied wurde in der Erteilung des Heiratsdispenses deutlich: Während Seeoffiziere die Erlaubnis zur Eingehung einer Ehe direkt von Seiner Majestät erhielten, wurde der Dispens für Marineingenieure durch höhere Kommandostellen erteilt. Es gab kein deutlicheres Zeichen für die gesellschaftliche Trennung zwischen den beiden Gruppen und schon lange drängten die Ingenieure, dass auch für sie der kaiserliche Dispens Gültigkeit erlangen sollte. Wie man hörte, war der Kaiser dem Wunsche durchaus gewogen, doch die Admiralität, allen voran der Flottenchef Tirpitz, war dagegen.
Rheinberg mischte sich in derlei nicht ein. Er war als Erster Offizier für das einwandfreie Funktionieren der Mannschaft verantwortlich, und nichts war für ein technisch so komplexes Gebilde wie einen Kleinen Kreuzer wichtiger als eine funktionierende Truppe im Maschinenraum und dort vor allem Offiziere, die sich darauf verlassen konnten, von der Schiffsführung anständig behandelt zu werden. Und exakt das gedachte Rheinberg zu tun.
Es mochte damit zusammenhängen, dass er selbst des Öfteren Opfer von Hänseleien und abfälligen Bemerkungen gewesen war. Er war bürgerlicher Herkunft, und obgleich kein Offizierskorps so bürgerlich war wie das der Marine, hatte das runde Fünftel von adeligen Söhnen nach wie vor in vielem Vorrang, insbesondere im Ansehen. Er hatte es nicht so schlimm getroffen wie jene Kameraden, die nicht einmal einen alten Kavallerieoffizier als Vater gehabt hatten. Sein Stubenkamerad Valentin, mit dem er zusammen als Seekadett gedient hatte, war Sohn eines Kaufmanns gewesen. Niemand wurde mit mehr Verachtung gestraft als ein »Koofmich«. Valentin hatte die Marine ein Jahr nach seiner Beförderung zum Leutnant verlassen und ein Studium begonnen. Rheinberg konnte es ihm nicht verübeln.
Er selbst hingegen war schon als Oberleutnant an Bord der Saarbrücken gekommen und hatte als Erster Offizier bereits einige Geschwaderübungen auf der Nordsee mitgemacht. Die meiste Zeit über hatte das Schiff jedoch im Hafen gelegen und war er mit Verwaltungskram beschäftigt oder auf Kursen gewesen …
Der Wachtposten vor dem Zugang zum Deck der Saarbrücken nahm Haltung an, als er Rheinberg erkannte. Es sprach für den Matrosen, dass er den Offizier erst an Bord ließ, nachdem er dessen Ausweis geprüft hatte. Rheinberg nickte ihm anerkennend zu, dann stand er auf dem nassen Stahldeck und schloss für einen Moment die Augen. All der Ärger, alle Grübeleien fielen von ihm ab. Er vergaß Karl und seine Schwester und die Tatsache, dass er diesen Rang und diese Position zwei Jahre später als andere Kameraden seines Jahrganges bekommen hatte. Er war hier, er war jetzt, und er war dort, wo er hingehörte.
»Herr Korvettenkapitän?«
Rheinberg öffnete die Augen und sah in das runde Gesicht von Marineoberstabsarzt Dr. Hans Neumann, dem leitenden Mediziner des Schiffes. Neumann war in allem das Gegenteil Rheinbergs. Wo dieser hochgewachsen und drahtig war, neigte jener zur Fülligkeit. Wo dieser mit seinem schmalen Gesicht und seiner scharfen, dünnen Nase eine Atmosphäre von Strenge verbreitete – manchmal auch ohne dies zu wollen –, verströmte Neumann Gemütlichkeit und Jovialität. Und wo Rheinberg die maßgeschneiderte Uniform passte wie angegossen, schien sie Neumann immer entweder zu groß oder zu klein zu sein.
Rheinberg hielt endlos viel von diesem Mann. Er war ein begnadeter Arzt und war in den letzten sechs Monaten zu einem Freund geworden. Er hatte ihm geholfen, zu lernen, wann Rigidität ein Ende hatte und wo ein nettes Wort, etwa im Umgang mit den Mannschaften, weiterhalf. So etwas lernte man in der Ausbildung nicht. Man lernte es oft nicht einmal als junger Offizier. Manche überdeckten ihre Unsicherheiten, indem sie zum Leuteschinder wurden. Als Oberleutnant war Rheinberg auf dem besten Wege dorthin gewesen. Dr. Neumann hatte ihn gerade noch vor diesem Irrtum bewahrt, und Jan war ihm auf ewig dankbar für diese Hilfe.
»Hans«, erwiderte Rheinberg den Gruß. »Du bist schon lange an Bord?«
»Drei Tage jetzt. Ich habe gehört, dass wir ein Rudel Landratten mit nach Kamerun nehmen.«
»Spricht sich schnell herum.«
Dr. Neumann grinste und zupfte an seiner wie üblich schief sitzenden Uniformjacke.
»Da wird dann das große Kotzen nicht lange auf sich warten lassen«, unkte er. »Das wird eine tolle Fahrt.«
»Du bekommst das schon hin. Wer hat sich sonst bereits gemeldet?«
»Klasewitz ist auf der Brücke.«
Johann Freiherr von Klasewitz, Korvettenkapitän wie Rheinberg – wenngleich mit etwas weniger Dienstjahren – und Zweiter Offizier, war exakt die Art von Person, mit der Rheinberg aufgrund seiner bürgerlichen Herkunft immer Ärger gehabt hatte. Zweimal waren sie bereits heftig aneinandergeraten und es hatte einige Zeit gebraucht, bis der Adlige Rheinbergs Autorität – obschon mit sichtbarem Widerwillen – anerkannt hatte.
»Dann werden ich ihn wohl besser in Ruhe lassen«, meinte Rheinberg mit feinem Lächeln. »Sind die neuen Mannschaften an Bord?«
»Wie ich es mitbekommen habe, ja. Ich habe die Hälfte schon durch die Musterung.«
»Haben alle ihre Rollentafeln bekommen?«
»Gleich nach Einschiffung. Die Mannschaft muss sich natürlich erst eingewöhnen. Wir haben diesmal etwa zwanzig Prozent Neulinge. Ich schlage vor, dass wir recht bald mit dem Gefechtsdrill beginnen.«
Rheinberg sah auf seine Uhr.
»Ich möchte, dass ab Mittag normale Routine herrscht. Nach dem Mittagessen gibt es eine Musterung, die Freizeit ist bis ein Uhr begrenzt. Statt kleinem Dienst will ich divisionsweisen Lecksicherungsdrill bis zum Abendessen. Nach dem Abendessen möchte ich alle Divisionschefs in der Messe sprechen.«
»Es sind wohl noch nicht alle Chefs da«, gab Neumann zu bedenken. »Wir warten zudem auf einige Deckoffiziere und Unteroffiziere. Wir bekommen schließlich eine ganz neue Mannschaft. Soweit ich weiß, sollen die letzten Männer zusammen mit dem Kapitän ankommen, also übermorgen.«
»Der Drill findet trotzdem statt. Wo noch keine Divisionschefs da sind, übernehmen die Stellvertreter oder stellen wir erfahrene Bootsleute ab. Wenn Kapitänleutnant von Krautz an Bord kommt, will ich mich ihm gegenüber nicht für eine möglicherweise schlecht eingespielte Mannschaft verantworten müssen, ohne nicht zumindest etwas dagegen unternommen zu haben.«
»Reden Sie mit von Klasewitz darüber. Er wird sich freuen.«
Rheinberg seufzte. Dem Zweiten Offizier war nie ein Dr. Neumann begegnet. Der Freiherr war ein Leuteschinder und würde jeden Drill für erbarmungslose Bestrafungsaktionen nutzen, wenn man ihn nicht unter Kontrolle hielt. Rheinberg wollte das Gespräch mit dem Mann so lange wie möglich hinauszögern.
»Wir kohlen am Donnerstag, denn wir haben Befehl, am Sonntag auszulaufen. Viel Zeit bleibt uns also nicht«, fuhr er fort. »Die Unterbringung der Infanteristen ist mein größtes Problem. Wir müssen zusätzliche Plätze für die Hängematten schaffen. Es wird alles noch enger als ohnehin. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass Frieden zwischen den Männern bleibt.«
»Das wird gehen, wenn wir gut vorankommen. Aber die Herbststürme stehen an. Es wäre besser gewesen, wenn wir schon vor zwei Monaten hätten aufbrechen können.«
Rheinberg zuckte mit den Schultern und klopfte auf das Bündel mit den Befehlen in seiner Brusttasche. »Es ist so, wie es ist.«
Neumann nickte. Er warf einen prüfenden Blick in den Himmel. Die Wolkendecke begann, an einigen Stellen aufzureißen. Zögerliche Sonnenstrahlen tanzten über das brackige Hafenwasser.
»Ein schöner Spätherbst wäre mir jetzt recht«, murmelte der Arzt.
»Mir auch. Wir sehen uns. Ist mein Bursche in Reichweite?«
»Er erwartet dich erst später, aber Moment …«
Neumann drehte sich um. »Oberbootsmann!«
Die massige, behäbig wirkende Gestalt, die sich die Leiter heruntergleiten ließ, war Rheinberg wohlbekannt. Oberbootsmann Harald Köhler war der dienstälteste Unteroffizier an Bord der Saarbrücken, genau fünfzig Jahre alt. Sein exakt gestutzter Bart war ebenso imposant wie der Rest der Erscheinung, der man das Alter nicht ansah. Köhler strotzte nicht nur vor Kraft, als Ältester der Unteroffiziere mit Portepee war er gleichzeitig der Sprecher aller Unteroffiziere und Mannschaften. Alle Beschwerden, alle Probleme gelangten im Regelfalle zuerst an sein Ohr. Die Tatsache, dass ihm tatsächlich freimütig vieles mitgeteilt wurde, sprach für den Respekt, den man ihm entgegenbrachte, ebenso wie für seine Beliebtheit. Rheinberg hatte in der kurzen Zeit, die er seinen neuen Posten innehatte, gelernt, sich blind auf den älteren Mann zu verlassen. Wenn er sich recht erinnerte, dann war es Neumann gewesen, der ihn sogleich nach Dienstantritt auf die Bedeutung des Veteranen hingewiesen hatte.
Köhler salutierte zackig. Rheinberg sah sich um und grinste.
»Sehen Sie von Klasewitz irgendwo, Köhler?«
»Nein, Herr Korvettenkapitän.«
»Dann lassen Sie das Gehampel. Sagen Sie meinem Burschen Bescheid, dass ich an Bord bin und dass er eine frische Uniform für mich rauslegen soll. Ich will nach dem Mittag eine Musterung durchführen – und ich möchte dabei selbst nicht durchfallen.«
Köhler erwiderte das Grinsen. »Ich greif ihn mir persönlich. Spielt sicher irgendwo Karten.«
»Fein. Und sonst?«
Die Frage klang beiläufig, war allerdings nicht so gemeint. Köhlers Urteil hatte für Rheinberg Gewicht.
»Alles so weit in Ordnung. Feines Schiff, aber das wissen Sie ja. Die Mannschaft ist noch ein wenig durcheinander und muss erst zusammenwachsen, wir haben reichlich Neulinge. Die Admiralität missbraucht uns ein wenig als Schulschiff, habe ich das Gefühl. Das kriegen wir aber hin. Ich würde vorschlagen, dass wir spätestens nach dem Kohlen mit dem Gefechtsdrill beginnen.«
»Lieber noch vorher, doch das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Wir müssen vorher ja die Infanterie unterbringen.«
Köhler verzog das Gesicht. »Wenn es wenigstens unsere Jungs wären …«
Rheinberg wusste, dass der Unteroffizier damit die Marineinfanteristen meinte. Er zuckte mit den Schultern.
»Nein, es werden richtige Graue sein. Behandeln Sie sie gut. Es wäre mir lieb, wenn Sie sich einen Feldwebel oder Wachtmeister zur Brust nehmen, ein paar Bier mit ihm kippen und während der Fahrt ein Ohr für die Nöte der Männer entwickeln. Ich kann Überraschungen auf einem ohnehin überfüllten und überladenen Schiff nicht gebrauchen.«
»Jawohl, Herr Korvettenkapitän.«
Rheinberg machte eine winkende Bewegung. Köhler tippte mit dem Zeigefinger gegen die Stirn und wandte sich ab.
Rheinberg seufzte und warf einen Blick auf die Brücke. Neumann klopfte ihm begütigend auf die Schulter.
»Jetzt müssen Sie wohl, Herr Korvettenkapitän.«
»Ja, jetzt muss ich wohl. Wir sehen uns später.«
Neumann nickte und verschwand. Rheinberg begab sich ohne weiteres Zögern auf die Brücke. Der Weg war nicht allzu weit, die Brücke relativ leicht erreichbar. Als er den geräumigen Kommandostand mit dem alles dominierenden Steuerrad betrat, fand er lediglich zwei Personen vor. Steuermannsmaat Börsen stand hinter der Ruderanlage, als befände sich die Saarbrücken auf großer Fahrt gegen die Engländer. Er fixierte das leicht aufgewühlte Hafenwasser mit einer Intensität, als wäre von dort jederzeit das Auftauchen eines Torpedos zu erwarten. Rheinberg rollte mit den Augen. Klasewitz.
Der Zweite Offizier war die andere Person auf der Brücke, ein Sinnbild des kaiserlichen Offiziers, hochgewachsen, muskulös, mit kantigem Gesicht und einem prächtigen Schnurrbart, welcher der Allerhöchsten Bartzier in nichts nachstand. Letzteres war derzeit im Offizierskorps nicht ungewöhnlich; allein die Tatsache, dass Rheinberg sein Gesicht glatt rasiert vorzog, war jedoch genug, um von Klasewitz’ Verachtung auf sich zu ziehen. Der Zweite Offizier, der zudem die Position des Artillerieoffiziers innehatte, lächelte maliziös. Obgleich er in der Hierarchie unter Rheinberg stand, war er bei der Beförderung nicht zurückgestellt worden – und sein Adelsrang machte ihn sowieso zu einem besseren Menschen. Rheinberg war von seinem Vater unbedingter Respekt vor dem Adel in die Wiege gelegt worden, trotzdem hatte er in der Kadettenschule seinen Verstand nicht abgegeben. Von Klasewitz war ein aufgeblasener Popanz, der seine Unfähigkeit durch unnötige Strenge und disziplinarische Willkür zu kompensieren suchte. Tatsächlich kannte er sich fast ausschließlich mit seinen Kanonen aus – mit allem anderen, vor allem mit Menschen, eher nicht. Er war so weit gekommen, weil sein Vater bei Hofe ein offenes Ohr fand und weil die Admiralität lieber Adelige in hohen Offizierspositionen sah als Bürgerliche. Daher hatte sich Rheinberg mühsam erarbeiten müssen, was das Schicksal von Klasewitz geschenkt hatte.
»Herr Korvettenkapitän!«
Der Freiherr machte nicht einmal Anstalten, eine korrekte Meldung zu fabrizieren.
Rheinberg deutete mit dem Finger auf Börsen.
»Haben wir neue Befehle erhalten, Herr von Klasewitz?«
Verständnislosigkeit zeichnete sich auf dem Bilderbuchgesicht des Freiherrn ab.
»Wie meinen?«
»Laufen wir sogleich aus?«
»Nein, keinesfalls … oder?«
Rheinberg unterdrückte ein erneutes Seufzen.
»Was soll dann Steuermannsmaat Börsen hier? Die Saarbrücken wird frühestens am Donnerstag bewegt, wenn wir zum Kohlen kommen. Das Schiff ist fest vertäut, wir haben noch nicht alle Mann an Bord, inklusive des Kapitäns.«
Von Klasewitz presste die Lippen aufeinander.
»Ich bin der Ansicht, dass wir allzeit bereit sein müssen. Der Feind …«
»… wird heute aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vorbeischauen«, vervollständigte Rheinberg den Satz. »Der einzige Maat, den wir auf der Brücke gebrauchen könnten, wäre vielleicht ein Signalmaat. Den sehe ich aber nicht. Dafür jemanden, der stocksteif ein Steuerrad umklammert, als würde es runterfallen, wenn er es losließe.«
Börsen stieß ein beinahe unhörbares Stöhnen aus. Rheinberg bewunderte ihn für seine Selbstbeherrschung. Der Maat war ein guter Mann. Es war eine Schande, dass er von seinem Zweiten Offizier zu dieser Farce gezwungen wurde.
»Börsen, Sie können gehen«, erlöste Rheinberg den Mann schließlich. Er wartete gar keine Bestätigung des Befehls ab, sondern wandte sich zusammen mit dem Maat ab und verließ die Brücke, von Klasewitz alleine zurücklassend.
Der Freiherr starrte ihm nach. Seine Hände ballte er zu Fäusten, bis die Knöchel weiß hervortraten.
Er sagte nichts.
Jan Rheinberg hatte gehofft, Infanterie und Kohlen getrennt an Bord nehmen zu können. Wie immer klappte es nicht exakt so, wie es geplant war. Genau drei Dinge passierten gleichzeitig: Nachdem die Saarbrücken an die Kohlenzunge verlegt worden war und die Kohlenkräne begonnen hatten, die schweren Bündel aufs Deck zu verholen, hatte der diensttuende Signalmaat aufgeregt nach Rheinberg verlangt. Der Erste Offizier war auf die Brücke gestürmt, in der unheilvollen Erwartung, dass sich eine der schweren Lasten vom Kran gelöst und auf das Deck gekracht sei, was leider hin und wieder vorkam und mitunter auch jemanden ernsthaft verletzen konnte. Zum Glück bestätigte sich diese Vermutung nicht. Sehr viel angenehmer war die Alternative allerdings nicht.
»Die Infanterie!«, meldete der Maat und wies auf das Ufer. In der Tat. Einen Tag später als angekündigt marschierte das Heer an, in vollem Gerödel. Immerhin, man stürmte nicht gleich an Bord. Als sich ein kleiner, stämmiger Mann von der Meute löste und zielstrebig auf das Fallreep zusteuerte, wusste Rheinberg, dass es sich nur um Hauptmann Becker handeln konnte. Vor seinem geistigen Auge sah er bereits, wie die kohlenstaubbedeckte Mannschaft die makellos aufmarschierten Infanteristen mit breitem Grinsen durch das kohlenstaubbedeckte Schiff schleusten und Letztere hinterher aussahen, als hätten sie Dienst vor den Kesseln gemacht.
»Wo ist der Diensthabende?«
»Oberleutnant Joergensen ist unten, das Verstauen der Kohle überwachen.«
Rheinberg seufzte. Ebenfalls noch nicht aufgetaucht war der neue LI, Marine-Oberingenieur Dahms, dessen Aufgabe das eigentlich sein sollte. Gerade wollte er die Brücke verlassen, um Becker entgegenzukommen, als er einen Wagen vorfahren sah. Rheinberg presste die Augen zusammen und sogleich entrang sich ihm ein tiefes Aufseufzen. Aus dem Wagen stieg, ein wenig wackelig auf den Beinen, Kapitänleutnant Harald von Krautz, der kommandierende Offizier der Saarbrücken, der eigentlich erst für heute Abend angekündigt war. Er hatte es wohl nicht mehr in der Obhut der Krankenschwester ausgehalten, was Rheinberg ihm nicht einmal verübelte. Aber seine Rückkehr kam ungelegen, eigentlich sogar sehr. Aus seinen Augenwinkeln sah er das Grinsen des Signalmaates, der dem Aufeinandertreffen der drei Offiziere offenbar eine amüsante Seite abgewinnen konnte. Rheinberg verkniff es sich, ihn deswegen zurechtzuweisen. Schadenfreude war immer noch die ehrlichste Freude, und zwar auch dann, wenn er das Objekt derselben war.
Rheinberg eilte den Männern entgegen. Becker und von Krautz hatten gleichzeitig die Wache am Fallreep erreicht, als er sich ebenfalls an Land schwang. Für einen Moment sahen sich die drei Männer sprachlos an. Becker machte den Mund auf, als von Krautz vor ihm das Wort ergriff.
»Meine Herren, mir scheint, wir haben hier eine kleine Feier.«
»Herr Fregattenkapitän«, erwiderte Rheinberg. »Es kommt alles ein bisschen ungünstig …«
Von Krautz lächelte. »Ich hoffe, Sie meinen damit nicht mich?«
Rheinberg lief etwas rot an. »Natürlich nicht, ich …«
»Er meint mich«, warf nun der Infanterist mit dunkler Stimme ein. »Und er hat recht, wir kommen nicht zur rechten Zeit.«
Nun wurde es Rheinberg noch ein wenig peinlicher, denn er hatte sich fest vorgenommen, den Gästen vom Heer einen durchaus freundlichen Empfang zu bereiten.
»Herr Hauptmann, ich habe das sicher nicht so gemeint«, wandte er lahm ein, sah das breite Grinsen auf den Gesichtern der beiden Männer und kapitulierte. »Meine Herren, willkommen an Bord der Saarbrücken. Herr Kapitänleutnant, ich …«
Von Krautz hob abwehrend die Hände. »Nichts da, Rheinberg! Wenn Sie mir gerade formell das Kommando übertragen wollen, dann haben Sie sich geschnitten! Haben Sie Ihren Spaß mit den Kameraden vom Heer! Ich verzieh mich in meine Kabine bis zum Abendessen.«
Er verbeugte sich Becker gegenüber. »Herr Hauptmann, ich lege das Schicksal Ihrer Männer in die fähigen Hände meines Ersten Offiziers, Korvettenkapitän Rheinberg. Ich würde mich freuen, Sie heute Abend als meinen Gast in der Offiziersmesse begrüßen zu dürfen. Das Essen bei der Kaiserlichen Marine ist deutlich besser als beim Heer, das darf ich Ihnen verraten.«
Becker erwiderte die Geste.
»Herr Kapitän, ich bedanke mich. Wir sehen uns heute Abend!«
Ohne weiteres Federlesen winkte von Krautz seinem Burschen, der mittlerweile das Gepäck aus dem Wagen gewuchtet hatte und nun Anstalten machte, die ersten Koffer an Bord zu tragen. Dann wandte er sich um, nickte Rheinberg mit in etwa dem gleichen Grinsen zu, das der Signalmaat im Gesicht getragen hatte, und drückte sich an ihm vorbei zum Wachsoldaten, dem er seinen Ausweis entgegenstreckte. Kurz darauf war er an Bord des Kleinen Kreuzers verschwunden.
Rheinberg musterte Becker. Der Infanterist war gut zehn Zentimeter kleiner als er, machte aber einen ausgesprochen kräftigen Eindruck. Er hatte eine gesunde, rötliche Hautfarbe und sein breites, weich wirkendes Gesicht war mit Sommersprossen bedeckt. Rheinberg schätzte ihn auf Ende zwanzig, trotzdem er sehr jugendlich aussah. Seine tiefe, dunkle Stimme mochte gar nicht zu dem jungenhaften Erscheinungsbild passen. Als er nun Rheinbergs dargebotene Rechte ergriff, drückte er sie fest, was die Kraft in seinen Armen erahnen ließ.
»Herr Korvettenkapitän, ich muss mich tatsächlich für dieses Durcheinander entschuldigen. Ich selbst wollte mich längst vorher bei Ihnen gemeldet haben. Es ist alles drunter und drüber gegangen. Ich habe noch einen neuen Stellvertreter bekommen, und dann fehlte die Hälfte der Männer, weil der Zug aus Oldenburg einen Schaden hatte. Meine Truppe ist ganz neu, ich kenne kein Drittel der Männer. Also – es tut mir einfach leid.«
Beckers Lächeln wirkte offen und entwaffnend. Rheinbergs schlechte Stimmung schmolz dahin. Er fasste unmittelbar Zutrauen zu dem Hauptmann und schüttelte daher nur den Kopf.
»Wir nehmen es jetzt so, wie es ist«, meinte er. »Ich muss Sie und Ihre Männer allerdings bitten, noch zwei Stunden zu warten, ehe sie an Bord gehen. Ich will das Kohlen vorher beendet haben. Es sieht nicht nach Regen aus, also lassen Sie die Männer sich setzen und eine Zigarette rauchen. Wir können auch Kaffee hinausbringen. Aber bitte lassen Sie uns dies eins nach dem anderen erledigen.«
Becker diskutierte gar nicht lange. Er rief einen jungen Mann mit den Rangabzeichen eines Oberleutnants zu sich, den er als seinen Stellvertreter vorstellte. Oberleutnant Klaus von Geeren lauschte aufmerksam den Erläuterungen seines Vorgesetzten, dann wandte er sich ab und bellte einige Befehle. Kurze Zeit später hockten sich die Soldaten auf ihre abgelegten Rucksäcke und der Tabak machte die Runde.
Rheinberg warf einen prüfenden Blick auf den Kreuzer. Wie insgeheim erwartet, stand Oberbootsmann Köhler an der Reling. Als hätte er nur auf das suchende Auge des Offiziers gewartet, machte er einige Gesten. »Noch anderthalb Stunden«, bedeuteten sie. Rheinberg hatte richtig kalkuliert. Er hob den Daumen und wandte sich wieder Becker zu.
»Sie, Herr Hauptmann, darf ich aber schon an Bord bringen. Es ist einiges los, dennoch will ich mir nicht nehmen lassen, Ihnen einen kleinen Rundgang durch das Schiff zu geben.«
Becker nickte. »Darauf freue ich mich schon lange. Sie haben da einen prachtvollen alten Pott.«
»Sie hatten schon mal das Vergnügen mit der Flotte?« Rheinberg wusste, dass dem so war, bloß wollte er dem Hauptmann Gelegenheit geben, mit seinen Erfahrungen etwas zu prahlen. Doch Becker war ein bescheidener Mann und konzentrierte sich auf das Wesentliche.
»Ich habe schon eine Dienstzeit in Deutsch-Südwest hinter mir. Damals war ich lediglich Ersatz für einen erkrankten Kameraden und bin mit dem Stationskreuzer gefahren, wie heute. Das ist schon eine Weile her, ich war ein frischer Leutnant und es war noch ein Aviso.«
»Lange her«, bestätigte Rheinberg. Die Avisos waren eine letztlich sehr unzuverlässige Schiffsklasse gewesen, deren Aufgaben heute von den Kleinen Kreuzern übernommen wurden. »Na, dann noch einmal: Willkommen an Bord!«
Mit diesen Worten führte er Becker über das Fallreep an Deck.
»Die Saarbrücken ist eines der ältesten Schiffe der Flotte«, begann er sogleich mit seiner Einführung und schritt Becker voran. »Sie wurde 1902 als zweites Schiff der Bremen-Klasse fertiggestellt. Ursprünglich besaß sie zehn 10,5-cm-Schnellladekanonen.« Rheinberg wies auf den Geschützturm, den sie gerade passierten. »Sechs haben wir davon noch, aber am Bug und am Heck wurde im Zuge der Umrüstung je eine 15-cm-Kanone aufgebaut. Damit verfügen wir jetzt über etwas mehr Feuerkraft.«
»Ich vermute, bei der Umrüstung ist einiges verändert worden«, meinte Becker und klopfte über das mit einer Plane abgedeckte Kanonenrohr.
»Einiges, ja. Der Fockmast wurde in die Brücke hineinverlegt. Das elektrische System wurde auf den neuesten Stand gebracht. Was wir nicht bekommen haben, waren Turbinen. Die Lübeck hat welche, wir hingegen schnaufen auf die herkömmliche Art und Weise.«
»Dreizylinder-Dreifachexpansionsmaschinen, zehn Marine-Wasserrohrkessel mit natürlichem Umlauf«, dozierte Becker. Rheinberg hob die Augenbrauen und nickte. »Sie kennen sich aus, Herr Hauptmann?«
»An mir ist ein Marineoffizier verloren gegangen. Nein, ich halte viel von dem Prinzip möglichst optimaler Vorbereitung, egal worum es geht. Viele meiner Kameraden lassen sich zu sehr von den Dingen überraschen, die sie erwarten. Mein guter Oberleutnant befand es nicht einmal für nötig, herauszufinden, wo Kamerun eigentlich liegt. Er meinte, er werde es ja sehen, wenn wir im Hafen von Douala einliefen.«
Rheinberg grinste. »Kein Hafeneinlauf. Es gibt eine schöne Reede und einen langen Pier, da ist es jedoch zu seicht für uns.«
Becker nickte. »Habe ich ihm auch gesagt. Daraufhin habe ich ihn mit einem Atlas sowie einem Erdkundebuch über unsere Kolonien für drei Stunden in Klausur geschickt. Über den Kreuzer hatte ich mich schon vorher informiert. Es ist einfach ein prächtiges Stück. So was bauen sie heute nicht mehr, der geschwungene Bug, die Verzierungen – das hatte noch Stil.«
Rheinberg kam nicht umhin, dem Infanteristen zuzustimmen. Die Schiffsneubauten wirkten deutlich funktionaler als die alte Saarbrücken. Man musste ihnen allerdings zugutehalten, dass sie ihren Sinn hatten. In den letzten elf Jahren war die technische Entwicklung nicht stehen geblieben. Der Einbau der Parsons-Turbinen in das Schwesterschiff Lübeck, das als erstes Schiff der Flotte mit der neuen Technologie auf Probefahrt gegangen war, zwei Jahre nach Indienststellung der Saarbrücken, war ein gutes Beispiel dafür.
»Wie groß ist die Besatzung?«, unterbrach Becker seinen Gedankengang. Sie hatten den Bug erreicht, standen direkt über der reichhaltigen Bugzier.
»287 Unteroffiziere und Mannschaften, 18 Offiziere«, erwiderte Rheinberg prompt. »Und seit Kurzem zusätzlich 160 Infanteristen.«
Becker grinste. »Wir werden uns so klein wie möglich machen, ich verspreche es.«
Rheinberg winkte ab. »Wir kriegen das schon hin. Wir werden das Schiff jedoch ganz schön überladen und daher etwas weniger Kohlen aufnehmen als sonst. Auch wird unsere Fahrt ein wenig gemütlicher ausfallen, denn unsere Lady würde bei forcierter Dauerfahrt gut zehn Tonnen Kohle in der Stunde schlucken. Wir werden also schön bei halber Fahrt bleiben, was unsere Reise verlängern, aber unsere Kohlevorräte schonen wird. In Portugal werden wir erneut kohlen, und dann noch langsamer bis Kamerun schippern. Richten Sie sich auf einige vergnügliche Wochen ein, so schnell wird es nämlich nicht gehen.«
Becker seufzte.
»Ich vermute, Sie werden uns die Zeit mit einigem Drill versüßen.«
»Exakt. Jeder Ihrer Männer bekommt eine Rollentafel. Sie alle müssen wissen, wo sie im Falle eines Falles am wenigsten im Weg stehen werden. Und das werden wir so lange üben, bis sie alle es im Schlaf beherrschen.«
»Tolle Aussichten sind das.« Becker klopfte auf die Reling. »Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass uns die alte Dame sicher an unser Ziel bringen wird.«
»Das bin ich ebenfalls«, sagte Rheinberg nur. Er drehte sich um und genoss den Blick auf die Brücke, auf der ein weißgesichtiger von Klasewitz stand und auf die beiden Männer herunterstarrte.
»Das da oben ist der Zweite Offizier«, erwähnte Rheinberg, als er merkte, dass Becker das Starren aufgefallen war. »Halten Sie sich lieber an den Kapitän oder an mich, noch besser: Wenn irgendwas ist, fragen Sie nach Oberbootsmann Köhler. Der ist seit zehn Jahren auf der Saarbrücken und kennt Ecken, von deren Existenz ich gar nichts ahne. Wenn etwas nicht klappt, auch im Zusammenleben mit der Mannschaft, dann ist er der Ansprechpartner.«
Becker nickte gedankenvoll. »Ich habe da einen Wachtmeister, der sich mit ihm anfreunden sollte …«
Rheinberg stellte erfreut fest, dass er mit dem Hauptmann anscheinend auf einer Wellenlänge lag. Wieder fiel sein Blick auf den stocksteifen von Klasewitz, der sie weiterhin beobachtete, als würden sie die Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates auf der Saarbrücken besprechen. Rheinberg ahnte, dass Becker diesen Mann genauso schätzen würde wie er. Das hatte auch damit zu tun, dass der Infanterist ebenso wie Rheinberg ein Offizier bürgerlicher Herkunft war – ein Umstand, der im Heer noch etwas seltener anzutreffen war als in der Flotte. Becker hatte es daher sicher auch nicht immer einfach gehabt, und nicht immer traf man auf hochanständige adlige Vorgesetzte wie von Krautz.
Rheinberg setzte die Führung fort. Becker zeigte sich als ausgesprochen aufmerksamer und konzentrierter Begleiter, der trotz aller ironischen Seitenhiebe und gelegentlichen Witzeleien jede Information in sich aufsog wie ein Schwamm. Am Ende ihrer Runde waren sie in Rheinbergs bescheidener Kajüte angekommen. Der Korvettenkapitän machte eine ausladende Bewegung.
»Seien Sie mein Gast, Herr Hauptmann. Ich werde mich um die Nachtwachen bemühen, dann können Sie hier in Ruhe schlafen. Zur Not haue ich mich in die Badewanne. Mein Bursche sorgt für frische Bettwäsche.«
Becker nickte. Sein Blick fiel auf das einzige Regal des Raumes. Es war dermaßen mit Büchern vollgestopft, dass wahrscheinlich selbst bei schwerstem Seegang keines herausrutschen würde. Er strich mit dem Finger über die Buchrücken und las die Titel laut vor.
»Edward Gibbon, Verfall und Untergang des Römischen Reiches. Die Notitia Dignitatum in neuer Übersetzung. Vegetius. Ambrosius … hm, Sie haben ein Faible für römische Geschichte, Herr Korvettenkapitän.«
Rheinberg lächelte verlegen.
»Seit früher Jugend. Mein Vater hat dieses Interesse gefördert, er meinte, ich könnte für meine Karriere so einiges lernen.«
»Ihr Vater wollte, dass Sie Geschichtsprofessor werden?«
Rheinberg Lächeln bekam einen schmerzlichen Zug.
»Nein, er wollte von Anfang an, dass ich Seeoffizier werde. Aber gerade die Geschichte des ausgehenden Römischen Reiches ist zum größten Teil Militärgeschichte. Ein faszinierendes Thema jedenfalls. Ich habe im Haus meiner Eltern noch eine ganze Wand voll Bücher. Nur die wichtigsten Werke habe ich mitgenommen, ich lese immer wieder gerne in ihnen.«
Becker zog einen dünnen Band mit etwas Mühe aus dem Regal.
»Lateinische Grammatik. Ich will verdammt sein, das ist das Grammatikbuch aus der Oberprima. Es gehört sicher zu den meistgehassten Büchern meiner Jugend.«
Rheinberg grinste nun fast jungenhaft.
»Latein ist meine Leidenschaft. Ich war Klassenbester bis zum Abitur. Ihr Lieblingsfach war es nicht?«
Becker verzog das Gesicht. »Ich war passabel in Griechisch. Latein hat mir permanente Kopfschmerzen bereitet. Wer denkt sich so was Abwegiges wie den Ablativ aus?«
Er schob das Buch vorsichtig zurück an seinen Platz.
»Ihre Leidenschaft für die Militärgeschichte hingegen teile ich. Wir können viel von den antiken Feldherren lernen.«
Rheinberg nickte. »Das können wir, nur leider tun wir es oft nicht. Herr Hauptmann, ich muss mich weiteren Pflichten widmen …«
Becker machte ein schuldbewusstes Gesicht.
»Ich habe Sie schon viel zu lange aufgehalten. Ich kehre zu meinen Männern zurück und wir sehen uns wieder, wenn ich mit der Truppe an Bord gehe. Eines aber noch: In einer meiner Kisten liegen 25 000 Goldmark für den Gouverneur von Kamerun. Wir sollten die sofort verstauen!«
Das hatte Rheinberg fast vergessen. Er bemühte sich mustergültig um Haltung und tat so, als hätte er mit diesem Thema gerechnet.
»Natürlich«, erwiderte er mit fester Stimme. »Der Zahlmeister wird sich um alles kümmern. Der Schiffstresor dürfte zu klein sein, das Büro des Zahlmeisters jedoch ist doppelt gesichert. Wir werden die Kiste dort verstauen. Es ist ein sicherer Ort und unser Oberleutnant Thies hat schon größere Summen beaufsichtigt.«
»Dann ist alles geklärt. Ich finde den Weg zurück an Deck alleine, ich muss es eh so schnell wie möglich lernen.«
»Wenn etwas ist, wenden Sie sich direkt an mich oder an den Oberbootsmann Köhler. Bei ihm sind Sie immer in guten Händen.«
Die Verabschiedung war schnell und höflich. Dann eilte Rheinberg nach oben, um sofort persönlich für die Verladung des Goldschatzes zu sorgen. Er war Becker für die Erinnerung dankbar, auch wenn er es sich nicht hatte anmerken lassen.
Mit dem Hauptmann würde er gut zurechtkommen.
2
Normalerweise war das Auslaufen eines Schiffes Anlass für das so genannte »Whooling«, das sich herzende, weinende, fröhliche, traurige, stille, laute und unkontrollierbare Verabschiedungsritual, mit dem Angehörige, Bräute und Freunde die Seeleute auf die große Fahrt entließen. Wie schon am Vortag fegte jedoch der Herbst mit seinen Sturmgewalten über die Molen und Piers von Wilhelmshaven – die angetretene Blaskapelle musste unverrichteter Dinge abtreten und die versammelten Angehörigen, die dem trotzig auslaufenden Kreuzer ihr Lebewohl hinterherwinkten, waren vom Wind und Regen reichlich zerzaust –, diesmal meinte es das Wetter wirklich nicht gut mit ihnen. Als die Bootsmannspfeifen erklangen, wich das Bedauern über die Trennung bei vielen schnell der Freude darüber, wieder ins Trockene zu kommen. Rheinberg konnte von der Brücke aus gut erkennen, wie die Ersten den Rückweg in die warme Stube antraten, als die Saarbrücken noch keine zwanzig Meter vom Kai entfernt war. Er wollte es niemandem verübeln, auch nicht den Feldgrauen, die es vorgezogen hatten, im Innern des Kreuzers zu bleiben. Ihre Angehörigen, die im Regelfalle in der Nähe der Heimatkaserne weiter im Inneren des Reiches zu finden waren, hatten sich ohnehin bereits zu anderer Gelegenheit von den Männern verabschiedet.
Die Infanteristen hatten zum Schluss noch einen zerlegten 4-Tonnen-Lastwagen von Benz geliefert bekommen und an Bord gehievt. Anscheinend benötigte der Gouverneur in Kamerun dringend ein großes Fahrzeug und wollte nicht auf einen Frachter warten. Köhler hatte stundenlang wie ein Rohrspatz geschimpft, Rheinberg hatte ihn gewähren lassen. Letztendlich war das Fahrzeug an den unmöglichsten Stellen auf und unter Deck verstaut worden. Hauptmann Becker war seitdem sehr, sehr freundlich zu dem alten Unteroffizier gewesen, was Rheinberg mit großer Freude festgestellt hatte. Es war schön, hin und wieder auf Offiziere zu treffen, die auch die Männer niedriger Dienstgradgruppen als menschliche Wesen ansahen.
Die Saarbrücken schlingerte. Windstärken bis acht und eine raue See waren nichts, was den sehr stabil und seesicher gebauten Kreuzer ernsthaft in Verlegenheit bringen konnte, doch das Schiff war leicht überladen und hatte seeunerfahrene Mannschaft an Bord. Rheinberg hegte gewisse Befürchtungen und erkundigte sich womöglich mehr als notwendig nach dem Wohlbefinden der Gäste. Als die Saarbrücken schließlich mit westlichem Kurs die Nordseeküste entlangstampfte und tapfer gegen die Wellen und den eindringenden Wind ankämpfte, war Rheinberg, der die Wache führte, regelrecht dankbar, als ein gesund und durchaus agil wirkender Hauptmann Becker die Brücke betrat. Ein Signalgast nahm ihm das schwere Ölzeug ab und legte den nassen Schal über die Metallplatte oberhalb des Heizofens, der die Brücke zu einem relativ angenehmen Ort machte. Draußen herrschten zwar noch keine eisigen Temperaturen, aber der scharfe Wind und der unablässige Regen, mal als Schauer, mal als bessere Gischt, senkte die gefühlte Temperatur auf ein Minimum.
»Volkert, geben Sie dem Hauptmann einen Kaffee!«, war dann auch Rheinbergs erster Befehl. Fähnrich zur See Thomas Volkert war mit der Saarbrücken