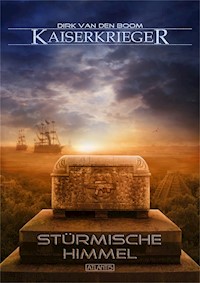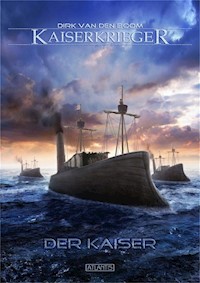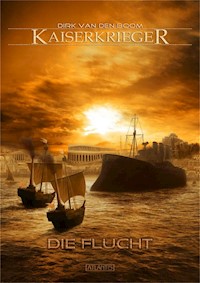
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Zeichen stehen auf Sturm. Das Römische Reich versinkt im Bürgerkrieg - alles, wofür die Zeitreisenden eingetreten sind, scheint sich in einer Orgie der Gewalt aufzulösen. Der Usurpator Maximus gewinnt die Oberhand und die Pläne zum Gegenschlag erweisen sich mehr und mehr als undurchführbar. Der Kleine Kreuzer Saarbrücken, erneut der Heimat beraubt, wird auf eine Odyssee geschickt. Verrat und Intrigen lauern auf dem Weg. Und als eine neue, tödliche Bedrohung das Reich in seinen Grundfesten zu erschüttern droht, bleibt allen Beteiligten nicht viel mehr als die Flucht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Personenverzeichnis
Weitere Atlantis-Titel
1
Konstantinopel war eine prächtige Stadt. Rheinberg stand auf der Brücke der Saarbrücken und blickte am Steuermann vorbei auf die sich abzeichnende Silhouette der mächtigen Metropole. Er war zu seiner Zeit nie hier gewesen, obgleich das Osmanische Reich und das Deutsche Reich durchaus freundschaftliche Beziehungen pflegten, zu denen auch regelmäßige Flottenbesuche gehörten. Zu seiner Zeit, erinnerte er sich, war das Osmanische Reich nur noch ein schwacher Abglanz dessen gewesen, was einst die Reste Ostroms niedergerungen hatte. Konstantinopel – oder Byzanz, wie es später hieß – war alles, was vom Römischen Reich überdauert hatte, bis die Stadt, die kaum mehr als ihre eigenen Mauern beherrschte, schließlich dem Ansturm osmanischer Truppen unterlag. Dann hatte die Metropole eine neue Blütezeit genossen, als Istanbul, dem Zentrum eines neuen Weltreichs. Es war in mehrfacher Hinsicht und gerade aufgrund seiner höchst wechselvollen Geschichte ein historisch fast schon überladener Ort.
Jetzt, zum Ende des Jahres 379 hin, war Konstantinopel die Hauptstadt Ostroms und bereits eine sich weit ausbreitende Siedlung. Sie wurde geschützt durch seine berühmten, als unbezwingbar geltenden Befestigungen, war stark durch seinen großen Hafen, Sitz der römischen Flotte, mit einem eigenen Senat und regiert – in Abwesenheit eines oströmischen Kaisers – durch das Konsistorium, eine Art Ministerkabinett unter dem Vorsitz des Prätorianerpräfekten des Ostens, einem alten und erfahrenen Politiker namens Domitius Modestus.
Hier, in der mächtigsten Stadt des Ostens, wollte die Saarbrücken Zuflucht finden. Von hier sollte der Gegenangriff Magnus Maximus in die Enge treiben und seinen Aufstand beenden. Von hier wollte der rechtmäßige Heermeister des Imperiums, Jan Rheinberg, die Einheit des Reiches wiederherstellen und Theodosius zum rechtmäßigen Kaiser von ganz Roms machen.
Zurzeit fühlte sich Rheinberg aber nur rechtschaffen müde.
Die Abreise aus Ravenna war bitter gewesen. Die Bewohner des »deutschen Dorfes«, der großen Produktions- und Ausbildungsanlage an der Küste, hatten sich zum Abschied versammelt, soweit sie nicht auf der kleinen Flottille mitkommen würden. Sie alle hatten gewusst, dass die faszinierende Zeit des Aufbruchs erst einmal vorbei war. Die Werkhallen waren in völlige Stille versunken, als die Maschinen und Werkbänke abgebaut worden waren. Überall hatte man Brandbeschleuniger verteilt. Sobald das Dorf geräumt war, würde man alles in Brand setzen. Als die drei Schiffe – der Kleine Kreuzer sowie die beiden Dampfsegler Valentinian und Horaz – den Hafen verlassen hatten, war nur ein Schiff im Hafen verblieben, der dritte der neu gebauten Dampfsegler, hastig in Gratianus umbenannt. Er würde erst auslaufen, wenn die Truppen des Maximus vor Ravenna standen und das Dorf in Brand gesteckt werden würde. Rheinberg erwartete, dass die Gratianus sich der Flottille der Flüchtenden schnell anschließen würde. Als sie ausliefen, war bereits bekannt gewesen, dass sich das Heer des Maximus näherte. Jetzt, wo sie Konstantinopel vor sich hatten, würden die Anlagen, die ihre vorübergehende Heimat gewesen waren, bereits wenig mehr als rauchende Ruinen darstellen.
Die drei Schiffe waren hoffnungslos überfüllt. Man hatte wichtiges Personal mitgenommen, einiges an Materialien, Prototypen, aber auch die Angehörigen der Mannschaften, Frauen und Kinder. Das Deck der Saarbrücken wirkte an schönen Tagen wie ein großer Kindergeburtstag, doch bei schwerem Seegang verwandelte es sich in ein lebensgefährliches Terrain voller leidender Zivilisten, meist von der Seekrankheit gebeutelt. Glücklicherweise war bisher niemand ernsthaft verletzt worden. Alle hatten die Überfahrt in die östliche Reichshälfte mit bemerkenswerter Disziplin absolviert. Die Tatsache, dass durch die Flucht Familien eben nicht auseinandergerissen worden waren, hatte sehr zur allgemeinen Ruhe und Besonnenheit beigetragen. Rheinberg dachte an Aurelia, die ehemalige Sklavin, die er zusammen mit drei weiteren Frauen in der Kajüte des Kapitäns wusste, während er selbst sein Nachtlager direkt auf der Brücke des Kreuzers aufgeschlagen hatte – wie fast alle Führungsoffiziere, die die geschützten Unterkünfte den Passagieren überlassen hatten.
Auf den beiden Dampfseglern, die in Formation mit der Saarbrücken fuhren, sah es nicht viel anders aus. Die Tatsache, dass die Saarbrücken nicht einfach vorpreschen konnte, sondern sich der langsamen Geschwindigkeit von sechs bis acht Knoten der beiden Neubauten mit ihren leistungsschwachen Bronzedampfmaschinen anpassen musste, führte bei manchen zu Ungeduld. Natürlich konnten die beiden Dampfer auch gut selbst auf sich aufpassen. Beide waren mit Arkebusen, großen Handkanonen aus Bronze, ausgestattet worden. Es gab kein Schiff auf dem Mittelmeer, das es mit ihnen militärisch aufnehmen konnte. Im Zweifel drehten die Dampfsegler gegen den Wind, warfen die Dampfmaschine an und fuhren einer angreifenden Kriegsgaleere einfach davon.
Es ging Rheinberg aber um die psychologische Wirkung, den Zusammenhalt. Sie mussten gemeinsam auftreten, zusammenbleiben. Und ehe es nicht auch für die neuen Schiffe eine funktionierende Funkanlage gab, waren die Kommunikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. De facto war die Flottille das Machtmittel, auf das Rheinberg verlässlich zugreifen konnte. Er wollte es nicht noch aufsplittern.
Das lag sicher auch daran, dass er Ehrfurcht vor Konstantinopel empfand. Er kannte keinen der politischen Akteure hier persönlich, seine bisherige Amtszeit als Heermeister war im Wesentlichen auf den Westen beschränkt gewesen. Thessaloniki kannte er, das war aber auch schon alles. Er wusste, dass diese Stadt im Römischen Reich ihresgleichen suchte. Und ihre Herren nahmen, das hatte er sich bereits erzählen lassen, für sich in Anspruch, mehr als nur die Verwalter des Ostens zu sein. Dass die Entwicklung der Geschichte aus Rheinbergs Vergangenheit mittlerweile auch hier bekannt geworden war, trug sicher dazu bei. Das Bewusstsein, dass in Rheinbergs Realität Byzanz ein neues Großreich errichtet hatte, Westrom aber machtpolitisch erst einmal in Bedeutungslosigkeit versunken war, hatte das natürliche Überlegenheitsgefühl der hiesigen Mächtigen sicher noch verstärkt. In gewisser Hinsicht bedrohten die Pläne Rheinbergs, Rom als Ganzes zu retten, diese besondere Renaissance der Stadt. Mit solchen Vorbehalten würde er sich direkt oder indirekt auseinandersetzen müssen, dessen war sich Rheinberg bewusst.
»Herr Kapitän, wir sind dann so weit!«
Langenhagens Stimme riss ihn aus seiner Kontemplation. Er rieb sich über das Kinn, frisch rasiert, und sah kurz an sich herab. Er trug die Kleidung eines römischen Adligen, während die meisten anderen Männer an Bord die übliche Marineuniform am Leib hatten. Rheinberg fühlte sich nicht sonderlich wohl in dieser Aufmachung, aber er wusste, was er seinen zukünftigen Gastgebern schuldig war.
Das Wetter war klar und für die Jahreszeit bemerkenswert ruhig, wenngleich unangenehm kalt. Der Hafen Konstantinopels lag vor ihnen. Die beiden Dampfsegler würden der Saarbrücken langsam folgen. Die Geschwindigkeit war ohnehin minimal. Es wäre fatal, den Antrittsbesuch des Kreuzers mit einem möglicherweise desaströsen Schiffsunfall zu beginnen. Börnsen, der Steuermannsmaat, umklammerte das Ruderrad mit fokussierter Konzentration.
Es war Spätherbst und die Schiffssaison auf dem Mittelmeer neigte sich dem Ende zu. Das Mittelmeer wurde zu stürmisch und kalt für die Rudergaleeren und Segelschiffe des Imperiums, sodass der Schiffsverkehr um diese Jahreszeit meist völlig zum Erliegen kam. Dementsprechend wohlgefüllt war der Hafen mit den zahlreichen Piers und den langen Kaimauern. Die Saarbrücken kam nicht völlig unangekündigt – sie hatten rechtzeitig Botschaften mit schnellen Küstenseglern aus Ravenna vorgeschickt, als klar wurde, wie die Planung aussehen würde –, dennoch befürchtete Rheinberg für einen Moment, mitten im Hafenbecken ankern zu müssen, so vollgestopft war die Anlage. Dann aber eröffnete sich ein langes Stück Kaimauer, offenbar freigehalten für exakt diesen Zweck. Rheinberg nickte.
»Das ist unser Ziel, Maat!«
»Jawohl, Herr Kapitän!«
Rheinberg war nicht der Kapitän, es war Joergensen. Und eigentlich hatte er als Heermeister auf der Brücke auch keine Befehle zu geben, eher der ebenfalls anwesende Erste Offizier Langenhagen. Doch die alten Gewohnheiten wogen schwer, und niemand wagte es – oder wollte es auch nur –, dem Heermeister zu sagen, was er zu tun und zu lassen hatte. Daher war es auch nur verständlich, dass er von den Deutschen weiterhin als »Kapitän« angesprochen wurde, nicht zuletzt deswegen, weil der Titel des »Heermeisters« ihnen allen doch noch sehr fremd vorkam.
Langenhagen stellte sich neben den Steuermann und begann, ihm leise Befehle zuzuflüstern. Rheinberg musste sich um das Manöver nicht weiter kümmern. Er betrachtete die Kaimauer und sah, dass dort nun eine Ehrenformation Legionäre aufmarschierte. Weitere Soldaten hielten die Schaulustigen unter Kontrolle, die von allen Seiten herbeigeströmt kamen. Von der Saarbrücken zu hören, das war eine Sache, aber dieses Wunderwerk dann einmal tatsächlich zu Gesicht zu bekommen, eine ganz andere. Die Nachricht würde sich in Windeseile in der Stadt verbreiten. Rheinberg hoffte, dass die Behörden darauf vorbereitet waren. Sein Blick wanderte die Reihe der Legionäre entlang und er wurde zuversichtlich. Offenbar hatten die Verantwortlichen ausreichende Kräfte zusammengezogen.
Es dauerte eine gute halbe Stunde, dann hatte sich die Saarbrücken so weit der Kaimauer genähert, dass die Haltetaue geworfen werden konnten und die Hafenarbeiter, zehn bis fünfzehn an jedem Tau, das Anlegemanöver unterstützten. Nach weiteren zehn Minuten glitt der Kreuzer butterweich an die Mauer heran. Ein perfektes Manöver.
Die beiden Dampfsegler hatten vergleichbare Positionen unweit des Kleinen Kreuzers gefunden. Alles lief problemlos ab. Auch die beiden Neubauten würden früher oder später Schaulustige anziehen, dessen war sich Rheinberg sicher. Vorher aber würde sich die Aufmerksamkeit ganz auf die Saarbrücken konzentrieren.
Nun war auch zu erkennen, dass sich zu der Ehrenformation der Legion ein Empfangskomitee von Notabeln gesellt hatte, gut auszumachen an der noblen Kleidung und dem großen Gefolge. Rheinberg kannte hier niemanden, aber er würde diesen Männern ohnehin nicht alleine entgegentreten: Die Senatoren Michellus und Symmachus hatten beschlossen, mit ihm nach Osten zu reisen, ebenso wie Militärpräfekt Renna, der ehemalige Navarch von Ravenna. Die meisten anderen Offiziere aber waren im Westen verblieben, um Kaiser Theodosius bei dessen militärischen Hinhaltetaktik zu unterstützen. Rheinberg hoffte, sich hier in Konstantinopel schnell einen neuen Stab verlässlicher Männer aufbauen zu können.
»Fallreep ist draußen!«, meldete Langenhagen.
»Dann sollten wir unsere Gastgeber nicht warten lassen.«
Rheinberg verließ die Brücke. Am Fallreep hatte sich bereits die Delegation versammelt, die als erste die Stadt betreten würde: Renna, Michellus und Dahms. Der Ingenieur nickte Rheinberg zum Gruß zu. Er sah grau aus, das Gesicht verhärmt. Der Verlust des »germanischen Dorfs« und der Früchte all seiner Anstrengungen hatte ihn besonders tief getroffen. Immerhin, so dachte Rheinberg bei sich, war sein besonderer Schützling Marcellus samt seiner Familie auf einem der Dampfsegler untergekommen.
»Wir gehen.«
Die Männer spazierten langsam über das Fallreep, kamen auf dem Kai an. Das Empfangskomitee hatte sich zeitgleich in Bewegung gesetzt. Angeführt wurde es von einem steinalten Notabeln. Er blieb vor Rheinberg stehen, musste zu dem deutlich größeren Mann aufblicken.
»Ich bin Domitius Modestus, Prätorianerpräfekt des Ostens und Vorsitzender des Konsistoriums«, erklärte er mit fester Stimme, die erstaunlich weit trug. Rheinberg verbeugte sich. Er hatte den höheren Rang, aber Seniorität im Amt wie im Alter wurde in Rom hoch geachtet. Er war der Jüngere, also hatte er Respekt zu zollen.
»Ihr seid Rheinberg«, sagte Modestus, bevor dieser etwas erwidern konnte.
»Das bin ich. Dies hier sind meine Begleiter: Militärpräfekt Renna, Senator Michellus und Magister Dahms aus meiner Mannschaft.«
Modestus ließ auf jedem kurz die Augen ruhen, dann wandte er sich an Renna.
»Eure Schwester ist die Frau des Lucius Graecus.«
Renna beugte seinen Kopf. »Ich hoffe, sie erfreut sich guter Gesundheit. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen.«
»Graecus passt gut auf sie auf«, erwiderte Modestus.
Renna hatte Rheinberg von seiner Schwester erzählt, die einen Offizier der Flotte geheiratet hatte und seitdem in Konstantinopel lebte. Rheinberg hatte ihm jede Freiheit gegeben, diese zu besuchen, und ihn von allen Formalitäten entbunden. Renna aber hatte darauf bestanden, zumindest die Begrüßungszeremonie mitzumachen, ehe er sich dezent verabschieden würde. Graecus war, wie Renna zuvor, Geschwaderkommandant im Rang eines Navarchen. Da Konstantinopel aber der Heimathafen fast der gesamten Flotte war, liefen hier zahlreiche Navarchen herum. Wo Renna im Westen noch eine relativ herausgehobene Stellung innegehabt hatte, ging sein alter Freund Graecus im Gewimmel hochstehender Offiziere förmlich unter. Zumindest würde er das immer erzählen.
»Wir haben ein Mahl im Palast bereitet«, erklärte Modestus. »Unterkünfte für all Eure Männer und ihre Familien. In dieser harten Zeit haben wir uns alle einige Annehmlichkeiten verdient. Morgen ist ein Rennen im Hippodrom geplant. Ihr seid alle Gäste der Stadt. Das Wetter ist trocken, nichts wird unser Vergnügen trüben. Ehe wir den Krieg planen, lasst uns Entspannung finden.«
Rheinberg verbeugte sich erneut. Die Logik des alten Mannes war bestechend. Zwar würden die Planungen, wenngleich informell, bereits zu Tisch beginnen und die entsprechenden Gespräche morgen im Hippodrom sicher nicht aufhören, aber das betraf ihn und den engeren Stab. Seine Mannschaft aber – einen Tag auf der Rennbahn würde niemand ablehnen. Das Hippodrom war ein Wahrzeichen der Stadt, ein soziales, ökonomisches und politisches Zentrum. Später, in einem Byzanz, das Rheinberg so zu verhindern trachtete, würden die Anhänger der verschiedenen Rennteams sogar mitentscheiden, wer Kaiser wurde und wer nicht.
»Eure Einladung ehrt mich. Wir freuen uns«, erwiderte Rheinberg.
»Dann wollen wir aufbrechen. Sänften stehen bereit. Der Legat hier wird Eure Leute einweisen und den Transport in die Unterkünfte vorbereiten. Sie sind alle in der Palastanlage zu finden. Ich bin mir sicher, Ihr wollt in der Nähe Eurer Männer bleiben.«
»Sehr umsichtig.«
»Hier, begleitet mich in meiner Sänfte, Heermeister.«
Rheinberg schob den Vorhang zur Seite und kletterte in die weichen Kissen. Modestus, schon gebrechlich, ließ sich von einem Sklaven helfen. So angenehm es war, in einer Sänfte zu reisen, so sehr war sie für Rheinberg das Sinnbild der Sklaverei, die noch überall in Rom herrschte. Er hatte nie ein gutes Gefühl dabei, wenn die Tragesklaven, kräftige Männer, die Sänfte hochnahmen und auf ihren Schultern durch die Stadt trugen, egal ob es die engen Gassen Triers oder jene Konstantinopels waren. In Trier hatte er diese Fortbewegung so oft vermieden, wie er konnte, was ihm aufgrund seiner Stellung recht leicht gefallen war. Hier aber war er erst einmal ein Gast. Er war angewiesen auf die Kooperation dieser Männer, Modestus allen voran. Er konnte es sich nicht leisten, gleich nach der Ankunft die Weltrevolution auszurufen.
Modestus war niemand, der zu höflicher Plauderei neigte. Tatsächlich wirkte er bedrückt und seine Schweigsamkeit verstärkte diesen Eindruck nur noch. Rheinberg war sich sicher, dass die allgemeine Lage und die schwierige Rolle des Ostens als Retter des Imperiums den Präfekten beschäftigten. Nicht zuletzt die Frage, welche Forderungen der gerade eingetroffene Heermeister stellen würde und welche Kraftanstrengungen notwendig sein würden, diese zu erfüllen.
Rheinberg hätte ihn beruhigen können. Er war nicht auf dem aktuellen Stand, was den Wiederaufbau der Armee im Osten anging. Seines Wissens lagerten die Reste des oströmischen Bewegungsheeres immer noch bei Thessaloniki, wo auch die neuen Rekruten zusammengezogen wurden. Er würde sich bald dorthin begeben, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Außerdem hatte er den jungen Godegisel bereits mit einer besonderen Mission beauftragt, die diesen in die Nähe der Stadt führen sollte. Wenn sie gelang, würde sich Rheinbergs militärische Position im Osten auf einen Schlag deutlich verbessern, ja sie würde ihn beinahe unüberwindbar machen.
Rheinberg versuchte, sich zu entspannen. Es fiel ihm schwer.
Die Zeit brannte ihm auf den Nägeln.
2
Potentia brannte.
Die Flammen schlugen hoch aus den Häusern, den Aufbauten der bewehrten Mauern. Dunkler Rauch tanzte in den Himmel, verwirbelte in der sanften Brise, ein weithin sichtbares Mahnmal der Zerstörung. Von der Anhöhe aus konnte man gut erkennen, wie ein anderes, dunkles Band sich wie ein endlos langer Wurm über den staubigen Boden wand. Die Karawane der Stadtbewohner, die sich mit ihren Habseligkeiten aus der Stadt absetzte. Potentia würde für lange Zeit nicht mehr ihre Heimat sein.
Theodosius senkte das Fernglas der Zeitenwanderer, verfluchte die Klarheit und die Schärfe, mit der das magische Glas ihm die Zerstörung der Provinzstadt nahe gebracht hatte. Die Verluste an Zivilbevölkerung waren gering, es hatte rechtzeitig Warnungen gegeben. Das eigentliche Ziel waren auch nicht die Häuser und Mauern Potentias, sondern die beiden großen Getreidespeicher der Stadt.
Theodosius hob den Feldstecher wieder an die Augen. Er wollte sich nicht um diesen Anblick drücken.
Er hatte den Befehl gegeben, Potentia in Flammen zu setzen.
Es war alles seine Schuld. Theodosius ging mit Schuld sehr sorgsam um. Der Tod seines Vaters, aber auch das, was er selbst in einer anderen Zeit, ebenfalls als Kaiser, getan hatte – all dies führte zu großer Konzentration beim Spanier. Er wollte erforschen, ob er der gleiche Mann war, der in Rage Tausende von Römern in Amphitheatern hinmetzeln ließ, oder ob er sich verändert hatte.
Wieder fokussierte er seinen Blick auf die sich langsam gen Süden davonmachende Karawane der Flüchtlinge. Viele dieser Menschen würden verhungern. Ihre Getreidevorräte standen in Flammen. Allerdings auch, wenn Theodosius vom Angriff auf Potentia abgesehen hätte, wäre es für die Bürger der Stadt nicht besser ausgegangen. Maximus hätte sich der Vorräte bemächtigt, um die eigenen Legionen zu versorgen. Theodosius’ eigene Truppen standen deutlich weiter südlich, als Lockmittel und Ablenkung. Das Kommandounternehmen, das die hellen Flammen ausgelöst hatte, die aus der Stadt loderten, war die Aktion einer Handvoll Soldaten gewesen.
»Maximus wird seine Pläne ändern müssen«, meinte Sedacius. Der Tribun stand neben ihm und starrte mit bloßem Auge auf das lodernde Feuer. Ihm war keine Gefühlsregung anzusehen. Auch dieser Offizier kannte die Notwendigkeiten der Kriegführung gegen den Usurpator. Theodosius nickte und senkte das Fernglas.
»Das war unsere Absicht. Wir kaufen Zeit. Es wird ihn aufhalten.«
»Ich bin immer noch der Ansicht, dass wir uns das Getreide selbst hätten nehmen sollen. Auch unsere Männer wollen verpflegt werden.«
Theodosius sah Sedacius an. Der andere Mann war gut zehn Jahre jünger als der frischgebackene Imperator, doch er hatte schon viel erlebt, verfügte über hohes Ansehen und hatte seine Männer gut im Griff. Er hatte im Osten die Hunnen gejagt und herausgefunden, dass Vorabteilungen der Barbaren viel näher bei Rom waren als erwartet. Die Zeit drängte, das Reich wieder zu einen und sich gegen die drohende Nemesis zu wappnen.
Hier sah er sich mit Sedacius einig.
Ansonsten aber misstraute er dem aufstrebenden Offizier.
»Wir haben es geschafft, die Brandstiftung Maximus in die Schuhe zu schieben«, entgegnete der Spanier ruhig. »Wenn wir Potentia geplündert hätten, wären wir die Schuldigen gewesen. Wir müssen eine Kluft zwischen Maximus und dem Volk graben und stetig erweitern. Dafür müssen wir auch Opfer bringen. Die Flüchtlinge werden exakt die Nachricht in Italien verbreiten, die wir hören möchten. Das ist der zentrale Punkt unserer Aktion.«
Sedacius erwiderte nichts. Er widersprach Theodosius oft, aber er akzeptierte es mit Gleichmut, von ihm in die Schranken gewiesen zu werden. Aus irgendeinem Grunde potenzierte dieses Verhalten das Misstrauen des Imperators nur noch mehr.
Theodosius ließ den Blick den Horizont entlangwandern. Das Fernglas gehörte zu den Errungenschaften der Zeitenwanderer, die ihn sofort überzeugt hatten. Und er fand schnell, was er mit fachkundigem Auge gesucht hatte: Auf einem Hügel, weit entfernt von ihrem derzeitigen Standort, tauchten kleine, schwarze Punkte auf, offenbar berittene Soldaten. Es musste sich um die Kundschafter des Maximus handeln. Es war überaus unwahrscheinlich, dass diese die kleine Abteilung des Spaniers entdecken würden. Sie verfügten nicht über Feldstecher.
»Wir ziehen uns zurück.« Damit wandte sich Theodosius ab. Sie schritten die Anhöhe hinab, wo einige weitere Männer mit den Pferden warteten.
Theodosius erinnerte sich an ein anderes Feuer, eines, das weitaus schmerzhafter gewesen war, wurde damit doch offenbar die Zukunft des Römischen Reiches in Asche verwandelt. Kurz bevor die Truppen des Maximus Ravenna erreicht hatten, kurz bevor die Armee des Theodosius, bestehend aus den Resten der verlorenen Schlacht gegen den Usurpator und eilig hinzugezogenen Verstärkungen, sich nach Süden hin abgesetzt hatte, war die »deutsche Stadt«, die um die Anlegestelle der Saarbrücken errichtete Siedlung, ebenfalls in Flammen gesetzt worden. Der Kleine Kreuzer, von dem man seitdem nichts mehr gehört hatte, war bereits vorher zusammen mit zwei der inzwischen fertiggestellten Dampfsegler nach Konstantinopel ausgewichen.
Man hatte länger ausharren können als erwartet, da der frühe Wintereinbruch den Vormarsch des Maximus etwas verlangsamt hatte. Vorräte waren gesammelt worden, Verbündete in Italien waren kontaktiert worden, Marschrouten geplant und festgelegt. Als Maximus schließlich mit wochenlanger Verzögerung zum Ende der Winterzeit unter großen Mühen Ravenna erreicht hatte, hatte der Rückzug bereits stattgefunden. Ravenna war kampflos gefallen, ebenso wie Rom und viele weitere norditalische Städte. Doch der Süden des Stiefels war immer noch mal mehr, mal weniger unter der Kontrolle des Maximus, und vor allem dann mal weniger, wenn die Truppen des Theodosius sich näherten. Jetzt, wo die ersten Anzeichen des Frühlings zu erwarten waren, würden die kriegerischen Aktivitäten an Intensität zunehmen.
Da man wusste, dass der Verräter von Klasewitz Maximus zu Diensten war, hatte man sich bemüht, dem selbst ernannten neuen Imperator die Werkzeuge aus der Hand zu schlagen, mit denen er leicht neues Waffengerät hätte erbauen können. Und so waren vor dem Verlassen Ravennas die Werkhallen und Schulräume in Brand gesetzt worden. Theodosius führte eine Reihe der von den Deutschen ausgebildeten Werkmeister in seinem Tross mit sich, aber der massive Verlust, den das Reich durch diese leider notwendige Tat erlitten hatte, war kaum zu beschreiben. War Maximus einst bezwungen, würde man alles von Neuem aufbauen müssen.
Oder er tat es selbst. Tatsächlich gingen alle davon aus, dass von Klasewitz exakt das bewerkstelligen würde.
Aber dies bedurfte der Zeit.
Theodosius schwang sich auf sein Pferd.
»Sobald wir bei den Legionen eingetroffen sind, müssen wir uns über unser weiteres Vorgehen klar werden«, erklärte er den wartenden Männern, allesamt Offiziere seines Stabes. »Maximus wird sich nicht lange aufhalten lassen. Wir sind ein böser Stachel in seinem Fleisch. Aber wir können andererseits die Flucht in Italien nicht ewig fortsetzen. Es muss für uns einen Ausweg geben.«
Sedacius beugte sich im Sattel vor. »Ich bleibe bei meinem Vorschlag, dass wir weiterhin Nadelstiche gegen mehrere Ziele gleichzeitig durchführen, die Legionen selbst aber nicht in eine große Feldschlacht führen. Wir müssen Maximus zwingen, seine Truppen aufzuteilen, sodass wir die Teile einzeln angreifen können. Dadurch können wir seinen Widerstand zermürben.«
Theodosius nickte. Der Vorschlag hatte etwas für sich. Nicht alle in seinem Stab fanden die Idee des Tribuns jedoch unterstützenswert. Der Aufstand des Maximus hatte in vielen seiner Männer den Reflex des Zurückschlagens ausgelöst, die Idee einer zweiten, großen Feldschlacht geboren. Doch obgleich der Kaiser eine kleine Abteilung der deutschen Infanteristen bei sich hatte, war doch klar, dass diese, nicht zuletzt aufgrund des Munitionsmangels, unter dem sie litten, nur noch begrenzt Hilfe leisten konnten. Die Zeit für ein abschließendes Kräftemessen mit Maximus war noch nicht gekommen.
»Wir warten auf Nachricht aus Konstantinopel. Wenn es Rheinberg gelingt, die Ostarmee zu reorganisieren und in den Westen zu führen, sind unsere Chancen größer«, sagte er dann.
Sedacius tat wie immer: Er widersprach nicht, neigte den Kopf, akzeptierte anscheinend, dass der Kaiser die Entscheidung zu treffen hatte.
Theodosius blickte nach vorne, auf den staubigen Pfad, den sie nun langsam entlangritten.
Das Unwohlsein, das ihn in Gegenwart des Sedacius befiel, nahm in solchen Situationen körperliche Ausmaße an. Er wusste, dass er sich darum kümmern musste. Doch alles in ihm widerstrebte dem Gedanken, sich in dieser Situation mit möglichem internen Dissens auseinandersetzen zu müssen.
Theodosius’ Blick fiel auf den Zenturio Thomasius, einen engen Vertrauten des Tribuns. Er war ständig in seiner Nähe, aber schweigsam, und der Imperator wusste nicht, ob diese Schweigsamkeit etwas mit dem Respekt vor seiner kaiserlichen Person oder schlicht mit dem Charakter dieses Mannes zu tun hatte. Wenn er sprach, dann nur wenige Worte und oft leise. Es schien, als wolle er nicht gehört werden, niemandem auffallen, und doch weckte gerade das Interesse und Neugierde. Was man über den jungen Mann gehört hatte, war sehr vielversprechend, und Sedacius war nicht dafür bekannt, sich mit unfähigen Speichelleckern zu umgeben. Er forderte die Ansichten seiner Offiziere heraus, war bereit, Vorschläge anzuhören und seine eigene Meinung zu ändern. Damit hatte er, nach dem, was man so hörte, große Ähnlichkeit mit Maximus.
Vielleicht war das der Grund für Theodosius’ Misstrauen.
Der Tribun war dem Usurpator in vielen Dingen ähnlich, vor allem in einigen positiven Charaktereigenschaften, die auch seine Gegner nicht bestreiten würden. Und es wies auf die eigene, oft unbeherrschte und barsche Art hin, mit der der aufbrausende Theodosius mitunter seine Untergebenen abfertigte. Zwar wurde dies als Privileg des Imperators gemeinhin akzeptiert – von manchen möglicherweise sogar erwartet –, aber es half nicht sehr dabei, Loyalität zu erzeugen.
Und Loyalität war in diesen Zeiten ein kostbares Gut.
Theodosius blickte Thomasius weiter an. Dieser hob den Kopf, begegnete dem kaiserlichen Blick, senkte die Augen fast unvermittelt wieder. Der Zenturio bot keine Angriffsfläche für einen Wutausbruch und er bot keinen Anhaltspunkt, um sich wirklich eine Meinung zu bilden.
Wenn überhaupt, dann war dieses Verhalten am ehesten dazu geeignet, Theodosius’ Unbehagen noch zu verstärken.
3
»Wir haben letztlich zwei Möglichkeiten«, murmelte Sedacius und stocherte mit einem Zweig im Lagerfeuer herum, um die Glut wieder anzufachen. Levantus schob ein Holzscheit in die Flammen und sorgte dafür, dass die einzige Wärmequelle nicht ausging. Volkert hielt dem Feuer die Handflächen entgegen. Es war eine kalte Nacht und es hatte sich bereits Bodenfrost gebildet – und das in der Südhälfte Italiens. Es würde ein strenger und unbarmherziger Winter werden. Secundus, der Vierte im Bunde, schaute in die Flammen und hielt einen Becher mit erhitztem Wein in Händen. Niemand sagte etwas. Sie hatten dieses Wachfeuer etwas abseits des Lagers gewählt, um ungestört sprechen zu können. Dennoch waren ihre Stimmen gedämpft und sie alle sahen sich immer wieder unwillkürlich um. Vorsicht war angebracht.
Sie unterhielten sich über Hochverrat.
Volkert fühlte sich unwohl dabei. Aber er wusste nicht mehr, welche Alternativen ihm noch blieben, außer den Befehlen zu folgen.
Sedacius fuhr fort.
»Der Winter wird sowohl die Bewegungsfähigkeit des Maximus einschränken wie auch die unsere. Theodosius hat einen guten Plan entwickelt, um den Usurpator trotzdem beschäftigt zu halten, und ich unterstütze ihn. Sobald die Aktion beginnt und die Männer unterwegs sind, sollten wir aber eine Entscheidung getroffen haben. Entweder wir attackieren Theodosius sofort und rufen mich zum neuen Imperator aus oder wir warten, bis Maximus erledigt ist. Was ist Eure Meinung?«
Volkert wusste, dass der Tribun diese letzte Frage ernst meinte. Sedacius wollte Ratschläge. Er hatte die Angewohnheit, Ideen hin und her zu wälzen. Er achtete die Meinung anderer. Er war dabei nicht halb so herrisch und ungnädig wie Theodosius, wenn ihm jemand widersprach.
Dennoch dauerte es eine Weile, bis jemand aus der Runde das Wort ergriff.
»Ich bin für die erste Option, Herr«, meinte der alte Levantus, der nur deswegen noch nicht mehr war als ein Zenturio, weil es keine angemessene Dienstposition für ihn gab. Volkert, selbst gerade erst befördert, würde sich niemals anmaßen, die gleiche Autorität zu reklamieren wie der Veteran. »Wenn wir es schaffen, Theodosius mit unseren Bundesgenossen zu stürzen und Euch, Sedacius, sogleich als Imperator zu installieren, geht der Wechsel glatt vonstatten. Rheinberg wird uns anerkennen müssen, denn es bleibt ihm keine andere Wahl, will er Maximus besiegen. Außerdem ist Theodosius, haben wir Maximus erst bezwungen, in einer ungleich stärkeren Stellung als jetzt. Es wird nicht nur schwerer sein, ihn zu stürzen, sein Sturz wird auch viel schneller Widerstand hervorrufen. Wenn wir jetzt entschieden handeln, dann zu einer Zeit, zu der es ihm noch an Sympathisanten, an einer Hausmacht fehlt.«
Damit hatte der alte Mann alles gesagt. Er würde auch keine großen Anstrengungen unternehmen, seine Position zu verteidigen, so gut kannte Volkert ihn mittlerweile. Levantus war der Auffassung, dass sein Wort entweder überzeugte oder nicht und dass es in beiden Fällen keiner zusätzlichen Anstrengungen seinerseits bedurfte.
Secundus fühlte sich erkennbar unwohl, als sich nun die Blicke auf ihn richteten. Er war, genauso wie sein Freund Volkert, erst kürzlich befördert worden und hatte sich noch nicht richtig darin eingerichtet, ein Mitglied des engeren Verschwörerzirkels zu sein. Im Gegensatz zu Volkert plagten ihn aber keine Skrupel: Der langjährige Spieler, der seine Geldsorgen mit allerlei kleinen Gaunereien finanzierte, sah eine Möglichkeit, wenn sie sich ihm eröffnete, und war jederzeit bereit, dafür auch ein Risiko einzugehen. Sollte der Plan des Sedacius aufgehen, würde Secundus die Karriereleiter hinauffallen, egal ob bei Hofe oder in einer Provinz. Dadurch würden sich wunderbare Möglichkeiten ergeben, schnell Geld zu machen und es noch schneller für große Genüsse auszugeben, und diese Aussicht alleine machte Secundus zu einem loyalen Mitstreiter.
Volkert beneidete ihn um sein simples Weltbild. Er wünschte sich manchmal, ein ähnliches entwickeln zu können.
»Ich bin für die zweite Lösung, Herr«, sagte Secundus schließlich. »Wenn wir Theodosius jetzt stürzen, wird Maximus dies als Schwäche ansehen und das nicht zu Unrecht. Es wird große Unruhe in die Truppe bringen und Ungewissheit auslösen, vielleicht sogar Desertionen nach sich ziehen. Wir würden dann die zentrale Aufgabe möglicherweise nicht mehr richtig ausführen können, die uns bleibt: Maximus zu besiegen. Natürlich wird es später ungleich schwieriger sein, Theodosius zu stürzen, aber wir hätten auch mehr Zeit, Bundesgenossen zu finden und uns richtig vorzubereiten.«
»Oder entdeckt und hingerichtet zu werden«, gab Volkert unwillkürlich zu bedenken. Sedacius sah ihn an. »Sprich, Zenturio. Du folgst der Ansicht des Levantus?«
Volkert machte eine verneinende Geste. »Nein.«
»So sprichst du trotz des Risikos für Secundus.«
»Nein.«
Sedacius lächelte, als hätte er etwas in der Art erwartet. »Ich höre.«
Volkert seufzte tief auf und stocherte für einen Moment im wieder hell und wärmend flackernden Wachfeuer.
»Wir können Theodosius nicht sofort stürzen, weil Sedacius dann als übler Verräter dastehen würde. Theodosius ist derzeit eine von allen mit großen Hoffnungen beladene Gestalt und er trägt diese Hoffnungen mit einer gewissen Würde. Egal wie viele Unterstützer wir jetzt haben, Sedacius hätte bei Amtsantritt nur eines: Blut an den Händen.«
Stille beantwortete seine Worte. Sedacius sah ernst drein, nachdenklich. Levantus hatte die Augen zusammengekniffen und bei Volkerts letzten Worten sanft genickt.
»Wir können andererseits auch nicht zu lange warten«, meinte Volkert nun. »Wenn wir Maximus geschlagen haben, ist Theodosius zwar nicht unangreifbar, aber wir werden möglicherweise einen weiteren Bürgerkrieg provozieren – und Rheinberg könnte auf die Idee kommen, im Osten einen eigenen Kaiser auszurufen.«
»Sich selbst«, meinte Secundus.
»Das glaube ich nicht«, erwiderte Volkert, erläuterte allerdings nicht weiter, woher er diese Gewissheit hatte. Er war froh, dass ihn auch niemand nach den Gründen für seine Einschätzung fragte, denn er hätte große Probleme gehabt, diese darzulegen, ohne seine wahre Herkunft zu enthüllen.
»Wenn es so ist – und ich bezweifle dies nicht –, was ist dann die richtige Vorgehensweise?«, fragte Secundus.
»Es geht um den richtigen Zeitpunkt. Die Ostarmee muss Maximus bereits übel zusetzen, aber er darf noch nicht geschlagen worden sein. Es muss auf der Kippe stehen. Dann kann Theodosius schnell beseitigt werden. Seine Anhänger wird man vor die Wahl stellen: Entweder ihr beginnt jetzt einen Bürgerkrieg und spielt damit Maximus in die Hände oder ihr seid mit uns und werdet in Amt und Würden bleiben. Ich möchte annehmen, dass ein guter Teil der Parteigänger des Theodosius bereit sein wird, über diese Wahl zumindest ernsthaft nachzudenken.«
Sedacius nickte nachdenklich. Er sah Levantus an, der die Lippen vor- und zurückschob.
»Der junge Thomasius hat recht«, meinte der Veteran schließlich und sah Volkert anerkennend an. »Wenn wir diesen Zeitpunkt abpassen und unsere eigene Basis an Unterstützern derweil mit großer Vorsicht erweitern, erhöhen wir unsere Chancen und minimieren das Risiko. Wir müssen nur auf der Hut sein, dass wir die Suche nach diesem Zeitpunkt nicht vernachlässigen, sondern immer im Blick haben.«
Sedacius lächelte und klopfte Volkert auf die Schulter. »Ich weiß schon, warum dieser Mann an meiner Seite reitet.«
Volkert blickte ins Feuer und sagte nichts. Stolz und Scham hielten sich bei ihm die Waage. Einmal mehr wünschte er sich die gleiche pragmatische Gier, wie Secundus sie besaß, der ihn anstrahlte.
»Welchen Posten stellst du dir vor, Thomasius, wenn Sedacius Kaiser ist und Maximus besiegt?«, fragte Levantus. »Es mag dir weit entfernt erscheinen, aber die Dinge entwickeln sich manchmal schneller als erwartet. Du solltest dir darüber Gedanken machen.«
Sedacius schlug in die gleiche Kerbe. »Levantus hier hat recht, junger Freund. Wenn wir den Sieg davongetragen haben, stehen dir zahlreiche Positionen offen. Die Beförderung zum Tribun? Möchtest du Dux werden oder Comes? Du machst dich sicher auch gut außerhalb der Armee, als hoher Verwaltungsbeamter! Oder du bleibst bei Hofe und dienst in einer herausragenden Stellung in meinem engsten Kreise. Mitglied des Konsistoriums? Prätorianerpräfekt?«
»Heermeister«, meinte Levantus. »Ich will das nicht werden.«
»Ich auch nicht«, erwiderte Volkert. »Wenn es geht, sollten wir Rheinberg überreden, den Posten zu behalten.«
»Kluger Mann«, lobte Sedacius. »Ja, wir müssen die Zeitenwanderer auf unsere Seite bringen, und dies zu erreichen, wird Rheinberg der Schlüssel sein.«
Volkert seufzte. »Die Provinz hört sich gut an, Tribun. Aber es gibt eine andere Sache, um die ich Euch bitten werde, wenn es so weit ist. Sie ist privater Natur. Ihr habt dann die Macht, dieses Problem für mich zu lösen. Ich werde es vorbringen, wenn die Zeit gekommen ist.«
Secundus lächelte wissend. Er war der Einzige, der genau über Volkerts private Sorgen mit Julia Bescheid wusste. Und er ahnte auch, was die Bitte seines Freundes sein würde: die Ehe mit Martinus Caius per kaiserlichem Dekret zu scheiden und damit Volkert die Möglichkeit zu eröffnen, ganz offen mit der Frau seines Herzens ein gemeinsames Leben aufzubauen – und ihrem Kind, das mittlerweile geboren sein musste.
Sedacius ergriff Volkerts Schulter. »Trag die Bitte vor, Zenturio, und ich will sie dir gewähren, das ist mein Versprechen. Und wenn es ein ruhiger Provinzposten sein soll, dann sei auch das versprochen.«
Volkert fühlte sich jetzt besser. Es war ihm egal, was für einen Posten er erhielt. Wenn Sedacius sein Versprechen wahr machen würde, ihm bei seinem Problem mit Julia zu helfen, dann war dies für ihn Ansporn genug, bei dessen Umsturzplänen mitzumachen.
Bei Weitem genug Ansporn.
4
Freiherr von Klasewitz erinnerte sich gut an Ravenna, hatte er die Stadt, wenngleich etwas überstürzt, doch vor nicht allzu langer Zeit erst verlassen. Seine Rückkehr war die eines Siegers, aber ihr fehlte der Triumph. Als er durch die verkohlten Reste des »deutschen Dorfes« gestapft war, bis hin zur Küste und dem langen Pier, an dem einst die Saarbrücken vertäut worden war, hielt sich seine Freude doch sehr in Grenzen.
Britannien war weit, sehr weit. Und Maximus, nun Imperator, verlangte nach weiteren Kanonen. Ein verständliches Verlangen, hatten die Batterien des Freiherrn während der Schlacht gegen Gratians Truppen doch nicht unerheblichen Schaden angerichtet. Und von Klasewitz musste Kanonen liefern, denn von diesen hing unter anderem ab, wie weit er sich in der Gunst des Imperators halten konnte, um seine eigene Chance abzuwarten und zu ergreifen.
Seine Hoffnung war es gewesen, zumindest einige der Anlagen von Dahms übernehmen zu können, um dort die Produktion wieder zu beginnen. Diese Hoffnung hatte sich nun zerschlagen. Der Verräter gab zu, dass er seine ehemaligen Kameraden da unterschätzt hatte, ganz gewaltig sogar. Andererseits hatte es ja auch andere Pläne für die Mannschaft der Saarbrücken gegeben, ein Giftanschlag war vorgesehen gewesen. Bis heute hatte man nicht herausfinden können, woran dieser Plan eigentlich gescheitert war. Fakt war, dass der Kleine Kreuzer unbehelligt abgelegt hatte, begleitet von nunmehr insgesamt drei weiteren der neuen Dampfsegler. Der letzte hatte wie zum Hohn weiße Dampfwolken in den Himmel gestoßen, als die Truppen des Maximus bereits in Ravenna einmarschiert waren. Er würde die Kunde vom Fall der Stadt mittlerweile sicher nach Konstantinopel gebracht haben.
Von Klasewitz gestattete sich ein Lächeln. Nicht dass dies Rheinberg jetzt noch sehr viel nützen würde. Maximus hatte sich einmal mehr als sehr weitblickender Stratege erwiesen. Wenn alles klappte, würde sich die Inbesitznahme des Kleinen Kreuzers nur um einige Wochen verzögern, bestenfalls Monate.
Von Klasewitz respektierte die Arbeit von Dahms. Insbesondere die Entwicklung der Dampfsegler war eine ganz ausgezeichnete Leistung gewesen. Obgleich die gelegten Feuer viel vernichtet hatten, waren den Angreifern doch Konstruktionsunterlagen in die Hände gefallen, offenbar aus einem früheren Planungsstadium, sodass sie unabsichtlich bei der Vernichtungsaktion übersehen worden waren. Für den Freiherrn eine ausgezeichnete Grundlage für die eigene Arbeit. Maximus hatte ihm das Kommando über die rauchenden Ruinen gegeben und den Auftrag, zu tun, was getan werden musste. Er selbst war damit beschäftigt, seine Position im Osten zu sichern – soweit man da von einer Sicherung reden konnte, denn bis auf einige voreilige Schleimer hatte sich dort noch niemand offen für Maximus erklärt – und vor allem den »Gegenkaiser« Theodosius zu jagen. Und das erwies sich als ausgesprochene Herausforderung, speziell im einbrechenden Winter, der hart sein würde, hart und lang. Keine guten Voraussetzungen.
Daher wollte Maximus mehr Kanonen.
Und der Freiherr hatte ein Problem. Er konnte natürlich die Manufaktur in Britannien auseinanderbauen und dann hierher schaffen lassen. Tatsächlich hatte er bereits entsprechende Befehle erteilt. Aber hier nur zu warten, bis das Wetter es zuließ, dass die Transportschiffe den Kanal überquerten, würde beim Imperator keine große Freude auslösen. Und zumindest derzeit war es noch so, dass alles, was Maximus nicht erfreute, auch ihm, dem Verräter, zu missfallen hatte, ob er nun wollte oder nicht.
Von Klasewitz stand immer noch am Pier und blickte auf das aufgewühlte Mittelmeer, als sich jemand zu ihm gesellte. Der Wind war frisch, fast schon stürmisch, und er war kalt. Der Freiherr fühlte für einen Moment die unbestimmte Sehnsucht in sich, all dies hinter sich zu lassen, um wieder die schwankenden Metallplatten eines Schiffes, eines richtigen Schiffes unter den Füßen zu spüren.
Er sah sich um, als er die Schritte des Neuankömmlings vernahm. Nein, es waren gleich mehrere, aber sie stellten keinerlei Bedrohung dar, zumindest nicht im körperlichen Sinne. Es waren drei Priester, einer davon ein ganz besonderer: Ambrosius von Mailand, der Mann mit dem schiefen Gesicht, dessen sorgfältige Manipulation der Bürger Roms dazu beigetragen hatte, Maximus’ Eroberung Galliens und Norditaliens so einfach zu machen.
Von Klasewitz fühlte sich in der Gegenwart dieses Mannes, der zu seiner Zeit als Kirchenvater und Heiliger verehrt wurde, immer etwas kleiner als sonst. Anderen Römern, selbst Maximus, trat er mit der Haltung von Überlegenheit gegenüber, auch wenn er diese nicht immer zeigte. Ambrosius aber schüchterte ihn ein.
Der Bischof stellte sich neben den Zeitreisenden, blickte aufs Meer und holte tief Luft. Seine beiden Begleiter blieben in einem respektvollen Abstand zurück.
»Ein trauriger Anblick«, sagte Ambrosius leise. »Die Ruinen lassen erahnen, welches Potenzial hier verloren gegangen ist. Aber es hat etwas Gutes.«
»Ja?«, fragte von Klasewitz.
»Wir haben unser Versprechen eingehalten und die unheiligen Stätten der Zeitenwanderer mit Feuer gereinigt. In der Tat haben wir die Zeitenwanderer sogar dazu getrieben, es selbst zu tun. Es ist gut, denn es ist ein Fanal für Maximus, ein deutliches Zeichen dafür, dass Gott auf unserer Seite streitet.«
Der Freiherr schwieg dazu lieber. Bei aller Ehrfurcht, die er in der Gegenwart des Bischofs empfand, wusste er doch, dass vieles von dem, was Ambrosius hier von sich gab, letztlich nur abergläubisches Zeug war. Er ging zudem davon aus, dass der Bischof selbst nicht die Hälfte von dem glaubte, was er da sagte, sondern alles tat, um die Festigung seiner Interpretation des christlichen Glaubens im Sinne einer Staatskirche zu befördern. Wenn dafür jemand oder etwas brennen musste, war dies in Kauf zu nehmen.
Da dieser Weg unter anderem auch dazu führte, für von Klasewitz Amt und Ansehen zu befördern, hatte er grundsätzlich erst einmal nichts gegen diese Vorgehensweise einzuwenden. Nur führte es in diesem Fall dazu, dass er vor einer monumentalen Aufgabe des Wiederaufbaus stand, die ihn den ganzen Winter über beschäftigen würde.
Ambrosius schien diese Gedanken in seinem Gesicht gelesen zu haben. Er lächelte begütigend.
»Mein Freund, verzagt nicht. Ich möchte damit nur sagen, dass es möglicherweise besser wäre, die eigene Manufaktur für Hexenwaffen nicht an diesem Ort zu errichten, sondern woanders, an einer geheimen Stelle, schwerer zugänglich und nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit, dass ihre Existenz zu … Missverständnissen führen könnte.«
»Ich verstehe«, erwiderte von Klasewitz und neigte den Kopf. Er verstand durchaus, worauf der Mann hinauswollte, wenngleich es ihm weniger passte, als er sich zugestehen wollte. Er musste so nahe am Meer bleiben wie möglich, da er gerade für die Kanonen noch eine zusätzliche Form der Mobilität anstrebte. Und trotz der Zerstörungen, die hier angerichtet worden waren, konnte man darauf viel besser eine neue Produktionsstätte errichten, als irgendwo gänzlich neu anzufangen. Die steinernen Fundamente der wichtigsten Gebäude standen. Von Klasewitz hatte die Absicht, sie für den Wiederaufbau zu nutzen.
»Ich würde also an Eurer Stelle nach einem geeigneten Ort suchen«, fuhr Ambrosius fort. »Ich werde dabei gerne behilflich sein, wenn Ihr es wünscht.«
»Maximus wird das letzte Wort haben wollen.« Und der Freiherr würde dafür sorgen, dass es in seinem Sinne ausfiel.
Der Bischof lächelte. »Der Kaiser ist beschäftigt. Er wird einem wohl formulierten und vorbereiteten Vorschlag gerne zustimmen.«
Von Klasewitz drehte sich um, sodass er Ambrosius direkt zugewandt war. Er wusste, dass er das Ohr des Maximus hatte, wenn es drauf ankam, ganz egal, womit dieser beschäftigt war. Dem Bischof war dies gleichfalls bekannt.
»Das ist sicher richtig«, meinte er vorsichtig. »Woher Euer plötzliches Interesse an diesen Dingen?«
Ambrosius lächelte immer noch. »Ich muss weit denken, von Klasewitz. Maximus wird über Theodosius siegen, daran besteht kein Zweifel. Ich muss danach darauf achten, dass alles, was die Zeitenwanderer an Neuerungen bringen, so in unser Leben eingeführt wird, dass es nicht den Geruch der Häresie mit sich trägt. Ich muss sicherstellen, dass die Kirche offiziell absegnet und sanktioniert, was wir aus der Zukunft in unsere Gegenwart übernehmen. Es wäre zum Besten für den Frieden im Reich und natürlich …«
Er machte eine unbestimmte Handbewegung und der Freiherr verstand. Wenn es der Kirche gelang, die Deutungshoheit über die richtige und falsche Nutzung der Technologie aus der Zukunft zu erlangen, konnte sie nicht bloß die scheinbaren und propagierten Widersprüche miteinander vereinen – und sei es auch nur durch stundenlanges, gewundenes Geschwurbel –, sondern würde zudem die eigene Machtstellung bis ins Unabsehbare stärken.
Der Freiherr unterdrückte ein Lächeln. Er brauchte die Hilfe des Bischofs, aber er hatte keinesfalls die Absicht, sich zu seinem Erfüllungsgehilfen zu machen. Tatsächlich wäre es ihm viel lieber, wenn das Verhältnis genau umgekehrt sein würde. Denn letztlich hatte ja auch von Klasewitz so seine Pläne.
»In der Zukunft, edler Bischof, gar nicht so viele Jahre von hier, in einer Epoche, die die Geschichtsgelehrten meiner Zeit das Mittelalter nennen, konnte die Kirche auf eigene Streitkräfte zurückgreifen, Ritterorden etwa, die den Führern der Kirche zu Gebote standen und bereit waren, unabhängig vom Willen mancher Könige und Kaiser die Politik des Heiligen Stuhls durchzusetzen.«
Ambrosius nickte. »Der Heilige Stuhl, ja. Ich sehe dies gleichfalls als sehr wichtig an. Maximus wird sich mit dem Papst ins Benehmen setzen und ich unterstütze dies aus ganzem Herzen.«
Die Idee des Papsttums musste für ihn konsequent und natürlich erscheinen, dachte der Freiherr. Möglicherweise würde es jetzt schneller zur Zementierung der Macht des Papstes kommen als in der Vergangenheit des von Klasewitz. Der aktuelle Bischof von Rom, ein Mann namens Siricius, trug bereits den Titel, verfügte aber noch nicht über die herausragende Stellung seiner Nachfolger für die gesamte Kirche. Siricius hatte sich während der Entwicklungen der letzten Monate interessanterweise sehr bedeckt gehalten. Von Klasewitz vermutete, dass er Ambrosius insgeheim unterstützte und bestärkte, selbst jedoch eine scheinbar neutrale Stellung bewahrte, um für die Fährnisse politischer Umschwünge gewappnet zu sein und nicht aus Versehen auf das falsche Pferd zu setzen. Der Freiherr machte sich eine mentale Notiz, die Rolle des Siricius einer näheren Begutachtung zu unterziehen, wenn es an der Zeit war. Das Gerücht besagte, dass Maximus mit seiner Armee in der Nähe Roms überwintern wolle, da die Durchführung eines richtigen Feldzuges gegen Theodosius aufgrund der Witterungsverhältnisse immer schwieriger wurde. Wenn sich der Kaiser bei Rom aufhielt, würde der Papst mit großer Wahrscheinlichkeit stärker in den Brennpunkt der Ereignisse rücken. Soweit von Klasewitz gehört hatte, war Siricius bislang vor allem kirchenintern, durch die engere Fassung von Liturgie- und Taufvorschriften, in Erscheinung getreten.
Ambrosius war hier der Politiker, nicht der Bischof von Rom.
»Ich danke Euch jedenfalls für all die Hilfe, die Ihr mir geben wollt«, erklärte von Klasewitz. »Wenn Ihr weiteren Rat für mich habt, will ich ihn gerne hören.« Er hoffte, damit Ambrosius ausreichend signalisiert zu haben, dass er weiterhin der Herr über die eigenen Entscheidungen zu bleiben gedachte, ohne allzu unhöflich zu wirken.
»Ihr habt Euch bemerkenswert gut in unserer Gesellschaft eingelebt. Die seltsame Mischung aus Umstürzlern und Frömmlern ist nicht immer leicht zu ertragen«, erwiderte Ambrosius unvermittelt und mit einem Lächeln. Der Bischof neigte normalerweise nur dann zur Ironie, wenn er sie gegen seine Gegner wenden konnte. Der Freiherr fühlte sich wie in einer Prüfung.
»Wer ein Umstürzler ist und wer die rechtmäßige Ordnung repräsentiert, entscheidet sich immer entsprechend des Ausgangs der Auseinandersetzung. Der Sieger schreibt die Geschichte«, sagte er.
Ambrosius machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Wir sind in Rom, Zeitenwanderer. Hier werden Kaiser mittlerweile fast nach Belieben gestürzt. Wer rechtmäßig an sein Amt gekommen ist und wer nicht, ist schon beinahe nebensächlich. In einem hat Rheinberg recht: Es kommt auf das verbindende Band des Reiches an, nicht so sehr darauf, wer dieses Band knüpft. Die Idee, nicht der Mann.«
»Und die Kirche«, betonte von Klasewitz. »Denn letztlich muss es die Kirche sein, die durch den Glauben alles zusammenhält.«
Ambrosius nickte gefällig. »So ist es. Ohne die Kirche ist alles nichts. Dann wären wir Barbaren. Wir wären nicht besser und nicht mehr als die Parther oder irgendwelche Germanenhäuptlinge.«
Er sah von Klasewitz an. »Entschuldigt, sollte ich Euch damit beleidigt haben.«
Der Freiherr hob abwehrend die Hände. »Aber nein. Meine Vorfahren täten gut daran, sich mehr am Imperium zu orientieren, in Denken, Handeln und …«, er rümpfte die Nase, »… Reinlichkeit und Aussehen.«
Ambrosius lachte auf und klatschte in die Hände. Von Klasewitz wusste, dass er seinen Vorfahren damit wahrscheinlich Unrecht tat, vor allem, weil er bis auf die schon weitgehend romanisierten Alanen, die ja innerhalb des Staatsgebietes lebten, bisher noch keine echten »wilden« Germanen kennengelernt hatte. Er verspürte allerdings auch kein unmittelbares Bedürfnis, dies zu ändern. Es war schlimm genug, mit den Römern klarzukommen, die sich für den Höhepunkt der Zivilisation hielten. Für einen Moment wunderte sich von Klasewitz darüber, was die zeitgenössischen Chinesen wohl zu den Römern und ihrer Zivilisation sagen würden.
»Ihr werdet es weit bringen, Zeitenwanderer. Ihr seid ein gutes Beispiel dafür, dass auch die Männer, die derzeit Rheinberg folgen, nicht ohne Chance sind, Vergebung zu erfahren und ein friedliches und nutzbringendes Leben in dieser Zeit zu führen.«
Von Klasewitz neigte den Kopf.
»Nun, ich …«
»Herr!«
Die beiden Männer drehten sich um. Ein Zenturio kam auf sie zugelaufen. Etwas weiter hinter ihm waren zwei weitere Soldaten stehen geblieben, die offenbar einen Gefangenen gemacht hatten. Es gab, ob man es glauben wollte oder nicht, Widerstandsnester in und um Ravenna, geführt von jenen, denen es unter Rheinberg besser gegangen war. Viele waren geflohen, doch einige waren der irrsinnigen Auffassung, etwas gegen die »Besatzer« ausrichten zu können. Hier, auf diesem Ruinenfeld, war von Klasewitz der höchste Befehlshaber und diese zweifelhafte Ehre führte dazu, dass er sich um solche armseligen Gestalten zu kümmern hatte.
Der Freiherr seufzte und sah Ambrosius entschuldigend an. Dann setzte er sich in Bewegung.
Der Zenturio eilte an seine Seite. »Man hat ihn verletzt aufgefunden, er lag wohl tagelang in einem erbärmlichen Zustand darnieder. Eine Familie hat ihn gepflegt, weil er ihr dafür eine Belohnung versprochen hat. Als er aufwachte und nicht zahlen konnte, rief man die Wache.«
Von Klasewitz runzelte die Stirn. Das klang nicht nach dem üblichen gefangenen Aufrührer.
»Er verlangte, Euch zu sehen!«, fügte der Legionär hinzu.
Das klang sogar ganz und gar nicht nach irgendeinem Gefangenen.
Dann hatten sie den Mann erreicht. Er war mehr oder weniger in Lumpen gekleidet und man sah die Narben leichter Verbrennungsverletzungen. Er trug seine Haare wild, hatte einen Bart und wirkte alles in allem sehr heruntergekommen. Von Klasewitz öffnete bereits den Mund, um ihn anzusprechen, dann aber hob er seine rechte Hand, fasste dem Mann unter den gesenkten Kopf und betrachtete ihn eingehend. Schließlich schüttelte er den Kopf.
»Lasst ihn los!«, befahl er. Die verdutzten Legionäre gehorchten. Der Gefangene stöhnte und hielt dem Zenturio die gefesselten Hände entgegen. Von Klasewitz nickte.
»Löst die Fesseln!« Der Zenturio zog ein Messer und durchschnitt die Lederbänder. Der Gefangene rieb sich die Handgelenke, dann zeigte er ein schwaches Lächeln.
»Danke«, sagte er schließlich.
Von Klasewitz sah die abgerissene Gestalt in Ruhe an, dann schüttelte er den Kopf.
»Tennberg, was ist nur mit Ihnen passiert?«
Fähnrich Markus Tennberg lächelte schief.
»Das ist eine lange Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen werde. Aber besteht vorher irgendeine Möglichkeit, dass ich mich waschen und umziehen kann? Ich stinke.«
5
Es war kalt.
Es war richtig kalt.
Neumann kniete auf dem etwas bröckeligen Boden, der ebenfalls Kälte ausstrahlte. Es war tiefe Nacht und ein sternenklarer Himmel erhellte das Plateau mit einem schwachen Lichtschein. Ein aufgehender Mond half, die Szenerie zu beleuchten. Neumann hätte im Zelt liegen und tief und fest schlafen können, doch die Höhenluft bekam ihm nicht gut. Er litt unter Schlaflosigkeit, wachte immer wieder auf, weil sein Körper annahm, er würde nicht genug Sauerstoff bekommen. Er musste an sich halten, nicht zu hyperventilieren, und nach einigen vergeblichen Versuchen, doch noch Schlaf zu finden, hatte er es aufgegeben.
Große Gefahren lauerten hier nicht, von den wenigen wilden Tieren einmal abgesehen. Eine Wache hatten sie zwar aufgestellt, doch der Mann döste über seinem Feuer, als Neumann aus dem Zelt gekrochen kam. Die Kälte machte den Arzt wach. Er sehnte sich das Ende dieses Ausflugs herbei. Köhler und Behrens kamen mit der dünnen Luft weitaus besser zurecht. Er würde sie das nächste Mal alleine losschicken.