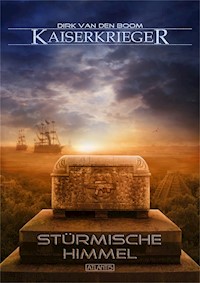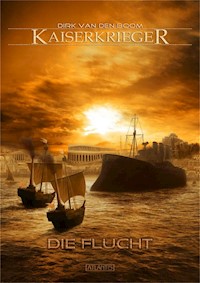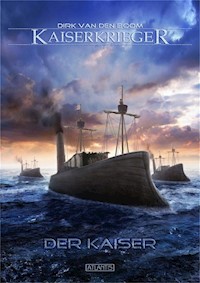
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Verrat, Seuchen, Niederlagen – die Liste der Probleme für die Mannschaft der Saarbrücken ist schier endlos. Jetzt läuft alles auf die Frage hinaus, wer in diesem Konflikt letztendlich die Oberhand behalten wird. Alle Mächte sind in Position, haben ihre Karten ausgespielt und sind zuversichtlich, dass sie den Sieg davontragen werden. Am Ende, das wissen Gegner wie Freunde der Zeitreisenden, wird nur einer übrig bleiben, der sich mit Recht Kaiser nennen darf. Doch bis dahin ist es noch ein langer und sehr blutiger Weg, der manche Überraschung mit sich bringen und viele Leben kosten wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Epilog
Nachwort
Personenverzeichnis
Weitere Atlantis-Titel
1
Volkert hatte es für sich behalten.
Außer ihm hatte es ja auch keiner gehört.
Als er festen Boden betrat, die breite Laufplanke verließ und hinauf in den Himmel starrte, beschattete er seine Augen mit der rechten Hand. Er machte einen Schritt beiseite, um der Kolonne von Legionären Platz zu machen, die unter dem Kommando von Secundus das Transportschiff zu verlassen begannen. Es herrschte eine heitere Stimmung, fast ausgelassen. Nicht nur hatte man das Mittelmeer bezwungen, nein, auch eine Piratenflotte hatte das Nachsehen gehabt. Es gab wunderbare Geschichten zu erzählen, wenn man sich erst im neuen Feldlager auf afrikanischem Boden eingerichtet hatte.
Die wunderbarste Geschichte von allen trug Volkert bei sich. Und er musste sie für sich behalten, denn obgleich er der Auffassung war, dass Rheinberg sie hören musste, fand er keinen Weg, sie ihm mitzuteilen, ohne seine mühsam erarbeitete Tarnung auffliegen zu lassen. Egal, wie er es drehte und wendete: Gäbe er all die Details an, die ihm notwendig erschienen, um glaubwürdig zu sein, wäre sein eigenes Schicksal besiegelt.
So behielt er es für sich und es löste massive Grübeleien aus.
Wie kam jemand der englischen Sprache mächtig in die Sklavenketten von Piraten? Volkert hatte jeden Vorwand gehabt, die Gefangenen zu verhören, doch das Ergebnis war völlig unbefriedigend geblieben. Der Mann war erworben worden auf einem Sklavenmarkt im Osten des Reiches, ganz legitim. Und woher dieser Sklavenhändler ihn hatte? Niemanden kümmerte es.
Volkert holte tief Luft und seufzte. Noch etwas, das er mit sich herumtragen musste. Die Lasten, die er schleppte, wurden nicht kleiner. Er bewegte seine Schultern, versuchte, die Verspannungen zu lösen. Als Tribun genoss er Privilegien. Niemand würde es ihm übel nehmen, wenn er nach der langen Seereise einen Tag freinahm und sich in den Badehäusern der Stadt Entspannung verschaffte. Außer ihm selbst.
Die Stadt, dabei handelte es sich um das nordafrikanische Hadrumentum. Soweit sich Volkert der offiziellen Seekarten des Mittelmeeres erinnerte, lag hier zu seiner Zeit – soweit er die Zukunft noch als »seine« Zeit zu betrachten mochte – die Stadt Sousse im von Frankreich beherrschten Kolonialgebiet. Es war eine sehr alte Stadt, hatte er sich belehren lassen, älter noch als Karthago, und vor allem würde sie, im Gegensatz zu ihrer berühmteren Schwester, die Jahrtausende überdauern und sich in die Neuzeit retten.
Jetzt war es ein betriebsamer Hafen, ein wichtiger Umschlagplatz für die Waren Afrikas, insbesondere des Getreides, das das gesamte Reich ernährte. Die Tatsache, dass Theodosius diesen Hafen – in Absprache mit den örtlichen Gouverneuren – zur Anlandung seiner Armee ausgewählt hatte, trug zur Hektik dieses Ortes noch mehr bei.
Sie waren erwartet worden. Offiziere berieten mit Secundus. Volkert sah es als notwendig an, sich mit der Betrachtung der Stadt nicht länger aufzuhalten, obgleich dies sein allererster Besuch auf afrikanischem Boden war. Als er sich zu den Männern gesellte, wurde ihm salutiert.
»Zenturio Rufus Argentius«, stellte sich einer der Männer vor. »Herr, die Truppen müssen sogleich weitermarschieren, es tut mir leid. Wir schlagen das Feldlager nicht direkt bei Hadrumentum auf, da wir den Handel nicht beeinträchtigen wollen. Wir gehen ein wenig weiter südlich und haben dort bereits mit der Arbeit am Lager begonnen. In Hippo Regius ziehen die afrikanischen Präfekten ihre Truppen zusammen. Sobald sie damit fertig sind, werden wir die Armeen vereinigen und wieder in Italien landen – oder Maximus hier erwarten, falls er so dumm sein sollte, uns zu folgen.«
Die selbstsichere Arroganz, die aus den Worten des Zenturios sprach, missfiel Volkert. Maximus hatte sich in der Vergangenheit nicht als Dummkopf erwiesen, warum sollte sich das jetzt geändert haben? Und wenn er übersetzte, dann ganz sicher mit ausreichender Zuversicht, diesen Angriff auch gewinnen zu können. Wer wusste, womit von Klasewitz in den letzten Wochen beschäftigt war und was er bis zu einer solchen Invasion fertigbringen würde?
Volkert unterdrückte sein Bedürfnis, den Mann zurechtzuweisen. Er sparte seine Kräfte lieber für den Marsch.
»Secundus, du organisierst das!«, befahl Volkert seinem Freund und dieser nickte beflissen. Dann wandte er sich wieder an den Zenturio.
»Es hat auf der Überfahrt einen Zwischenfall gegeben.«
»Ja, ich habe selbst schon gemerkt, dass mehr Schiffe als erwartet eingetroffen sind«, erwiderte Rufus lächelnd. »Es handelt sich wohl um Piraten, wie ich gehört habe.«
»Korrekt. Wir haben eine Prise, die ich dem Hafenkommandanten übergeben möchte. Darüber hinaus habe ich Gefangene, die ich ebenfalls loswerden möchte.«
»Ich werde alles veranlassen.«
»Die Gefangenen sind auf dem Getreideschiff unter Bewachung des Trierarchen. Er wird froh sein, wenn er sie bald los wird.«
»Bereits erledigt.«
Volkert nickte zufrieden. Er wandte sich mit einem Gruß ab und ging zum Kai zurück. Eine Pflicht wollte er selbst erledigen.
Die befreiten Rudersklaven der Piraten wurden bereits ans Ufer geführt. Sie sahen jetzt um einiges besser aus als zu dem Zeitpunkt, als sie befreit worden waren. Man hatte ihre Verwundungen behandelt, so gut es ging. Aus den Beständen der Piraten hatten sie alle ordentliche Kleidung erhalten sowie Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Es blieb jetzt nur noch die Verteilung des Handgeldes.
Volkert sah schweigend zu, wie ein Mann des Trierarchen die Kiste mit den Barmitteln der Piraten an Land schleppte und vor sich aufklappte. Volkert hatte befohlen, mit dem Handgeld großzügig zu sein. Die Männer stammten aus allen Teilen des Reiches und hatten möglicherweise einen langen Heimweg vor sich. Dies war das Mindeste, was er für sie tun konnte.
In den Augen der Befreiten sah Volkert Dankbarkeit und überdies ein wenig Überraschung, dass der Offizier sein großzügiges Versprechen tatsächlich einhielt – sie waren frei, sie hatten Münzen in den Taschen und ein Bündel für die Reise bei sich. Es war eine Wendung des Schicksals, die alle vor wenigen Wochen noch für völlig unmöglich gehalten hatten.
Einer der Männer trat auf Volkert zu, nachdem das Geld verteilt worden war. Niemand hatte sich über die Summe beschwert. Alle hatten es mit stiller, freudiger Demut in Empfang genommen.
»Herr, ich möchte mich im Namen meiner Kameraden hier erneut für Eure Güte bedanken. Wir werden Euren Namen auf ewig im Gedächtnis behalten und Gott bitten, Euch bei allem zu beschützen und zu belohnen. Wir alle sind einfache Männer, ohne Einfluss und Reichtum. Mehr als Gottes Segen für Euch zu erflehen, können wir nicht anbieten.«
Volkert lächelte, etwas verlegen vielleicht, aber angenehm berührt, ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr empfunden hatte.
»Ich akzeptiere euren Dank«, sagte er laut. Alles andere wäre respektlos gewesen. »Ich schicke euch alle mit meinen besten Wünschen auf die Reise und hoffe, dass ihr eure Familien wiedersehen werdet. Eure guten Wünsche nehme ich gerne an, denn der Krieg ist noch nicht vorbei und ich kann jeden guten Willen gebrauchen, der mir angeboten wird.«
Es gab noch ein wenig Gemurmel und es wurden Hände geschüttelt, Unterarm an Unterarm, wie es römische Sitte war. Dann, nach einem kurzen Moment, während dessen die Männer etwas unschlüssig an der Kaimauer standen, lösten sich die Gruppe langsam auf, fast zögerlich, als wollten einige immer noch nicht glauben, dass sie jetzt wirklich verschwinden durften.
Volkert blieb stehen, bis auch der letzte der Befreiten im Gewimmel des Hafens untergetaucht war. Manche würden auf schnellstem Wege die Heimreise antreten. Andere würden sich hier in Afrika eine neue Existenz aufbauen wollen, entwurzelt, wie sie oft waren. Und wieder andere würden die nächste Taverne aufsuchen oder ein Badehaus und das Handgeld im warmen Wasser der Bäder, in Gesellschaft weicher Brüste der Bademädchen und mit viel Wein und Essen verprassen.
Das war aber jetzt ihre eigene Entscheidung. Sie waren frei zu scheitern und frei, sich wieder zu berappeln und ihren Weg zu gehen. Mehr hatte Volkert nicht für sie tun können, und in gewisser Weise beneidete er diese Männer. Sie genossen, vielleicht nur für kurze Zeit, eine Freiheit, die er selbst schon lange nicht mehr gehabt hatte.
Volkerts Gefängnis mochte für diese armen Teufel vergoldet erscheinen und sie hätten seinen Neid nicht verstanden, ungläubig gelächelt, einen Scherz vermutet, so er sich entsprechend geäußert hätte.
Also behielt er es für sich.
Er spürte, wie jemand an ihn herantrat. Es war Bertius mit ihrem gemeinsamen Gepäck, bescheiden, wie es war, auf dem Rücken.
»Ja, Bertius«, sagte Volkert und nickte seinem Faktotum zu. »Es geht weiter.«
»Ihr seht besorgt aus, Herr.«
Bertius kannte Volkert gut, wahrscheinlich sogar zu gut. Er war außergewöhnlich verschwiegen, was gewisse Details anbetraf, aber hatte in seiner Fürsorglichkeit mitunter etwas allzu Mütterliches – nicht zuletzt deswegen, weil er damit von der Tatsache ablenken wollte, dass er seine Pflichten nicht immer so ernst nahm, wie es seiner Dienststellung gemäß zu erwarten wäre.
Was Volkert ihm nicht allzu oft unter die Nase rieb. Er hatte schließlich eine alte Schuld abzutragen, und diese Arbeit würde ein Leben lang dauern. Es war Bertius durchaus anzurechnen, dass er wiederum diese Tatsache ebenfalls nicht beständig in Erinnerung brachte.
Eigentlich sogar nie.
Volkert seufzte und sah Bertius an.
»Ich bin immer besorgt.«
»Das ist nur zu wahr.« Der Mann hob die eine Hand, die ihm geblieben war, und wackelte missbilligend mit dem Zeigefinger. »Das ist der Gesundheit nicht zuträglich, Herr.«
»Deswegen bist du auch ein Ausbund der Vitalität, mein Freund.«
Sollte der Satz Ironie enthalten haben, so entging sie Bertius völlig – oder er hatte beschlossen, sie zu ignorieren. Stattdessen hob er würdevoll eine der großen Reisetaschen seines Vorgesetzten und signalisierte damit, dass er den baldigen Aufbruch für notwendig hielt.
»Es geht weiter«, wiederholte der Germane, ohne dabei allzu sehr zu drängen.
Volkert schaute zurück aufs Meer, als ob ihn eine Sehnsucht dorthin zurücktriebe.
Dann nickte er seinem Faktotum zu.
Er hatte viele Sehnsüchte.
Die Flucht gehörte noch nicht dazu.
2
Theodosius, Kaiser von Rom, sah unglücklich aus.
Das hatte, so hoffte Rheinberg jedenfalls, nichts damit zu tun, dass er dem Magister Militium des Reiches die Hand schütteln und sich zu ihm in die enge Kapitänskajüte der Saarbrücken setzen musste.
Er ahnte aber zumindest, wo die Ursache des Kummers lag.
Die Pest.
Der Krieg.
Verrat und Intrige.
Das Übliche.
Der Kleine Kreuzer war gerade noch rechtzeitig in Süditalien eingetroffen, um dort die Reste der Armee zu beschützen, wie sie Schiffe bestiegen und sich gleichfalls daranmachten, nach Afrika überzusetzen. Der Kaiser selbst ließ es sich nicht nehmen, auf der Saarbrücken zu residieren, und sei es nur, um damit sein dauerhaftes Vertrauen in die Fähigkeiten des Heermeisters offen nach außen hin zu demonstrieren.
Dass dieser mit eingezogenem Schwanz von seiner Mission zurückgekehrt war, im Osten eine große Armee zu sammeln und gegen Maximus zu führen, schien diesen Akt der betonten Vertrautheit notwendig zu machen. Die unwichtige Kleinigkeit, dass im Osten des Reiches die Pest wütete und gar keine Armee zur Verfügung stand, die man hätte einsetzen können, war nichts, was kritische Geister von hämischen Kommentaren abhielt. All jene, die sich von der scheinbar unüberwindlichen Überlegenheit der Zeitenwanderer ein wenig an die Wand gespielt fühlten, hatten nun Oberwasser. Die Bemerkungen waren fein und spitz, immer in wohl geschwungenen Worten, niemals beleidigend, zumindest nicht richtig. Aber Rheinberg hatte mittlerweile gelernt, ein Ohr für Nuancen zu haben, und wenn er einmal den tieferen Sinn eines beiläufig hingeworfenen Satzes nicht begriff, so stand Aurelia bereit, ihm eine umfassende und erschöpfende Interpretation anzubieten. Die frühe Schwangerschaft seiner Gefährtin hatte erkennbare Auswirkungen auf ihre Stimmungslage, und Rheinberg war sich nicht sicher, ob das etwas Gutes war. Die latente, gefährliche Aggressivität der bezaubernden Aurelia kam nun, ergänzt durch einen radikalen Beschützerinstinkt, besonders zum Vorschein. Hätte man ihr die Möglichkeit gegeben, so wäre sie selbst an der Spitze eines Heeres gegen Maximus marschiert, nur um endlich anständig im Blut ihrer Feinde waten zu können.
Rheinberg war sehr froh, dass Aurelia ihn selbst zu ihren Freunden zählte.
Und er war froh, dass auch Theodosius offenbar bereit war, weiterhin auf ihn zu setzen. Jedenfalls gehörte der Spanier nicht zu jenen, die Rheinberg indirekt die Schuld am Desaster im Osten gaben. Er hatte mittlerweile von verschiedenen Quellen den Ausbruch der Pest bestätigt bekommen, und man mochte den Zeitenwanderern ja Hexerei und Ähnliches vorwerfen, aber dass sie die Pest auslösen würden, um damit ihre eigenen militärischen Machtmittel zu zerstören – nein, die Zeitenwanderer waren vielleicht dämonische Hexer, durch außergewöhnliche Dummheit waren sie bisher jedoch nicht aufgefallen, das akzeptierten auch ihre ärgsten Kritiker.
Glücklicherweise befanden sich diese am Hofe des Maximus. Es war anstrengend genug, die Sticheleien und Randbemerkungen jener zu ertragen, die sich für loyale Gefolgsleute des Theodosius hielten.
Rheinberg betrachtete den Kaiser. Er war sichtlich gealtert. Graue Strähnen waren an seinen Schläfen erkennbar, mehr als vorher. Seine Augen wirkten müde. Er schlief nicht viel, hatte Rheinberg gehört, und damit war er in der gleichen Situation wie sein Heermeister. Er trieb sich selbst permanent an. Und der Verrat des Sedacius, von dem Rheinberg sogleich berichtet worden war, hatte an seinen Kräften gezehrt. Weniger an den körperlichen, ganz sicher aber an den emotionalen. Wer mochte der Nächste sein, der bereit war, dem Imperator das Messer an die Kehle zu legen? Rheinberg wusste, wie der Mann sich fühlte. Spätestens seit Malobaudes, allerspätestens seit Konstantinopel wusste er es ganz genau.
Das machte es für sie beide nicht einfacher. Der Spruch, dass geteiltes Leid nur halbes Leid sei, war völliger Schwachsinn. Manchmal potenzierte es sich eher.
»Wir sollten an Deck gehen«, schlug Rheinberg vor. »Wir laufen gleich aus. Es ist ein schöner Anblick.«
»Er symbolisiert Bewegung. Aber ob das auch gleichzeitig ein Fortschritt ist?«
Theodosius’ Bemerkung gab wie nichts anderes seine aktuelle Gemütslage preis. Rheinberg nickte nur und führte den Kaiser ins Freie. Sie stellten sich an den Bug, in respektvollem Abstand zu den beiden Matrosen, die die Taue bereits eingeholt hatten. Rheinbergs Blick wanderte auf die Reede, wo sieben Segelschiffe ganz unterschiedlicher Größe bereits Kurs Richtung Afrika nahmen, begleitet von den drei Dampfseglern, die ihren Geleitschutz übernehmen würden. Die Saarbrücken selbst würde mit halber Kraft an ihnen vorbeiziehen, damit immer noch deutlich schneller als die anderen Schiffe, doch der Imperator wollte jetzt so zügig wie möglich nach Afrika, um dort die Koordinierung und Neuformierung seiner Streitkräfte zu überwachen.
Rheinberg konnte ihm diese Rastlosigkeit nicht übel nehmen. Es war Wunder genug, dass die Truppen des Maximus sie nicht bis hierher gejagt hatten, um das Übersetzen zu verhindern. Der Tod des Andragathius aus den Händen eines aufstrebenden jungen Offiziers, von dem Rheinberg gehört hatte, schien die Strategie des Usurpators mehr aus dem Gleichgewicht gebracht zu haben als erwartet. Theodosius hatte ihm versprochen, ein Treffen mit dem jungen Mann zu arrangieren. Er hielt sehr große Stücke auf ihn, schien er doch auch instrumentell für die Aufdeckung der Verschwörung des Sedacius gewesen zu sein. Ein Leuchtturm der Loyalität, reichhaltig gewürdigt durch schnellen Aufstieg in der Militärhierarchie.
Rheinberg war gespannt.
Der Leib des Kreuzers erzitterte, als auf der Brücke der Befehl gegeben wurde, die im Leerlauf stampfenden Maschinen hochzudrehen. Erst unmerklich langsam, dann deutlich spürbar löste sich die Saarbrücken von der Hafenmauer. Sie trieb erst noch etwas seitwärts in das Hafenbecken hinein, ehe der Steuermann sacht am Ruder drehte und sich der Bug auf die offene See zu richten begann.
Rheinbergs Blick fiel zurück ans Land, das er kaum betreten hatte. Die Zivilbevölkerung war zahlreich herbeigeströmt, um dem Schauspiel beizuwohnen. Immer noch gab es überall in Rom, wo die Saarbrücken auftauchte, große Augen, offene Münder und diese Mischung aus Begeisterung, Neugierde und Angst. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis der Anblick des Kreuzers zur Normalität gehören würde, zumindest so lange, bis die Dampfsegler weitere Verbreitung gefunden hatten und die Menschen den mentalen Sprung von diesen Schiffen zur Saarbrücken möglicherweise leichter machen konnten als bisher. Tatsächlich waren die Dampfsegler gar keine so große Attraktion gewesen. Sie ähnelten letztlich noch zu sehr den Schiffstypen, die die Menschen gewöhnt waren – Holz, Segel, Takelage und dieses metallene Rohr, das da aus dem Rumpf ragte. Die wahre Qualität ergab sich nur für das geschulte Auge des Seemannes, der plötzlich nicht mehr hohe Brecher fürchten musste oder für den Gegenwinde oder Strömungen keine Gefahr mehr darstellten.
Zuletzt waren Nachrichten an Rheinbergs Ohr gedrungen, nach denen jemand in Alexandria die großzügig verbreiteten Baupläne der Bronze-Dampfmaschine ernst genommen hatte. Man hörte, dass an einem ersten Prototyp gebaut wurde. Rheinberg war zuversichtlich, dass in spätestens acht bis zehn Jahren der Anteil an dampfgetriebenen Schiffen – und sei es nur als Hilfsantrieb – auf dem Mittelmeer erkennbar hoch sein würde.
Alles würde viel schneller, problemloser und angenehmer verlaufen, wenn da nicht die lästige Kleinigkeit des Bürgerkriegs wäre, eine Kleinigkeit, die diese tiefen Falten in das Gesicht des Kaisers gegraben hatte.
Rheinberg selbst schaute nicht mehr allzu oft in den Spiegel. Ihm reichten die kritisch-prüfenden Blicke Aurelias und die kurzen Momente, in denen sie sehr sorgenvoll dreinblickte, immer dann, wenn sie sich unbeobachtet glaubte.
Rheinberg unterdrückte ein Seufzen. Er wusste jetzt, was es bedeutete, wenn jemand früh alterte.
»Ich gehe davon aus, dass Sie das Kommando der Truppen übernehmen, sobald wir in Afrika sind«, erklärte Theodosius. Rheinberg runzelte die Stirn. Natürlich war dies eine Erwartung, die berechtigt war – er trug den Titel des Heermeisters und es war seine Aufgabe, die Truppen zu führen. Aber er wusste genauso gut, dass seine Erfahrungen zu Land sehr begrenzt waren. Auch bei der entscheidenden Schlacht gegen Maximus hatte er sich stark auf den Rat erfahrener Generäle verlassen müssen. Und sie hätten gewonnen, wenn Gratian nicht ermordet worden wäre.
Theodosius wusste das. Er musste es wissen.
Der Kaiser hatte die zweifelnden Gedankengänge seines Heermeisters offenbar in Rheinbergs Gesicht wiedergefunden. Er gestattete sich ein dünnes Lächeln.
»Wir dürfen keine Fehler mehr begehen, Heermeister«, erklärte der Spanier. »Sie haben bereits einen Kaiser verloren und mit ihm eine Schlacht. Der Nimbus ist angekratzt, der Ruf infrage gestellt. Ihr Scheitern im Osten – nicht Ihre Schuld, aber dennoch! – hat auch nicht geholfen.«
Theodosius machte eine Pause und schaute auf das Wasser. Die Sonne tanzte in den Wellen. Es war viel zu idyllisch für ein solch ernstes Thema.
»Es gibt viele – und durchweg wohlmeinende – Stimmen, die mir raten, einen anderen Heermeister zu ernennen. Jemanden, der weiß, wie man eine römische Legion führt. Die Stimmen sind lauter geworden, jetzt, da alle wissen, dass Ihre eigenen Soldaten ihre Wunderwaffen nur noch sehr sparsam einsetzen können. Niemand bezweifelt den Nutzen der Saarbrücken. Niemand möchte die Uhr zurückdrehen und die vielen Neuerungen ablegen, die Sie gebracht haben. Tatsächlich schlägt man vor, Sie zum obersten Flottenadmiral zu machen und Ihnen den Bereich zuzuordnen, in dem Sie sich am besten auskennen und die größten Machtmittel haben. Völlig unlogisch ist das nicht, oder?«
Rheinberg spürte ein Kratzen im Hals und räusperte sich. Natürlich war das nicht unlogisch. Es würde ihm eine große Bürde von der Schulter nehmen. Warum empfand er aber jetzt diesen Schmerz angesichts der Diskussion?
»Es ist letztlich Eure Entscheidung, Theodosius«, erwiderte er ruhig. »Ich werde mich nicht an dieses Amt klammern.«
Der Spanier nickte, als hätte er diese Antwort erwartet.
»Ich werde es aber nicht tun. Ich werde Sie nicht ersetzen«, erklärte er schließlich. »Und mal ganz ehrlich: Das liegt nicht daran, dass ich keinen Besseren wüsste, der die Truppen führen könnte. Ich habe gute Generäle. Männer, die auch auf Ihren Rat hören würden, die aber wissen, wie man einen Krieg an Land führt. Doch es gibt einen sehr wichtigen Grund dafür, dass ich Sie im Amt belassen werde.«
»Welchen?«, fragte Rheinberg, weil er wusste, dass dies von ihm erwartet wurde.
Theodosius hielt ihm ein Pergament hin, das er unter seinem wallenden Umhang hervorgeholt hatte. Es war eine kleine Schriftrolle, typisch für die niedergelegten Meldungen, die den Imperator per Boten jeden Tag erreichten von Untergebenen, Spionen oder Freunden.
Rheinberg hob beide Hände. »Ich glaube Euch, wenn Ihr es mir einfach erzählt!«
Theodosius lächelte wissend. Unterhalten konnte sich Rheinberg schon sehr ordentlich auf Latein wie auch Griechisch, aber das Lesen fiel ihm ungleich schwerer. Doch verschwand das Lächeln schnell wieder aus seinem Gesicht. Rheinberg fühlte sofort eine düstere Vorahnung in sich aufsteigen.
Ohne Zweifel eine schlechte Nachricht.
»Eine Meldung aus Ravenna«, sagte Theodosius gemessen.
»Eine neue Entwicklung bei Maximus?«
»O ja. Es gibt einen neuen Heermeister.« Der Kaiser sah Rheinberg an. War das Mitleid in seinen Augen?
»Wen?«
»Freiherr von Klasewitz.«
Theodosius senkte das Pergament, sagte nichts weiter, schaute seinen Heermeister nur forschend an.
Rheinberg bemühte sich, nicht allzu sehr zu starren, aber es gelang ihm nicht recht. Unglaube machte sich in ihm breit. Das war – ihm fehlten die Worte. War er wütend? War er enttäuscht? Oder war er letztlich einfach nur amüsiert darüber, wie sich alles fügte und das Schicksal unablässig damit befasst war, ihm in die Suppe zu spucken?
Der Spanier ließ ihm einige Augenblicke, dann ergriff er wieder das Wort.
»Eine gewisse Ironie hat das alles, oder?«
»Das ist mir nicht entgangen«, rang Rheinberg sich ab. »Ich empfinde aber keine große Freude darüber.«
Theodosius nickte sinnierend.
»Jetzt treten die Zeitenwanderer gegeneinander an, als Paladine ihrer Kaiser. Das hat große Symbolkraft. Und niemand weiß besser, wie dieser Mann denkt, handelt und plant. Deswegen bleiben Sie mein Heermeister, Rheinberg. Bis zum Ende.«
»Dem Ende –«, echote sein Gegenüber mit nachdenklichem Unterton.
»Ja, dem Ende«, bekräftigte Theodosius und bedachte Rheinberg mit einem intensiven Blick. »Sorgen Sie dafür, Heermeister, dass mir dieses Ende gefällt.«
Rheinberg senkte den Kopf. Natürlich. Er musste funktionieren, das war ihm klar. Der Kaiser erwartete viel von ihm, jetzt erst recht.
Das Ende.
Ihm gefiel schon der Anfang nicht mehr.
3
Freiherr von Klasewitz war ausgesprochen zufrieden mit sich selbst. Er stand auf dem Achterdeck der Julius Caesar und schaute auf den lang gestreckten, massiven Schiffsleib vor sich hinunter. Der Blick über das Deck des großen Transporters wurde ihm durch die beiden Masten verstellt und nicht zuletzt durch den dunklen Schornstein, der sich aus dem Holzboden in die Höhe streckte und damit symbolisierte, was dieses Schiff war.
Es war eine kleine Revolution.
Von Klasewitz drehte den Kopf nach rechts. Da lag die Octavian, das eine Schwesterschiff der Caesar, ebenso wie dieses kurz vor der Fertigstellung. Er wandte den Blick nach links und sein Auge ruhte wohlgefällig auf der beinahe fertigen Konstruktion der Traian, des dritten Schiffsneubaus dieser Klasse. Es waren die größten Schiffe, die Rom jemals gebaut hatte, größer noch als die Getreidesegler, die die kostbaren Nahrungsmittel aus Afrika über das Mittelmeer transportierten. Es waren auch gänzlich andere Schiffe, hochbordig, mit einem mächtigen Kiel versehen und anderen Segeln und Takelagen. Die klassischen Rahsegler der Antike konnten weder gegen den Wind kreuzen noch eine ordentliche Wende fahren, diese drei Leviathane waren absolut dazu in der Lage.
Die in dem Rumpf eingebauten Dampfmaschinen waren viel zu schwach für die großen Schiffskonstruktionen. Dies war der Eile geschuldet, mit der von Klasewitz hatte vorgehen müssen. Tag und Nacht war an den Transportern gearbeitet worden, ebenso wie an den drei Bronzemaschinen. Sie würden alleine die Schiffe nicht nennenswert antreiben können, aber sie würden helfen bei Gegenwind, bei Manövern und zumindest etwas Antrieb leisten, wenn es Windstille geben würde. Sie machten aus diesen drei Transportgiganten die einsatzfähigsten Schiffe der römischen Flotte. Sie stellten in den Händen des richtigen Mannes eine großartige Waffe dar.
Selbstverständlich war er der richtige Mann.
»Wann können wir mit der Verschiffung der Legionäre beginnen?«
Die Stimme riss den Freiherrn aus seinen Überlegungen. Tribun Lucius Sempronus gehörte zu seinem Stab, seit der Kaiser diesen bereits vor seiner Ernennung zum Heermeister an seine Seite gestellt hatte. Klasewitz hatte im Stillen gehofft, nach seiner Beförderung von ihm befreit zu werden, aber der Tribun hing an ihm wie eine Klette, immer höflich, ja unterwürfig, niemals widersprechend, ein treu sorgender Adlatus, aber eben da. Einfach da. Drehte sich von Klasewitz um – da war Sempronus. Öffnete er eine Tür – da war der Tribun, lächelnd, mit höflicher Verbeugung. Inspizierte er eine Baustelle, ein Manöver, ein Gebäude – Sempronus inspizierte mit. Er war sein Schatten, und er war gut darin. Der Freiherr konnte ihn nicht abschütteln, denn das hieße, den Imperator selbst abzuweisen, und so viel getraute sich der neue Heermeister dann doch nicht.
Also hieß es, den Tribun zu ertragen.
Und dessen Fragen zu beantworten, denn es waren die Fragen des Kaisers.
»Jedes der Schiffe kann gut 800 Legionäre transportieren, also fast eine Legion«, erklärte von Klasewitz. »Wir können mit dem ersten Transport in einer Woche beginnen, vielleicht zwei. Die Schiffe sind fast fertiggestellt. Bis zum vereinbarten Landepunkt in Afrika werden wir für eine Überfahrt etwa zwei Wochen benötigen, dann die Rückfahrt – ich denke, wir werden die Kerntruppe des Kaisers in zwei Monaten in Afrika haben. Bis dahin hat Maximus genug andere Schiffe requiriert, um den Rest der Armee in einem Schwung übersetzen zu lassen, von den Schiffen ganz zu schweigen, die ihm die Präfekten aus Afrika entgegenschicken werden. Wir sind im Zeitplan. Alles läuft wie vereinbart.«
Zumindest von seiner Seite, dachte er im Stillen. Maximus verließ sich auf die verräterischen Präfekten Afrikas, die so taten, als würden sie Theodosius unterstützen, sich aber in Wirklichkeit auf die Seite des Usurpators gestellt hatten. Von Klasewitz hegte ein gesundes Misstrauen gegenüber Verrätern, und auf dem Gebiet kannte er sich ganz gut aus. Er war einer und er wollte erneut einer werden. Da machte man sich durchaus so seine Gedanken.
Allerdings keine, die er mit Sempronus zu teilen beabsichtigte.
Der Tribun jedenfalls lauschte den Worten des Heermeisters mit respektvoller Andacht und zeigte sich über alles sehr erfreut. Wie viel davon aufrichtig und wie viel gespielt war, von Klasewitz vermochte es nicht zu ermessen. Letztlich war es gleichgültig, denn der Tribun selbst war ohne jede Bedeutung. Er war der getreue Gefolgsmann des Kaisers, sein Ohr, seine Stimme, nicht mehr als eine Hülle, eine Marionette. Von Klasewitz musste auf ihn achtgeben, weil er auf Maximus achtgeben musste, doch Sempronus selbst war – nichts.
Niemand.
Nervig.
Von Klasewitz holte tief Luft. Natürlich war einiges gelogen. Von außen sahen die Schiffe schon recht ordentlich aus, aber tatsächlich würde noch einige Zeit vergehen, bis sie wirklich einsatzbereit waren. Im Spätsommer vielleicht. Aber das schadete nicht. Bis dahin würden sich die Truppen des Theodosius dermaßen in Sicherheit wiegen und von den afrikanischen Präfekten verwöhnt worden sein, dass der plötzliche Wandel der Loyalitäten und das Auftauchen von Maximus’ Armee sie völlig aus dem Konzept bringen würde. Bis zuletzt würden sie glauben, dass ihnen der Sieg sicher war. Und dann war ihr Schicksal besiegelt. Von Klasewitz freute sich auf diesen Moment, vor allem da er die Ausgangslage für die Besiegelung seines eigenen Schicksals sein würde. Mit einer treuen Truppe bei der Hand sollte es ihm gelingen, Maximus zu stürzen und sich selbst zum Imperator zu machen. Möglicherweise würde es danach noch einen kleinen Bürgerkrieg geben. Aber die Situation half ihm. Der Osten stöhnte unter der Pest, mit etwas Glück würde sie sich auch in andere Reichsteile ausbreiten. Er musste nur abwarten, bis genug Leute gestorben waren, dann würde seine Regierung als Anker der Stabilität gelten, als Quelle der Zuversicht. Er rechnete nicht mit ernsthaften Problemen, war erst die Tat vollbracht, die ihm den Purpur sichern würde.
Sempronus, so hatte er sich vorgenommen, würde auch zu den Opfern gehören. Eine kleine Rache, eigentlich seiner nicht würdig, unnötig, aber doch erfreulich. Als Imperator durfte er sich diese kleinen Vergnügen gönnen, fand der Freiherr. Wofür sonst hielt man die Macht in Händen?
Er lächelte Sempronus an.
»Wollen wir die Schiffe gemeinsam inspizieren?«
Der Tribun winkte ab. »Wenn Ihr es befehlt, sofort natürlich. Aber ich bin kein Fachmann und verstehe das alles nicht so richtig.«
Der Freiherr lächelte breiter und tätschelte dem Offizier die Schulter. »Das geht in Ordnung.«
Von Klasewitz wusste genau, dass Sempronus die endlos langen Inspektionen des Heermeisters, seit er sie einmal mitgemacht hatte, zu meiden versuchte, wo es nur ging. Der Freiherr selbst machte diese nicht, um alles ständig zu kontrollieren, sondern vielmehr, um mit allen Arbeitern, Vorarbeitern und den Wachsoldaten zu plaudern, sich ihre albernen Sorgen und Nöte anzuhören, so zu tun, als interessiere ihn das Geschwätz tatsächlich, und sich dann regelmäßig exakt einer der Nöte anzunehmen und das Problem abzustellen. So etwas sprach sich herum und sorgte für Loyalität und Vertrauen in seine Person. Und es war keine große Anstrengung. Der Pöbel hatte Probleme, die seinem geistigen Horizont entsprachen. Da schmeckte der Wein zu wässrig, da war die Pause für das Mittagessen gestern ausgefallen, und als man sich bei der Arbeit verletzte, war weit und breit niemand zu finden, der einen Verband anlegte. Dies und das. Von Klasewitz sorgte dann dafür, dass am nächsten Tag ein oder zwei Amphoren richtig guter Wein geliefert wurden oder dass die Pause für jenen Trupp, der so gelitten hatte, am Folgetag verlängert wurde oder dass ein Arzt die Baustelle abwanderte und jedes Wehwehchen mit großer Anteilnahme behandelte.
Damit machte von Klasewitz sich beliebt.
Und das war ein Kapital, das er noch gut gebrauchen konnte.
Sempronus verließ das Schiff, betrat den Kai und marschierte in Richtung Kantine.
Von Klasewitz’ Lächeln veränderte sich. Es war jetzt nicht mehr ganz so falsch und aufgesetzt, es war jetzt ganz voller aufrichtiger und ehrlicher Arroganz. Diese ewige Schauspielerei forderte durchaus ihren Tribut und mal einen Augenblick ganz der Alte sein zu dürfen, diente sicherlich seiner geistigen Gesundheit. Und der Preis, den er für diese Anstrengung zahlte, war nichts im Vergleich zum Preis, den er als Lohn einstmals in Empfang nehmen würde.
Wie gut, dachte er bei sich, ehe er seinen Kontrollgang begann, dass die Welt größtenteils aus Idioten besteht und ich nicht dazugehöre.
Wie gut, wie wunderbar.
4
»Irgendwann wirst du dich entscheiden müssen«, erklärte der alte Mann, als er Godegisel dabei beobachtete, wie dieser mit seinen Fingerkuppen vorsichtig über die frisch verheilte Narbe strich.
»Wozu entscheiden, Clodius?«, fragte der Gote leise.
»Ob du darüber froh sein willst, noch am Leben zu sein, oder entsetzt darüber, dass du die Narben deiner Krankheit mit dir herumträgst.«
Godegisel nickte langsam und schaute an sich hinab. Er fühlte sich schwach und sah auch so aus, die Beulen der Pest zeichneten sich auf seinem mittlerweile ausgemergelt wirkenden Körper deutlich ab. Sie waren auf dem Weg der Heilung, die Schmerzen hatten nachgelassen. Seit einigen Tagen aß Godegisel wieder drei Mahlzeiten am Tag, sorgsam vorbereitet vom alten Clodius, und er konnte sich vorsichtig waschen, trug frische Kleidung, stand auch hin und wieder auf, um einige wackelige Schritte zu gehen. Am schönsten war es, wenn er mit seinem Wohltäter auf der Bank vor der Hütte saß und die Sommersonne auf seine schmerzenden Glieder scheinen ließ.
Clodius nutzte diese Zeit, um ihm von seinem Leben zu erzählen. Er las ihm auch aus den Schriften vor, von denen er Versionen unterschiedlicher Qualität sein Eigen nannte, den größten Schatz in dieser bescheidenen Behausung. Godegisel war sich sicher, zu keinem Zeitpunkt seines Lebens intensiver und umfassender mit den Worten des Herrn befasst gewesen zu sein wie in den vergangenen Wochen. Clodius achtete darauf, seinen Patienten niemals zu ermüden. Godegisel schlief viel. Und die Albträume ließen nach, sie schwanden mit dem nachlassenden Fieber.
Wenn Godegisel den alten Mann ansah, fühlte er große Wärme und Zuneigung. Als er das erste Mal aus dem Delirium aufgewacht war, völlig orientierungslos, erhitzt vom brennenden Fieber, schwach bis zur Ohnmacht, hatte er das freundlich lächelnde, von feinen Runzeln durchzogene Gesicht des Clodius erblickt. Und dann die kühle, feuchte Labsal eines Tuchs auf seiner Stirn. Die sanfte Stimme, die ihn beruhigte und ihm versicherte, dass alles gut sei und er das Schlimmste bald überstanden habe. Er erinnerte sich mit Freude an den kräftigen Geschmack der Hühnerbrühe, die ihm Clodius verabreichte, die angenehme, stärkende Wärme in seinem Magen, die Belebung seiner Lebensgeister und die fast schon euphorische Freude darüber, am Leben zu sein.
Und da war der alte Clodius, wie ein Anker und steter Begleiter, die Verkörperung des Gefühls von Sicherheit und Sorge. Der alte Mann hatte die nässenden Beulen versorgt, den unerträglichen Gestank erduldet, den leidenden Infizierten beruhigt, wenn er an seinem Schicksal zu verzweifeln drohte. Er war an seiner Seite gewesen, bei Tag und bei Nacht, und Godegisel konnte nur ahnen, welche Kräfte der alte Körper hatte mobilisieren müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen.
Godegisel hatte Clodius vielmals gedankt, und dieser hatte den Dank mit einer erfrischend natürlichen Bescheidenheit akzeptiert. Doch der Gote fühlte jeden Tag aufs Neue, dass er seine Schuld noch nicht hinreichend abgetragen hatte, und versprach Clodius ein Haus und Ehren und Geld, wenn er nur wieder in die Dienste des Heermeisters zurückgekehrt war.
Doch Clodius machte dann immer eine umfassende Bewegung beider Arme und schüttelte den Kopf. »Was brauche ich noch? Lebe dein Leben, junger Gote, das ist mir Lohn genug.«
Godegisel akzeptierte diese Worte dann in scheinbarer Demut, dennoch ließ ihn der Gedanke nicht los, etwas schuldig zu sein.
Und er betrachtete sich selbst, die langsam heilenden Wunden, mit sich abzeichnenden Narben, die ihn an den Gelenken verunzieren würden, im Bereich seiner Lenden, ein Mal, das ihn lebenslang begleiten würde. Ein Zeichen dafür, dass er gesegnet war, ein Überlebender, zäher als die meisten anderen, also nicht einmal ein Makel.
Aber, und bei diesem Gedanken ertappte sich Godegisel immer wieder, wenn er eine der heilenden Beulen mit vorsichtigen Fingern berührte, was würde Pina dazu sagen?
Vielleicht wäre es tatsächlich besser, die Köhlerstochter aus seinen Gedanken zu verbannen. Er hatte sie verlassen, klammheimlich, und würde nicht als strahlender, junger Mann von Adel zu ihr zurückkehren, als geehrter Held, in Amt und Würden, mit Salär und Wohlstand, sondern als Gezeichneter, gealtert durch die Pest, und ob noch in Ehren, das würde allein der Ausgang des Bürgerkrieges entscheiden. Und das sah derzeit nicht gut aus. Der Osten konnte Rheinberg und Theodosius nicht helfen. Der Westen war in der Hand des Maximus, der seine Gegner in die Enge trieb. Von nirgends her war Hilfe zu erwarten.
Godegisel fand, dass er keine besonders gute Partie mehr machte.
Clodius schien seine Gedanken zumindest teilweise zu erahnen. Der alte Mann sah seinen Schützling mit einer Mischung aus Mitleid und Unwillen an. Godegisel ahnte, dass Clodius für sein Gejammer nur wenig Verständnis aufbringen würde, und es bedurfte einiger Nachfragen des Alten, bis er schließlich bereit war, ein paar Worte zu seinem Gemütszustand zu verlieren.
»Ich bin froh, noch am Leben zu sein«, sagte Godegisel schließlich auf die Frage des alten Mannes. »Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was für ein Leben das sein wird.«
Clodius zog seine Augenbrauen hoch, ehe er durchaus nachsichtig mit dem Kopf schüttelte.
»Die Schwäche, die durch die Krankheit kam, drückt dir auf die Seele«, erklärte er und warf einen prüfenden Blick auf die Feuerstelle, wo ein Topf mit seiner ausgezeichneten Hühnersuppe vor sich hin brodelte. »Fühlt der Körper sich schlecht, werden wir betrübt und erwarten das Schlimmste. Nicht anders ergeht es dir. Sobald du vollständig genesen bist, wirst du anders darüber denken. Es muss Dinge in deinem Leben geben, die dich erfreuen und auf die du dich freust. Widme dich diesen.«
Godegisel hatte dem alten Mann nicht viel über sich erzählt und sein Fürsorger hatte auch nicht weiter nachgefragt. Aber es war sicher genug zusammengekommen, um ermessen zu können, dass der junge Gote nicht irgendein Reisender gewesen war, der einfach nur Pech hatte.
Er hatte schon erwogen, Clodius viel mehr über sich zu berichten. Aber wer würde ihm eine solch abenteuerliche Geschichte glauben? Erst den Kaiser Ostroms gefangen genommen, dann einen Zeitenwanderer getötet, Valens daraufhin, den alle für tot gehalten hatten, nach Britannien gebracht. Dort erst Teil der Verschwörung des Maximus, dann die Flucht nach Gallien, dann der Tod des Valens, die Reise nach Süden, Pina, die Aufnahme durch Rheinberg, Sonderbotschafter zu den Goten und jetzt ein Pestkranker in der Hütte eines alten freigelassenen Sklaven – all dies binnen wenig mehr als einem Jahr.
So ein Leben führte kein normaler Mensch. Er hatte mehr erlebt als der alte Clodius während seiner ganzen Existenz, und er war noch jung. Jetzt hatte er die Pest überlebt, was kaum einem gelang, und nun – bei Gott, was nun?
»Ich hoffe, dass der Herr jetzt genug hat von meinen Abenteuern«, erklärte Godegisel leise. »Ich habe doch jetzt wirklich genug gemacht.«
Clodius wusste nicht, auf was alles sich sein Patient bezog, aber er ahnte möglicherweise, dass er nicht bloß die gerade überstandene Seuche meinte. Der alte Mann schien ein erneutes Kopfschütteln unterdrücken zu wollen – es gelang ihm nur halbherzig – und dann seufzte er nur leise. Es war schwer, jemandem Hoffnung und Zuversicht einzuflößen, der ermattet und von einer schweren Krankheit gezeichnet darniederlag.
Er erhob sich und schaute auf Godegisel hinab.
»Ich bringe dir jetzt noch etwas Hühnersuppe und backe frisches Brot. Morgen gehe ich zum Markt und kaufe einen Braten.«
Godegisel schüttelte den Kopf. »Nein, das kostet alles viel zu viel Geld, mein Freund. Ich kann es dir bis auf Weiteres nicht zurückzahlen.«
Clodius machte eine abwertende Handbewegung. »Ich habe mein Auskommen, meine Pension von meinem ehemaligen Herrn, das kann ich gar nicht alles ausgeben. Oder wie sonst hätte ich mir deiner Ansicht nach die Schriftrollen leisten können? Ich werde uns einen Braten kaufen, ein ordentliches Stück Fleisch, und wir werden sehen, ob wir dich damit nicht ein gutes Stück auf dem Weg der Besserung voranbringen.«
Godegisel widersprach nicht. Sein Appetit wuchs. Und er wollte kräftiger werden. Er hatte noch einen langen Weg vor sich, und da man ihm alles genommen hatte, musste er ihn zumindest anfangs zu Fuß zurücklegen. Das war keine Aussicht, die ihn erfreute. Doch die Rastlosigkeit, die mit jedem Tag stärker würde, war nur schwer zu bändigen. Sobald er auch nur einigermaßen reisefähig war, würde er aufbrechen, und das dann ganz sicher zu Clodius’ Missfallen, der sich an der Gesellschaft des jungen Mannes trotz aller Mühen erfreute.
»Wie ist die Lage in den umliegenden Dörfern?«, fragte er den alten Mann. »Wie ist die Pestsituation?«
»Ich bin ziemlich erstaunt«, erwiderte Clodius. »Die Behörden haben schnell reagiert und offenbar die richtigen Maßnahmen ergriffen. Kranke werden rasch isoliert. Überall ist man auf der Jagd nach Ratten. Reinigende Feuer werden entzündet. Die Bewegungen der Reisenden werden scharf kontrolliert. Zu meiner Zeit hat sich die Pest schneller und umfassender ausgebreitet. Es läuft alles nicht halb so voller Panik ab wie damals. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es gibt jetzt tatsächlich diese Momente, da will ich der imperialen Administration dankbar sein. Jedenfalls scheint die Pest hier in der Gegend zu bleiben. Aber ich hörte, die Ostarmee sei stark betroffen. Die Männer wurden rechtzeitig isoliert, aber sie leiden.«
Er sah Godegisel prüfend an. »Wir müssen darauf achten, dass du erst wieder aufbrichst, wenn deine Beulen gut und sichtbar verheilt sind, mein Freund. Sonst wird man dich für einen Erkrankten halten und sogleich aufgreifen und isolieren. Es ist besser, wenn du deine Ungeduld noch etwas im Zaum hältst und bei mir bleibst.«
Er lächelte Godegisel verständnisvoll zu. »Ich werde langsam langweilig, oder?«
Der Gote schüttelte den Kopf. »Clodius, ich liebe Euch wie meinen Vater.«
Der alte Mann sah den Kranken seltsam an.
Er wandte den Kopf rasch zur Seite, wischte sich etwas aus den Augen.
Dann konzentrierte er sich darauf, einen Teller mit Hühnersuppe zu füllen.
5
Charamadoye war der Ansicht, dass es zu früh war, sich mit diesen Dingen zu befassen. Er ließ sich den Umhang von seiner Leibsklavin zurechtzupfen, dann seufzte er leise. Aira zog ihre Hände von der königlichen Gestalt zurück und lächelte. Sie war, genauso wie ihr Oberherr, keine 17 Jahre alt, und in der letzten Nacht hatte sie ihm noch auf andere Art gedient, als ihm beim Ankleiden zu helfen. Charamadoyes Blick ruhte mit Wohlgefallen auf der schlanken und hochgewachsenen Gestalt der Sklavin, die von seinen Ältesten offenbar mit großem Bedacht ausgewählt worden war. Sie war nicht irgendein Mädchen, das allein durch äußere Schönheit und Fügsamkeit des Geistes dafür qualifiziert worden war, dem König von Nobatia zu dienen. Sie war überdies eine Tochter des Königs von Alwa, und der Feldzug, den Charamadoyes Vater gegen den entfernten Nachbarn geführt hatte, mit Duldung und stiller Unterstützung des dazwischen liegenden Makuria, hatte nicht nur dazu geführt, dass Charamadoye den Thron hatte besteigen müssen, sondern auch reichlich Beute gebracht.
Der junge Herrscher Nobatias betrachtete sich in dem reichhaltig verzierten römischen Spiegel, vor dem er stand. Auch dieser Gegenstand war Teil der Kriegsbeute gewesen. Er war sich nicht sicher, ob der Tod seines Vaters auf der Rückreise aus Alwa die Sache wert gewesen war, wenngleich er nach letzter Nacht beinahe bereit war, es zu glauben.
Der junge König hatte früh aufstehen müssen. In der Nacht war die aksumitische Delegation angekommen. Die Kriege zwischen den drei nubischen Nachfolgestaaten, die die Reste des einst mächtigen Kusch unter sich aufgeteilt hatten, waren eine Sache. Das mächtige Aksum war eine ganz andere. Ezana hatte einst Meroe erobert, die alte Hauptstadt von Kusch, und damit dem einstmals so mächtigen Reich den Todesstoß versetzt. Aksum hatte aber auf eine dauerhafte Eroberung verzichtet – die territorialen Interessen lagen eher im arabischen Raum und man hatte nichts gegen drei schöne Pufferstaaten zwischen sich und Rom. Das hieß aber nicht, dass sich Aksum nicht für das interessierte, was in Nobatia, Makuria und Alwa passierte, und der Feldzug von Charamadoyes Vater hatte nicht unbedingt Freude in Aksum ausgelöst. Die Ältesten vermuteten, dass die Delegation, die nunmehr in der Haupstadt Pharas eingetroffen war, den jungen, gerade frisch aufgestiegenen König freundlich darauf hinweisen wollte, dass der Kaiser ein wachsames Auge auf die nubischen Entwicklungen habe und daher auch ein ungestümer Mann wie Charamadoye lieber zweimal überlegen solle, ehe er zu neuen Taten aufbreche.
Der König von Nobatia hatte damit absolut kein Problem.
Er würde die Anwesenheit der aksumitischen Delegation nutzen, um seine Verlobung mit Aira und ihre Befreiung aus dem Sklavenstand bekannt zu geben. Dies würde nicht nur Frieden bringen, sondern auch ein starkes Signal nach Aksum senden, dass der neue Herr in Pharas die Absicht hatte, seine Außenpolitik über das Bett und nicht über das Schwert zu regeln. Die Aksumiten, die innerhalb ihres Reiches zwischen den rivalisierenden Familienclans selbst auf eine komplexe Heiratspolitik angewiesen waren, würden das gut verstehen. Und gaben sie ihm seinen Segen, dann würde das seine Stellung in Nobatia sicher zementieren.
Das war dem König nur recht, vor allem angesichts des Durcheinanders, das sich im nördlich von Nobatia liegenden Römischen Reich zu entwickeln drohte. Aegyptus war nahe, zu nahe nach Charamadoyes Geschmack, und vor allem hörten seine Spione nichts Gutes.
Der König seufzte. Es war ihm zu früh. Und Diplomatie war anstrengend, wenn man gerade die ganze Nacht damit verbracht hatte, eine schöne Frau in allen Feinheiten zu erkunden. Mit Inbrunst. Es zehrte etwas. Charamadoye freute sich nicht auf die Pflichten, die vor ihm lagen. Er würde erst froh sein, wenn er all dies hinter sich gebracht hatte.
»Dann wollen wir unsere Gäste nicht warten lassen«, murmelte er mehr zu sich selbst, doch Aira sah dies als Aufforderung, ein letztes Mal an seinem Gewand zu zupfen und sich dann leise zurückzuziehen.
Der König Nobatias verließ seine persönlichen Gemächer. Vor der Tür gesellten sich die vier Männer seiner persönlichen Leibgarde zu ihm, die ihn heute begleiten würden. Sie waren alle nicht älter als er, teilweise Spielgefährten, Söhne einflussreicher Persönlichkeiten, gute Freunde. In ihrer Gegenwart fühlte er sich so sicher, wie sich ein König heutzutage fühlen konnte.
Bald hatten sie den Innenhof des bescheidenen Palastes erreicht. Er war im römischen Stil errichtet worden. Für einen echten Römer mochte er nicht mehr als ein weitläufiges Herrenhaus eines wohlhabenden Ritters sein, aber Charamadoye war nicht so eitel, als dass er seinen Platz in der Geschichte überschätzen würde. Jung zwar, war er doch seit frühester Kindheit mit den besten Lehrern auf seine Funktion vorbereitet worden. Als Kusch vor rund 30 Jahren unterging, war Charamadoyes Familie ein wichtiges Adelsgeschlecht gewesen, Provinzfürsten zwar, aber von Bedeutung. Dass sein Vater dann selbst ein König werden würde, war eher unvorhergesehen gewesen. Doch er hatte sich schnell in die Rolle eingefunden und war den Tod eines Königs gestorben.
Charamadoye achtete und respektierte seinen Vater, hatte sich allerdings vorgenommen, an Altersschwäche zu sterben. In den Armen junger Mädchen wie Aira, vorzugsweise. Immerhin war er König.
Das sollte sich arrangieren lassen.
Sein bescheidener Hofstaat hatte sich bereits versammelt und dort, gegenüber dem leicht erhöhten Sessel, den der König als seinen Thron beanspruchte, standen drei Aksumiten, an ihrer Tracht wie auch an ihrer Haltung gut erkennbar. Nicht unhöflich oder gar arrogant, aber auch nicht allzu unterwürfig.
Einer seiner Berater gesellte sich an die Seite des Königs und flüsterte ihm zu: »Der Anführer der Gruppe ist Wazeba, der Bruder des Ouezebas.«
Charamadoye versteifte sich unwillkürlich. Wazeba war ein hoher Adliger und Offizier der aksumitischen Streitkräfte und damit ganz sicher ein würdiger Gesandter. Er war aber vor allem der Bruder des zukünftigen aksumitischen Kaisers, und das war bemerkenswert. Es symbolisierte die Bedeutung, die der Kaiser dieser Gesandtschaft zubilligte, und es bedeutete auch, dass Charamadoye besonders vorsichtig sein musste.
Er setzte sich auf seinen Thronsessel und schaute freundlich auf die Versammelten hinab. Dann hob er die Hände.
»Ich will unsere Gäste begrüßen. Tretet vor!«
Die drei Aksumiten schritten nach vorne, blieben in respektvollem Abstand stehen und verbeugten sich.
»Ich bin Wazeba«, erklärte ein besonders hochgewachsener Mann mit tiefer Stimme. »Ich repräsentiere Mehadeyis, den Kaiser des großen Aksum. Ich überbringe die freundschaftlichen Grüße meines Oberherrn und freue mich, den König von Nobatia bei guter Gesundheit zu sehen.«
Charamadoye nickte hoheitsvoll, aber möglichst wenig herablassend.
»Ich begrüße Euch, Wazeba. Bitte, setzt Euch an meine Seite.«
Sitzgelegenheiten neben dem Thronsessel waren den Beratern und Ältesten vorbehalten oder eben besonders wichtigen Ehrengästen. Wazeba und seine Begleiter nahmen Platz und wurden sogleich mit Erfrischungen bedient, derer sie mehr aus Höflichkeit zusprachen.
»Welche Botschaft hat mein väterlicher Freund, der Kaiser Aksums, Euch mitgegeben?«
Wazeba lächelte. Es schien ihm durchaus zu gefallen, dass der junge König sogleich zur Sache kam.
»Mein Kaiser war besorgt über den Tod Eures geehrten Vaters sowie die Reibungslosigkeit Eurer Thronbesteigung. Er wollte sicherstellen, dass in Nobatia alles zum Guten steht.«
Er machte eine umfassende Handbewegung. »Ich sehe, dass die Sorge meines Herrn unbegründet war.«
»Keinesfalls«, widersprach Charamadoye. »Es ist immer ein Risiko, wenn jemand ohne große Erfahrung und dann arg plötzlich die Nachfolge eines Herrschers antritt. Euer Kaiser ist so weise, Euren Bruder auf dieses hohe Amt vorzubereiten. Mein Vater hatte dafür nicht so viel Zeit und war oft mit – anderen Dingen beschäftigt.«
Wazeba neigte den Kopf. »Mein Kaiser ist sich nicht sicher, ob der Feldzug gegen Alwa eine kluge Entscheidung war.«
»Ah, ich darf Euch versichern, edler Wazeba, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass diese Entscheidung meines Vaters mindestens als voreilig zu bezeichnen ist.«
Der Aksumite nickte interessiert. Charamadoye lehnte sich nach vorne.
»Bitte teilt dem Herrn von Aksum mit, dass ich nicht die Absicht habe, die kriegerischen Aktivitäten meines Vaters fortzusetzen, zumindest nicht offensiv. Kusch ist erst vor wenigen Jahrzehnten untergegangen und viele Adlige aus jener Zeit hegen den tiefen Wunsch, das Reich wiederauferstehen zu lassen. Ich möchte annehmen, dass mein Vater gleichfalls Gedanken in dieser Richtung hegte.«
»Ihr aber nicht?«
»Ich aber nicht. Es gibt Gründe, warum Kusch zerfiel. Wir hatten jede innere Einigkeit verloren.«
»Aksum eroberte Meroe.«
»Das war ein Symptom, aber nicht die Ursache der Krankheit.«
»Ihr seid gütig.«
»Ich bin Realist genug. Mich bekümmert weniger, was im Süden vorgeht, als das, was im Norden passiert.«
Wazeba kniff die Augen zusammen, sein Gesicht voll neugieriger Anspannung.