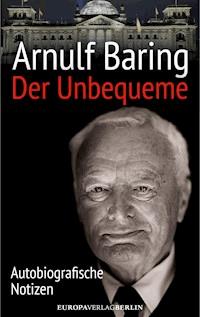Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Fundierung – Konrad Adenauer und Ludwig Erhard
Umbau – Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt
Sicherung – Helmut Schmidt und Helmut Kohl
Ausbau – Helmut Kohl und Gerhard Schröder
Konsolidierung? – Gerhard Schröder und Angela Merkel
Literatur
Namenverzeichnis
Bildnachweis
Copyright
Vorwort
zur erweiterten Ausgabe
Kanzler werden ist schwer, Kanzler bleiben erst recht. Am schwierigsten aber wird der Auszug aus dem Amt, der Abschied von der Macht. Kein Bundeskanzler ist bislang freiwillig von der politischen Bühne abgetreten. Warum nicht? Was zog sieben Männer und eine Frau verschiedener Herkunft, Begabung und Zielsetzung ins Kanzleramt? Warum hielten sie dort bis zu sechzehn Jahren aus, obgleich die Last der Verantwortung an die Grenze dessen stößt, »was man auf die Dauer ertragen kann«, wie einer von ihnen, Helmut Schmidt, gesagt hat? Was hat sie am rechtzeitigen, umsichtigen Ausstieg aus der Kanzlerkarriere gehindert?
Diese Fragen haben uns gereizt, und so sind wir, ohne lange zu zögern, der Einladung nachgekommen, die Geschichte des Landes im Spiegel der Biographien seiner Kanzler zu erzählen. Die erste Auflage unseres Buches erschien zur Bundestagswahl 2002 und erfreute sich großen Zuspruchs. Die breite und durchweg zustimmende Aufnahme hat uns ermuntert, die Darstellung bis zur zweiten Großen Koalition und zur ersten Kanzlerin in der Geschichte der Republik fortzuschreiben.
Arnulf Baring, Berlin
Gregor Schöllgen, Erlangen
Fundierung
Konrad Adenauer und Ludwig Erhard
1945 -1966
Konrad Adenauer fühlte sich sicher. Da er regelmäßig Auslandssender hörte, glaubte er, daß die Amerikaner in Richtung Mainz, die Engländer in Richtung Wesel vorrückten. Sein Wohnort Rhöndorf und die Umgebung, auf der Ostseite des Rheins, hoch am Hang des Siebengebirges, würden also nicht zum unmittelbaren Kriegsschauplatz werden. Aber es kam anders. Weil deutsche Truppen die Rheinbrücke von Remagen, ein Dutzend Kilometer stromaufwärts, nicht rechtzeitig sprengten, änderten die Amerikaner ihre Pläne und stießen am 7. März 1945 über den Strom vor. So geriet Rhöndorf unmittelbar in die Kampfzone. Granaten schlugen in Adenauers Garten ein, trafen sein Haus, richteten erhebliche Zerstörung an. Im unterirdischen Weinkeller fanden er und seine vierzehnköpfige Familie, außerdem vier geflohene französische Kriegsgefangene, die er bei sich aufgenommen hatte, notdürftig Schutz – hinter dem Wohnhaus, im Faulen Berg.
Erst nach acht Tagen wagte sich der Hausherr wieder ins Freie und atmete auf. Gewiß, seine Heimat war von ausländischen Mächten erobert. Doch für ihn war es eine Befreiung. Kurz nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten war Adenauer als Oberbürgermeister von Köln abgesetzt worden. Wiederholt hatte er sich seitdem verstecken müssen, war mehrfach verhaftet und zuletzt im November 1944 aus der Gestapohaft entlassen worden, in die er nach dem gescheiterten Staatsstreich des 20. Juli geraten war. Jetzt aber war die Zeit jahrelanger Zurückgezogenheit und Gefahr vorbei. Schon Ende März wurde er von amerikanischen Offizieren aufgefordert, erneut die Verwaltung der Stadt Köln zu übernehmen. In Begleitung seiner Frau machte sich Konrad Adenauer auf den Weg in seine schwer zerstörte Geburtsstadt.
Auch der Franke Ludwig Erhard wartete in den Frühjahrstagen 1945 auf die Niederlage Hitler-Deutschlands. Als Gegner nationalsozialistischer Planwirtschaft hatte er schon 1944 in einer Denkschrift Grundzüge für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands nach dem Ende des Krieges entwickelt. Seine Stunde schlug, als die Amerikaner in Fürth eintrafen. Eigentlich hatte Erhard die Hochschullaufbahn einschlagen wollen. Aber in der Überzeugung, mit seinen wirtschaftlichen Konzepten den Schlüssel eines demokratischen Wiederaufbaus seiner Heimat zu besitzen, nahm er ohne Zögern den Auftrag der Amerikaner an, die Fürther Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Wenig später sollte ihm diese Aufgabe auch für Bayern, dann für das ganze von den Westmächten besetzte Deutschland zufallen.
Nicht alle, die den alliierten Truppen bei ihrer Ankunft begegneten, waren durch ihr Verhalten während der letzten zwölf Jahre so einwandfrei entlastet wie Adenauer und Erhard. Kurt Georg Kiesinger war vom 1. März 1933 bis zum bitteren Ende Mitglied der NSDAP gewesen. Ende April, als Adenauer und Erhard bereits an den Wiederaufbau dachten, reiste er nach Landshut, wo der deutsche Auslandsrundfunk des Auswärtigen Amtes ein Ausweichquartier eingerichtet hatte; seit 1940 war er stellvertretend für dessen Rundfunkpropaganda verantwortlich. Wenige Tage nach seiner Ankunft wurde Kiesinger von einer amerikanischen Patrouille aufgegriffen und zum Verhör geschickt. Das war der Beginn einer achtzehnmonatigen Internierungshaft.
Am 7. und 9. Mai wurde offiziell besiegelt, was alle längst hatten kommen sehen: Im Hauptquartier General Eisenhowers in Reims und – zwei Tage darauf – im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst kam es zur bedingungslosen Kapitulation des Großdeutschen Reiches. Beim Eintreffen dieser Nachricht in Stockholm fielen sich Willy Brandt und Rut Hansen, seine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau, glücklich in die Arme. Brandt war als Gegner des Nationalsozialismus schon 1933 in die Emigration nach Norwegen, dann nach Schweden gegangen und hatte von dort aus im Widerstand gegen das Regime gestanden.
Von einem »Alpdruck« befreit war in seinen eigenen Worten auch Brandts späterer politischer Weggefährte und parteiinterner Rivale Helmut Schmidt, als der Krieg im Mai 1945 zu Ende ging. Wie Brandt hielt er sich zum Zeitpunkt der deutschen Kapitulation nicht in Deutschland auf. Schmidt saß in britischer Kriegsgefangenschaft. Beim Machtantritt der Nationalsozialisten war er gerade 14 Jahre alt gewesen und, wie fast alle Männer seines Jahrgangs, mit Achtzehn zum halbjährigen Arbeits- und danach zum zweijährigen Wehrdienst eingezogen worden, der in seinem Fall direkt in den Kriegsdienst überging. Immer schwerer ließen sich für ihn die Pflicht des Soldaten und eine zunehmende Abneigung gegen die NS-Herrschaft miteinander vereinbaren. In der Gefangenschaft wurde Schmidt »unter dem Einfluß älterer Offiziere« zum Sozialdemokraten. So begann sein politischer Weg in die Nachkriegszeit.
Deutlich jünger als Schmidt, nämlich erst knapp drei Jahre alt, war Helmut Kohl, als die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernahmen. Seit Herbst 1944 hielt sich der Hitlerjunge in Berchtesgaden auf – die deutschen Behörden gingen davon aus, daß es für Kinder auf dem Land sicherer sei. Dort überstand Kohl das Kriegsende unversehrt und machte sich schnellstmöglich auf den Heimweg nach Ludwigshafen zu seiner Familie – zunächst mit dem Fahrrad, dann zu Fuß. Tagelang war er unterwegs, bis er bei Mannheim die Brücke von Germersheim erreichte, die ihn über den Rhein in seine Geburtsstadt führen sollte. Doch statt der Brücke sah der Fünfzehnjährige nur Trümmer, Schiffswracks und jenseits des Rheins die rauchenden Ruinen Ludwigshafens.
Ähnliche Bilder boten sich Konrad Adenauer und Willy Brandt, als sie 1945 ihre Geburtsstädte Köln und Lübeck betraten. Erst 1998 ist mit dem 1944 geborenen Gerhard Schröder ein Bundeskanzler angetreten, für den solche Erlebnisse nicht mehr zu den bewußten Erfahrungen seines Lebens gehören. Ludwig Erhard, der reserviert Oppositionelle, Kurt Georg Kiesinger, der Mitläufer, Willy Brandt, der Exilant, Helmut Schmidt, der Offizier, Helmut Kohl, der Hitlerjunge, dessen älterer Bruder im vorletzten Kriegsjahr gefallen war – sie alle trugen lebenslang schwer an ihren Erfahrungen in und mit der Diktatur.
Anders Konrad Adenauer und Gerhard Schröder. Die Wurzeln des einen reichten zu tief, als daß Hitlers Deutschland ihnen etwas hätte anhaben können; dem anderen fehlten sie, um eine prägende Erfahrung zu bilden. Ansonsten hatten Gerhard Schröder und Konrad Adenauer manches gemein – miteinander und mit den übrigen Nachfolgern und Vorgängern im Kanzleramt. Vor allem die Faszination der Macht. »Politik ist eine Leidenschaft«, wußte Adenauer. »Macht«, so erkannte Gerhard Schröder bereits als niedersächsischer Ministerpräsident, »macht süchtig«, verleite »dazu, alle Hemmungen fahrenzulassen, bloß um sich die nächste Dosis einverleiben zu können«. Für Menschen mit solcher Veranlagung ist die Kanzlerschaft der Höhepunkt der Karriere, ja des ganzen Lebens.
Aber Kanzler werden ist schwer. Der Weg ist lang und führt steil bergauf. Der Pfad – unsicher, schmal, mit Stolpersteinen gepflastert, von unvermuteten Abgründen gesäumt – bietet immer nur einem Platz. Der Aufstieg verschlingt Zeit und Energien. Ans Ziel gelangt, muß der neue Regierungschef mit den verbliebenen Kräften haushalten. Die statistische Lebensmitte liegt längst hinter ihm: Helmut Kohl war mit 52 Jahren der jüngste Kanzler, es folgen Gerhard Schröder mit 54, Willy Brandt und Helmut Schmidt mit 55, Kurt Georg Kiesinger mit 62 und Ludwig Erhard mit 66 Jahren. Konrad Adenauer übertraf sie alle: 73 Jahre war er alt, als er ins Kanzleramt einzog.
Schon Adenauers Beispiel zeigt aber auch, daß Kanzler zu werden eine Sache ist, rechtzeitig und umsichtig den Ausstieg aus dem Kanzleramt zu schaffen eine andere. Das ist bislang keinem gelungen, keiner räumte seinen Platz freiwillig. Adenauer und Erhard fielen 1963 beziehungsweise 1966 Kanzlermördern aus den eigenen Reihen zum Opfer, wobei der kleinere Koalitionspartner FDP jeweils sekundierte. Kiesinger feierte im September 1969 einen Wahlsieg, der keiner wurde. Der Sturz Willy Brandts im Mai 1974 war eine traurige Mischung aus Selbst- und Fremddemontage, der Mann mit seinen Kräften am Ende. Helmut Schmidt sollte es richten, und es gelang. Doch nach über acht Amtsjahren und einem erfolgreichen konstruktiven Mißtrauensvotum der Opposition mußte er seinem weithin unterschätzten Nachfolger Helmut Kohl weichen. Der brach im Herbst 1996 den Amtsrekord seines erklärten politischen Großvaters Konrad Adenauer: die Kanzlerschaft des Pfälzers ging ins nunmehr fünfzehnte Jahr. Zwei Jahre später mußte auch er seinen Abschied nehmen. Helmut Kohl war als erster Bundeskanzler direkt abgewählt worden.
Gerhard Schröder, der Triumphator des historischen Wahlsonntags, konnte am 27. September 1998 den größten Stimmenvorsprung für sich verbuchen, den je ein Herausforderer erzielt hatte. Machtwechsel in Bonn, der letzte vor dem Umzug der Bundespolitik nach Berlin. Zeitenwende? Richtungswechsel? Wachsende Herausforderungen, drinnen und draußen. Der Ausgang bleibt ungewiß. Keinem Kanzler halfen die Erfahrungen seiner Amtsvorgänger so wenig wie Schröder. Adenauer? Eine Sagengestalt. Die alte Bundesrepublik und ihre idyllische Einhegung, im Rückblick ein Puppenheim, sind vorbei, wurden Geschichte. Der Kanzler der Berliner Republik regiert ein anderes Land, in einer anderen Welt.
Und damals – nach der Katastrophe? Wer nach Ende des Zweiten Weltkrieges durch die rauchenden Trümmerlandschaften Deutschlands stieg, tat sich schwer, nach vorne zu blicken, an eine Zukunft zu glauben. Wo einst Straßen und Alleen das Bild der Metropolen geprägt, wo Rathäuser und Kathedralen, Bahnhöfe und Geschäfte oder das eigene Zuhause gestanden hatten, erstreckten sich Trümmerfelder, so weit das Auge reichte. 131 deutsche Städte waren während des Krieges durch Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt worden, darunter München und Frankfurt, Köln und Hamburg, Dresden und Berlin, das Willy Brandt nach dem Krieg so erlebte: »Krater, Höhlen, Schuttberge, Trümmerfelder, Geröllhalden, Ruinen, die kaum noch erkennen ließen, daß hier einst Häuser gestanden hatten, Kabel und Wasserleitungen, die wie die zerstückelten Eingeweide eines vorsintflutlichen Untiers aus der Erde ragten, keine Heizung, kein Licht, jeder kleine Garten ein Friedhof und über allem wie eine unbewegliche Wolke der Gestank der Verwesung.«
Dennoch gab es Millionen, für die dieses »Niemandsland am Rande der Welt« ein Ziel, die einzig verbliebene Hoffnung war: Bis zum Oktober 1946 strömten nicht weniger als zwölf Millionen Menschen in die Ruinenlandschaften – Vertriebene aus Ost- und Ostmitteleuropa, Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit vor Stalins Statthaltern und Armeen. Eine ungeheure Herausforderung, machten sich doch in den westlichen Besatzungszonen, in denen das Riesenheer der Vertriebenen anstrandete, die desolate Ernährungslage, der Zusammenbruch der Energieversorgung und des Verkehrswesens, die Zerstörung von mehr als der Hälfte des Wohnraums, aber auch die Spätfolgen nationalsozialistischer Wirtschafts- und Währungspolitik erst jetzt in vollem Ausmaß bemerkbar. Im Westen verhinderte das Eingreifen der Besatzungsmächte das Schlimmste, vor allem während des harten Winters 1946/47. In der von den Sowjets okkupierten Zone verdüsterten Demontagen und Deportationen die Lage dauerhaft.
Die Trümmer und Ruinen waren sichtbar, die Verwüstung und Verwirrung in den Köpfen der meisten Deutschen waren es nicht. Als sich den Alliierten nach und nach die Verbre-chen des nationalsozialistischen Deutschland offenbarten, wirkte das wie die Rechtfertigung ihres Sieges, ihrer Politik schlechthin. Kein Wunder, daß diese Bilanz die Prioritäten setzte: Der Wiederaufbau des Landes war unausweichlich; vordringlich aber waren Antworten auf die Frage nach Schuld und Verantwortung.
Vorübergehend geschlossen: Insgesamt finden zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in den Westzonen eine neue Heimat
Den meisten war bewußt, daß man im Nürnberger Tribunal tatsächlich nur die »Hauptkriegsverbrecher«, einige wenige führende Repräsentanten des Regimes, zur Rechenschaft gezogen und verurteilt hatte. Wie aber stand es um das Volk? Wer war Täter, wer nur Mitläufer, und wer konnte als entlastet gelten? Gab es eine Kollektivschuld? Wie vollständig Deutschland diskreditiert war, konnte man immerhin sehen: In Nürnberg stand nie zur Debatte, auch einen Vertreter des »anderen«, nicht-nationalsozialistischen Deutschland als Ankläger zuzulassen.
Die alleinige staatliche Macht übte seit Juni 1945 der in Berlin sitzende Alliierte Kontrollrat der Besatzungsmächte aus. Zwischen Großbritannien, den USA, der Sowjetunion und Frankreich war Deutschland in Zonen geteilt. Das konnte nicht gutgehen. Immerhin saßen hier vier im Boot der sogenannten Anti-Hitler-Koalition, die eigentlich nur ein einziges gemeinsames Ziel gehabt hatten: die Niederwerfung Deutschlands. Alles andere war Dissens, bestenfalls Kompromiß.
Gewiß, auch Amerikaner und Briten ließen damals keinen Zweifel, was sie von ihren deutschen Kriegsgegnern und deren Art der Kriegführung hielten. Aber sie folgten dabei im allgemeinen Regeln und Gesetzen, die von den Besiegten selbst häufig genug außer Kraft gesetzt worden waren. Anders sah es im Machtbereich der Sowjetunion aus: Wo Stalins Rote Armee vorrückte, waren Mord, Vergewaltigung und Plünderung an der Tagesordnung, und allzuoft waren die Opfer Unschuldige, auch unzählige Frauen und Kinder. Daß die Deutschen auf ihren Eroberungs- und Vernichtungsfeldzügen im Osten kaum anders vorgegangen waren, minderte die Leiden dieser Menschen nicht. Kein Wunder also, daß sich, bald nach Einstellung der Kampfhandlungen, zwischen den Westmächten und der Sowjetunion ein Gegensatz auftat, den die »Anti-Hitler-Koalition« nur kurzzeitig zugedeckt, aber niemals überwunden hatte.
Dabei kam es zu einem bemerkenswerten Vorgang: Die Frage nach der Behandlung des besiegten Deutschland, die in sich die Probleme von Entnazifizierung und Demokratisierung, von Wiedergutmachung und wirtschaftlichem Neuaufbau, von Entmachtung und neuer Staatlichkeit barg, wurde von den weltpolitischen Ereignissen überholt, von ihnen beantwortet. Am Ende einer rasanten Entwicklung standen 1949 zwei Staatsgründungen. Sie verkörperten geradezu das Unvermögen der beiden Welt- und neuen Vormächte USA und Sowjetunion, sich über Deutschland zu verständigen.
Die Sowjets fackelten nicht lange, schufen vollendete Tatsachen. So führten sie zwar, wie auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 mit Briten und Amerikanern vereinbart, in ihrer Besatzungszone eine umfassende Entnazifizierung durch, sorgten aber gleichzeitig und vorrangig dafür, daß bewährte Kommunisten an die Schalthebel der politischen und wirtschaftlichen Verwaltung gelangten. Die Entnazifizierung sollte in erster Linie potentiell feindlich betrachtete bürgerliche »Elemente« kaltstellen, ausschalten. Grundsätzlich galt das auch für die traditionsreichste deutsche Partei: Schon im April 1946 wurde in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gegen den erbitterten Widerstand vieler Sozialdemokraten, insbesondere ihres Vorsitzenden in den Westzonen, Kurt Schumacher, die Vereinigung der SPD mit der KPD zur Sozialistischen Einheitspartei (SED) vollzogen: Die Teilung des Landes war in der Spaltung der Partei vorweggenommen.
Die Gefahr, daß die Sowjetunion einen Teil Deutschlands zu einem ihrer kommunistischen Satellitenstaaten machen würde, war groß. Und selbst das empfanden manche nur als eine erste Etappe auf dem Weg sowjetischer Expansionsabsichten. Das russische Fernziel heiße Weltherrschaft, beschrieb der amerikanische Präsident später seine auf der Potsdamer Konferenz gewonnene Gewißheit. Seine Gegenstrategie lautete »Eindämmung«. Am 12. März 1947 verkündete Harry S. Truman vor dem amerikanischen Kongreß die nach ihm benannte Doktrin: Alle, »deren Freiheit von militanten Minderheiten oder durch einen von außen ausgeübten Druck bedroht« würde, könnten auf amerikanische Unterstützung hoffen – jedenfalls auf wirtschaftliche und finanzielle. An wen diese Botschaft gerichtet war, mußte der Präsident nicht eigens erläutern.
Diese dramatische Kehrtwende der amerikanischen Außenpolitik zeitigte auch für die Bevölkerung der westlichen Besatzungszonen in Deutschland umgehend und unmittelbar Wirkung. Die ursprünglich angepeilte umfassende Entnazifizierung geriet angesichts der neuen weltpolitischen Situation in den Hintergrund, zeitweilig fast aus dem Blick. Für die vormaligen Kriegsgegner Deutschlands gab es eine neue Herausforderung: Das Böse, das man sechs Jahre lang bekämpft hatte, schien in anderem, knallrotem Gewand erneut zum Angriff auf die freie Welt anzusetzen. Dem galt es gegenzusteuern. Schon im Juni 1947 zogen die Amerikaner die Konsequenzen aus Trumans Ankündigung und brachten ein gigantisches wirtschaftliches Hilfsprogramm für Europa auf den Weg, das nach seinem Erfinder, Außenminister George Marshall, bekannt geworden ist und auch die drei Westzonen einbezog. Nur ein Jahr später übergaben deren Militärgouverneure den Ministerpräsidenten der inzwischen neugebildeten westdeutschen Länder die »Frankfurter Dokumente«, in denen sie zur Ausarbeitung einer gemeinsamen Verfassung aufgerufen wurden. Eine Bundesrepublik Deutschland kam in Sicht.
Das war die Stunde Ludwig Erhards. Der hatte die Zeit genutzt, hatte seine marktwirtschaftlichen Konzepte weiterentwickelt. Jetzt bekam er die Chance, sie umzusetzen. Bereits zum 1. Januar 1947 hatten Amerikaner und Briten ihre Besatzungszonen zur sogenannten Bizone zusammengelegt, und am 2. März 1948 wurde Erhard zum »Direktor der Verwaltung der Wirtschaft«, sozusagen zum Wirtschaftsminister dieses »Vereinigten Wirtschaftsgebietes« ernannt. Damit bekleidete er den wohl einflußreichsten Posten, den ein deutscher Politiker zu diesem Zeitpunkt einnehmen konnte. Erhard nutzte die Befugnisse bis hart an die Grenzen des Erlaubten. Als am 20. Juni 1948, auf Anordnung der Westmächte und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, eine Währungsreform durchgeführt wurde, riß er die Initiative an sich.
Ohne daß die Alliierten oder der deutsche Länderrat dieses Vorgehen gebilligt hätten, ließ Erhard seinen Pressesprecher über den Rundfunk das Ende der Bewirtschaftung und die Aufhebung der Preiskontrollen für eine große Zahl von Waren bekanntgeben – ein Befreiungsschlag. Die Währungswurde an eine Wirtschaftsreform gekoppelt, und die Westdeutschen wurden zum Sprung in das kalte, unbekannte Wasser der freien Marktwirtschaft gezwungen. Der Erfolg gab Erhard recht. Nachdem die Besatzungsmächte sein Vorgehen zunächst für übereilt gehalten hatten, außerdem im November 1948 fast zehn Millionen Beschäftigte in der Bizone in den Streik getreten waren, begann um die Jahreswende langsam, aber merklich der Aufschwung. Das kalte Wasser verwandelte sich gewissermaßen in ein wohltemperiertes, belebendes, energiespendendes Bad, und der zigarrerauchende Erhard wurde im Laufe der Zeit zum Symbol für einen neuen, ungekannten, ungeahnten Wohlstand.
Das war die eine Seite, aber es gab auch eine andere. Weil nicht nur die Deutschen, sondern auch die Sowjets von der Währungsreform überrascht wurden, entschloß sich Stalin, Nägel mit Köpfen zu machen. Wie zuvor den Alliierten Kontrollrat für Deutschland, legte er durch den Rückzug des sowjetischen Vertreters jetzt auch die Alliierte Kommandantur Berlins lahm und ließ seinerseits in der SBZ sowie in »Groß-Berlin« am Morgen des 23. Juni eine eigene Währung installieren. In der Nacht gingen dann auf den Straßen und in den Wohnungen Berlins die Lichter aus; tags darauf funktionierten weder Strom noch Gas. Die Eisenbahnen standen still, die Binnenschiffahrt ruhte, die Zugangswege nach Berlin waren plötzlich unpassierbar – alles angeblich wegen »technischer Schwierigkeiten«. Stalin hatte sämtliche Land- und Wasserverbindungen in die ehemalige Reichshauptstadt kappen lassen.
Das war der Anfang der fast einjährigen Blockade Berlins und zugleich der Auftakt zu einer der ungewöhnlichsten und spektakulärsten Aktionen der Luftfahrt: Dieselben Flugzeuge, die noch wenige Jahre zuvor Zerstörung und Tod über die Stadt gebracht hatten, kehrten jetzt, geflogen von ihren amerikanischen und britischen Besatzungen, als »Rosinenbomber« zurück und beförderten Nahrung, Brennstoffe und Medikamente in die geschundene Metropole – 900 Maschinen täglich mit einer durchschnittlichen Lieferung von 13 000 Tonnen. »Schaut auf diese Stadt!«, beschwor der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter am 9. September 1948 die »Völker der Welt«. Diskrete Verhandlungen, unter anderem am Rande der Vereinten Nationen, zogen sich in die Länge. Erst als Stalin die Aussichtslosigkeit seiner Blockade eingesehen hatte, lenkte er ein: Am 12. Mai 1949 hoben die Sowjets die Blockade auf. Die Stadt aber blieb geteilt – kein gutes Omen für die Zukunft Deutschlands.
Die Weichen waren längst auf Teilung gestellt. Im Sommer 1945, wenige Wochen nach dem Vorlauf in der SBZ, waren auch in der britischen und amerikanischen, später in der französischen Zone Parteien zugelassen worden. Bald kam es zu Wiedergründungen, namentlich von SPD und KPD, aber auch zu neuen Formierungen – allen voran der CDU beziehungsweise ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU. Diese verstanden sich als »Volksparteien« im weitesten Sinne, offen für alle Schichten der Bevölkerung und vor allem: für Angehörige der beiden großen Konfessionen in Deutschland. Von den zahlreichen übrigen Parteien setzte sich langfristig nur die FDP, ein Zusammenschluß der beiden liberalen Strömungen des Deutschen Reiches, als mitgestaltende bundespolitische Kraft durch. Bei den anderen handelte es sich zu-meist um regionale Zusammenschlüsse wie die Bayernpartei oder die Niedersächsische Landespartei, die von ihrer ganzen Anlage und Programmatik her keine Volksparteien werden konnten.
Was ist sie wert? Einführung der D-Mark, 20. Juni 1948
Daß allein die neugegründete CDU der traditionsreichen SPD den Führungsanspruch in Deutschland streitig machen konnte, lag an den Persönlichkeiten der ersten Stunde: Konrad Adenauer konnte Kurt Schumacher das Wasser reichen. Als der große, schlanke, kerzengerade Herr nach dem Krieg erneut die politische Arena betrat, lag seine politische Zukunft nach menschlichem Ermessen hinter ihm. 1876 geboren, hatte Adenauer 1906, also mit dreißig Jahren, als Vertreter der Zentrumspartei in Köln seine kommunalpolitische Karriere begonnen. 1917 wurde der vom Militärdienst befreite Rheinländer Oberbürgermeister von Köln, damals übrigens als jüngstes Stadtoberhaupt in ganz Deutschland. Seit 1920 gehörte er außerdem dem Preußischen Staatsrat an, zeitweilig als dessen Präsident. 1933 von den Nationalsozialisten aus dem Kölner Rathaus vertrieben, verbrachte Adenauer die folgenden zwölf Jahre zurückgezogen – in der inneren Emigration und wiederholt in Angst um sein Leben. 1944 saß er in Gestapo-Haft. Während dieser Zeit arbeitete Konrad Adenauer nicht, wie die Angehörigen der deutschen Opposition gegen Hitler, an politischen Konzeptionen für das »andere Deutschland« oder verfaßte, wie sein Nachfolger im Kanzleramt Ludwig Erhard, Denkschriften für den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Vielmehr ging er unauffällig privaten Neigungen nach und versuchte sich, weitgehend erfolglos, als Erfinder.
Unmittelbar nach Kriegsende kehrte Konrad Adenauer auf die politische Bühne zurück, ungebrochen, nüchtern, verantwortungsbereit: Er wisse, was nun zu tun sei – es lag offen zutage, man mußte es nur anpacken. Tatsächlich erwiesen sich sein Alter und seine Lebenserfahrung als unschätzbarer Vorteil. Er war nicht – wie die Jüngeren – wesentlich von Hitlers Deutschland geprägt. Die zwölf Jahre des »Tausendjährigen Reiches« empfand auch er als furcht-bar. Aber sie waren eine vorübergehende, kurze Schreckenszeit, eine triste Episode, kein bleibendes, ewiges Trauma. Adenauers Wurzeln reichten zu tief, als daß Diktatur und »Stunde Null« sie ernsthaft hätten beschädigen können.
Nachkriegserfahrung: Alliierte »Rosinenbomber« über Berlin, 1948/49
Er war persönlich und politisch im tüchtigen, starken, selbstsicheren Deutschen Kaiserreich groß geworden. Rheinisch und katholisch, wie er war, zeigte er sich wenig anfällig für dessen forsche Töne und Attitüden, gehörte, so gesehen, zu den Außenseitern. Aber die Zeitprägung war stärker als die gesellschaftliche Randlage. Adenauer blieb lebenslang ein selbstbewußter Deutscher, gleichermaßen zielstrebig und gelassen. Solche Eigenschaften waren gefordert, als es darum ging, dem fragilen Kunstprodukt Bundesrepublik solide, dauerhafte Fundamente zu verschaffen: Wirtschaftswunder, Westintegration, Wiederbewaffnung, vor allem eine stabile, führungsstarke Demokratie. André François-Poncet, als französischer Botschafter und Hoher Kommissar jahrzehntelang mit den Deutschen vertraut, hat hellsichtig gemeint, ihr Land müsse einen rauhen Kanzler haben.
Diesen Wesenszug teilte Adenauer mit vielen seiner Generation – kein Wunder nach den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre. Mancher wurde durch sie zum Menschenverächter. Nicht so Konrad Adenauer – zumindest konnte er, weil er humorvoll war, schlagfertig und witzig, seinen Zynismus tarnen. Seinem großen innenpolitischen Gegner gelang das weniger gut. Carlo Schmid, Sozialdemokrat der ersten Stunde, hat gesagt, man blicke bei Kurt Schumacher in das »Schmerzensantlitz« des Dritten Reiches. Schon im Ersten Weltkrieg, als junger Kriegsfreiwilliger, hatte Schumacher seinen rechten Arm verloren. Infolge jahrelanger Konzentrationslagerhaft unter den Nationalsozialisten mußte ihm später ein Bein amputiert werden. Sein Gesicht wurde von einem nervösen Zucken geplagt. Schumachers Reden waren durchtränkt von höhnischem Sarkasmus und bitterer Ironie. Dieser Mann strahlte im Gegensatz zu Adenauer äußerlich wenig Hoffnung aus, was angesichts seines Schicksals nicht überrascht. Sein geschundener Körper erweckte Mitleid, seine geistige Schärfe und Überlegenheit Respekt, bei nicht wenigen auch Furcht. Schumacher verkörperte gleichsam die Erinnerung an das Unheil, das Deutschland auch über sich selbst gebracht hatte.
Gezeichnet: Kurt Schumacher und Herbert Wehner, Juli 1949
Die Unterschiede der Charaktere zwischen den beiden waren auffallend; die Gegensätze in der Sache erst recht. Am Ende seines langen Lebens nach der prinzipiellen Schranke zwischen ihm und Schumacher befragt, nannte Adenauer 1965 ohne Zögern dessen »Nationalismus«. Gewiß, wie sein christdemokratischer Kontrahent war auch der erste SPD-Vorsitzende der Nachkriegszeit ein Befürworter westlicher Werte, die in seiner Lesart ohnehin die grundlegenden Werte »aller Menschen mit moralischem Verantwortungsgefühl für ihre Mitmenschen« waren. Allerdings hatte das Gebot nationaler Einheit für Schumacher höhere Priorität als die politische Anbindung an den Westen. Der kernige Sozialdemokrat aus Kulm an der Weichsel hoffte, Deutschland könne zusammen mit den anderen mitteleuropäischen Ländern eine Art »Dritte Kraft« zwischen West und Ost bilden. Damit stand er in der Tradition prominenter deutscher Politiker der Weimarer Zeit, die Deutschlands außenpolitische Rolle im Ausgleich zwischen West und Ost gesehen hatten.
Für den Kölner Konrad Adenauer dagegen gab es, Teilung hin oder her, nur einen Weg vernünftiger, verantwortungsbewußter deutscher Politik, und der führte nach Westen. Nach der Währungsreform war die nächste große Etappe auf diesem Weg die Ausarbeitung und Verabschiedung einer Verfassung. Dazu waren die Ministerpräsidenten der neun westdeutschen Länder und die Bürgermeister der zwei Stadtstaaten Hamburg und Bremen bereits im Juli 1948 von den drei westlichen Militärgouverneuren aufgerufen worden. Doch bei der Beratung über die weitere Vorgehensweise meldeten sich deutsche Skrupel und Vorbehalte vernehmlich zu Wort: Schrieb die Verabschiedung einer Verfassung nicht auf unabsehbare Zeit die Teilung fest? Letztlich gab es wenig Alternativen. Die einzige Möglichkeit, zu einer stärkeren Verhandlungsposition gegenüber den Alliierten zu gelangen, war die Staatsbildung. Also nahm man, nach einigem Zögern, den Auftrag an, setzte allerdings durch, daß die Verfassung nur als »Grundgesetz« ausgegeben würde, um den provisorischen Charakter des Staatengebildes zu betonen. Nachdem die Militärgouverneure den Text nach wiederholten Einsprüchen und Korrekturen am 12. Mai genehmigt hatten, wurde die neue Verfassung am 23. Mai 1949 feierlich verkündet.
Aus 331 Meter Höhe schaut man von der Kuppe des Petersbergs auf die Stadt Bonn herab. Hier, auf dem höchsten Punkt des malerischen Siebengebirges, hatte schon lange vor dem Krieg ein Kurhotel Besucher und Gäste angelockt, die in der Vulkanlandschaft gesunden wollten. Jetzt war das Gebäude Hauptsitz der drei Hohen Kommmissare, wie die vormaligen Militärgouverneure hießen, seit das Besatzungsstatut im April 1949 veröffentlicht und ein halbes Jahr später, am 21. September, in Kraft getreten war. Tag für Tag, wenn Konrad Adenauer mit der Fähre vom östlich des Flusses gelegenen Rhöndorf ins linksrheinische Bonn übersetzte, hatte er den Berg im Blick: Dort oben also saßen die Vertreter der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs und beobachteten mit wachsamen Augen die ersten politischen Gehversuche der zweiten deutschen Demokratie – bereit und berechtigt einzugreifen, sobald die Deutschen vom gewünschten Kurs abzukommen drohten. Sie konnten jedes Gesetz zu Fall bringen, und selbstverständlich vertraten sie die Bundesrepublik nach außen: Fremde Botschafter wurden bei ihnen akkreditiert, nicht beim Bundespräsidenten. Die Bundesrepublik Deutschland war noch über Jahre kein souveräner Staat.
Kein beneidenswerter Zustand, besonders nicht für die neue Regierung, die in vitalen Fragen abhängig, ja ohnmächtig war, vor allem auch bei jenem Thema, das auf der Skala außenpolitischer Forderungen und Wünsche damals noch ganz oben rangierte: der Wiedervereinigung Deutschlands. In diesem Punkt waren sich fast alle einig, die beiden großen Parteien ohnehin. Konrad Adenauer wie Kurt Schumacher bauten auf die »Magnettheorie«. Ein wirtschaftlich prosperierender Westen werde binnen kurzer Zeit eine so unwiderstehliche Anziehungskraft auf die DDR ausüben, daß die Sowjetunion den östlichen Teil Deutschlands schließlich aufgeben müsse – wobei Schumacher unter »Westen« die Bundesrepublik, Adenauer ein geeintes Westeuropa verstand: das deutsche Gewicht, allein genommen, werde zu schwach sein.
In gewisser Weise sollten sie damit recht behalten, Adenauer mehr als Schumacher, auch wenn diese Entwicklung vier Jahrzehnte auf sich warten ließ. Anfänglich stand für die beiden Parteivorsitzenden wie für die Mehrheit der Deutschen zudem fest, daß sich das Gebot der »Wiedervereinigung« auch auf jene Gebiete östlich von Oder und Neiße beziehe, die 1937 zu Deutschland gehört hatten und als Folge der Potsdamer Vereinbarungen unter polnische und sowjetische Verwaltung geraten waren. Deutschland »3 geteilt? niemals!« konnte man bis in die sechziger Jahre hinein auf großen Tafeln in deutschen Städten lesen.
Damit endeten die Gemeinsamkeiten zwischen den Vertretern der beiden großen Volksparteien aber auch schon. Adenauer setzte, stärker noch als vor Gründung der Bundesrepublik, auf die unbedingte außen- und sicherheitspolitische Anbindung an den Westen, zugleich auf eine »Politik der Stärke« gegenüber »Sowjetrußland«, wie er in der Sprachregelung der zwanziger Jahre zu sagen pflegte. Schumacher hielt diese Stratgie für gefährlich, für unvereinbar mit der Aufforderung des Grundgesetzes, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Adenauers Politik werde nicht etwa die Teilung des Landes überwinden, sondern seine Spaltung zementieren.
Im Wahlkampf des Sommers 1949 prallten die Gegensätze aufeinander – schärfer denn je. CDU und SPD beurteilten ja nicht nur die Westintegration und die mit ihr zusammenhängende Zukunft Gesamtdeutschlands höchst unterschiedlich. Auch in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen gab es wenige Gemeinsamkeiten. Das maßgeblich von Ludwig Erhard formulierte Konzept einer Sozialen Marktwirtschaft, auf das sich die Christdemokraten im Sommer 1949 endgültig festgelegt hatten, war auch nur schwer mit jenen Planungs- und Lenkungsmaßnahmen vereinbar, welche die meisten Sozialdemokraten beim Wiederaufbau des zerstörten Landes vorerst für unverzichtbar hielten.
Welches Deutschland soll es sein? Bis in die sechziger Jahre wurde auf emaillierten Großtafeln eine Wiedervereinigung Deutschlands in den Grenzen von 1937 gefordert – also einschließlich der 1945 an Polen und die Sowjetunion gefallenen Gebiete
Jetzt waren die Wähler gefragt; am 14. August 1949 wurden sie an die Urnen gerufen. Sieht man von Landtagswahlen ab, war das die erste freie und geheime Wahl in Deutschland nach 17 Jahren. Die Spannung war auch auf alliierter Seite groß. Das Ergebnis ließ Raum für Interpretationen. Keine Partei kam auch nur über die 30-Prozent-Hürde, von einer absoluten Mehrheit gar nicht zu reden. Die SPD, der man den Wahlsieg zugetraut hatte, mußte sich, für alle überraschend, mit 29,2 Prozent der Stimmen zufriedengeben, erhielt im ersten Bundestag sogar weniger Mandate als CDU und CSU, die insgesamt 31 Prozent der Stimmen für sich verbuchen und damit die stärkste Fraktion stellen konnten. Zusammen aber hatten die beiden großen demokratischen Volksparteien weit mehr als die Hälfte der Mandate. Die Liberalen erzielten erstaunliche 11,9 Prozent der Stimmen, ein Ergebnis, das an ihre besten Jahre nach Gründung des Deutschen Reiches oder auch nach Errichtung der Weimarer Republik erinnerte. Somit empfahl sich die FDP schon im ersten Bundestag als potentieller Koalitionspartner. Die übrigen fast 30 Prozent verteilten sich auf mehrere kleine Parteien, von denen immerhin sechs den Einzug ins Parlament geschafft hatten. Das erinnerte manchen an Weimarer Verhältnisse.
Aus denen aber wollte man lernen, die Konsequenzen ziehen. Sie lagen in einer starken, trag- und handlungsfähigen Koalition. Wie auch später in politisch schwierigen Zeiten schien sich eine Große Koalition anzubieten – trotz aller Gegensätze. Entschiedener Gegner eines solchen Zweckbündnisses war Konrad Adenauer. Nicht alle in seiner Partei dachten damals wie er. Zwar war der Patriarch in den letzten Jahren zu einer Führungspersönlichkeit innerhalb der CDU aufgestiegen, aber er war nicht die einzige. Karl Arnold, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Jakob Kaiser, der ehemalige CDU-Vorsitzende der SBZ, und andere mehr machten Adenauer nicht nur seinen Führungsanspruch streitig, sondern sie vertraten auch alternative politische Konzepte. Die Idee eines geeinten, blockfreien Deutschlands, das Brücke zwischen Ost und West sein sollte, gehörte dazu, aber auch die Hoffnung auf den innenpolitischen Brückenschlag einer Großen Koalition aus CDU und SPD.
Jetzt bewies Adenauer, was in ihm steckte: Am 21. August 1949, einem Sonntag, die Wahl lag gerade eine Woche zurück, lud der altersweise, listenreiche Routinier eine Reihe einflußreicher CDU/CSU-Mitglieder in sein Haus nach Rhöndorf ein. Augenscheinlich handelte es sich um eine Zusammenkunft privater Natur. Tatsächlich wurden unter der Regie Adenauers die Weichen für die Zukunft gestellt. Als Gastgeber hatte er den Vorteil auf seiner Seite: Er ergriff als erster das Wort, er bestimmte die Pausen, er sorgte für eine opulente Bewirtung, und er beendete die Zusammenkunft, als er den Zeitpunkt für gekommen hielt. So fielen im Laufe dieses hochsommerlich heißen Tages die Würfel zu seinen Gunsten. Am Ende trat die Runde nicht nur für eine bürgerliche Regierungskoalition ein, bestehend aus CDU/CSU, FDP und der niedersächsisch-konservativen Deutschen Partei, sondern auf Vorschlag des Gastgebers auch für den FDP-Vorsitzenden Theodor Heuss als Bundespräsidenten sowie, natürlich nicht zuletzt, für Konrad Adenauer als Bundeskanzler. Ein, zwei Jahre könne er dieses Amt in seinem Alter nach Meinung seines Hausarztes noch ausüben, erklärte er den Versammelten in schlauer Bescheidenheit.
Geplant, getan: Am 12. September 1949 wurde Theodor Heuss zum Bundespräsidenten gewählt, drei Tage danach Konrad Adenauer zum Bundeskanzler – mit einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen. Wenig später trat das erste Kabinett zusammen. In seiner aufschlußreichen Kombination von Namen und Ressorts spiegelte es die spezifische Lage der jungen Republik. Daß Ludwig Erhard das Wirtschaftsministerium übernahm, war keine Überraschung, und Fritz Schäffer von der CSU galt auch deshalb als die geeignete Besetzung für das benachbarte Finanzressort, weil er dieses Amt schon in Bayern bekleidet hatte. Die Liberalen hatten wenig Mühe, ihren Vorsitzenden auf dem Sessel des Vizekanzlers zu plazieren. Daß Franz Blücher gleichzeitig das Ministerium für »Europafragen« übernahm, hatte weniger mit europapolitischen Visionen als mit den »Angelegenheiten des Marshallplans«, also mit der alles überragenden Frage zu tun, wie man mit den dramatischen Folgen des Krieges zurechtkommen könne.
Kein Wunder, daß neben den Europafragen auch die Vertriebenen und der Wiederaufbau eigene Ministerien erhielten. Andere, klassische Ressorts hingegen fehlten. Aber was hätte ein Land ohne äußere Souveränität auch mit einem Außen- und mit einem Verteidigungsministerium anfangen sollen? Erst mit der Wiedereinrichtung des Auswärtigen Amtes am 15. März 1951, Folge der gelockerten Besatzungsherrschaft, gab es wieder einen Außenminister – einen Posten, für den der Kanzler vorerst, bis zur Erlangung der fast vollständigen Souveränität im Mai 1955, keinen Geeigneteren zu benennen wußte als sich selbst; und erst mit der Aufnahme der Bundesrepublik in die westlichen Verteidigungsgemeinschaften hatte das Land seit Juni 1955 einen richtigen Verteidigungsminister – zunächst Theodor Blank, seit Oktober 1956 dann Franz Josef Strauß. Der 1915 geborene Bayer, der es 1952 zum stellvertretenden Vorsitzenden der CSU gebracht hatte, war übrigens zuvor erster Chef des im Oktober 1955 eingerichteten Ministeriums für Atomfragen gewesen, wie die zwei Jahre später in »Bundesministerium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft« umbenannte Behörde damals noch hieß.
Nicht nur die Regierungsparteien richteten sich im Sommer 1949 in den neuen parlamentarischen Verhältnissen ein, auch Kurt Schumacher folgte den neuen Spielregeln und stellte in seiner Erwiderung auf Adenauers Regierungserklärung am 21. September 1949 für die SPD fest, daß »die Opposition sich nicht in der bloßen Verneinung der Regierungsvorschläge erschöpfen« könne; vielmehr wolle und müsse sie »mit konkreten Vorschlägen der Regierung« ihren »positiven Gestaltungswillen« aufzwingen. Also konstruktive, auf den Erhalt des Staatswesens bedachte Oppositionspolitik. Das war im Vergleich zu Weimarer Verhältnissen nicht selbstverständlich. Schumacher verkörperte die Figur eines parlamentarischen Oppositionsführers, den es bis dahin in Deutschland nicht gegeben hatte.
Die Opposition war für Adenauer ein Problem; die hauchdünne Mehrheit seiner Regierung war ein anderes. Aber der Kanzler hatte die eigenen Reihen insgesamt fest im Griff. Das lag an der Persönlichkeit des Patriarchen, der Partei, Fraktion und Koalition mit milder Autorität regierte; es lag aber auch an einigen Bestimmungen des Grundgesetzes, die Adenauer entschieden in seinem Sinne auslegte. So die Definition der Richtlinienkompetenz, dank deren der Bundeskanzler die Maximen der Politik bestimmt und dafür die Verantwortung trägt. Außerdem – und auch das half Adenauer – kann der Kanzler nur dann durch ein Mißtrauensvotum sein Amt verlieren, wenn aus den Reihen des Parlaments ein konstruktiver Gegenvorschlag kommt, also ein Nachfolger mit ausreichender Mehrheit gewählt wird. In der Geschichte der Bundesrepublik ist ein solches »konstruktives Mißtrauensvotum« zweimal gewagt worden, nur einmal mit Erfolg.
Während der Regierungszeit Adenauers verfiel niemand ernsthaft auf diese Idee, schon weil der Kanzler es verstand, seine Partei an sich zu binden, auf seine Person auszurichten. Ihre Gegner quittierten diese Strategie mit Spott. Ein »Kanzlerwahlverein« sei die CDU, eine Partei, die sich nicht über Inhalte und Programme, sondern über Personen definiere. Damit konnte man leben, solange sich Erfolge einstellten. Erst 1978, als sie entgegen allen Erwartungen in ihr zehntes Oppositionsjahr ging, sollte die Partei ein Grundsatzprogramm formulieren. Daran mochte in den Gründertagen von Partei und Republik niemand denken. Einstweilen waren Programm, Partei und Regierungschef eins, zumal der Kanzler für einige Jahre die außen- und sicherheitspolitischen Kompetenzen an sich zu ziehen wußte. Das war ein Startvorteil, und Adenauer nutzte ihn entschlossen.
Als er 1949 Kanzler wurde, war er ein gestandener Mann, frei von Zögern und Selbstzweifeln. Konrad Adenauer wußte, daß sein Weg die Bundesrepublik zum Erfolg führen werde. Zwei Jahre vor seinem Tod antwortete er dem Journalisten Günter Gaus auf die Frage, ob es für ihn »nie eine Last bedeutet« habe, »Entschlüsse fassen zu müssen«, mit einem schlichten, unkommentierten »Nein«. Ob es einsame Entscheidungen gewesen seien? »Herr Gaus, Sie schreiben ja Bücher. Sind Sie da nicht ein Mann der einsamen Entschlüsse? Fragen Sie vorher Kollegen, was Sie schreiben sollen?« Der Beruf des Kanzlers, das wußte nun wirklich niemand besser als Adenauer, forderte seinen Tribut. Einsamkeit war der Preis, wenn man sich keine Schwäche erlauben konnte, entscheidungsstark und konsequent erscheinen mußte.
So zielstrebig und beharrlich Adenauer auch war, im Rahmen seiner Grundüberzeugungen blieb er flexibel. Pragmatiker war er, kein Intellektueller. Ausgefeilte Konzeptionen, an die man sich sklavisch zu halten hatte, waren seine Sache nicht. Seine erste Frage galt der Machbarkeit unter den jeweils gegebenen Umständen. Der Kanzler war ein Anhänger der »Kunst des Möglichen«, insoweit ein Bismarckianer reinen Wassers. In Verbindung mit seinem überlegenen taktischen Geschick sicherte ihm dieser pragmatische Zug über fast vier Legislaturperioden hinweg die einflußreichste Position im politischen Gefüge. Aber Taktik hin, Pragmatismus her: Konrad Adenauer war auch ein Mann fester Grundsätze und verbindlicher Maximen, gerade in der Politik. Die Sicherung individueller Freiheit, parlamentarischer Verantwortung und der europäisch-atlantischen Westbindung der Bundesrepublik rangierten dabei an vorderster Stelle. Schon zu Zeiten der Weimarer Republik war er nicht nur Demokrat aus Überzeugung gewesen, sondern auch Verfechter einer klaren Westorientierung Deutschlands, wobei ihm schon damals unter anderem eine Verklammerung der westdeutschen und der französischen Kohle- und Stahlindustrie vorschwebte.
Und dann war Adenauer ein Kind rheinisch-katholischen Bürgertums. Für ihn war Köln das Zentrum des christlichen Abendlandes. Die Vormachtstellung Preußens im Deutschen Reich war dem Lokalpatrioten wie vielen seiner Landsleute stets ein Dorn im Auge gewesen. Schon Anfang der zwanziger Jahre hatte er deshalb einen – von Preußen losgelösten – westdeutschen Bundesstaat im Rahmen des Reiches favorisiert, weshalb man ihn bisweilen – ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt – des Separatismus verdächtigte. Vertraulich hatte er damals geäußert, daß für ihn bei Braunschweig die »asiatische Steppe« beginne; in Magdeburg ziehe er immer die Vorhänge zu; wenn er über die Elbe fahre, spucke er aus dem Fenster. Nach dem Zweiten Weltkrieg gestand er, sich in Berlin immer wie in einer heidnischen Stadt gefühlt zu haben. Verwundert es da, wenn dem Mann bisweilen vorgeworfen wurde, ihm sei die deutsche Einheit keine Herzensangelegenheit gewesen?
Fest steht, daß sich diese Weltsicht gut jenem Handlungsrahmen einfügte, den die Alliierten den Deutschen der Nachkriegszeit zustanden. Sie alle, die Sowjets eingeschlossen, sahen in Preußen den Kern allen Übels. Deshalb hatten sie im Februar 1947 den Staat Preußen einvernehmlich aufgelöst – eine der ganz wenigen Entscheidungen, bei denen sie sich im Alliierten Kontrollrat einig waren. Adenauer hatte frühzeitig erkannt, welche Möglichkeiten die neue Lage bot – für Westdeutschland, für das Rheinland, für ihn selbst. Das Unglück des Vaterlandes, das er nicht herbeigeführt hatte, sondern für das andere verantwortlich waren, hatte eine Seite, aus der sich etwas machen ließ.
Die neue Lage war auf ihn und sein Konzept der Westbindung zugeschnitten. In einer radikal vereinfachten Situation, in der Deutschlands Osten in den Machtbereich der Sowjetunion geraten und Westdeutschland auf den europäisch-atlantischen Rückhalt zwingend angewiesen war, hatten seine alten Ziele plötzlich Chancen der Verwirklichung. Hindernisse, die in der Weimarer Republik seinem Vorhaben eines dauerhaften partnerschaftlichen Ausgleichs mit den westlichen Nachbarn im Wege gestanden hatten, waren beseitigt: Preußen war ausgelöscht, Berlin kam als Regierungssitz, als Hauptstadt unter den obwaltenden Umständen nicht in Frage, das wirtschaftliche und das politische Machtzentrum konnten künftig in einer Landschaft zusammenfallen. Bot sich nicht seine Heimat, das Land an Rhein und Ruhr, ganz natürlich als selbstbewußtes Kerngebiet eines neuen westdeutschen Staatsgefüges an? Adenauer fühlte seit 1945, daß seine Stunde gekommen war.
Wer er war, was er wollte, konnte alle Welt an einer symbolträchtigen Szene auf dem Petersberg ablesen. Am 21. September 1949 mußte Adenauer dort seinen Antrittsbesuch bei dem Amerikaner John McCloy, dem Briten Brian Robertson und André François-Poncet machen, der den für die Bundesrepublik besonders wichtigen französischen Nachbarn vertrat. Als dieser auf den Kanzler zuging, um ihn zu begrüßen, stellte Adenauer seinen Sinn für Stil, Selbstachtung und Würde, aber auch sein taktisches Geschick unter Beweis und ging ihm entgegen, als wolle er François-Poncet höflich den Weg verkürzen. Beinahe beiläufig, tatsächlich aber demonstrativ betrat er dabei jenen Teppich, der den Hohen Kommissaren vorbehalten war; der Bundeskanzler hatte auf dem blanken Boden warten sollen. Das sagte mehr als Worte: Der Anspruch der jungen Bundesrepublik war nicht mehr und nicht weniger als eine künftige Gleichberechtigung mit dem Westen.
Es blieb vorläufig bei Gesten. Die Macht lag bei den Alliierten. Sie konnte nur geduldig Schritt für Schritt zurückerlangt werden. Das erforderte Vertrauensarbeit, und deswegen akzeptierte Adenauer das am 22. November 1949 geschlossene sogenannte Petersberger Abkommen. Es eröffnete der Bundesrepublik die Möglichkeit, konsularische Be-ziehungen aufzunehmen und sich internationalen Organisationen anzuschließen; außerdem wurde die Demontage zahlreicher Betriebe offiziell beendet. Der Preis dafür war hoch. Er bestand im Beitritt zur Internationalen Ruhrbehörde, und das hieß nichts anderes, als daß der Kanzler jetzt jener fremden Kontrolle der Kohle- und Stahlproduktion an Rhein und Ruhr seinen Segen erteilte, die er – wie die meisten seiner Landsleute – noch kurz zuvor rundweg abgelehnt hatte. Konnte man überrascht sein, als bei der Debatte über dieses Abkommen im Bundestag die Emotionen hochkochten? Am 25. November, gegen drei Uhr morgens, entfuhr Schumacher in der aufgeheizten Atmosphäre der an Adenauer gerichtete Zwischenruf »Bundeskanzler der Alliierten!«, der mit Pfeifkonzerten und Buhrufen der Regierungsparteien quittiert wurde. Daraufhin wurde die Sitzung unterbrochen; drei Stunden später, um genau 6 Uhr 11 frühmorgens, wurde sie mit einem unerhörten Beschluß wiedereröffnet: Schumacher wurde für 20 Sitzungstage ausgeschlossen.
Auf dem Teppich: Konrad Adenauer vermeidet die Diskriminierung der jungen Bundesrepublik, 21. September 1949
Für die Genossen, und nicht nur für ihren in nationalen Kategorien denkenden Vorsitzenden, war jeder bindende Schritt in Richtung Westen ein Beitrag zur Spaltung Deutschlands. Deswegen stimmten sie gegen die Aufnahme der Bundesrepublik als assoziiertes Mitglied in den Europarat; deshalb machte die SPD gegen deren Eintritt in die sogenannte Montanunion mobil. Am 9. Mai 1950 hatte Frankreichs Außenminister Robert Schuman vorgeschlagen, die gesamte französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion unter eine gemeinsame Oberste Aufsichtsbehörde zu stellen. Das sollte ein Schritt zur Überwindung des »jahrhundertealten Gegensatzes zwischen Frankreich und Deutschland« und damit zugleich zur Einigung Europas sein. Zwei Jahre später trat tatsächlich zwischen Frankreich, der Bundesrepublik, Italien und den Benelux-Staaten der Vertrag zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in Kraft. 1957 folgten mit den »Römischen Verträgen« die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) – diesmal mit Zustimmung der SPD. Bis heute bilden die drei Europäischen Gemeinschaften Grundpfeiler der Europäischen Union.
Aber der Kanzler wollte weiter, wollte die begonnene Westintegration vertiefen und forcieren. Den Anlaß für seinen spektakulären Vorstoß bot ihm kein Geringerer als Josef Stalin persönlich. Jedenfalls mußte man damals vermuten, der sowjetische Diktator stecke hinter jenem Überfall des kommunistischen Nordens auf den Süden der koreanischen Halbinsel, der am 25. Juni 1950 begann und die westliche Welt in einen Schockzustand versetzte. Innerhalb weniger Monate konnten die nordkoreanischen Verbände, seit der Jahreswende von Hunderttausenden Soldaten aus Maos chinesischer Volksrepublik unterstützt, gleich zweimal die südkoreanische Hauptstadt Seoul einnehmen.
Einmal mehr schlug jetzt die Stunde Konrad Adenauers. Was im geteilten Korea möglich war, konnte auch im gespaltenen Deutschland nicht ausgeschlossen werden. Was lag näher, als sich auf den Ernstfall vorzubereiten, sich darauf einzustellen, daß Vergleichbares auch an der europäischen Nahtstelle des Ost-West-Gegensatzes geschehen konnte? Wie aber war, den Ernstfall ins Auge gefaßt, das freie Deutschland ohne die Deutschen selbst zu verteidigen? Die Konsequenzen aus diesem Szenario erforderten Mut – gegenüber den Alliierten, aber auch gegenüber den eigenen Landsleuten. Der Kanzler ging in die politische Offensive.
Eindringlich beschwor Adenauer die Westmächte, ihre Verteidigungsbemühungen zu steigern, verband jedoch seinen Appell mit einem Vorschlag: Gewiß, niemand könne in dieser Situation, gerade einmal fünf Jahre nach Beendigung des verheerenden Weltkriegs, wieder deutsche Soldaten wünschen oder wollen. Wenn es aber um einen Existenzkampf, wenn es darum gehe, das Vaterland zu verteidigen, würden sich die Deutschen nicht ihrer Pflicht entziehen, zumal man nicht übersehen dürfe, daß es inzwischen in der DDR schon wieder paramilitärische Verbände gebe. Sollten die Westmächte in dieser Situation ernsthaft daran denken, seine Landsleute an der Verteidigung des freien Teils Deutschlands, damit Europas und der Welt zu beteiligen, dann müßten sie jedoch die Weichen auch in anderer Hinsicht neu stellen: Nur unter der Voraussetzung »völliger Gleichberechtigung« der Bundesrepublik mit ihren westlichen Nachbarn sei der »deutsche Mensch« in der Lage, in einer dramatisch veränderten Welt die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen.
Natürlich unterbreitete der Kanzler seine weitgehenden Vorschläge nicht in aller Öffentlichkeit, umging vielmehr die eigene Partei, die eigene Fraktion, ja selbst die eigene Regierung und wandte sich vertraulich direkt an die westlichen Verbündeten – genauer gesagt: an deren Hochkommissare, da ihm, dem Kanzler der Besiegten und Besetzten, der unmittelbare Kontakt zu den Regierungen der Siegermächte in den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft versperrt war. Da kein Geringerer als Winston S. Churchill, der große Herausforderer und Sieger über Adolf Hitler, soeben aus der Deckung des britischen Oppositionsführers heraus eine Europaarmee ins Gespräch gebracht hatte, wußte sich der Bundeskanzler auf vergleichsweise sicherem Terrain, jedenfalls was England anging.
Daß sich die Situation beim französischen Nachbarn anders darstellte, kann man verstehen. Dreimal – 1870/71, 1914 bis 1918 und 1940 bis 1944 – hatte man dort erlebt und erlitten, wie Deutsche Krieg führten. Wenn aber der Aufbau einer deutschen Armee nicht mehr zu vermeiden war, dann mußte er unter französischer Kontrolle erfolgen. Also ergriff man in Paris die Flucht nach vorn und entwickelte damit ein Verhaltensmuster, das die französische Deutschlandpolitik bis in jene Epoche hinein prägen sollte, in der 1989/90 unerwartet die Vereinigung des geteilten Deutschland auf der Tagesordnung stand.
Schon der Vorschlag zur Gründung der Montanunion war ein Versuch gewesen, einem raschen Wiedererstarken der deutschen Schwerindustrie zu Lasten der französischen entgegenzuarbeiten. Sicherheit vor Deutschland war das Gebot der Stunde, erst recht, wenn es um Rüstung und Verteidigung ging. Mit einem aufsehenerregenden Vorstoß riß daher der französische Ministerpräsident René Pleven die Initiative an sich und legte im Oktober 1950 den Plan einer europäischen Verteidigungsarmee vor – freilich zunächst mit Klauseln, die Deutschland diskriminierten und erst Monate später, dank amerikanischer Vermittlung, entschärft wurden.
Konnte man mehr verlangen als eine wirklich europäische Armee? Was war besser als die Möglichkeit, die deutsche Aufrüstung und die Beilegung der deutsch-französischen »Erbfeindschaft« in einer derartigen Weise konstruktiv zu verknüpfen? Und das war noch nicht alles: Mit dem Beitritt zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) wurde der Bundesrepublik auch die Herstellung der äußeren Souveränität in Aussicht gestellt – Adenauers Hauptziel seit der Staatsgründung.
Andernorts hielt sich die Freude über eine solche Entwicklung begreiflicherweise in engen Grenzen: Nicht nur in Frankreich, auch in der Sowjetunion bestand nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges ein berechtigtes Sicherheitsbedürfnis gegenüber Deutschland. Ob die sogenannten Stalin-Noten, die im März 1952 in den drei westlichen Hauptstädten eintrafen, ein bloßes Störmanöver waren? Die Geister schieden sich, auch in der deutschen Debatte. Dabei war man gar nicht Stalins Ansprechpartner. Fest steht, daß der sowjetische Diktator von einem wiedervereinigten, neutralen Deutschland sprach. Für den Bundeskanzler war der Vorschlag teils unernst, teils riskant; abwehrend sprach er von einem bloßen »Fetzen Papier«. Ein Teil der Westdeutschen sah das anders und hoffte auf eine ernsthafte Prüfung des sowjetischen Angebots. Daß die Westmächte die Offerte einvernehmlich zurückwiesen, war ganz im Sinne Adenauers: So konnten die Verhandlungen über einen deutschen Wehrbeitrag weiterlaufen und die EVG-Verträge, wie vorgesehen, im Mai 1952 unterzeichnet werden.
Das sowjetische Störfeuer war also erfolgreich abgewehrt worden. Anders die Kampagnen der Kritiker und Gegner im