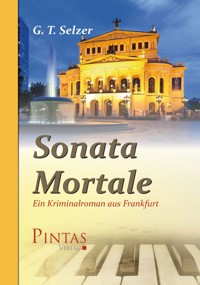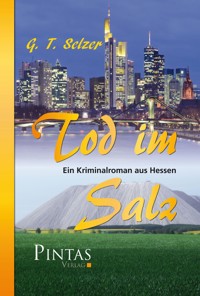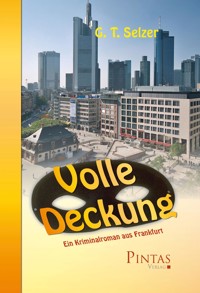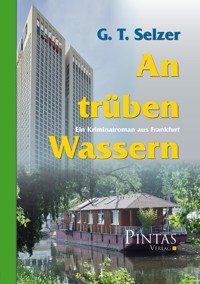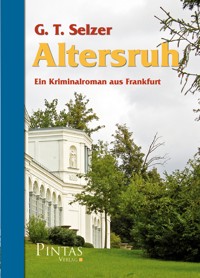4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pintas-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Unfall – Mord – Selbstmord? Zwei Brüder sterben auf nicht alltägliche Weise, zwei Kommissare gehen sich mächtig auf die Nerven, und zwei Frauen finden Antworten auf viele Fragen in einem Stück aus dem 18. Jahrhundert. Die Geschichte ist für die beiden nicht ungefährlich, und bevor sie noch wissen, ob sie mit ihrer Theorie richtig liegen, finden sie sich im Krankenhaus wieder. Was wiederum für die Polizei Grund genug ist, den phantastischen Ideen von Bettina und Sarah nachzugehen. Der Fall wird zu einer Herausforderung für die Kommissare Langer und Korp. Ein Krimi (nicht nur) für Literaturliebhaber und der erste Fall für die so unterschiedlichen Kommissare Paul Langer und Johannes Korp aus Frankfurt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung zur 1. Auflage
Personen
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Die Reihe mit Langer & Korp
Impressum
G. T. Selzer
… kein Ende als das Grab Ein Kriminalroman aus Frankfurt
ISBN 978-3-945343-20-3
ISBN der Printausgabe 978-3-945343-14-2 © 2014 by PINTAS-VERLAG, Frankfurt am Main
www.pintas-verlag.de 4. Auflage 2019
Foto Frankfurt Skyline Titelseite: © Thomas Wolf, www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0)
Vorbemerkung zur 1. Auflage
Die Geschichte spielt 1994. Und so sah die Welt vor zwanzig Jahren aus:
Auch wenn es bereits Online-Anbieter, Auto-, Funk- und Mobiltelefone gab (mit denen man telefonierte – und sonst nichts): Tatsächlich war es eine Welt ohne Internet und E-Mail, ohne Handys und SmartPhones, ohne GPS und WhatsApp; der Erfinder von Facebook war gerade 10 Jahre alt. Und ja, es wurden damals alle Wörter entweder groß oder klein geschrieben. Die Computer und Laptops rechneten in Megabyte. Man speicherte auf 3,5-Zoll-Disketten oder Magnetbänder. Die Mailbox hieß Anrufbeantworter; wer etwas cooler sein wollte, sagte AB.
Der schnellste Weg der schriftlichen Kommunikation war in der Regel das Telefaxgerät. DNS-Analysen waren bekannt, aber nicht in jedem Fernseh-Vorabendkrimi zu Hause.
Man konnte in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens noch sitzen. In Zügen, Büros, Restaurants und Flugzeugen wurde geraucht. Das Polizeipräsidium in Frankfurt am Main befand sich zwischen Hauptbahnhof und Messe in einem neobarocken Prunkbau, der gerade langsam verrottet.
Die fünfstellige Postleitzahl war gerade ein Jahr alt. Die gängige Währung hierzulande hieß D-Mark
Und fünf Jahre vorher hatte die Mauer in Berlin noch gestanden.
Frankfurt am Main, im November 2014
Personen
Bettina Veit freiberufliche Lektorin
Peter Lampe Wirtschaftsredakteur bei der Neuen Frankfurter Zeitung
Charlotte seine Tochter
Sarah Remberger Produktionsleiterin beim KWK-Verlag in Frankfurt
Udo Schröter ihr Freund
Dr. Hilde Remberger Ärztin, Schwester von Sarah
Ingeborg Markus Studienrätin für Chemie und Biologie am Reuter-Gymnasium in Frankfurt
Michaela Markus Auszubildende im KWK-Verlag, ihre Tochter
Martin Kaspar Kollege von Ingeborg Markus für Deutsch und Geschichte, ihr Lebenspartner
Norbert Markus Geschäftsmann, Ingeborgs Bruder
Rainer Kaspar Bruder von Martin, Anwalt bei Holbein, Kaspar & Berthold in Berlin
Dr. Frank Holbein, Dieter Berthold Anwälte in Berlin
Elisabeth Müller-KlagenbrinkAnwaltssekretärin
Prof. Dr. Christian Berger Autor beim KWK-Verlag
Wolfgang Weber Studiendirektor am Reuter-Gymnasium
Annemarie Kramm Studentin, ehemalige Schülerin am Reuter-Gymnasium
Paul Langer Kriminalhauptkommissar Kaptaldelikte, Mordkommission Frankfurt
Johannes Korp Kriminaloberkommissar
Jens SchmidtbauerKriminalobermeister
Dr. Jürgen Eilers Rechtsmedizin
Stefan Zeisig, KHK Rauschgiftdelikte
Prolog
„Nun komm schon! Stell dich nicht so an!“
Der Junge nestelte an der Bluse seiner Begleiterin, während er mit der anderen Hand tollpatschig über ihre Brüste fuhr. Das Mädchen wehrte ihn heftig ab.
„Nein, Danny, hör auf! Nicht so. Es gefällt mir nicht!“ Mit einem Ruck setzte sie sich auf und schob seine Hände weg. „Ich will überhaupt nicht mehr!“
„Aber es war doch deine Idee, hierher zu kommen! Dumme Kuh! Echt zickig bist du heute!“ Er griff nach ihrer Schulter, drückte sie ins Heu zurück und warf sich über sie.
„Lass das, verdammt !“ Sie wandte das Gesicht ab, als sein Mund näher kam, und versetzte ihm mit ihrem freien Knie einen heftigen Stoß in die Seite.
Die Sekunde, in der er mit schmerzverzerrtem Gesicht locker ließ, nutzte sie, um sich blitzschnell zur Seite rollen zu lassen und aufzustehen. Dabei stolperte sie und fiel seitwärts auf einen Heuballen.
Dann schrie sie. Sie schrie, wie sie noch nie in ihrem Leben geschrien hatte.
Er brüllte sie an: „Julia, hör auf! Ist ja gut! Ich lass dich ja in Ruhe! Wenn dich jemand hört!“
Mit einem Satz war sie auf den Beinen und im nächsten Moment an der Tür der kleinen Hütte. Ihr Schreien war in ein lautes Wimmern übergegangen. Doch sie nutzte den offenen Fluchtweg nicht, sondern blieb, zitternd am ganzen Körper, an der Tür stehen.
Danny, jetzt mehr verblüfft als ärgerlich, setzte sich mit einem Ruck hoch. „Was ist denn nur in dich gefahren?“ fragte er, während er sich seine linke Seite massierte.
Sie zeigte auf das Heu, aus dem sie gerade aufgesprungen war.
„Da … da! Da liegt jemand!“
Er sah verständnislos von ihr zu der Stelle neben ihm. Dann rutschte er auf Knien zu dem Ballen hin und schaufelte vorsichtig ein paar Hände voll Heu beiseite. Plötzlich zuckte er zurück, als habe er einen elektrischen Schlag erhalten. Ein Bein kam zum Vorschein. Julia stieß erneut einen durchdringenden Schrei aus. Danny war aufgesprungen und ebenfalls zur Tür geflüchtet. Sein Gesicht war aschfahl. Ein paar Minuten standen sie beide zitternd an der Tür der Blockhütte.
„Er ist tot!“ flüsterte Julia.
„Es ist eine Frau“, gab Danny ebenso leise zurück.
„Wir müssen die Polizei holen!“
Danny nickte, aber sie bewegten sich beide nicht.
„Sieh mal, da liegt noch was!“ Er zeigte auf ein weiß aus dem Heu schimmerndes Blatt Papier. Julia hielt ihn zurück, als er sich langsam wieder der Gestalt näherte. Er wehrte sie ab, kniete nieder und fegte vorsichtig ein paar Halme beiseite. Das Papier kam jetzt vollends zum Vorschein, eine herausgerissene Seite aus einem Schulheft. Es lag neben der Toten, etwa in Taillenhöhe.
Danny winkte Julia heran. „Da steht was drauf. Komm mal her!“
Sie schüttelte heftig den Kopf. Dann siegte ihre Neugier und sie sah Danny über die Schulter, während er las.
Ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsch, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen, und morgens schlag ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war. Mit mir ists aus! Mir wärs besser, ich ginge. Ich seh all dieses Elends kein Ende als das Grab.
Kapitel 1
Sie hockte zusammengekauert am Grab und redete lautlos mit dem Toten. Der Duft der Blumen neben dem frisch aufgeschütteten Hügel zog betörend zu ihr hin. Das ist endgültig das Ende, dachte sie, und es ist gut so. Langsam legte sie die Rose aus ihrer Hand auf einen Strauß Vergissmeinnicht.
Sie wusste nicht, wie lange sie schon so da saß. Ihre Knie begannen zu schmerzen. Sie stand auf, ging ein paar Schritte weiter, setzte sich auf eine Bank in die Sonne und starrte zum Grab hinüber. Es war März, die Forsythien blühten, der Duft des Frühlings lag in der Luft.
Dass Martin Kaspar gestorben war, hatte sie durch einen merkwürdigen Zufall erfahren: Sie las seine Todesanzeige. Noch nie, so weit sie sich erinnerte, hatte sie Todesanzeigen beachtet, wenn sie Zeitung las, doch am Samstag war ihr Blick darauf gefallen. Ein Zufall, wenn es Zufälle gibt. Die Beerdigung vormittags hatte sie gemieden – fremde Leute, mit denen sie nichts zu tun hatte.
„Haben Sie meinen Bruder gut gekannt?“
Sie fuhr herum. Neben ihr saß ein Mann, der sie aufmerksam betrachtete. Sie starrte einen Moment in sein Gesicht, ohne ihn wahrzunehmen, und schaute dann wieder zum Grab hin.
„Nein“, sagte sie leise.
Der Mann blieb sitzen. Sie hatte ihn nicht kommen hören, doch er musste sie die ganze Zeit beobachtet haben.
„Nein, eigentlich habe ich ihn nicht gut gekannt,“ murmelte sie vor sich hin. – „Sie sind ihm gar nicht ähnlich“, sagte sie nach einer Weile und schaute ihn an. Ende Vierzig, dunkles Haar, das bereits mit grauen Strähnen durchzogen war. Er sah müde aus.
Aber er hat seine Augen, dachte sie.
Sie raffte sich auf. Es hatte keinen Zweck. Es war verführerisch, weiter in der Märzsonne zu sitzen. Doch sie hatte sich vorgenommen, mit diesem Tag das Kapitel abzuschließen, und es schien ihr gelungen zu sein. Man nimmt Abschied und kehrt zum Leben zurück.
Sie stand auf, nickte dem Fremden zu und ging langsam zum Ausgang.
„Bettina!“
Erschrocken blieb sie stehen und wandte sich langsam um.
„Sie sind doch Bettina Veit, oder?“
Sie nickte automatisch. Wie um alles in der Welt … ?
Er schien aus seiner Lethargie erwacht zu sein und stand abrupt auf.
„Ich muss mit Ihnen reden. Ich hätte Sie ohnehin gesucht. Dass wir uns hier treffen, macht die Sache einfacher.“
Sie sah ihn an, ohne zu verstehen.
„Martin hat mir einen Brief anvertraut, den ich Ihnen geben soll. Ein Foto lag auch dabei. Deshalb habe ich Sie erkannt.“
Sie trat einen Schritt auf ihn zu, dann setzte sie sich wieder.
„Einen Brief? Jetzt … ?“
Ihre Knie waren merkwürdig schwach. Warum hatte er das getan? Warum konnte er sie nicht in Ruhe lassen? Sie müsste jetzt nur aufstehen und endgültig gehen. Doch sie wusste, dass es nicht möglich sein würde.
Rainer Kaspar griff in seine Manteltasche und holte aus seiner Brieftasche einen Umschlag hervor.
Ihr Name stand darauf; sie erkannte Martins Schrift sofort.
„Er hatte seinem Testament einen Brief an mich beigelegt, in dem noch dieser Umschlag steckte. Ich sollte ihn Ihnen persönlich geben.“
Sie nahm den Brief und tat ihn in ihre Handtasche, ohne ihn noch einmal anzusehen. „Wie ist er gestorben?“
Die Antwort kam zögernd. „Er hatte einen Unfall.“ Er sah sich um. „Haben Sie etwas Zeit?“
„Wie gut haben Sie Martin gekannt?“, fragte er noch einmal. Sie saßen jetzt in einem Café in der Nähe des Südfriedhofs am offenen Fenster. Der Henninger Turm glänzte weiß in der Sonne. Bettina sah auf den Vorgarten hinaus, in dem sich wie feiner Staub das erste Grün auf den Zweigen ausbreitete.
„Ich traf ihn vor ein paar Jahren und hatte beruflich mit ihm zu tun. Danach … “ sie zögerte, ließ dann den Rest des Satzes mit einer vagen Handbewegung in der Luft hängen und starrte in ihre Kaffeetasse.
Sie erinnerte sich noch genau, wie Martin Kaspar vor vier Jahren zum ersten Mal ihr Büro im Verlag betrat und ein Manuskript vor sie auf den Schreibtisch legte, eine Abhandlung über Nicolai. Sie hatten vorher miteinander telefoniert, der Annahme des Manuskripts stand nichts im Wege; man kannte ihn als kompetenten Autor, der bereits zwei Bücher bei ihnen veröffentlicht hatte.
Sie hatten danach über Wochen immer wieder miteinander zu tun, bis aus dem Manuskript ein Buch geworden war. Sie war vom ersten Augenblick von ihm fasziniert gewesen und hätte bis heute nicht sagen können, woran das lag.
Martin Kaspar war ein eher unattraktiver Mann, leise, verschlossen, distanziert, aber immer freundlich. Sie hatten während dieser Zeit kaum ein persönliches Wort miteinander gewechselt, als ob eine unsichtbare Mauer zwischen ihnen bestünde, die es ihnen unmöglich machte, ein harmloses Gespräch zu führen. Bettina hatte nicht den Mut, diese Mauer zu durchbrechen. Und doch zunehmend den Eindruck, als empfände er diese Situation genau wie sie.
Als er die letzten Korrekturen in ihr Büro brachte – er hatte immer alles persönlich abgegeben, was sicher nicht daran lag, dass er in Frankfurt wohnte; schließlich hätte er auch innerhalb der Stadt den Postweg wählen können – ja, auch als er sie zum letzten Mal im Verlag aufsuchte, blieb er nicht länger als nötig. Und er war schon an der Tür, da drehte er sich plötzlich, die Klinke bereits in der Hand, um und sah sie an, als wolle er noch etwas sagen. Doch ehe sie, mehr erschrocken als neugierig, reagieren konnte, hatte er wortlos die Tür geöffnet und war verschwunden.
Etwa ein halbes Jahr später hatte sie einen Brief von ihm erhalten. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie und doch auf ernste, wohltuend nüchterne Art erklärte er ihr, dass sie ihm viel bedeute, dass er jedoch auf Grund von Umständen, die darzulegen er nicht in der Lage sei, keinen Weg sähe, wie sie zusammen kommen könnten, und sei es auch nur, um darüber zu reden. Und sie möge bitte auch nicht versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen – immer vorausgesetzt, sie wolle dies überhaupt. Mit Recht könne sie jetzt nach Sinn und Zweck eines solchen Briefes fragen, und er müsse zugeben, dass er darauf keine Antwort habe. Außer der, dass ein törichter Mitteilungsdrang stärker gewesen sei als rationale Überlegungen ...
Sie fuhr hoch. Rainer Kaspar sah sie an. „Entschuldigung, ich war in Gedanken. Was sagten Sie?“
„Sie arbeiten in dem Verlag, in dem Martin ab und zu veröffentlichte?“, wiederholte er seine Frage.
„Ja. Woher … ?“
„Es stand in seinem Brief an mich.“
Sie nickte. „Ich arbeite für verschiedene Verlage, freiberuflich. – Erzählen Sie mir von ihm“, sagte sie nach einer Pause.
Er schaute gedankenverloren einer Amsel zu, die laut kreischend aus einem Busch aufflog. „Martin und ich hatten ein merkwürdiges Verhältnis. Wir sahen uns manchmal Monate lang nicht – ich lebe in Berlin. Doch wenn ich hier in Frankfurt zu tun hatte, besuchte ich ihn, und wir kamen sehr gut miteinander aus. Das war nicht so, als ich noch hier lebte.“ – Den letzten Satz sagte er leise, mehr zu sich selbst. Dann schien er sich einen Ruck zu geben. „Martin, na ja, er war … Er war ganz anders als ich. Introvertiert. Ich konnte eigentlich immer dann besonders gut mit ihm reden, wenn es mir schlecht ging. Seine Ruhe tat mir gut. Zu anderen Zeiten konnte er mir damit eher auf die Nerven gehen.“
Rainer Kaspar lächelte wehmütig. Bettina merkte, dass er mehr von sich selber als von seinem Bruder preisgab mit dem, was er erzählte. „Sie sind spontaner, wie?“
„Ich denke schon.“
Er sah sie an. „Ich bin noch eine Weile in Frankfurt. Darf ich sie in den nächsten Tagen einmal anrufen?“
Bettina zögerte: „Warum … ? Ich weiß nicht recht …“
Er sah sie immer noch an. Er hat tatsächlich Martins Augen, dachte sie. Hastig wechselte sie das Thema.
„Wieso haben Sie den Nachlass geordnet, nicht seine Frau?“
„Ingeborg und er waren nicht verheiratet.“
Sie sah überrascht auf. „Ich dachte…“ – Aber was spielte das jetzt noch für eine Rolle?
„Ich bin sein einziger Verwandter. Und er dachte wohl, ich käme besser damit zurecht. Als Rechtsanwalt.“
„Strafrecht?“
„Nein. Wirtschaftsrecht. Meist Verwaltung und Beratung.“
Als sie sich verabschiedeten, fragte sie: „Wie genau ist er gestorben?“
Seine Miene änderte sich schlagartig. Er war wieder der müde Mann vom Friedhof.
„Er war mit dem Wagen unterwegs im Taunus. Spätabends. Es war glatt, zu einer Zeit, wo hier schon alles blüht.“ Er blickte sich um. „Und da oben ein ganz dünner Eisfilm auf der Straße. Er hat nicht damit gerechnet.“ Sein Blick blieb an einem Strauch Forsythien hängen. „Martin muss sofort tot gewesen sein.“
„Also, Chef, das gefällt mir nicht!“ Johannes Korp blätterte in einer Akte. „Irgend etwas ist da merkwürdig“.
„Und was ist es, was Ihnen Ihrer Meinung nach gefallen soll?“ Hauptkommissar Paul Langer sah ungnädig auf. „Wovon reden Sie eigentlich?“
„Fall Kaspar. Wir sollten noch einmal den Bruder befragen. Er ist der Alleinerbe, und seine Kanzlei in Berlin steht nicht besonders gut da. Und ich denke …“
„Und ich denke, das ist alles schon geschehen? Der Bruder des Toten, seine Frau …“
„… Ingeborg Markus, seine Lebensgefährtin …“
Langer winkte ab. „… der Sohn …“
„… nein, Tochter …“
„… von mir aus Tochter …“
„… ihre Tochter! …“
„… na schön, ihre Tochter!“ Langer stöhnte und warf seinen Bleistift auf den Schreibtisch. „Was wollen Sie eigentlich, Mann?“, brummte er, während er sich im Sessel zurücklehnte. „Haben Sie Langeweile? Was ist zum Beispiel mit dem Parkmörder? Sind Sie da weitergekommen?“
Mutig ignorierte der andere die Fragen. „Wenn einer mit 2,1 Promille auf gerader Fahrbahn mit 140 Stundenkilometern gegen einen Baum rast, Chef, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken … Und er schien Probleme mit dem Alkohol gehabt zu haben!“
Langers Hand wedelte wieder durch die Luft. „Na eben. Und es war glatt. Was stellen Sie sich denn vor? Dass jemand diesen – diesen“ er kippte nach vorne und schielte auf das Papier „diesen Martin Kaspar volltrunken gemacht, ihn in einen Wagen gesetzt und ihm dann gut zugeredet hat loszufahren? Der Bruder vielleicht? Sie wissen doch, dass der in Frankfurt war – und zwar in dem an der Oder! 800 km entfernt. Den ganzen Nachmittag mit Klienten zusammen. Und dann mit ihnen essen.“
Also hatte der Chef sich auch schon seine Gedanken über den Fall gemacht! Korp grinste in sich hinein und nahm, neu gestärkt, das Gefecht wieder auf. Er zeigte auf die Kopie des Testaments. „Und dann das: Ingeborg Markus hat nichts abbekommen, nach all den Jahren. Sie ist angewiesen auf das, was Rainer Kaspar ihr geben wird.“
„Das Verhältnis war eben nicht mehr so rosig, oder was weiß ich. Er wird seine Gründe gehabt haben.“
Korp stöhnte. Was er am meisten an seinem Chef verabscheute, war dessen Sturheit. Korp versuchte es auf die unterwürfige Tour; das liebte der Herr Hauptkommissar.
„Chef, sehen Sie doch mal …“
Langer verlor die Geduld. Und er hasste es, so angesprochen zu werden. Er schnaubte und wischte mit einer Bewegung seiner kleinen, dicken Hand sämtliche Argumente vom Tisch.
Korp wusste, was jetzt kommen würde. Eine ihrer üblichen Streitereien, die darauf hinauslief, dass Langer ihn einen feinen Pinkel schimpfen und ihm raten würde, Banker zu werden. Er achtete auf gutes Aussehen und kaufte in Geschäften, die zugegeben nicht so recht seiner Gehaltsklasse entsprachen, na und? Er betrachtete seinen Vorgesetzten und hätte ihm gerne einmal einige Tipps in Sachen Kleidung gegeben. Ein Paar Tropfen Rasierwasser würden ihm im übrigen …
Langer unterbrach seinen Gedankengang. Er schob den Ordner, in dem er vor Korps Unterbrechung gelesen hatte, endgültig beiseite und langte über den Schreibtisch nach der Akte Kaspar.
„Was war auf der Beerdigung?“ fragte er betont sachlich und wider Erwarten bemüht, die Situation zu entkrampfen. Er holte ein Taschentuch aus der Tasche des zerknitterten Jacketts und fuhr damit über seine kahle Stirn ab.
„Nichts Besonderes. Schmidtbauer hat Fotos gemacht. Unauffällig“, fügte Korp schnell hinzu, als er Langers misstrauisches Gesicht sah. Er holte die Fotos aus der Schublade und schob sie Langer hin. „Hier, der Bruder, Rainer Kaspar. Dann Ingeborg Markus, die an der gleichen Schule wie Martin Kaspar unterrichtet. Sie lebten seit einiger Zeit wieder getrennt. – Das Mädchen da“ – sein Finger fuhr auf ein verweintes Mädchengesicht – „ist die Tochter der Markus, Michaela.“
„Und Martin Kaspar ist nicht der Vater?“
„Nein. Das Mädchen war ein Jahr alt, als Ingeborg Markus und Martin Kaspar sich kennen lernten. Das war vor 17 Jahren. Eine lange Ehe. Nur ohne Trauschein. Was die Markus jetzt zu spüren bekommt. Und rechtlich kann sie da gar nichts machen, wo sie noch nicht einmal mehr zusammen wohnten.“
„Ihre Anteilnahme in allen Ehren, ich habe begriffen, dass sie Eindruck auf Sie gemacht hat – aber weiter. Der große Blonde?“ Langer zeigte auf einen eleganten Mann neben Rainer Kaspar.
„Dr. Frank Holbein, einer der Partner von Rainer Kaspar aus der Kanzlei. Sie sind zu dritt. Kaspar, Holbein und …“ er blätterte in seinen Notizen. „… Berthold. Dieter Berthold.“ Er zeigte wieder auf das Foto. „Das hier ist Norbert Markus, hier, der mit dem Bart. Er ist der Bruder von Ingeborg Markus. Der Rest Kollegen und Schüler aus dem Gymnasium.“
„Sind die auch befragt worden?“
Korp nickte. „Bei Schülern und Kollegen allgemein beliebt. Zumindest wollte niemand etwas Schlechtes über Kaspar sagen.“
Langer sah von den Fotos auf. „Ein Unfall. Tragisch. Aber nicht mehr. Pflichtuntersuchung, reine Routine. Wir haben keinerlei Indizien für das Gegenteil. Abgeschlossen.“
„Nur, dass Kaspar verdammt viel zu vererben hatte. Als Lehrer! Dazu noch die hohe Lebensversicherung.“
„Es soll sparsame Leute geben“, erwiderte Langer mit einem Blick auf Korps neues Jackett. „Und Sie hatten doch Einblick in die Kontoauszüge?“ Als Korp nickte, fuhr Langer fort: „Wir haben wirklich alles überprüft. Mann, Korp, wir haben so viele Fälle am Hals, echte Fälle!“
Korp seufzte. Langer blätterte noch einmal – eher oberflächlich – in der Akte, las hier und da einen Satz und wollte sie schon zuklappen, als er stutzte. Er sah auf.
„Ich würde viel lieber mit Holbein noch einmal reden. Sehen Sie mal das hier.“ Er hielt Korp den Ordner hin. „Wieso ist Ihnen das vorher nicht aufgefallen?“
Korp sah sofort, was er meinte. Wieso eigentlich immer mir? dachte er, während er gleichzeitig nach dem Telefon griff, in die Akte schielte und eine Nummer wählte.
„Ist Holbein nicht befragt worden?“
„Doch, von Schmidtbauer. Wie alle anderen auch. Routinefragen. Keine bemerkenswerten … Ja, guten Tag, Frau Markus. Hier ist noch einmal Oberkommissar Korp. Können Sie mir sagen, wo ich Dr. Holbein erreichen kann? Er ist doch noch nicht zurück nach Berlin geflogen?“ Pause. „Und wann? – Nein, nur noch eine Frage. Danke.“ Er legte auf. „Holbein ist nach Stuttgart gefahren, zu Klienten. Will am Wochenende nach Frankfurt zurück, bevor er nach Berlin fliegt.“
„Na gut, der läuft uns nicht weg. Kümmern Sie sich darum.“
„Ja, Mann“, murmelte Korp.
Sarah Remberger hob den Kopf vom Schreibtisch, der mit Korrekturfahnen übersät war, und streckte sich. „Es wird Zeit, dass ich hier rauskomme. Zwei Wochen Lago Maggiore – und da unten ist fast schon Mai. Mensch, ich freu‘ mich so darauf. Hoffentlich klappt es mit Hilde.“
Bettina sah ihre Freundin an und grinste. Sie kannte das gespannte Verhältnis zwischen den Schwestern. Zwei Lokomotiven, die ständig unter Volldampf standen. Und nicht selten mit ungezügelter Kraft aufeinander losrasten. Manchmal gelang ihnen kurz vor dem Zusammenstoß eine Vollbremsung. Manchmal auch nicht.
Und nun wollten sie zusammen in Urlaub fahren ...
„Guck nicht so skeptisch, wir sind beide erwachsen. Und das Appartement ist groß genug, dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. – Es ist ein Experiment“, fügte Sarah hinzu, als sie Bettinas Gesicht sah.
„Na, denn viel Glück. Wann fahrt ihr?“
„Heute Nacht. Wir wollen morgen früh in Cannero sein. Hilde hat heute schon Urlaub, sie kann sich ausruhen und fahren. Ich hoffe, die Tage lenken mich ein bisschen ab von der Sache mit Udo. Eigentlich wollten ja er und ich … Dieser Mistkerl! Er wird sich nie ändern.“
Sie seufzte tief und blickte sich um. In der Produktionsabteilung des Verlages gab es auch – und gerade — am letzten Arbeitstag keine aufgeräumten Schreibtische.
„Also, dann schicke ich das heute noch in den Satz zurück; bis ich wiederkomme, ist die Revision auf dem Tisch.“ Sie packte die Fahnen zusammen und heftete eine Notiz daran. Dann legte sie das Paket in den Ablagekorb. „Und was ist mit dem Lichtenberg?“
Bettina verzog das Gesicht und stöhnte. „Dieser Berger! Einer von den Autoren, die erst anfangen zu schreiben, wenn die Fahnen vor ihnen liegen! Es wird teuer werden .“
„Aber ein wichtiger Autor, wenn man dem Chef glauben darf!“
„Ja, und das weiß er auch. Sehr genau sogar. Ich will diese Woche mit der Korrektur durch sein. Ich könnte sie dann selber an die Setzerei geben.“
Das Telefon klingelte. Sarah sprach ein paar Worte hinein, legte auf und stöhnte.
„Ein Uhr – Sie vergessen wieder das Essen!“ Michaela Markus, die Auszubildende, stand an der Tür. Sie sah mitgenommen aus.
„Und das wäre doch schade!“ Sarah lachte schon wieder. „Wir kommen! – Ja, kein Problem, du machst das schon“, wandte sie sich wieder an Bettina und sah auf die Uhr. „Komm, lassen wir uns noch mal so richtig von den Köstlichkeiten der Kantine verwöhnen, bevor ich mich dem fürchterlichen italienischen Essen aussetzen muss.“ Sie grinste und packte ihre Handtasche.
Einmal in der Woche, wenn Bettina ihren regelmäßigen Besuch im Verlag machte, kam auch sie in diesen zweifelhaften Genuss.
Teller und Besteckgeklapper, Reden, Lachen und ein undefinierbarer Essengeruch kündigten im Erdgeschoss an, dass in der Kantine Hochbetrieb herrschte. Es gab Spaghetti – ausgerechnet – und vorher ein dickflüssiges Etwas, was laut Speiseplan als ‚pürierte Gemüsesuppe‘ zu essen war.
„Wär’ ich jetzt nicht drauf gekommen“, raunte Sarah, als sie die milchig weiße Soße in Empfang nahm und skeptisch beäugte. Sie schob ihr Tablett weiter. Ludwig Frohling, Lektor für Sozialwissenschaften und Politologie und vor ihr in der Schlange, wandte sich um.
„Um mit Tucholsky zu sprechen: ‚Haben Sie das gegessen, oder werden Sie das essen?’“ Er lachte dröhnend, ohne auf den grimmigen Blick des Kochs hinter der Theke zu achten.
„Sie brauche die Supp net nemme. Sie könne se auch gern stehe lasse! Es gibt genuch Abnemmer dafür.“
Frohling schüttelte den Kopf. „Sie gehört doch dazu, oder? Dann wird sie auch genommen. Ich liebe Überraschungen.“ Er drehte nochmals den Kopf zu Sarah. „Übrigens, Frau Remberger, ich warte immer noch auf die Korrekturen zum Neuen Europa. Sie sollten schon letzte Woche da sein.“ Er schnappte sich eine Cola aus der Vitrine. „Glas?! Sind alle!“ Auffordernd fuchtelte seine Hand Richtung Küchenhilfe, während er immer noch Sarah im Visier hatte.
„Ich rufe heute Nachmittag noch mal an und sag Frau Pochstedt-Steiner, dass sie dran bleibt, wenn ich in Urlaub bin.“
„Urlaub? Schon wieder?“ Frohling lachte wieder raumfüllend, als hätte er einen Witz gemacht.
Sarah beeilte sich weiterzukommen, was nicht so einfach war, weil Frohling immer noch vor ihr stand.
„Haben Sie eigentlich die Setzerei gewechselt?“, maulte er nun. „Der dritte Band der Ökonomie strotzt ja nur so von Satzfehlern!“
„Ich habe jetzt Mittagspause“, sagte Sarah bestimmt und schnappte sich ihr Tablett. Bettina folgte ihr. Sie fanden einen Platz in der Ecke, wo sie ungestört sitzen konnten.
„Es wird höchste Zeit! Morgen sitze ich schon in der Sonne, und alle Lektoren der Welt können mich mal, Anwesende ausgeschlossen.“
„Nun hör’ schon auf, mich neidisch zu machen!“ Bettina stellte die Suppe beiseite – sie war ungenießbar. „Lago Maggiore – das wäre jetzt genau das, was ich brauche. Und richtige Pasta!“ Bettina sah sehnsüchtig auf ihren Teller, wo die Spaghetti in einer undefinierbaren roten Sauce klebten.
„Hast du übrigens gehört, dass Martin Kaspar gestorben ist?“ fragte Sarah. „War das nicht ein Autor von dir?“
Bettina nickte und blickte zu Michaela hinüber, die zwei Tische weiter bei einigen jungen Leuten aus der Werbeabteilung saß.
„Ein netter Mensch. Nicht mein Typ, zu ruhig, zu lehrerhaft. Ich hatte immer das Gefühl, meine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben, wenn ich mit ihm sprach.“ Sarah lachte. „Aber nett. Höchstens 45. Schade um ihn.“ Sie kämpfte mit einem Salatblatt, nahm es schließlich auf den Teller und zerschnitt es ungeniert. Sie fuhr fort: „Gestern habe ich Peter beim Einkaufen getroffen. Wie geht es mit ihm?“
Seit ihre Beziehung mit Udo wieder einmal – zum fünften Male, soweit Bettina wusste – in die Brüche gegangen war, sprach Sarah besonders gerne über die Beziehungen von anderen. Nur um nicht über eigene Probleme nachdenken zu müssen, wie Bettina vermutete.
„Jeder hat sein Leben. Doch es ist schön, dass es ihn gibt, in meinem.“ Bettina lächelte. „Ich würde ihn richtig vermissen. Und Charlotte auch.“
„Kein Wunder – Charlotte hängt an dir wie an einer Mutter. Weißt du, manchmal denke ich, es hat doch alles seinen Sinn, wie es kommt.“
Noch einmal nahm Rainer Kaspar das Testament zur Hand. Nie hätte er mit so viel Geld gerechnet. Fast 150.000 Mark. Dazu die Lebensversicherung. Die Kanzlei war damit fast saniert. Er stand auf, ging durch Martins Arbeitszimmer, blieb vor den vielen Regalen stehen, las gedankenlos den einen oder anderen Buchrücken, lief dann ziellos weiter. Er schaute sich um, als sähe er Martins Wohnung zum ersten Mal. Was wusste er eigentlich von ihm? Sie waren sich fremd geworden, seit Martin mit Ingeborg zusammen war.
Ingeborg … Kein Wort von ihr im Testament. Und ausgerechnet er sollte nun entscheiden, was und wie viel sie bekommen würde. Sie könnte versuchen, das Testament anzufechten. Die Rechtsprechung hatte sich den Zeiten angepasst und urteilte in Sachen eheähnliche Lebensgemeinschaft anders als noch vor fünfzehn Jahren. Sie hätte eine gute Chance, wenn – ja, wenn sie noch zusammengelebt hätten.
Ein Bier wäre jetzt das Richtige, dachte er und ging in die Küche. Er fand keines. Er fand überhaupt keinen Alkohol. Natürlich. Seit seinem Rückfall vor fünf Jahren hatte Martin keinen Tropfen mehr angerührt. Der Entzug war lang und hart gewesen. In den vielen Gesprächen, die dann folgten, waren sich die Brüder zum letzten Mal nahe gewesen, fast wie früher.
Nur fast.
Er setzte sich wieder ins Wohnzimmer und nahm sich noch einmal Martins Brief vor. Das Foto von Bettina Veit fiel aus dem Umschlag. Rainer betrachtete es kurz, legte es beiseite.
Lieber Rainer,
das Testament mag Dir auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, andererseits kennst Du das Verhältnis zwischen Ingeborg, Michaela und mir gut genug, um zu verstehen. „Die ganze Hölle möge sich auf ihrem Wege finden“, erinnerst Du Dich? – Kümmere Dich um sie! Ich weiß, dass bei Dir alles in guten Händen ist, Du wirst es richtig machen. Wir hatten in den letzten Jahren nicht mehr viel miteinander zu tun, Du und ich. Ich habe das immer bedauert und war doch nicht in der Lage, die Barriere einzureißen, die sich aufgebaut hat. Du kennst mich, ich brauche immer einen Anstoß und hoffte, er würde von Dir kommen. Doch er kam nicht.
Betrachte dies bitte nicht als Vorwurf gegen Dich, sondern gegen mich. Einer der vielen Vorwürfe, die ich mir machen muss.
Martin
PS: Bitte gib den beiliegenden Brief Bettina Veit – persönlich. Ich will ihn nicht dem Notar übergeben. Sie soll nicht womöglich noch bei der Testamentseröffnung erscheinen müssen. Sie hat im KWK-Verlag in Frankfurt gearbeitet; Du wirst sie schon finden.
Er musste lächeln über die blinde Zuversicht, die aus diesen Zeilen sprach. Außenstehende hätten sie interpretieren können als das Davonlaufen vor jeglicher Verantwortung, doch Rainer kannte seinen Bruder besser. Martin hatte zuweilen etwas rührend Hilfloses, wenn es um praktische Dinge ging, weitreichende Entscheidungen waren ihm ein Gräuel. Er hat auch kaum welche treffen müssen, dachte Rainer. Dafür hatte er immer mich. Und dann Ingeborg.
Und jetzt hat er mir den Schwarzen Peter zugespielt, ohne mir eine Chance zu geben, ihn wieder loszuwerden. Nun ja, wenigstens Frau Veit hatte er problemlos finden können und damit eine der Aufgaben erledigt, die Martin ihm hinterlassen hatte.
Er steckte Foto und Brief wieder in den Umschlag.
Es klingelte. Michaela Markus stand vor der Tür.
„Hallo, Rainer.“
„Hallo, Michaela. Komm rein.“
Sie bewegte sich in der Wohnung wie in ihrer eigenen. Er hatte sie bei der Beerdigung zum ersten Mal wieder gesehen – nach fast vier Jahren. Sie sah mitgenommen aus. Doch trotz der Anspannung in ihrem Gesicht und der geröteten Augen konnte er sehen, wie schön sie geworden war. Damals hatte sie etliche Pfunde mehr, Pickel im Gesicht und konnte kaum jemanden ansehen, der mit ihr sprach.
Martin hat seine Sache gut gemacht, dachte Rainer. Ingeborg war immer sehr viel mehr als er in ihrem Beruf aufgegangen und hatte vieles an Michaelas Erziehung Martin überlassen.
„Komm, setz dich. Dir geht es nicht sehr gut, hm? Du scheinst die einzige zu sein, die wirklich um ihn trauert.“
„Er war doch mein Vater“, sagte sie leise, während sie sich auf die Couch setzte und vor sich hinstarrte. Dann sah sie ihn an: „Trauerst du nicht um ihn?“
„Doch. Und um vieles mehr als um seinen Tod. Zum Beispiel darum, dass ich so viel versäumt habe, als er noch lebte.“
Michaela griff nach dem Testament, das Rainer achtlos auf dem Wohnzimmertisch hatte liegen lassen.
„Was wirst du jetzt mit dem Geld machen?“, fragte sie.
In Rainer regte sich Misstrauen. „Hat deine Mutter dich geschickt?“
Sie winkte ab: „Nein, natürlich nicht. Außerdem kommt sie gleich selber. Sie sucht nur noch einen Parkplatz. Aber sie wird mit dir darüber reden wollen, wie ich sie kenne.“
Es klingelte aufs Stichwort. Ingeborg betrat die Wohnung und nahm sie sofort völlig für sich ein. Es war immer das gleiche: Sobald sie einen Raum betrat, war sie der Mittelpunkt des Geschehens. Sie war jetzt 40, sah aus wie 34, benutzte kaum Make-up, wie um jedem zu zeigen, dass sie das nicht nötig hatte, kleidete sich sportlich und wirkte stets schick. Sie gehörte zu den Frauen, die es schafften, noch in einem Kartoffelsack elegant aussehen. Ihr Haar war kurz und so raffiniert geschnitten, dass es eine Fülle vortäuschte, die womöglich gar nicht vorhanden war. Sie lachte gerne und war eine bezaubernde Gesprächspartnerin. Ganz und gar nicht der herbe Typ, als den man sich eine Studienrätin für Chemie und Biologie landläufig vorstellt.
Und sie kannte ihre Wirkung sehr genau.
Sie begrüßte Rainer mit einem leichten Kuss auf die Wange und setzte sich neben ihre Tochter auf die Couch.
„Bekomme ich einen Kaffee?“
„Ja sicher.“ Rainer ging in die Küche, um die Maschine anzustellen. Als er wiederkam, hatte Ingeborg das Testament in der Hand.
„Wir müssen darüber reden!“
„Du verlierst keine Zeit, nicht wahr?“
„Was meinst du? Eine Anstandsfrist? Sei nicht albern. Du fliegst in ein paar Tagen nach Berlin zurück – sollen wir das dann telefonisch regeln? Wo läge da der Sinn?“
Natürlich hatte sie Recht. Es hätte keinen Sinn, aus Pietät die Sache hinauszuzögern. Sie sprach gleich weiter, ihr Ton hatte sich jedoch verändert. „Du bist verstimmt, Rainer. Vermisst die Anzeichen meiner tiefen Trauer, Heulen und Tränen über Martins Tod, nicht wahr?“ Sie sah ihn offen an und wandte sich dann ab. „Ich sehe nicht ein, dass ich sie mit jedem teilen muss.“
„Ich bin nicht ‚jeder’“, sagte Rainer.
„Komm, bitte, lassen wir das jetzt.“
Michaela stand auf. „Ich merke schon, es ist besser, ihr macht das unter euch aus. Ich wollte ohnehin noch in die Stadt. Mach‘s gut, Rainer.“
Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, sagte Ingeborg: „Weißt du, ich brauche wirklich dringend Geld. Michaela und ich haben da kürzlich eine Eigentumswohnung gesehen, genau richtig für uns. Westend, nicht gerade billig. Doch etwas fürs Leben, sozusagen. Ich müsste mich bald entscheiden. Doch dazu muss ich wissen, wie viel Geld ich habe.“
„Du kannst sicher sein, dass ich in seinem Sinne handeln werde. Er hat mir vertraut. Nur – lass mir noch ein paar Tage Zeit, bitte.“ Er stand auf, um den Kaffee zu holen. Dabei nahm er den Briefumschlag, der die ganze Zeit neben dem Testament gelegen hatte, vom Tisch und steckte ihn ein.
„Peter! Wie schön, dass du anrufst!“
„Na, so überschwänglich hast du mich ja schon lange nicht mehr begrüßt. Wie geht‘s denn?“
„Bescheiden. Ich habe mal wieder ein Berger-Manuskript vor mir. Und nichts klappt.“
„Du Armes. Und wann muss es fertig sein?“
„Hat noch Zeit. Aber es nervt. Wo bist du?“
„Noch in der Redaktion. Muss noch mal zur Bundesbank raus. Wir sind da an einer vertrackten Geschichte, die sich wohl noch etwas hinzieht.“
Bettina hörte ein Feuerzeug schnappen. „Du wolltest es doch lassen, Peter!“
„Ich rauche nicht. Ich spiele nur mit dem Ding.“
„Und Charlotte?“
„Raucht auch nicht“. Er kicherte. „Blöder Witz, entschuldige. Frau Schäfer ist bei ihr. Hör mal, kannst du sie morgen vom Kindergarten abholen? Charlotte, meine ich, nicht Frau Schäfer.“ Er lachte wieder leise. „Ich werde es nicht schaffen bis zwölf. Dafür bin ich dann nachmittags frei und wir können zusammen essen. Hast du Zeit?“
„Ja, kein Problem. Das heißt dann, ich gehe nach dem Kindergarten schon einmal zu dir und koche, oder?“
Peter lachte. „Siehst du, deshalb liebe ich dich so. Eine Frau mit rascher Auffassungsgabe …“
„Schwätzer!“ lachte Bettina und legte auf.
Sie wandte sich wieder den Korrekturabzügen zu und seufzte. Über spezifische Topoi in Lichtenbergs Aphorismen unter besonderer Berücksichtigung des ideologiekritischen Aspektes der frühbürgerlichen Emanzipationsbestrebungen. Bettina schüttele den Kopf. Unmöglich. Völlig undenkbar. Den Titel konnte man nicht lassen. So etwas ließ sich einfach nicht verkaufen, auch nicht als Fachbuch.
Das bedeutete, sie würde noch einmal mit Berger reden müssen. Ihr graute davor. Professor Dr. Christian Berger, Autor des vorliegenden Manuskripts. Arrogant, selbstgefällig, chauvinistisch und stur. Aber eine unangefochtene Kapazität auf dem Gebiet der Literatur des 18. Jahrhunderts. Der Verlag konnte sich glücklich schätzen, ihn als Autor gewonnen zu haben. Sie weniger. Bei jedem Telefonat mit ihm ließ er sie überdeutlich spüren, dass er sie für inkompetent hielt, ihm Vorschläge zu machen, und für völlig unwürdig, sein Buch zu lektorieren. Dabei legte er eine ausgesuchte Höflichkeit an den Tag, gab sich keine direkte Blöße, so dass sie auch keine Handhabe zu echter Gegenrede hatte. Ein Fisch, der ihr immer wieder aus den Händen glitt.
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
Das war Lichtenberg, spöttisch, voller Witz und mit scharfem, kritischem Verstand, der den ihren momentan lähmte. Ihr fiel beim besten Willen keine Änderung des Titels ein, die verkaufsfördernd – oder doch wenigstens nicht verkaufshemmend – und gleichzeitig wissenschaftlich anspruchsvoll genug war. Sie seufzte. Nein, heute würde sie ihn nicht anrufen. Das schaffte sie nicht. Dann lieber weiter im Text.
Die Entdeckung des Gefühls und einer empfindsamen Seele ist genuin bürgerlich und als Teil der Emanzipation des Bürgertums gegen aristokratischrepräsentatives ‚Amüsement‘ gerichtet. Tränen werden zum Ausdruck der aufklärerischen Vernunft, die sich dem Mitmenschen zuwendet. Und Tränen sind reichlich geflossen, seit Mellefont und Sara auf deutschen Bühnen zum ersten Mal geweint haben. Um die Mitte des Jahrhunderts impliziert Empfindsamkeit jedoch immer auch soziale Handlungsbereitschaft, Philanthropie: „Empfindsam zu schreiben, dazu ist mehr nötig als Tränen und Mondschein“ (GCL, I, F 157). Für Lichtenberg ist zwanzig Jahre später die gesellschaftliche Perspektive immer noch fester Bestandteil: „... lasst Eure Empfindungen Kraft zu guten oder zu großen Taten [geben], nicht das Sprechen aus Empfindung ist, worüber ich lache, … sondern das Schwätzen von Empfindung“ (GCL, I,E 240).
mit seiner Kritik an der falschen Empfindsamkeit. Zunächst noch gegen eine willenlose Subjektivität ohne praktisch-moralische …
Bettina stutzte, blättere zurück, wieder vor. Der Anschluss war nicht da, da fehlte etwas. Sie blätterte im Manuskript – auch hier fehlten ein paar Seiten. Berger hatte sie nicht mit zurückgeschickt. Wütend betrachtete sie den vollgeschmierten Korrekturabzug und warf den Stift hin. Sie hatte genug. Sarah würde toben. Ihre ganze Kalkulation war durcheinander.
Kurz entschlossen griff Bettina nun doch zum Telefon und rief die Universität an. Die Fachbereichssekretärin teilte ihr kühl mit, dass Herr Professor Berger gerade in einer Vorlesung sei. Bettina bat um Rückruf und legte auf. Sie würde ihn am besten im Verlag treffen, auf neutralen Boden. Mit Sarah als Schiedsrichter, falls ihr selber die Nerven durchgingen. Sie machte sich einen Vermerk und legte die Fahnen beiseite.
Ihr Blick ging aus dem Fenster, wo der Regen unablässig in feinen Bindfäden vom Himmel rann. Vor ihr auf dem Schreibtisch lag immer noch der Brief von Martin Kaspar, den ihr sein Bruder auf dem Friedhof gegeben hatte. Der Brief war der eigentliche Grund für ihre Missstimmung, wenn sie ehrlich war. Seit zwei Tagen lag er da – ungeöffnet. Sie hatte sich noch nicht entschließen können, ihn zu lesen.
Als das Telefon klingelte, schreckte sie hoch. Unwillig hob sie ab.
„Veit“.
„Guten Tag. Hier ist Rainer Kaspar. Störe ich?“
„O nein … ich war nur eben …“
„… in Gedanken?“ Sie hörte ihn lachen.
„Ja … nein. Entschuldigen Sie …“
Warum war sie eigentlich so verwirrt?
„Ich fürchtete schon, ich komme ungelegen“.
„Nein, nein.“
Pause.
„Ich wollte Sie fragen …“
„Ja?“
„Ich meine, vielleicht könnten wir – …“
Seine Unsicherheit half ihr. „… uns einmal sehen und etwas zusammen essen?“
Sie mussten beide lachen. Der Bann war gebrochen.
„Wissen Sie, ich dachte es sei ganz einfach“, sagte er. „Ich dachte, ich rufe Sie an und frage Sie, ob Sie mit mir essen gehen wollen. Und plötzlich stellt sich das als großes Problem heraus. Ich stehe hier dauernd neben mir und frage mich, warum ich mich so kindisch benehme.“ Sie sah ihn förmlich den Kopf schütteln. „Also, was meinen Sie?“
„Ja gerne. Wann passt es Ihnen?“
„Samstag Abend? Um acht? Kennen Sie das ‚Cicerone’?“
„Ja, ich weiß wo das ist.“
„Also bis dann. Ich freue mich.“
Langsam legte sie auf und starrte auf den Hörer. Dann auf den Brief, der vor ihr lag.
Drei Jahre, dachte sie.
Und das Leben ging weiter, als sei nichts geschehen.
Sie stolperte über den Koffer, stieß sich am Bett, warf einen Stoß T-Shirts um, fluchte leise und fand schließlich das läutende Telefon vergraben zwischen Jeans und Blusen.
„Ja, Veit.“
„Hier ist Martin Kaspar.“
Ihr Herz kam mit dem letzten Schlag aus dem Rhythmus. Über ihr Atmen hatte sie urplötzlich die Kontrolle verloren.
„Guten Tag“, brachte sie heiser hervor. Der Kloß in ihrem Hals war resistent gegen ihr Schlucken.
„Guten Tag. Sie … haben Sie meinen Brief erhalten?“
„Ja.“
Seine Stimme kam leise, zögernd, nach einer Pause. „Können Sie ihn vergessen?“
Sie merkte, dass ihre Knie plötzlich nur noch aus Pudding bestanden. Langsam setzte sie sich aufs Bett. Ihr Kopf rauschte. Die Stille wurde unerträglich.
„Sind Sie noch da?“
„Ja. Ich … ich … was, ich meine, wie …“
Herrgott, konnten sie denn keinen vernünftigen Satz zustande zu bringen?
Er sprach weiter, seine Stimme zitterte leicht. „Können wir uns einmal sehen?“
Sie überlegte fieberhaft. Ihr Nachtzug nach Florenz ging in zwei Stunden. Sie hatte noch nicht fertig gepackt. Zwei Wochen Urlaub. Danach könnte man … Das war es dann, was sie ihm sagte, als sie schließlich ihre Sprache wieder gefunden hatte.
„Und wenn ich nachkäme?“
Sie glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen.
Doch er war gekommen.
Drei Jahre, in denen sie alles versucht hatte zu vergessen. Und nun lagen sie wieder vor ihr.
Entschlossen nahm sie den Umschlag vom Schreibtisch und öffnete ihn.
Liebe Bettina,
Du wirst diesen Brief nach meinem Tode durch meinen Bruder erhalten. Rainer ist zuverlässig, und Du kannst dich voll und ganz auf ihn verlassen, wie ich es tue.
Es stand immer viel zwischen uns. Dabei hätte ich nichts lieber getan, als dir alles zu sagen. Du hättest es verdient.
Doch es ging nicht. Selbst jetzt bin ich nicht in der Lage, offen zu Dir zu sein*). Es drängt mich dazu – und ich kann es nicht. Dass dies nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun hat, weißt du.
Du kannst die ganze Sache auf sich beruhen lassen. Solltest Du jedoch – was ich eher annehme – alles erfahren, dann denke bitte daran, dass es auch hier keine Sicherheit gibt. Verzeih mir meine Unentschlossenheit. Ich möchte einerseits, dass du alles weißt und scheue mich doch, es in Worte zu fassen.
Ich habe Dich sehr geliebt und tue es immer noch. Ach, hätten wir doch mehr Zeit miteinander gehabt!
Bitte verzeih mir, denn ich weiß, dass ich Dir weh tue, weil ich alte Wunden aufreiße.
Martin
*) S. 1990, 237; V/10:M, IV/9: M, V/7:B
Frank Holbein saß in der Hotel-Lobby und rührte missmutig in seinem Kaffee. Die Sache mit Stegmeier war wichtig. Es wäre ihm lieber gewesen, Rainer wäre mitgekommen. Die Kanzlei Holbein, Kaspar und Berthold allein bei einem neuen Klienten zu repräsentieren, passte ihm ganz und gar nicht. Normalerweise hatte zwar jeder der drei Partner seine eigenen Fälle und zog nur in Zweifelsfragen einen anderen hinzu. Hier jedoch war es eine Imagefrage, dass wenigstens zwei bei diesem ersten Gespräch dabei waren. Aber Rainer hatte alle Hände voll zu tun mit dem Nachlass seines Bruders – und dann diese Ingeborg Markus noch auf dem Hals. Eine fürchterliche Frau. Anmaßend, selbstgefällig und eiskalt. Holbein hatte sie nie gemocht. Und Dieter Berthold musste in Berlin bleiben und dort die Stellung halten.
Eine größere Gruppe englischer Geschäftsleute war angekommen. Holbein schaute gedankenverloren einem hübschen pakistanischen Hotelboy zu, der gerade noch einen Koffer auf den ohnehin schon überfüllten Gitterwagen hievte, um alles zusammen zum Aufzug zu schieben.
Es war ein Koffer zu viel gewesen. Mit lautem Getöse schepperte die Hälfte der Gepäckstücke, Taschen, Regenschirme und Boardcases auf die eleganten Fliesen der Hotelhalle. Der Empfangschef in beeindruckender Livree stürzte, so schnell es ihm seine Vornehmheit erlaubte, zu dem Jungen hin und zischte ihm mit verzerrtem Gesicht Schimpfworte zu, die alles andere als vornehme Lebensart verrieten.
Seufzend wandte sich Holbein seinem eigenen Aktenkoffer zu. Der Schriftsatz Stegmeier war gut ausgearbeitet worden, die Herren waren zufrieden gewesen. Es kam jetzt nur noch auf die Chefin an. Frau Dr. Elisabeth Stegmeier, Vorstandsvorsitzende der Stegmeier AG, hielt 51% der Aktien. Er nahm die Akte noch einmal in die Hand.
Die Kraftmaschinen Union in Brandenburg – ehemals VEB Kraftma – war über die Treuhand ausgeschrieben worden. Ein heißes Rennen hatte eingesetzt und es sah so aus, als hätte die Stegmeier AG die Ziellinie als erste überschritten. Die Kanzlei Holbein, Kaspar und Berthold hatte von der Treuhand den Auftrag bekommen, für seriöse Vermittlung zu sorgen und danach beiden Seiten beratend zur Seite zu stehen. Es war nicht der erste Auftrag dieser Art; die Kanzlei hatte einen guten Ruf.
Der Hotelboy hatte inzwischen die Koffer wieder säuberlich auf dem Boden aufgerichtet und begann, den Wagen von neuem zu beladen und zum Aufzug zu schieben. Ein Teil der Koffer musste zunächst in der Hotelhalle stehen bleiben. Der Empfangschef schwänzelte gerade zur Eingangstür und blieb dann, obwohl sie einen automatischen Drehmechanismus hatte, katzbuckelnd daneben stehen, als wolle er sie aufhalten, um einen offensichtlich höchst wichtigen Gast persönlich zu begrüßen. Dann wedelte er zurück zur Rezeption und stolperte prompt über die stehen gebliebenen Koffer, obschon sie der Pakistani vorsorglich etwas abseits platziert hatte. Zischende Flüche drangen zu Holbein herüber. Der Hotelboy, immer noch auf den Aufzug wartend, hatte die Szene ebenso beobachtet wie Holbein. Ihre Blicke trafen sich kurz und beide grinsten.
Holbein las weiter. Wenn alles glatt ging, konnte es heute zum Abschluss kommen. Die nötigen Vollmachten hatte er dabei. Plötzlich stutzte er. Es fehlten ein paar Seiten im Ordner. Er blätterte vor – sie waren nicht da. Verdammt – ausgerechnet. Er schaute auf die Uhr. Kurz nach drei. Um 15.30 Uhr war der Termin mit Frau Dr. Stegmeier und den Herren vom Vorstand angesetzt. Es fehlte die genaue Beschreibung der einzelnen Liegenschaften und die letzte Bilanz der Kraftmaschinen Union, Unterlagen, in die der Finanzchef der Stegmeier AG bei seinem Besuch in Brandenburg natürlich schon Einsicht gehabt hatte, die jedoch heute – wenn es zum Abschluss kam – ausgehändigt werden sollten.
Er zog sein Mobiltelefon heraus. Frau Müller-Klagenbrink, die Kanzleisekretärin, meldetet sich sofort.
„Ich muss dringend mit Herrn Berthold sprechen! Ist er da?“
„Herr Dr. Holbein! Sie müssten jetzt in Stuttgart sein!“
„Stimmt genau. Man kann hier sogar telefonieren. Geben Sie mir jetzt Herrn Berthold?“
Er sah förmlich ihren missbilligenden Blick, als sie durchstellte.
„Dieter! Gut, dass ich dich antreffe …“
„Wie ist es mit Stegmeier gelaufen?“
Warum lassen einen die Leute in wichtigen Momenten eigentlich nie ausreden? Holbein seufzte leise.
„Das kann ich dir erst in zwei Stunde sagen – wenn überhaupt. Mir fehlen die Liste und die Bilanz. Sie sind nicht im Ordner. Sie müssen im Büro sein. Fax sie mir schnell durch, ja? In einer halben Stunde rücken sie an. Wir können die Sache vergessen, wenn …“
„Natürlich. Ich lass es sofort suchen. Und bleib beim Fax stehen. Du weißt ja, vertrauliche Unterlagen. Die Nummer?“
Holbein wandte sich an den Uniformierten, während er gleichzeitig hörte, wie Berthold durch die Kanzlei Frau Müller-Klagenbrink zurief, sie solle die gottverdammten Stegmeier-Unterlagen zusammensuchen, die diese unsagbar hirnlose Ulli verschlampt hätte.
„Und wenn es – wider Erwarten – nicht zu finden sein sollte“, Dieter Berthold sprach wieder in den Hörer, „ruf ich dich an. Dir wird schon was einfallen. Die Stegmeier soll eine süße Lady sein, sie fliegt sicher hochkant auf dich!“
Holbein stöhnte, gab ihm die Fax-Nummer durch und hörte Dieters lautes Lachen. Dann wurde es ernster auf der anderen Seite. „Wie geht es Rainer? Ist er wieder okay? Es hat ihn ja sehr mitgenommen, schien mir.“
„Ja, es geht wieder. Jetzt nur noch das Übliche mit dem Nachlass, Formalitäten.“
„Alles klar, sie hat es!“ kam wieder Bertholds Stimme. „Sie legt es dir gleich aufs Fax. Toi, toi toi! Denk an Dr. Stegmeier!“ Er lachte wieder und legte auf.
Ein paar Minuten später hatte Holbein die Unterlagen in der Hand. Sie müssten sich eben zunächst einmal mit Fax-Kopien zufrieden geben. Er legte die Kopien in den Ordner und holte die paar Seiten heraus, die da nicht hingehörten.
Diese Ulli! Ulrike Dorflein, Rechtsanwaltsgehilfin, war gerade – wieder einmal – frisch verliebt. Die rosarote Wolke, auf der sie schwebte, warf lange, dunkle Schatten auf den Kanzleibetrieb. Ulli hatte einen von Rainers Fällen aus Frankfurt/Oder – zumindest Teile davon – in die Stegmeier-Akte geheftet; die Aktenzeichen unterschieden sich durch einen Buchstaben und eine Ziffer.
Holbein wollte sie schon in die Seitentasche seines Koffers schieben, als ihn ein paar Worte eines Briefes innehalten ließen: „Einstweilige Verfügung“. Er überflog flüchtig die anderen Blätter: Mahnschreiben, letzte Aufforderungen und Kopien von weiteren einstweiligen Verfügungen. Alles an verschiedene Parteien, und Holbein konnte nicht erkennen, um was es eigentlich ging. Sicher war nur, dass es ihm nicht gefiel, und sein Gefühl täuschte ihn selten.
Und alle Briefe waren von Rainer unterschrieben.
Holbein würde es später noch einmal genau lesen. Und er würde mit Rainer reden müssen. Auf was hatte der sich da eingelassen? Der Ruf einer Kanzlei war schneller ruiniert, als man annahm. Sie hatten große Mühe, ihre finanziellen Schwierigkeiten nach außen zu kaschieren; die neuen Räume, erlesenes Inventar, repräsentables Äußeres – es waren hohe Investitionen, die sich erst in der Zukunft bezahlt machen würden.
„Herr Dr. Holbein?“
Er sah auf. Frau Dr. Stegmeier stand vor ihm – und er wusste Bescheid. Er kannte diesen Blick bei Frauen, wenn es um ihn – in einer speziellen Absicht – ging. Oft genug hatte er dieses Phänomen beobachtet: Schneeschmelze im Februar.
Auch das noch, dachte er, setzte ein strahlendes Lächeln auf und erhob sich.
„Und der Osterhase ist für Papi!“
Charlotte stellte vorsichtig ein Gebilde aus Pappmaché und Buntpapier auf ihren Tisch, betrachtete es wohlgefällig und versteckte es dann im Schrank. „Das ist für Ostern. Bettina, wann ist Ostern?“
„Bald.“
„Gefällt er dir?“
„Ja, ja. Sehr schön. Komm, du kannst den Tisch decken. Peter kommt gleich.“
Charlotte schaute sie kritisch an. Sehr überzeugend hatte das nicht geklungen. Bettina war heute komisch. Sonst alberten sie miteinander herum, heckten sich Streiche aus, die Peter ausbaden musste und hatten einen Heidenspaß, wenn er darauf hereinfiel, auch wenn Charlotte manchmal den Verdacht hatte, dass er sich ganz gerne auf die Schippe nehmen ließ. Warum dachten die Erwachsenen eigentlich, sie würde das Theater nicht durchschauen? Aber sie machte den Spaß mit – sonst hätte sie ihrem Vater ja die Freude verdorben.
Sie ging zum Tisch und schleifte quietschend einen Stuhl zum Schrank, während sie zu Bettina hinüberschielte. Keine Reaktion. Sie kletterte auf den Stuhl, holte laut klappernd drei Teller aus dem Schrank, stellte sie auf den Tisch und schob den Stuhl mit Gepolter wieder zurück. Verstohlen schaute sie über die Schulter. Nicht die leiseste Ermahnung. Bettina stand am Herd, rührte in der Soße und hatte noch nicht einmal das Gesicht verzogen.
Charlotte schüttelte den Kopf. Kein gutes Zeichen. Heute war eindeutig nichts los mit Bettina.
Nach dem Essen – Charlotte war kaum in ihrem Zimmer verschwunden – fragte Peter: „Was hast du heute eigentlich? Du gefällst mir gar nicht.“
„Na, nach deiner Liebeserklärung gestern am Telefon hätte ich doch vermutet …“
Der Versuch misslang. Peter ließ sich nicht ablenken. Bettina setzte sich auf die Couch, nippte an ihrem Kaffee und suchte nach einer Zigarette. „Martin Kaspar ist gestorben“, sagte sie leise, ohne Peter anzuschauen.
Er setzte sich neben sie und streichelte ihr Haar. „Das tut mir leid. Du hast ihn nie vergessen, nicht wahr?“
Sie schüttelte den Kopf und vergrub ihr Gesicht an seiner Schulter. Er hörte sie schluchzen, nahm ihr die Zigarette ab, und legte den Arm um sie. Eine ganze Weile saßen sie da. Schließlich setzte sich Bettina auf.
„Es geht schon wieder. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es mich noch so mitnimmt nach all der Zeit. Sentimentalität.“
Sie versuchte zu lächeln. „Die Gefahr bei solchen Beinahe-Beziehungen ist, dass man sie idealisiert. Man hat ja keine Gelegenheit, den anderen richtig kennen zu lernen. Seine schlechte Seiten zum Beispiel.“
„Selbst wenn man sie kennt, ist es immer noch hart genug“, sagte Peter leise.
Sein Blick ging zu dem Foto, das auf seinem Schreibtisch stand. Peter mit dem Baby, neben ihm Renate, fröhlich lachend. Sie war gestorben, als Charlotte ein Jahr alt war.
„Er hat mir einen Brief hinterlassen. Da kam alles wieder …“
Peter war der einzige, der von Martin wusste. Sie kannten sich seit fünfzehn Jahren. Es war fast selbstverständlich gewesen, dass sie ihn ins Vertrauen gezogen hatte.
„Papi!“ Charlottes Stimme drang aus dem Kinderzimmer.
Peter ging hinüber, als er zurückkam, lachte er: „Sieh mal, mein Ostergeschenk! Sie konnte es nicht abwarten.“
Er stellte den Hasen neben das Foto auf den Schreibtisch.
„Er hat einen Bruder. Ich bin morgen mit ihm verabredetet. Im ‚Cicerone‘.“
„Wer?“
„Martin Kaspar.“
„Warum erzählst du mir das?“ Sein Ton war scharf geworden.
Bettina schaute überrascht auf. „Ich weiß nicht, einfach so. Warum? Was hast du?“
Charlotte erschien an der Tür, wollte etwas sagen und verdrückte sich gleich wieder. Eindeutig dicke Luft heute. Erfahrungsgemäß ließ man die Erwachsenn dann allein. Man konnte nie wissen, ob man nicht selber etwas abbekam.
Peter hatte sich herumgedreht und sah auf Bettina herab. „Es interessiert mich nicht“, sagte er kurz und griff nach den Zigaretten. Sie nahm sie ihm wieder aus der Hand. Aufmerksam sah sie ihn an.
„Peter – du bist eifersüchtig!“
„Und wenn schon, das ist mein Problem.“
Er leugnete es nicht einmal! Bettina konnte es nicht fassen. Ungläubig starrte sie ihn an. Peter – ihr Fels in der Brandung in all den Jahren. Daran hatte auch Renate nichts ändern können. Ausgerechnet er. Das fehlte jetzt noch, dass er seinen Kopf verlor und auch eine Wendung zu sentimentaler Romantik nahm. Und damit ihr unkompliziertes Verhältnis problematisierte.
„Peter, aber wir hatten abgemacht, dass jeder von uns seine eigenen Wege gehen kann, ohne dass der andere …“
„Schon gut. Ich benehme mich ja schon wieder. Weißt du“, er kam zurück zur Couch, „in letzter Zeit, da habe ich mir so ein paar Sachen zurechtgesponnen. Du und ich und Charlotte … . Man wird älter, Bettina.“
Er grinste und war fast wieder der alte. „Man denkt plötzlich an Familie und … , na ja, du weißt schon. Aber offensichtlich liegt es nicht so ganz auf deiner Wellenlänge.“
„Findest du es nicht schön so, wie es ist?“
„Doch, aber es reicht mir nicht mehr. Ich will dich heiraten.“ Er hob beschwichtigend die Hand und legte sie ihr auf den Mund, als er ihr Gesicht sah. Eine völlig unnötige Geste, sie hätte vor Überraschung ohnehin nicht gewusst, was sie sagen sollte.
„Nicht jetzt. Irgendwann. Du sollst nur wissen, dass ich es will. Vielleicht kommst du einmal darauf zurück. Ich werde nicht mehr davon reden.“ Er stand auf. „Lass uns noch ein bisschen spazieren gehen. Charlotte!“ Er war im Kinderzimmer verschwunden.
Bettina blieb erschlagen zurück. Was war nur in ihn gefahren? Noch nie war von Heirat die Rede gewesen – nicht vor fünfzehn Jahren, als sie einige Monate zusammen waren, und nicht, als er alleine mit dem Kind dastand und sie ihre Beziehung erneuerten, auf eine völlig andere Art. Peter hätte seine Arbeit bei der Zeitung als allein erziehender Vater kaum geschafft ohne Bettinas Hilfe in den letzten Jahren. Sie hätte nicht gedacht, dass er sie noch einmal so verwirren könnte. Und doch – wenn sie darüber nachdachte – war es eigentlich ganz einfach. Er hatte gar nichts problematisiert. Er hatte ihr eine Tatsache mitgeteilt, auf die zu reagieren nun bei ihr lag.
„Gehen wir?“ Vater und Tochter standen an der Tür.
„Nein, ich gehe besser nach Hause.“ Sie stand auf und nahm ihre Handtasche. „Seid nicht böse. Ich habe nachzudenken.“
Vor der Haustür verabschiedeten sie sich. Sie sahen ihr beide nach.
Hoffentlich wird sie wieder, dachte Charlotte nachdenklich.
Ingeborg Markus hielt vorsichtig einige Messkolben, Becher und Reagenzgläser unter den Wasserstrahl der dunklen Steinspüle. Drei Wochen Ferien – man sollte ausspannen und abschalten können. Doch sie konnte ihren Ärger nicht einfach hinunterspülen wie den Rest der Lauge, den sie gerade in den Ausguss schüttete.
Diese Kollegen! So nett. Und so mitfühlend. Und dabei glitzerte ihnen allen förmlich die Gier nach jeder Einzelheit aus den Augen, als seien Sensationen zu erwarten. Das war das einzige, was sie alle wirklich interessierte. Nicht der Kummer, den Ingeborg haben könnte. Nicht der Verlust eines Kollegen. Sondern die blanke Neugierde.
„Stimmt es, dass er sich in letzter Zeit … wieder nicht – wohl gefühlt hat?“ – „Warum ist er nicht zu mir gekommen, wir waren doch befreundet, sozusagen!“ – Leeres Geschwätz!
Sie verstaute die Gläser in ihren Halterungen und stellte die Becher hinter die Glasfenster des alten Schranks. Und erst Weber! Der Direktor hatte es fertig gebracht, ihr, als sie zwei Tage nach der Beerdigung wieder ins Lehrerzimmer trat, die Hand zu geben und zu murmeln: „Aber er war doch ein guter Kollege. Das habe ich immer gesagt!“ Nur Frau Neubauer, die war nett gewesen. Sie hatte ihr auf dem Friedhof nur die Hand gedrückt und nicht viel geredet.
Ingeborg stellte ein paar Chemikalien in Glasbechern auf ein abgegriffenes Holztablett und brachte es langsam und vorsichtig in den kleinen Nebenraum.
Als sie mit dem leeren Tablett wieder den Chemiesaal zurückkam, prallte sie zurück.
„Mein Gott! Norbert! Hast du mich erschreckt! Was machst du denn hier!?“
„Ich muss nachher weg und dachte, ich erreiche dich nicht mehr. Hast du mit Rainer geredet?“ Norbert Markus sah seine Schwester fragend an. „Oder willst du warten, bis er wieder in Berlin ist? Das verzögert die Sache unnötig.“
„Ja, ich war bei ihm.“
„Und? Was hat er gesagt?“
„Dass er noch etwas Zeit braucht. Er will nachdenken.“
Norbert brauste auf. „Was gibt es denn da nachzudenken? Martin hat gewollt, dass du deinen Anteil bekommst. Rainer hat sich gefälligst danach zu richten. Außerdem ist er mir noch etwas schuldig.“
„Dir?“ Ingeborg kniff die Augen zusammen und fixierte ihren Bruder einen Augenblick. „Sag mal, was geht denn dich die Sache eigentlich an? Du versprichst dir etwas zu viel, glaube ich! Wenn, dann ist es mein Geld. Ich habe dir von der Wohnung erzählt, die ich …“
„Wir waren uns einig, dass du mir etwas leihst. Ich brauche das Geld nötiger denn je. Und nicht für eine läppische Eigentumswohnung. Mir steht das Wasser bis zum Hals.“
„Warum redest du denn nicht selber mit ihm? Leihst dir direkt von ihm etwas? Er hat es doch jetzt.“
„Wir waren uns einig, dass du …“, wiederholte er.
Sie winkte müde ab und zog den weißen Kittel aus. „Ja, ja, sicher. Aber erst muss ich das Geld haben. Und es hat keinen Zweck, Rainer zu drängen. Er ist zuverlässig. Ich kenne ihn. Er wird es schon nicht übers Herz bringen, mich leer ausgehen zu lassen.“
Sie erwachte, als es dämmerte. Ein Vogel sang ganz in der Nähe des offenen Fensters. Laut und penetrant – eine Amsel? Sie sah schlaftrunken um sich und registrierte unbewusst, dass zwar die Zeit, nicht aber der Ort dazu angetan war, sich noch einmal auf die andere Seite zu drehen und weiterzuschlafen. Sie war nicht zu Hause. Jemand lag auf der anderen Seite des Bettes …
Mit einem Ruck war Bettina hellwach. Sie schaute auf die Uhr neben dem Bett. Halb sechs! Sie hatte nicht einschlafen wollen, nicht hier, nicht mit ihm. Wie viel hatte sie gestern Abend getrunken? Sie wusste doch, dass sie keinen Alkohol vertrug!
Vorsichtig schaute sie zur Seite. Rainer Kaspar lag ruhig und friedlich da, seine Haare hingen ihm halb ins Gesicht. Leise stand sie auf, suchte hastig ihre Kleider zusammen und zog sich an. Der Gedanke an ein gemeinsames Frühstück war ihr unerträglich.
Sie schaute sich um. Küche, Bad, Arbeitszimmer. Waren sie im Wohnzimmer gewesen? Oder gleich im Bett gelandet? Sie schüttelte den Kopf. Nicht mehr daran denken. Sie konnte sich ohnehin nur noch ganz dunkel daran erinnern, wie sie gestern Abend in diese Wohnung gekommen war. Richtig, es waren vier Treppen gewesen. Ohne Aufzug.
An der Tür blieb sie abrupt stehen. Erst jetzt wurde ihr klar, dass dies Martins Wohnung sein musste. Sie ließ die Klinke, die sie schon in der Hand hatte, wieder los und ging von unhaltbarer Neugierde getrieben noch einmal durch alle Räume. Im Arbeitszimmer blieb sie stehen. Alle Eile war vergessen. Auf dem Schreibtisch lagen eine Ledermappe, Briefe, Papiere.
Ihr Blick fiel auf einen großen Umschlag mit dem Absender eines Notariats, offen. Daneben ein Kuvert mit Martins Handschrift, adressiert an Rainer. Sie hatte den Brief herausgenommen und auseinandergefaltet, bevor ihr überhaupt bewusst wurde, was sie tat.
Lieber Rainer,
das Testament mag Dir auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, andererseits kennst Du das Verhältnis zwischen Ingeborg, Michaela und mir gut genug, um zu verstehen. „Die ganze Hölle möge sich auf ihrem Wege finden“, erinnerst Du Dich? – Kümmere Dich um sie! Ich weiß, dass bei Dir alles in guten Händen ist, Du wirst es richtig machen. Wir hatten in den letzten Jahren nicht mehr viel miteinander zu tun, Du und ich. Ich habe das immer bedauert und war doch nicht in der Lage, die Barriere einzureißen, die sich aufgebaut hat. Du kennst mich, ich brauche immer einen Anstoß und hoffte, er würde von Dir kommen. Doch er kam nicht.
Betrachte dies bitte nicht als Vorwurf gegen Dich, sondern gegen mich. Einer der vielen Vorwürfe, die ich mir machen muss.
Martin
PS: Bitte gib den beiliegenden Brief Bettina Veit – persönlich. Ich will ihn nicht dem Notar übergeben. Sie soll nicht womöglich noch bei der Testamentseröffnung erscheinen müssen. Sie hat im KWK-Verlag in Frankfurt gearbeitet, ihre neue Adresse kenne ich nicht; Du wirst sie schon finden.
Hastig steckte sie den Brief wieder zurück, ging auf Zehenspitzen auf den Flur zurück, schnappte im Vorbeigehen Handtasche und Mantel und machte vorsichtig die Wohnungstür auf. In der Wohnung war es still. Nur der Vogel sang noch. Sie zog leise die Tür hinter sich zu. Erst als sie die Treppen hinunter eilte, kam ihr zu Bewusstsein, was sie getan hatte.