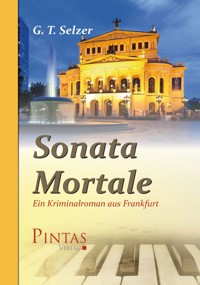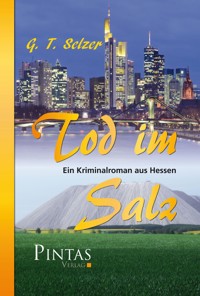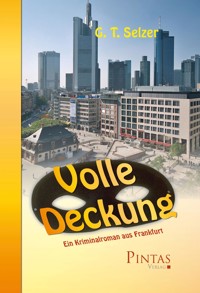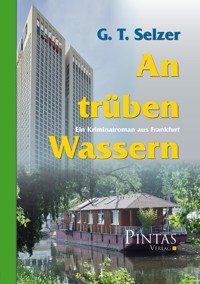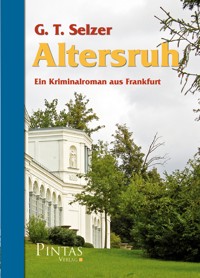
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pintas-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tod in Haus Sonnenstein Auch die nobelste Seniorenresidenz ist letztlich nur ein Altersheim und der unbeliebte Mann mit der Sense dort ein häufiger Gast. Doch ist Charlotte Hagen wirklich eines natürlichen Todes gestorben, oder hatte es der Arzt etwas zu eilig mit dem Totenschein? Und wenn es nicht mit rechten Dingen zuging: Galt der Anschlag überhaupt ihr oder vielleicht doch ihrer Nachbarin Stephanie, mit der sie das Zimmer getauscht hatte? Paul Langer und Johannes Korp, die beiden Ermittler aus Frankfurt, haben zunächst keine Veranlassung, sich damit zu beschäftigen. Denn eine nicht mehr ganz frische Leiche am Eisernen Steg hält sie auf Trab und gibt ihnen Rätsel auf. Erst als sich die Anzeichen dafür mehren, dass der Tote in Verbindung zur Residenz Sonnenstein stand, werden die Beamten hellhörig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
G. T. Selzer
Altersruh
Ein Kriminalroman aus Frankfurt
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Personen:
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Impressum
G. T. Selzer
Altersruh.
Ein Kriminalroman aus Frankfurt
Widmung
Das Buch ist all jenen gewidmet,
die sich eine Einrichtung wie Sonnenstein
nie werden leisten können –
ja, noch nicht einmal davon zu träumen wagen.
ISBN der Print-Ausgabe 978-3-945343-16-6
1. Auflage 2019
© 2019 by PINTAS-VERLAG, Frankfurt am Main
www.pintas-verlag.de
Umschlaggestaltung, Montage, Satz und Layout:
PINTAS‐VERLAG
Foto: Orangerie Putbus, Rügen © by Gerhard Giebener/pixelio.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf als Ganzes und in Auszügenur mit Genehmigung der Rechte-Inhaber wiedergegeben werden.
Personen:
Steffen und Katja Velber; verheiratet, Polizeioberkommissar, Erzieherin
Thomas und Sandra Reismüller; verheiratet, Inhaber der Detektei Reismüller
Matthias und Melanie Jung verheiratet; Inhaber von JungCatering
Joachim Holstein und Max; Dozent für Mittelalterliche Literatur mit Sohn
Britta Zimmermann und Kai; seine Schwester, Werbefachfrau, mit Sohn
Bewohner der Seniorenresidenz Sonnenstein:
Stephanie Velber, Charlotte Hagen, Sebastian Wühler, Rudolf Bartels
Angestellte der Seniorenresidenz Sonnenstein:
Ursula van Dahlen, Direktorin
Regina Schlüter, stellvertretende Leiterin
Tanja Klose und Petra Fichte, Empfangsdamen
Dr. Michael Reinig, Arzt
Polizeipräsidium Frankfurt:
Paul Langer, Kriminalhauptkommissar
Johannes Korp, Kriminaloberkommissar
Jens Schmidtbauer, Kriminalobermeister
Dr. Jürgen Eilers, Rechtsmediziner
Polizeirevier Kaltenberg:
Peter Müller, Polizeihauptkommissar
Franka Holler, Polizeiobermeisterin
Dienstag
Wer weiß, wofür es gut ist.
Dieser Satz seiner Großmutter kam Steffen später, als alles vorbei war, in den Sinn. Es war einer ihrer Lieblingssätze, eine Mischung aus Lebenserfahrung, Altersweisheit und Gottvertrauen – selbst wenn sie letzteres als eingefleischte Skeptikerin weit von sich gewiesen hätte. Der Satz hatte ihr geholfen, Schicksalsschlägen zu begegnen und nach vorne zu schauen. Wobei ihr Schicksal, soweit Steffen es beurteilen konnte, meist Samthandschuhe getragen hatte, wenn es seine Schläge ausgeteilt hatte, denn seine Großmutter war zeit ihres Lebens eine glückliche Frau gewesen. Sie durfte nach einem zu ihrer Zeit keineswegs selbstverständlichen Studium den Mann heiraten, den sie über alles liebte, war nie nennenswert krank gewesen, hatte drei Söhne auf die Welt gebracht – einer davon war Steffens Vater –, und zu sagen, sie hätte ihr ganzes Leben lang in gesicherten Verhältnissen gelebt, wäre die Untertreibung des Jahres gewesen: Steffens Großvater war sofort nach dem Studium die medizinische Karriereleiter zielstrebig nach oben geklettert und mit knapp vierzig Jahren zu einem der jüngsten Chefärzte der ebenfalls noch jungen Republik befördert worden. Erst vor fünf Jahren, mit über achtzig, war er gestorben.
Sie hatte den Gatten mit ihren neunundachtzig Jahren inzwischen weit übertroffen und lebte in einer Seniorenresidenz draußen Richtung Taunus zufrieden und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Dass der alte Körper nicht mehr so wollte, wie sie es gerne hätte – nun ja, man kann nicht alles haben.
Tatsache war, dass sie wieder einmal Recht behalten sollte. Der böse Streit, den Steffen und Katja an diesem Abend austrugen, diese bittere, lautstarke Auseinandersetzung voller Zorn, Wut und Häme – sie hatte einem Menschen das Leben gerettet.
Es war der Dienstag nach Pfingsten, doch es war in keiner Beziehung das „liebliche Fest“, wie es der Geheime Rat von Goethe einst besungen hatte. Es war im Gegenteil ein stickig heißer Tag gewesen, der fünfte in Folge über dreiunddreißig Grad, der jedoch diesmal mit einem reinigenden Gewitter zu enden versprach. Und gerade, als die ersten dicken Regentropfen auf die Erde niederprasselten, als der Himmel sich vorzeitig verdunkelte, so dass es gegen acht Uhr an diesem Frühsommerabend bereits Nacht war, als Donner und Blitz ihren akustisch-optischen Schlagabtausch hielten – da begann der Krach zwischen Katja und Steffen.
Er endete damit, dass Steffen wutentbrannt ins Schlafzimmer stürmte, Decke und Kopfkissen vom Doppelbett riss und mit langen Schritten ins Gästezimmer eilte. Die Tür schlug mit einem Knall zu, der jedoch von einem gleichzeitig einsetzenden Donnerschlag so stark gedämpft wurde, dass er seine dramatische Wirkung völlig verfehlte.
Im Haus kehrte Stille ein.
Draußen wurde der Sturm stärker, der Donner knallte in immer kürzeren Abständen, Blitze rissen die Dunkelheit auseinander und hinterließen einen grellen, unangenehmen Streifen auf der Netzhaut, wenn man die Augen nicht rechtzeitig schloss. Steffen stand am Fenster und fluchte leise vor sich hin.
So eine blöde Kuh!
Er atmete noch einmal tief ein und merkte, dass er ruhiger wurde. Allmählich begann er, seine Umwelt wieder wahrzunehmen.
Das Gästezimmer lag als einziges in diesem Stockwerk neben Küche und Bad der Straßenseite zu. Die mächtigen Platanen gegenüber bogen sich im heulenden Wind; die wenigen Autofahrer fuhren ungewohnt langsam und vorsichtig durch riesige Wasserlachen. Ein einzelner Fußgänger hastete durch den strömenden Regen, eilte auf den Zebrastreifen zu und schaute flüchtig nach links und rechts.
Der dunkle SUV kam aus dem Nichts.
Steffen, eher unbewusst am Überlegen, was den Mann dort draußen bei diesem Wetter wohl auf die Straße getrieben haben mochte, hörte trotz des Gewitters plötzlich das Aufheulen eines starken Motors, sah, wie ein dunkles Etwas herangeschossen kam, sich dem Fußgängerüberweg näherte, den Mann, der gerade die Mitte der Straße erreicht hatte, erfasste und weiter raste.
Ein dunkles Bündel blieb auf dem Zebrastreifen liegen.
Nur für den Bruchteil einer Sekunde stand Steffen wie erstarrt, dann rannte er aus dem Zimmer, auf den Flur hinaus.
Das Handy. Verflucht, wo hatte er das hingetan?
„Du willst doch nicht noch raus heute?“
Katjas Stimme aus dem Wohnzimmer ließ ihn innehalten. „Bist du jetzt völlig übergeschnappt!?“
„Da draußen ist was passiert. Ruf einen Krankenwagen! – Nun mach schon!“, setzte er hinzu, als sie ihn nur verständnislos anstarrte. Er schnappte sich eine Jacke von der Garderobe und registrierte, wie Katja nach ihrem Smartphone griff.
Draußen raubte ihm der Wind fast den Atem. Er rannte zum Zebrastreifen, wo der Mann unverändert lag, ein Bündel aus dunklen, leichten Sommerhosen und einem grauen Kapuzensweatshirt. Es war noch hell genug, um zu erkennen, wie sich die Kapuze vom Blut dunkel färbte. Das linke Bein streckte sich in einem unnatürlichen Winkel vom Körper ab. Unter dem Oberschenkel hatte sich eine Blutlache gebildet, die rasch größer wurde.
Steffen zog die Jacke aus, zögerte kurz und zog dann das T-Shirt über den Kopf. Vorsichtig legte er das leichte Baumwollshirt unter das verdrehte Bein, nahm die beiden Enden und verknotete sie fest. Die Blutung schien langsamer zu werden. Er wollte die Jacke unter den Kopf des Fremden legen, sah das Blut rund um die Kapuze und beschloss, den Kopf nicht zu bewegen. Die Unfallstelle hätte jetzt abgesichert werden müssen, doch daran war gar nicht zu denken. Verdammt, hätte er wenigstens sein Handy gefunden, das er als Taschenlampe benutzen könnte ...
So blieb er stehen und hatte das Glück, dass sonst niemand unterwegs war. Verzweifelt sah er die Straße hinunter. Seitdem die neue Rettungsstation in Kaltenberg nur einen knappen Kilometer stadtauswärts an der Autobahnauffahrt fertig gestellt worden war, waren Blaulicht und Martinshorn für die Anwohner zum Alltag geworden. Wie oft waren Kleinkinder aus der Mittagsruhe aufgeschreckt, hatte sich das Rentnerehepaar nebenan in seiner Siesta gestört gefühlt, hatte drei Häuser weiter Herr Schütze geflucht, der ausgeruht zu seiner Nachtschicht wollte …
Und jetzt – wenn man sie selber dringend benötigte – wie lange dauerte das denn? Hatte Katja überhaupt angerufen?
Tatsächlich waren noch keine drei Minuten seit dem Unfall vergangen. Und endlich hörte Steffen den vertrauten Klang, sah das rotierende blaue Licht den kleinen Hügel hinaufkommen, noch ehe der Wagen selber in Sicht kam. Er stand auf und winkte.
Das orange-weiße Gefährt war kaum richtig zum Stehen gekommen, als schon eine junge Frau aus der Fahrerkabine sprang. Ihr folgte ein Sanitäter mit einer schweren Tasche. Der Fahrer blieb beim Wagen.
Sie beugte sich über den Verletzten, fühlte den Puls.
„Angefahren?“
Steffen nickte.
„Waren Sie das?“, fragte sie eher uninteressiert, während sie dem Fahrer mit Zeichensprache etwas übermittelte.
Steffen schüttelte vehement den Kopf. „Nein!“
Doch die Ärztin hatte sich bereits wieder dem Mann auf der Straße zugewandt und hörte nicht mehr zu. Sie legte eine Infusion und gab dem Sanitäter einen Wink.
Der Fahrer sprach in sein Telefon.
„Okay“, sagte er, während er das Handy wegsteckte. „Sie wissen Bescheid.“ Er eilte mit dem Kollegen nach hinten, um die Trage zu holen.
„Gute Idee, das Bein abzubinden“, sagte die Ärztin im Vorbeigehen und folgte dem Fahrer.
„Wohin …?“, fragte Steffen.
Die Ärztin dreht sich noch einmal um. „Uniklinik. – Und Sie gehen jetzt besser wieder rein, sonst holen sie sich noch was. – Und die Polizei wird mit Ihnen sprechen wollen.“
Polizei bin ich selber, dachte Steffen, während ihm bewusst wurde, dass er immer noch mit nacktem Oberkörper im strömenden Regen stand; seine Jacke lag auf dem Zebrastreifen in einer blutigen Pfütze.
Der Verletzte wurde vorsichtig auf die Trage gelegt, zum Wagen gefahren und hineingeschoben. Eine Minute später war der Wagen den Hügel hinabgerast.
Steffen nahm seine Regenjacke vom Boden auf und ging langsam zur Haustür zurück. Katja war an der Schwelle erschienen und sah ihn fragend an. Er zuckte die Schultern.
„Irgend so ein Idiot hat einen angefahren.“
Bevor er die Kollegen anrief, steuerte Steffen das Bad an. Wahrscheinlich würden sie ohnehin bald auf der Matte stehen.
Unter der Dusche gab er sich wohlig dem heißen Wasser hin, von dem er noch vor einigen Stunden, als die Hitze am größten war, nicht gedacht hätte, dass es ihm heute noch gut tun würde.
Doch seine Gedanken waren woanders. Ihm ging etwas im Kopf herum, das mit dem Unfall zu tun hatte. Da war etwas gewesen … Es war bereits in sein Unbewusstes gedrungen, als er noch am Fenster gestanden und wütend über Katja nachgedacht hatte.
Etwas mit dem Auto.
Schwester Inge Petermann hoffte auf eine ruhige Nachtwache. Sie schlüpfte in die weißen Schuhe, zupfte ihren Kittel zurecht und holte ihren Krimi aus der Handtasche. Dann griff sie nach den Papieren auf dem Schreibtisch im Schwesternzimmer.
„Neuzugang auf der Acht“, informierte sie Werner Breuer, der Kollege, mit dem sie diese Nacht auf der Intensivstation den Dienst verrichten würde. „Schweres SHT, innere Verletzungen, Frakturen. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Wahrscheinlich irgend ein Rowdy, der gedacht hat, die Straße gehöre ihm. Sieht nicht gut aus. Dr. Eichborn hält es für möglich, dass er nicht durchkommt.“
Werner, passionierter Sportradfahrer, hatte für Autofahrer nichts übrig.
„Gut. Dann mache ich mal die Runde“, sagte Inge, nachdem sie in den Krankenakten geblättert hatte. Sie ging hinüber in das Zimmer des Unfallopfers, wo im dämmrig gedämpften Licht der Patient regungslos im Bett lag. Drei Monitore standen rund um das Kopfende des Bettes, die ein leises, regelmäßiges Piepsen von sich gaben – der einzige Hinweis darauf, dass ein Rest Leben in dem Körper war. Inge kontrollierte EEG, EKG, Sauerstoffzufuhr, notierte die Werte in der Krankenakte und warf, schon an der Tür, noch einen Blick auf den Patienten.
Ruckartig blieb sie stehen. Er hatte sich bewegt! Rasch ging sie zum Bett zurück. Jetzt wieder: Mit leichten, fahrigen Bewegungen strich seine Hand, die eben noch starr neben dem Körper gelegen hatte, über das Laken. Aus dem offenen Mund kam ein leises Geräusch, eine Mischung aus Röcheln und Stöhnen.
Inge beugte sich über den Kranken und drückte gleichzeitig den Alarmknopf. Seine Lippen öffneten und schlossen sich krampfhaft, wie unter großer Anstrengung. Sie lehnte sich tiefer über ihn und legte ihr Ohr nahe an seinen Mund.
Mittwoch
Der nächste Tag zeigte sich in frühsommerlicher Unschuld, als hätte die Erde nie etwas anderes gesehen als gemäßigte Temperaturen, blauen Himmel und Sonnenschein. Die Luft war frisch und klar, die Welt sauber und mit sich im Reinen.
Was man von der Beziehung zwischen Katja und Steffen nicht behaupten konnte. Ihr persönliches Donnerwetter hatte alles andere als eine reinigende Wirkung gehabt. Steffen verließ nach einem einsamen Frühstück das Haus, als Katja noch im Bad war; sie musste erst um acht Uhr im Kindergarten sein. Miteinander gesprochen hatten sie nicht an diesem Morgen.
Jetzt saß Polizeioberkommissar Steffen Velber an seinem Schreibtisch auf der kleinen Polizeiwache in Kaltenberg und mühte sich mit dem Protokoll des gestrigen Abends. Meier und Wolters, die beiden Kollegen der Spätschicht, hatten ihn gestern noch kurz aufgesucht, sich dann aber hauptsächlich draußen mit der Spurenlage auf der Straße und dem Zebrastreifen beschäftigt. Sie würden erst nachmittags um zwei Uhr wieder ihren Dienst antreten, doch ihr Bericht vom Abend zuvor war bereits ordentlich im Computer abgespeichert.
Allerdings gab es nichts zu berichten. Die Nachbarn waren befragt worden, doch hatte keiner im entscheidenden Augenblick aus dem Fenster geschaut, geschweige denn, wäre selber draußen gewesen. Alles andere hätte Steffen auch gewundert: Die Häuser der kleinen Siedlung hatten alle den gleichen Grundriss wie Steffens und Katjas Haus, und die Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer lagen ausnahmslos auf der Gartenseite. Sicher hatte kein Nachbar an diesem Abend Veranlassung gehabt, im Gästezimmer zu übernachten
Man fahndete zwar nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines dunklen SUV wegen Fahrerflucht und schwerer Körperverletzung. Steffen hatte bereits am Abend zuvor den Kollegen eingestehen müssen, dass er weder Automarke noch Kennzeichen, ja noch nicht einmal angeben konnte, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer gesessen, nur eben, dass er einen großen, dunklen Geländewagen wahrgenommen hatte. Doch in Zeiten, in denen es megacool war, sich mit knapp drei Tonnen Blech auf der Straße fortzubewegen, ging die Wahrscheinlichkeit, den Wagen zu finden, gegen Null. Zumal man keinerlei Spuren gefunden hatte: keine Metall- oder Glasteile, keine Bremsspuren – nichts, was hätte weiterhelfen können.
Steffen sah von dem Bericht auf.
Keine Bremsspuren?
Dann lehnte er sich in seinem Sessel zurück und starrte an die Decke.
Natürlich – keine Bremsspuren!
Lebhaft stand jetzt die Szene wieder vor seinen Augen: Der Mann betritt die Straße; in diesem Moment taucht der Wagen aus dem Dunkel auf, rast mit weitaus überhöhter Geschwindigkeit heran, fährt mit unvermindertem Tempo direkt auf den Mann zu …
Es konnte gar keine Bremsspuren geben!
Denn der Wagen hatte nicht gebremst.
Und mit einem Schlag wusste Steffen auch, was seit gestern Abend sein Unterbewusstes beschäftigte: Der Wagen kam aus dem Dunkel. Und blieb im Dunkel.
Denn er war ohne Licht gefahren.
Deshalb also war Steffen so gar nichts in Erinnerung geblieben, kein Fahrzeugtyp, kein Fahrer, auch nicht Teile des Nummernschilds. Unter normalen Umständen hätte sein Gehirn reflexartig mindestens winzige Teilinformationen abgespeichert; es war darauf trainiert. Doch wenn nichts zu sehen war …
Und das alles ließ nur einen Schluss zu: Es handelte sich nicht um Fahrerflucht mit schwerer Körperverletzung, sondern um Vorsatz – um versuchten Totschlag, wenn nicht Mord.
Steffen Velber war ein äußerst gewissenhafter Beamter. Wenig später betrat er das Büro seines Vorgesetzten, seinen ausgedruckten und überarbeiteten Bericht in der Hand.
Polizeihauptkommissar Peter Müller, kurz vor der Pensionierung und in Würden ergraut, legte gerade den Telefonhörer hin.
„Das war die Uniklinik“, sagte er. „Das Unfallopfer von gestern Abend ist noch nicht bei Bewusstsein. Man weiß noch nicht, ob er durchkommt.“
Steffen sah den Mann wieder vor sich auf der Straße liegen, im strömenden Regen, die Augen geschlossen. Seltsam friedlich war das Gesicht gewesen ...
„Stellen Sie bitte alles zusammen, was wir haben“, hörte er seinen Chef sagen. „Wir werden es den Ermittlungsbeamten rüber geben.“
Steffen nickte, zeigte auf seinen Bericht und erzählte von seinem Verdacht.
„Hm“, Müller nickte anerkennend. „Gute Arbeit, Velber. Vorsatz also. Umso wichtiger ist, dass das jetzt schnell zur Kripo rüber kommt.“
„Ich würde gerne selber mal in die Klinik fahren, Herr Müller.“ Steffen stand vor Müllers Schreibtisch und druckste herum.
„Wozu?“ Müller blinzelte misstrauisch zu seinem Mitarbeiter hoch. Vom Tisch war vom Tisch – je schneller, desto besser –, das war von jeher seine Devise gewesen.
Steffen zuckte die Schulter. „Ich weiß nicht. Mich etwas umhören, mal mit den Ärzten sprechen, mit den Schwestern.“
„Blödsinn, das ist nicht unsere Aufgabe.“ Müller schüttelte unwillig den Kopf. „Geben Sie die Sache nach Frankfurt ab und damit basta.“
„Dann eben nicht, Blödmann!“
Das war noch das höflichste der Schimpfwörter, mit denen Katja Velber lautstark ihren Göttergatten bedachte, während sie missmutig mit gesenktem Kopf und gerunzelter Stirn die Pedale ihres Fahrrads malträtierte. Wenigsten kurz Tschüss! hätte er durch die Badezimmertür rufen können, als er ging. Statt dessen beleidigte Leberwurst – oh ja, das konnte er gut!
Der Kindergarten, in dem sie arbeitete, lag nur knapp zwei Kilometer von Kaltenberg entfernt im Nachbarort. Katja hob den Kopf und atmete die frische Morgenluft ein, hielt das Gesicht in die Sonne und spürte den Wind in ihren langen blonden Haaren. Sie wurde ruhiger. Sich von diesem Idioten den Tag vermiesen lassen? Nein, niemals! Den Tatsachen ins Auge sehen und das Beste daraus machen – daran hatte sie sich stets gehalten, und sie war sie immer gut damit gefahren.
Und Tatsache war: Es war vorbei. Aus, Ende, Feierabend. Endgültig.
Sechs Jahre hatte ihre Beziehung gedauert, ihre Ehe fast genauso lange. Wahrscheinlich war die schnelle Heirat genau der Fehler gewesen. Für Katja stand von Anfang an fest, dass Kinder dazugehörten, für Steffen nicht ...
Katja liebte Kinder. Sie freute sich jeden Tag aufs Neue auf ihre Arbeit mit den Kleinen, und so war ihre schlechte Laune auch jetzt buchstäblich weggepustet, als sie das Fahrrad vor der Tür der Kita festmachte. Sie war meist die Erste, Elke und Volker, die beiden anderen Erzieher, und ihre derzeitige Praktikantin Anne würden in ein paar Minuten eintreffen.
Sie hörte eine Wagentür zuschlagen und drehte sich um.
„Guten Morgen, Frau Velber! Was für ein schöner Tag!“
Joachim Holstein winkte ihr zu und öffnete die hintere Tür seines X3.
„Guten Morgen!“ Katja trat näher.
„Halte doch mal still, du kleiner Zappelphilipp!“, sagte Holstein lachend. Er löste die Sicherheitsgurte des Kindersitzes und hob einen etwa dreijährigen Jungen heraus.
„Appelfillip!“, krähte der fröhlich und rannte auf Katja zu.
„Hallo Max, guten Morgen! Schön dich zu sehen!“
Dann wandte sie sich dem Vater zu. In letzter Zeit gab es da immer so einen kleinen Stich in der Herzgegend, wenn er sie ansah. Den sie tunlichst zu ignorieren pflegte. Aber in letzter Zeit war es auch immer öfter der Vater, der den kleinen Max in den Kindergarten brachte, statt Max’ Tante, die mit ihnen zusammen lebte und die das früher meist getan hatte. Eigentlich immer getan hatte – bis vor vier Wochen zum Frühlingsfest, zu dem alle Eltern eingeladen waren. Da hatte sie Joachim Holstein kennengelernt. Und seitdem war er meist …
Blödsinn, das war Zufall.
Andererseits – die Familie wohnte im Frankfurter Westend und hatte den Kindergarten in diesem Dorf ausgewählt, weil er auf dem Arbeitsweg von Max’ Tante lag. Sie konnte ihn morgens bequem bringen und nachmittags wieder abholen. Und trotzdem war es jetzt Joachim Holstein, der mit schöner Regelmäßigkeit …
Sie schaute zu ihm auf und sah sein fragendes Gesicht.
„Oh – entschuldigen Sie, was sagten Sie?“
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. „Ich sagte, hoffentlich bin ich nicht zu früh, es ist erst kurz nach halb.“
„Oh! Nein, nein, das ist schon in Ordnung.“
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem Satz ohne Oh?, schalt sie sich.
„Kommen Sie gerne noch auf einen Sprung mit rein, wenn Sie Zeit haben.“ Sie wandte sich zur Tür, wo Max bereits stand und ungeduldig wartete.
Ein alter Golf rumpelte geräuschvoll auf den Parkplatz, Volker stieg aus.
„Moin!“, rief er fröhlich in die Runde. Er war Ende Zwanzig, trug nie etwas anderes als Jeans und T-Shirt und hatte seine mehr als schulterlangen Haare als Pferdeschwanz auf dem Rücken gebunden. Die Kinder liebten ihn heiß und innig – erkannten sie doch instinktiv das Kind, das immer noch in ihm steckte und ihn wahrscheinlich bis ins Alter begleiten würde. Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Wenn sich je einer diesen Rat von Erich Kästner zu Herzen genommen hatte, dann war es Volker Keller.
Prompt stürmte Max auf ihn zu.
Volker hob die Hand.
„Hi Max! Give me five!“
Zwei Hände, eine große, eine kleine, klatschen aneinander. Der Junge quiekte.
Katja schmunzelte und betrat mit Joachim Holstein das Gebäude. Sie führte ihn ins Büro.
„Hier, dann kann ich Ihnen das gleich geben. Die Einladung zum Elternabend nächste Montag. Wäre schön, wenn Sie kommen könnten. – Und Ihre Schwester natürlich“, fügte sie rasch hinzu.
„Ja, ich denke, es lässt sich einrichten.“ Er nahm das Papier und lächelte sie an.
Himmel, er sollte das wirklich bleiben lassen!
Er war bereits an der Tür, als er sich nochmals umdrehte.
„Sagen Sie, haben Sie eigentlich auch meine Nummer, ich meine für Notfälle? Oder nur die von Britta?“
„Ich glaube, wir haben beide, ich schau gleich nachher in den Computer. Vielleicht könnten Sie sicherheitshalber ...“
Er kam zum Schreibtisch zurück und legte ihr seine Visitenkarte hin. Blieb stehen, zögerte.
„Ich wollte Ihnen doch endlich einmal sagen, Frau Velber, dass ich sehr froh bin, dass Max hier untergekommen ist. Er fühlt sich so wohl bei Ihnen. Ich ...“ Er stockte.
„Danke, Herr Holstein“, sagte sie freudig überrascht. „Wissen Sie, viele Eltern halten alles für selbstverständlich und verlieren kaum ein Wort darüber. Aber auch unsereins braucht ab und zu ein Wort der Bestätigung.“
„Wenn es nur das ist“, wieder lächelte er, „das können Sie gerne haben!“ Er sah auf die Uhr. „Ich muss,. Einen schönen Tag, und lassen Sie sich von den kleinen Rackern nicht stressen, Frau Velber!“
„Werde mir Mühe geben. Auf Wiedersehen!“
Durch das Fenster beobachtete sie, wie Joachim Holstein seinen Sohn noch einmal hochhob und sich mit einem Kuss von ihm verabschiedete. Dann rollte der BMW vom Parkplatz.
Wer sagt denn, dass ein mieser Morgen nicht noch zu einem schönen Tag werden kann, dachte Katja beschwingt. Und machte sich keine Illusionen darüber, warum es ihr auf einmal so leicht fiel, an eine Trennung von Steffen zu denken.
Das Leben konnte doch sehr einfach sein.
Lange lag das Lächeln noch auf seinen Lippen, als Joachim Holstein zurück in die Stadt fuhr. Doch, sie war wirklich nett, diese Kindergärtnerin – nein, Erzieherin hieß das heute. Dann schüttelte er den Kopf; sein Lächeln verschwand. Was sollte das denn! Sie war verheiratet. Und außerdem: Sibylle war erst seit drei Jahren tot.
Er lenkte den schweren Wagen Richtung Westend, fuhr jedoch am Campus vorbei und schlug den Weg zur Villa ein. Er hatte heute keine Vorlesungen, und seine Abteilung für Mediävistik im literaturwissenschaftlichen Fachbereich war alles andere als überlaufen. Er konnte genauso gut zu Hause arbeiten.
Als er die Haustür aufschloss, stand noch immer der Umzugskarton in der großen Eingangshalle, wo er am Samstag nachlässig abgestellt worden war. Während Holstein die Halle durchquerte und seinem Büro zustrebte, rief er die große Freitreppe hinauf: „Kai, räum doch endlich mal das Zeug hier weg!“
Nicht, dass er eine Antwort erwartet hätte. Dagegen sprachen laute, fremdländische Klänge, die aus den oberen Sphären des Hauses bis in das Erdgeschoss drangen. Exotische Tonsequenzen in ungewohnter Instrumentalisierung – dünne Streicher, flötenartige Bläser –, gemischt mit hohen Frauenstimmen.
Er schloss die Tür seines Büros hinter sich, ging ans Fenster und starrte in den gepflegten Garten hinaus. Vielleicht hätte er doch ins Institut gehen sollen; er wäre weniger abgelenkt gewesen.
Die Musik verstummte urplötzlich, kurz darauf klopfte es an der Tür. Britta erschien.
„Entschuldige, wir haben dich zu spät gehört. Die Musik war wohl zu laut. Kai wollte mich dafür begeistern, allerdings fürchte ich ...“ Sie lachte und machte eine hilflose Geste mit den Händen.
Er winkte ab. „Kein Problem.“
„Alles in Ordnung? Du siehst unzufrieden aus.“ Britta Zimmermann betrachtete ihren Bruder nachdenklich und setzte sich auf die große Couch in der Ecke.
Er schüttelte den Kopf. „Schon gut. Du weißt schon, es gibt so Tage …“ Er seufzte, ging an die kleine Kaffeemaschine auf dem Sideboard und ließ zwei Espressi einlaufen. Er reichte ihr eines der kleinen Tässchen und setzte sich hinter den Schreibtisch.
Er hatte seine Entscheidung, Britta nach Frankfurt zu holen, um sich nach Sibylles Tod mit ihr und dem kleinen Max das Haus im Westend – ihrer beider Elternhaus – zu teilen, noch nicht bereut. Das Haus war weiß Gott groß genug, jeder lebte in seiner eigenen Wohnung und sein eigenes Leben, doch der Junge hatte seine Ersatz-Mama, die er Itta nannte.
Britta war nach ihrer Scheidung gerne wieder nach Frankfurt gezogen. Bereits in den letzten Wochen von Sibylles Schwangerschaft war sie öfter von Bad Nauheim heruntergekommen und hatte sich mit ihnen auf das Baby gefreut, für das sie selbstverständlich als Patentante auserkoren war. Was Joachim damals noch nicht wusste, weil seine Gedanken viel zu sehr von der Vorfreude auf das Baby und der Sorge über Sibylle gefangen genommen waren: Es waren auch die letzten Wochen von Brittas Ehe gewesen.
Sibylle hingegen schien in Brittas Probleme eingeweiht – die beiden Schwägerinnen hatten sich ja schon immer sehr gut verstanden – und Joachim erinnerte sich an ihre endlosen Gespräche vor Max’ Geburt. Frauengespräche, hatte er gedacht und sich ausgeschlossen gefühlt. Doch sie hatten Sibylle gut getan in einer Zeit, die diese fast nur liegend verbringen musste.
Und dann die Katastrophe: Sibylle hatte die Geburt nur drei Tage überlebt. Eine Sepsis im Wochenbett. Im einundzwanzigsten Jahrhundert. Unfassbar, unverständlich – und unentschuldbar.
Gedankenverloren blickte Joachim Holstein wieder in den Garten hinaus.
Und jetzt war auch noch Kai da.
Kai Zimmermann, Brittas Sohn aus jener unglückseligen Ehe, war fünfundzwanzig und studierte in Bonn. Beziehungsweise studierte nicht: Vor zwei Wochen hatte er seiner Mutter lapidar eröffnet, dass er sein bislang äußerst erfolgreiches Medizinstudium an den Nagel zu hängen gedachte, stattdessen nach China gehen und dort die Traditionelle Chinesische Medizin studieren wolle. „Die Schulmedizin hat keine Zukunft, Mama“, hatte er erklärt. Ihren Einwand, dass das eine das andere nicht ausschließe, dass er zunächst den Abschluss hier machen solle und danach immer noch Gelegenheit für ein Aufbaustudium in TCM sei, hatte er mit einer Handbewegung und einem ärgerlichen Verlorene Zeit! beiseite gewischt.
„Hast du noch einmal mit ihm geredet?“ Joachim nickte mit dem Kopf nach oben, wo die Musik leise wieder eingesetzt hatte.
„Stur wie ein Esel“, sagte Britta mit unterdrücktem Zorn. „Wie sein Vater. Andere würden Gott weiß was tun für einen Medizinstudienplatz – und er wirft einfach alles hin!“
„Er ist alt genug; er muss wissen, was er tut. Dumm ist er nicht.“
„Ja, eben! Es war ein letzter Versuch. Und dann hat er mir so nebenbei eröffnet, dass er bereits im Wintersemester in Peking anfängt.“
„Oh, das ging schnell!“, meinte Joachim erstaunt.
„Na klar, die Uni verdient ja daran. Billig wird das nicht!“
„Meinst du ...“
„Nein, nein, alles gut. Das ist kein Problem. Wir schaffen das. – Ach, lassen wir’s!“
„Musikalisch ist er jedenfalls schon eingestimmt“, sagte er lächelnd mit einem Blick zur Decke.
Sie seufzte und gab sich einen Ruck. „Ich hoffe, es war nicht zu umständlich für dich, den Kleinen in die Kita zu bringen“, meinte sie dann.
„Oh, nein überhaupt nicht, ich ...“
Er sah auf und bemerkte, wie seine Schwester ihn über den Rand ihre Tasse amüsiert musterte. Eine leichte Röte stieg ihm ins Gesicht.
Süß, dachte sie.
„Sie ist aber auch wirklich nett“, meinte sie dann.
„Wer?“
Britta sah ihn mit hoch gezogenen Augenbrauen an. Er grinste in sich hinein. Keine Chance – er hatte ihr noch nie etwas vormachen können.
„Ja, sehr nett. – Aber es ist noch zu früh“, setzte er leise hinzu.
„Offensichtlich nicht“, bemerkte sie trocken.
Er winkte ab. „Außerdem ist sie verheiratet. Mit diesem Polizisten.“
„Mit welchem Polizisten?“
„Erinnerst du dich nicht? Damals auf dem Frühlingsfest in der Kita, wo er den Kindern die ersten Verkehrsregeln beigebracht hat? Max war total begeistert von der Uniform.“
Britta setzte sich auf. „Ach, das war der Mann von Frau Velber?“ – Nachdenklich sah sie ihren Bruder an. „Vielleicht solltest du dich dann doch lieber etwas zurückhalten.“
„Warum? Weil sie verheiratet ist? Oder weil er Polizist ist?“
Sie antwortete nicht und stand auf. „Ich muss noch mal ins Büro, ein paar Unterlagen holen.“
„Wann musst du morgen früh weg?“
„Ich fahre schon heute Abend mit dem Zug, da bin ich noch vor acht in Köln und kann im Hotel schlafen. Das Meeting fängt morgen um halb neun an, und ich hasse es, früh aufzustehen, wie du weißt.“
An der Tür blieb sie noch einmal stehen. „Ihr kommt doch zurecht, Kai und du und Mäxchen?“
„Aber ja. Wir sind doch schon große Jungs!“
Halb sechs. Steffen räumte zum dritten Mal die Akte eines Autoknackers auf die rechte Schreibtischseite und schlug den Vorgang über den Einbruchdiebstahl in einem Eckkiosk auf. Und wieder zu. Er seufzte. Feierabend – und keine Lust, nach Hause zu gehen, wo er und Katja versuchen würden, sich aus dem Weg zu gehen und den Abend irgendwie über die Runden zu bringen. Sein Bettzeug lag noch immer im Gästezimmer, und da würde es wohl auch bleiben …
„Willste nicht Schluss machen für heute?“ Franka Holler grinste zu ihm hinüber. „Oder haste kein Bock auf zu Hause?“
„Bist ja auch noch da.“
„Auf mich wartet ja auch keiner.“
Warum wohl, dachte Steffen und warf der Kollegin einen viel sagenden Blick zu. Franka Holler war knapp einen Meter sechzig hoch, dafür fünfundsiebzig Kilo schwer. Die Uniformjacke spannte über ihrem üppigen Busen, der Hosenbund schien ihre Taille schmerzhaft einzuschnüren. Dünne, strähnige, schulterlange Haare undefinierbarer Farbe waren im Nacken zu einem Zopf zusammengefasst, was ihrem Gesicht zusätzliche Fülle verlieh – Fülle, die ihr Haar weitaus nötiger hatte und mit einer geschickteren Frisur auch hätte erreicht werden können.
„Hast Recht, ich geh jetzt“, sagte Steffen im Aufstehen. „Bis morgen.“
Er hatte einen Entschluss gefasst.
Er lenkte den Golf Richtung Autobahn, nachdem er entschieden hatte, dass der Weg durch die Stadt wahrscheinlich länger dauern würde, und fuhr auf die A5. Eine gute Fee zauberte ein kleines Wunder und sorgte dafür, dass er trotz des nachmittäglichen Pendlerverkehrs nach knapp zanzig Minuten eine kleine Ansiedlung in der Nähe von Steinthal erreichte.
Der makellos weiße Stein des klassizistischen Herrenhauses leuchtete in der Nachmittagssonne; in jeder Etage des dreistöckigen Gebäudes zog sich eine Reihe von Balkonen über die Fassade; das mächtige Hauptportal wurde von Säulen flankiert. Im Hintergrund ging rechts ein Säulengang zu einem kleineren, modernen Bau ab; auf der linken Seite befand sich eine Halle, durch deren große, offen stehende Fenstertüren man das Wasser eines Pools glitzern sah. Den gepflegten Rasen, der den gesamten Komplex umgab, begrenzten üppig blühende Blumenrabatten; hinter den Gebäuden ging die Anlage in einen baumbestandenen Park über. Aus der Ferne grüßte der Taunus herüber.
Idylle pur.
Nur der Leichenwagen, der, halb von Büschen verdeckt, diskret neben dem Haupthaus stand und gerade mit einem billigen Blechsarg beladen wurde, passte nicht in das Bild.
Steffen fuhr langsam über den breiten Kiesweg der Auffahrt, parkte und stieg aus. Dann blieb er stehen und sah hinüber. Nun ja, dies war ein Altersheim; mochte es sich auch Seniorenresidenz nennen und den gut betuchten Bewohnern jeden nur möglichen Komfort bieten; mochten auch Begriffe wie Speisesaal, Krankenstation, Patient oder Heimleitung strikt aus dem Wortschatz gestrichen sein zugunsten von Restaurant, Reha, Gast oder Direktion: Tatsachen ließen sich nicht euphemistisch aus der Welt schaffen. Die Senioren waren alt und die Residenz ihr letztes Heim. Und das Auftauchen des schwarzen Kombis mit den Milchglasscheiben und den dezenten goldfarbenen Palmwedeln auf den Seitentüren war hier sicher keine Seltenheit.
Plötzlich bemerkte Steffen die neugierigen Blicke, die auf ihn gerichtet waren. Ein Mann in feierlichem Schwarz löste sich aus der kleinen Gruppe um den Leichenwagen und kam auf ihn zu.
„Ist etwas nicht in Ordnung?“, fragte er.
„Wie?“ Steffen schaute irritiert. „Wieso?“
„Na ja ...“ Der Mann schaute ihn fragend an. „Es hieß, wir können sie mitnehmen. Totenschein ist ausgestellt.“ Er zeigte zum Haus hin. „Dr. Reinig meinte, es gäbe keine Fragen. Die Frau war über achtzig ...“
Steffen starrte ihn an, dann wurde ihm bewusst, dass er noch immer seine Uniform trug.
„Ach so.“ Er schüttelte den Kopf. „Nein, nein, ich bin privat hier.“ Er nickte den Bestattern zu und ging zum großen Portal hinüber. Mit einem Knall hört er hinter sich die Hecktür des Leichenwagens zuschlagen. Etwas Endgültiges lag in diesem Geräusch.
Er war bereits an der Empfangstheke vorbei, als er hinter sich eine Stimme hörte: „Hallo! Wohin möchten Sie?“
Er drehte sich um. Eine junge Frau mit langen blonden Haaren und strengem Blick hatte sich über den Tresen gebeugt und sah ihn fragend an. Ihr Namensschild wies sie als Petra Fichte aus. Sie musste neu sein, Steffen hatte sie noch nie hier gesehen.
„Ist Frau Klose nicht da?“
„Ich vertrete sie“, sagte sie kurz angebunden. „Zu wem möchten Sie bitte?“
„Apartment 108, zu Frau ...“ Weiter kam er nicht.
„Nein, da können Sie jetzt nicht rein.“ Sie musterte ihn, und Steffen hörte die gleiche Frage innerhalb von zwei Minuten noch einmal. „Oder ist etwas nicht in Ordnung?“
Er ging langsam zur Theke zurück. „Was soll den nicht in Ordnung sein? Meine Großmutter ...“
„Oh!“ Erschrocken fuhr ihre Hand an den Mund. „Dann hat man Sie gar nicht benachrichtigt?“
Mit einem großen Schritt war er vollends bei ihr und packte sie am Unterarm. „Was? Was hat man ...“ Er schaute nach draußen in die Auffahrt, wo eben der Leichenwagen langsam über den Kies davonknirschte. „Nun sagen Sie schon!“
Sie folgte seinem Blick und nickte. „Ja. Die Dame aus 108. Es tut mir leid.“
„Frau Velber?“ Er war laut geworden. „Sie meinen, das dort ist Frau Velber!?“
„Ich habe am Montag erst angefangen und kenne die Namen unserer Gäste noch nicht, aber es ist die Dame von 108. – Entschuldigen Sie – mein Arm … Würden Sie bitte … Das tut weh ...“
Steffen starrte sie an, dann auf seine Hand, die ihren Unterarm immer noch fest umklammert hielt, und zog sie schnell zurück. „Aber das kann nicht sein, ich habe sie doch am Wochenende noch gesehen!“, murmelte er.
„Was gibt es denn? Kann ich Ihnen helfen, Herr Velber?“ Ein Mann in legeren dunkelblauen Hosen und weißem Polo-Shirt kam die große Freitreppe herunter. Ein kleines Namensschild unter dem Logo des teuren Herstellers wies ihn als Angestellten des Hauses aus.
Steffen fuhr herum. „Herr Dr. Reinig! Was ist mit meiner Großmutter?“
Der Arzt runzelte leicht die Stirn. „Nichts, so viel ich weiß. Ich denke, es geht ihr gut.“ Dann schien er zu begreifen. „Oh, keine Sorge! Wussten Sie nicht, dass sie das Zimmer mit Frau Hagen getauscht hatte? Frau Hagen ist gestern verstorben.“
„Wann?“
„Gestern am späten Abend. Wir hatten sie …“
Steffen schüttelte ungeduldig den Kopf. „Ich meine, wann haben sie das Zimmer getauscht? Und warum denn um Himmels Willen?“
„Wie wäre es, wenn Sie hoch zu ihr gingen? Sie kann Ihnen sicher alles besser erklären. Sie ist jetzt in 107, das Apartment auf dem Flur gegenüber.“
Steffen nickte benommen, dann wandte er sich ab und eilte auf die Treppe zu. Hinter sich hörte er ein scharfes, zischelndes Flüstern. Dr. Reinig hielt der armen Frau Fichte eine gehörige Standpauke.
„Du kannst dir vielleicht vorstellen, was ich für einen Schrecken bekommen habe“, sagte Steffen, während er mit den Teetassen hantierte. „Wo ist denn hier der Zucker?“
„Oben links. Kekse müssten auch noch in der blauen Dose daneben sein.“ Seine Großmutter saß in einem gemütlichen Ohrensessel, den Steffen nicht kannte. Ebenso wenig wie die restlichen Möbel, die Bilder, die Teppiche. Ansonsten war das Apartment genau so geschnitten wie das auf dem Flur gegenüber liegende, das Frau Velber normalerweise bewohnte. Der Tod ihrer Nachbarin schien sie nicht über die Maßen mitgenommen zu haben.
„Charlotte war zweiundachtzig, sieben Jahre jünger als ich“, fuhr die alte Dame mit Stolz in der Stimme fort, als sei es ihr persönlicher Verdienst, länger durchgehalten zu haben. „Das ist eine verflucht lange Zeit in unserem Alter.“
Steffen grinste. Seine Großmutter war in ihrer ganzen Erscheinung immer schon das gewesen, was er mit dem Wort distinguiert verband: die schneeweißen Haare stets modisch-chic frisiert, die Kleidung zu jeder Tageszeit elegant, leichtes Make-up, gepflegte Hände – die nötigen Muße und die finanziellen Möglichkeiten dazu hatte sie stets gehabt.
Immer wieder blitzte hinter dieser freundlichen Fassade ein eiserner Wille auf, der ihr geholfen hatte, in jeder Lebenssituation Haltung zu bewahren. Und der Schalk, mit dem sie die polierte Oberfläche ab und an zu durchbrechen beliebte, etwa wenn sie sprachlich aus der Rolle fiel.
„Wie kommt es denn, dass ich dich an einem normalen Mittwochabend sehe?“, fragte sie, als er alle Tee-Utensilien auf den kleinen runden Tisch vor der Balkontür gestellt hatte, neben dem der Ohrensessel stand.
Schlau war sie auch, seine Oma – hatte sie doch sofort den Finger auf die richtige Stelle gelegt. Oder wollte sie nur nicht über das reden, was drüben passiert war? Er fühlte ihren prüfenden Blick.
„Na ja, geht mich nichts an“, sprach sie weiter. „Nur so viel: Überlege dir gut, wie lange es noch so laufen soll. – Glücklich siehst du jedenfalls nicht aus“, entschied sie und griff zur Teetasse.
„Nun mal ehrlich, Oma. Du hast Katja nie gemocht.“
„Ha, dachte ich es mir doch!“ – Zufrieden über die prompte Bestätigung ihrer kryptischen Bemerkung, biss sie in einen Keks. „Mal wieder dicke Luft zu Hause.“
Keine Frage – eine Feststellung.
Steffen seufzte nur.
Die Großmutter nickte. „Nein“, fügte sie dann nachdenklicher hinzu, „es ist nicht so, dass ich Katja nicht mag. Ich habe nur immer gedacht, dass ihr überhaupt nicht zusammen passt.“
„Ich fürchte immer mehr, du hast Recht.“ Er blickte durch die offene Balkontür auf den Park hinaus. „So kann es mit uns nicht weitergehen.“
„Solange es dazu führt, dass du mich während der Woche überraschend besuchst, nur um nicht nach Hause zu müssen, bin ich zufrieden.“
Steffen grinste wieder.
„Am Wochenende habe ich keinen Dienst, da wäre ich ohnehin gekommen. – Aber jetzt erzähl mal. Wie kommt es, dass du in diesem Apartment bist und deines dieser Frau gegeben hast?“
„Ach das. Das war nur vorübergehend. Am Sonntag saßen wir unten auf der Terrasse zusammen – das kam eher selten vor, Frau Hagen war ein sehr verschlossener Typ – und sie jammerte darüber, dass sie in den letzten Nächten kaum geschlafen hätte. Der Vollmond schien direkt ins Fenster oder was weiß ich ...“
Frau Velber schwieg und warf ihrem Enkel einen kurzen Blick zu, dann schaute sie wieder aus dem Fenster. Schließlich zuckte sie die Schultern.
„Na ja, eher spaßeshalber habe ich ihr angeboten, es doch mal bei mir drüben zu versuchen, und sie stimmte sofort zu. Das Personal hatte ohnehin gerade die Betten neu bezogen ... – Gib mir bitte noch eine Tasse Tee, ja?“
Steffen rührte sich nicht. „Das ist doch nicht alles!“
„Also – weißt du – wirklich! Meinst du, ich lüge?“, setzte sie in schlecht gespielter Empörung an. „Wenn ich dir doch sage, es war ein Spaß …“
Doch sie wich seinem Blick aus.
„Und wann ziehst du wieder rüber in dein Apartment?“
„Morgen, haben sie gesagt. Was ist jetzt mit dem Tee?“
Merkwürdig, dachte er, als er nach dem Abschied dem Parkplatz zustrebte. Sicher, für spontane Einfälle war seine Großmutter immer zu haben. Doch dass sie aus einer Laune heraus mal eben das Bett tauschte – sie, die so großen Wert auf Privatsphäre legte – nein, das glaubte er nicht. Da musste es einen Grund gegeben haben.
Doch sie hatte sich standhaft geweigert, mehr dazu zu sagen.
Und Steffen wusste, wann er verloren hatte.
Donnerstag
Der Mann, der am nächsten Nachmittag die kleine Polizeistation in Kaltenberg betrat, war etwa Mitte Dreißig, trug einen teuren dreiteiligen Anzug und duftete dezent nach einem exklusiven Eau de Cologne. In der Hand hatte er einen schmalen Aktenordner. Er wartete höflich an der Theke, bis eine korpulente Sechzigerin mit festgebackenen Dauerwellenlöckchen ihre ausführlichen Schilderungen der nachbarlichen Ruhestörung beendet hatte. Offensichtlich eine Stammkundin des Reviers.
„Is gut, Frau Breithaupt!“, sagte Polizeiobermeisterin Franka Holler auf der anderen Seite des Tresens – etwas lauter als nötig und mit kaum unterdrückter Ungeduld. „Hab alles aufgeschrieben, okay?“ Sie klopfte mit dem Kugelschreiber auf den dünnen Ordner, der vor ihr lag. „Sie können jetzt nach Hause gehen!“ Ein entsprechender Fingerzeig zur Tür unterstrich die Aufforderung.
„Und Sie werden auch bestimmt was unternehmen? Weil, so geht das net, und ich …“
„Wir kümmern uns drum!“, unterbrach sie die Polizistin grob.
Frau Breithaupt grummelte in sich hinein und ging zur Tür. Franka seufzte tief und wandte sich mit grimmigem Gesicht dem neuen Besucher zu.
„Ich möchte gerne Polizeioberkommissar Velber sprechen“, sagte der Fremde.
„Und Sie sind?“ – Franka spielte mit dem Kugelschreiber in ihrer rechten Hand, indem sie ihn nervös zwischen Zeige- und Mittelfinger hin und her schwenken ließ.
„Johannes Korp.“
„Haben Sie eine Aussage zu machen?“
„Nein. Ich ...“
„Haben Sie einen Termin mit dem Kollegen Velber?“
„Nein, ich wollte nur ...“
„... mit Polizeikommissar Velber sprechen.“ Sie musterte ihn missbilligend. Fatzke! „In welcher Angelegenheit?“ Sie variierte das Spiel mit dem Kugelschreiber, indem sie hektisch den Druckkopf auf und nieder drückte.
Der Besucher seufzte resigniert, griff in seine Jackentasche und hielt ihr ein scheckkartengroßes Stück Plastik unter die Nase.
„In einer dienstlichen.“
Der Kugelschreiber fiel auf dem Tresen, wo er einen Sprung machte und auf dem Boden landete. Franka bückte sich rasch und kam mit rotem Kopf wieder hoch.
„Vielleicht sollte ich erst einmal mit dem Chef ...“, murmelte sie und hangelte nach dem Telefon.
„Tun Sie das, Kollegin, wenn Sie es für nötig halten“, sagte Korp milde.
Doch dann ließ Franka den Hörer wieder sinken und eilte durch eine Tür davon. Kurz darauf schoss sie wieder heraus und baute sich vor Korp auf.
„Hab ich ganz vergessen. Der Chef ist ja kurz weg.“
Korp atmete langsam tief durch. „Ich wollte auch nicht Herrn Müller sprechen, sondern Herrn Velber.“
In diesem Moment trat Steffen aus dem Flur, legte einen Schlüssel mit einem Holzbrettchen als Anhänger – WC. Nur für Dienstpersonal – auf den Tresen und sah Korp fragend an.
Der hielt Steffen seinen Dienstausweis hin. „Kriminaloberkommissar Johannes Korp. Können wir hier irgendwo ungestört reden?“ Ein beredter Blick ging in Richtung Franka Holler.
Steffen schaute auf den Ausweis und nickte. „Sie kommen vom Präsidium in Frankfurt? Was gibt’s denn?“, fragte er, während sie zusammen zum Sozialraum gingen.
Korp schloss die Tür, und beide setzten sich. Statt einer Antwort fragte er: „Sie heißen Steffen Velber?“ Er legte den Ordner vor sich auf den Tisch. „Oder Stefan?“
Steffen runzelte die Stirn. „Ja, eigentlich Stefan, genauer Stefan Christian Friedrich Viktor. Man hat mir die Namen meiner Großeltern gegeben, und zwar alle.“ Er verzog das Gesicht. „Aber die meisten sagen Steffen zu mir. Warum?“
„Es geht um den Unfall vorgestern Abend vor Ihrem Haus.“ Korp sah auf. „Gute Arbeit, ihr Protokoll, Herr Kollege. Wir sind ebenfalls zu der Überzeugung gelangt, dass es kein Unfall mit Fahrerflucht war. Nun“, er beugte sich vor, „Sie wissen, dass der Mann jetzt ins künstliche Koma versetzte wurde?“
Steffen nickte.
„Er ist im Krankenhaus noch einmal kurz zu Bewusstsein gekommen. Und zufällig war eine Krankenschwester in diesem Moment im Raum, die ihre fünf Sinne beisammen hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass ihre Schicht gerade erst begonnen hatte und sie noch frisch und munter war. Oder dass sie gerne Krimis liest.“ Er lächelte kurz. „Jedenfalls, sie hörte, wie der Patient etwas zu sagen versuchte.“
Korp machte eine Kunstpause. „Und sie ist sicher, dass er Ihren Namen genannt hat. Stefan Velber.“
Korp lehnte sich zurück und beobachtete Steffen scharf.
„Was?“ Steffen starrte ihn ungläubig an. „Sie meinen, der Mann, der vorgestern Abend …?“
„Der Mann heißt ....“ – Korp nahm den Ordner wieder zur Hand und blätterte – ein völlig unnötiges Manöver. Steffen war überzeugt, dass Korp den Namen im Kopf hatte, war aber dankbar für die kurze Verschnaufpause, in der er versuchte, das Gedankenkarussell in seinem Kopf anzuhalten.
„Der Mann heißt Thomas Reismüller“, hörte er den Kollegen aus Frankfurt sagen. Korp blickte ihn direkt an. „Er ist Privatdetektiv in Frankfurt. Kennen Sie ihn?“
Steffen Velber schüttelte den Kopf. „Nie gehört.“
„Und sein Gesicht? Kam es Ihnen irgendwie bekannt vor?“
„Nein. Es hat geschüttet wie aus Kübeln, es war dunkel, ich stand unter Schock.“ Er sah auf Korps leicht erstauntes Gesicht und winkte ab. „Nein, nicht dass Sie meinen … ich denke, ich habe professionell genug reagiert. Aber auch Polizisten sind Menschen, oder? Ich meine, wie oft haben Sie denn schon zusehen müssen, wie vor Ihren Augen jemand überfahren wird?“ Er schüttelte wieder den Kopf. „Aber ich habe das Gesicht gut genug sehen können, dass ich ihn erkannt hätte, und bin sicher, dass ich es noch nie vorher gesehen habe.“
„Es hat Sie auch nicht vage an jemanden erinnert? Sie wissen schon, man hat manchmal etwas, das im Hinterkopf rumort …?“
„Nein, nichts. Tut mir leid.“
Korp nickte und schlug die Akte zu. „Mein Chef möchte trotzdem, dass Sie nach Frankfurt kommen und sich den Patienten ansehen.“
Steffen blickte überrascht auf. „Echt jetzt?“, entfuhr es ihm. Hatte er nicht gestern noch seinen Chef gebeten, in die Klinik fahren zu dürfen, um zu ermitteln – was ja nun nicht eigentlich sein Job war, wie Müller richtig festgestellt hatte. Dann fügte er hinzu: „Sie sollten vielleicht erst mit Herrn Müller reden, ob ...“
„Das wird Hauptkommissar Langer wahrscheinlich in diesem Moment tun.“ Korp stand auf. „Wenn es Ihnen passt, könnten Sie gleich mit mir in die Uniklinik kommen.“
„Ich nehme besser meinen eigenen Wagen“, meinte Steffen und stand ebenfalls auf. „Muss ja irgendwie wieder zurück.“
Eine halbe Stunde später passierten Johannes Korp und Steffen Velber, der ihm folgte, die Schranke zu den Kliniken der Goethe-Universität. Der Geheimrat höchstselbst zeigte ihnen den Weg, war er doch überall als stilisierte Strichzeichnung in Blau oder Schwarz gegenwärtig. Korp schlich mit gefühlten fünfzehn Stundenkilometern in die Ministadt hinein, die das Klinikum darstellte – ein Tempo, das weniger der Geschwindigkeitsbegrenzung geschuldet war als der Tatsache, dass er vergeblich nach einem Parkplatz Ausschau hielt. Schließlich setzte er frech das Blaulicht auf das Dach des Dienstwagens, das stumm vor sich hin rotierte, während er sich ins Halteverbot auf einen Bürgersteig klemmte. Steffen entschied sich sicherheitshalber für das Parkhaus gegenüber dem Hauptgebäude. Er war mit seinem Privatauto da.
Es dauerte weitere fünfzehn Minuten, bis sie auf der richtigen Station gelandet waren. Korp trat auf die Schwester am Empfang zu und erklärte ihr Anliegen, während er sich auswies.
„Sie wollen beide da rein?“, fragte sie, während der Blick von ihm zu Steffen und zurück ging. „Ich weiß nicht, ob … Wozu denn? Der Patient liegt jetzt im künstlichen Koma; er wird Ihnen keine Fragen beantworten können. Außerdem ist seine Frau gerade bei ihm.“
„Wir müssen nur einen kurzen Blick auf ihn werfen. Dr. Garcic weiß Bescheid.“
Sie nickte. „Also gut, Zimmer zehn, hinten rechts.“
Als sie den Gang hinunter liefen, sahen sie eine Frau Ende Dreißig aus Reismüllers Zimmer treten. Sie trug eng geschnittene Jeans, ein leichtes T-Shirt und weiße Sneakers; ihr kastanienbraunes Haar war sportlich kurz geschnitten.
Korp hielt sie auf. „Frau Reismüller?“
Sie blieb stehen. „Polizei?“ Ihr Blick ging von Korp zu Steffen in seiner Uniform hinüber.
Korp nickte und zückte erneut seinen Ausweis.
„Ja, ich bin Thomas’ Frau.“
„Ich würde Sie gerne sprechen, Frau Reismüller. Wenn Sie gleich noch ein paar Minuten Zeit hätten …? Es dauert nicht lange.“
Sie nickte wieder. „Ich warte unten. Da gibt es eine Cafeteria.“
Als Steffen hinter dem Frankfurter Kollegen das Krankenzimmer betrat, war seine erste Assoziation die an das Cockpit einer Raumstation in einem älteren Science-Fiction-Film. Monitore, Schläuche, Drähte, Roboterarme, Rechner; dazu ein ständiges leises Piepsen aus den Maschinen, das Blinken auf den Bildschirmen – etwas durch und durch Surreales lag über dem abgedunkelten Raum.
Steffen trat ans Bett und sah auf den Mann hinunter.
Jetzt, wo er ihn direkt vor sich sah, schien es ihm, als schaute er in ein bekanntes, ein geradezu vertrautes Gesicht, trotz der Schläuche und des Kopfverbands, die dieses Gesicht verunstalteten. Er schloss die Lider, und der Film vom vorvorigen Abend lief so lebhaft vor seinem geistigen Auge ab, dass er schauderte.
Nein, die Fantasie durfte ihm jetzt keinen Streich spielen! Er kannte diesen Mann nicht – er kannte ihn ganz bestimmt nicht. Das, was er glaubte wiedererkennen zu können, waren die Bilder eines Gesichts, die in seinem Gedächtnis eingebrannt waren, weil sich sein Unterbewusstsein damit beschäftigt hatte – eines Gesichts, das er aber tatsächlich vor jenem Dienstagabend noch nie gesehen hatte.
Er wandte sich ab. „Nein, ganz sicher. Ich kenne diesen Mann nicht, Herr Korp!“
Sie ist älter als Vierzig, schoss es Korp durch den Kopf, als er sich mit seinem Cappuccino zu Sandra Reismüller an den Tisch setzte. Nicht viel darüber, höchstens eins, zwei Jahre. Und auf jeden Fall sehr gut erhalten, trotz der Schatten unter den Augen, die von den letzten beiden schlaflosen Nächten erzählten.
Er konnte nicht anders. Jede Frau, die ihm begegnete, wurde einer kurzen, aber intensiven Musterung unterzogen. Nicht der Art von Musterung, die jedermann – und ein Polizist allemal – automatisch seinem Gegenüber angedeihen lässt, sondern einer Einschätzung des weiblichen Menschen – unter besonderer Berücksichtigung des Weiblichen. Den Vorwurf des Sexismus hätte er weit von sich gewiesen. Ging es ihm doch nicht um Bewertung, so hätte er beteuert – und hätte den Selbstbetrug nicht einmal bemerkt –, nicht um Beurteilung, sondern um die Einordnung seines Gegenübers in den Johannes-Korp-Gedankenkosmos. Und in diesem verortete er Sandra Reismüller jetzt unter attraktiv, intelligent, selbständig und gewohnt, die Dinge in die Hand zu nehmen – wahrscheinlich mittelständische Geschäftsfrau – mit Vorliebe für Dolce&Gabbana.
Und trotzdem wirkte sie seltsam schüchtern, fast gehemmt. Sie wich seinen Augen nicht aus, doch schien ihr Blick durch ihn durch zu gehen, in Fernen zu wandern, die nur in ihrem Kopf sichtbar wurden, und nur für sie.
„Schön, dass Sie noch ein paar Minuten Zeit gefunden haben.“
Eine dümmliche Eröffnung, schalt sich Korp. Ihr Mann liegt oben auf der Intensivstation im Koma – was soll die Frau schon machen? Zur Tagesordnung übergehen?
Als ob sie seine Gedanken gelesen hätte, antwortete sie: „Ich habe die Detektei für ein paar Tage zugemacht. Das schaffe ich jetzt nicht.“
„Sie arbeiten mit Ihrem Mann zusammen?“
Sie nickte. „Wir sind gleichberechtigte Partner.“
„Frau Reismüller, wir gehen bei dem Beruf Ihres Mannes zwangsläufig davon aus, dass der Anschlag auf ihn etwas mit einem seiner Aufträge zu tun hat.“
Sie zuckte zusammen; der Salzstreuer, mit dem sie gespielt hatte, fiel ihr aus der Hand. Ruckartig beugte sie sich vor, ihre Augen fixierten ihn scharf – der verschleierte Blick war verschwunden. Endlich schien sie ihn richtig wahrzunehmen.
„Sie meinen, es war gar kein Unfall?“ Ihre Stimme sprang eine Oktave höher.
Korp starrte sie an. Oh verdammt!, dachte er. Natürlich – sie konnte es ja noch gar nicht wissen. Mehr als die Nachricht vom Unfall hatten die Kollegen ihr nicht überbracht ...
Ein grober Schnitzer, ein unverzeihlicher Anfängerfehler.
„Verzeihen Sie.“ Er machte eine hilflose Geste. „Es tut mir Leid. Ja, alle Indizien sprechen leider dafür, dass der Fahrer des Wagens mit Vorsatz gehandelt und Ihren Mann mit Absicht angefahren hat. Um so wichtiger ist es, die Hintergründe für die Tat zu ermitteln.“ Er machte eine Pause. „Können Sie sich irgendeinen Grund dafür vorstellen?“
Sie ignorierte die Frage. „Und wie kommen Sie auf die Idee, dass es kein Unfall war?“ Noch immer hielten ihn die weit aufgerissenen Augen fest.
„Es gibt Zeugen.“
Sie nickte müde und sagte leise. „Wie oft habe ich gelacht, wenn Freunde uns um unser angeblich so aufregendes Leben beneideten ...“
Korps Handy ertönte. Er zog es aus der Jackentasche, schaute auf das Display und schloss kurz die Augen. Dann holte er tief Luft und nahm ab, hielt aber das Gerät zwanzig Zentimeter vom Ohr entfernt. Was nicht nur Frau Reismüller, sondern der halben Cafeteria die Möglichkeit gab, jedes Wort von Paul Langers Schimpftirade zu verstehen.
Schließlich brummte Korp ja, gleich und legte grußlos auf – und stellte sich schadenfroh vor, wie Langer in diesem Moment kurz vor dem Platzen stand.
Geschieht ihm Recht, verdammt.
„Mein Chef macht zur Zeit eine schwierige Phase durch“, meinte Korp in dem bemüht verständnisvollen Tonfall eines mit pubertierenden Kindern geschlagenen Vaters. Und schüttelte gleich darauf den Kopf. Völlig unprofessionell, mit Zeugen über den Vorgesetzten zu sprechen. Was war heute nur in ihn gefahren …
Nein, weiß Gott, er hatte schon geschicktere Befragungen durchgeführt. Die Frau machte ihn nervös, und er konnte noch nicht einmal sagen warum. Sie war nicht der Typ Frau, auf den er reagierte – nein, es war ganz sicher nicht ihr Sexappeal, das ihn irritierte –, doch etwas in ihrer Ausstrahlung verunsicherte ihn.
„Also, Frau Reismüller, was meinen Sie?“
„Würden Sie bitte Ihre Frage wiederholen?“
„Können Sie sich vorstellen, dass der Überfall etwas mit einem Ihrer Aufträge zu tun haben könnte?“
Sie nickte leicht und blickte ihn über ihre Kaffeetasse mit wachen Augen nachdenklich an. „Nun, Sie wissen, das wird jetzt nicht einfach für mich. Einerseits möchte ich natürlich alles tun, damit Sie den Schuldigen finden. Andererseits … ich kann nicht so ohne weiteres aus dem Nähkästchen plaudern. Der Mandantenschutz gilt auch für Privatdetektive, zumindest bei uns. Wenn wir es nicht ernst nähmen mit der Diskretion, könnten wir einpacken. Im Übrigen“, sie trank einen Schluck und stellte die Tasse ab. „Im Übrigen ist unser Geschäft, wie ich schon sagte, nicht so spektakulär, wie Sie es vielleicht aus dem Fernsehen kennen.“
„Unseres auch nicht immer.“
Sie lächelte zum ersten Mal und wurde gleich wieder ernst. „Ja, natürlich. – Nun, hauptsächlich arbeiten wir im Wirtschaftssektor – im weitesten Sinne. Das geht von der Überprüfung eines Außendienstmitarbeiters, der seine Provisionsabrechnung allzu kreativ erstellt, über Versicherungsbetrug bis hin zur Schuldnersuche. Das eigentliche Inkassogeschäft gehört aber nicht zu unseren Aufgaben.“
„Und wem ist Ihr Mann in letzter Zeit besonders auf die Füße getreten?“ Als sie schwieg, setzte er hinzu: „Hören Sie, Frau Reismüller, Sie betreiben die Detektei gemeinsam. Wenn der Anschlag berufliche Gründe hat, sind Sie vielleicht selber in Gefahr!“
Ihr entrückter Blick kehrte zurück. Diesmal schaute sie an ihm vorbei auf die Baguettes und Kuchenstücke in der Auslage der Cafeteria, ohne sie zu sehen. Schließlich meinte sie: „Wissen Sie was, ich werde mir die Fälle der letzten Zeit einmal ansehen und nach Anhaltspunkten durchgehen. Ich melde mich dann bei Ihnen. Vielleicht kann ich Ihnen ja die eine oder andere Information geben, die Ihnen weiterhilft, zunächst einmal ohne Namen zu nennen und ohne dass Sie gleich mit richterlichem Beschluss winken müssen.“
Er nickte. „Wir werden sehen. – An was arbeiten Sie denn gerade? Ganz allgemein, ohne Namen zu nennen?“
„Nun, ich habe ganz klassisch einen Ehemann beschattet, der seine Frau betrügt. – Wirklich erstaunlich, wie sehr Klischees unser Leben bestimmen“, setzte sie philosophisch hinzu.
„Nur so sind Klischees entstanden“, meinte er ebenso tiefsinnig.
Er erntete einen erstaunten Blick, dann fuhr sie fort: „Der Fall ist am Montag abgeschlossen worden. Aber nein, daran brauchen Sie nicht einmal zu denken. Der Mann war sicher nicht böse auf uns.“ Wieder lächelte sie. „Ich hatte fast das Gefühl, ihm einen Gefallen getan zu haben. Endlich jemand, der seiner Frau gesagt hat, was Sache ist. Er hatte jahrelang nicht den Mut dazu.“
Korp grinste und wurde gleich wieder ernst. „Und Ihr Mann?“
„Tja, sehen Sie, das ist schon ein bisschen merkwürdig.“ Sie schob die leere Kaffeetasse von sich. „Normalerweise wissen wir immer, an was der andere gerade arbeitet. Oft sind wir beide im gleichen Fall im Einsatz, nicht immer, je nach Bedarf. Aber immer reden wir über unsere Fälle miteinander, manchmal kommt im Gespräch eine zündende Idee – Sie wissen sicher, wie das ist. Doch dieses Mal … Ich weiß, dass Thomas an einem neuen Auftrag arbeitete, mehr aber auch nicht.“
„Er hat nicht mit Ihnen darüber gesprochen?“
Sie schüttelte den Kopf. „Und ehrlich gesagt, es hat mich ein bisschen geängstigt. Er hat so merkwürdig reagiert, als ich ihn fragte, hat sofort abgeblockt, wurde ärgerlich … Das ist so gar nicht seine Art.“
Korp war längst aus dem Mikrokosmos der Unikliniken in Richtung Polizeipräsidium verschwunden, und Steffen hatte seinen Wagen immer noch nicht aus dem Parkhaus geholt. Statt dessen saß er auf einer der Bänke in einer ruhigeren Ecke und hatte einen Kaffeebecher to go in der Hand – ausnahmsweise, sagte er sich, denn ein Beitrag zur gesunden Umwelt war das nicht.
Steffen Velber dachte nach.
Er dachte an den fremden Mann, der dort oben um sein Leben kämpfte und der Steffens Namen gekannt hatte. Der in der stürmischsten und regenreichsten Nacht des Jahres nichts Besseres zu tun hatte, als ihn zu besuchen. Denn davon war Steffen mittlerweile überzeugt: Dass dieser Privatdetektiv Thomas Reismüller ihn aufsuchen wollte – und jemand ihn erfolgreich daran gehindert hatte.
Reismüllers Wagen, ein dunkelblauer 5er BMW mit Frankfurter Kennzeichen war, so hatte Steffen von Korp erfahren, in einer der Nebenstraßen gefunden worden. Thomas Reismüller hätte ohne Problem vor oder in unmittelbarer Nähe von Steffens Haus parken können – man war schließlich nicht in Frankfurt. Doch offensichtlich wollte der Detektiv genau das eben nicht, sondern war stattdessen lieber durch das Gewitter und den wasserfallartigen Regen gelaufen …
Und in sein Verderben.
Steffen zermarterte sich das Hirn. Wann hatte er jemals mit einem Privatdetektiv zu tun gehabt? Beruflich? Nein, nie. Privat? Ganz sicher nicht.
Oder?
Der Kaffeebecher stoppte auf halber Höhe zu seinem Mund.
Katja?
Katja!?
Hatte Katja ihn etwa beobachten lassen? Gescheiterte Ehe, Privatdetektiv, Beschattung …
Lückenlose Assoziation.
Die Idee war so abenteuerlich, dass Steffens Kaffeebecher noch sekundenlang in der Luft schwebte, bevor er ihn wieder an den Mund führte und seinen Verstand einschaltete.
Blödsinn. Wozu um alles in der Welt hätte sie so etwas tun sollen?
Es wäre zudem äußerst unprofessionell von diesem Reismüller gewesen, die Klientin abends zu besuchen, wenn das Objekt der Observation aller Wahrscheinlichkeit im Haus anwesend war. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, Kontakt aufzunehmen. Und besseres Wetter.
Außerdem hatte Reismüller seinen und nicht Katjas Namen genannt.
Trotzdem – er würde mit ihr reden müssen. Er würde ohnehin mit ihr reden müssen. Vielleicht schafften sie es ja diesmal, wie vernünftige Menschen miteinander umzugehen. Katja war intelligent genug, um zu dem gleichen Schluss gekommen zu sein wie er. Und wie Großmutter: Dass sie eben nicht zusammenpassten und halbwegs zivilisiert die ganze Angelegenheit – ihre Ehe – hinter sich bringen mussten.
Großmutter.
Auch das eine merkwürdige Geschichte.
Sie schläft eine Nacht (oder waren es zwei? Er würde sie noch einmal befragen müssen und diesmal nicht klein beigeben!) in einem anderen Bett – und prompt stirbt die Frau, die mit Stephanie Velber Bett und Wohnung getauscht hatte. An Herzversagen, wie Dr. Reinig auf den Totenschein geschrieben hatte.
Stirbt man nicht immer irgendwie deshalb, weil das Herz versagt? War Dr. Reinig bei einer zweiundachtzigjährigen Patientin etwa zu voreilig gewesen? War wirklich alles in Ordnung mit dem Tod von Charlotte Hagen – soweit man die Abgeklärtheit besaß, den Tod an sich „in Ordnung“ zu finden?
Man hätte einem Arzt in einem Altersheim – ja, doch, das war es und nichts anderes! – keinen großen Vorwurf machen können. Totenscheine waren Routine für ihn …
Steffen schüttelte ärgerlich den Kopf. Spekulationen! Er stand abrupt auf und warf den leeren Kaffeebecher in den Abfallkorb neben der Bank.
Doch er hatte das Gefühl, auf etwas Entscheidendes gestoßen zu sein.
Erst als die Schranke, die das Klinikum absperrte, sich hinter ihm wieder geschlossen hatte und er an der Ampel zum Mainufer auf Grün wartete, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen:
Stephanie Velber.
Hatte er nicht heute Vormittag noch zu Korp gesagt, dass er seine Vornamen nach den Großeltern erhalten hätte? Stefan Christian Friedrich Viktor Velber. Christiane hatte die Mutter seiner Mutter geheißen, Viktor und Friedrich seine Großväter.
Und den Namen Stefan hatte er von seiner Großmutter Stephanie Velber bekommen …
Was also, wenn Thomas Reismüller, kurz bevor er das Bewusstsein verloren hatte, nicht Stefan, sondern Stephanie Velber geflüstert hätte? Ein Hörfehler, völlig verständlich in dieser Situation.
Auch das reine Spekulation. Wäre da nicht die obskure Geschichte mit dem Zimmertausch und dem Tod von Frau Hagen gewesen ...
Steffen hatte das Gefühl, etwas mehr auf seine Oma aufpassen zu müssen.
Kriminalhauptkommissar Paul Langer war unübersehbar schlecht gelaunt, und das schon seit Tagen. Nicht, dass er im Normalzustand vor Lebensfreude gesprüht hätte. Nur ganz wenige Kollegen im Frankfurter Polizeipräsidium kannten ihn gut genug, um zu wissen, dass seine ansonsten ohnehin eher grimmige Art keine Bösartigkeit war, sondern mehr gedankenloser Umgang mit seinen Mitmenschen. Was die Zusammenarbeit trotzdem nicht einfacher machte.
Und obschon man deshalb gewillt war, bei ihm Abstriche zu machen, war in den letzten Tagen die Grenze des Zumutbaren in bedenkliche Nähe gerückt.
Einen normalen Umgangston mit seinen Mitarbeitern schien er nicht mehr zu kennen, grundlegende Aspekte zwischenmenschlicher Höflichkeit erwarteten sie vergebens. Jede Lappalie ließ ihn aus der Haut fahren. Jedes Missgeschick, namentlich ein eigenes – wie das Fallenlassen eines vollen Filters mit altem Kaffeesatz aus seiner steinzeitlichen Maschine –, hatte minutenlanges, gotteslästerliches Fluchen zur Folge. Besonders Jens Schmidtbauer, der Junior der Truppe, hatte unter ihm zu leiden. Langer raunzte seine Anweisungen in einem Befehlston ins Nebenzimmer, von dem auch ein altgedienter Unteroffizier noch etwas hätte lernen können.
Korp hatte seinen Chef einige Male böse ins Telefon zischen hören und ganz richtig vermutet, dass die Misere häuslichen Ursprungs war.
Noch einen Tag, nahm er sich vor, als er jetzt dem gemeinsamen Büro zustrebte. Noch einen Tag sehe ich mir das an, und dann ist Schluss. Dann werde ich mit ihm reden. Er seufzte. Doch, ganz bestimmt. Chef hin oder her …