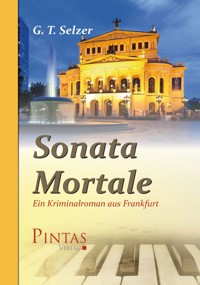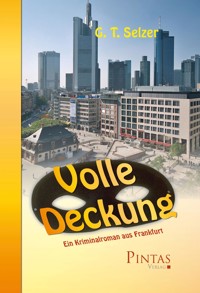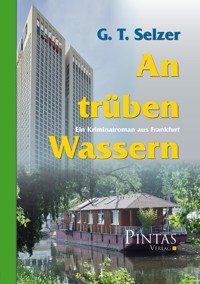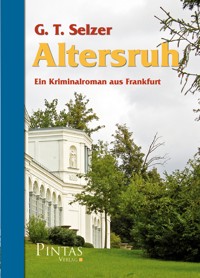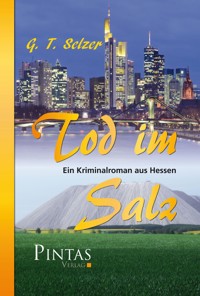
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pintas-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwischen Mainmetropole und dörflicher Idylle Der Erfolgsautor Boris Kemper steht im Mittelpunkt dieses neuen Falls mit den Kommissaren Langer und Korp von der Frankfurter Mordkommission. Kemper muss einem alten Freund helfen, mit der Vergangenheit abzuschließen und den Tod eines geliebten Menschen aufzuklären. Doch dann holt ihn seine eigene Vergangenheit ein. Und die ist in eigenartiger Weise mit der Geschichte von Hauptkommissar Paul Langer verknüpft, der feststellen muss, dass auch in hessischen Dörfern die Welt nicht immer in Ordnung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Personen
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Die Reihe mit Langer & Korp
Impressum
G. T. Selzer
Tod im Salz
Ein Kriminalroman aus Hessen
ISBN 978-3-945343-25-8
ISBN der Printausgabe 978-3-945343-17-3 © 2016 by PINTAS-VERLAG, Frankfurt am Main
2. Auflage 2019 www.pintas-verlag.de
Bildnachweis siehe Impressum
Personen
Frankfurt
Richard Immelshausen, Kriminalschriftsteller (Pseudonym: Boris Kemper)
Dr. Friedrich Mommsen, Lektor im Ruhestand
Andreas Liebig, Autohausbesitzer
Hella Liebig seine Frau, Tochter von Friedrich Mommsen
Bad Hersfeld
Isabella Neumann, Tochter von Richard Immelshausen, Lehrerin
Tobias Neumann, ihr Mann, Anwalt
Heubach/Osthessen: die alte Clique
Jürgen Meister, Finanzbeamter
Susanne Meister, seine Frau
Heiner Hellermann, Landwirt
Roswitha Müller/Steve Miller, Ehepaar, zu Gast aus Montana/USA
Peter und Lisa Schrader, Ehepaar aus Rotenburg
Marga Krantzfeld, Single, reich geschieden
Felix und Wolfgang Schulze, Brüder
Polizei Frankfurt
Paul Langer, Kriminalhauptkommissar
Johannes Korp, Kriminaloberkommissar
Jens Schmidtbauer, Kriminalobermeister
Dr. Jürgen Eilers, Rechtsmediziner
Cem Özil, Chef der Spurensicherung
Polizei Fulda
Ludwig Hanisch, Kriminalhauptkommissar
Kapitel I
1
„Paul!!“
Ein schriller Schrei gellte durch die geöffneten Seitenfenster des VW Passat in den strahlenden Apriltag hinaus und durchbrach das monotone Dröhnen des nachmittäglichen Verkehrs auf der A5.
Die Augen weit aufgerissen und starr vor Schreck, klammerte sich Gerda Langer mit der rechten Hand an den Griff der Beifahrertür und stützte die linke an der schwarzen Verkleidung des Armaturenbrettes ab.
„Hast du den denn nicht gesehen!?“
Paul Langer trat hektisch auf die Bremse; der Passat schlingerte gefährlich zwischen der rechten und mittleren Spur; dann hatte Langer ihn wieder unter Kontrolle und fuhr geradeaus.
„Der blöde Sack! Kann sich doch nicht einfach so vor mich setzen und ...“
Aufgebracht schlug er mit der rechten Faust aufs Lenkrad, worauf der Wagen einen weiteren Schlenker machte.
„Fahr sofort rechts ran!“
„... und ohne jeden Grund ...“
„Fahr sofort rechts ran!“
„... und noch mit überhöhter Geschwindigkeit ...“
„Sofort!“
„Aber Gerda, der hat … Hast du die Nummer aufgeschrieben? Dem werden wir ...“
„So - fort!!“
„Nun schrei doch nicht so! Dieser Depp da hat mich geschnitten ...“
„Paul“, Gerdas Stimme war auf einmal leise, fast freundlich, „wenn du nicht auf der Stelle rechts ran fährst, aussteigst und mich fahren lässt“, sie holte tief Luft, „dann kannst du dir unseren Urlaub in die dir noch verbleibenden Haare schmieren!“
Kriminalhauptkommissar Paul Langer warf einen irritierten Seitenblick auf seine Frau. Mehr als alles andere war es ihre ungewohnte Wortwahl, die ihn – eher verblüfft als verärgert – den Wagen langsam auf dem Standstreifen auslaufen ließ. Er stieg wortlos aus und ging um das Auto herum, stieg ebenso wortlos auf der Beifahrerseite wieder ein und schnallte sich an.
Gerda setzte sich ans Steuer.
Schweigend fuhren sie Richtung Norden.
„Er hat mich geschnitten“, wiederholte Paul Langer nach einigen Kilometern zaghaft.
„Hat er nicht.“ Gerda sah kurz in den Außenspiegel, blinkte, warf einen Blick über die Schulter und setzte auf die linke Spur.
„Er kam von rechts und hat noch nicht einmal den Blinker gesetzt.“
„Doch, er hat.“
„Er wollte mich rechts überholen.“
„Wollte er nicht.“
Langer brummte. „Wir sind noch nicht einmal an Friedberg vorbei und haben noch hundertfünfzig Kilometer vor uns; was soll das denn für ein Urlaub werden, wenn er schon so anfängt.“
„Ein sehr schöner, wenn du mich fahren lässt.“
Wieder wanderte Langers Blick zu seiner Angetrauten hinüber, die entspannt hinter dem Steuer saß und mit der lässigen Selbstverständlichkeit einer routinierten Autofahrerin abbremste, Gas gab, schaltete, überholte. Er würde das nie so hinbekommen, nicht in diesem Leben und nicht im nächsten. Zugegeben hätte er das nie, obschon es für sein gesamtes berufliches und privates Umfeld ein offenes Geheimnis war.
Eine gute Stunde später rollte der Wagen auf den weiträumigen Parkplatz eines riesigen Hotelkomplexes, der den Kamm eines bewaldeten Berges beherrschte. Prospekt und Website hatten die Aussicht, die Unterkunft, den Wellnessbereich und die Verpflegung gepriesen und zumindest im ersten Punkt nicht übertrieben.
Langer stieg aus, streckte sich ausgiebig und trat näher an den Rand des Parkplatzes, wo der Hang fast senkrecht in die Tiefe fiel und zwischen den Bäumen die Sicht auf die Serpentinen freigab, die Gerda in den letzten Minuten dank der Pferdestärken unter der Motorhaube zügig erklommen hatte.
Er atmete tief ein. „Gerda, guck mal, ist das nicht herrlich hier! Diese Luft! Diese Landschaft!“ Er drehte sich zu ihr um. „Lass doch die Tasche jetzt! Komm her und sieh dir das an!“
Gerda lächelte und trat zu ihrem Mann. Der zeigte stolz in die Gegend, als hätte er sie eben aus dem Ärmel geschüttelt. Wälder, Wiesen und Felder und wieder Wälder, wohin das Auge sah – man war in Waldhessen –, durchbrochen von kleineren und mittelgroßen Ansiedlungen. Unter ihnen wand sich die Fulda als schmales silbernes Band durch eine langsam aus dem Winterschlaf erwachende Landschaft. Noch sehr zögerlich überzog das Grün die Wälder; unten im Tal war es von dicken, bauschigen Ballen durchsetzt – Obst- und Laubbäume, die in weißer und rosa Blüte standen.
„Bei uns ist die Natur schon viel weiter, da sind die Blüten fast überall schon abgefallen. Was die paar Kilometer doch ausmachen“, wunderte sich Gerda.
Langer hatte den Kopf schweifen lassen und sinnend nach unten geschaut. „Da vorne liegt Rotenburg, weiter hinten kannst du Bebra sehen. Und dort ...“, er drehte sich nach links, „dort muss ungefähr Heubach liegen.“
„Ach ja, Heubach. Da bleiben wir aber nicht lange, oder?“
„Na ja, ich will es schon mal wieder sehen.“ Er sah noch einen Augenblick in die Ferne, dann schüttelte er den Kopf und ging auf das Hotel zu.
„Lass uns reingehen und uns die gute Stube mal ansehen.“
Gerda Langer war geschlagen mit einem verhassten Vornamen, den sie hauptsächlich ihrer Mutter zu verdanken hatte, und einem Ehemann, der trotz ihrer ständigen Bemühungen – oder vielleicht auch gerade deshalb – zu den unordentlichsten Menschen gehörte, die sie jemals kennengelernt hatte.
Gegen ihren Namen konnte sie nichts unternehmen, hatten ihre Eltern sie doch noch nicht einmal mit einem zweiten Taufnamen ausgestattet.
Was ihren Mann betraf, so focht sie seit nunmehr fast dreißig Jahren einen schier aussichtslosen Kampf. Um ihres eigenen guten Rufes willen war sie ständig auf der Hut; sie sortierte rechtzeitig die Jacketts für die Reinigung aus, damit er nicht – ohne jede Absicht, aber mit untrüglicher Sicherheit – gerade jenes aus dem Schrank fischte, das die Reste der mittäglichen Tomatensoße zierte; überredete ihn zum nächsten Friseurtermin; befreite seine Aktentasche von faulendem Obst der Vorwoche.
Zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, pflegten die Langers Urlaub zu machen. Um die Anzahl und das Ausmaß der Ehestreitigkeiten auf einem vertretbaren Maß zu halten, hatte man sich schon vor einiger Zeit darauf geeinigt, dass die Wahl des Herbsturlaubs Gerda überlassen blieb – meist ging es dann nach Frankreich oder Italien –, während über die Tage im Frühling Paul bestimmen durfte, der sich immer für einen möglichst nahe gelegenen deutschen Landstrich entschied. Dieses Mal also war man im Osthessischen Bergland gelandet, keine zweihundert Kilometer von Frankfurt entfernt, in unmittelbarer Nähe der thüringischen Grenze.
Der Hotelprospekt hatte auch in den anderen Punkten seine Versprechen gehalten. Gerda brauchte auf keine Bequemlichkeit zu verzichten, Paul genoss lautstark die Landschaft und schweigend das abendliche Menü.
Bereits am ersten Abend war Langer ein Paar am Nebentisch aufgefallen, das aus dem Rahmen der restlichen Gäste – Rentner und Familien mit Kindern – herausfiel; letztere hatte man vorsorglich in den Apartments und Familienzimmern in einem etwas abgelegenen Trakt untergebracht. Die beiden jedoch waren weder das eine noch das andere.
Die Frau mochte Anfang oder Mitte Fünfzig sein, er vielleicht ein paar Jahre älter, beide wirkten sportlich und trotz der frühen Jahreszeit auf natürliche Weise sonnengebräunt – eine Bräune, wie kein Sonnenstudio sie hätte hervorzaubern können. Man hätte sie sich besser in Cannes oder in einem Skihotel in Davos vorstellen können; diesem ruhigen Landhotel im letzten Zipfel Hessens gaben sie etwas fast Mondänes.
Auch Gerda hatte schon zwei oder drei Mal einen Blick auf den Mann nebenan riskiert, war er doch in jeder Beziehung genau das Gegenteil von dem, was ihr Göttergatte repräsentierte: schlank, beste Umgangsformen, die Kleidung von legerer Eleganz – unvorstellbar, dass die schicke Frau, die neben ihm saß, ein Auge darauf haben musste, dass er morgens mit sauberem Jackett aus dem Haus ging.
Am zweiten Tag liefen sich die beiden Paare in der Fußgängerzone der historischen Altstadt von Rotenburg über den Weg, wo Gerda den Startpunkt ihrer Sightseeingtour durch die Region angesetzt hatte.
„Ach, hallo“, der Fremde kam freundlich lächelnd näher, „Sie wohnen doch auch bei uns im Hotel, nicht wahr?“
Langer brummte still etwas in sich hinein und spürte gleichzeitig einen sanften Rippenstoß von Gerdas Seite; ganz im Gegensatz zu ihrem Mann lernte sie gerne neue Leute kennen. Ein Ausweichen war ohnehin unmöglich.
„Guten Tag“, sagte Gerda.
„Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Andreas Liebig, meine Frau Hella.“
Langer musste wohl oder übel in Aktion treten. „Angenehm. Paul Langer, meine Frau Gerda“, echote er im gleichen Tonfall.
Es entstand eine kleine Verlegenheitspause, bevor Liebig sagte: „Wirklich schön hier, oder? Wir haben mal gedacht, wir bleiben im Lande und machen einen völlig ruhigen Urlaub. Nur erholen, entspannen, Natur, keine Hektik und keine Pläne. Leben von einem Tag auf den anderen sozusagen.“ Sein Lachen war ansteckend.
Ein paar Minuten später fand man sich zu viert in einem Café nahe der Fulda wieder. Das schnell lebhaft werdende Gespräch, in dem zunächst einmal festgestellt wurde, dass alle – welch unfassbarer Zufall! – aus Frankfurt kamen, wurde hauptsächlich von den Liebigs und Gerda bestritten. Langer, der im entscheidenden Moment den Absprung verpasst hatte, saß meist still in seiner Ecke.
„... ein Autohaus, ziemlich groß sogar. Wir machen das zusammen. Ohne meine Frau geht gar nichts“, hörte er Liebig gerade sagen. „Vielleicht kennen Sie es, draußen in der Hanauer ...“
Der Mann war ihm nicht unsympathisch, er hatte eine Art, sogar solche Sachen zu sagen, ohne dass es nach Angeberei geklungen hätte; die Frau, Hella, hatte einen natürlichen Charme, dem man sich nur schwer entziehen konnte. Trotzdem wäre Langer jetzt gerne alleine an der Fulda entlang gegangen, vielleicht Schwäne gefüttert – gab es da überhaupt Schwäne? – und …
„Beamter“, kam es in diesem Moment von Gerdas Seite.
Langer setzte sich ruckartig auf. Gerda hatte strikte Anweisung, bei solchen Gelegenheiten dies und nicht mehr über seinen Beruf verlauten zu lassen. Sie hielt sich – wie immer – daran und fuhr geschickt fort, bevor noch weitere Fragen gestellt werden konnten: „Und ich arbeite nebenberuflich in einer Boutique. Man kann ja nicht immer nur Haushalt und Garten ...“
„Ach, Sie haben einen Garten! Wie schön! Mein Traum!“ warf Hella Liebig ein, während sie ihren Mann mit einem ungnädigen Blick streifte. „Aber er hier“, sie knuffte ihn in die Seite, „ist so ein schrecklich urbaner Typ! Auf unserer Terrasse kann ich gerade mal eine paar Töpfe aufstellen.“
„Dabei hat er doch gerade noch von der Natur hier und der Ruhe geschwärmt“, wunderte sich Gerda.
Anerkennend lächelte Langer in sich hinein. Schlaues Mädchen, hättest zur Kripo gehen können. Widersprüche in der Aussage aufspüren und den Finger drauf legen.
„Ja eben!“ konterte Andreas Liebig lachend. „Manchmal braucht man das ja. Aber jeden Samstag Rasen mähen, das wäre nichts für mich.“
„Hättest ja nicht gleich mit ins Café gehen müssen!“, murrte Langer, als sie sich verabschiedet hatten und ihren Weg fortsetzten. „Wir sehen die doch sowieso jeden Tag im Hotel.“
„Wieso denn nicht? Die sind doch nett, oder?“
„Mag sein. Aber jetzt haben wir sie für den Rest des Urlaubs am Bein. Die hängen an uns wie Kletten, wirst an mich denken.“
„Du bist und bleibst ein alter Brummbär“, erwiderte Gerda gutgelaunt und hakte sich bei Paul ein. „Außerdem wollen wir morgen erst mal in dieses Heubach, da hast du schon mal vor ihnen Ruhe.“
2
Hans Schmitt, Ende Vierzig, schütteres Haar, große, unvorteilhafte Brille, war unscheinbar und unauffällig wie sein Name. Beides, Name und Erscheinung, bildete sein größtes Betriebskapital. Denn keiner würde in ihm einen der erfolgreichsten Privatdetektive Osthessens vermuten.
Jetzt stand er in der Altstadt von Rotenburg, zog sein Handy aus der Tasche und wählte die ihm inzwischen bekannte Nummer.
„Zunächst mal ein kurzer Zwischenbericht, weil Sie doch schon wieder so ungeduldig auf der Mailbox klangen, und dann …“ Er holte Luft, kam aber nicht weit. „Wie?“
Die Person am anderen Ende der Leitung schien ärgerlich zu sein, doch Hans Schmitt hatte ein dickes Fell. Auch das gehörte zu seinem Beruf. Er hörte geduldig zu.
„Immer langsam, Chef, nur die Ruhe! – Ja, ich weiß, es ist Ihr Geld. Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden! Ich denke, ich habe heute was für Sie.“
Er schüttelte den Kopf. Wollen was wissen von einem, die Leute, und lassen einen nicht reden.
„Also. Ich hatte sie gestern den ganzen Tag auf dem Schirm. Sie waren in Fulda. Dom, Schloss, Schlossgarten, das ganze Programm, haben sogar das Polizeipräsidium nicht ausgelassen. Danach essen. Shoppen. Himmel, was die Frau so alles zusammenkauft! Die Einzelheiten bekommen Sie schriftlich, bis hin zum letzten T-Shirt, wenn Sie wollen. Dann saßen sie im Eiscafé, da war ich ganz nah dran.“ Er machte eine Kunstpause. – „Wie? – Ja, ich sagte doch, ich war nah dran. Es gab aber nichts, was irgendwie wichtig sein könnte – wie gesagt, Sie können sich ja selbst ein Bild machen, wenn Sie‘s schriftlich haben – außer …“ – Wieder eine kleine Pause. „Warten Sie, ich habe es mir aufgeschrieben.“
Schmitt wühlte in der Tasche seines leicht schmuddeligen Jacketts, „Hören Sie zu, Chef! Er fragt: ‚Hast du eigentlich den grünen Karton endlich entsorgt?‘ – Darauf sie: ‚Ich habe ihn Vater gegeben.‘ – Er: ‚Warum das denn, um Himmels Willen?‘ – Und sie: ‚Er wollte eben die Sachen von dem Jungen haben, warum denn nicht?‘ – Können Sie was damit anfangen, Chef?“
Hans Schmitt erfuhr nicht, ob der ‚Chef‘ damit etwas anfangen konnte oder nicht. Denn am anderen Ende der Leitung wurde wortlos aufgelegt. Er sah noch einmal kurz zum Café hinüber, wo die Ehepaare Langer und Liebig zusammen saßen und sich angeregt unterhielten, und beschloss, für heute genug getan zu haben.
3
Die unbelebte Landstraße zog sich durch Wälder und Wiesen, Langer saß am Steuer, Gerda einigermaßen entspannt daneben, das Radio dudelte leise.
„Was ist denn das?“ Gerda zeigte nach vorne auf einen schneeweißen, etwa zweihundert Meter hohen Tafelberg, dessen gesamte Höhe ein riesiges Plateau, etliche hundert Meter lang, bildete.
„Ein Salzberg. Eine Abraumhalde aus der Kalisalzproduktion. Die Leute sagen ‚Monte Kali‘ dazu.“ Er warf einen schnellen Blick zur Seite. „Himmel, ist der groß geworden!“
„Schön ist anders“, murmelte Gerda in sich hinein. „Aber immerhin wohl so was wie eine Attraktion für die Gegend hier, oder?“
Langer antwortete nicht, sondern konzentrierte sich auf die Straße.
Endlich passierten sie das Ortsschild Heubach und Langer sah sich aufmerksam um, was seiner Fahrsicherheit nicht eben zugute kam. Schließlich fuhr er auf der Hauptstraße in der Nähe einer kleinen Kirche an den Rand. Die Straße lag still und leer im nachmittäglichen Sonnenlicht. Über ihnen im Haus, vor dem sie parkten, wurde, von ihnen unbemerkt, eine Gardine zurückgezogen.
„Das ist es. Das Haus meiner Großeltern.“
Er zeigte auf ein vorbildlich restauriertes Fachwerkhaus auf der anderen Straßenseite. Rechts davon fiel der Blick durch ein offenes Tor auf einen großen, gepflegten Hof mit Pflastersteinen. Große Terracottatöpfe mit Oleander waren bereits aus dem Winterquartier gebracht worden und bildeten grüne Inseln; ein großes Scheunentor im Hintergrund war zugleich Abschluss und Beginn für etwas Neues.
„Oder besser, war es“, meinte er sinnend.
Gerda sah sich um. „Schön. Und jetzt? Willst du noch ein bisschen durchs Dorf fahren?“
Langer reagierte nicht. „Es hat sich viel verändert.“
„Wie lange warst du nicht mehr hier? Fast vierzig Jahre? Was erwartest du?“
„Ja, aber ich kannte hier alles wie meine Westentasche. In jeden Oster- und Sommerferien war ich hier, sogar noch in den ersten Semestern der Polizeihochschule ab und zu.“ Er brach ab und blickte weiter über die Straße hinüber in den Hof. „Wer da wohl jetzt wohnt?“
„Du wirst die Leute ohnehin nicht kennen.“ Eine leichte Ungeduld schwang in Gerdas Stimme mit. „Du hast es jetzt gesehen, was machen wir jetzt?“
Plötzlich kam eine Katze aus der Haustür in den Hof hinausgeschossen, fast gleichzeitig fegte eine Frau über die beiden Stufen, setzte der Katze nach und schimpfte lachend: „Jetzt isser schon wieder entwischt!“
Die Katze war auf einen riesigen Hibiskusbusch geflüchtet, dessen Zweige, säuberlich gestutzt, noch auf das erste Grün warteten. Dort blieb sie sitzen und sah gelassen auf ihr Frauchen herab.
„Du dummer Peter“, lockte die Frau, „nun komm schon runter!“
Sie streckte sich und holte den Kater vorsichtig aus den Ästen. Er schien nichts dagegen zu haben.
„Nun mach schon,“ sagte Gerda, „Lass uns fahren.“
Langer reagierte nicht, sondern starrte geistesabwesend auf die Szene im Hof.
„Du kannst nicht so lange hier stehen bleiben, wie sieht das denn aus! In so einem Dorf fällt man doch sofort auf!“
Die Frau war tatsächlich stehen geblieben und sah nun, den Kater auf dem Arm, über die Straße auf den parkenden Pkw. Langsam überquerte sie den Hof und trat auf die Straße hinaus. Es war eine attraktive Mittfünfzigerin mit ungebändigten, schwarzen Locken – bereits mit etlichen grauen Strähnen durchzogen, doch noch so dick, dass sie nur mühsam durch das Haargummi im Nacken gehalten wurden. Eine Strähne fiel ihr ins Gesicht.
„Jetzt hast du‘s. Sie hat uns entdeckt – was soll die Frau nur von uns denken?“ Gerda wurde zunehmend unruhig. „Nun fahr schon los.“
„Die schwarze Susanne!“, flüsterte Langer und sah gebannt auf die Frau, die nun langsam die Straße überquerte. Ohne auf den verständnislosen Blick Gerdas zu achten, öffnete er die Fahrertür und stieg aus.
Die Frau starrte ihn an.
„Paul?“, fragte sie leise, dann lauter. „Paul? Mein Gott, das gibt’s doch nicht! Paul Langer!“
Den Kater mit der Linken mühsam an sich klammernd, hielt sie ihm die rechte Hand hin und lachte. „Ich fass‘ es nicht. Der Paul Langer is mal wieder in Heubach!“
Sie sprach den leichten Singsang des Osthessischen, der schon an Thüringen erinnerte und mit der Frankfurter Diktion nichts mehr gemein hatte.
Langer war hochrot im Gesicht geworden, ergriff die Hand der Frau und stammelte hilflos: „Hallo Susanne.“ Er wies auf Gerda, die inzwischen ebenfalls ausgestiegen war. „Äh … das ist meine Frau Gerda. Susanne Dengelmann, eine alte Freundin aus Heubach.“
„Nee, nicht mehr Dengelmann, ich hab‘ doch den Jürgen geheirat‘.“ Sie drehte sich zu Gerda um. „Susanne Meister.“
Diese nahm die dargebotene Hand und betrachtete die Frau neugierig. Ein paar Sekunden stand die kleine Gruppe nebst Kater beieinander und versuchte, mit der unerwarteten Situation fertig zu werden. Zwei Krähen schossen durch die Luft und ließen sich krächzend auf der Kastanie neben der Kirche nieder. Ein lang gezogenes Quietschen zeigte das Bremsen eines Zuges ganz in der Nähe an.
Plötzlich bog ein Motorrad um die Kurve, preschte die Hauptstraße hinab und machte ihnen lautstark ihre ungünstige Position nahezu mitten auf dem Asphalt bewusst. Der Kater, zu Tode erschrocken von dem Höllenlärm der rasenden Suzuki, riss sich aus Frauchens Arm los, rannte über die Straße in den Hof und war mit einem Satz wieder auf dem Hibiskus.
Susanne schüttelte lachend den Kopf und strich sich eine widerspenstige Locke aus der Stirn. „Der wird es einfach nicht müd´, das Spielchen. Und immer wieder auf den selben Busch.“
Sie sah Langer an. „Kommt doch rein, ich mach‘ uns einen schönen Kaffee, dann können wir ein bisschen von alten Zeiten reden!“
Bevor noch Gerda entsetzt abwehren konnte, hatte Paul Langer, der die ganze Zeit seinen Blick nicht von Susanne gelöst hatte, genickt.
„Eine prima Idee. Wir stören doch hoffentlich nicht?“
Dass seine Frage rein rhetorisch gemeint war, bewies die Tatsache, dass er bereits an der Fernbedienung des Autoschlüssels herumfingerte und kurz darauf ein leises Plopp ertönte, das die Wagentüren schloss.
Einigermaßen fassungslos beobachtete Gerda ihren Mann, der schon Anstalten machte, die Straße zu überqueren. Notgedrungen folgte sie den beiden. Der Kater ließ sich ebenso widerstandslos vom Hibiskus pflücken wie beim ersten Mal.
Sie betraten einen niedrigen Flur und kamen in eine große, gemütliche Wohnküche. Im Vorbeigehen drückte die Hausfrau auf den Knopf eines Kaffeeautomaten und holte drei Becher.
„Hab‘ sogar noch ein bisschen Kuchen von gestern“, meinte sie, während die Kaffeemaschine lautstark ihre Arbeit aufnahm. „Bin gleich wieder da.“
„Machen Sie sich doch keine Umstände!“, rief Gerda ihr nach und drehte sich, kaum war Susanne aus dem Zimmer, fauchend zu ihrem Mann um: „Was um alles in der Welt soll das denn jetzt?“
Langer schien endlich aus seinem tranceähnlichen Zustand zu erwachen und lächelte seine Frau glücklich an.
„Da staunst du, was? Jetzt sitzen wir hier doch tatsächlich in der alten Küche von Opa zusammen!“
Gerda starrte zurück. „Und wer ist – sie?“ Sie deutete auf die Tür, durch die Susanne Meister verschwunden war.
„Ach, Susanne“, Langer seufzte. „Susanne wohnte damals mit ihren Eltern ein paar Häuser weiter und wir – na ja ...“
Wieder wurde er rot wie ein Siebtklässler vor dem ersten Date. Seine Frau beobachtete ihn zunehmend beunruhigt. Das war nicht ihr Paul, den sie seit mehr als dreißig Jahren bemutterte.
„Also, ihr hattet mal was miteinander?“
Langer zuckte hilflos die Schultern, nickte, wiegte den Kopf, hob unschlüssig die Hände.
„Ja, was denn nun?“
„Na ja. Nein. Ja. Fast ...“ Ein tiefer Seufzer.
Plötzlich grinste Gerda ins sich hinein und stieß Paul mit dem Ellbogen sanft in die Rippen. „Du musst dich nicht aufführen wie ein Klosterschüler; das ist doch ewig her.“
Kleine Pause. Scharfer Blick.
„Ist es doch, oder?“
„Was? Ja, natürlich!“ Paul wandte ihr endlich den Kopf zu und sah sie entgeistert an. „Was dachtest du denn?“
„Na ja, du stellst dich an ...“
Sie brach ab, als Susanne mit einem großen Kuchenteller an der Tür erschien. Langer sprang auf und nahm ihn ihr ab, was Gerdas Augenbrauen in die Höhe schießen ließ. Sie selbst erhob sich ebenfalls und nahm drei Teller aus dem Gestell neben der Spüle.
„Dass Sie sich so viel Arbeit mit uns machen! Sie haben doch sicher zu tun – ich meine, der Hof und so.“
Susanne füllte die Tassen und setzte sich. „Hof? Ach so, nein, wir haben keine Landwirtschaft. Mein Mann – Jürgen Meister, du erinnerst dich doch, Paul, oder?“ Langer nickte dumpf. „Also Jürgen arbeitet in Bad Hersfeld auf dem Finanzamt, ich arbeite zwanzig Stunden die Woche in einem Steuerbüro und helfe drüben auf dem Reiterhof aus, vielleicht seid ihr daran vorbeigekommen. Und dann habe ich halt meinen Garten, fahre auf den Markt nach Rotenburg und Bad Hersfeld – na ja“, sie lachte, „es gibt immer was zu tun. Aber erzählt doch mal, was verschlägt euch hierher?“
„Urlaub“, antwortete Langer. „Ist ja so nah bei Frankfurt, aber tatsächlich war ich nach Großvaters Tod nicht mehr hier. Wollte es einfach mal wieder sehen.“
„Gute Idee! Dann müsst ihr unbedingt am Wochenende noch mal herkommen. Da ist großes Dorffest – unsere 850-Jahr-Feier. Die ganze Hauptstraße wird ein einziges Museum, Essen und Trinken gibt’s natürlich auch, und es spielen die Waldbuben im großen Zelt. Wird bestimmt toll!“
„Die Waldbuben?“, warf Gerda ein.
„Eine Band hier aus der Gegend. Super Musik, ehrlich. Die spielen alles, von Herzilein bis We will Rock You.“
Gerda begann, entsetzt den Kopf zu schütteln, doch Langer machte Augen wie ein kleiner Junge vorm Weihnachtsbaum.
„Ja, warum eigentlich nicht. Was meinst du, Gerda?“ Er wandte sich zu seiner Frau um, die ihn nur sprachlos anstarrte.
„Fast alle von der alten Clique werden da sein“, fuhr Susanne Meister unbekümmert fort, als habe sie Gerdas entsetzten Blick nicht wahrgenommen.
„Ach ja“, Langer drehte sich zu ihr um. „Was machen die denn jetzt so?“
„Na ja, den Jürgen habe ich geheiratet. Die Roswitha Müller ist schon vor fünfundzwanzig Jahren mit ihrem Steve nach Montana ausgewandert. Den hat sie in Frankfurt kennen gelernt, als da noch die Kasernen waren. Und jetzt heißt sie Miller – passt ja!“ Susanne kicherte. „Die hatte schon immer so einen Ami-Tick, kannst du dich erinnern?“
Langer nickte. „Ja, hat den ganzen Tag AFN gehört, war am liebsten in Cowboystiefeln unterwegs, die Pferde immer ohne Sattel geritten. Die Roswitha ...“ Er lächelte. „Was ist mit Heiner? Heiner Haller oder Heller?“
„Hellermann. Der wohnt noch hier in Heubach, hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Ist aber ein schweres Geschäft, beißt sich halt so durch. Der kommt bestimmt.“ Susanne seufzte. „Der kommt immer, wenn‘s Bier gibt. Hat eine aus der Stadt geheiratet, aus Eisenach, gleich nach der Grenzöffnung, aber die blieb nicht lange.“
„Da war doch noch einer, so ein Stiller ... Peter?“
Susanne schmunzelte. „Der Peter Schrader. Ist jetzt Lehrer in Bad Hersfeld. Frau, zwei Kinder, Hund, Reihenhaus in Rotenburg. Alles unauffällig wie er selber.“ Ihre Schultern hoben sich, ihr Lächeln wurde breiter. „Ob der Ausgang bekommt … Seine Frau müsste es erst mal erlauben.“ Langer gestattete sich ein wissendes Grinsen.
Gerda schielte auf ihre Uhr. Das konnte noch Stunden so weitergehen. Sie knuffte ihrem Mann leicht in die Seite, doch der schien es nicht zu bemerken, sondern fragte statt dessen:
„Was ist mit der Marga? Wie hieß die noch gleich?“
„Marga Krantzfeld? Ja, die heißt jetzt wieder so, wohnt in Bad Hersfeld, ist gerade zum dritten Male geschieden. Wir haben nur noch losen Kontakt. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Noch immer die oberflächliche Person, die sie immer war. Sie wird sicher kommen. Nur der Felix ...“
Sie brach ab, ihr Blick trübte sich.
„Felix. Felix Schulze.“ Auch Langer wurde ernst. „Hast du nach dieser … dieser Sache noch mal etwas von ihm gehört?“
Susanne schüttelte den Kopf. „Nein,“ sagte sie leise. „Nie mehr. Ist 1978 einfach verschwunden aus dem Dorf, keiner weiß, wo er abgeblieben ist. Jemand will ihn mal in Berlin gesehen haben, aber ob das stimmt ...“
Beide schwiegen. Gerdas Blick wanderte zwischen den beiden hin und her; blitzschnell packte sie die Gelegenheit beim Schopf und stand entschlossen auf. „Jetzt haben wir Sie aber lange genug aufgehalten, wir müssen mal wieder.“ Sie sah ihren Mann scharf an. „Nicht wahr, Paul?“
Er erhob sich widerwillig. „Ja, wir müssen mal weiter. War schön, dich zu sehen, Susanne.“
„Ebenfalls. Und – ihr kommt doch, oder?“
„Auf keinen Fall!“ zischte Gerda, als sie die Straße in Richtung Auto überquerten. Schaurige Bilder von singenden Lederhosenträgern stiegen vor ihrem geistigen Auge auf, ein eingefrorenes Grinsen im Gesicht und zu dröhnender Blasmusik Laute von sich gebend, die für den hiesigen Normaldeutschen akustisch nicht mehr zumutbar waren. Davor lange Reihen stumpfsinnig klatschender Menschen …
„Auf gar keinen Fall!“, wiederholte sie. „Da kriegst du mich nicht hin!“
„He!“ Gutgelaunt stieß Langer sie in die Rippen. „Nun komm schon! Das wird bestimmt lustig! Wir schwofen mal ein bisschen.“
„Wir schwo … Paul, was ist denn nur in dich gefahren!“
Sie setzte sich ans Steuer und sah ihren Mann nachdenklich an. „Das ist doch sonst nicht deine Art, dass du auf einmal Leute treffen willst, auf Feste gehen, tanzen, schwofen! Blasmusik hören. Blasmusik!“
„Das ist meine Vergangenheit, mein Leben“, sagte er, unvermittelt ernst geworden. „Ja, ich will die alle noch mal sehen. Mach dir doch einen schönen Abend mit den Liebigs, wenn du nicht mit willst.“
Sie antwortete nicht, startete den Wagen, und eine Weile fuhren sie stumm Richtung Hotel.
„Nett, die Susanne. Warst wohl schwer verknallt in sie damals, wie?“ meinte sie schließlich betont beiläufig.
„Das ganze Dorf war verknallt in sie, zumindest der männliche Teil. Dass ausgerechnet der Jürgen sie gekriegt hat ...“ Langer schüttelte den Kopf.
„Wieso?“
„Der war schon immer so ein Langweiler! Und mindestens zehn Jahre älter als sie! Müsste doch schon in Rente sein. Finanzamt, ja, das kann ich mir gut vorstellen! Und überhaupt … Der passt doch gar nicht zu ihr. Was die nur an ihm findet!“
Gerda grinste und schielte zu ihm hinüber. Dann wurde sie wieder ernst. „Was war das denn für eine ‚Sache‘, von der ihr da geredet habt? Im Zusammenhang mit dem einen aus eurer Clique, wer war das noch gleich?“
„Felix. Felix Schulze. Der war der Sohn des Lebensmittelhändlers. Tja, das war schon sehr merkwürdig damals.“
„Nun erzähl schon.“
Langer lehnte sich in den Sitz zurück.
„Also, Felix hatte noch einen jüngeren Bruder, Wolfgang. Wolfgang war anders als wir, still, kindlich, langsamer in allem. Damals sagte man: zurückgeblieben. Wie ein Hündchen trottete er immer der Clique hinterher, auch wenn die ihn gar nicht haben wollte. Oft wurde er von den anderen gehänselt, ja, ich fürchte – ich war ja nur in den Ferien da, darfst du nicht vergessen – ich fürchte, manchmal haben sie ihm richtig schwer zugesetzt. Natürlich nur, wenn Felix nicht in der Nähe war. Dann hat keiner es gewagt, Wolfgang zu ärgern, sein Bruder hat ihn verteidigt wie eine Löwin ihre Jungen. Und vor Felix hatte jeder Respekt.“
Langer machte eine Pause. „In meinem letzten Jahr war es, kurz bevor Großvater starb. Eines Abends kam Wolfgang nicht mehr nach Hause. Die einen sagten, er sei mal wieder der Gruppe hinterher gelaufen, die anderen meinten, sie hätten ihn nachher noch im Dorf gesehen. Als er nachts immer noch nicht zu Hause war, wurden Suchtrupps losgeschickt. Nach zwei Tagen fand man seine Leiche unterhalb des Salzbergs.“
„Da vorne bei dem Berg?“, fragte Gerda überrascht.
Sie passierten gerade den weißen Giganten, der sich jeden Tag etwas weiter in die grüne Landschaft schob, bedrohlich und unaufhaltsam.
Langer nickte nachdenklich. „Damals waren die Absperrungen und Sicherheitsvorkehrungen lange nicht so streng wie jetzt. Heute würdest du gar nicht mehr an den Berg herankommen; damals war das kein Problem, wir waren oft da. Der Berg war noch viel, viel kleiner; er wächst ja jeden Tag. Und die Salzauswaschungen sind alles andere als unproblematisch für Boden und Grundwasser hier.“
Er ließ den Blick kurz an dem Kaliberg hängen, der allmählich kleiner wurde und schließlich verschwand. „Na ja, jedenfalls, es hieß, der Junge – Wolfgang – sei abgestürzt. Er galt als orientierungslos und nicht in der Lage, auf sich aufzupassen. Man beließ es dabei und schloss die Akte ziemlich schnell. Vielleicht zu schnell. Womöglich untersuchte man den Fall nachlässiger, als es hätte sein sollen“, setzte er leise dazu.
„Und sein Bruder Felix verschwand?“
„Genau. Am Tag nach der Bekanntgabe des offiziellen Untersuchungsergebnisses war er aus dem Dorf verschwunden. Und blieb unauffindbar. Der Vater starb ein paar Jahre später, und noch nicht einmal zu dessen Beerdigung hat man ihn gesehen. Ein Makler hat das Haus verkauft, die Mutter war ja schon ein paar Jahre vorher gestorben, und es war, als hätte es die Familie Schulze in Heubach nie gegeben.“
Gerda warf ihm wieder einen Blick zu. Manchmal konnte der alte Brummbär fast poetisch werden.
„Aber es gab keine Hinweise darauf, dass es etwas anderes als ein Unfall war?“, fragte sie. „Bei Wolfgang, meine ich.“
Langer zuckte die Schultern. „Ich weiß es nicht. Ich war damals in den letzten Semestern auf der Polizeihochschule. Habe erst später von der Sache gehört. Ja, und eben heute, als Susanne mir sagte, dass Felix immer noch verschwunden ist.“
Sie näherten sich bereits dem Hotel, als Gerda meinte: „Also gut, ich gehe mit zu diesem Dorffest. Und die Musik höre ich mir exakt fünf Minuten an; wenn sie mich dann noch nicht überzeugt hat, fahre ich zurück.“
Langer strahlte, was selten genug vorkam. „Sagen wir fünfzehn, okay?“
Kapitel II
4
Über einen schier endlosen, meisterlich geschnittenen und unverschämt grünen Rasen schlenderte Detective Sergeant James Scott gemessenen Schrittes Lestercombe Manor entgegen, einem Herrenhaus im Tudorstil, vor dessen Eingangshalle der Detective Chief Inspector gerade mit dem Butler sprach.
In respektvollem Abstand blieb er stehen und räusperte sich leise.
„Sir, wir haben ein Problem.“
DCI Thomas Warren warf ihm einen kurzen Blick zu, nickte, verabschiedete sich formvollendet mit einem „Danke, Parsons“ von dem gebieterischen Hausangestellten und folgte gemessenen Schrittes seinem DS den Weg über das gepflegte Grün zurück zu den Stallungen, wo im Mittelgang zwischen einer langen Reihe von Pferdeboxen auf der einen und etlichen Strohballen auf der anderen Seite ein übel zugerichteter menschlicher Körper in einer riesigen Blutlache lag.
Einen kurzen Moment blieben die beiden Detectives stehen und begutachteten das Problem. Man hörte leises Pferdeschnauben und sah dann einen ratlos dreinblickenden jungen Mann, dessen Kleidung und Redeweise ihn als Stallburschen auswiesen.
„So hab‘ ich ihn gefunden, Sir. Alles voller Blut. Weiß gar nich‘, was ich sagen soll, bin noch ganz durcheinander ...“
Ein Telefon dudelte.
Richard Immelshausen alias Boris Kemper brauchte eine Zehntelsekunde, um sich von der Welt des britischen Landhausmordes mental zu verabschieden, und eine weitere, um zu begreifen, dass nicht sein Handy, sondern der Festnetzanschluss geklingelt hatte. Er schaltete seufzend den Ton am Fernsehgerät aus, erhob sich und fischte auf seinem Schreibtisch nach dem Mobilteil.
„Ja?“, meldete er sich mürrisch.
„Hier ist Eva. Stör ich dich beim Arbeiten?“
Seine Agentin. „Was willst du?“
„Lieber Himmel, haben wir wieder gute Laune heute?“
„Komm bitte zur Sache; es ist nach zehn!“
„Wusste gar nicht, dass das für dich eine Rolle spielt.“ Kleine beleidigte Pause. „Und was ich will, kannst du dir ja denken. Wie weit ist das Manuskript? Es fehlt das letzte Kapitel. Als ob du das nicht wüsstest. Und abgesehen davon, dass Schering allmählich unruhig wird ...“
„Und abgesehen davon, dass das nichts Neues ist ...“, äffte er ihren nörgelnden Ton nach.
„... sehr unruhig“, kam es unbeirrt aus dem Hörer. „Abgesehen davon würde es mich selber mal interessieren, wer nun dein Mörder ist. Ich bin ja normalerweise ganz pfiffig darin, wie du weißt, aber dieses Mal kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie du die losen Fäden jetzt noch auf den letzten Seiten ...“
„Was hat er gesagt?“
„Wer?“
„Der Nikolaus. – Schering natürlich – von wem reden wir denn gerade?“
„Also Richard, weißt du, ...“
Ein tiefer Seufzer kam durch die Leitung, den Richard nutzte, sich wieder mit den – immer noch lautlosen – Vorgängen im idyllischen Highsummer Meadows zu beschäftigen.
Dem Detective Sergeant hatte sich inzwischen ein weiteres Problem in Form einer völlig verkohlten Leiche aufgetan, gefunden in einem Morgan Roadster, der inmitten der lieblichen Hügel von Kent ebenfalls fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war.
Muss die Pflegemutter des Stallburschen sein, dachte Richard Immelshausen mit einem prüfenden Blick auf den Bildschirm. Der ist nämlich in Wahrheit der uneheliche Sohn der Schwester des feinen Pinkels aus dem Herrenhaus. Jahrelang hat der Onkel bezahlt, damit die Pflegeeltern den Mund halten. Doch die wollen immer mehr, erpressen ihn, und er bringt sie um, alle beide. Oder aber, dachte Richard weiter, der Stallbursche hat seine Pflegeeltern aus dem Weg geräumt, weil er natürlich lieber im netten Herrenhaus statt in dem engen Cottage …
„Hast du was gesagt?“, tönte es aus dem Hörer.
„Nein, rede nur weiter.“
„Richard! Ich habe dich etwas gefragt! Du bist dran mit Reden!“
„Ha!“ Richard schnippte mit dem Finger, den Blick immer noch auf dem Fernseher. „Der Arzt war‘s! Natürlich! So passt alles zusammen.“
Im Hörer blieb es still, und Richard spann seinen Faden in Gedanken weiter, bis er Evas Stimme wieder hörte. Sie war leiser geworden, nachdenklicher, fast ängstlich.
„Richard, du willst nicht ernsthaft den Arzt zum Mörder machen, oder? Der kommt ganz am Anfang einmal kurz vor, spricht drei Sätze und verschwindet. Den kannst du im letzten Kapitel nicht wieder wie ein Kaninchen aus dem Hut ziehen!“
Widerwillig riss Richard sich vom Bildschirm los. „Was meinst du? Welcher Arzt …? Ach so, nein, ich dachte eben an etwas anderes. Also, was will Schering nun?“ Sicherheitshalber drehte er dem großen Bildschirm den Rücken zu. „Er bekommt das letzte Kapitel Ende der Woche. Bestimmt.“
„Du könntest ihn mal anrufen. Er ist dein Lektor, du bist der Star – rede doch einfach mal wieder mit ihm. Da freut er sich.“
„Ja, mach ich morgen.“
Sprach‘s – und hatte es schon wieder vergessen, als er das Gespräch wegdrückte und sich wieder dem Fernseher zuwandte. Das Angenehme an den Highsummer Meadows Murders war, dass man von den neunzig Minuten, zu denen die BBC-Produzenten sie aufgebläht hatten, gut und gerne fünf verpassen konnte, ohne den Faden zu verlieren.
Nachdem Richard befriedigt festgestellt hatte, dass tatsächlich der Dorfarzt all die schauerlichen Morde begangen hatte, und die Abspannmusik erklang, schaltete er das Gerät aus und wandte sich seufzend seinen eigenen fiktiven Verbrechen zu.
Das Laptop stand einladend aufgeklappt auf dem Schreibtisch; Stöße von Ausdrucken lagen daneben auf dem Boden.
Nachdenklich betrachtete Richard das Durcheinander, ließ seinen Blick weiter durch das große Wohn-Arbeitszimmer wandern und ging schließlich zum Fenster, wo er sich wie immer durch den grandiosen Ausblick auf die erleuchtete Frankfurter Skyline ablenken ließ. Die City schien zum Greifen nah. Hier in Sachsenhausen am Schaumainkai, umgeben von der Hochkultur des Museumsufers, eine Wohnung mit diesem Panorama zu besitzen, war kaum mit Geld zu bezahlen.
Er wandte sich entschlossen um und ging zum Schreibtisch zurück. Das letzte Kapitel musste endlich geschrieben werden. Und Schering hatte völlig Recht, wenn er allmählich die Geduld verlor. Das Problem war nur – und Eva hatte es auf den Punkt gebracht –, dass Richard keine Ahnung hatte, wie er jetzt noch die Einzelteile des Puzzles, das bald als DER NEUE KEMPER in den Regalen der Buchhändler und auf sämtlichen Online-Portalen stehen sollte, – ein Thriller, der in gewohnter Weise die Bestsellerlisten anführen würde und auf den seine Leser bereits fieberhaft warteten, – wie er jetzt in nur einem Kapitel all diese Teile zu einem Ganzen fügen könnte. Irgendwo in seinem Manuskript hatte er sich verfahren, Dinge waren ausgeufert, Beschreibungen zu langatmig geraten, Personen und Schauplätze hatten sich verselbständigt und vermehrt. Er würde mindestens noch drei Kapitel brauchen, hundert Seiten mehr als geplant. Oder aber alles noch einmal durchgehen, Handlungsstränge zurechtstutzen, kürzen, die Logik überprüfen.
Nicht dass bei der Art von Romanen, mit denen Richard Immelshausen alias Boris Kemper erfolgreich war, die Logik eine übergeordnete Rolle gespielt hätte. Was die Leser, meist männliche, an seinen Büchern liebten, gehörte in die Kategorie sex and crime; britische Zurückhaltung wie in Highsummer Meadows war Boris Kempers Art nicht. Bei ihm ging es radikal zur Sache; Blut floss reichlich, es gab Vergewaltigung und die Rache dafür, es gab schwere Körperverletzung, atemberaubende Verfolgungsfahrten, schicke Frauen, coole Kerle, heißen Sex und blutige Attentate. Das alles möglichst anschaulich und detailliert zu Papier zu bringen, damit verdiente Richard Immelshausen sein gutes – sehr gutes – Geld. Denn die Plots waren, wenn schon nicht übertrieben anspruchsvoll, doch schlüssig, die Figuren bestens skizziert, die Dialoge lebendig geschrieben. Und seitdem das Fernsehen zwei Kemper-Thriller verfilmt hatte – ein dritter wurde gerade in London und Schottland gedreht – konnte Richard rundum mit sich zufrieden sein.
Was er aber ganz und gar nicht war – das hatte Eva eben zu spüren bekommen. Er war müde, er hatte keine Lust mehr, er hatte die Nase voll.
Nun sei jedem Menschen – Künstlern allemal – eine solche Stimmung zugestanden; Tatsache jedoch war, dass dieser Zustand bei Richard Immelshausen nun schon geraume Zeit anhielt, und das konnte für sein Alias Boris Kemper entschieden ungünstig ausgehen. Nein, das neue Buch musste fertig werden,
Doch heute Abend nicht mehr. Richard warf einen letzten, resignierten Blick auf den Schreibtisch und sah auf die Uhr. Dann nahm er Schlüssel, Handy und Geldbörse und verließ seine Wohnung.
Langsam wanderte er durch den Duft des Aprilabends nach Sachsenhausen hinein. Noch vor der Gartenstraße sah er die beiden auf sich zukommen, mit denen er um diese Stunde und an dieser Stelle fest gerechnet hatte: ein kalbhohes, beige-graues Zottelvieh – das Ergebnis einer unachtsamen halben Stunde zwischen einer Deutschen Dogge und einem Irischen Wolfshund – und einen alten Mann in Jeans, Trenchcoat und schwarzem Filzhut, der, die Hände mit der losen Hundeleine auf dem Rücken verschränkt, gesenkten Hauptes hinter dem Monster hertrottete.
Richard blieb stehen und betrachtete das friedliche Bild. Lange Zeit blieb ihm dazu allerdings nicht, denn der Hund hatte ihn entdeckt, streckte seine hohen Beine in Galoppstellung und sprintete los.
Es würde nur noch eine Frage von Sekundenbruchteilen …
Rasch, aber nicht hektisch – so wie Hunderte von Malen praktiziert – hob Richard die Hand.
„Sheriff, stopp! Und sitz!“, sagte er ruhig.
Er konnte förmlich die Bremsen quietschen hören, als der Koloss seine Vorderhufe in den Asphalt hieb, kurz abfederte und schließlich regungslos auf dem Trottoir sitzen blieb, seine Riesenschnauze erwartungsvoll Richard zugewandt.
„Irgendwann wirst du richtigen Ärger bekommen, Fritz“, grinste Richard dem alten Mann zu, der langsam näher kam. „Spätestens, wenn der erste Passant mit einem Herzinfarkt drüben in der Uniklinik liegt, nachdem er euch abends begegnet ist!“
„Hallo, mein Lieber! Schön dich, zu sehen. Wie geht’s?“
„Nix für ungut!“ Richard kramte unter Sheriffs hypnotischem Blick in der Hosentasche nach einem Hundekeks. „Aber es gilt Leinenpflicht in dieser Stadt.“
Der andere lachte laut auf. „Richard, glaubst du denn im Ernst, ich könnte diesen Apparat halten, wenn‘s drauf ankäme?“ Er warf seinem Baby einen liebevollen Blick zu. „Dafür habe ich ihn verbal fest im Griff, gell, mein Alter?“
„Aber nicht, wenn du geistig so weggetreten bist wie eben. Wo warst du denn wieder mit deinen Gedanken?“
Fritz winkte ab, holte die Leine hervor und legte sie dem Hund an. Zusammen machten sie kehrt und wandten sich wieder dem Mainufer zu. Eine Gruppe Jugendlicher in Kapuzenpullis kam laut grölend die Uferpromenade hoch gestolpert, lärmte ihnen entgegen, wurde leiser und schlich schließlich still an ihnen vorbei.
Fritz kicherte. „Hat alles seine Vorteile, siehst du? Obwohl die wahrscheinlich harmloser sind, als sie gerne sein wollen.“
Sie machten einen Bogen zur Schweizer Straße hin und erreichten schließlich ihre Stamm-Ebbelwoi-Kneipe, wo Sheriff zielgerichtet den gewohnten Tisch in der Ecke ansteuerte und sich tief aufatmend neben den Stuhl fallen ließ, den sein Herrchen gleich drauf in Beschlag nahm. Petra, die blonde Bedienung mit Betonfrisur, Typ Margit Sponheimer in ihren späteren Jahren, stellte kommentarlos zwei Gerippte und einen Krug mit dem Frankfurter Nationalgetränk vor sie hin und dem Hund eine Schüssel Wasser vor die Nase. Fritz nahm den Schlapphut ab, und eine glänzend polierte Glatze kam zum Vorschein.
„Was esse mer dann heut Awend, Fritz?“, fragte sie, während sie ihm zuzwinkerte.
Richard grinste in sich hinein. Petra also auch. Dieser alte Windbeutel.
„Was du isst, Petra, waaß isch net“, antwortete Friedrich in einer der Umgebung geschuldeten Dialekteinlage, „awwer mir bringste mal widder von dene köstlische Ribbscher mit Kraut.“
Nachdem Petra geruht hatte, auch Richards Bestellung der Grie Soß aufzunehmen, entschwand sie ihrem Blickfeld.
„Du sachst jetzt nix, gell!“ Friedrich bedachte Richard mit einem warnenden Blick, während der den Apfelwein einschenkte, „Kein Kommentar, hörste? Was kann isch dann dafür, wenn mir die Fraue zublinzeln duun!“
„Isch hab nix gesacht!“ Richard hob prostend sein Glas, immer noch breit grinsend. „Awwer du hast zurück geblinzelt, isch hab‘s genau gesehe!“
„Is awwer aach e goldisch Grott, gelle?“ Der andere blickte der Kellnerin nach und seufzte. Dann drehte er sich zu Richard um.
„So, nun erzähl mal: Du kommst nicht weiter, wie?“
So war es immer gewesen. Dr. Friedrich Mommsen (Fritz nur für seine besten Freunde) hatte stets gemerkt, wenn Richard Immelshausen in einer Schaffenskrise steckte. Mommsen war lange Jahre sein Lektor im Verlag gewesen, hatte ihn entdeckt, aufgebaut und groß herausgebracht. Auch jetzt, obwohl schon lange Jahre im Ruhestand, war er der erste Ansprechpartner bei Problemen, neuen Ideen, großen Veränderungen.
Richard seufzte. „Dieser Walken macht nur Probleme! Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll.“
„Du hast ihm von Anfang an zu viele Freiheiten gelassen – ich habe es dir prophezeit. Das konnte nicht gut gehen.“
Richard nickte trübsinnig. „Jetzt hängt er mir wie ein Klotz am Bein.“
„Dann bring ihn doch endlich um!“ Es geschah nicht ohne Absicht, dass Fritz bei diesem Satz seine Stimme erhob. Der Mann am Nebentisch schickte einen irritierten Blick herüber, seine Begleiterin ließ eine Gabel mit Sauerkraut in der Luft stehen und starrte die beiden Männer an.
„Kann ich noch nicht“, meinte Richard. „Ich brauche ihn später noch. Er ist der Einzige, der den Code knacken kann. Irgendwann ist ohnehin geplant, ihn auszuschalten. Aber in der Zwischenzeit … Er stört kolossal!“
„Es schwirren zu viele Figuren rum. Mach einen rabiaten Schnitt, sage ich dir! Kann Walken die Decodierung nicht irgendwo aufschreiben – USB-Stick, CD – am besten unter subtiler, aber wirkungsvoller Folter, das kannst du doch so gut ...“
Die Gabel der Dame fiel auf den Teller zurück, auch der Mann war zum unverhohlenen Gaffen übergegangen.
„... und dann kannst du ihn gleich in die ewigen Jagdgründe schicken und bist ihn endlich los!“, setzte Fritz ungerührt hinzu.
„Hm. Nicht schlecht. Manchmal kann es so einfach sein.“ Richard nahm einen Schluck Apfelwein. „Werde ich mal drüber nachdenken. Ich muss morgen ohnehin im Verlag anrufen, bis dahin habe ich sicher eine Idee, wie ich das bewerkstellige.“
Die beiden am Nebentisch warfen sich einen erleichterten Blick zu. Das nachbarliche Sauerkraut wanderte in den Mund der Dame, ihr Mann widmete sich wieder seinem Handkäs‘ mit Musik, und Friedrich lächelte in sich hinein. Richard hatte von dem kleinen Zwischenspiel nichts mitbekommen, sondern nickte gedankenverloren vor sich hin. „Ja, so könnte es gehen.“
„Und danach machst du erst mal Pause! Die hast du dir verdient.“
Petra rauschte durch das Lokal und stellte ihnen zwei Teller auf den Tisch.
Fritz wedelte den Duft des Sauerkrauts in seine Nase. „Was macht deine Tochter Isabella? Immer noch glücklich mit Ehemann Nummer zwei?“, fragte er betont munter. „Wie hieß er noch mal?“
„Tobias. Ja, der ist in Ordnung. Und die Kleine! Fanny ist der reinste Sonnenschein! Kunststück – mit fünf!“ Er sah den Schatten im Gesicht des alten Mannes und legte ihm sacht die Hand auf den Arm.
„Entschuldige, Friedrich“, sagte er leise.
„Keine Angst, ist schon in Ordnung. Ich habe ja damit angefangen.“
Friedrich legte Messer und Gabel beiseite. „Es ist so grauenhaft, wenn ein Kind vor seinen Eltern geht, aber wenn man seinen eigenen Enkel begraben muss … und auf diese entsetzliche Art und Weise ...“ Er stützte unvermittelt das Gesicht in die Handflächen und saß eine Weile stumm da. „Ich weiß nicht, wie Hella das verkraftet hat.“
„Sie hat ihren Andreas.“
Friedrich nahm die Hände vom Gesicht. „Die kleine Fanny hätte meine Urenkelin werden können“, sagte er wehmütig lächelnd und griff wieder zum Besteck.
Richard beobachtete seinen alten Freund besorgt. Das scharf geschnittene Gesicht unter dem kahlen Schädel sah plötzlich älter aus, als es war, die sonst so lebhaften grau-grünen Augen blickten stumpf und müde. „Ist wirklich alles in Ordnung mit dir, Fritz?“
„Ja, ich bin okay. Liegt sicher an Ralphs zehntem Todestag morgen, dass die alte Geschichte wieder so vehement hochkommt.“
„Ja, an Isabellas Geburtstag.“ Richard drehte gedankenverloren das Apfelweinglas in den Händen, bevor auch er zum Besteck griff. „Sie hat es einigermaßen verkraftet – die Gnade der Jugend: Man sieht leichter nach vorne als zurück.“
„Es gibt noch nicht so viel in der Rückschau zu sehen. – Entschuldige, Richard, ich wollte dir nicht den Abend verderben. Es lässt sich nichts mehr rückgängig machen.“
5
Friedrich Mommsen hielt vor seinem Haus in der Holbeinstraße, von dem er das Erdgeschoss bewohnte, und ging um seinen Toyota SUV herum, um Sheriff herauszulassen. Er hatte ihn nach dem Treffen mit Richard draußen am Stadtwald noch einmal ausgiebig laufen lassen. Der Hund machte einen Satz aus dem Kofferraum und verfiel augenblicklich auf der breiten Grünanlage in bewegungslose Sitzposition.
Ein spätabendlicher Gassigeher mit zwei bellenden Jack-Russel-Terriern an der Leine hangelte sich im großen Bogen um Sheriff herum, der sich von dem Gekläff völlig unbeeindruckt gab und nur Augen für sein Herrchen hatte. Friedrich hatte nicht übertrieben, wenn er sagte, dass er seinen Liebling fest im Griff hatte; anders wäre der Riese nicht zu handhaben gewesen, schon gar nicht in der Stadt. Der große Wagen war nur eines der Zugeständnisse an den Hund, ein weiteres die Masse an Zeit, die er mit dem Vierbeiner verbrachte, damit dieser genügend Auslauf bekam.
Doch der Stadtwald war nicht weit, und Zeit hatte Dr. Friedrich Mommsen genug.
Er genoss die Gespräche mit seinem alten Freund Richard Immelshausen in den Ebbelwoi-Kneipen der Stadt oder die langen Spaziergänge mit ihm, Sheriff natürlich eingeschlossen. Sie kannten sich schon fast dreißig Jahre, und dieser Bekanntschaft war es zu verdanken, dass Richards Tochter Isabella und sein Enkel Ralph sich kennengelernt und schließlich geheiratet hatten. Dass es nur ein kurzes, tragisches Zwischenspiel im Leben aller Beteiligten bleiben würde, konnte damals keiner ahnen.
Heute war es besonders schlimm mit den vermaledeiten Erinnerungen. Er seufzte tief auf, während er die Haustür aufschloss. Vom geräumigen Vorplatz führte geradeaus eine Holztreppe mit kunstvoll gearbeitetem Geländer nach oben, links ging es durch eine Glastür im Jugendstil zu seiner eigenen Wohnung.
Sheriff blieb abrupt stehen und brummte.
Friedrich schrak aus seinen Gedanken hoch und lauschte nach oben. Die Mieter waren in Urlaub, das wusste er.
Legte das Ohr an seine Wohnungstür.
Nichts.
Das Brummen ging zum Knurren über.
„Still, Sheriff“, flüsterte Friedrich und legte seine Hand um die Hundeschnauze, während die andere kurz seinen Kopf streichelte.
„Feiner Hund.“
Tür und Schloss waren unversehrt.
Friedrich nahm einen Stuhl von der Wand und klemmte ihn vorsichtig unter den Türgriff.
„Komm, Sheriff, Fuß!“
Den Hund am Halsband gefasst, wandte er sich leise wieder der Haustür zu, von dort nach links Richtung Garten. Als er um die Hausecke bog, sah er es: Der schwache, flackernde Lichtschein einer Taschenlampe huschte durch die offene Glastür über Rasen und Terrasse.
Das Arbeitszimmer!
Wieder knurrte der Hund, und diesmal ließ Friedrich ihn los.
Sheriff preschte laut bellend Richtung Terrasse vor, dann jaulte er plötzlich qualvoll auf. Gleichzeitig fiel ein Schuss.
„Um Gottes Willen – Sheriff.“
Als Friedrich endlich die offene Terrassentür erreicht hatte, sah er aus den Augenwinkeln eine Gestalt in einiger Entfernung im Garten an ihm vorbeihuschen, doch er achtete nicht darauf. Er registrierte kurz, dass sein Hund vor dem Schreibtisch auf dem Bauch lag – was ihm kurz ein beruhigendes Gefühl gab – und sich unter leisem Winseln abwechselnd beide Vorderpfoten leckte.
Mit zitternden Fingern holte Friedrich sein Handy aus der Tasche und wählte. Unter der Nummer der Tierarztpraxis vermeldete eine Stimme, dass er außerhalb der Praxiszeiten anrufe, die da seien …
Verdammt. Er atmete tief durch. Ruhig jetzt. Hysterie nutzte jetzt niemandem. Schließlich fand er die Privatnummer der Tierärztin. „Marianne, komm sofort. Sie haben auf Sheriff geschossen!“
Es folgte eine kurze Pause, dann die beruhigende, tiefe Stimme der Veterinärin: „Bin sofort da.“
Eine halbe Stunde später packte Marianne Möller bereits ihre Sachen wieder zusammen. Sheriff war inzwischen geschmückt mit zwei blauen Stretch-Verbänden an den Vorderpfoten und lag in einer sicheren Ecke des Zimmers ohne Glasscherben.
„Ganz sicher keine Schussverletzung, Fritz, wirklich, du kannst dich beruhigen. Er ist in zwei Glasscherben gleichzeitig getreten und hingefallen. Möglich, dass ihm das das Leben gerettet hat, denn stehend hätte er ein gutes Ziel abgegeben, das wohl kein Schütze auf die geringe Entfernung verfehlt hätte. Wird schon wieder, mein Großer.“
Sie tätschelte dem Hund die lange Flanke und kramte in ihrer Tasche. „Gib ihm das drei Mal am Tag gegen die Schmerzen. Und komm übermorgen zum Verbandswechsel vorbei.“
„Ich danke dir, Marianne, dass du so schnell da warst.“
„Kein Problem. – Guter Gott, wie siehst du denn aus!? Du brauchst ja selber einen Arzt. Soll ich dir was für den Kreislauf spritzen?“
Friedrich wehrte ab. „Bewahre!“
Die Tierärztin kicherte. „Ich hätte auch was aus dem Bereich der Humanmedizin dabei. Nein? Wie du willst.“ Sie sah sich um. „Aber ich würde die Polizei rufen, schon wegen der Versicherung.“
Friedrich schien jetzt erst das Chaos zu bemerken, in das sich sein Arbeitszimmer verwandelt hatte. Offene Schubladen, Bücher auf dem Boden, Papier im Raum verstreut. Und doch machte die Szene nicht den Eindruck von blindem Vandalismus, sondern zeugte von gezielter Professionalität … Er ging in die Ecke des Zimmers zu einem kleinen Wandsafe. Er war unberührt. Dann rief er die Polizei an.
„Ich warte mit dir“, meinte Marianne Möller mit einem weiteren kritischen Blick auf ihn. „Hast du noch einen Schluck von dem guten Roten von neulich? Im Wohnzimmer? Dann setz dich mal hier hin. Dir bringe ich einen Cognac mit.“
Friedrichs Handy klingelte.
„Hoffe, du hast noch nicht geschlafen“, kam Richards Stimme durch den Hörer. „Aber ich hatte ganz vergessen, dir zu sagen ...“
„Richard, bei mir ist eingebrochen worden.“
„Wie bitte?“
Er kam nicht dazu, sein Abenteuer zu erzählen, denn Richard unterbrach ihn. „Ich komme.“
Richard brauchte nur wenige Minuten vom Mainufer zur Holbeinstraße – meist fuhr er mit dem Fahrrad – und blieb schließlich erschüttert vor dem Chaos im Arbeitszimmer stehen.
„Ach du lieber Gott!“ Er ließ sich kraftlos auf einen der Sessel sinken. „Mensch, Alter, dich kann man ja nicht eine Sekunde alleine lassen!“
Frau Möller stand auf und gähnte diskret. Sie hatte einen langen Arbeitstag in der Praxis hinter und voraussichtlich einen ähnlichen vor sich.
„Ich werde dann mal wieder, Sie bleiben noch einen Moment bei ihm, Herr Immelshausen, nicht wahr?“
Richard nickte. „Hast du eine Vorstellung, was die hier gesucht haben?“, fragte er, als die Tierärztin gegangen war. „Fehlt etwas? Hast du die Polizei angerufen?“
Fritz zuckte die Schultern. „Nichts. Im Wandsafe ist eine eiserne Reserve, dreitausend Euro, und ein paar Papiere, aber der Safe ist nicht angerührt worden. Mir scheint, dass er gar nicht gesucht worden ist. Sonst hingen wohl einige Bilder schief. – Und im Schreibtisch sind wirklich keine aufregenden Sachen.“
„Hinter den Büchern haben sie gesucht.“ Richard zeigte auf die Regale.
Es klingelte, und Fritz ließ zwei uniformierte Beamte ein. Sie ließen sich die Ereignisse schildern, protokollierten sie und wurden erst hellhörig, als Fritz von dem Schuss erzählte.
„Eine echte Waffe oder eine Schreckschusspistole?“
„Himmel, das weiß ich doch nicht! Mein Hund wurde gerade angeschossen – zumindest glaubte ich das – da hatte ich anderes zu tun, als darauf zu achten. Außerdem … klingen die denn verschieden? Schließlich habe ich die Waffe ja nicht gesehen. Und selbst wenn ...“ Er zuckte hilflos die Schultern.
Die Beamten sahen sich an. „Recht ungewöhnlich, dass Einbrecher Schusswaffen bei sich haben. Und sie dann auch benutzen“, meinte der erste.
„Jedenfalls ist das eine Sache für die Ermittlungsbehörden; bei Schusswaffen sind die eigen“, sagte der andere. „Die Spurensicherung wird morgen bei Ihnen auftauchen und nach dem Projektil und der Hülse suchen. Heute Nacht hat das keinen Sinn mehr. Sie lassen alles so, wie es ist und rühren nichts an.“
„Ja sicher.“
„Dann gute Nacht!“ Sie wandten sich zum Gehen.
„Andererseits.“ Der erste Polizist blieb an der Tür stehen und warf einen zweifelnden Blick zu Sheriff hinüber. „Wenn so ein Vieh in der Dunkelheit auf mich zugerast käme, würde ich wahrscheinlich auch schießen.“
6
Boris Kemper war so gut wie nie im Verlagshaus zu sehen; die wenigsten Mitarbeiter dort würden ihn überhaupt erkannt haben als eines der Zugpferde ihres Hauses. In der Regel bemühte sich Walter Schering, Cheflektor der Belletristik, zu ihm in seine Sachsenhäuser Wohnung. Dies war Teil gewisser vertraglicher Vereinbarungen, auf deren strikte Einhaltung Immelshausen inzwischen die Macht hatte zu bestehen. Er hasste jede Form von Öffentlichkeit; der Gedanke, auf Lesungen zu erscheinen, verursachte ihm Übelkeit. Sein Pseudonym wurde strikt gewahrt. Abgesehen von Friedrich Mommsen, seiner Agentin, seiner Familie, zwei, drei Leuten im Verlag und vielleicht vom Finanzamt wusste niemand – noch nicht einmal seine unmittelbaren Nachbarn in Sachsenhausen – dass sich hinter dem Klingelschild Richard Immelshausen der Schriftsteller Boris Kemper verbarg. Leichter gemacht wurde ihm das Versteckspiel durch die Tatsache, dass er unter seinem bürgerlichen Namen für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften als freiberuflicher Journalist arbeitete, so dass er nachweislich – da sein Name unter den Artikeln stand – einen Beruf vorzuweisen hatte, wenn er gefragt wurde.
Und der Verlag war geschickt genug, diese Geheimniskrämerei seines Starautors für Marketingzwecke auszuschlachten – bis zu einem gewissen Maße, denn man wollte natürlich vermeiden, dass durch eine allzu große öffentliche Neugier eine mediale Hatz nach dem bekannten Schriftsteller einsetzte.
Der nächste Tag begann mit einem derart strahlenden Morgen, dass Richard, im Begriff, Schering anzurufen, beim Blick auf das frische Grün der Platanen am Mainufer unter ihm den Telefonhörer spontan wieder hinlegte, kurz entschlossen seine Jacke aus dem Schrank holte und über den Eisernen Steg zum Roßmarkt marschierte, wo in einem eher unscheinbaren Haus aus der Gründerzeit der MOLAF-Verlag residierte.
Er hatte früh bereits Fritz angerufen und sich vergewissert, dass alles in Ordnung war.
„Und wie geht es Sheriff?“
„Oh,“ hatte Fritz durch den Hörer gelacht, „der findet es toll, mit Fleischwurst gefüttert zu werden.“
Zwei Stunden später schlenderte Richard aus der City wieder heimwärts. Schmunzelnd dachte er an Scherings völlig verdattertes Gesicht, als er urplötzlich in dessen Bürotür aufgetaucht war, eine offensichtlich neue Sekretärin hinter sich, die nicht wusste, wer er war, im vergeblichen Versuch, ihn aufzuhalten, und an das überraschend friedliche Gespräch mit dem Lektor, der sich sofort Zeit für ihn genommen hatte.
Eilig hatte er es auf dem Heimweg nicht.
Er gönnte sich einen kleinen Umweg über den Römerberg, bog zur Schirn ab und setzte sich schließlich an einen der Tische des Cafés, die bereits draußen aufgestellt waren. Wie in jedem Frankfurter Gastronomiebetrieb, der auf sich hielt und die entsprechenden Möglichkeiten hatte, wurde auch hier die Möblierung beim ersten übermütigen Sonnenstrahl ins Freie geräumt – unabhängig von Jahreszeit und Temperatur. An einem sonnigen Januartag mochte man das Zugeständnis einer warmen Decke und eines Gasstrahlers machen. Hauptsache, die Sonne schien.
Während er gedankenverloren in seinem Cappuccino rührte, ließ er seinen Blick ziellos über die Menge von Müßiggängern, Museumsbesuchern und Büroangestellten schweifen, die zwischen Dom und Römer hin- und herwogte.
Wie lange schon das halblaute, aufgeregte Zischeln hinter seinem Rücken durch alle sonstigen Hintergrundgeräusche in sein Unterbewusstsein gedrungen war, konnte er später nicht sagen – Tatsache war, dass er es mit einem Schlag bewusst wahrnahm und in der selben Sekunde wusste, dass er die Stimmen kannte. Er blieb regungslos sitzen, um sie einzuordnen – zeitlich, örtlich … dann wusste er es. Vorsichtig machte er eine halbe Drehung zu der sich über drei Stockwerke erstreckenden Glasfront der Ausstellungshalle hin, vor der sich der Außenbereich des Cafés befand und die wie eine riesige Kinoleinwand das Freiluftcafé widerspiegelte: Richtig – er hatte sich nicht getäuscht. Ein paar Minuten noch blieb er sitzen, in seinem Stuhl lässig zurückgelehnt, die Kaffeetasse in der Hand, den Blick immer noch schweifend, doch aufmerksam dem zuhörend, was hinter seinem Rücken gesprochen wurde.
Dann stand er auf, bewegte sich langsam auf den Eingang des Cafés zu und zahlte. Im seitlichen Vorbeigehen warf er nochmals einen Blick auf die Glasfont. Doch es bestand kein Grund zur Beunruhigung; man hatte ihn nicht gesehen.
Die beiden waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
7
Nachdenklich drückte Isabella Neumann das Gespräch weg. Warum konnten diese Leute sie nicht endlich in Ruhe lassen? Was vorbei war, war vorbei. Sie hatte jetzt ein neues Leben mit Tobias und Fanny. Und heute war ihr fünfunddreißigster Geburtstag. Gedankenverloren schaute sie durch das große Wohnzimmerfenster auf die Terrasse hinaus, wo ihre Gäste sich offensichtlich gut amüsierten. Plötzlich erklang schallendes Gelächter; jemand, wahrscheinlich Otto Weller, ein Kollege aus der Schule in Bad Hersfeld mit Zweitberuf Frohnatur – was angesichts der allgemeinen Zustände an den deutschen Schulen eine beachtliche Leistung war – hatte gerade einen Witz erzählt.
„Was ist denn, Schatz?“ Ihr Mann war neben sie getreten. Er zeigte auf das Telefon. „Schlechte Nachrichten?“
„Nein, gar nicht. Andreas und Hella haben mir gratuliert.“
„Ist doch nett von ihnen, oder?“, fragte Tobias unbekümmert.
„Ja, sicher. Aber irgendwie, weißt du … irgendwie wäre es mir lieber, ich würde nichts mehr von ihnen hören.“
„Immerhin warst du mal ihre Schwiegertochter.“
„Ach, Tobias, Ralph ist seit zehn Jahren tot, und unsere Ehe hat nur knapp ein Jahr gedauert! Außerdem – Hella druckste so unbeholfen rum – gar nicht ihre Art! – sie seien ganz in der Nähe, wäre doch schön, sich wieder mal zu sehen … Ich hab‘s einfach ignoriert, was bei dem kompletten Lattenzaun, mit dem sie gewunken hat, sehr unhöflich war. Jetzt tut‘s mir schon wieder leid, aber ...“ Sie stellte energisch das Telefon in die Station zurück.
„Zwei mehr oder weniger heute Abend wären kaum aufgefallen“, meinte Tobias.
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, wenn ich sie jetzt eingeladen hätte, würde ich sie auf Dauer nicht mehr so schnell loswerden.“
Tobias schaute auf die Terrasse hinaus. Der warme Frühlingstag ging langsam in eine kühle Dämmerung über. Dem Dutzend Leute draußen schien es nichts auszumachen. Wieder erscholl lautes Gelächter.
„Sag bloß, Peter hat einen Witz gemacht!“ Tobias lachte. „Allein das wäre lustig genug!“
Isabella warf ihrem Mann einen nicht ganz ernst gemeinten missbilligenden Blick zu. „Von keinem wird er so richtig ernst genommen, der Peter. Warum eigentlich? Ich finde ihn ganz sympathisch. Im Gegensatz zu seiner Frau.“ Isabella betrachtete Lisa Schraders verkniffenes Gesicht durch die Scheibe. „Passt ihr offensichtlich gar nicht, dass Peter mal im Mittelpunkt steht und sich dabei auch noch amüsiert.“
„Na ja ... Komm, lass uns wieder rausgehen“, meinte er.
„Muss noch Vater zurückrufen, der hat es heute schon drei Mal probiert. Sag ihnen, ich komme gleich. Hast du mal nach Fanny geschaut?“