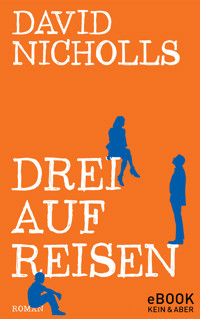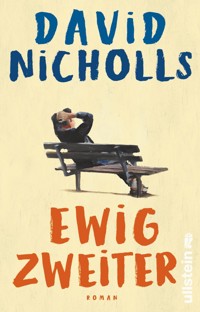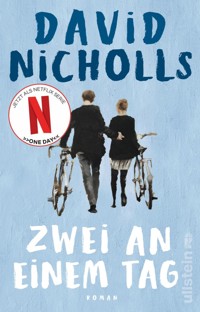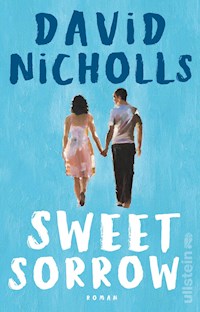10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nichts ist so verzweifelt-schön und so komisch wie die erste große Liebe. In seinem ersten Jahr auf der Uni verliebt sich der in allen Dingen lerneifrige Brian in die charismatische Alice. Ein Mann, ein Plan: Er wird an dem anspruchsvollen Fernsehquiz "The Challenge" teilnehmen, und so das Herz der Angebeteten erobern. Jeder weiß doch, Frauen bewundern Männer, die oft unnützes Wissen zur Schau stellen. Alice gefällt Brians tapsiger Charme. Sie selbst träumt von einer Karriere als Schauspielerin, doch sie sehnt sich nach echten Gefühlen. Kann Brian mit seiner Liebe die Leere in ihr füllen? "Eine bewegende, komische Liebesgeschichte." The Times "Herrlich albern, dabei unglaublich tiefsinnig." The Guardian "Selbstironisch, anrührend und mit einem Hang zu pointiertem Slapstick." Spiegel Online
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Keine weiteren Fragen
Der Autor
DAVID NICHOLLS, Jahrgang 1966, ist ausgebildeter Schauspieler, hat sich dann aber für das Schreiben entschieden. Mit seinem Roman »Zwei an einem Tag« gelang ihm der Durchbruch, seine Romane wurden in vierzig Sprachen übersetzt und verkauften sich weltweit über acht Millionen mal. 2014 wurde sein Roman »Drei auf Reisen« für den Man Booker Prize nominiert. Auch als Drehbuchautor ist David Nicholls überaus erfolgreich und mehrfach preisgekrönt, zuletzt erhielt er den BAFTA und eine Emmy-Nominierung für »Patrick Melrose«, seine Adaption der Romane von Edward St Aubyn, die als HBO-Serie Furore machte.Von David Nicholls sind in unserem Hause bereits erschienen: Keine weiteren Fragen · Ewig Zweiter · Zwei an einem Tag · Sweet Sorrow
David Nicholls
Keine weiteren Fragen
Roman
Aus dem Englischen von Ruth Keen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2021© 2003 by David NichollsCopyright der deutschen Übersetzung © 2005 Kein und Aber AG Zürich – BerlinCopyright der deutschen Ausgabe © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Titel der englischen Originalausgabe:Starter For Ten (Hodder & Stoughton, London)Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenTitelabbildung: © James Coates 2020Autorenfoto: joSon / Gallery StockE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-2400-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Erste Runde
1
2
3
4
5
6
7
8
Zweite Runde
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dritte Runde
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Vierte Runde
33
34
35
36
37
38
Die letzte Runde
39
40
41
42
Epilog
43
Anhang
Dank
Nachweis der Zitate
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Erste Runde
Widmung
Für Ann und Alan Nicholls.Und Hannah natürlich.
Erste Runde
Sie kannte den Typ Mann nur zu gut –die vage Hoffnung auf gesellschaftlichen Aufstieg,die geistige Unaufrichtigkeit, die äußerlicheVertrautheit mit Büchern.E.M. Forster, Howards End1
FRAGE: Der Stiefsohn von Robert Dudley und einstiger Günstling Elizabeths, der einen schlecht organisierten und fehlgeschlagenen Aufstand gegen die Königin führte und daraufhin im Jahr 1601 hingerichtet wurde, war der Earl of …?
ANTWORT: Essex.
Als Jugendlicher macht man sich ständig Sorgen um alles Mögliche, das gehört einfach zum Erwachsenwerden, und im Alter von sechzehn war meine größte Angst, dass ich nie wieder so was Gutes, Schönes, Edles und Wahres zustande bringen würde wie mein Abschlusszeugnis der zehnten Klasse.
Selbstverständlich habe ich damals kein Theater darum gemacht. Ich habe mir das Zeugnis nicht gerahmt oder sonst was Bescheuertes. Und ich will hier auch nicht die Noten einzeln aufzählen, denn dann wird es nur noch streberhafter, aber ich war eindeutig froh, sie zu haben: eine Qualifikation. Ich meine, man ist sechzehn und hat zum ersten Mal im Leben das Gefühl, überhaupt für irgendwas qualifiziert zu sein.
Das ist natürlich schon Ewigkeiten her. Mittlerweile bin ich achtzehn und bilde mir ein, die Dinge wesentlich reifer und cooler anzugehen. Deshalb war mein gutes Abitur keine Riesensache mehr. Außerdem finde ich die Vorstellung, Intelligenz ließe sich durch ein lächerliches, antiquiertes System schriftlicher Prüfungen irgendwie messen, eindeutig überholt. Aber davon mal abgesehen waren es die besten Ergebnisse des Jahrgangs 1985 an der Langley-Street-Gesamtschule. Und übrigens die besten seit fünfzehn Jahren. Drei Einsen und eine Zwei, also 19 Punkte – na schön, jetzt ist es raus –, aber ich glaube ehrlich nicht, wirklich, dass es eine besonders große Rolle spielt, ich erwähne es nur nebenbei. Was zählt es schon, ein Haufen Zeugs zu wissen, im Vergleich zu anderen Eigenschaften wie echtem, sportlichem Mut, Beliebtheit, gutem Aussehen, reiner Haut oder einem aktiven Sexleben zum Beispiel.
Aber wie mein Vater immer sagte, das A und O einer guten Ausbildung sind die Möglichkeiten, die sie einem bietet, die Türen, die sie einem öffnet, denn ansonsten ist Wissen, an und für sich, bloß eine Sackgasse – besonders wenn man hier wie ich an einem Mittwochnachmittag Ende September in einer Fabrik hockt, die Toaster herstellt.
Ich habe die Ferien über in der Versandabteilung von Ashworth Electricals gejobbt. Genauer gesagt bin ich dafür zuständig, die Toaster in Kartons zu packen, bevor sie an die Einzelhändler rausgehen. Es gibt aber nun mal nur soundso viele Methoden, wie man einen Toaster in einen Karton tun kann, darum waren es insgesamt eher zwei ziemlich öde Monate. Aber auf der Habenseite waren es £ 1.85 die Stunde, also nicht schlecht – und so viel Toast, wie man essen kann. Da heute mein letzter Tag hier ist, habe ich ein bisschen nach der heimlich herumgereichten Abschiedskarte geschielt und nach der konspirativen Sammlung für ein kleines Geschenk und habe darauf gewartet, dass mir mitgeteilt wird, in welche Kneipe wir nachher ziehen, um noch ein paar Biere auf mein Wohl zu trinken. Aber mittlerweile ist es Viertel nach sechs, und ich kann wohl ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie einfach alle nach Hause gegangen sind.
Auch egal, denn ich hatte eh was anderes vor, darum sammle ich meine Sachen zusammen, greife mir ein paar Kugelschreiber und eine Rolle Tesafilm aus dem Schrank mit den Büromaterialien und mache mich Richtung Pier auf, wo ich mit Spencer und Tone verabredet bin.
Mit seinen 2360 Yards beziehungsweise 2158 Metern ist der Pier von Southend offiziell der längste der Welt. Ehrlich gesagt ist er fast ein bisschen zu lang, besonders dann, wenn man jede Menge Bier dabeihat. Es sind zwölf große Büchsen Skol, dazu Schweinefleisch süß-sauer, Nasi Goreng und eine Portion Pommes mit Currysauce – Köstlichkeiten aus aller Welt. Als wir endlich an der anderen Seite des Piers ankommen, ist das Bier warm und das Essen kalt. Außerdem musste Tone, da das hier eine Feier aus besonderem Anlass ist, unbedingt noch seinen Ghettoblaster von den Ausmaßen eines kleinen Kleiderschranks mitschleppen, der höchstwahrscheinlich nie ein Ghetto blasten wird, es sei denn, man erkennt Shoeburyness als Ghetto an. Im Moment spielt er gerade Tones persönlichen Best of the The Zep-Zusammenschnitt, während wir eine Bank am Ende des Piers in Beschlag nehmen und zusehen, wie die Sonne majestätisch hinter der Ölraffinerie versinkt.
»Du verwandelst dich doch nicht in einen Pisser, oder?«, fragt Tone und öffnet ein Bier.
»Wie meinst du das?«
»Er meint, ob du uns gegenüber jetzt den Studenten raushängen lässt«, erklärt Spencer.
»Na ja, ich bin Student. Beziehungsweise, ich werde einer sein, darum …«
»Nein, ich hab gemeint, ob du jetzt vielleicht ein Schnösel wirst und ›Sie mich auch‹ sagst und in den Weihnachtsferien in einer Robe nach Hause kommst und nur noch Latein laberst und Sachen wie ›in der Tat‹ sagst und ›gehe ich recht in der Annahme‹ und so was …«
»Klar, Tone, genau das hab ich vor.«
»Also lass es. Weil du jetzt schon Wichser genug bist und nicht noch mehr Wichser werden musst.«
Tone nennt mich oft »Wichser« – »Wichser« oder »Gnädigste«, aber mein Trick ist, eine Art linguistische Angleichung vorzunehmen und es mir als Kosewort vorzustellen, so wie manche Pärchen »Schatz« oder »Liebling« zueinander sagen. Tone hat gerade im Warenlager von Currys zu arbeiten angefangen und baut sich langsam einen hübschen kleinen Nebenerwerb mit geklauten tragbaren Hi-Fis auf, wie zum Beispiel dem Ding hier, das wir dabeihaben. Auch das Led-Zeppelin-Tape ist seins; Tone bezeichnet sich gern als »Metaller«, was professioneller klingt als »Rocker« oder »Heavy-Metal-Fan«. Er zieht sich auch an wie ein Metaller; lauter hellblauer Jeansstoff und langes, nach hinten gekämmtes, glänzend blondes Haar, wie ein verweichlichter Wikinger. Allerdings ist Tones Haar das Einzige, was an ihm verweichlicht ist. Denn dieser Mann ist durchdrungen von brutaler Gewalt. Eine Kneipentour mit Tone hat man erfolgreich überstanden, wenn man wieder nach Hause kommt, ohne dass er einem den Kopf ins Klo gedrückt und gespült hat.
Jetzt läuft Stairway to Heaven.
»Müssen wir uns eigentlich diesen grauenhaften Hippie-Scheiß anhören, Tone?«, sagt Spencer.
»Das sind The Zep, Spence.«
»Ich weiß, dass es The Zep sind, Tone, darum will ich ja, dass du das verdammte Ding ausmachst.«
»Aber The Zep sind die größten.«
»Wieso? Nur weil du es sagst?«
»Nein, weil sie eine wahnsinnig einflussreiche und wichtige Band waren.«
»Sie singen von Kobolden, Tony. Das ist peinlich …«
»Nicht von Kobolden …«
»Dann eben Elfen«, sage ich.
»Es geht doch nicht bloß um Kobolde und Elfen, das ist Tolkien, das ist Literatur …« Tone ist von solchem Zeug begeistert, von Büchern, in denen eine Karte drin ist, oder von Titelbildern mit großen, angsteinflößenden Frauen in Kettenpanzer-Unterwäsche und mit einem Breitschwert in der Hand – die Art von Frau, die er in einer idealen Welt heiraten würde. Was in Southend übrigens viel wahrscheinlicher ist, als man denkt.
»Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Kobold und einer Elfe?«, fragt Spencer.
»Keine Ahnung. Frag Jackson, der ist das Arschloch mit dem Superabschluss.«
»Ich weiß es nicht, Tone.«
Das Gitarrensolo hat eingesetzt, und Spencer verzieht schmerzhaft das Gesicht. »Nimmt es irgendwann mal ein Ende, oder geht es immer weiter und weiter und weiter …«
»Das sind sieben Minuten und zweiunddreißig Sekunden pure Genialität.«
»Pure Folter«, sage ich. »Warum hören wir eigentlich immer, was du aussuchst?«
»Weil es mein Ghettoblaster ist …«
»Den du beiseite geschafft hast. Genau genommen gehört er immer noch Currys.«
»Ja, aber ich kaufe auch die Batterien.«
»Nein, du klaust die Batterien …«
»Diese nicht, die hab ich gekauft.«
»Und, was haben sie gekostet?«
»Ein Pfund achtundneunzig.«
»Wenn ich dir also sechsundsechzig Pence gebe, können wir dann was Anständiges hören?«
»Was denn, Kate Bush vielleicht? Na schön, Jackson, dann legen wir ein bisschen Kate Bush auf und singen alle mit bei Kate Bush und reichen uns die Händchen und tanzen Ringelreihen zu Kate Bush …« Während Tone und ich uns zanken, beugt sich Spencer zum Ghettoblaster runter, drückt lässig auf »Eject« und wirft The Best of The Zep im hohen Bogen ins offene Meer.
»Ey!«, schreit Tone und schmeißt seine Bierdose nach ihm, und sie rennen beide den Pier hinunter. Es ist besser, wenn man sich bei diesen Streiterein raushält. Tone hat die Angewohnheit, etwas außer Kontrolle zu geraten, wird vom Geiste Odins geritten oder so was, und wenn ich mich einmische, endet es unweigerlich damit, dass Spence auf meinen Armen sitzt, während Tone mir ins Gesicht pupst, darum bleibe ich einfach still sitzen, trinke mein Bier und sehe zu, wie Tone versucht, Spencers Beine über das Geländer vom Pier zu hieven.
Obwohl wir September haben, liegt eine erste feuchte Kälte in der Abendluft, eine Vorahnung, dass der Sommer zu Ende geht, und ich bin froh um meinen Mantel aus dem Army-Restpostenladen. Ich konnte den Sommer noch nie leiden; ich mag nicht, wie die Sonne am Nachmittag auf den Fernsehbildschirm knallt, und dann dieser gnadenlose Druck, T-Shirts und Shorts zu tragen. Ich hasse T-Shirts und Shorts. Würde ich in T-Shirt und Shorts vor einer Apotheke stehen, käme garantiert ein altes Ömchen an und würde versuchen, mir eine Münze in den Scheitel zu stecken.
Nein, ich freue mich richtig auf den Herbst, durch raschelndes Laub zu einer Vorlesung zu laufen und mich mit einem Mädchen namens Emily oder Katherine oder Françoise in dicken schwarzen Strumpfhosen und einem Louise-Brooks-Bubikopf angeregt über die Metaphysischen Dichter zu unterhalten und dann mit ihr in ihre kleine Dachkammer zu gehen und vor dem elektrischen Kaminfeuer miteinander zu schlafen. Hinterher lesen wir uns gegenseitig T.S. Eliot vor, trinken guten alten Port aus winzigen Gläschen und hören Miles Davis dazu. So jedenfalls stelle ich mir das vor. Das Uni-Erlebnis. Ich mag das Wort Erlebnis, es klingt so schön nach Karussellfahrt auf dem Rummelplatz.
Der Kampf ist vorbei, und Tone arbeitet seine überschüssigen Aggressionen ab, indem er süß-saure Fleischbällchen nach Möwen schmeißt. Spencer kommt langsam zurückgelaufen, stopft sich sein Hemd in die Hose, setzt sich neben mich und öffnet ein neues Bier. Er hat ein ganz spezielles Händchen für Bierdosen; wenn man ihm so zusieht, könnte man meinen, er trinke aus einem Martiniglas.
Spencer wird mir von allen am meisten fehlen. Er geht nicht zur Uni, obwohl er mit Abstand der schlauste Mensch ist, den ich kenne, außerdem der hübscheste, härteste und coolste. Das sage ich ihm natürlich alles nicht, weil es nur peinlich klingen würde, aber es ist auch gar nicht nötig, weil er es sowieso weiß. Er hätte studieren können, wenn er wirklich gewollt hätte, aber er hat seinen Abschluss in den Sand gesetzt; nicht direkt absichtlich, aber man konnte ihm praktisch dabei zusehen. Während der Englischprüfung hat er am Tisch neben mir gesessen, und an den Bewegungen seines Stifts war zu erkennen, dass er nicht geschrieben, sondern gezeichnet hat. Bei der Frage über Shakespeare hat er Die fröhlichen Weiber von Windsor gemalt, bei der Lyrikfrage ein Bild mit dem Titel Wilfred Owen erlebt aus nächster Nähe den Schrecken der Schützengräben. Ich hab andauernd versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen und ihm einen freundlichen Blick mit der Botschaft »Hey Kumpel, reiß dich zusammen!« zuzuwerfen, aber er hat die ganze Zeit nach unten geguckt, ununterbrochen vor sich hin gezeichnet, und nach einer Stunde ist er dann aufgestanden und gegangen. Vorher hat er mir noch zugezwinkert; kein freches, sondern eher so ein tränennahes Zwinkern aus rotgeränderten Augen, wie ein tapferer Tommy auf dem Weg zum Erschießungskommando.
Danach ist er einfach nicht mehr zu den Prüfungen erschienen. Das Wort »Nervenzusammenbruch« fiel einige Male, wenn er nicht dabei war, aber Spencer ist viel zu cool, als dass er einen Nervenzusammenbruch gehabt haben könnte. Oder falls doch, würde er einen Nervenzusammenbruch cool aussehen lassen. Wie ich die Sache einschätze, ist diese ganze Jack-Kerouac-, qualvolle Existenz-Kiste bis zu einem bestimmten Punkt okay, aber nicht, wenn sie deine Zensuren vermasselt.
»Also, was wirst du machen, Spence?«
Er kneift die Augen zusammen und schaut mich an. »Was meinst du mit ›machen‹?«
»Du weißt schon. Jobmäßig.«
»Ich habe einen Job.« Spencer geht stempeln, arbeitet aber außerdem schwarz in einer rund um die Uhr geöffneten Tankstelle auf der A127.
»Ich weiß, dass du einen Job hast. Ich meine in Zukunft …«
Spencer schaut über die Flussmündung hinaus und ich bereue schon, das Thema angeschnitten zu haben.
»Dein Problem, lieber Brian, du unterschätzt den Reiz, den das Leben in einer 24-Stunden-Tankstelle bietet. So viele Süßigkeiten, wie ich essen will. Straßenkarten zum Lesen. Interessante Dämpfe zum Einatmen. Gratis-Weingläsersets …« Er nimmt einen großen Schluck Bier und überlegt, wie er das Thema wechseln könnte. Dann greift er in seine Harringtonjacke und gibt mir eine Musikkassette mit einer handgeschriebenen Karte: »Hab ich dir aufgenommen. Die kannst du deinen neuen Universitätsfreunden vorspielen und so tun, als hättest du Geschmack.«
Ich nehme die Kassette, auf deren Rücken Brians College-Collage steht, in sorgfältig ausgeführten 3-D-Großbuchstaben. Spencer kann unglaublich gut zeichnen.
»Fantastisch, Spencer, vielen Dank, Kumpel …«
»Schon gut, Jackson, es ist ja nur ein Tape für neunundsechzig Pence aus dem Supermarkt, da muss man nicht gleich flennen.« Sagt er, aber wir wissen beide, dass ein Neunzig-Minuten-Zusammenschnitt gute drei Stunden Arbeit bedeutet, und noch mehr, wenn man eine Karte dazu entwirft. »Leg’s ein, ja? Bevor der Trottel zurückkommt.«
Ich lege die Kassette ein, drücke auf »Play«, und schon singt Curtis Mayfield Move On Up. Spencer war mal Mod, hat dann aber zu klassischem Soul gewechselt – Al Green, Gil Scott-Heron, die Richtung. Spencer ist so cool, dass er sogar Jazz mag. Und nicht bloß Sade und The Style Council; nein, richtigen Jazz, das nervige, langweilige Zeug. Wir sitzen da und hören eine Weile zu. Tone versucht gerade, Geld aus dem Teleskop herauszufummeln, mit dem Schnappmesser, das er sich auf unserem Schulausflug nach Calais gekauft hat. Spencer und ich sehen ihm zu wie nachsichtige Eltern eines stark verhaltensgestörten Kindes.
»Und, kommst du mal am Wochenende nach Hause?«, fragt Spencer.
»Ich weiß nicht. Ich denke, schon. Nicht jedes.«
»Sieh mal zu, dass du’s schaffst, ja? Sonst hab ich hier Conan den Barbaren ganz alleine an der Backe …«, Spencer nickt in Tones Richtung, der jetzt Anlauf nimmt und das Teleskop mit Dropkicks bearbeitet.
»Sollten wir nicht irgendwie anstoßen oder so was?«, frage ich.
Spencer kräuselt die Lippen. »Anstoßen? Worauf?«
»Na ja – auf die Zukunft vielleicht?«
Spencer seufzt und tippt mit seiner Bierdose an meine. »Auf die Zukunft. Möge sie dir eine reine Haut bescheren.«
»Verpiss dich, Spencer.«
»Verpiss dich, Brian«, sagt er, lacht aber.
Bei unseren letzten Bieren sind wir ziemlich betrunken, legen uns flach auf den Rücken und sagen gar nichts, hören nur das Meer und Otis Redding, der Try a little Tenderness singt. In dieser klaren Spätsommernacht, als ich, flankiert von meinen besten Kumpels, in die Sterne gucke, fühlt es sich an, als würde das wahre Leben endlich beginnen und einfach alles möglich sein.
Ich möchte Aufnahmen von Klaviersonaten hören können und wissen, wer spielt. Ich möchte klassische Konzerte besuchen und wissen, an welcher Stelle man klatscht. Ich möchte in der Lage sein, modernen Jazz zu kapieren, ohne dass er sich wie so ein grauenhafter Fehler anhört, und ich möchte wissen, wer die Velvet Underground eigentlich genau sind. Ich möchte vollkommen in die Welt der Ideen eintauchen, ich möchte komplexe ökonomische Zusammenhänge begreifen und wissen, was die Leute an Bob Dylan finden. Ich möchte radikale, aber humane und fundierte politische Ideale haben, und ich möchte an runden Holzküchentischen sitzen und leidenschaftlich, aber sachlich diskutieren und Sachen sagen wie: »Definier erst mal Ausbeutung!« und »Das ist ein Scheinargument!«, bis man dann plötzlich merkt, dass es draußen schon hell geworden ist und wir die ganze Nacht geredet haben. Ich möchte, dass mir Wörter wie »eponym« und »solipsistisch« und »utilitaristisch« ganz selbstverständlich von den Lippen gehen. Ich möchte lernen, Geschmack an Jahrgangsweinen zu finden, an ausgefallenen Likören und einem guten Single Malt, und lernen, wie man so was trinkt, ohne mich in einen totalen Schnösel zu verwandeln. Ich möchte fremde und exotische Gerichte essen, Wachteleier und Hummer Thermidor – Dinge, die kaum genießbar klingen oder die ich nicht mal aussprechen kann. Ich möchte mit schönen, weltgewandten, einschüchternden Frauen schlafen, am Tag oder sogar mit Licht an, und dabei nüchtern und angstfrei sein; und ich möchte viele Sprachen fließend sprechen können, vielleicht auch noch die eine oder andere tote Sprache beherrschen, und ein Heft mit Ledereinband bei mir führen, in dem ich mir scharfsinnige Gedanken und Beobachtungen notiere und gelegentlich eine Verszeile. Vor allem aber möchte ich Bücher lesen; dicke, fette Schwarten, ledergebundene Bücher aus unglaublich dünnem Papier und mit diesem lila Bändchen, das man als Lesezeichen benutzt; billige, stockfleckige, antiquarische Lyrik-Anthologien oder sündhaft teure, importierte Bücher mit unverständlichen Essaysammlungen ausländischer Universitäten.
Und dann möchte ich irgendwann eine originelle Idee haben. Und ich möchte gemocht, vielleicht sogar geliebt werden. Doch da schauen wir mal, was kommt. Und in Sachen Job weiß ich noch nicht genau, was ich tun will, aber es muss ein Job sein, den ich nicht verabscheue, der mich nicht krank macht und der nicht beinhaltet, dass ich mir die ganze Zeit Sorgen um Geld machen muss. Und genau das sind die Dinge, die mir eine Universitätsausbildung ermöglichen wird.
Wir machen das Bier alle, und dann artet es ein bisschen aus. Tone schmeißt meine Schuhe ins Meer, und ich muss auf Socken nach Hause laufen.
2
FRAGE: In welchem Film von Powell und Pressburger – frei nach der Geschichte von Hans Christian Andersen – tanzt sich Moira Shearer vor einer Dampflokomotive zu Tode?
ANTWORT: Die roten Schuhe.
Archer Road Nummer 16 ist wie alle anderen Häuser auf der Archer Road eine Maisonette; das ist die Diminutivform des französischen Substantivs (femininum) maison und bedeutet wörtlich »kleines Haus«. Hier wohne ich mit meiner Mum, und wenn man sich eine so richtig ungünstige Wohnsituation vorstellen will, dann sind ein achtzehnjähriger Junge und eine einundvierzigjährige Frau in einer Maisonette eigentlich unschlagbar. Der heutige Morgen wäre da mal wieder ein gutes Beispiel. Es ist halb neun, ich liege unter der Bettdecke, höre The Breakfast Show und gucke die Flugzeugmodelle an, die von der Decke baumeln. Ich weiß, ich hätte sie abnehmen sollen, aber irgendwann vor ein paar Jahren haben sie den Übergang von rührendkleinjungenhaft zu komisch-kitschig gemacht, darum habe ich sie hängen lassen.
Mum kommt rein und klopft dann.
»Morgen, Schlafmütze. Heute ist dein großer Tag!«
»Warum klopfst du nie an, Mum?«
»Ich klopf doch an!«
»Nein, du kommst rein und klopfst dann an. Das ist nicht Anklopfen …«
»Na und? Du machst da doch nichts, oder?«, sagt sie anzüglich.
»Nein, aber …«
»Sag bloß, du hast ein Mädchen bei dir«, und sie zupft an der Bettdecke. »Komm raus, Kleine, nur nicht so schüchtern, lass uns drüber reden. Komm raus, komm raus, wer immer du bist …«
Ich reiße ihr die Decke weg und ziehe sie mir über den Kopf.
»Ich komm gleich runter …«
»Es riecht hier richtig streng, weißt du das?«
»Kann dich nicht hören, Mum …«
»Riecht nach Jungs. Was macht ihr Jungs eigentlich, dass es immer so riecht?«
»Umso besser, dass ich weggehe, oder?«
»Wann fährt dein Zug?«
»Viertel nach zwölf.«
»Wieso bist du dann noch im Bett? Hier, ein Abschiedsgeschenk für dich …«, und sie wirft eine Einkaufstüte auf den Bettüberwurf. Ich mache sie auf; es ist eine durchsichtige Plastikröhre drin, wie man sie für Tennisbälle verwendet, nur enthält diese drei zusammengeknüllte Baumwoll-Herrenslips in Rot, Weiß und Schwarz, den Farben der Naziflagge.
»Mum, das hättest du doch nicht …«
»Ach, es ist ja nur ’ne Kleinigkeit.«
»Nein, ich meine, ich wünschte, du hättest es wirklich sein lassen.«
»Werd nicht frech, junger Mann. Steh lieber auf. Du musst ja noch packen. Und öffne bitte das Fenster.«
Nachdem sie weg ist, schüttle ich die Unterhosen aus der Plastikröhre auf die Bettdecke und genieße die symbolhafte Feierlichkeit dieses Anlasses. Denn das sind jetzt echt Die Letzten Unterhosen, Die Mir Meine Mutter Im Leben Gekauft Hat. Die weißen sind okay, und ich sehe ein, dass die schwarzen eine gewisse Haltbarkeit versprechen, aber Rot? Sollen die irgendwie feurig wirken oder was? Meiner Meinung nach schreien rote Unterhosen »Stopp!« und »Gefahr!«.
Aber in einer Anwandlung von Mut und Abenteuer stehe ich auf und schlüpfe in die roten Unterhosen. Was ist, wenn sie wie Die roten Schuhe sind und ich sie nie wieder ausziehen kann? Was ich nicht hoffe, denn als ich den Gesamteffekt im Spiegel des Kleiderschranks überprüfe, sehe ich aus, als hätte man mir in die Lenden geschossen. Ich ziehe dann trotzdem die Hosen von gestern Abend drüber, und mit pelzigen Zähnen, süß-saurem Mundgeruch und einem immer noch leicht flauen Gefühl in der Magengrube vom Skol am Vorabend gehe ich nach unten zum Frühstück. Danach werde ich ein Bad nehmen, packen, fahren und fertig. Ich kann es nicht fassen, dass ich tatsächlich hier weggehe. Ich kann es nicht fassen, dass man mich lässt.
Aber natürlich ist die große Herausforderung des Tages noch zu packen, aus dem Haus zu gehen und in den Zug zu steigen, ohne dass Mum sagt: »Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen.«
Ein Dienstagabend im Juli, draußen ist es noch hell, und die Gardinen sind halb zugezogen, damit wir das Fernsehbild erkennen können. Ich habe schon gebadet und bin in Pyjama und Bademantel, rieche leicht nach Dettol und konzentriere mich auf meinen Lancaster-Bomber von Airfix im Maßstab 1:72, den ich auf einem Tablett vor mir zusammenbaue. Dad ist gerade von der Arbeit gekommen, er trinkt ein Bitter aus der Dose, und der Rauch seiner Zigarette hängt im Abendlicht.
»Hier kommt Ihre Startfrage: Welcher britische Monarch war der Letzte, der selbst noch auf dem Schlachtfeld kämpfte?«
»George V.«, sagt Dad.
»George III.«, sagt Wheeler vom Jesus College, Cambridge.
»Korrekt. Ihre Bonusrunde beginnt mit einer Frage in Geologie.«
»Verstehst du was von Geologie, Bri?«
»Ein bisschen«, behaupte ich kühn.
»Im Aussehen kristallin oder gläsern, welche der drei wichtigsten Gesteinsklassen entsteht durch Abkühlung und Erstarrung geschmolzener Erdmassen?«
Ich weiß es, ich weiß es ganz sicher. »Vulkangestein!«, rufe ich.
»Magmagestein«, sagt Armstrong vom Jesus College, Cambridge.
»Korrekt.«
»Fast«, sagt Dad.
»Welche Struktur weist Magmagestein, das große auffällige, Phenocryst genannte Kristalle enthält, auf?«
Einfach raten. »Gekörnt«, sage ich.
Johnson, Jesus College, Cambridge, sagt: »Porphyr?«
»Korrekt.«
»Fast«, sagt Dad.
»Von welchem viktorianischen Dichter ist das narrative Gedicht Porphyria’s Lover, in dem der Protagonist seine Geliebte mit einer Strähne ihres Haars erwürgt …« – halt mal, das weiß ich jetzt wirklich – Robert Browning. Haben wir letzte Woche in Englisch durchgenommen. Es ist Browning, ich weiß es.
»Robert Browning!«, sage ich und versuche, nicht zu schreien.
»Robert Browning?«, sagt Armstrong, Jesus College, Cambridge.
»Korrekt!«, und es gibt Applaus von den Studio-Zuschauern, aber wir wissen beide, dass der Applaus in Wirklichkeit mir gilt.
»Scheiße, Bri, wie hast du das gewusst?«, fragt Dad.
»Ich weiß es einfach.« Ich möchte mich umdrehen und sein Gesicht sehen, sehen, ob er lächelt – er lächelt nicht oft, jedenfalls nicht nach der Arbeit –, aber ich will nicht selbstgefällig wirken, darum halte ich einfach still und beobachte sein sonnenbeschienenes Spiegelbild im Fernsehbildschirm. Er zieht an seiner Kippe, dann legt er mir sanft seine Zigarettenhand auf den Kopf, wie ein Kardinal, glättet mir das Haar mit den langen, gelben Fingerspitzen und meint:
»Wenn du nicht aufpasst, sitzt du eines Tages auch mal da«, und ich lächle in mich hinein und komme mir klug und schlau vor und habe das Gefühl, zur Abwechslung mal was richtig gemacht zu haben.
Natürlich werde ich dann übermütig und versuche, jede Frage zu beantworten und beantworte alle falsch, aber es macht nichts, denn ich habe endlich was richtig gemacht, und ich weiß, eines Tages werde ich es wieder richtig machen.
Ich glaube, ich kann sagen, dass ich mich nie irgendwelchen Modeerscheinungen unterworfen habe. Ich bin nicht anti-Mode, das nicht, nur hat von allen wichtigen Strömungen, die ich bisher miterlebt habe, keine richtig zu mir gepasst. Unterm Strich sieht die knallharte Realität so aus, dass für einen Fan von Kate Bush, Charles Dickens, Scrabble, David Attenborough und University Challenge nicht allzu viel drin ist, was junge Modetrends angeht.
Was nicht heißt, dass ich’s nicht versucht hätte. Eine Zeit lang habe ich ständig wachgelegen und mir Sorgen gemacht, dass ich vielleicht Grufti sein könnte, aber ich glaube, es war nur eine Phase. Außerdem bedeutet ein männlicher Grufti zu sein, sich mehr oder weniger wie ein aristokratischer Vampir zu kleiden, und wenn ich in einem Aufzug nie überzeugen werde, dann als aristokratischer Vampir. Mir fehlen einfach die Wangenknochen dafür. Und als Grufti muss man deren Musik hören, und die ist das Letzte.
Das war so ziemlich mein einziger Abstecher in Richtung Mode. Ich denke, mein ganz persönlicher Stil lässt sich am besten als leger, aber klassisch bezeichnen. Ich trage lieber Baumwoll-Bundfaltenhosen als Jeans, dann aber lieber dunkle Jeans als helle. Mäntel sollten schwer und lang und der Kragen hochgeschlagen sein, Schals leicht gefranst und schwarz oder weinrot, und beides gehört von Anfang September bis Ende Mai unbedingt dazu. Schuhe müssen dünne Sohlen haben und dürfen nicht zu spitz sein, und zu Jeans (das ist jetzt sehr wichtig) gehen nur schwarze oder braune Schuhe.
Andererseits habe ich auch keine Angst vor Experimenten, besonders jetzt nicht, da ich die Chance habe, mir eine neue Persönlichkeit zuzulegen. Darum liegt der alte Koffer von Mum und Dad offen vor mir auf dem Bett, und ich begutachte ein paar von den Neuerwerbungen, die ich mir für diesen besonderen Tag aufgehoben habe. Ganz oben auf der Liste steht meine neue Donkey Jacke, ein unglaublich dickes, schweres schwarzes Ding, das sich tatsächlich ein bisschen so anfühlt, als hätte man sich einen Esel über die Schulter geworfen. Sie ist genial, auch wegen der unterschwelligen Mischung aus Bohème und harter Knochenarbeit, die sie ausstrahlt – »genug über Shelly gequatscht, ich muss los, die Straße teeren«.
Dann sind da die fünf Altmännerhemden in ausgewählten Weiß- und Blautönen, die ich für £ 1.99 das Stück auf einer Tagestour mit Tone und Spencer in der Carnaby Street ergattert habe. Spencer hasst sie, aber ich finde sie toll, besonders zusammen mit der schwarzen Weste, die ich bei Help The Aged für drei Pfund gebraucht gekauft habe. Ich musste die Weste vor Mum verstecken, nicht weil sie grundsätzlich was gegen Wohltätigkeit für alte Leute hat, sondern weil sie meint, Sachen aus zweiter Hand zu kaufen sei total niveaulos, und danach wäre es nur noch ein kleiner Schritt, bis man sich aus der Mülltonne ernährt. Ich strebe mit der Kombination aus Weste/Altmännerhemd/Omabrille die äußere Erscheinung eines jungen, stotternden Offiziers mit Kriegsneurose und einem Notizbuch voller Gedichte an, der vorzeitig von der Front mit all ihren Abscheulichkeiten entlassen wurde, aber dennoch seine patriotische Pflicht erfüllt, indem er in einem entlegenen Dorf in Gloucestershire auf einem Gutshof arbeitet, wo ihm die Einheimischen mit schroffem Misstrauen begegnen, er aber heimlich und aus der Ferne von der schönen Tochter des Vikars geliebt wird, die ein Bücherwurm und bisexuelle Vegetarierin ist und sich für Frauenrechte und Pazifismus engagiert. Es ist wirklich eine tolle Weste. Und außerdem ist sie nicht gebraucht gekauft, sondern klassisch.
Dann ist da das braune Cordjackett von Dad. Ich lege es flach aufs Bett und falte die Ärmel sorgfältig über Kreuz vor der Brust. Vorne drauf ist ein blasser Teefleck von vor zwei Jahren, als ich den Fehler machte, es während einer Schulparty zu tragen. Ich weiß, das könnte man für ein bisschen morbide halten, aber ich dachte, es wäre vielleicht eine nette Geste, eine Art Tribut. Wahrscheinlich hätte ich aber Mum vorher fragen sollen, denn als sie mich in Dads Jacke vor dem Spiegel stehen sah, hat sie geschrien und ihre Teetasse nach mir geworfen. Als ihr schließlich klar wurde, dass das bloß ich war, ist sie in Tränen ausgebrochen und lag dann eine halbe Stunde heulend auf dem Bett, was einen übrigens irrsinnig in Partystimmung bringt. Und als sie sich beruhigt hatte und ich endlich zur Disco gehen konnte, gab es folgende Unterhaltung zwischen mir und meiner damaligen großen Liebe der Woche, Janet Parks, die ich zu einem langsamen Tanz aufforderte.
ICH: Wollen wir, Janet?
JANET PARKS: Schöne Jacke, Bri.
ICH: Danke!
JANET PARKS: Wo hast du sie her?
ICH: Sie gehört meinem Dad!
JANET PARKS: Aber ist dein Dad nicht …
tot
?
ICH: Stimmt!
JANET PARKS: Du trägst die Jacke von deinem toten Dad?
ICH: Genau. Was ist jetzt mit unserem Tanz?
… und da hat sich Janet den Mund zugehalten und ist ganz, ganz langsam weggegangen und hat angefangen, mit dem Finger auf mich zu zeigen und in der Ecke mit Michelle Thomas und Sam Dobson zu flüstern, und danach hat sie dann mit Spencer Lewis rumgemacht. Nicht dass ich ihr das noch nachtrage oder so. Außerdem werden an der Uni solche Vorgeschichten keine Rolle spielen. Keiner weiß von der Sache außer mir. An der Uni wird es einfach nur ein schönes Cordjackett sein. Ich falte es zusammen und lege es in den Koffer.
Mum kommt herein, klopft dann, und ich schließe schnell den Koffer. Sie sieht jetzt schon aus, als wäre sie den Tränen nahe, dafür brauchen wir nicht auch noch Dads Jacke. Immerhin hat sie sich extra den Vormittag zum Weinen freigenommen.
»Na, bist du so weit?«
»Fast.«
»Möchtest du eine Friteuse mitnehmen?«
»Nein, ich komm gut ohne klar, Mum.«
»Aber was wirst du essen?«
»Ich ess auch noch andere Sachen außer Pommes!«
»Stimmt doch gar nicht.«
»Na, vielleicht fang ich jetzt damit an. Außerdem gibt’s ja auch die Sorte Pommes, die man im Herd erhitzen kann.« Ich drehe mich zu ihr um und sehe, dass sie beinahe lächelt.
»Solltest du nicht langsam los?« Der Zug fährt erst in Jahrzehnten, aber Mum glaubt, einen Zug zu kriegen, ist ein bisschen wie eine internationale Flugreise, bei der man vier Stunden vor Abfahrt einchecken muss. Nicht dass wir je geflogen sind oder so, aber trotzdem, es ist ein Wunder, dass sie mich nicht noch zum Impfen losgeschickt hat.
»Ich geh in einer halben Stunde«, sage ich, und es folgt ein Schweigen. Mum sagt etwas, kriegt aber die Worte nicht richtig raus, also war es wahrscheinlich irgendwas in der Richtung, dass Dad jetzt stolz auf mich wäre, aber sie beschließt, es für später aufzuheben, und geht wieder raus. Ich setze mich auf den Koffer, damit er richtig zugeht, lege mich dann aufs Bett und sehe mich zum letzten Mal in meinem Zimmer um – ein Moment, in dem ich eine rauchen würde, wenn ich rauchen würde.
Ich kann nicht fassen, dass es jetzt tatsächlich wahr werden soll. So fühlt es sich also an, das freie Erwachsenenleben. Sollte es nicht irgendein Ritual geben? Bei bestimmten entlegenen afrikanischen Stämmen würden sie jetzt ein unglaubliches, vier Tage dauerndes Initiationsritual feiern, mit Tätowierungen und starken halluzinogenen Drogen aus Laubfrosch-Extrakt und Dorfältesten, die mir den Leib mit Affenblut einschmieren, aber bei diesem Übergangsritus hier dreht sich alles um drei Paar Unterhosen und darum, dass man sein Bettzeug in einen schwarzen Müllsack stopft.
Als ich nach unten gehe, stelle ich fest, dass Mum mir ein Paket zurechtgemacht hat, zwei große Kartoffelchipskartons, die den überwiegenden Teil unseres Hausrats enthalten. Natürlich ist die Friteuse drin, raffiniert unter einem kompletten Tafelservice versteckt, der Toaster, den ich bei Ashworth Electricals geklaut habe, ein Wasserkessel, ein Kochbuch mit dem Titel Gaumenfreuden mit Minze und ein Brotkasten mitsamt sechs pappigen Sandwichbrötchen und einem Laib Mighty-White-Toastbrot. Es ist sogar eine Käseraspel dabei, obwohl sie genau weiß, dass ich keinen Käse esse. »Ich kann das unmöglich alles mitschleppen, Mum«, sage ich, und so vergehen die einschneidenden und bewegenden letzten Augenblicke meines Lebens im Haus meiner Kindheit mit einem Streit darüber, ob ich einen Schneebesen brauche … – und ja, es wird einen Grill in der Backröhre geben, wo man Toast machen kann, ja, ich brauch den Plattenspieler und die Boxen –, und als die Verhandlungen endlich abgeschlossen sind, haben wir mein Gepäck auf einen Koffer, einen Rucksack mit meiner Anlage und meinen Büchern, zwei Müllsäcke mit Bettdecke und Kopfkissen und, weil Mum darauf besteht, eine Unmenge Geschirrtücher reduziert.
Endlich ist es an der Zeit. Ich lehne es strikt ab, mich von Mum zum Bahnhof begleiten zu lassen, weil es so irgendwie bedeutender und symbolischer ist. Ich stehe in der Tür, während sie ihr Portemonnaie holt und mir feierlich eine ganz klein zusammengefaltete Zehn-Pfundnote in die Hand drückt, wie einen Rubin.
»Mum …«
»Nun komm schon, nimm.«
»Ich hab genug, wirklich …«
»Na los. Pass auf dich auf …«
»Mach ich …«
»Versuch hin und wieder mal ein frisches Stück Obst zu essen …«
»Ich versuch’s …«
»Und …«, jetzt kommt’s. Sie schluckt und sagt: »… du weißt, dass dein Vater stolz auf dich gewesen wäre, ja?« Ich küsse sie schnell auf ihre trockenen, gespitzten Lippen und renne mit kurzen, kleinen Zwischenspurts, so gut ich kann, zum Bahnhof.
Während der Bahnfahrt setze ich die Kopfhörer auf und höre das Tape mit der Spezialzusammenstellung meiner absoluten Lieblings-Kate-Bush-Nummern aller Zeiten. Es ist eine ziemlich gute Sammlung, aber wir haben zu Hause keine anständige Stereoanlage, und mitten in The Man with the Child in his Eyes kann ich noch hören, wie Mum zu mir rauf ruft, dass die Koteletts fertig sind.
Andächtig schlage ich meine druckfrische Ausgabe von Spensers The Faerie Queene auf, die wir im ersten Semester durchnehmen. Ich bilde mir ein, dass ich ein ziemlich guter Leser bin, aufgeschlossen und überhaupt, aber das hier scheint mir der reine Schwachsinn zu sein, darum lege ich die Faerie Queene nach den ersten achtzehn Zeilen wieder zur Seite und konzentriere mich auf Kate Bush und die vorbeisausende englische Landschaft und darauf, gedankenversunken, kompliziert und interessant auszusehen. Ich habe ein großes Fenster, vier Sitzplätze und einen Tisch für mich allein, eine Cola und ein Twix, und das Einzige, was mir mein Leben jetzt noch versüßen könnte, wäre, wenn eine attraktive Frau vorbeikommen und sich mir gegenüber setzen und etwas in der Art sagen würde wie:
»Entschuldigung, mir ist aufgefallen, dass du The Faerie Queene liest. Du bist nicht zufällig gerade auf dem Weg zur Universität, um Anglistik zu studieren?«
»Doch, doch, bin ich!«, würde ich antworten.
»Das ist ja fantastisch! Hast du was dagegen, wenn ich mich zu dir setze? Ich heiße übrigens Emily. Sag mal, kennst du eigentlich die Musik von Kate Bush …?«
Und meine Konversation ist so weltgewandt, kultiviert und geistreich, und zwischen uns knistert es dermaßen erotisch, dass sich Emily, als wir in den Bahnhof einfahren, über den Tisch lehnt, sich spröde auf die sinnliche Unterlippe beißt und sagt:
»Hör mal, Brian, ich kenn dich kaum, und ich hab das auch noch nie zu einem Mann gesagt, aber meinst du, wir könnten vielleicht … in ein Hotel gehen oder so? Weil ich einfach nicht glaube, dass ich noch eine Minute länger dagegen ankämpfen kann«, und ich willige mit einem müden kleinen Lächeln ein, wie um zu sagen: »Warum muss mir das eigentlich jedes Mal passieren, wenn ich in einen Zug steige?«, und nehme ihre Hand und führe sie ins nächste Hotel …
Aber Moment mal. Erstens, was tun mit all meinem Gepäck? Ich kann ja schlecht mit zwei schwarzen Müllsäcken in einem Hotel aufkreuzen, oder? Und dann die Kosten. Das Geld von meinem Ferienjob ist schon für meine Unterkunft an der Uni draufgegangen, der Scheck mit dem Stipendium kommt erst nächste Woche, und obwohl ich noch nie in einem Hotel abgestiegen bin, weiß ich, das es nicht billig sein kann – vierzig, fünfzig Pfund vielleicht – und machen wir uns nichts vor, die ganze Sache dauert, na, zehn Minuten, wenn ich Glück habe, maximal eine Viertelstunde, und ich möchte nicht auf den Augenblick höchster sexueller Ekstase zusteuern und mir gleichzeitig Sorgen machen müssen, ob ich auch Leistung kriege für mein Geld. Ich schätze, Emily könnte eventuell vorschlagen, dass wir mit dem Zimmer halbe-halbe machen, aber ich werde das ablehnen müssen, sonst denkt sie, ich bin knickerig. Und selbst wenn sie drauf besteht und ich mich breitschlagen lasse, müsste sie mir das Geld immer noch in irgendeiner Form überreichen; und egal, ob wir das nun vorher machen oder nachdem wir miteinander geschlafen haben, es würde der Begegnung vermutlich was von ihrem melancholischen, bittersüßen Verlangen nehmen. Ob sie mich abartig findet, wenn ich hinterher bleibe, um noch so viel wie möglich aus dem Hotelangebot rauszuholen? »Emily-Schatz, unser Liebesspiel war wunderschön und seltsam ergreifend zugleich. Hilfst du mir jetzt bitte, die Handtücher in meinen Rucksack zu quetschen?« Wäre es überhaupt ratsam, gleich mit jemandem ins Bett zu springen, mit dem man gemeinsam studieren wird? Was, wenn die sexuelle Spannung zwischen uns unsere akademische Leistung beeinträchtigt? Alles in allem ist es wahrscheinlich doch keine so gute Idee. Vielleicht sollte ich warten, bis ich Emily besser kenne, bevor wir eine körperliche Beziehung eingehen.
Als der Zug dann in den Bahnhof einfährt, bin ich sogar ziemlich erleichtert, dass Emily nur ein Hirngespinst war.
Ich schleife die Müllsäcke und den Koffer aus dem Bahnhof, der auf einem Berg liegt, von dem aus man auf die Stadt hinunterschauen kann. Seit meinem Vorstellungsgespräch bin ich erst zum zweiten Mal hier, und, okay, es ist vielleicht nicht Oxford oder Cambridge, aber es ist das nächstbeste. Die Hauptsache ist doch, dass es eine Universitätsstadt mit Türmchen ist. Träumenden Türmchen.
3
FRAGE: Welcher berühmte Roman von Frances Hodgson Burnett, der 1886 geschrieben und seitdem vielfach für Bühne und Film adaptiert wurde, löste eine Mode unter kleinen Jungen aus, die lockiges Haar und Samtanzüge mit Spitzenkragen vorschrieb?
ANTWORT: Der kleine Lord.
Folgendes habe ich in die Rubrik »Hobbys und Interessen« meines Antrags für das Akademische Wohnungsamt geschrieben: Lesen, Kino, Musik, Theater, Schwimmen, Badminton, Partys!
Offensichtlich ist die Liste nicht gerade aufschlussreich. Sie ist nicht mal ganz wahr. »Lesen« stimmt, aber jeder schreibt Lesen. Dasselbe gilt für »Kino« und »Musik«. »Theater« ist gelogen, ich hasse Theater. Dabei habe ich sogar schon selber auf der Bühne gestanden, nur hab ich noch nicht sehr viele Aufführungen gesehen, außer einmal dieses Lehrstück eines tourenden Ensembles über die Sicherheit auf unseren Straßen, was mir, obwohl es an Schwung, Feuer und Dynamik nichts fehlen ließ, ästhetisch nicht so wahnsinnig viel gegeben hat. Aber man muss so tun, als würde man das Theater mögen – das ist ein Grundgesetz. »Schwimmen« stimmt auch nicht hundertprozentig. Ich kann schwimmen, aber nur in der Art, wie jedes ertrinkende Tier schwimmen kann. Ich dachte nur, irgendwas Sportliches könnte nicht schaden. Dito »Badminton«. Wenn ich sage, dass ich mich für Badminton interessiere, dann meine ich, wenn man mir eine Pistole an die Brust setzt und mich bei Todesstrafe zwingt, Sport zu treiben, und die sich weigern, Scrabble als Sport anzuerkennen, dann wäre dieser Sport Badminton. So schwer kann das doch nicht sein. »Partys!« ist auch eher ein Euphemismus. »Einsam und sexuell frustriert« hätte es besser getroffen, sich aber auch kränker angehört. Übrigens soll das Ausrufezeichen am Ende von »Partys!« eine respektlose, unbekümmerte, leichtsinnige Einstellung zum Leben signalisieren.
So gesehen habe ich zugegebenermaßen den Leuten in der Quartiervermittlung nicht besonders viele Anhaltspunkte gegeben, was aber noch lange nicht erklärt, weshalb sie mich in dieses Haus mit Josh und Marcus gesteckt haben.
Richmond House als solches ist ein Reihenhaus aus rotem Backstein, das ganz oben auf einem sehr steilen Berg über der Stadt steht, praktischerweise mehrere Meilen von der nächsten Bushaltestelle entfernt, sodass ich meine Donkey Jacke als ich endlich ankomme, einmal komplett durchgeschwitzt habe. Die Haustür steht schon offen, und der Flur ist mit Kisten und Rennrädern und zwei Rudern, einem Cricketschläger mitsamt Schutzpolstern, einer Skiausrüstung, Sauerstoffgeräten und einem Wetsuit vollgestellt. Es sieht aus, als hätte jemand ein Sportgeschäft geplündert. Ich lade meinen Koffer gleich hinter der Tür ab und steige mit wachsender Beklommenheit über die angehäuften Sportgeräte, um meine neuen Mitbewohner zu suchen.
Die Küche ist neonbeleuchtet, anstaltsmäßig und riecht nach Bleichmittel und Hefe. Vor der Spüle sind zwei Jungs – der eine hünenhaft und blond, der andere dunkel, untersetzt und mit einem pickligen Nager-Gesicht – damit beschäftigt, Wasser über einen Duschaufsatz aus Gummi in einen leeren Plastikmülleimer zu füllen. Ein Ghettoblaster spielt sehr laut She Sells Sanctuary von The Cult, und ich stehe eine Zeit lang in der Tür und muss »Hi!« und »Hallooo!« sagen, bevor der Blonde endlich hochschaut und mich mit meinen schwarzen Plastiksäcken entdeckt.
»Ja Wahnsinn! Der Müllmann!«
Er dreht die Musik einen Tick leiser, kommt angesprungen wie ein freundlicher Labrador und schüttelt mir kräftig die Hand, und mir wird bewusst, dass ich zum ersten Mal im Leben einem Gleichaltrigen die Hand schüttle.
»Du bist sicher Brian«, sagt er. »Ich bin Josh, und das ist Marcus!«
Marcus ist klein und karbunkelhaft, und seine Gesichtszüge laufen alle auf seine Gesichtsmitte zu, hinter einer Pilotenbrille, der es einmalig misslingt, den Eindruck zu erwecken, er könnte ein Flugzeug lenken. Er mustert mich mit seinem Rattengesicht einmal von oben bis unten, nimmt Witterung auf und widmet seine Aufmerksamkeit dann wieder dem Plastikeimer. Aber Josh plappert munter weiter, ohne irgendwelche Antworten abzuwarten, mit einer Stimme wie direkt aus einer tönenden Wochenschau. »Wie bist du hergekommen? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wo sind deine Eltern? Sag mal, alles in Ordnung? Du bist ja klatschnass vor Schweiß.«
Josh trägt weinrote, spitz zulaufende Wildlederstiefel, eine beige Samtweste – ja, ich sagte Samtweste –, ein lila Rüschenhemd und schwarze Jeans, die so eng sind, dass man tatsächlich den genauen Aufenthaltsort jedes einzelnen Hoden erkennen kann. Er hat die Frisur von Tone, die des verweichlichten Wikingers, Markenzeichen des eingefleischten Metallers, die aber hier von einem zaghaften flaumigen Schnurrbart ergänzt wird; ein leicht geckenhafter Kavalierslook, der einen beinahe glauben lässt, er hätte nur mal kurz seinen Degen verlegt.
»Was ist in dem Eimer?«, frage ich.
»Eigenbräu. Wir dachten, je eher wir die Gärung in Gang bringen, umso besser. Selbstverständlich kannst du mitmachen, wenn du willst, wir teilen dann einfach die Kosten durch drei …«
»Verstehe …«
»Das heißt jetzt zwar erst mal einen Zehner für dich, für die Hefe und das Hopfen-Konzentrat und die Schläuche und das Fass und so, aber in drei Wochen hast du dann den vollen Genuss eines guten traditionellen Yorkshire Bitter für sechs Pence das Pint!«
»Abgemacht!«
»Marcus und ich sind echte alte Schwarzbrenner, wir haben schon im Internat eine kleine Brauerei betrieben und damit ganz hübsch abgesahnt, nebenbei gesagt. Obwohl dabei ein paar Externe versehentlich erblindet sind!«
»Ihr seid zusammen zur Schule gegangen?«
»Haargenau. Wir sind an der Hüfte zusammengewachsen, was, Marcus?« Marcus schnieft. »Welche Schule hast du besucht?«
»Oh, die wirst du nicht kennen …«
»Na, das wollen wir doch mal sehen.«
»Langley Street?« Keine Reaktion.
»Langley-Street-Gesamtschule?« Keine Reaktion.
»Southend?«, versuche ich’s noch mal. »Essex?«
»Nee! Du hattest vollkommen Recht, nie davon gehört! Soll ich dir dein Zimmer zeigen?«
Ich folge Josh die Treppe hoch, während Marcus geduckt hinter uns herschlurft, einen Schlachtschiff-grauen Flur entlang, der mit Instruktionen für den Brandfall geschmückt ist. Wir gehen an ihren neuen Zimmern vorbei, die voller Kisten und Koffer, aber immer noch eindeutig sehr geräumig sind, und am Ende des Korridors reißt Josh die Tür von einem Kabuff auf, das auf den ersten Blick wie eine Gefängniszelle aussieht.
»Da-da! Hoffentlich macht’s dir nichts aus, aber wir haben die Zimmer verteilt, bevor du angekommen bist.«
»Oh. Verstehe …«
»Haben eine Münze geworfen. Wir wollten mit dem Auspacken anfangen, uns einrichten, weißt du.«
»Natürlich! Verstehe!« Ich habe das sichere Gefühl, dass man mich über den Tisch gezogen hat, und beschließe, nie wieder einem Mann in einer Samtweste zu trauen. Die Kunst besteht jetzt darin, mich durchzusetzen, ohne übertrieben unnachgiebig zu wirken.
»Ziemlich klein, oder?«, sage ich.
»Na ja, sie sind alle klein, Brian. Und wir haben eine Münze geworfen, offen und ehrlich.«
»Wie wirft man eine Münze unter drei Leuten?«
Schweigen. Josh runzelt die Stirn, und sein Mund arbeitet lautlos.
»Wir können gern noch mal losen, wenn du uns nicht traust«, schnieft Marcus pikiert.
»Nein, das ist es nicht, es ist nur …«
»Na, dann richte dich erst mal ein. Willkommen an Bord!«, und sie rennen tuschelnd zu ihrem Eigenbräu zurück.
Meine Bude ist ein Loch. Das Zimmer besitzt den ganzen Reiz und Charme vom Schauplatz eines Verbrechens; Ein-Personen-Matratze auf einem Bettgestell aus Metall, Kleiderschrank und Schreibtisch aus passendem Sperrholz, zwei Holzimitat-Regalbretter aus Resopal. Die Teppiche sind schlammbraun und offenbar aus gepresstem Schamhaar gewebt. Ein schmutziges Fenster vor dem Schreibtisch geht auf die Mülltonnen hinaus, während ein gerahmtes Schild die Verwendung von Reißzwecken an den Wänden bei Todesstrafe verbietet. Aber ich wollte eine Mansarde, und jetzt hab ich eine Mansarde. Machen wir das Beste draus.
Als Erstes schließe ich die Stereoanlage an und lege Never for Ever auf, Kate Bushs umwerfendes drittes Album. Die restlichen Scheiben staple ich neben dem Plattenspieler und überlege dann ein bisschen hin und her, welches Album ich als Blickfang nach vorn stellen soll. Ich probiere es mit Revolver von den Beatles, Joni Mitchells Blue, Diana Ross and The Supremes und mit Ella Fitzgerald, bevor ich mich für meine nagelneue Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte von Bach vom Musik-for-Pleasure Label entscheide, ein Schnäppchen zu £ 2.49.
Als Nächstes packe ich meine Bücher aus und probiere verschiedene Anordnungsvarianten auf den Resopal-Regalen aus; alphabetisch nach Autor, alphabetisch nach Autor, aber unterteilt nach Thema, Genre, Nationalität und Größe oder schließlich, und am effektvollsten, nach Farbe. Die schwarzen Penguin-Klassiker auf der einen Seite, die zu den weißen Picador-Bänden am anderen Ende hin verblassen – wobei die fünf Zentimeter der grünen Titel von Virago Press, die zu lesen ich noch keine Zeit hatte, was ich aber garantiert demnächst nachholen werde, die Mitte des Spektrums einnehmen. Das dauert natürlich seine Zeit, und als ich fertig bin, ist es dunkel geworden, darum klemme ich meine schwenkbare Schreibtischlampe an der Tischkante fest.
Danach beschließe ich, das Bett in einen Futon zu verwandeln. Das habe ich übrigens schon länger vorgehabt, aber als ich es zu Hause ausgetestet habe, hat mich Mum nur ausgelacht, also werde ich’s hier mal versuchen. Ich wuchte die Matratze, die voller geheimnisvoller Flecken und so feucht ist, dass man Kresse drauf anpflanzen kann, auf den Boden, ohne sie mit meinem Gesicht in Berührung zu bringen und stelle unter etlichen Anstrengungen das metallene Bettgestell hochkant. Es wiegt eine Tonne, aber irgendwann gelingt es mir doch, das Ding außer Sichtweite hinter den Schrank zu verfrachten. Offensichtlich muss ich dafür einiges von meinem wertvollen Fußbodenraum opfern, aber der erzielte Effekt ist es wert – eine Art minimalistisch-kontemplative, fernöstliche Atmosphäre, die von den kühnen blau-weiß-roten Streifen auf dem Bettüberwurf von Woolworth nur geringfügig untergraben wird.
Im Einklang mit dem Zen-haften Minimalismus des Futons will ich die Innendekoration auf eine Postkarten-Montage von Lieblingsgemälden und -fotos an der Wand über meinem Kopfkissen beschränken, einer Art Bilder-Manifest meiner Helden und Vorlieben. Ich lege mich auf den Futon und hole die Reißzwecken raus; Henry Wallis’ Chattertons Tod, Millais’ Ophelia, Da Vincis Madonna mit Kind, Van Goghs Sternennacht, einen Edward Hopper; Marilyn Monroe im Tutu, melancholisch in die Kamera blickend, James Dean mit langem Mantel in New York, Dustin Hoffman in Der Marathon-Mann, Woody Allen, ein Foto von Mum und Dad, die in ihren Liegestühlen eines Butlins-Feriencamps eingeschlafen sind, Charles Dickens, Karl Marx, Che Guevara, Laurence Olivier als Hamlet, Samuel Beckett, Anton Tschechow, ich als Jesus in der Aufführung unserer Abschlussklasse von Godspell, Jack Kerouac, Burton und Taylor in Wer hat Angst vor Virginia Woolf? und ein Foto von Spencer, Tone und mir auf einem Schulausflug zur Burg von Dover. Spencer in leichter Pose mit geneigtem Kopf – er sieht cool, angeödet und klug aus. Tone macht wie üblich das »Fuck You«-Zeichen.
Schließlich hänge ich gleich neben mein Kissen ein Bild von Dad auf, der spindeldürr und leicht bedrohlich aussieht, wie Richard Attenborough als Pinkie Brown in Brighton Rock, nur dass es hier die Strandpromenade von Southend ist, Bierflasche und glimmende Zigarette zwischen den langen Fingern einer Hand. Er hat eine schwarze Tolle, hohe, markante Wangenknochen, eine lange schmale Nase und trägt einen eleganten Anzug mit schmalem Revers und drei Knöpfen. Obwohl er halb in die Kamera lächelt, wirkt er immer noch ziemlich beängstigend. Es wurde um 1962 aufgenommen, vier Jahre vor meiner Geburt, also muss er ungefähr so alt gewesen sein wie ich jetzt. Ich liebe dieses Foto, habe aber immer so ein ungutes Gefühl, dass mein Vater, wenn wir uns als Neunzehnjährige an einem Samstagabend auf dem Pier von Southend begegnet wären, höchstwahrscheinlich versucht hätte, mich zu verprügeln.
Es klopft an der Tür, und ich verstecke instinktiv die Reißzwecken hinter meinem Rücken. Ich vermute, dass es Josh ist, der irgendwelche Sklavendienste von mir verlangen will oder so, aber es rauscht eine riesige blonde Frau mit Wikinger-Frisur und milchig-blondem Schnurrbart ins Zimmer.
»Wie kommst du voran? Alles okay?«, fragt Josh im Fummel.
»Gut, gut.«
»Warum liegt die Matratze auf dem Boden?«
»Ach, ich dachte, ich probier sie mal eine Weile als Futon aus.«
»Als Futon? Wirklich?«, sagt Josh und spitzt sein bemaltes Mündchen, als wäre es das Exotischste, das er je im Leben gehört hat, was von einem Mann in Frauenklamotten ein ziemlicher Hammer ist. »Marcus, komm mal her und sieh dir Jacksons Futon an!«, und Marcus – mit schwarzer Nylon-Lockenperücke, Hockeyrock und Strümpfen mit Laufmaschen – steckt seine Nase zur Tür herein, schnieft und verschwindet wieder.
»Na, wir wollen jetzt jedenfalls los – kommst du mit oder was?«
»Entschuldigung, mit wohin …?«
»Nutten-und-Pfaffen-Party in Kenwood Manor. Wird bestimmt komisch.«
»Verstehe, na ja, vielleicht. Ich dachte eigentlich, ich bleib zu Hause und lese …«
»Ach komm, sei kein Langweiler …«
»Aber ich hab nichts anzuziehen …«
»Du hast doch ein dunkles Hemd, oder?«
»Hmm.«
»Na bitte. Stopf dir ein Stück weiße Pappe unter den Kragen, und ab geht’s. In fünf Minuten. Und oh, vergiss den Zehner nicht für das Selbstgebraute, ja? Übrigens toll, was du aus dem Zimmer gemacht hast …«
4
FRAGE: Die Energie, die in der Interaktion zweier Protonen entsteht, variiert entsprechend dem Abstand zwischen den beiden. Welcher Art sind die Kräfte zwischen den Protonen, wenn der Abstand zwischen ihnen a) klein beziehungsweise b) mittelgroß ist?
ANTWORT: Einander abstoßend und einander anziehend.
Als Mann von Welt weiß ich, wie wichtig es ist, sich eine solide Grundlage zu verschaffen, wenn man abends was vorhat. Darum kaufe ich mir eine Tüte Pommes und ein paniertes Würstchen und esse das Ganze auf dem Weg zur Party. Es beginnt, ziemlich beständig zu regnen, und ich esse so viele Pommes, wie ich kann, bevor sie total kalt und nass werden. Marcus und Josh schreiten zielstrebig und selbstsicher in ihren Stöckelschuhen vor mir aus, offenbar immun gegen die freudlosen Blicke der Passanten. Ich denke mal, dass Vornehme-Jungs-im-Fummel zu den unvermeidlichen Plagen in einer Universitätsstadt gehören. Denn bald ist auch noch »Rag Week«, mit schreiend komischen Spektakeln für wohltätige Zwecke. Die Blätter werden einen bronzenen Farbton annehmen, die Schwalben gen Süden fliegen, und in der Fußgängerzone wird es nur so wimmeln von männlichen, als knackige Krankenschwestern verkleideten Medizinstudenten.
Auf dem Weg bombardiert mich Josh mit Fragen.
»Was studierst du?«
»Anglistik.«
»Gedichte, was? Ich mach Politik und Ökonomie, Marcus Jura. Treibst du irgendeinen Sport, Brian?«
»Nur Scrabble«, schleudere ich ihm pfeilschnell entgegen.
»Scrabble ist kein Sport«, schnieft Marcus.
»Du hast mich noch nicht spielen sehen!«, entgegne ich schlagfertig.
Aber scheinbar findet er es nicht komisch, denn er guckt nur verdrießlich und sagt: »Egal wie man es spielt, es ist trotzdem kein Sport.«
»Ja, weiß ich doch, ich hab nur …«
»Was ist dein Ding: Fußball, Cricket oder Rugby?«, fragt Josh.
»Na ja, eigentlich keins von alledem …«
»Also kein Sportsmann, wie?«
»Überhaupt nicht.« Ich werde das Gefühls nicht los, dass ich hier auf Mitgliedschaft in irgendeinem namenlosen Privatclub geprüft werde und nicht bestehe.
»Wie ist dein Squash? Ich such noch einen Partner.«
»Auch nicht Squash. Hin und wieder Badminton.«
»Badminton ist ein Mädchensport«, sagt Marcus und zieht die Riemchen seiner Sandaletten zurecht.
»Hast du nach dem Abi ein Jahr Auszeit genommen?«, fragt Josh.
»Nein …«
»Irgendwo Interessantes Ferien gemacht diesen Sommer?«
»Nein …«
»Was machen deine Eltern?«
»Na ja, Mum arbeitet bei Woolworth an der Kasse. Dad hat Isolierverglasungen verkauft, aber er ist gestorben.« Josh drückt meinen Arm und sagt, »Tut mir so leid«, aber es ist unklar, ob er den Tod meines Vaters oder Mums Job meint.
»Und deine?«
»Oh, Dad ist im Außenministerium, meine Mutter im Verkehrsministerium.« O mein Gott, er ist ein Tory. Beziehungsweise muss ich davon ausgehen, dass er Konservativer ist, wenn seine Eltern es sind, so was vererbt sich ja gewöhnlich. Was Marcus angeht, würde es mich nicht wundern, wenn er in der Hitlerjugend wäre.
Schließlich kommen wir in Kenwood Manor an. Ich habe einen Bogen um die Studentenwohnheime gemacht, weil mir am Tag der Offenen Tür gesteckt wurde, dass sie langweilig, anstaltsmäßig und gerammelt voll mit Christen sind. Die Realität bewegt sich irgendwo zwischen Nervenheilanstalt und zweitklassiger Privatschule – lange, hallende Korridore, Parkettfußböden, der Geruch feuchter Unterwäsche, die auf lauwarmen Heizkörpern trocknet, und das ungute Gefühl, dass auf irgendeiner Toilette gerade etwas Schreckliches passiert.
Das entfernte Wummern von Dexys Midnight Runners führt uns einen Gang entlang zu einem großen, holzgetäfelten Raum mit hohen Fenstern, der nur spärlich mit Studenten bevölkert ist – zu etwa sieben Teilen Nutten und drei Teilen Pfarrern, wobei die Nutten ungefähr je zur Hälfte weiblich oder männlich sind. Es ist kein schöner Anblick. Stämmige Männer und sogar ziemlich viele Frauen, die in kunstvoll zerrissenen Strumpfhosen und mit ausgestopften BHs an der Wand lehnen wie, na ja, Nutten, während aristokratische Uni-Rektoren aus der Zeit von König Edward verzweifelt aus ihren Bildnissen auf sie herabstarren.
»Übrigens, Bri, du hast nicht zufällig den Zehner dabei …?«, fragt Josh mit gerunzelter Stirn, »… für das Selbstgebraute?«
Ich kann mir das natürlich überhaupt nicht leisten, und es ist der Zehner, den mir Mum in die Hand gedrückt hat, aber unserer neuen Freundschaft zuliebe gebe ich ihm das Geld, und Josh und Marcus tollen los wie zwei Hunde am Strand und lassen mich allein zurück, um noch weitere Freundschaften fürs Leben zu schließen. In dieser Frühphase des Abends halte ich es allgemein für das Schlauste, mir dazu einen Pfarrer und keine Nutte zu suchen.
Auf dem Weg zu der behelfsmäßigen Bar, einer aufgebockten Tischplatte, wo sie Red Stripe zu einem sehr anständigen Preis von 50 Pence die Dose verkaufen, setze ich mein Bitte-sprich-mich-an-Gesicht auf, ein einfältiges Grinsen bei geschlossenem Mund, das von zaghaftem Nicken und hoffnungsvollen Blicken begleitet wird. Neben mir wartet einer darauf, bedient zu werden, ein schlaksiger Hippie mit einem Dorftrottel-Grinsen, das perfekt zu meinem passt, und einer verblüffenderweise noch schlimmeren Akne. Er sieht sich im Raum um und sagt dann in einem schrillen Birmingham-Akzent: »Der helle Waaaahnsinn, was?«