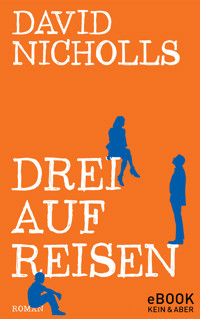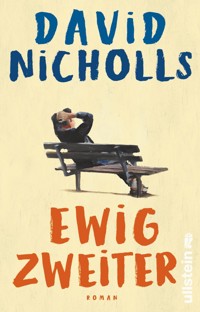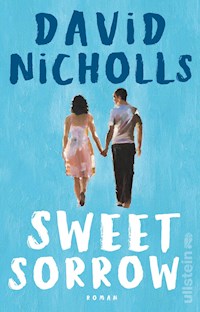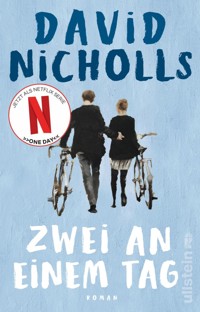
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie lange braucht man, um die große Liebe zu erkennen? Emma und Dexter verbringen eine Nacht miteinander, der 15. Juli wird für sie beide immer etwas Besonderes sein. Schon am nächsten Tag trennen sich ihre Wege. Über zwanzig Jahre lang denken sie am 15. Juli an den anderen, sie treffen sich oder sie verpassen einander knapp. Wann werden sie sich eingestehen, dass sie für einander bestimmt sind? "Eine herrliche Liebesgeschichte." Christine Westermann "Ein wundervolles, wundervolles Buch." The Times "Dazu bestimmt, ein moderner Klassiker zu sein." Daily Mirror Der Weltbestseller mit mehr als 10 Millionen verkaufter Exemplare in neuer Ausstattung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Zwei an einem Tag
Der Autor
DAVID NICHOLLS, Jahrgang 1966, ist ausgebildeter Schauspieler, hat sich dann aber für das Schreiben entschieden. Mit seinem Roman »Zwei an einem Tag« gelang ihm der Durchbruch, seine Romane wurden in vierzig Sprachen übersetzt und verkauften sich weltweit über acht Millionen mal. 2014 wurde sein Roman »Drei auf Reisen« für den Man Booker Prize nominiert. Auch als Drehbuchautor ist David Nicholls überaus erfolgreich und mehrfach preisgekrönt, zuletzt erhielt er den BAFTA und eine Emmy-Nominierung für »Patrick Melrose«, seine Adaption der Romane von Edward St Aubyn, die als HBO-Serie Furore machte.Von David Nicholls sind in unserem Hause bereits erschienen: Keine weiteren Fragen · Ewig Zweiter · Zwei an einem Tag · Sweet Sorrow
David Nicholls
Zwei an einem Tag
Roman
Aus dem Englischen von Simone Jakob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Februar 2021© 2009 by David NichollsCopyright der deutschen Übersetzung © 2009 Kein und Aber AG Zürich – BerlinCopyright der deutschen Ausgabe © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Titel der englischen Originalausgabe:One Day (Hodder & Stoughton, London)Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenTitelabbildung: © James Coates 2020Autorenfoto: joSon / Gallery StockE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-2338-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
ERSTER TEIL
1988–1992
Anfang zwanzig
KAPITEL EINS
Die Zukunft
KAPITEL ZWEI
Zurück ins Leben
KAPITEL DREI
Der Taj Mahal
KAPITEL VIER
Gelegenheiten
KAPITEL FÜNF
Spielregeln
ZWEITER TEIL
1993–1995
Ende zwanzig
KAPITEL SECHS
Chemie
KAPITEL SIEBEN
Mann mit Sinn für Humor gesucht
KAPITEL ACHT
Showbusiness
KAPITEL NEUN
Zigaretten und Alkohol
DRITTER TEIL
1996–2001
Anfang dreißig
KAPITEL ZEHN
Carpe diem
KAPITEL ELF
Zwei Treffen
KAPITEL ZWÖLF
»Ich liebe dich« sagen
KAPITEL DREIZEHN
Die Welle
KAPITEL VIERZEHN
Vater sein
KAPITEL FÜNFZEHN
Jean Seberg
VIERTER TEIL
2002–2005
Ende dreißig
KAPITEL SECHZEHN
Montagmorgen
KAPITEL SIEBZEHN
großertag.doc
KAPITEL ACHTZEHN
Die Mitte
FÜNFTER TEIL
Drei Jahrestage
KAPITEL NEUNZEHN
Der Morgen danach
KAPITEL ZWANZIG
Der erste Jahrestag
Eine Feier
KAPITEL EINUNDZWANZIG
Arthur’s Seat
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
Der zweite Jahrestag
Auspacken
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
Der dritte Jahrestag
Ein letzter Sommer
Anhang
DANK
NACHWEIS DER ZITATE
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
ERSTER TEIL 1988–1992 Anfang zwanzig
Widmung
Für Max und Romy, wenn ihr älter seid. Und, wie immer, für Hannah.
Motto
Wofür sind Tage gut? In Tagen leben wir. Sie kommen, wecken uns, immer von neuem. Sie sind zum Glücklichsein: Wo könnten wir sonst leben als in Tagen?
Ja, die Lösung dieser Frage ruft nach dem Priester und dem Arzt, in langen Mänteln kommen sie über die Felder gelaufen.
Philip Larkin, Tage
ERSTER TEIL1988–1992 Anfang zwanzig
Dies war für mich ein denkwürdiger Tag, da er gewaltige Veränderungen in mir bewirkte. Doch das gibt es in jedem Leben. Man stelle sich vor, ein ganz bestimmter Tag würde daraus gelöscht, und überlege dann, wie anders dieses Leben verlaufen wäre. Du, der du dies liest, halt ein und denke für einen Augenblick an die lange Kette aus Eisen oder Gold, aus Dornen oder Blumen, die dich niemals gefesselt hätte, wäre nicht an einem denkwürdigen Tage ihr erstes Glied geschmiedet worden.Charles Dickens, Große ErwartungenKAPITEL EINS Die Zukunft
Freitag, 15. Juli 1988
Rankeillor Street, Edinburgh
»Ich glaube, das Wichtigste ist, irgendwas zu verändern«, sagte sie. »Du weißt schon, wirklich zu verbessern.«
»Wie, meinst du etwa ›die Welt verbessern‹?«
»Nicht gleich die ganze Welt. Nur das kleine Stück um dich rum.«
Für einen Augenblick lagen sie schweigend und eng umschlungen in dem schmalen Einzelbett, dann lachten beide in der Dunkelheit vor Sonnenaufgang leise vor sich hin. »Ich kann es nicht fassen, dass ich das gesagt habe«, stöhnte sie. »Klingt ganz schön abgedroschen, was?«
»Schon ein wenig.«
»Ich versuche hier, dich zu inspirieren! Ich versuche, deine schwarze Seele auf das große Abenteuer einzustimmen, das vor dir liegt.« Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn an. »Nicht, dass du es nötig hättest. Du hast deine Zukunft bestimmt schon total verplant, heißen Dank auch. Hast wohl irgendwo einen Masterplan deines Lebens rumliegen.«
»Wohl kaum.«
»Was hast du denn sonst vor? Wie sieht der große Plan aus?«
»Na ja, meine Eltern holen mein Zeug ab, nehmen es mit nach Hause, und dann verbringe ich ein paar Tage in ihrer Wohnung in London und besuche Freunde. Danach ab nach Frankreich …«
»Wie nett …«
»Später gucke ich mich vielleicht ein bisschen in China um, anschließend eventuell weiter nach Indien, ein bisschen rumreisen …«
»Reisen«, seufzte sie. »War ja klar.«
»Was hast du gegen Reisen?«
»Klingt mehr nach Realitätsflucht.«
»Ich finde, die Realität wird überbewertet«, sagte er in der Hoffnung, düster und charismatisch zu klingen.
Sie schniefte. »Schätze, das geht in Ordnung, wenn man es sich leisten kann. Aber warum sagst du nicht gleich: ›Ich nehm zwei Jahre Urlaub‹? Ist doch gehopst wie gesprungen.«
»Weil Reisen den Horizont erweitert«, sagte er, stützte sich auf den Ellbogen und küsste sie.
»Also, ich glaube, in deinem Fall hieße das Eulen nach Athen tragen«, sagte sie und wandte das Gesicht ab, zumindest für den Moment. Sie ließen sich auf das Kissen zurücksinken. »Egal, ich hab nicht gemeint, was du nächsten Monat machst, sondern in der richtigen Zukunft, wenn du, keine Ahnung …« Sie schwieg, als versuchte sie sich etwas Fantastisches vorzustellen, etwa eine fünfte Dimension. »… 40 bist oder so. Was willst du mit 40 sein?«
»40?« Auch er hatte Mühe, sich das auszumalen. »Keinen Schimmer. Wie wärs mit ›reich‹?«
»So was von oberflächlich.«
»Na gut, dann ›berühmt‹.« Er knabberte an ihrem Nacken. »Etwas morbide, die Vorstellung, oder?«
»Nicht morbide, es ist … aufregend.«
»›Aufregend!‹« Er ahmte ihren leichten Yorkshire-Akzent nach, so dass es bescheuert klang. Sie erlebte oft, wie reiche, verwöhnte Jungs Dialekte nachäfften, als ob sie ungewöhnlich oder seltsam wären, und nicht zum ersten Mal verspürte sie einen beruhigenden Anflug von Abneigung gegen ihn. Sie rückte von ihm ab und presste den Rücken an die kühle Wand.
»Ja, aufregend. Wir sollten schließlich aufgeregt sein, oder? So viele Möglichkeiten. Wie der Vizedekan schon sagte: ›Alle Türen stehen Ihnen weit offen …‹«
»›Ihre Namen werden dereinst die Zeitungen zieren …‹«
»Eher unwahrscheinlich.«
»Und, bist du aufgeregt?«
»Ich? Gott nein, ich mach gleich in die Hose.«
»Ich auch. Heilige Scheiße …« Plötzlich drehte er sich um und griff nach den Zigaretten auf dem Boden neben dem Bett, wie um seine Nerven zu beruhigen. »40 Jahre. 40. Teufel auch.«
Sie lächelte über seine Panik und beschloss, noch einen draufzusetzen. »Und was willst denn du jetzt machen, wenn du 40 bist?«
Nachdenklich zündete er sich eine Zigarette an. »Tja, die Sache ist die, Em …«
»›Em‹? Wer soll das denn sein?«
»Alle nennen dich Em. Ich habs gehört.«
»Ja, meine Freunde nennen mich Em.«
»Und, darf ich jetzt Em zu dir sagen?«
»Nur zu, Dex.«
»Also, ich habe ziemlich viel über diesen ganzen ›Erwachsenwerden‹-Kram nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich genau so bleiben will, wie ich jetzt bin.«
Dexter Mayhew. Sie linste unter ihrem Pony zu ihm hoch, während er sich an das billige Vinyl-Knopfpolster lehnte, und selbst ohne Brille konnte sie klar erkennen, warum er genau so bleiben wollte, wie er war. Die Augen geschlossen, die Zigarette lässig im Mundwinkel, eine Seite des Gesichts vom warmen, durch den Vorhang rötlich gefärbten Licht des Sonnenaufgangs beschienen, hatte er die Gabe, ständig so auszusehen, als posierte er für ein Foto. »Wie ein junger Gott«, schoss es Emma Morley durch den Kopf, ein alberner Ausdruck aus dem 19. Jahrhundert, aber es gab wirklich keine treffendere Beschreibung, außer vielleicht »schön«. Er hatte eines der Gesichter, bei dem selbst die Knochen unter der Haut anziehend wirken, sogar sein Schädel schien attraktiv. Die Nase war fein, glänzte leicht fettig, und er hatte dunkle Ringe um die Augen, fast schon Veilchen, Ehrenmale, die er sich durch Rauchen und nächtelange, absichtlich verlorene Strip-Poker-Partien mit Mädchen von der Bedales-Schule erworben hatte. Er hatte etwas Katzenhaftes an sich: feine Augenbrauen, volle, etwas zu dunkle, bewusst zum Schmollmund verzogene Lippen, die jetzt trocken, rissig und rot vom bulgarischen Rotwein waren. Das erfreulich schrecklich aussehende Haar war hinten und an den Seiten kurzgeschnitten, aber vorn hatte er eine peinliche kleine Stirnlocke. Das Haargel hatte sich verflüchtigt, und die Tolle sah keck und aufgeplustert aus wie ein albernes Hütchen.
Mit geschlossenen Augen blies er den Rauch durch die Nase. Er schien genau zu wissen, dass er beobachtet wurde, denn er schob sich eine Hand unter die Achsel, so dass die Brustmuskeln und der Bizeps anschwollen. Wo hatte er die Muckis her? Mit Sicherheit nicht vom Sport, es sei denn, man zählte Nacktbaden und Billard dazu. Wahrscheinlich war es einfach die Art von guter Gesundheit, die in seiner Familie vererbt wurde, zusammen mit den Aktien, den Wertpapieren und den teuren Möbeln. Wie ein junger Gott, oder eben schön, die Boxershorts mit dem Paisleymuster bis auf die Hüftknochen heruntergezogen, war er nach vier Jahren College irgendwie hier in dem schmalen Bett ihres winzigen möblierten Zimmers gelandet. »Wie ein junger Gott«! Für wen hältst du dich, Jane Eyre? Werd erwachsen. Sei vernünftig. Reiß dich zusammen.
Sie nahm ihm die Zigarette aus dem Mund. »Ich kann mir vorstellen, wie du mit 40 bist«, sagte sie mit einer Spur Bosheit in der Stimme. »Ich sehs direkt vor mir.«
Er lächelte mit geschlossenen Augen. »Dann schieß mal los.«
»Na schön …« Sie setzte sich auf, die Decke unter die Achseln geklemmt. »Du hockst in ’nem offenen Sportkabrio in Kensington, Chelsea oder irgendeinem anderen Nobelviertel, und das Tolle an dem Auto ist, dass es absolut geräuschlos fährt, wie alle Autos im Jahr, keine Ahnung – 2006?«
Er rechnete mit zusammengekniffenen Augen. »2004 …«
»Das Auto schwebt zehn Zentimeter über dem Boden die Kings Road entlang, dein Bäuchlein klemmt unter dem Lederlenkrad wie ein kleines Kissen, du trägst diese Rennfahrerhandschuhe mit Luftlöchern, hast kein Kinn, und dein Haar lichtet sich. Du bist ein dicker Mann in einem kleinen Auto, knackbraun wie ein gebratener Truthahn …«
»Themenwechsel?«
»Und neben dir sitzt eine Frau mit Sonnenbrille, deine dritte, nein, vierte Frau, bildschön, ein Model, nein, ein Ex-Model, 23 Jahre alt, du hast sie getroffen, als sie bei einer Autoausstellung in Nizza auf einer Motorhaube lag oder so, und sie ist atemberaubend schön und dumm wie Brot …«
»Klingt gut. Kinder?«
»Keine Kinder, bloß drei Scheidungen, es ist ein Freitag im Juli, ihr seid auf dem Weg zu irgendeinem Landhaus, im winzigen Kofferraum deines schwebenden Autos liegen Tennis- und Krocketschläger, ein Korb voll mit edlem Weißwein, südafrikanischen Trauben, ein paar bedauernswerten kleinen Wachteln und Spargel, und der Wind weht dir durch die Geheimratsecken, du bist unglaublich selbstzufrieden, und Ehefrau Nummer drei, vier, weiß der Teufel, lächelt dich mit zweihundert strahlendweißen Beißerchen an, du lächelst zurück und versuchst zu verdrängen, dass ihr euch nichts, rein gar nichts zu sagen habt.«
Plötzlich brach sie ab. Du klingst total durchgeknallt, sagte sie sich. Versuch, normaler zu klingen. »Aber falls es dich tröstet, wir gehen sowieso alle vorher bei ’nem Atomkrieg drauf!«, fuhr sie fröhlich fort, doch er sah sie immer noch stirnrunzelnd an.
»Vielleicht sollte ich lieber gehen. Wenn ich so oberflächlich und verdorben bin …«
»Nein, geh nicht«, sagte sie, etwas zu schnell. »Es ist doch erst vier.«
Er rutschte nach oben, bis sein Gesicht nur noch Zentimeter von ihrem entfernt war. »Keine Ahnung, wie du zu dieser Vorstellung von mir kommst, du kennst mich doch kaum.«
»Ich kenne deinen Typ.«
»Meinen Typ?«
»Ich habe euch gesehen, ihr lungert bei den Literatur- und Sprachwissenschaften rum, grölt euch Sachen zu, schmeißt Dinnerpartys im Smoking …«
»Ich habe überhaupt keinen Smoking. Und grölen tu ich schon gar nicht …«
»Schippert in den Semesterferien auf Jachten durchs Mittelmeer, heititei, wir sind so toll …«
»Wenn ich so schrecklich bin …« Er legte ihr die Hand auf die Hüfte.
»… bist du.«
»… warum schläfst du dann mit mir?«
Seine Hand lag jetzt auf dem warmen weichen Fleisch ihres Schenkels.
»Hab ich strenggenommen doch gar nicht, oder?«
»Kommt drauf an.« Er beugte sich vor und küsste sie. »Definier den Begriff.« Er legte ihr die Hand auf das Kreuz und ließ ein Bein zwischen ihre gleiten.
»Übrigens«, murmelte sie, den Mund gegen seinen gepresst.
»Was?« Er spürte, wie sie das Bein um seines schlang und ihn enger an sich zog.
»Du müsstest dir mal die Zähne putzen.«
»Mich störts nicht, wenns dich nicht stört.«
»Es ist schrecklich«, lachte sie. »Du schmeckst nach Wein und Kippen.«
»Na, dann sind wir ja quitt. Du nämlich auch.«
Abrupt drehte sie den Kopf weg. »Echt?«
»Mich störts nicht. Ich steh auf Wein und Kippen.«
»Bin gleich wieder da.« Sie schlug die Decke zurück und kletterte über ihn hinweg.
»Wo willst du hin?« Er legte ihr die Hand auf den nackten Rücken.
»Bloß auf den Lokus«, sagte sie und fischte ihre Brille vom Bücherstapel neben dem Bett; ein dickes, schwarzes Kassengestell Modell Nullachtfünfzehn.
»›Lokus‹, ›Lokus‹ … das Wort ist mir leider …«
Einen Arm über die Brust gelegt, blieb sie stehen, wobei sie darauf achtete, ihm den Rücken zuzudrehen. »Bleib, wo du bist«, sagte sie, tappte aus dem Zimmer und hakte zwei Finger in den Bund ihres Schlüpfers, um ihn herunterzuziehen. »Und spiel nicht an dir rum, während ich weg bin.«
Er atmete durch die Nase aus, setzte sich auf, sah sich in dem schäbigen Zimmer um und wusste mit absoluter Gewissheit, irgendwo zwischen den Kunstpostkarten und fotokopierten Plakaten von engagierten Theaterstücken lag ein Foto von Nelson Mandela – wie das Bild eines Schwarms. In den vergangenen vier Jahren hatte er, über die Stadt verteilt wie Tatorte auf einer Karte, unzählige solcher Schlafzimmer gesehen, in denen man nie weiter als zwei Meter von einem Nina-Simone-Album entfernt war. Und obwohl er selten zweimal dasselbe Schlafzimmer besuchte, kam ihm alles nur zu bekannt vor. Die kaputten Nachtlichter, die verwelkten Topfpflanzen und der Waschmittelgeruch der billigen, schlecht sitzenden Laken. Sie hatte auch die für künstlerisch angehauchte Mädchen typische Vorliebe für Fotomontagen: Schnappschüsse von Kommilitonen und der Familie inmitten von Chagalls, Vermeers, Kandinskys, Che Guevaras, Woody Allens und Samuel Becketts. Nichts war neutral, alles verriet irgendeine Anhängerschaft oder einen Standpunkt. Das Zimmer war ein Manifest, und seufzend erkannte Dexter sie als die Art von Mädchen, die »Bourgeois« für ein Schimpfwort hält. Er verstand, warum »Faschist« negative Konnotationen hatte, aber er mochte das Wort »Bourgeois« und alles, was damit zusammenhängt. Sicherheit, Reisen, Ehrgeiz, gutes Essen und gute Manieren; weshalb sollte er sich dafür entschuldigen?
Er sah den Rauchkringeln seiner Zigarette aus seinem Mund nach. Dann machte er sich auf die Suche nach einem Aschenbecher und fand neben dem Bett ein Buch. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, dessen Rücken an den »erotischen« Stellen geknickt war. Das Schlimme an diesen ultraindividualistischen Mädchen war, dass sie alle gleich waren. Noch ein Buch: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Was für ein Idiot, dachte er in der Gewissheit, dass ihm so ein Irrtum nie unterlaufen würde.
Mit 23 Jahren hatte Dexter Mayhew ähnlich nebulöse Zukunftsvorstellungen wie Emma Morley. Er hoffte, Erfolg zu haben, seine Eltern stolz zu machen und mit mehr als einer Frau gleichzeitig zu schlafen, aber wie ließ sich das alles vereinbaren? Er wollte, dass Zeitschriftenartikel über ihn erschienen, und hoffte, es werde eines Tages eine Retrospektive seiner Werke geben, ohne einen Schimmer zu haben, was für Werke das sein könnten. Er wollte das Leben voll und ganz auskosten, ohne Schlamassel und Komplikationen. Wenn ein Fotograf von einem beliebigen Augenblick seines Lebens ein Foto machte, sollte es ein cooles Bild werden. Alles sollte perfekt aussehen. Es sollte jede Menge Spaß und nicht mehr Traurigkeit darin geben als unbedingt notwendig.
Das war kein besonders toller Plan, und er hatte auch schon Fehler gemacht. Diese Nacht beispielsweise würde bestimmt nicht ohne unangenehme Folgen bleiben: Tränen, peinliche Telefongespräche und Vorwürfe. Am besten, er verdrückte sich so schnell wie möglich, und zur Fluchtvorbereitung sah er sich nach seinen abgelegten Kleidern um. Als aus dem Badezimmer das warnende Scheppern und Rauschen einer antiken Toilettenspülung ertönte, legte er das Buch hastig zurück, fand unter dem Bett ein kleines gelbes Colman’s-Senfglas, öffnete es, um festzustellen, ja, es enthielt Kondome sowie die winzigen, grauen Überbleibsel eines Joints, die aussahen wie Mäusedreck. Das kleine gelbe Senfglas und die Aussicht auf Sex und Drogen gaben ihm neue Hoffnung, und er beschloss, wenigstens noch ein Weilchen zu bleiben.
Im Badezimmer wischte sich Emma Morley die Zahnpasta-Halbmonde aus den Mundwinkeln und fragte sich, ob das alles nicht ein schrecklicher Fehler war. Nach vierjähriger romantischer Durststrecke war sie endlich, endlich mit jemandem im Bett gelandet, den sie wirklich mochte, auf Anhieb gemocht hatte, seit sie ihn 1984 auf einer Party zum ersten Mal gesehen hatte, doch in ein paar Stunden würde er weg sein. Wahrscheinlich für immer. Er würde sie wohl kaum bitten, ihn nach China zu begleiten – und abgesehen davon boykottierte sie China. Aber er war in Ordnung, oder? Dexter Mayhew. Insgeheim hatte sie zwar den Verdacht, dass er nicht übermäßig helle und etwas zu selbstzufrieden war, aber er war beliebt, witzig und – das ließ sich nicht leugnen – verdammt gutaussehend. Weshalb war sie dann so kratzbürstig und sarkastisch? Wieso konnte sie nicht so selbstbewusst und amüsant sein wie die adretten, gutgelaunten Mädchen, mit denen er sonst herumhing? Morgenlicht drang durch das winzige Badezimmerfenster. Nüchternheit. Mit den Fingerspitzen fuhr sie sich durch das widerspenstige Haar, schnitt eine Grimasse, zog die Kette der antiken Klospülung und ging zurück ins Zimmer.
Vom Bett aus sah Dexter sie im Türrahmen auftauchen, sie trug das Barett und den Talar, die sie für die Abschlusszeremonie hatten ausleihen müssen, und schlang das Bein gespielt lasziv um den Türrahmen, in der Hand das zusammengerollte Abschlusszeugnis. Sie spähte über den Brillenrand und zog sich das Barett tief ins Gesicht. »Und, wie seh ich aus?«
»Steht dir. Besonders das kecke Hütchen. Und jetzt zieh das aus und komm zurück ins Bett.«
»Vergiss es. Ich habe 30 Mäuse dafür hingeblättert. Das muss man ausnutzen.« Sie schlang den Talar um sich wie ein Vampircape. Dexter zog daran, aber sie schlug mit der Zeugnisrolle nach ihm, setzte sich auf den Bettrand, nahm die Brille ab und schlüpfte aus dem Talar. Er erhaschte einen letzten Blick auf ihren nackten Rücken und die Rundung ihrer Brust, bevor sie sich ein schwarzes T-Shirt überzog, das sofortige Nuklearabrüstung forderte. Das wars dann wohl, dachte er. Nichts war sexuellem Begehren so abträglich wie ein langes schwarzes politisches T-Shirt, außer vielleicht ein Tracy-Chapman-Album.
Resigniert hob er das Zeugnis vom Boden auf, nahm das Gummiband ab, entrollte es und verkündete laut: »Englisch und Geschichte, Doppelabschluss, Einskommanull.«
»Da kannst du mit deinem ›Befriedigend‹ einpacken.« Sie griff nach dem Zeugnis. »He, vorsichtig damit.«
»Lässt es dir wohl einrahmen, was?«
»Meine Eltern lassen sich ’ne Tapete draus machen.« Sie rollte es fest zusammen und klopfte gegen die Enden. »Oder laminierte Platzdeckchen, oder meine Mum lässt es sich auf den Rücken tätowieren.«
»Wo sind deine Eltern überhaupt?«
»Och, nebenan.«
Er verzog das Gesicht. »Ohne Scheiß?«
Sie lachte. »Nö. Sind wieder nach Leeds gefahren. Dad findet, Hotels sind was für feine Pinkel.« Sie ließ die Rolle unterm Bett verschwinden. »Rutsch mal«, sagte sie und bugsierte ihn auf die kalte Bettseite. Er machte Platz, legte ihr etwas unbeholfen den Arm unter die Schultern und küsste sie versuchsweise auf den Hals. Sie zog das Kinn ein, um ihn anzusehen.
»Dex?«
»Hm.«
»Lass uns nur kuscheln, ja?«
»Klar doch. Wenn du möchtest«, sagte er galant, obwohl Kuscheln überhaupt nicht sein Ding war. Das war was für Großtanten und Teddybären. Vom Kuscheln bekam er einen Krampf. Besser, er gab sich geschlagen und trat schnellstmöglich den Rückzug an, aber sie legte ihm besitzergreifend den Kopf auf die Schulter, und so blieben sie eine Zeitlang steif und befangen liegen, bis sie sagte:
»Unfassbar, dass ich ›kuscheln‹ gesagt habe. Scheiße auch – kuscheln. Entschuldige.«
Er lächelte. »Schon okay. Wenigstens wars nicht knuddeln.«
»Knuddeln ist übel.«
»Oder schmusen.«
»Schmusen ist grausam. Schwören wir feierlich, nie, nie zu schmusen«, sagte sie und bereute die Bemerkung sofort. Was, miteinander? Eher unwahrscheinlich. Sie schwiegen wieder. In den letzten acht Stunden hatten sie geredet und geknutscht, und beide verspürten die tiefe, körperliche Erschöpfung, die bei Sonnenaufgang einsetzt. Im überwucherten Garten hinter dem Haus sangen die Amseln.
»Ich mag das Geräusch«, murmelte er in ihr Haar. »Amseln bei Sonnenaufgang.«
»Ich hasse es. Gibt mir das Gefühl, was getan zu haben, das ich bereuen werde.«
»Deshalb mag ich es ja«, sagte er in dem erneuten Versuch, düster und charismatisch zu klingen. Kurz darauf fügte er hinzu: »Hast du das denn?«
»Was?«
»Etwas getan, das du bereuen wirst?«
»Du meinst, das hier?« Sie drückte ihm die Hand. »Oh, ich schätze schon. Weiß ich noch nicht, oder? Frag mich morgen noch mal. Und du?«
Er küsste sie aufs Haar. »Natürlich nicht«, sagte er und dachte: Das darf nie, nie wieder vorkommen.
Zufrieden schmiegte sie sich enger an ihn. »Wir sollten schlafen.«
»Wozu? Morgen steht nichts an. Keine Abgabetermine, keine Arbeit …«
»Nur der Rest unseres Lebens«, sagte sie schläfrig, atmete seinen wunderbar warmen, muffigen Geruch ein, während ihr bei dem Gedanken an ein unabhängiges Erwachsenenleben ein unbehaglicher Schauder über den Rücken kroch. Emma fühlte sich nicht erwachsen. Sie war völlig unvorbereitet. Es war, als wäre mitten in der Nacht ein Feueralarm losgegangen und sie stehe mit einem Kleiderbündel im Arm auf der Straße. Was sollte sie nach der ganzen Lernerei jetzt tun? Was sollte sie mit ihrer Zeit anfangen? Sie hatte nicht die leiseste Ahnung.
Der Trick ist, sagte sie sich, mutig und unerschrocken zu sein und etwas zu verändern. Vielleicht nicht gleich die ganze Welt, nur das kleine Stück um dich herum. Geh da raus mit deinem Doppeleinserabschluss, deiner Leidenschaft und der neuen, elektrischen Smith-Corona-Schreibmaschine und arbeite hart … woran auch immer. Vielleicht das Leben mithilfe der Kunst zu verändern. Schreib etwas Schönes. Kümmer dich um deine Freunde, bleib deinen Prinzipien treu, leb dein Leben gut, leidenschaftlich und in vollen Zügen. Mach neue Erfahrungen. Liebe und werde geliebt, wenn es irgendwie geht. Iss vernünftig. Etwas in der Richtung.
Das war zwar keine berauschende Lebensphilosophie und bestimmt keine, die sie jemandem mitteilen konnte, am allerwenigstem diesem Mann hier, aber sie glaubte daran. Und bislang waren die ersten paar Stunden ihres unabhängigen Erwachsenenlebens doch ganz in Ordnung gewesen. Vielleicht fand sie ja am nächsten Morgen, nach Tee und Aspirin, den Mut, ihn wieder ins Bett zu bitten. Bis dahin wären sie wieder nüchtern, was die Sache nicht erleichterte, aber vielleicht würde es ihr ja Spaß machen. Die wenigen Male, die Emma mit Jungs ins Bett gegangen war, hatte sie entweder einen Kicheranfall bekommen oder war in Tränen ausgebrochen, und es wäre nett, mal irgendwas dazwischen zu erleben. Sie fragte sich, ob noch Kondome im Senfglas waren. Wahrscheinlich schon, zumindest waren noch welche da gewesen, als sie das letzte Mal nachgeschaut hatte: Februar 1987, Vince, ein Chemieingenieur mit behaartem Rücken, der sich mit ihrem Kissenbezug die Nase geputzt hatte. Zauber der Liebe …
Draußen wurde es hell. Dexter sah das rötliche Licht durch die dicken Wintervorhänge schimmern, die zum Inventar gehörten. Um sie nicht zu wecken, streckte er vorsichtig den Arm aus, ließ die Zigarettenkippe in eine Tasse Wein fallen und starrte an die Decke. An Schlaf war nicht zu denken. Stattdessen würde er Muster in das graue Artex knibbeln, bis sie fest eingeschlafen war, und sich dann klammheimlich davonstehlen.
Wenn er sich jetzt vom Acker machte, würde er sie allerdings nie wieder sehen. Ob es ihr etwas ausmachen würde? Vermutlich schon, das war meistens so. Und er? Vier Jahre lang war er problemlos ohne sie ausgekommen. Bis zur gemeinsamen Nacht hatte er geglaubt, sie hieße Anna, und trotzdem hatte er auf der Party nicht den Blick von ihr abwenden können. Warum war sie ihm erst jetzt aufgefallen? Er betrachtete ihr Gesicht, während sie schlief.
Emma war hübsch, aber das schien sie zu ärgern. Ihr rot gefärbtes Haar war fast fahrlässig schlecht geschnitten, vermutlich tat sie es selbst vor einem Spiegel oder ließ das von Tilly Dingsbums erledigen, ihrer lauten, stämmigen Mitbewohnerin. Die leicht aufgedunsene, blasse Haut verriet, dass sie zu viel Zeit in Bibliotheken oder beim Biertrinken in Pubs verbrachte, und die Brille ließ sie spröde und eulenhaft wirken. Das Kinn sah weich und leicht mollig aus, aber das war vielleicht nur Babyspeck (oder durfte man »mollig« und »Babyspeck« heute nicht mehr sagen, so, wie man ihr nicht sagen konnte, dass sie geile Brüste hatte, ohne dass sie ausrastete, selbst wenn es stimmte).
Egal, zurück zu ihrem Gesicht. Die Spitze ihrer hübschen, kleinen Nase glänzte leicht fettig, und sie hatte ein paar winzige rote Pickel auf der Stirn, aber ansonsten ließ sich nicht leugnen, dass – nun, ihr Gesicht war hinreißend. Sie hatte die Augen geschlossen, und er konnte sich nicht an die genaue Farbe erinnern, nur, dass sie groß und leuchtend waren und Humor verrieten; wie die beiden ausgeprägten Lachfältchen um den breiten Mund, die sich noch vertieften, wenn sie lächelte, was sie anscheinend oft tat. Glatte, rosige, einladend warm aussehende Wangen. Die ungeschminkten, weichen, himbeerroten Lippen, die sie beim Lächeln fest zusammenpresste, vielleicht um die Tatsache zu verbergen, dass ihre Zähne einen Tick zu groß waren oder dass ein Stück des Schneidezahns abgebrochen war: All das erweckte den Eindruck, als unterdrückte sie ein Lachen, eine kluge Bemerkung oder irgendeinen tollen, geheimen Witz.
Wenn Dexter jetzt abhaute, würde er dieses Gesicht möglicherweise nie wieder sehen, außer vielleicht in zehn Jahren bei irgendeinem schrecklichen Jahrgangstreffen. Sie hätte zugenommen, wäre desillusioniert und würde ihm vorwerfen, dass er sich ohne Abschied davongestohlen hatte. Besser, er verdrückte sich heimlich und mied Jahrgangstreffen. Immer vorwärts, kein Blick zurück. Da draußen gab es noch jede Menge andere Gesichter.
Als er sich gerade entschieden hatte, verzog sie den Mund zu einem breiten Lächeln und sagte mit geschlossenen Augen:
»Und, was hältst du davon, Dex?«
»Wovon, Em?«
»Uns beiden. Ist es die große Liebe, was meinst du?«, und sie lachte leise mit fest geschlossenen Lippen.
»Schlaf einfach, ja?«
»Dann hör auf, mich anzustarren.« Sie öffnete die Augen, die blaugrün, strahlend und scharfsinnig waren. »Welcher Tag ist morgen?«, murmelte sie.
»Du meinst heute?«
»Heute. Der strahlende, neue Tag, der uns erwartet.«
»Es ist Freitag. Freitag, den ganzen Tag. Der Tag des heiligen Swithin, um genau zu sein.«
»Was für ein Tag?«
»Alte Bauernregel. Wenns heute regnet, regnet es noch 40 Tage weiter, den ganzen Sommer oder irgendwas in der Richtung.«
Sie runzelte die Stirn. »Das ergibt keinen Sinn.«
»Soll es ja auch nicht. Es ist ein Aberglaube.«
»Wo soll es denn regnen? Es regnet doch immer irgendwo.«
»Auf St. Swithins Grab. Es liegt vor der Kathedrale von Winchester.«
»Woher weißt du das?«
»Ich bin da zur Schule gegangen.«
»Nobel geht die Welt zugrunde«, murmelte sie ins Kissen.
»›Gibts Regen am St.-Swithins-Tag, Dingsda dumdidum nicht enden mag.‹«
»Wie poetisch.«
»Na ja, war ein freies Zitat.«
Sie lachte wieder und hob schläfrig den Kopf. »Dex?«
»Em?«
»Was, wenn es heute nicht regnet?«
»M-hm.«
»Hast du schon was vor?«
Sag ihr, du hast keine Zeit.
»Nichts Besonderes«, antwortete er.
»Hast du Lust, was zu unternehmen? Mit mir, meine ich?«
Warte, bis sie schläft, und zieh Leine.
»Ja. Geht klar«, sagte Dexter. »Lass uns was unternehmen.«
Emma ließ den Kopf wieder aufs Kissen sinken. »Ein ganz neuer Tag«, murmelte sie.
»Ein ganz neuer Tag.«
KAPITEL ZWEI Zurück ins Leben
Samstag, 15. Juli 1989
Wolverhampton und Rom
Mädchen-Umkleideraum Stoke-Park-Gesamtschule Wolverhampton 15. Juli 1989
Ciao, Bello!
Wie gehts dir? Und wie ist Rom? Die Ewige Stadt mag ja ganz nett sein, aber ich bin jetzt erst seit zwei Tagen in Wolverhampton, und es kommt mir schon wie eine Ewigkeit vor (obwohl ich zugeben muss, der hiesige Pizza Hut ist ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet).
Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich beschlossen, den Job bei der Sledgehammer-Theater-Genossenschaft anzunehmen, von dem ich dir erzählt habe, und in den letzten vier Monaten haben wir »Furchtbare Fracht« geschrieben, geprobt und sind damit getourt, es ist ein von der Akademie der Künste gefördertes Spektakel über den Sklavenhandel mit Geschichten, Folksongs und ziemlich schockierenden Pantomime-Einlagen. Ich habe eine schlecht fotokopierte Broschüre beigelegt, damit du dich mit eigenen Augen davon überzeugen kannst, was für eine anspruchsvolle Nummer es ist.
Furchtbare Fracht ist ein TP-Stück (Theaterpädagogik für dich) für Elf- bis Dreizehnjährige und vertritt den kontroversen Standpunkt, dass Sklaverei etwas ganz Schlimmes ist. Ich spiele Lydia, die, hm, nun ja, die HAUPTROLLE, um genau zu sein, die eitle, verwöhnte Tochter des bösen Sir Obadiah Grimm (erkennst du am Namen, wie böse er ist?), und in der ergreifendsten Szene erkenne ich schließlich, dass all meine hübschen Sachen, all die Kleider (deutet auf Kleid) und Juwelen (ebenso), mit dem Blut meiner Mitmenschen erkauft sind (schluchz-heul) und dass ich mich schmutzig fühle (starrt Hände an, als wären sie BLUTBESUDELT), schmutzig bis in die SEEEEEEEEELE. Es ist eine ziemlich ergreifende Szene, auch wenn ein paar Schüler sie gestern Abend ruiniert haben, indem sie mir M&Ms an den Kopf geworfen haben.
Aber im Ernst, im Großen und Ganzen ist es gar nicht so übel, keine Ahnung, warum ich so zynisch bin, wahrscheinlich ein Abwehrmechanismus. Wir kriegen eigentlich gute Reaktionen von den Jugendlichen im Publikum, d.h. von denen, die nicht mit Sachen schmeißen, und wir halten echt spannende Workshops in den Schulen ab. Schon erstaunlich, wie wenig die Jugendlichen, sogar die aus der Karibik, über ihr kulturelles Erbe und ihre Herkunft wissen. Das Schreiben hat auch Spaß gemacht, und ich habe jede Menge Anregungen für Stücke und andere Sachen bekommen. Ich finde, es lohnt sich, auch wenn du das Ganze für Zeitverschwendung hältst. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir etwas verändern können, Dexter. Ich meine, es gab unglaublich viele radikale Theaterstücke im Deutschland der 30er-Jahre, und sieh nur, was DAS für einen Unterschied gemacht hat. Wir werden die Diskriminierung in den West Midlands auslöschen, und wenn wir uns jeden Schüler einzeln vorknöpfen müssen.
Wir sind vier Schauspieler in der Truppe. Kwame ist der Edle Sklave, und dafür, dass wir Herrin und Diener spielen, kommen wir ganz gut klar (obwohl, als ich ihn neulich im Café gebeten habe, mir eine Packung Chips mitzubringen, hat er mich angeguckt, als wollte ich ihn UNTERDRÜCKEN oder so). Aber er ist nett und nimmt die Arbeit ernst, obwohl er bei den Proben viel geflennt hat, was ich leicht übertrieben fand. Er ist eine kleine Heulsuse, wenn du verstehst. Im Stück soll eine starke erotische Spannung zwischen uns bestehen, aber einmal mehr imitiert das Leben nicht die Kunst.
Dann gibt es noch Sid, der meinen bösen Vater Obadiah spielt. Ich weiß, du hast deine Kindheit damit verbracht, auf einem gottverdammt tollen Kamillen-Rasen Kricket zu spielen, anstatt so was Abgeschmacktes zu tun wie fernsehen, aber Sid war früher mal ein recht bekannter Darsteller in einer Krimiserie namens City Beat, und seine Wut darüber, HIERZU gezwungen zu sein, schimmert durch. Pantomime lehnt er kategorisch ab, als wäre es unter seiner Würde, mit einem nichtexistenten Gegenstand gesehen zu werden. Und er fängt jeden zweiten Satz mit »Als ich noch beim Fernsehen war« an, soll heißen, »Als ich noch glücklich war«. Sid pinkelt in Waschbecken, trägt gruselige Polyester-Hosen, die man ABWISCHT, anstatt sie zu waschen, ernährt sich von Fleischpasteten aus der Tanke, und Kwame und ich halten ihn für einen verkappten Rassisten, aber ansonsten ist er ein reizender Mensch, wirklich ganz, ganz reizend.
Und dann ist da noch Candy, ach, Candy. Sie würde dir gefallen, denn sie ist genau so zuckersüß, wie sie klingt. Candy spielt das Freche Dienstmädchen, einen Plantagenbesitzer und Sir William Wilberforce. Sie ist wunderschön, spirituell und, obwohl ich das Wort nicht mag, eine echte Zicke. Sie fragt mich ständig, wie alt ich wirklich bin, sagt mir, ich sehe erschöpft aus und mit Kontaktlinsen könnte ich fast hübsch sein, was ich natürlich TOLL finde. Sie lässt deutlich raushängen, dass sie nur mitmacht, um eine Gewerkschaftskarte zu bekommen und die Zeit totzuschlagen, bis sie von irgendeinem Hollywood-Produzenten entdeckt wird, denn die haben ja bekanntlich nichts Besseres zu tun, als an einem verregneten Dienstagnachmittag auf der Suche nach angesagten neuen Theaterpädagogik-Talenten durch Dudley zu streifen. Schauspielerei ist echt scheiße, was? Bei der Gründung der STG (Sledgehammer-Theater-Genossenschaft) haben wir großen Wert darauf gelegt, ein progressives Theaterkollektiv ohne diesen ganzen Ego-Ruhm-ins-Fernsehen-kommen-Ego-Angeberei-Schwachsinn aufzubauen, um wirklich gutes, aufregendes, originelles, politisches, selbstverfasstes Theater zu machen. Das mag in deinen Ohren dämlich klingen, aber genau das war unser Plan. Das einzige Problem bei demokratischen, gleichberechtigten Kollektiven ist, dass man Blindgängern wie Sid und Candy zuhören muss. Alles wäre halb so wild, wenn sie spielen könnte, aber ihr Newcastle-Akzent ist unglaublich, als hätte sie einen Schlaganfall gehabt, außerdem macht sie gern Yoga-Übungen in Unterwäsche. Da, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit, stimmts? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in Strapsen und Korsage den Sonnengruß habe machen sehen. Da stimmt doch was nicht, oder? Der arme, alte Sid schafft es kaum mehr, seine Curry-Fleischpastete zu mümmeln, er verfehlt ständig den Mund. Wenn sie sich schließlich was anzieht, um auf die Bühne zu gehen, und einer der Jugendlichen anzüglich pfeift, macht sie anschließend im Minibus einen auf beleidigte Feministin. »Ich kann nicht ausstehen, wenn man mich auf mein Äußeres reduziert, mein ganzes Leben lang bin ich nach meinem exquisiten Gesicht und dem knackigen jungen Körper beurteilt worden«, sagt sie und rückt den Strapsgürtel zurecht, als wäre das ein ernstes, POLITISCHES Problem, als sollten wir politisches Straßentheater über das Leid von Frauen mit tollen Titten machen. Habe ich mich zum Schwadronieren hinreißen lassen? Bist du schon in sie verknallt? Vielleicht stelle ich sie dir vor, wenn du wieder da bist. Ich sehs schon vor mir, du schaust sie mit angespanntem Kiefer an, knabberst an deiner Lippe und fragst nach ihrer Karrieeere. Vielleicht mache ich euch doch nicht bekannt …
Emma Morley drehte das Blatt um, als Gary Nutkin, der dünne, angespannt wirkende Regisseur und Mitbegründer der Sledgehammer-Theater-Genossenschaft, hereinkam, um seine motivierende Ansprache zu halten. Die Unisex-Garderobe war eigentlich der Mädchenumkleideraum einer innerstädtischen Gesamtschule, die selbst am Wochenende immer noch den typischen Schulgeruch verströmte: Hormone, rosa Flüssigseife und moderige Handtücher.
Im Türrahmen räusperte sich Gary Nutkin, ein blasser Mann mit Rasurbrand und bis obenhin zugeknöpftem, schwarzem Hemd, dessen persönliche Stil-Ikone George Orwell war. »Viel Publikum heute Abend, Leute! Die Aula ist fast halb voll, nicht schlecht, in Anbetracht der Umstände!«, sagte er, ohne auszuführen, welche Umstände, vielleicht war er auch von Candy abgelenkt, die gerade in einem gepunkteten Einteiler Beckenrollen übte. »Bieten wir ihnen eine Wahnsinnsshow, Leute. Hauen wir sie um!«
»Ich würd sie gern umhauen«, knurrte Sid, beobachtete Candy und spielte mit Pastetenkrümeln. »Mit ’nem Kricketschläger voller Nägel, die kleinen Mistkäfer.«
»Immer positiv bleiben, ja, Sid?«, beschwor ihn Candy und atmete langsam und kontrolliert aus.
Gary fuhr fort. »Denkt daran, haltet es peppig, stellt einen Kontakt her, spielt lebhaft, sprecht den Text, als wärs das erste Mal, und das Wichtigste ist, lasst euch auf keinen Fall vom Publikum einschüchtern oder provozieren. Interaktion ist großartig. Rache nicht. Lasst euch nicht von denen auf die Palme bringen. Tut ihnen nicht den Gefallen. Noch fünfzehn Minuten!«, und mit diesen Worten schloss Gary die Garderobentür wie ein Gefängniswärter.
Sid begann sein allabendliches Aufwärmritual, die gemurmelte Beschwörungsformel Ich-hasse-diesen-Job-ich-hasse-diesen-Job. Hinter ihm saß Kwame verloren mit nacktem Oberkörper und in zerlumpten Hosen, die Hände unter die Achseln geschoben, den Kopf nach hinten gelehnt, vielleicht weil er meditierte oder versuchte, nicht zu weinen. Links von Emma sang Candy mit hohem, ausdruckslosem Sopran Lieder aus Les Misérables und pulte an den in 18 Jahren Balletttraining erworbenen Hammerzehen herum. Emma wandte sich wieder dem gesprungenen Spiegel zu, bauschte die Puffärmel ihres Empirekleides auf, nahm die Brille ab und seufzte wie die Heldin eines Jane-Austen-Romans.
Das letzte Jahr hatte aus einer Serie von Sackgassen, Fehlentscheidungen und abgebrochenen Projekten bestanden. Da war die Mädchenband, in der sie Bass gespielt hatte, die nacheinander Throat, Slaughterhouse Six und Bad Biscuit geheißen hatte und sich für keinen Namen, geschweige denn eine Musikrichtung, entscheiden konnte. Da waren die alternative Clubnacht, zu der keiner gekommen war, der unvollendete erste Roman, der unvollendete zweite Roman und mehrere erbärmliche Sommerjobs als Kaschmir- und Tartan-Verkäuferin für Touristen. Am absoluten Tiefpunkt hatte sie einen Zirkuskurs belegt, um ihre artistischen Fertigkeiten zu entwickeln, bis sich herausstellte, dass Emma keine hatte. Trapez war auch keine Lösung.
Der vielbeschworene Second Summer of Love war voller Trübsinn und verlorenem Schwung gewesen. Selbst ihr geliebtes Edinburgh hatte angefangen, sie zu langweilen und deprimieren. Weiter in der Universitätsstadt zu wohnen, hatte sich angefühlt, als bliebe man als Einziger auf einer Party zurück, die alle anderen schon verlassen haben, weshalb sie im Oktober ihre Wohnung in der Rankeillor Street aufgegeben hatte und für einen langen, angespannten, feuchten Winter voll gegenseitiger Beschuldigungen, Türenknallen und Fernsehen am Nachmittag wieder zurück in ihr Elternhaus gezogen war, das ihr jetzt unfassbar klein vorkam. »Aber du hast doch eine Doppel-Einskommanull! Was ist mit deiner Doppel-Einskommanull?«, fragte ihre Mutter sie täglich, als sei Emmas Abschluss eine Superkraft, die zu benutzen sie sich hartnäckig weigerte. Ihre jüngere Schwester Marianne, eine glücklich verheiratete Krankenschwester mit einem neugeborenen Baby, kam abends vorbei, um über das tief gesunkene Goldmädchen der Eltern zu triumphieren.
Hin und wieder war da allerdings Dexter Mayhew. In den wenigen letzten warmen Sommertagen nach dem Abschluss hatte sie ihn in dem wunderschönen Haus seiner Familie in Oxfordshire besucht; in ihren Augen war es eher eine Villa, ein ausladendes Gebäude aus den Zwanzigerjahren mit verblichenen Teppichen, großen abstrakten Gemälden und Eiswürfeln in den Drinks. In dem weitläufigen, nach Kräutern duftenden Garten hatten sie einen langen, faulen Tag zwischen dem Swimmingpool und dem Tennisplatz verbracht, die ersten nicht-öffentlichen, die sie je gesehen hatte. Als Emma in einem Korbsessel saß, einen Gin Tonic trank und die Aussicht bewunderte, musste sie an Der große Gatsby denken. Natürlich hatte sie es verpatzt, war nervös geworden, hatte beim Abendessen einen über den Durst getrunken und Dexters Vater – einen sanften, bescheidenen, äußerst vernünftigen Mann – wegen Nicaragua angeschrien, während Dexter sie liebevoll, aber enttäuscht ansah wie einen Welpen, der auf den Teppich gemacht hat. Hatte sie wirklich am Familientisch gesessen, ihr Essen gegessen und seinen Vater einen Faschisten genannt? In der Nacht lag sie benommen und reumütig im Gästezimmer und wartete auf ein Klopfen an der Tür, das sicherlich nie kommen würde; romantische Hoffnungen, geopfert für die Sandinisten, die es ihr schwerlich danken würden.
Im April hatten sie sich in London bei der Party zum 23. Geburtstag ihres gemeinsamen Freundes Callum wiedergesehen, den gesamten nächsten Tag gemeinsam in Kensington Gardens verbracht, Wein aus der Flasche getrunken und geredet. Er hatte ihr zwar offensichtlich verziehen, aber ihre Beziehung war zum Verrücktwerden freundschaftlich geworden; zumindest fand Emma es zum Verrücktwerden, als sie so dicht beieinander im frischen Frühlingsgras lagen, dass ihre Hände sich fast berührten, und er ihr von Lola erzählte, dem unglaublichen spanischen Mädchen, das er beim Skifahren in den Pyrenäen kennengelernt hatte.
Und dann ging er wieder auf Reisen, um seinen Horizont noch mehr zu erweitern. Es stellte sich heraus, dass China für Dexters Geschmack zu fremd und ideologisch war, und stattdessen brach er zu einer gemächlichen einjährigen Tour durch die »Partystädte« auf, wie sie in den Reiseführern genannt wurden. Deshalb waren sie jetzt Brieffreunde, Emma schrieb lange, leidenschaftliche Briefe voller Witze, unterstrichener Wörter, gezwungenem Geplänkel und kaum verhohlener Sehnsucht; aus 2000 Wörtern bestehende Liebesbeweise auf Luftpostpapier. Wie selbst aufgenommene Kassetten sind Briefe ein Mittel, um unausgesprochene Gefühle auszudrücken, und sie verschwendete eindeutig zu viel Zeit und Energie darauf. Im Gegenzug schickte Dexter ihr unzureichend frankierte Postkarten: »Amsterdam ist IRRE«, »Barcelona ist WAHNSINN«, »Dublin ROCKT. Heute Morgen gekotzt wie ein REIHER«. Als Reiseschriftsteller war er kein Bruce Chatwin, trotzdem ließ sie die Postkarten in die Tasche ihres dicken Mantels gleiten, um auf ausgedehnten, schwermütigen Spaziergängen durch Ilkley Moor über den verborgenen Sinn von »VENEDIG TOTAL ABGESOFFEN!!!!« nachzugrübeln.
»Wer ist denn dieser Dexter?«, fragte ihre Mutter mit einem Blick auf die Rückseite der Postkarten. »Ist er dein Freund?« Und mit besorgtem Blick fügte sie hinzu: »Hast du dir schon mal überlegt, für die Gaswerke zu arbeiten?« Emma bekam einen Job hinter der Bar des örtlichen Pubs, die Zeit verging, und ihr Hirn wurde weich wie etwas, das man ganz hinten im Kühlschrank vergessen hat.
Dann hatte sie einen Anruf von Gary Nutkin bekommen, dem mageren Trotzki-Fan, der damals im Jahr 86 in der sachlichen, kompromisslosen Aufführung von Furcht und Elend im Dritten Reich, an der sie mitgewirkt hatte, Regie geführt und sie dann bei der Abschlussfeier drei Stunden lang sachlich und kompromisslos geküsst hatte. Kurz darauf hatte er sie in eine Peter-Greenaway-Doppelvorstellung mitgenommen und ihr erst nach vier Stunden gedankenverloren eine Hand auf die linke Brust gelegt, als wollte er an einem Dimmer drehen. Später am Abend hatten sie sich in einem muffigen Einzelbett unter einem Poster von Schlacht um Algiers einer Brecht’schen Liebesnacht hingegeben, wobei Gary darauf bedacht war, sie nicht zum Objekt zu machen. Danach nichts, kein Wort, bis zu jenem nächtlichen Anruf im Mai und den zögerlichen, sanften Worten: »Wie würde es dir gefallen, meiner Theatergenossenschaft beizutreten?«
Emma hatte keine schauspielerischen Ambitionen und schätzte das Theater nur als Medium zur Vermittlung von Worten und Ideen. Aber Sledgehammer sollte eine neue Art progressiver Theatergenossenschaft werden, mit gemeinsamen Absichten, einem gemeinsamen Ziel, einem schriftlichen Manifest und dem festen Willen, das Leben junger Menschen mithilfe der Kunst zu verändern. Vielleicht ergab sich ja eine Romanze, dachte Emma, oder zumindest Sex. Sie packte einen Rucksack, verabschiedete sich von ihren skeptischen Eltern und brach im Minibus auf, als handele es sich um eine große Sache, eine Art theatralischen Spanischen Bürgerkrieg, gesponsert von der Akademie der Künste.
Aber was war drei Monate später aus der Wärme, dem Kameradschaftsgeist, dem gesellschaftlichen Nutzen und den mit Spaß gepaarten hohen Idealen geworden? Immerhin waren sie doch eine Genossenschaft. Zumindest stand das auf dem Minibus, sie hatte den Schriftzug selbst angebracht. Ich-hasse-diesen-Job-ich-hasse-diesen-Job, murmelte Sid. Emma hielt sich die Ohren zu und stellte sich ein paar grundlegende Fragen:
Was mache ich eigentlich hier?
Verändere ich wirklich etwas?
Warum zieht sie sich nicht endlich was an?
Was riecht hier so komisch?
Wo möchte ich jetzt eigentlich sein?
Sie wollte in Rom sein, bei Dexter Mayhew. Im Bett.
»Shaf-tes-bu-ry Avenue.«
»Nein, Shafts-bu-ry. Drei Silben.«
»Ly-ches-ter Square.«
»Leices-ter Square, zwei Silben.«
»Warum nicht Ly-chester?«
»Keine Ahnung.«
»Du bist doch mein Lehrer, du musst das doch wissen.«
»Sollte ich wohl.« Dexter zuckte die Achseln.
»Es ist dumme Sprache«, sagte Tove Angstrom und boxte ihn auf die Schulter.
»Eine dumme Sprache. Da hast du völlig Recht. Trotzdem kein Grund, mich zu schlagen.«
»Ich entschuldige mich«, sagte Tove, küsste ihn erst auf die Schulter, dann den Hals und den Mund, und einmal mehr war Dexter erstaunt, wie befriedigend Unterrichten sein konnte.
Sie lagen auf einem Kissenstapel auf dem Terrakottaboden seines winzigen Zimmers, weil das Einzelbett sich für ihre Zwecke als zu klein erwiesen hatte. In der Broschüre der Internationalen Percy-Shelley-Englischschule wurden die Lehrerunterkünfte als »einige komfortabel mit vielen mildernden Umständen« beschrieben, was es auf den Punkt brachte. Sein Zimmer im Centro Storico war langweilig und unpersönlich, aber wenigstens gab es einen Balkon, ein geschirrtuchgroßes Sims über einem malerischen Platz, der ganz nach römischer Sitte zugleich als Parkplatz diente. Jeden Morgen weckte ihn das Geräusch der ausparkenden Büroangestellten, die sich forsch-fröhlich gegenseitig anfuhren.
An diesem schwülen Julinachmittag hörte man allerdings nur die Räder der Touristenkoffer auf dem Kopfsteinpflaster rattern, und sie lagen bei weit geöffneten Fenstern da, küssten sich träge, und ihr dichtes, dunkles Haar, das ihm im Gesicht klebte, roch nach irgendeinem dänischen Shampoo; künstlicher Pinienduft und Zigarettenrauch. Sie griff über ihn hinweg nach der Packung am Boden, zündete zwei Zigaretten an, gab ihm eine, und er richtete sich in den Kissen auf, die Zigarette im Mundwinkel wie Belmondo oder ein Darsteller aus einem Fellini-Film. Er hatte noch keinen Belmondo- oder Fellini-Film gesehen, kannte aber die coolen Schwarzweißpostkarten. Dexter hielt sich eigentlich nicht für eitel, aber es gab zweifellos Zeiten, wo er wünschte, jemand würde ein Foto von ihm machen.
Sie küssten sich wieder, und er fragte sich flüchtig, ob die Situation irgendwelche moralischen oder ethischen Dimensionen hatte. Natürlich wäre der richtige Zeitpunkt, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob er mit einer Schülerin schlafen sollte oder nicht, nach der Schulfete gewesen, als Tove schwankend auf der Bettkante saß und sich die kniehohen Stiefel auszog. Selbst im Rausch von Rotwein und Lust hatte er sich bei der Frage ertappt, was Emma Morley wohl davon halten würde. Selbst als Tove ihm die Zunge ins Ohr steckte, hatte er sich innerlich eine Verteidigung zurechtgelegt: Sie ist neunzehn, erwachsen, und ich bin gar kein richtiger Lehrer. Außerdem war Emma im Augenblick weit weg, veränderte von einem Minibus auf der Umgehungsstraße einer Provinzstadt aus die Welt, und was hatte das Ganze überhaupt mit Emma zu tun? Toves kniehohe Stiefel standen jetzt umgeknickt in der Zimmerecke des Wohnheims, wo Übernachtungsgäste streng verboten waren.
Dexter wälzte sich auf ein kühleres Terrakottafleckchen, spähte aus dem Fenster und versuchte, anhand des kleinen viereckigen Ausschnitts strahlendblauen Himmels die Uhrzeit abzuschätzen. Toves Atem verlangsamte sich, als sie einschlief, aber er hatte noch eine wichtige Verabredung. Er ließ die letzten zwei Fingerbreit Zigarette in ein Weinglas fallen und streckte sich nach seiner Armbanduhr, die auf einem ungelesenen Exemplar von Primo Levis Ist das ein Mensch? lag.
»Tove, ich muss los.«
Protestierend stöhnte sie auf.
»Ich treffe mich mit meinen Eltern. Ich muss gehen.«
»Kann ich mitkommen?«
Er lachte. »Das geht nicht, Tove. Außerdem schreibst du am Montag einen Grammatiktest. Geh üben.«
»Du testest mich. Teste mich jetzt.«
»Na schön, Verben. Präsens.«
Sie schlang ein Bein um ihn und zog sich auf ihn. »Ich küsse, du küsst, er küsst, sie küsst …«
Er stützte sich auf. »Wirklich, Tove …«
»Nur zehn Minuten«, flüsterte sie ihm ins Ohr, und Dexter sank zurück auf den Boden. Warum nicht, dachte er. Schließlich bin ich in Rom, es ist ein schöner Tag. Ich bin vierundzwanzig Jahre alt, finanziell abgesichert und kerngesund. Ich will so viel erleben wie nur irgend möglich, ich tue etwas, das ich nicht tun sollte, und ich habe ein Riesenschwein. Wahrscheinlich ließ die Anziehungskraft eines Lebens, das den Sinnenfreuden, dem Vergnügen und dem Ego gewidmet ist, irgendwann nach, aber bis dahin war noch jede Menge Zeit.
Und wie gefällt dir Rom? Wie ist La Dolce Vita? (Schlags nach.) Ich sehe dich vor mir, wie du an einem Cafétisch sitzt, einen dieser »Cappuccinos« trinkst, von denen alle reden, und allem hinterherpfeifst, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wahrscheinlich liest du das hier mit Sonnenbrille. Nimm sie ab, du siehst peinlich aus. Hast du die Bücher bekommen, die ich dir geschickt habe? Primo Levi ist ein großartiger italienischer Autor. Das soll dich daran erinnern, dass das Leben nicht nur aus Gelati und Espadrilles besteht. Im Leben gehts nicht immer zu wie in der Eröffnungsszene von»Betty Blue«. Und wie gefällt dir das Unterrichten? Bitte versprich mir, dass du nicht mit den Schülerinnen schläfst. Das wäre einfach nur … enttäuschend.
Ich muss los. Das Seitenende droht, und aus dem Nebenraum kann ich das aufregende Geräusch von Zuschauern hören, die murmeln und sich gegenseitig mit Stühlen bewerfen. In zwei Wochen bin ich fertig mit dem Job, GOTT SEI DANK, und dann will Gary Nutkin, unser Regisseur, dass ich ein Stück über Apartheid für Vorschüler schreibe. Mit PUPPEN, Himmel, Arsch und Zwirn. Sechs Monate in einem Transit auf der M6 mit einer Desmond-Tutu-Marionette auf dem Schoß. Das schenke ich mir doch lieber. Außerdem habe ich ein Zwei-Frauen-Stück über Virginia Woolf und Emily Dickinson namens »Zwei Leben« (oder alternativ»Zwei frustrierte Lesben«) geschrieben. Vielleicht bringe ich das auf irgendeine Pub-Bühne. Als ich Candy erklärt hatte, wer Virginia Woolf war, hat sie gesagt, sie will sie unbedingt spielen, aber nur, wenn sie ihr Oberteil ausziehen darf, das Casting wäre also schon erledigt. Ich spiele Emily Dickinson, behalte mein Top aber an. Ich lege dir Karten zurück.
In der Zwischenzeit muss ich mich entscheiden, ob ich in Leeds oder London einen Job annehmen soll. Die Qual der Wahl. Ich wollte eigentlich nicht nach London ziehen – das ist so was von VORHERSEHBAR – aber meine ehemalige Mitbewohnerin Tilly Killick (erinnerst du dich? Große rote Brille, kompromisslose Ansichten, Koteletten?) hat ein freies Zimmer in Clapton. Sie nennt es ihre »Abstellkammer«, was nichts Gutes ahnen lässt. Wie ist Clapton denn so? Kommst du bald zurück nach London? Hey! Vielleicht können wir ja zusammenziehen?
»Zusammenziehen?« Emma hielt inne, schüttelte den Kopf, stöhnte auf und schrieb dann: »Nur Spaß!!!!« Wieder stöhnte sie auf. »Nur Spaß« schrieb man nur, wenn man jedes Wort ernst gemeint hatte. Zu spät, um es durchzustreichen, aber wie sollte sie den Brief beenden? »Mit freundlichen Grüßen« war zu förmlich, »Tous mon amour« zu affektiert, »In Liebe« zu kitschig, und plötzlich stand auch schon wieder Gary Nutkin im Türrahmen.
»Okay, alle auf die Plätze!« Bekümmert hielt er ihnen die Tür auf, als führte er sie vor ein Erschießungskommando, und hastig, bevor sie es sich anders überlegen konnte, schrieb sie:
Gott, du fehlst mir, Dex
– unterschrieb und drückte einen dicken Kuss auf das hellblaue Luftpostpapier.
An der Piazza della Rotonda saß Dexters Mutter an einem Cafétisch, ein Buch locker in der Hand, die Augen geschlossen, den Kopf in den Nacken gelegt und leicht zur Seite geneigt wie ein Vogel, der die letzten Strahlen der Nachmittagssonne genießt. Anstatt direkt zu ihr zu gehen, setzte sich Dexter einen Moment zwischen die Touristen auf die Stufen des Pantheons und beobachtete, wie der Kellner auf sie zuging, den Aschenbecher vom Tisch nahm und sie aufschreckte. Beide lachten, und an ihrer theatralischen Mimik und Gestik konnte er erkennen, dass sie ihr schreckliches Italienisch sprach, als sie dem Kellner kokett den Arm tätschelte. Der Kellner, der offenbar kein Wort verstand, grinste trotzdem, flirtete zurück und drehte sich im Gehen noch einmal nach der wunderschönen englischen Frau um, die ihn am Arm berührt und unverständliches Zeug gefaselt hatte.
Dexter nahm alles in sich auf und lächelte. Die alte Freud’sche Vorstellung, die man ihm zuerst im Internat zugeflüstert hatte, dass Jungen in die Mutter verliebt seien und ihre Väter hassten, erschien ihm völlig logisch. Jeder, den er kannte, war in Alison Mayhew verliebt. Aber das Beste war, dass er seinen Vater auch wirklich gern hatte; in dieser wie in fast jeder Hinsicht war sein Glück ungetrübt.
Oft hatte er seinen Vater dabei ertappt, wie er Alison mit seinen Bluthund-Augen voll stummer Bewunderung anstarrte, wenn sie beim Abendessen in dem weitläufigen, üppigen Garten des Hauses in Oxfordshire saßen oder wenn sie im Frankreich-Urlaub in der Sonne schlief. Der fünfzehn Jahre ältere, große, introvertierte Stephen Mayhew mit dem langen Gesicht schien diesen einmaligen Glücksfall kaum fassen zu können. Bei den Partys, die sie häufig gab, auf denen Dexter ganz still dasaß, um nicht ins Bett geschickt zu werden, konnte er beobachten, wie die Männer sich in einem gehorsamen, ergebenen Kreis um sie scharten; intelligente, gebildete Männer, Ärzte, Anwälte und Radiosprecher benahmen sich wie verliebte Teenies. Er sah, wie sie mit einem Cocktailglas in der Hand, beschwipst und selbstvergessen, zu frühen Roxy-Music-Alben tanzte, während die anderen Frauen zusahen und neben ihr hoffnungslos plump und schwer von Begriff wirkten. Auch Schulfreunde, selbst die coolen, komplizierten, verwandelten sich in Gegenwart von Alison Mayhew in Cartoonfiguren, flirteten mit ihr, während sie zurückflirtete, zogen sie in Wasserschlachten hinein und lobten ihre haarsträubenden Kochkünste – die totgerührten Rühreier, der schwarze Pfeffer, der eigentlich Zigarettenasche war.
Früher hatte Alison in London Modedesign studiert, leitete heute das örtliche Antiquitätengeschäft und verkaufte dem vornehmen Oxford mit beachtlichem Erfolg teure Teppiche und Kronleuchter. Sie hatte immer noch etwas von der Aura einer Berühmtheit aus den Sechzigern – Dexter hatte die Fotos und Ausschnitte aus verblichenen Farbbeilagen gesehen –, hatte all das aber ohne sichtbare Traurigkeit oder Bedauern gegen ein zutiefst respektables, sicheres, bequemes Familienleben eingetauscht. Typischerweise hatte sie anscheinend genau den richtigen Moment gewählt, um die Party zu verlassen. Dexter hatte den Verdacht, dass sie hin und wieder Affären mit den Ärzten, Anwälten und Radiosprechern hatte, konnte ihr deshalb aber nicht ernstlich böse sein. Und die Leute sagten immer das Gleiche – dass er es von ihr geerbt hatte. Niemand sagte genau, was »es« eigentlich war, aber alle schienen es zu wissen: blendendes Aussehen natürlich, Energie, gute Gesundheit und außerdem ein gewisses lässiges Selbstvertrauen, das Recht, im Mittelpunkt, auf der Gewinnerseite zu stehen.
Selbst jetzt, als sie im verwaschenen blauen Sommerkleid dasaß und auf der Suche nach Streichhölzern in der voluminösen Handtasche wühlte, schien das Leben auf der Piazza sich nur um sie zu drehen. Kluge braune Augen in einem herzförmigen Gesicht unter einer Mähne kostspielig zerzausten schwarzen Haars, das Kleid einen Tick zu weit aufgeknöpft, makellos unordentlich. Sie sah ihn kommen, und ein strahlendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus.
»Eine Dreiviertelstunde Verspätung, junger Mann. Wo hast du gesteckt?«
»Ich habe von da drüben zugeguckt, wie du den Kellner aufreißt.«
»Kein Wort zu deinem Vater.« Sie stieß mit der Hüfte an den Tisch, als sie aufstand und ihn umarmte. »Und wo warst du nun wirklich?«
»Hab Unterricht vorbereitet.« Sein Haar war noch feucht vom Duschen mit Tove Angstrom, und als seine Mutter es ihm aus dem Gesicht strich und ihm zärtlich die Hand auf die Wange legte, bemerkte er, dass sie schon leicht angetrunken war.
»Du bist ganz zerzaust. Wer war das? Was hast du wieder angestellt?«
»Hab ich doch gesagt, Unterricht vorbereitet.«
Skeptisch zog sie einen Schmollmund. »Und wo warst du gestern Abend? Wir haben im Restaurant auf dich gewartet.«
»Tut mir leid, bin aufgehalten worden. Discoabend in der Schule.«
»Eine Disco. Sehr 70er-Jahre. Und wie wars?«
»200 betrunkene, skandinavische Mädchen beim Vogue-en.«
»›Vogue-en‹. Zum Glück habe ich keine Ahnung, was das ist. Hats Spaß gemacht?«
»Es war die Hölle.«
Sie tätschelte ihm das Knie. »Mein armer, armer Schatz.«
»Wo ist Dad?«
»Er musste ins Hotel zurückgehen, um sich etwas hinzulegen. Die Hitze, und seine Sandalen haben gedrückt. Du kennst ja deinen Vater, ein typischer Waliser.«
»Und was habt ihr gemacht?«
»Wir sind nur ein bisschen ums Forum gewandert. Ich fand es wunderschön, aber Stephen hat sich zu Tode gelangweilt. So eine Unordnung, überall liegen Säulen herum. Ich glaube, seiner Meinung nach sollte man alles einstampfen und stattdessen ein nettes Gewächshaus errichten oder so.«
»Du solltest dir den Palatin mal ansehen. Da oben auf dem Hügel …«
»Ich weiß, wo der Palatin ist, Dex, ich war schon in Rom, bevor du geboren wurdest.«
»Ja, und wer war damals Kaiser?«
»Ha. Hier, hilf mir mal mit dem Wein, lass mich nicht die ganze Flasche allein austrinken.« Das hatte sie schon fast, aber er goss den Rest in ein Wasserglas und schnappte sich ihre Zigaretten. Alison schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Weißt du, manchmal glaube ich, wir haben es mit der liberalen Erziehung übertrieben.«
»Eindeutig. Dank euch bin ich ein Wrack. Gib mir mal die Streichhölzer.«
»Rauchen ist nicht klug, weißt du. Klar, du glaubst, du siehst aus wie ein Filmstar, aber in Wirklichkeit sieht es furchtbar aus.«
»Weshalb machst du es dann?«
»Weil ich dadurch sensationell aussehe.« Sie steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen, und er zündete sie ihr mit dem Streichholz an. »Ich höre sowieso auf. Das hier ist meine letzte. Jetzt aber fix, dein Vater ist gerade nicht da …« Verschwörerisch beugte sie sich vor. »Erzähl mir was über dein Liebesleben.«
»Nein!«
»Jetzt komm schon, Dex! Du weißt, ich bin gezwungen, mein Leben stellvertretend durch meine Kinder zu leben, und deine Schwester ist so was von verklemmt …«
»Bist du betrunken, Mutter?«
»Keine Ahnung, wie sie zwei Kinder zustande gebracht hat …«
»Du bist hinüber.«
»Ich trinke nicht, verstanden?« Als Dexter zwölf war, hatte sie ihn eines Abends ernst in die Küche geführt und ihm leise erklärt, wie man einen trockenen Martini mixt, als sei es ein feierlicher Ritus. »Komm schon. Her mit den schmutzigen Details.«
»Da gibts nichts zu erzählen.«
»Niemand in Rom? Kein nettes, katholisches Mädchen?«
»Nein.«
»Doch wohl hoffentlich keine Schülerin.«
»Ach was.«
»Und zu Hause? Wer schreibt dir noch mal diese langen, tränenverschmierten Briefe, die wir dir immer nachschicken?«
»Geht dich nichts an.«
»Zwing mich nicht, sie heimlich zu öffnen, sags mir!«
»Da gibts nichts zu erzählen.«
Sie lehnte sich im Stuhl zurück. »Du enttäuschst mich. Was ist mit dem netten Mädchen, das uns damals besucht hat?«
»Welches Mädchen?«
»Hübsch, ernst, aus dem Norden. Hat sich betrunken und deinen Vater wegen der Sandinisten angeschrien.«
»Das war Emma Morley.«
»Emma Morley. Ich mochte sie. Dein Vater auch, obwohl sie ihn einen faschistischen Bourgeois genannt hat.« Dexter verzog bei der Erinnerung daran das Gesicht. »Ich fands nicht schlimm, wenigstens hatte sie ein bisschen Feuer und Leidenschaft. Anders als diese dümmlichen Sexbomben, die wir sonst am Frühstückstisch vorfinden. Ja, Mrs Mayhew, nein, Mrs Mayhew. Ich höre übrigens, wenn du nachts ins Gästezimmer schleichst …«
»Du bist echt hinüber, was?«
»Und was ist jetzt mit Emma?«
»Sie ist nur eine Freundin.«
»Ach ja? Da wäre ich nicht so sicher. Ich glaube eher, sie mag dich.«
»Alle mögen mich. Das ist mein Fluch.«
In seinem Kopf hatte es gut geklungen, verwegen und selbstironisch, aber jetzt saßen sie schweigend da, er kam sich wieder einmal dumm vor, wie auf den Partys, wenn seine Mutter ihn bei den Erwachsenen sitzen ließ, er angab und sie blamierte. Nachsichtig lächelte sie ihn an und drückte ihm die Hand, die auf dem Tisch lag.
»Sei nett, ja?«
»Ich bin nett, ich bin immer nett.«
»Aber nicht zu nett. Ich meine, mach keine Religion draus.«
»Ist gut.« Unbehaglich sah er sich auf der Piazza um.
Alison stupste ihn an. »Möchtest du jetzt noch eine Flasche Wein, oder sollen wir zurück ins Hotel gehen und nach dem Hühnerauge deines Vaters sehen?«
Sie gingen nach Norden durch die Seitengassen, die parallel zur Via del Corso in Richtung der Piazza del Popolo verlaufen, Dexter wählte unterwegs den malerischsten Weg aus, begann sich besser zu fühlen und genoss das Gefühl, sich in einer Stadt gut auszukennen. Beschwipst hing sie an seinem Arm.
»Wie lange willst du denn noch hier bleiben?«
»Weiß nicht. Vielleicht bis Oktober.«
»Aber dann kommst du nach Hause und lässt dich irgendwo nieder, ja?«
»Natürlich.«
»Ich meine, nicht bei uns. Das tu ich dir nicht an. Aber wir könnten dir bei der Anzahlung für eine Wohnung unter die Arme greifen, weißt du?«
»So eilig ist es doch nicht, oder?«
»Na ja, es ist jetzt schon ein ganzes Jahr, Dexter. Wie viel Urlaub brauchst du denn noch? An der Uni hast du dich ja auch nicht gerade totgearbeitet …«
»Ich mach keinen Urlaub, ich arbeite!«
»Was ist mit Journalismus? Hast du nicht was von Journalismus gesagt?«
Er hatte es flüchtig erwähnt, aber mehr als Ablenkungsmanöver und Alibi. Je mehr er auf die zwanzig zuging, desto beschränkter waren die Möglichkeiten geworden. Bestimmte cool klingende Berufe – Herzchirurg, Architekt – waren ihm jetzt für immer verschlossen, und mit Journalismus verhielt es sich anscheinend ähnlich. Dexter war kein berauschender Autor, hatte wenig Ahnung von Politik, sprach schlechtes Restaurant-Französisch, verfügte über keinerlei Ausbildung oder Qualifikationen und hatte im Grunde nur einen Reisepass und ein lebhaftes Bild von sich, wie er in einem tropischen Land rauchend unter einem Deckenventilator auf dem Bett lag, neben sich auf dem Boden eine ramponierte Nikon und eine Whiskyflasche.
Eigentlich wollte er Fotograf werden. Mit sechzehn hatte er ein Fotoprojekt mit dem Titel Strukturen abgeschlossen, das aus lauter Schwarzweißnahaufnahmen von Baumrinde und Muscheln bestanden und seinen Kunstlehrer »umgehauen« hatte. Seither hatte ihn nichts so sehr befriedigt wie Strukturen