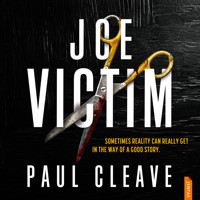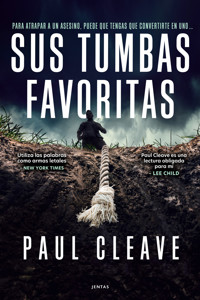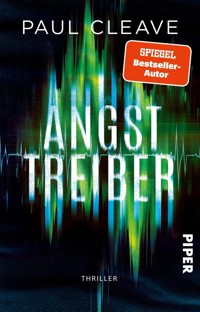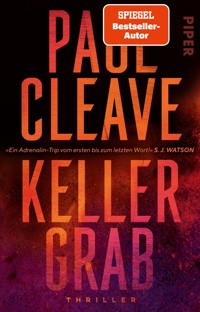
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Paul Cleave ist der König des harten Thrillers Wer könnte perfider morden als ein Thriller-Schriftsteller? Oder am besten gleich ein Autorenpaar? Cameron und Lisa Murdoch sind so ein Paar und behaupten, sie könnten ein perfektes Verbrechen begehen. Als ihr Sohn verschwindet, scheint aus blutigen Geschichten Ernst zu werden. Es beginnt eine öffentliche Hetzkampagne gegen das Ehepaar. Als Lisa bei einem Tumult schwer verletzt wird, bricht die Welt ihres Mannes endgültig zusammen. Doch dann wird der wahre Kidnapper des Jungen gefunden – tot. Cameron wird böse ... sehr böse ... und er will sich an denen rächen, die leben ... die noch leben! »Seine Worte schneiden wie ein Skalpell!« New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Kellergrab« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für meine Nachbarn, die mich seit Jahren beim Duschen singen hören, wie ich erfahren habe. Das tut mir echt leid.
© Paul Cleave 2021
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Quiet People«, Orenda Books, London 2021
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Sandra Taufer, München
Coverabbildung: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
PROLOG
SONNTAG
1 – Das Gras im Park …
2 – Mein Sohn kann …
3 – Auf dem Weg nach …
4 – »Ich wäre ausgerastet«, …
MONTAG
5 – Als ich am nächsten …
6 – Detective Inspector …
7 – Der nächstgelegene …
8 – Im Auto rufe ich …
9 – Vom Radwechsel sind …
10 – Lisa und ich sind …
11 – Zachs Eltern können …
12 – Wir folgen Kent. …
13 – Kent folgt Thompson …
14 – Es wird immer …
15 – Ich wechsle von …
16 – Es ist schon später …
17 – Kent kommt mit …
18 – Der Geräuschpegel …
19 – Im Verhörzimmer …
20 – Kent betritt den …
21 – Constable Green …
22 – Cameron Murdoch …
23 – Ich nehme das Foto …
24 – Der Abend ist rasch …
25 – Als Junge bin ich …
26 – Ich darf nicht ins …
DIENSTAG
27 – Ich kämpfe gegen …
28 – Kent legt auf. …
29 – Mein schwerer Kater …
30 – Ich werde Kent erst …
31 – Wir sind die Headline. …
32 – Cameron Murdoch …
33 – Ein paar Meter von …
34 – Lisa ist nicht zu …
35 – Jonas Jones trägt …
36 – Sie sitzen zu viert …
37 – Die Menge draußen …
38 – Kent ruft mich am …
39 – Lockwood hat gut …
40 – Kent beendet das …
MITTWOCH
41 – Auf dem Weg zur …
42 – Das Gefühl von …
43 – Sie bilden einen …
44 – Thompson befiehlt …
45 – Auf der Straße …
46 – Die meisten der …
47 – Der Raum ist …
48 – Kent verlässt den …
49 – Aber dann fangen …
50 – »Ist das eine Taktik?« …
51 – Ich klemme einen …
52 – Die Zeit läuft anders …
53 – Cameron Murdoch …
54 – Kent fährt mich …
55 – Sie bringen mich …
56 – Vor dem Haus der …
57 – Ich halte Lisas Hand …
58 – Ich hebe die Tasche …
59 – Die Anzahl der …
DONNERSTAG
60 – Ich lasse das Handy …
61 – Die Frau sieht nicht …
62 – Ich hebe Ellen aus …
63 – Dallas Lockwood …
64 – Kent schaut zu, wie …
65 – Ich nehme an, es …
66 – Ich erwische ihn …
67 – Die Szene ähnelt …
68 – Wir fahren das …
69 – Cameron Murdoch …
70 – Wir alle wissen …
71 – Sie trinken ihren …
72 – Ich brenne mein …
73 – Pater Jacob erwartet …
74 – Lockwoods Freundin …
75 – Ich gehe ins Bade…
76 – Unterwegs halte …
77 – Thompson wohnt …
78 – Detective Thompson …
79 – Ich will die Bierflasche …
80 – Ich fahre ruhig, denn …
81 – Sie spricht jetzt mit …
82 – Zach lebt. Irgendwo. …
83 – Ein eigenartiges …
84 – Keine Menschenmenge, …
85 – Es geht Zentimeter …
86 – Ich warte an der …
87 – Es ist nur eine …
88 – Die Wände sind …
89 – Er könnte einen …
90 – Thompson richtet …
91 – Die Welt um mich …
92 – »Zunächst einmal …
93 – Kent überschreitet …
94 – Während Kahn bellt …
95 – Kent springt auf, …
96 – Kent hört Stimmen …
97 – Um diese Zeit ist …
98 – Kent sitzt auf der …
99 – Kent rollt bis an …
100 – Anstatt mich aus …
101 – Die Sirenen sind …
102 – Sie müssen mich …
SAMSTAG
DANKSAGUNGEN
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
PROLOG
Lucas Pittman muss sich beeilen.
Die beiden Kriminalbeamten haben ihre Fragen gestellt, die Frau mit den muskulösen Armen und der Mann in dem gut sitzenden Anzug, den Lucas sich selbst dann nicht leisten könnte, wenn er arbeiten und zehn Jahre lang darauf sparen würde. Diese Berechnung basiert natürlich auf dem Lohn im Knast, wo er für jeden Tag, an dem er Blut und Scheiße in den Toiletten wegschrubbt, gerade mal einen Dollar bekommen hat.
Er will nicht zurück in den Knast.
Er kann nicht.
Und er muss es auch nicht. Wenn er jetzt schnell ist.
Der Raum unter dem Haus ist nur wenig größer als eine Gefängniszelle. Vier Wände aus Hohlblocksteinen, der Fußboden aus Beton, und der einzige Zugang eine gut getarnte Luke. Die Polizei hat sein Haus durchsucht und nichts gefunden. Und genau darum geht es doch, wenn man einen verborgenen Raum hat, oder? Dass man etwas darin versteckt. Sein Vater jedenfalls war dieser Ansicht gewesen. Und wenn sein Vater ihn nicht manchmal dort unten ans Bett gekettet hätte, zusammen mit einigen anderen, dann hätte Lucas nie von dessen Existenz erfahren.
Und selbst wenn die Polizei anrücken und den Raum doch noch finden sollte, würde es einen gewaltigen Unterschied machen, ob sie ihn leer vorfinden oder darin zwei gefangene, mit Drogen betäubte Kinder entdecken. Lucas will nicht, dass es so endet, aber hat er eine Wahl? Irgendjemand weiß Bescheid. Das ist offensichtlich – aber wer Bescheid weiß, ist leider nicht so offensichtlich.
Er öffnet die Schranktür im Flur. Dort hängen Jacketts an Kleiderbügeln, auf dem Boden liegen jede Menge Schuhe. Lucas schaufelt die Schuhe aus dem Schrank, zieht den Teppichboden zur Seite und hebelt die Bretter des Unterbodens heraus. Das dauert immer eine Weile, und bis heute hat ihn das nie gestört. Doch jetzt zählt jede Sekunde. Pittman hat einige Zeit im Knast verbracht und kennt den Unterschied zwischen zwei Minuten, die man zu lang braucht, um sich Zugang zu einem Raum zu verschaffen, und zehn Jahren, die man dann in einem anderen Raum eingesperrt ist. Aber heute ist alles anders, denn seit heute ist Zach Murdoch in seinem geheimen Raum.
Er beeilt sich. Nachdem er die Bretter herausgenommen hat, sind zwei Vertiefungen zu sehen, in die er die Hände schieben kann, um das quadratische Bodenstück hochzuheben. Er lehnt es gegen die Wand und klettert hastig die Leiter nach unten.
Bloß keine Zeit verlieren.
Der Junge ist immer noch betäubt. Er trägt ein gelbes T-Shirt mit einem aufgedruckten Bus. In diesem Alter hat Lucas auch so eins gehabt. Er erinnert sich noch, wie seine Mutter es ihm zu Weihnachten schenkte und sein Vater es ein Jahr später zerfetzte. Er wird den Jungen vermissen. Weil er Kleider trägt, wie Lucas sie in seiner Kindheit getragen hat. Weil ihm eine schönere Kindheit vergönnt war.
Der Körper des Jungen ist schlaff, aber so leicht, dass es kein Problem ist, ihn die Leiter hochzutragen. Lucas setzt das Bodenstück wieder ein und legt die Bretter darüber, dann den Teppich, dann die Schuhe. Das dauert seine Zeit.
Er trägt den Jungen zum Auto in der Garage und quetscht ihn in den Kofferraum. Wenn im Kofferraum genug Platz für zwei Jungs wäre, würde es doppelt so schnell gehen, aber das ist leider nicht der Fall. Er hat noch nie weiter darüber nachgedacht, zwei Jungen auf einmal zu transportieren. Einen auf den Vordersitz zu schnallen wäre sicher keine gute Idee, denn dann könnte sein Nachbar ihn sehen. Dieser Nachbar, der immer neugierig herüberglotzt. Der sich besser um seine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte.
Er legt den Spaten mit dem kurzen Griff in den Kofferraum. In seinen Gedanken hört er die Stimme des Vaters, der ihm erklärt, dass es nicht nötig sei, zwei separate Gräber auszuheben, weil ein großes völlig ausreicht.
Er fährt die Garagentür auf und setzt rückwärts aus der Einfahrt. Er schaut zum Haus des Nachbarn. Und tatsächlich, der steht am Fenster und glotzt raus. Hat ein Telefon in der Hand. Ruft wahrscheinlich die Bullen.
Ich hätte ihn vor Monaten schon umbringen sollen.
Ich bringe ihn um, wenn das alles vorbei ist.
Er biegt auf die Straße und lässt das Haus hinter sich. Fährt mal nach rechts, mal nach links, Richtung Norden, und verlässt das Stadtgebiet von Christchurch. Dorthin, wo er früher mit seinem Vater fuhr, der ihm beibrachte, wie man eine Leiche entsorgt, bevor er Diabetes bekam, ein Bein verlor, sein Augenlicht, sein Leben. Er würde gern schneller fahren, um sein Haus so rasch wie möglich hinter sich zu lassen, um alles hinter sich zu bringen, aber er beherrscht sich und achtet auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Verkehrskontrolle wäre das Letzte, was er jetzt braucht. Er flucht über jede rote Ampel und dankt Gott für jede grüne. Sein Auto macht ein eigenartiges klapperndes Geräusch. Das geht schon seit einigen Wochen so. Er hat es eigentlich in die Werkstatt geben wollen. Hoffentlich macht es nicht ausgerechnet jetzt schlapp. Dumm, dass er es nicht hat überprüfen lassen. Er atmet tief durch, bemüht sich, ruhig zu bleiben, bloß nichts zu provozieren.
Sirenen sind nicht zu hören. Kein Streifenwagen ist in Sicht. Plötzlich aber doch. Sie sind ihm auf den Fersen. Sie haben ihn gefunden. Er hätte gern mehr Zeit gehabt. Er drückt das Gaspedal durch, überschreitet die Höchstgeschwindigkeit. Das Klappern wid immer lauter, schneller und durchdringender, aber der Wagen fährt weiter. Sein Herz rast. Er muss seine schwitzenden Hände am Hemd trocknen. Der Streifenwagen ist noch fünfzig Meter hinter ihm, dann vierzig, dann dreißig. Ein zweiter Wagen schert aus dem Verkehr aus und nähert sich. Ein Blaulicht taucht im Rückspiegel auf. Eine Zivilstreife? Wie viele sind es noch?
Er will nicht wieder in den Knast.
Nur das nicht.
Er hält das Gaspedal ganz durchgedrückt und rast weiter. Der Streifenwagen bleibt an ihm dran. Er fährt immer schneller – wenn man in Neuseeland so schnell fährt, dass es lebensgefährlich wird, ist die Polizei gesetzlich verpflichtet, die Verfolgung zu beenden. Lucas empfindet das als eine Art Belohnung. Wieder und wieder verlässt er den Verkehrsstrom, schert dann wieder ein. Der Streifenwagen folgt ihm immer noch, aber dann wird er langsamer und bleibt zurück. Weiter vorn wird der Verkehr immer dichter. Er muss die nächste Abfahrt nehmen. Er bemerkt eine Lücke im Gegenverkehr. Er könnte zwischen einem weißen Van und einem Lastwagen durchbrettern. Jetzt befindet sich die Lücke kurz vor der nächsten Kreuzung. Es wird eng, aber er kann es schaffen.
Er nimmt den Fuß vom Gas und biegt hinter dem Van nach rechts, berührt beinahe dessen Stoßstange, gibt wieder Gas. Kurz befürchtet er, der Wagen könnte genau in diesem Moment seinen Geist aufgeben, das Klappern ohrenbetäubend werden, der Keilriemen reißen, die Kolben blockieren, aber alles läuft normal weiter, der Motor, das Auto, auch wenn die Lücke viel enger ist, als er dachte. Passt schon, er wird es schaffen, er muss.
Der Lastwagen rammt seinen Wagen und schiebt ihn zusammen, ehe er ihn in die Luft schleudert. Metall verdreht sich, Glas splittert, der Tank reißt auf. Als er das erste Mal auf dem Boden aufkommt, wird das Auto auf die Hälfte zusammengedrückt. Lucas Pittman spürt den Druck auf seinem Schädel. Beim zweiten Aufschlag erfüllt sich sein Wunsch, nie mehr in den Knast zu müssen. Der Junge im Kofferraum wird hin und her geworfen. Schließlich bleibt der Wagen liegen. Flammen schießen empor.
SONNTAG
1
Das Gras im Park ist niedergetrampelt, zahlreiche Zelte sind aufgebaut. Stände und Buden überall, Schlangen wartender Menschen, Jahrmarktsattraktionen, grelle Lichter und Musik. Losgerissene Luftballons fliegen der Sonne entgegen. Aufgeschlagene Kinderknie, Grasflecken an Ellbogen und Sodbrennen wegen all der Hotdogs. Lachen, Schreien, Rufen. Hitze. Staub. Schausteller, die Besucher anlocken, damit sie ihr Glück versuchen. Der Sommer hat in Neuseeland offiziell begonnen, und die Welt riecht nach Popcorn und Zuckerwatte.
Auf dem Karussell sehe ich Kiwis statt Pferde, zweibeinige, flügellose Vögel statt vierbeinige, flügellose Pferde. Jeder Vogel hat einen langen Schnabel, der bis zum Boden reicht. Zach lacht, als der Karussellbetreiber ihn auf den letzten freien Kiwi setzt. Wir mussten zehn Minuten anstehen. Das Karussell ist bunt, dicke Farbkleckse übertünchen die Rostflecken, tausend bunte Glühbirnen leuchten. Die Kiwis beginnen sich zu drehen, Zach verschwindet und taucht wieder auf. Jedes Mal, wenn er wieder erscheint, zieht er eine andere Grimasse, damit ich ihn fotografiere. Mal hängen seine glatten, schwarzen Haare über der Brille, mal steckt er die Finger in die Ohren oder die Nase, verdreht die Augen, grinst fröhlich, blickt finster drein, streckt die Zunge raus, grinst schlau, grinst blöd, grinst gar nicht. Dann wird die Musik langsamer, die Kiwis werden langsamer, und Zach springt herunter, kaum dass das Karussell angehalten hat. Er rennt auf mich zu.
»Hüpfburg!«, ruft er aus und sprintet an mir vorbei in Richtung der Burg, auf der sich einige Kinder austoben.
Heute ist der erste Tag des Jahrmarkts. Er wird den restlichen Dezember hindurch bis Mitte Januar stattfinden. Tausende sind gekommen, jede Menge Kinder drängen sich vor den Attraktionen, halten Tüten mit schmelzenden Eiskugeln in den Händen, werden von ihren Eltern mühsam im Zaum gehalten. Es duftet süß, und eine gespannte Erwartung liegt in der Luft. Ich wünsche mir, noch einmal Kind zu sein, durch die Menge zu flitzen und alle Attraktionen auszuprobieren. Stattdessen renne ich hinter meinem siebenjährigen Sohn her, der völlig durchgedreht ist, kaum dass wir aus dem Auto gestiegen sind. Vor der Hüpfburg ist keine Schlange, nur ein halbes Dutzend Kinder springen darin herum. Der Typ, der sie betreibt, hat mehr Lücken als Zähne im Mund. Er hat eine Ledertasche am Gürtel und einen Eimer mit Putzlappen neben sich, um den Schmutz wegzuwischen, der in einer Hüpfburg so anfällt.
Die Burg ist groß genug für zwanzig Kinder. Man kommt auf der einen Seite über eine Rampe hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus. Ich kaufe eine Eintrittskarte. Der Besitzer fordert Zach auf, seine Sandalen auszuziehen. Zach kickt sie weg und gibt mir seine Brille. Kurz sieht es aus, als wolle er sich kopfüber in die Burg stürzen, aber dann reißt er sich zusammen und klettert langsam hinein. Die anderen Kinder werfen ihm kurze Blicke zu. Das passiert öfter. Zach erregt immer Aufmerksamkeit bei anderen Kindern, weil sie sofort spüren, dass er ein bisschen anders ist. Jedes Mal, wenn ich das mit ansehen muss, gibt es mir einen Stich.
Ich hebe seine Sandalen auf und stelle mich neben den Betreiber, um zuzuschauen. Der Mann blättert in einer Autozeitschrift und blickt nur gelegentlich auf, um nachzuschauen, ob es in der Hüpfburg keinen Ärger gibt.
Zach ist jetzt auf dem Hüpfareal. Eins der Kinder spricht kurz mit ihm und lässt ihn dann in Ruhe. Zach beginnt vorsichtig zu hüpfen, wirkt aber unsicher. Ich mache noch mehr Fotos mit meinem Smartphone und schicke sie zusammen mit den anderen an Lisa.
Lisa arbeitet an den Korrekturen für den neuen Roman, der nächstes Jahr erscheinen soll. Ich schaue aufs Display und sehe die Pünktchen, als Lisa mir eine Nachricht schickt: Er amüsiert sich ja prächtig! Ich antworte, dass ich es schade finde, dass sie nicht dabei ist, dann kommen wieder Pünktchen, als sie schreibt: Ich auch.
Ich stecke das Handy ein. Zach ist im Innern der Hüpfburg verschwunden. Das ganze Ding schwankt hin und her, während die Kinder herumtoben. Neue kommen dazu, darunter zwei Schwestern, Zwillinge in identischen Kleidern. Ihre Mutter fotografiert sie beim Springen.
Ich gehe näher ran, damit ich Zach beobachten kann. Ich muss aufpassen, dass die anderen Kinder nicht böse zu ihm sind. Aber ich sehe ihn nicht. Offenbar ist er oben auf der Rampe in einer Ecke, die ich nicht einsehen kann, und steht für die Rutsche an. Oder er versteckt sich vor mir. Spontanes Versteckspiel ist eine seiner Spezialitäten. Aber ich glaube nicht, dass er es hier tun würde – wir haben ausgiebig darüber gesprochen, welche Regeln für den Jahrmarkt gelten. Nicht weglaufen. Nicht verstecken. Er soll die ganze Zeit in Sichtweite bleiben.
Kein Kind kommt die Rutsche hinunter. Oben ist auch keine Warteschlange. Hat sich ihm jemand in den Weg gestellt? Das wäre nicht das erste Mal. Ich gehe ein Stück um die Burg herum, schaue in alle Ecken. Kein Zach. Eine Stimme in meinem Kopf – die elterliche, mahnende – erinnert mich daran, dass ich eine solche Situation schon in zahllosen Kinofilmen gesehen habe: Gerade war das Kind noch da, plötzlich ist es verschwunden und liegt auch schon im Kofferraum eines wildfremden Menschen.
Ich bleibe am Eingang stehen und schaue in den Hüpfbereich. Die Zwillinge toben am Rand herum. Eine hält inne und schaut mich an, die andere rempelt ihre Schwester an, und sie fallen aus der Burg heraus. Landen direkt vor meinen Füßen. Ich bücke mich, um ihnen aufzuhelfen. Die eine nimmt meine Hand, die andere steht allein auf und schaut mich misstrauisch an. Sie klettern wieder hinein.
»Zach?«
Zach antwortet nicht, aber Was-wäre-wenn meldet sich zu Wort. Was-wäre-wenn ist die Stimme in meinem Kopf, die zum Zuge kommt, wenn ich schreibe. Sie schickt meine Charaktere auf neue, unbekannte Wege oder nimmt eine ganz alltägliche Situation und stellt sie auf den Kopf. Was wäre, wenn der Kerl ein Messer hätte?Was wäre, wenn die Tür verschlossen ist? Was wäre, wenn sie nicht die Polizei rufen würden? Aber jetzt ist es bittere Realität, als Was-wäre-wenn in meinem Kopf sagt: Er ist weg. Jemand hat ihn geholt und schleppt ihn durch die Menge nach draußen.
»Zach?«
Du musst dich beeilen.
Ich steige in die Hüpfburg. Der Boden sinkt tief ein unter meinem Gewicht, und die Kinder müssen sich anstrengen, um nicht die Balance zu verlieren. Ich klettere auf die Rampe. Dort ist niemand. Ich steige wieder herunter. Die Kinder haben aufgehört zu hüpfen. Sie starren mich an.
»Ein Junge hat hier gespielt«, sage ich. »Er ist so groß.« Ich halte meine Hand vor die Brust. »Er trägt ein Superman-T-Shirt. Hat jemand ihn gesehen?«
Keine Antwort.
Der Boden sinkt tief ein und wackelt, als ich weitergehe. Ein kleiner Junge verliert das Gleichgewicht und fällt gegen mich. Ich helfe ihm auf, aber er fällt wieder um. Ich stolpere über ihn, und das Ganze endet damit, dass ich eins der Zwillingsmädchen aus der Hüpfburg stoße. Die Kleine landet unsanft auf dem Boden, fängt an zu weinen, steht auf und humpelt zu ihrer Mutter, die auf ihr Handy starrt.
Zach ist nicht da.
Was-wäre-wenn hat recht.
Mein Sohn ist verschwunden.
2
Mein Sohn kann nicht verschwunden sein. So etwas passiert immer nur anderen Leuten, genauso wie Autounfälle, Krebs oder dass einem das eigene Haus abbrennt.
Tu etwas.
Immer noch halte ich Zachs Sandalen in der Hand. Ich muss mich zusammenreißen. Das kriege ich hin. Kinder verschwinden nicht so einfach am helllichten Tag. Nicht im realen Leben. Es sei denn, es passiert dann doch. Was aber gar nicht sein kann. Denn das Leben hier ist sicher. Wir leben in einer ruhigen Stadt mit anständigen Bürgern.
Ich helfe dem kleinen Jungen in der Hüpfburg auf, der eben hingefallen ist. Er hat vorhin mit Zach gesprochen. Ich knie mich hin, damit ich auf Augenhöhe mit ihm bin. »Du hast doch mit …«
»Tun Sie mir nicht weh«, sagt er.
»Ich tue dir nicht weh«, sage ich und ziehe mein Handy aus der Tasche. Er dreht sich um, aber ich halte ihn am Arm fest.
»Warte bitte. Ich will dir nur ein Foto zeigen.«
»Lassen Sie den Jungen in Ruhe«, ruft ein Mann und stürmt auf mich zu. Er hat eine Glatze, ist ungefähr dreißig und sieht wütend aus.
Er ist nicht der Einzige. Auch die Mutter der Zwillinge nimmt mich ins Visier. Sie ist ebenfalls um die dreißig, hat die dunklen Haare streng zurückgebunden und sieht zornig aus. Eine ihrer Töchter ist weinend zu ihr gerannt, die andere steht noch in der Hüpfburg und starrt mich an. Plötzlich wird mir klar, wie die Situation auf die anderen Eltern wirken muss. Ich bin in die Hüpfburg gesprungen und habe ihre Kinder belästigt. Ich richte mich auf und steige aus dem Hüpfareal.
»Tut mir leid«, sage ich und hebe entschuldigend die Hände, in denen ich die Sandalen halte. »Ich wollte nicht …«
Weiter komme ich nicht. Der Mann, der mich angeschrien hat, schlägt mir gegen die Brust. Ich taumle nach hinten gegen die Hüpfburg.
»Warten Sie, ich …«
»Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht?«, fragt die Frau mit schriller Stimme und deutet anklagend mit dem Finger auf mich. Sie baut sich neben dem Mann auf, der mich geschubst hat. Ich stütze mich an der Hüpfburg ab, um wieder aufrecht zu stehen.
»Ich …«
»Was soll das? Wollen Sie sich an den Kindern vergehen?«, fragt sie.
»Nein, natürlich nicht. Ich …«
»Er hat meinen Sohn angefasst«, sagt der Mann.
»Ich hab’s gesehen«, stimmt die Frau zu. »Wahrscheinlich hat er alle Kinder da drinnen begrapscht.«
»Ich wollte doch nur …«
»Er hat mir wehgetan«, sagt der Junge.
Ich hebe abwehrend die Hände. »Hören Sie mir doch mal …«
Der Mann macht eine Drehung und verpasst mir einen Schlag in die Magengrube. Ich falle rücklings in die Hüpfburg, durch die Erschütterung wird das andere Zwillingsmädchen hinausgeschleudert. Ich rolle zur Seite, rutsche aus der Burg und lande auf dem Boden, schnappe nach Luft. Der Mann packt seinen Sohn und stürmt mit ihm davon. Dann deutet er noch mit dem Finger auf mich und droht mir, er werde mich umbringen, sollte ich seinem Sohn jemals etwas zuleide tue.
Die Mutter nimmt ihre schluchzende Tochter an die Hand, das andere Mädchen steht ein paar Meter abseits und weint ebenfalls. »Sie sollten sich schämen«, sagt sie und macht mit ihrem Handy ein Foto von mir.
Ich sage nichts und werfe einen Blick zurück in die Hüpfburg, in der Hoffnung, dass Zach wiederaufgetaucht ist. Ist er aber nicht.
Er ist verschwunden, hämmert Was-wäre-wenn in meinem Kopf. Die Stimme wird lauter, je größer meine Angst wird. Er ist weg, und du wirst ihn nie mehr wiedersehen.
»Ich rufe die Polizei«, setzt die Mutter nach.
»Ich wollte den Kindern nichts tun«, sage ich.
»Erzähl das deinem Anwalt, du Kinderschänder«, sagt sie und geht weg, die Kinder im Schlepptau.
Der Hüpfbudenbesitzer kommt und hilft mir auf die Beine.
»Alles in Ordnung?«
»Ich kann meinen Sohn nicht finden.«
»Er ist vor einer Minute rausgeklettert«, sagt er und bückt sich, um mein Handy aufzuheben, während ich Zachs Sandalen aufsammle. Er reicht mir das Handy. »Das war, als Sie mit dem Ding hier beschäftigt waren.«
»Warum haben Sie mir nichts gesagt?«
»Warum haben Sie nicht auf Ihr Kind aufgepasst?«
Ich hasse ihn, weil er recht hat. Die Frau mit den Zwillingen telefoniert, starrt mich an und gibt wahrscheinlich gerade der Polizei meine Personenbeschreibung durch.
»Ist jemand bei ihm gewesen?«
»Weiß ich nicht. Vielleicht.« Er deutet in die Menge. »Er ist in diese Richtung gegangen.«
»Was befindet sich dort?«
»Lauter Sachen, mit denen ich nichts zu tun habe.«
Ich tauche in die Menge ein. Suche nach jemandem, der für Notfälle zuständig ist. Jemand vom Sicherheitsdienst oder einen Polizisten. Es muss doch irgendwo eine Information geben oder einen Sammelpunkt, an dem Eltern ihre verloren gegangenen Kinder abholen können. Ein Sanitätszelt. Aber ich sehe nur Tausende Menschen, die Spaß haben und sich um nichts weiter kümmern. Sie alle könnten mir helfen, aber …
Aber da ist er ja. Da vorne steht er in der Schlange vor dem Spiegelkabinett. Er spricht mit einem Mädchen, das in seinem Alter ist. An seinen Händen klebt Zuckerwatte, und das Mädchen versucht das Naschwerk an ihrem Kleid abzuwischen. Die Kleine schaut Zach an und hört ihm zu. Ich zögere. Am liebsten wäre ich hingegangen, hätte ihn umarmt und gefragt, was er sich dabei gedacht hat, einfach wegzulaufen. Aber das ist ja das Problem – er hat sich eben überhaupt nichts dabei gedacht. Er ist sieben Jahre alt. Er tut das, was Siebenjährige so tun. Meine Welt, die gerade aus allen Fugen geraten ist, renkt sich langsam wieder ein.
Ich gehe zu ihm, nehme ihn an der Hand und sage ihm, dass es Zeit wird zu gehen. Er fragt, ob etwas nicht stimmt, und ich sage, dass alles in Ordnung ist. Das scheint er nicht ganz zu glauben und sieht aus, als wolle er in Tränen ausbrechen. Eine typische Reaktion, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er sich das wünscht. Ich komme ihm zuvor, indem ich vorschlage, auf dem Weg nach draußen noch ein Eis zu kaufen.
»Darf ich jede Sorte haben?«
»Du suchst dir aus, was du haben willst«, sage ich. Mit Zach muss man die Dinge sehr genau besprechen. Wenn ich ihm verspreche, dass er aus allen Sorten aussuchen kann und es dann eine Sorte, die ihm vorschwebt, nicht gibt, dann bricht für ihn eine Welt zusammen. »Weißt du noch, was ich dir in Bezug auf Weglaufen gesagt habe?«
»Dass ich das niemals tun soll.«
»Warum hast du es dann getan?«
»Was?«
»Du bist von der Hüpfburg weggegangen, ohne es mir zu sagen.«
Er überlegt, geht die letzten Minuten noch mal durch. Dann sagt er: »Einer der Jungs in der Burg hat gesagt, ich sei seltsam. Deshalb wollte ich weg. Ich bin doch gar nicht seltsam, oder?«
»Natürlich nicht.«
»Ich habe dir gewunken, aber du hast nicht geguckt.«
»Dann hättest du warten sollen.«
»Warum hat der Junge das zu mir gesagt?«
»Die Leute sagen manchmal Dinge, die sie gar nicht so meinen.«
Er denkt eine Weile nach und sagt dann: »Also, wenn du und Mama mir sagen, ich soll die Hände waschen vor dem Essen, dann meint ihr das gar nicht so?«
»Doch, das meinen wir so.«
»Ich kapier das nicht«, sagt er. »Ich glaube, ich brauche mindestens zwei Kugeln Eis.«
Ich lache, und erst dann merke ich, dass Zach keinen Witz gemacht hat. Wir gehen in Richtung Ausgang, reihen uns in den Menschenstrom ein. Am Straßenrand parken jede Menge Autos. In der zweiten Reihe suchen Fahrer verzweifelt nach einer Parkmöglichkeit. Unser Wagen steht auf einem Parkplatz zwischen zahllosen anderen. Ich öffne die hintere Tür, und Zach steigt ein. Ein paar Reihen weiter sehe ich den Kerl, der mich geschlagen hat. Er setzt sein Kind in eine dunkelrote Limousine. Der Junge weint immer noch. Ich überlege, ob ich rübergehen und mich entschuldigen soll, aber das erübrigt sich, als der Typ aufschaut und mich bemerkt. Er wirft mir einen drohenden Blick zu. Ich frage mich, was die Personen aus meinen Büchern in so einer Situation tun würden. Einige würden zu ihm hingehen und ihn zusammenschlagen. Andere würden ihn für immer in irgendeinem Loch versenken. Ich würde ihm gern mitteilen, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, Leute umzubringen. Dass ich weiß, wie man das perfekte Verbrechen verübt.
Stattdessen steige ich ein, und wir fahren los.
3
Auf dem Weg nach Hause kommen wir an einer ehemaligen Scheune vorbei, in der sich ein Obst- und Gemüsehandel befindet Über dem Eingang hängt ein großes, von der Sonne gebleichtes Schild mit lächelnden Himbeeren und Erdbeeren, die fröhlich die Hände ausstrecken. Die Vorderseite der Scheune steht offen, sodass der Laden wie eine Markthalle wirkt. Der Anblick der Obstkisten macht mich hungrig. Im Sommer ist hier viel los. Es gibt auch eine Eistheke mit vielen Sorten. Dahinter steht ein Mädchen mit Sommersprossen und einer Weihnachtsmannmütze. Vor der Eistheke wartet eine lange Schlange von Leuten in Shorts, T-Shirts und Flip-Flops. Es dauert fast zehn Minuten, bis wir drankommen, aber das ist es wert. Das Eis ist Balsam für meine gepeinigten Nerven.
Wir setzen uns an einen der Picknicktische. Die Erdbeer-Himbeer-Mischung schmilzt in der Hitze, und wir müssen uns mit dem Essen beeilen. Alles scheint wieder normal, aber mein Körper hat sich noch immer nicht entspannt. Das Böse, das in meinen Büchern in allen Spielarten auftaucht, hat mich mit seinem kalten Griff gestreift. Hinter uns recken sich ein paar Pohutukawa-Bäume in die Höhe und spenden Schatten.
»Stecke ich in Schwierigkeiten?«, fragt Zach. Er schleckt seine Eiscreme so wie alle Siebenjährigen – hastig, als habe er Angst, jemand könne sie ihm wegnehmen. Gesicht und Hände sind verschmiert. Seine Brille ist im Auto. Als ich sie aus meiner Hosentasche geholt hatte, bemerkte ich, dass ein Bügel abgebrochen war. Wahrscheinlich war das passiert, als mich der Mann geschubst hatte.
»Du steckst nicht in Schwierigkeiten«, sage ich. »Wir sprechen darüber, wenn wir zu Hause sind, okay? Wie ist dein Eis?«
»Dann stecke ich also in Schwierigkeiten«, sagt er. Er hört auf zu schlecken. Das Eis tropft von seinen Händen auf die Bank.
»Nein, natürlich nicht. Jetzt iss mal dein Eis auf, und dann fahren wir heim, okay? Wir können den Christbaum aufstellen, wenn du magst.«
Er wendet sich wieder seinem Eis zu, denkt eine Weile nach und fragt dann wieder: »Kriege ich jetzt Probleme?«
»Nein.«
»Ich glaub dir nicht.«
Ich möchte hier nicht weiter darüber reden, aber er besteht darauf. »Hör mal, Zach, deine Mutter und ich, wir haben dich sehr lieb. Wir möchten, dass es dir gut geht. Wenn du so plötzlich verschwindest, dann bekommen wir Angst. Du darfst nicht einfach fortlaufen, verstehst du? Was wäre, wenn du dich verirrst?«
»Ich hab mich nicht verirrt«, sagt er mit der Logik eines Siebenjährigen. »Ich wusste doch, wo ich war und wo du warst. Du warst bei der Hüpfburg.«
»Weil ich dachte, dass du noch drinnen bist. Als ich gemerkt habe, dass du fort bist, musste ich dich suchen. Was wäre gewesen, wenn ich in die falsche Richtung gelaufen wäre und dich nicht gefunden hätte?«
»Aber du hast mich doch gefunden.«
»Wir sprechen darüber, wenn wir zu Hause sind.«
»Es ist doch nicht meine Schuld, wenn du mich nicht siehst«, sagt er.
Damit hat er allerdings recht. »Und was hättest du getan, wenn du aus dem Spiegelkabinett gekommen wärst und ich nicht mehr da gewesen wäre?«
Diese Frage übersteigt seine Vorstellungskraft. Er starrt sein Eis an. »Warum solltest du nicht mehr da sein?«
»Weil ich weggegangen wäre, um dich zu suchen. Zum Beispiel hätte ich denken können, du seist auf dem Weg nach Hause. Und was dann?«
»Weiß ich nicht.«
»In Zukunft solltest du einfach darauf achten, dass wir immer wissen, wo du bist. Sonst kann dir etwas passieren.«
»Was denn?«
Ja, was? Die Liste ist lang, aber jedes Beispiel beginnt gleich – mit einem Fremden. Es beginnt mit Was-wäre-wenn und endet in einem dunklen Keller, mit Fesseln aus Klebeband.
»Du hättest verloren gehen können.«
Er starrt seine Eistüte an und sagt nichts. Dann dreht er sich weg und wirft sie auf die Bank. Genau das hatte ich vermeiden wollen.
»Ist ja gut, Zach, wirklich. Du steckst nicht in Schwierigkeiten. Versprochen.«
Er hebt das Eis auf und wirft es wieder hin.
»Es ist alles in Ordnung.«
Er fängt an zu schreien. Laut. Das schrille Kreischen bewirkt, dass die Leute zu uns schauen. Ich merke, wie ich knallrot anlaufe.
»Bitte, Zach, hör jetzt auf damit.«
Er klaubt die zerdrückte Eistüte auf und wirft sie nach mir. Sie landet auf meinem Hemd, auf meinen Shorts. Die Leute, die neben uns sitzen, stehen auf. Einer sagt: »Sie sollten Ihr Kind besser im Griff haben.«
Ich nehme Zachs Hand. »Alles ist gut, Zach, alles ist gut.«
Er hört auf zu schreien. Starrt mich an. Sein Gesicht ist rot vor Zorn, er hat Tränen in den Augen. Es ist Monate her, seit er so einen Anfall in der Öffentlichkeit hatte. Über die Jahre haben wir eine Strategie entwickelt, was in einem solchen Fall zu tun ist – weggehen.
Ich stehe auf. Er fängt wieder an zu schreien. Als ich ihn hochhebe, schlägt er nach mir. Aber ich umklammere ihn und trage ihn weg, während er mit Händen und Füßen um sich schlägt.
Er kreischt weiter, die Leute starren uns kopfschüttelnd an. Jemand sagt: »Manche Menschen sollten sich besser keine Kinder anschaffen.« Ich senke den Kopf und spüre die stechenden Blicke in meinem Rücken.
Ich trage Zach zum Auto und setze ihn auf den Rücksitz. Er schlägt weiter um sich, während ich den Sicherheitsgurt festmache. Ich setze mich hinters Steuer und schiebe Zachs Lieblings-CD in den Player. Er hört trotzdem nicht auf zu schreien, bis wir zu Hause sind.
4
»Ich wäre ausgerastet«, sagt Lisa, nachdem ich ihr erzählt habe, wie der Nachmittag verlaufen ist. Es ist sieben Uhr abends. Zu Hause hat Zach sich wieder beruhigt. Trotzdem hat er während des Abendessens kein Wort mit uns gesprochen und ist schon eine halbe Stunde vor der Schlafenszeit in sein Zimmer verschwunden. Ich sitze mit Lisa auf der Terrasse hinterm Haus, jeder an einem Ende des Outdoor-Sofas, die Füße auf dem Beistelltisch, vor uns jeweils ein Glas Wein. Die Sonne steht noch über dem Dach des Nachbarhauses und wird erst in einer Stunde untergehen.
Lisa verscheucht eine Biene. Der Lavendel neben der Terrasse lockt Insekten an. Ich würde ihn gern entfernen, aber Lisa will das nicht. Lisa ist kleiner als ich, aber besser in Form, weil sie regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Ihre Haare sind genauso dunkel wie die von Zach, nur länger. Sie reichen ihr bis auf die Schultern, jetzt sind sie aber zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie hat die gleichen grünen Augen wie Zach.
Ich frage mich, ob sie an meiner Stelle wirklich ausgerastet wäre. Sie ist ruhiger als ich. Sollten wir jemals einen Unfall haben, würde sie garantiert einen kühlen Kopf behalten, während ich wahrscheinlich völlig ausrasten würde. Vielleicht liegt hierin das Geheimnis unserer Zusammenarbeit. Sie ist die Planerin – sie entwirft erst alles bis ins Detail, bevor sie anfängt zu schreiben. Ich hingegen beginne mit einer leeren Seite und warte ab, was beim Schreiben passiert, fühle mich in meine Charaktere ein, während die Handlung sich entwickelt.
»Wirklich nicht zu fassen, dass dieser Kerl dich geschlagen hat.«
»Allerdings.«
»Und dann ist dich auch noch die Frau angegangen. Haben die denn nicht kapiert, dass du nach Zach gesucht hast?«
»Du ließen mich gar nicht zu Wort kommen.«
»Meinst du, sie hat wirklich die Polizei gerufen?«
»Gut möglich. Sie hat mich sogar fotografiert.«
»Vielleicht wird schon nach dir gefahndet«, sagt sie. »Wir sollten mal den Fernseher anmachen und schauen, ob sie dein Bild in den Nachrichten bringen.«
Als ich nichts sage, lacht sie. »Ich mach doch nur Spaß. Wahrscheinlich hat die Mutter vom Betreiber der Hüpfburg verlangt, ihr das Geld zurückzugeben. Und der hat ihr dann gesagt, was wirklich los war.«
»Ja, gut möglich.«
Sie trinkt ihr Glas Wein aus. »Wir müssen noch mal mit Zach reden und ihm erklären, was er falsch gemacht hat.«
»Meinst du, beim tausendsten Mal fällt endlich der Groschen?«
»Ja«, sagt sie lächelnd. »Komm schon, gehen wir.«
»Ich mache das.«
»Ganz allein? Meinst du, du kannst einen KZM ganz allein entschärfen?« KZM ist unsere Abkürzung für »Komplizierter Zach-Modus«. Es klingt nach einem gefährlichen Element, das man in eine schmutzige Bombe einbaut.
»Keine Ahnung, aber immerhin war das heute meine Schuld.«
»Es war nicht deine Schuld«, sagt sie. »Es war … es ist einfach … passiert.«
»Wie auch immer, es ist meine Aufgabe.«
»Okay. Viel Glück. Ich mache dir währenddessen einen Gin-Tonic.«
Wir gehen ins Haus. Es hat nur ein Stockwerk mit einer offenen Küche inklusive Essbereich. Letzten Sommer haben wir alles neu gestrichen. Seither sind die Ecken und Seitenleisten schon wieder von Spielzeug, Schuhen und Ellbogen malträtiert worden. Gleiches gilt für den Flur und die vier Zimmer. Zwei davon dienen uns als Arbeitszimmer, in denen wir schlimme Dinge passieren lassen, wie wir unseren Freunden gern erzählen. Zachs Zimmer befindet sich am Ende des Flurs. Die Fenster gehen nach Norden, damit er die Straße überblicken kann. An den Wänden hängen Comic-Poster, die wahrscheinlich irgendwann durch Bandposter und Plakate von Filmstars ersetzt werden. Auf einer Landkarte an der Wand markieren bunte Nadeln die Orte, an denen er schon gewesen ist. Er hat ein niedriges Etagenbett, und darunter befindet sich seine »geheime Höhle«. Auf einem Regal stehen Bücher, nach Farbe geordnet. Letzten Monat war Größe das Ordnungsprinzip gewesen. An der Decke kleben fluoreszierende Sterne, die nachts leuchten.
Zach sitzt auf dem Boden und spricht mit einer Superheldenfigur, die er in ein Auto zwängen will, das nicht für Superhelden gemacht ist. Damit soll der Superheld einen Dinosaurier angreifen, der deutlich größer ist. Der Protagonist seiner Wahl ist nicht im allerbesten Zustand, denn drei seiner vier Gliedmaßen sind aus dem Körper gerissen worden. Zach schaut mich nicht an, als ich mich neben ihn hocke.
»Wer gewinnt?«, frage ich.
»Keiner.«
»Wir sollten mal …«, sage ich und halte inne. Was sollten wir? Über das sprechen, was heute vorgefallen ist? Über sein Verhalten? Ich habe keine Kraft mehr dafür, und selbst wenn, würde es nichts ändern. »Du solltest mal ins Bett gehen. Wie wär’s mit einer Gutenachtgeschichte?«
»Nein.« Da der Superheld immer noch nicht ins Auto passt, reißt er ihm den übrig gebliebenen Arm ab und dann den Kopf.
»Wirklich? Wir könnten die Harry-Potter-Geschichte weiterlesen.«
»Nein«, sagt er. Er wirft das Auto und den Superhelden in die neue Spielzeugkiste, die Lisa gekauft hat, weil die alte zu klein geworden war. Dann steigt er die Leiter hinauf in sein Bett und zieht sich die Decke über den Kopf, sodass nur seine Füße unten rausgucken.
»Ich laufe weg«, sagt er. Seine Stimme unter der Decke klingt gedämpft. »Ich laufe weg, und ihr werdet mich nicht mal vermissen.«
»Das stimmt doch gar nicht.«
»Dann könnt ihr endlich glücklich sein, weil ihr mich nie mehr ausschimpfen müsst.«
»Zach …«
»Ich hasse euch.«
»Nein, tust du nicht.«
»Doch, tue ich.«
Mit einem Mal bin ich unglaublich müde. Ich will, dass dieser Tag zu Ende geht. »Okay, okay, Zach, wenn du weglaufen willst, musst du genug Kleider und Essen einpacken, damit es reicht, bis du den ersten Lohn bekommst.«
»Was?«
»Du musst dir einen Job suchen, damit du Geld verdienst, um zu bezahlen, was du zum Leben brauchst. Du musst ein Haus mieten, Steuern zahlen und dein Essen selbst kochen. Ganz schön viel Arbeit.«
Er erwidert nichts.
»Oder du bleibst hier und musst dir über solche Dinge keine Gedanken machen. Wir haben den Christbaum immer noch nicht aufgestellt. Wie wär’s, wenn du auf das Weglaufen verzichtest, damit wir ihn morgen zusammen schmücken können? Was meinst du?«
»Nein.«
»Willst du dieses Jahr keinen Christbaum haben?«
»Nein.«
»Auch keine Weihnachten feiern?«
»Nein.«
»Sag Bescheid, wenn du deine Meinung geändert hast. Ich liebe dich, Zach.«
»Nein, tust du nicht.«
Ich schalte sein Nachtlicht ein und schließe die Kinderzimmertür.
MONTAG
5
Als ich am nächsten Morgen aufwache, brauche ich erst mal einen Kaffee. Das ist eigentlich immer so, heute allerdings ist der Kaffee besonders nötig, denn ich habe einen leichten Kater. Wegen der Gin-Tonics, die Lisa mir gestern Abend gemacht hat. Je älter ich werde, desto mehr merke ich den Alkohol.
Ich höre Lisa in ihrem Arbeitszimmer rumoren. Sie ist immer schon früh zugange und beginnt ihren Tag mit der Beantwortung der E-Mails, die über Nacht eingegangen sind. Ich trinke meinen Kaffee und gehe online, um die neuesten Nachrichten zu lesen, was ich sofort bereue. Jede Meldung bestätigt nur, dass die Menschheit sich über nichts mehr einig ist. Der Klimawandel ist real und dann auch wieder nicht. Brauchen wir weniger Waffen oder doch eher mehr? Die Bevölkerung zahlt zu hohe Steuern, nur die Reichen zahlen gar keine. Die Politiker sind Engel oder Teufel, je nachdem, für wen man gestimmt hat. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt lese. Laut Wetterbericht soll es dreißig Grad werden. Aktuell sind wir schon bei zwanzig. Zum Glück haben wir eine Klimaanlage.
Als ich mir einen Toast machen will, stelle ich fest, dass uns das Brot ausgegangen ist. Für Zach fülle ich Cornflakes in eine Schale und gehe in sein Zimmer. Er ist nicht im Bett. Auch nicht in seiner »Höhle« darunter. Ich gehe in Lisas Büro. Sie tippt bereits fleißig. Lisa braucht keinen Kaffee, um wach zu werden. »Hast du Zach irgendwo gesehen?«
Sie schüttelt den Kopf und schaut gar nicht erst auf. Ich mache mich auf die Suche. Sehe in den Schränken nach. Gehe ins Wohnzimmer, schaue hinters Sofa und hinter die Vorhänge. Ich überprüfe die Vorratskammer in der Küche, die Schränke. Gehe ins Badezimmer und in den Wäscheraum, dann in die Garage. Ich schaue im Auto nach. Schließlich suche ich im Garten. Dann gehe ich wieder in sein Zimmer und sehe noch mal in seiner »Höhle« nach. Im Schrank. Ich stehe in der Mitte des Kinderzimmers und drehe mich im Kreis. Das Fenster steht offen. Das habe ich vorhin nicht bemerkt. Nachts schließen wir es immer. Das Fenster ist zu hoch für Zach, er kann es nicht öffnen, aber nun steht die umgekippte Spielzeugkiste davor.
Jetzt fällt mir wieder ein, dass Zach gestern Abend gedroht hat, er würde weglaufen.
Ich beuge mich aus dem Fenster. Die Pflanzen vor der Hauswand sind niedergetrampelt.
In meinem Hinterkopf meldet sich eine Stimme zu Wort. Was-wäre-wenn ist aufgewacht.
Ich durchsuche Zachs Kleiderschrank. Seine Schultasche ist weg. Ich eile in die Küche. Gestern Abend habe ich ihn geradezu aufgefordert, genügend Essen einzupacken, damit es reicht, bis er sein erstes Geld verdient hat. Die Kekse sind verschwunden, auch die Softdrinks, genau wie das Brot, das ich vorhin vermisst habe, ein Glas mit Erdnusscreme und eins mit Himbeergelee.
Ich rase zu Lindas. »Er ist weg!«
Sie tippt weiter, weil sie mein »Er ist weg!« nicht erfasst hat, mein verzweifeltes »ER IST WEG!«. Sie fragt: »Was meinst du damit?«
»Zach ist weggelaufen. Sein Fenster steht offen.«
»Aber er kommt doch gar nicht dran …«
»Er hat die Spielzeugkiste umgedreht.«
Jetzt endlich versteht sie. Lisa springt auf und rennt zum Kinderzimmer. Sie macht genau das Gleiche, was ich schon getan habe. Ruft nach ihm, sieht unter dem Bett nach, im Schrank, dann schaut sie aus dem Fenster. »Die Pflanzen sind niedergetrampelt«, stellt sie fest.
»Hab ich bemerkt.«
Ich erzähle ihr von meiner Unterhaltung mit ihm am gestrigen Abend und von seiner Drohung, er werde abhauen. Davon, dass sein Ranzen weg ist und er sich Sachen aus der Vorratskammer genommen hat.
Sie schüttelt den Kopf, ihre Kiefer zucken. »Er hat dir also gesagt, dass er weglaufen will, und du hast nichts dagegen unternommen?«
»Es war ein klassischer KZM. Ich hab es nicht ernst genommen. Warum auch? So etwas hat er doch früher schon angedroht.« Das stimmt. Jeden Monat hat er aufs Neue damit angefangen. Ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, wenn er damit aufgehört hätte.
»Hast du nach ihm geschaut, bevor wir gestern Abend ins Bett gegangen sind?«, fragt sie.
»Nein.«
»Verdammt, Cameron, wieso hast du nicht noch mal nachgeschaut, nachdem er das gesagt hat?«
»KZM«, erwidere ich.
»Ist das jetzt deine Antwort auf alles?«
»Ich habe es nicht ernst genommen.«
»Dann hast du dich aber gewaltig verschätzt. Er kann schon seit zwölf Stunden weg sein. Ruf die Polizei. Ich suche draußen weiter nach ihm.«
Lisa zieht sich Schuhe an und geht im Pyjama nach draußen. Was-wäre-wenn rumort in meinem Kopf und verschafft sich Gehör. Was wäre, wenn Zach für immer verschwunden ist? Was wäre, wenn er in einen Abwasserschacht gefallen ist?
Ich rufe die Polizei an. Eine Frau in der Zentrale meldet sich. Ich erkläre ihr, wer ich bin und wo ich wohne und dass unser Sohn Zach weggelaufen ist.
»Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?«
»Gestern Abend, als wir ihn ins Bett gebracht haben.«
Am anderen Ende herrscht Schweigen, während sie sich vergegenwärtigt, dass Zach seit zwölf Stunden nicht mehr gesehen wurde. Zwölf Stunden sind eine Ewigkeit. »Haben Sie bei Nachbarn, Freunden und Angehörigen nachgefragt?«
Was wäre, wenn er in ein tiefes Loch gefallen ist?
»Wir sind gerade dabei. Meine Frau ist draußen und klingelt bei den Nachbarn«, sage ich. Wie weit kann ein Siebenjähriger in zwölf Stunden kommen? Dabei komme ich zu dem Schluss, dass es nicht zwölf, sondern eher dreizehn Stunden sind. Durchs Fenster sehe ich, wie Lisa die Straße entlangläuft und nach Zach ruft.
»Ich schicke einen Streifenwagen zu Ihnen«, sagt die Frau in der Zentrale.
Was wäre, wenn er in einem tiefen Grab liegt?
Was wäre …
»Sei still!«
»Wie bitte?«
»Entschuldige, Sie hab ich nicht gemeint.«
»Wen denn sonst? Ihre Frau?«
»Ich habe mit niemandem gesprochen.«
Die Polizistin fragt, in welchem Zustand Zach war. Ob wir uns gestritten hatten. Ist er schon mal weggelaufen? Wie gut kennt er die Nachbarn? »Gibt es Parks bei Ihnen in der Nähe? Hat er einen Lieblingsort?«
»Was?«
»Parks. Könnte er an einen bestimmten Ort …«
»Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Es gibt zwei Plätze, die mir einfallen.« Ganz bestimmt ist er an einem davon. »Ich geh gleich los und schau nach.«
»Die Streife ist in wenigen Minuten bei Ihnen. Ich schlage vor, Sie warten bis …«
»Warten? Bestimmt nicht!«
Ich lege auf, gehe nach draußen und rufe Lisa. Sie taucht auf dem Fußweg ein paar Häuser weiter auf und rennt zu mir.
»Die Polizei ist unterwegs. Die Beamtin am Telefon meint, er könnte in einen Park gegangen sein.«
Lisa nickt. Das kommt ihr offensichtlich plausibel vor. »Natürlich. Da wird er sein.«
»Ich gehe sofort hin.«
»Er könnte auch zur Schule gegangen sein. Oder zu deiner Mutter.« In Wahrheit könnte er überall sein. »Hast du bei ihr angerufen?«
»Das mache ich noch.«
»Dann suche ich die Parks ab und das Schulgelände.«
»Und ich klappere weiter die Nachbarn ab, bis die Polizei da ist. Vergiss nicht, dein Handy mitzunehmen.«
Ich gehe rein und schnappe mir die Autoschlüssel. Ich mache mir nicht die Mühe, meinen Pyjama auszuziehen, ich ziehe nur Turnschuhe an. In der Garage drücke ich auf den Knopf, um das Tor hochzufahren, setze rückwärts raus, bin zu schnell, streife den Briefkasten und drücke ihn um. Ich hau den Gang rein, gebe Gas und fahre mit durchdrehenden Reifen davon.
6
Detective Inspector Rebecca Kent setzt den Kreuzschlüssel auf die Radmutter und tritt mit dem Fuß auf das hintere Ende, um die Hebelwirkung zu erhöhen. Bei Reifenpannen geht es ihr wie mit Todesfällen unter Prominenten – es kommen immer drei hintereinander. Was bedeutet, dass sie bis zum Jahresende noch einiges Geld loswerden wird. Hoffentlich passiert es ihr nicht, wenn sie gerade mit Vollgas einen Psychopathen jagt. Sie setzt immer mehr Körpergewicht ein, bis die Radmutter sich endlich löst. Sie hat zahllose Filme gesehen, in denen jemand auf den Knien hockt und sich mit der Radmutter abquält, während der Serienkiller sich von hinten nähert. Wieso benutzen die nie ihr Körpergewicht, um die Hebelwirkung zu verstärken, fragt sie sich.
Kent versucht sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal einen Platten hatte. Dabei stöhnt sie auf. Das letzte Mal hatte sie vier auf einmal gehabt. Technisch betrachtet. Alle vier Reifen waren geplatzt, als das ganze Auto explodierte. Trotz der Sommerhitze läuft ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Auch wenn die Person, die die Bombe an ihrem Wagen angebracht hatte, ihr nicht mehr schaden kann, ist Kent jedes Mal angespannt, wenn sie in ein Auto steigt und den Zündschlüssel umdreht. Jedes Mal erwartet sie ein lautes Klicken und dann die ohrenbetäubende Explosion. Das ist seither nicht mehr passiert, aber noch immer träumt sie davon. Und noch immer hat sie Narben, äußerliche und innerliche. An manchen Tagen macht es sie schon nervös, an geparkten Autos vorbeizugehen. Da die Welt nun mal voller Autos ist, lebt sie fast ständig am Rand des Nervenzusammenbruchs.
Kent zuckt zusammen, als ihr Handy klingelt, dann lacht sie erleichtert. Es ist mal wieder einer von diesen Tagen.
Sie nimmt den Anruf entgegen. Es ist ihr Kollege, Detective Inspector Ben Thompson. Sie arbeitet seit drei Wochen mit ihm zusammen und bisher ziemlich erfolgreich – zumindest erfolgreicher als mit ihren letzten Kollegen, von denen der eine ums Leben kam und der andere aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Sie fragt sich, ob das auch so eine Sache ist, die immer dreimal hintereinander passiert, und wie weit der Zeitrahmen dafür wohl gesteckt ist.
»Hallo«, meldet sie sich.
»Wo bist du?«
»In meiner Auffahrt. Ich hab einen Platten«, sagt sie und legt die zweite Radmutter beiseite.
»Verdammt. Das erste von drei Malen, hm?«
»So ist es.«
»Brauchst du Hilfe?«
»Ich schaff das schon.«
»Hör mal, da ist eine Vermisstenmeldung reingekommen, ein siebenjähriger Junge namens Zach Murdoch. Bei seinen Eltern handelt es sich um Cameron und Lisa Murdoch.«
»Wieso klingelt da etwas bei mir?«
»Sie schreiben Thriller«, sagt er. Jetzt erinnert sie sich an die beiden. Sie hat sie mal auf einem Literaturfestival in Auckland kennengelernt. Sie war Backstage, während ein Kollege von ihr zwei Autoren von True-Crime-Büchern befragte. Die Murdochs wollten gerade gehen. Beide waren Mitte dreißig, gut aussehend und locker drauf. Sie erinnert sich noch, dass Cameron Witze über seine ergrauenden Haare machte. Er meinte, sie würden jedes Mal grauer werden, sobald die ersten Rezensionen kamen. Er hatte einen Dreitagebart, wirkte sportlich und war wirklich witzig. Lisa war noch sportlicher und kleidete sich so, dass man es auch bemerkte. So wie sie aussah, landete sie wahrscheinlich in einer Yogaposition, sobald sie hinfiel. Auch sie hatte Humor. Die beiden gingen Händchen haltend davon.
Kent tritt mit dem Fuß auf den Kreuzschlüssel. »Ich hab sie vor ein paar Jahren mal kurz getroffen. Nette Leute. Wann wurde der Junge denn zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend so gegen sieben. Heute Morgen gingen sie in sein Zimmer, und er war weg. Die Ehefrau klappert gerade die Nachbarschaft ab, der Mann fährt herum und sucht. Eine Streife ist auf dem Weg zu ihnen. Gut möglich, dass der Junge sich irgendwo im Garten versteckt oder in der Garage eines Nachbarn. Aber …« Er macht eine bedeutungsvolle Pause.
»Aber?«
»Die Kollegin aus der Zentrale meinte, der Ehemann wäre am Telefon merkwürdig gewesen. Er sagte, sie solle die Klappe halten, während sie ihm erklärte, dass die Streife schon auf dem Weg sei. Als sie ihn fragte, was los sei, antwortete er, er habe nicht sie gemeint.«
»Meinte er seine Frau?«
»Weiß ich nicht. Er sagte, seine Frau sei draußen und würde die Nachbarn abklappern.«
»Mit wem hat er dann geredet?«
»Keine Ahnung. Die Kollegin meinte, er sei sehr aufgeregt gewesen. Also … Es ist gut möglich, dass der Junge sich ein paar Straßen weiter versteckt hat, das hoffe ich jedenfalls, aber …« Wieder macht er eine bedeutungsvolle Pause.
Kent steckt den Kreuzschlüssel auf die dritte Radmutter. »Aber?«
»Das muss nichts bedeuten. Aber es handelt sich eben um Thriller-Autoren.«
»Wie meinst du das?«
»Heißt es nicht immer, dass Schriftsteller nur über das schreiben können, was sie auch kennen?«
»Mit Schriftstellern kenne ich mich nicht aus. Und meine zwei Minuten mit den Murdochs vor fünf Jahren dürften kaum relevant sein.«
»Na ja, so sagt man jedenfalls.«
»Worauf willst du hinaus, Ben?«
»Ich frage mich, ob wir es hier nicht mit der anderen Seite der Medaille zu tun haben. Anstatt über das zu schreiben, was sie kennen, wollen sie vielleicht kennenlernen, über was sie schreiben. Verstehst du?«
7
Der nächstgelegene Park ist der Haydon Park. Mehr als ein Hektar mit Wiesen, die von Bäumen gesäumt werden, alles eingezäunt, dahinter Wohnhäuser. In der Mitte gibt es eine Spielburg, ein Klettergerüst, ein Karussell. Aber kein Zach auf dem Spielplatz. Ich rufe bei meiner Mutter an. Sie geht nicht ran.
Danach fahre ich zum nächsten Park, der fünf Minuten entfernt ist. Der Antberry Park ist viermal so groß wie der Haydon und bietet die gleichen Spielmöglichkeiten, nur alles in Größer – eine größere Burg, ein größerer Spielplatz, höhere Bäume, längere Zäune und größere Häuser dahinter. Der leere Spielplatz sieht aus wie in einer alten Simulation der Folgen eines Atomangriffs, in der er dann gleich durch die Luft fliegen würde – zusammen mit Autos und Schaufensterpuppen und Gebäuden. Eine Frau in einem engen, grellen Jogginganzug läuft in gemessenem Tempo den Rundweg entlang. Ich renne auf sie zu in der Hoffnung, sie noch abpassen zu können. Sie sieht mich, und ich winke ihr zu. Sie bemerkt es, aber sie weicht mir großzügig aus und nimmt Kurs zur Straße.
Ich suche weiter den Park ab. Kein Zach zu sehen. Nichts weist darauf hin, dass er hier gewesen sein könnte – aber auch nichts auf das Gegenteil.
Ich gehe zu meinem Auto zurück und sehe einen Streifenwagen, der gerade anhält. Ein Mann steigt auf der Fahrerseite aus, eine Frau auf der Beifahrerseite. Die Frau ist Anfang dreißig und groß. Hat ihre langen, dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre blauen Augen wirken kalt. Sie sieht aus wie eine Hochspringerin. »Was tun Sie hier, Sir?«, fragt sie.
»Ich suche meinen Sohn.«
»Sie passen genau auf die Beschreibung, die uns eine Joggerin gerade durchgegeben hat: Sie sagt, dass sie von einem Mann im Pyjama belästigt wurde. Was tun Sie hier wirklich?«
»Das, was ich gesagt habe. Ich suche nach meinem Sohn Zach. Er ist weggelaufen. Ich wollte die Frau fragen, ob sie ihn gesehen hat. Das ist alles.«
»Hm«, sagt ihr Kollege. Er ist kleiner, stämmiger und etwa zehn Jahre älter als sie. Sieht aus wie ein Ringer. Hat einen dicken Hals und verkrüppelte Ohren, so wie manche Rugbyspieler. »Wieso haben Sie nicht die Polizei gerufen?«
»Hab ich doch.«
Ihr Gesichtsausdruck ändert sich ein bisschen.
Ich rede weiter. »Vor fünfzehn Minuten. Eine Streife ist auf dem Weg zu uns. Sie sind wahrscheinlich schon dort und reden mit Elsie. Ich wollte die Parks absuchen, und jetzt gehe ich zur Schule.«
»Wie heißen Sie denn?«, fragt der Ringer, deutlich weniger skeptisch.
»Cameron Murdoch.«
»Und Ihre Frau heißt Elsie?«
»Ja, das heißt nein. Meine Frau heißt Lisa.«
»Und wer ist Elsie?«
»Das ist der Spitzname von Lisa.«
»Ein Spitzname?«, fragt der Ringer.
»Das sind ihre Initialen. L und C für Lisa Cross.«
»Und wo wohnen Sie, Mr Murdoch?«
Ich gebe ihm meine Adresse. Der Ringer bittet die Hochspringerin, die Daten zu prüfen, und sie beugt sich in den Streifenwagen.
»Wie alt ist Zach?«, fragt der Ringer.
»Sieben.«
»Und wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend, als er ins Bett ging. Heute Morgen haben wir entdeckt, dass er verschwunden ist.«
»Dann wird Ihr Sohn jetzt also vermisst seit …« Er schaut auf die Uhr, aber bevor er es ausgerechnet hat, komme ich ihm zuvor.
»Dreizehneinhalb Stunden.«
Die Hochspringerin kommt zurück. Ihr Ton hat sich leicht verändert, als sie zu mir spricht. »Wir bringen Sie nach Hause. Dort warten zwei Beamte auf Sie.«
»Aber ich muss zur Greenbark-Grundschule. Das ist seine Schule. Dort könnte er sein.«
»Wir kümmern uns darum«, sagt sie.
»Aber …«
Sie unterbricht mich: »Bitte, Mr Murdoch. Je eher Sie uns helfen, umso eher können wir Ihnen helfen.«
Ich könnte jetzt widersprechen, aber das wäre Zeitverschwendung. Ich steige in mein Auto, und sie folgen mir nach Hause.
8
Im Auto rufe ich wieder bei meiner Mutter an, und diesmal geht sie ran.
»Ist Zach bei dir?«
»Warum sollte er hier sein?«
»Er ist abgehauen. Wir haben ihn seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Kannst du …«
»Was?«
»Er ist abgehauen. Kannst du bei dir im Garten nachschauen? Vielleicht hat er sich dort versteckt.«
»Selbstverständlich, selbstverständlich. Das mach ich sofort«, sagt sie aufgeregt.
Es knallt, als sie den Hörer auf die Küchenbank legt. Sie ruft nach Zach. Dann höre ich, wie sie die Tür aufmacht und wieder schließt. Ihre Stimme wird leiser, und nach einer Minute wieder lauter. Sie kommt wieder ans Telefon. »Hier ist er nicht«, sagt sie atemlos. »Habt ihr schon die Polizei angerufen?«
Ich schaue in den Rückspiegel. Der Streifenwagen ist dicht hinter mir, um sicherzustellen, dass ich nicht vom rechten Weg abkomme. »Sie suchen schon nach ihm.«
»Ich zieh mir was über und komme zu euch.«
»Nein, besser nicht. Bleib zu Hause, und halte Ausschau nach ihm.«
»Habt ihr schon die Parks abgesucht?«
»Ja.«
»Und die Schule?«
»Die Polizei kümmert sich darum.«
»Hör mal, Cameron, es geht ihm bestimmt gut. Da bin ich mir sicher. Lass dich nicht von deiner überdrehten Fantasie ins Bockhorn jagen«, sagt sie, aber ich weiß, dass sie genau den gleichen Fehler macht.
»Ich muss jetzt auflegen.«
»Ruf mich zurück, sobald du kannst.«
»Mach ich.«
»Mach es bitte wirklich. Sobald du kannst. Ich bete für euch.«
Ich komme an unserem Haus an. Ein Streifenwagen steht davor. Ich biege in die Auffahrt und umfahre den umgekippten Briefkasten. Das Garagentor steht immer noch offen, aber ich halte davor an. Die Streife hinter mir wendet und fährt davon, wahrscheinlich zu Zachs Schule. Ich gehe ins Haus. Aus dem Wohnzimmer kommen Stimmen.
Lisa sitzt auf einem der Sofas, zwei Beamte ihr gegenüber. Zwei Männer. Der eine ist groß und kahlköpfig – noch so ein Ringertyp –, der andere dünn und drahtig – noch so ein Hochspringer. Vielleicht ist das heute der Tag der Dicken und Langen auf der Polizeistation. Der Lange macht sich Notizen. Als ich eintrete, schauen mich alle an. Lisas Gesicht zeigt Hoffnung, die aber verschwindet, als sie merkt, dass Zach nicht bei mir ist. Sie steht auf und kommt zu mir. Sie hat geweint. Ihre Augen sind rot. Auch die beiden Polizisten stehen auf. Sie stellen sich vor. Der Ringer heißt Michael Woodley, der Hochspringer Matthew Waverly. Wie soll man Personen mit solchen Namen auseinanderhalten?
Wir geben uns nicht die Hand. Ich setze mich hin.
»Wir haben mehrere Einheiten losgeschickt, die nach Ihrem Sohn suchen«, erklärt Woodley. Er hat eine tiefe Stimme, ein freundliches Gesicht und schaut unentwegt zwischen Lisa und mir hin und her, als würde er ein Tennisspiel verfolgen. Er sagt mir, dass Zachs Lieblingskleider – ein Superman-T-Shirt, eine blaue Kapuzenjacke und braune Shorts – nicht mehr da sind. Diese Sachen hat Zach gestern getragen, was heißt, dass er sie aus dem Wäschekorb geholt hat.
»Ich habe ein Foto von ihm, auf dem er diese Sachen anhat«, sage ich und hole mein Smartphone heraus. »Allerdings trägt er eine andere Jacke.«
»Ihre Frau hat uns das Foto schon gezeigt«, sagt Waverly. Seine Stimme klingt ähnlich wie die seines Kollegen, und er blickt ebenfalls mitfühlend drein. Aber die meiste Zeit sieht er nur mich an. Sie sind die Ersthelfer vor Ort, sie wollen uns beruhigen. Wenn der Sturm dann losbricht, sind sie schon wieder weg.
»Ich hab den Herren die Fotos gezeigt, die du auf dem Jahrmarkt gemacht hast«, sagt Lisa. »Ich hab ihnen auch die gezeigt, die wir vor ein paar Wochen im Garten deiner Mutter gemacht haben. Darauf ist er besser zu sehen.«
Ich erinnere mich an dieses Foto, auf dem Zach die Hände in die Seiten stemmt, den Fuß auf einen Ball gestellt, und breit in die Kamera grinst.
»Lisa erzählte uns gerade, dass Zachs Fahrrad noch da ist«, sagt der Ringer und will wissen, wieso ich vorhin nicht danach geschaut habe. »Hat er ein Skateboard, einen Roller oder Rollschuhe – irgendwas, mit dem er schneller voran- und weiter wegkommen könnte?«
»Hat er nicht«, sagt Lisa.
»Bekommt er Taschengeld?«, fragt Woodley.
»Nein«, sage ich.
»Haben Sie bei seinen Freunden angerufen?«
»Noch nicht«, sagt Lisa.
»Okay. Wie wär’s, wenn Sie alle anrufen, die etwas wissen könnten? Wir haben Kriminalbeamte angefordert, die mithelfen können. Ich hätte auch gern Ihre Erlaubnis, dass wir uns im Haus umschauen dürfen. Es ist schwer zu glauben, aber wir haben schon vermisste Kinder gefunden, die sich im Haus versteckt haben, weil ihre Eltern ihnen nicht erlaubt haben fernzusehen oder Nintendo zu spielen.«
»Sie können gern überall nachschauen«, sagt Lisa.