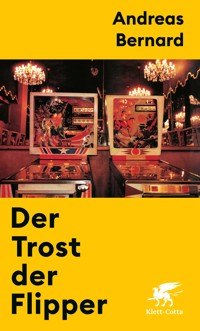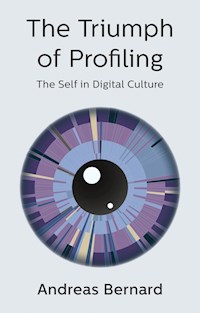9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Leihmütter, Samenspender, künstliche Befruchtung: wenn die biologischen Eltern nicht die sozialen sind … +++ NEU: Ergänzt um das Thema »Social Freezing« +++ Immer mehr Babys werden mit medizinischer Unterstützung gezeugt. Diese Kinder, Samenspender und Leihmütter sind die neuen Akteure der Reproduktionsmedizin – doch was bedeutet das für unser Verständnis von Familie? Was passiert, wenn biologische Elternschaft sich von sozialer entfernt? Von der Ukraine über Deutschland bis nach Kalifornien hat Andreas Bernard die maßgeblichen Orte, u.a. Samenbanken und Labore, aufgesucht, Eltern, Spender und Mediziner nach ihren Motiven befragt, die Schicksale der Kinder recherchiert. Gleichzeitig hat er die Geschichte des Wissens um die Reproduktion aufgearbeitet und Erstaunliches zutage gefördert. In Verbindung aus Reportage und Wissenschaftsgeschichte gelingt ihm eine glänzend erzählte Bestandsaufnahme aller Aspekte der künstlichen Zeugung von Menschen – und was das für die Ordnung der Familie bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 820
Ähnliche
Andreas Bernard
Kinder machen
Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. Samenspender, Leihmütter, Künstliche Befruchtung
FISCHER E-Books
Inhalt
EinleitungErzwungene Befruchtung: Im Labor der Fortpflanzungsmedizin
Die Pipette nähert sich dem Ei, wird seine Hülle gleich durchstechen, um das Spermium zu injizieren, doch was unter dem Mikroskop am meisten erstaunt in diesem Augenblick, ist die unerwartete Biegsamkeit der menschlichen Eizelle. Sie zieht sich zusammen, als die Nadel ihre Oberfläche erreicht, schrumpft fast auf die Hälfte ihres Durchmessers, ohne dem Druck nachzugeben. Unerfahrene Laboranten ziehen die Pipette deshalb häufig zu früh zurück, glauben, dass sie das Spermium bereits in der Eizelle abgesetzt haben, und registrieren am nächsten Tag mit Verwunderung, dass keine Befruchtung eingetreten ist. Es dauert Monate, bis ein Embryologe durch die Übung mit unreifen Eizellen das Gespür für diese Arbeit entwickelt, bis er etwa genau erkennt, wann er die Hülle der Eizelle, die Zona pellucida, sowie die innere Haut durchstochen hat und das Spermium tatsächlich eingedrungen ist. Im mikroskopischen Bild wird in diesem Moment das Unvorgesehene, Erzwungene der Prozedur deutlich. Die natürliche Befruchtung im weiblichen Körper, jene Verschmelzung der Eizelle mit einem von abertausenden Spermien, die den Eileiter erreicht haben, vollzieht sich als uneinsehbarer, kontingenter, bis heute nicht endgültig geklärter Prozess. Hier im Labor ist dieser Prozess restlos offengelegt, reduziert auf die Zusammenführung zweier ausgewählter Zellen durch einen Akt der Einspritzung. »Intrazytoplasmatische Spermieninjektion« heißt die Befruchtungsmethode, im Vokabular der Reproduktionsmedizin nach der englischen Abkürzung als ICSI bezeichnet (gesprochen: »Ixi«). Im Jahr 1992 wurde die Behandlung an der Universität Brüssel erstmals vorgestellt; in den Kinderwunschzentren der Welt ist sie inzwischen das Standardverfahren künstlicher Fortpflanzung und hat die In-vitro-Fertilisation, also das bloße Vermischen von Eizellen und Spermien in der Petrischale, als effizientere, auch die männliche Unfruchtbarkeit überwindende Methode verdrängt. Der Ursprung menschlichen Lebens: Jahrtausendelang galt er als ein göttliches Mysterium, ein unbeeinflussbarer Naturvorgang. In den ICSI-Labors der Gegenwart ist die Imitation dieses Vorgangs außerhalb des weiblichen Körpers längst Routine geworden.
Ein Sonntagnachmittag im Frühling, in einem Reproduktionszentrum direkt in der Münchner Innenstadt. Helena Angermaier, die seit 1985 als Embryologin arbeitet und nach einem Forschungsbesuch in Brüssel als einer der ersten Menschen weltweit auch ICSI-Behandlungen vorgenommen hat, sitzt vor einem Mikroskop des Laborraums im 6. Stock: eine hochgewachsene Frau Anfang fünfzig, in ihrer Freizeit Balletttänzerin, mit weißblonden, zum Knoten geformten Haaren und auffälliger grüner Wimperntusche. Sie hat im letzten Vierteljahrhundert über 10000 Kinder unter dem Mikroskop gezeugt. In dem Reproduktionszentrum wird an sieben Tagen in der Woche gearbeitet; »der Eisprung kennt kein Wochenende«, wie Angermaier mit ihrer Vorliebe für pointierte Redewendungen sagt. Doch am Sonntag ist es in der Praxis zumindest ruhiger. Die Behandlungszyklen unter der Woche werden so organisiert, dass bei möglichst wenigen Paaren der Tag der künstlichen Zeugung auf das Wochenende fällt. An diesem Nachmittag steht noch eine Befruchtung durch ICSI an; außerdem hat Helena Angermaier mehreren Patientinnen die frohe Botschaft zu überbringen, dass es bei ihren mit dem Samen des Ehemannes versetzten Eizellen, die über Nacht im Brutschrank standen, tatsächlich zur Befruchtung gekommen ist. Jetzt geht es darum, mit den Frauen einen geeigneten Termin für den Embryotransfer in die Gebärmutter abzustimmen, der zwei bis fünf Tage nach der Fertilisation möglich ist. »Wir haben eine erfreuliche Nachricht. Die Spermien waren sehr fleißig«, sagt die Embryologin am Telefon zur ersten Patientin. »Könnten Sie am Mittwoch um 14 Uhr in die Praxis kommen?« Zu diesem Zeitpunkt hat die Frau aber schon einen Termin. Donnerstag und Freitag seien auch ungünstig, da wolle sie eigentlich mit ihrem Mann über ein verlängertes Wochenende verreisen. Eine merkwürdige Synchronisation zweier Zeitpläne: Die künstliche Erzeugung von Leben muss sich nach notwendigen Abfolgen richten (nur bis zum fünften Tag, solange der Embryo bei natürlicher Empfängnis im Eileiter bleibt, kann die Körperumgebung in der Petrischale nachgeahmt werden), doch diese Gesetze biologischer Entwicklung kollidieren nun mit dem Terminkalender einer vielbeschäftigten Patientin. Am Ende des Telefonats kündigt die Frau allerdings an, ihre Reise abzusagen.
Der Behandlungsgang in dieser Praxis – die verschiedenen Schritte, die nötig sind, bevor die Spermien und Eizellen eines Paares im Labor vereinigt werden – ist bei allen Patienten ähnlich. Hat sich ein Paar nach der Anamnese, dem sogenannten »Kinderwunschgespräch« mit dem Arzt, für eine künstliche Befruchtung entschieden, muss zunächst das Verfahren festgelegt werden. Diese Entscheidung hängt in erster Linie davon ab, bei welchem der Partner die Ursache für die Kinderlosigkeit vermutet wird. Wenn die Analyse der Spermienqualität ergibt, dass der Mann grundsätzlich zeugungsfähig ist, wird zunächst nur eine konventionelle In-vitro-Fertilisation vorgenommen. Ist der Befund des Ejakulats dagegen mangelhaft und müssen die Spermien sogar aus dem Hodengewebe entnommen werden (wo bei etwa der Hälfte der zeugungsunfähigen Männer noch intakte Samenzellen aufzufinden sind), wird die kostspieligere ICSI-Methode notwendig, bei der theoretisch ein einziges brauchbares Spermium zur Befruchtung ausreicht. Am Anfang jeder Behandlung allerdings steht fast immer die Hormonstimulation der Frau, die den Prozess der Ei-Reifung regulieren und anregen soll. In der letzten Woche eines Menstruationszyklus nehmen die Patientinnen ein Medikament ein, das ihre körpereigene Produktion von Sexualhormonen unterdrückt. Zu Beginn des neuen spritzen sie sich dann täglich follikelstimulierende Hormone unter die Bauchdecke. Auf natürlichem Wege kommt gewöhnlich nur eine Eizelle pro Zyklus zur Reifung. Infolge der Behandlung können es bis zu vierzig werden, im Durchschnitt etwa ein Dutzend: eine Entwicklung, die der Arzt in dieser Zeit regelmäßig durch Ultraschall-Untersuchungen kontrolliert. Sobald die Follikel die gewünschte Größe und hormonelle Reife erreicht haben, zumeist zwischen dem elften und dreizehnten Zyklustag, injiziert sich die Patientin ein eisprungauslösendes Hormon, das die Ovulation auf die Stunde genau berechenbar macht (»den Eisprung programmieren«, sagen die Ärzte). Die transvaginale Entnahme der Eizellen schließlich, über einen Ultraschall-Monitor gesteuert, ist mittlerweile ein zehnminütiger Routineeingriff in Vollnarkose. An einem langen Schlauch führt der Arzt eine Nadel in die Eierstöcke ein, durchsticht die Follikel und saugt die Eizellen ab, die in Reagenzgläser geleitet, gezählt und dann in den Brutschrank gegeben werden, in einem Nährmedium, das der Eileiter-Flüssigkeit entsprechen soll. Die Patientin wird vom Arzt nur ein bis zwei Stunden später über den Verlauf des Eingriffs informiert.
Sämtliche Operationen finden in der Reproduktionsklinik am Vormittag statt. Nachmittags dann werden die Petrischalen mit den entnommenen Eizellen in den Laborraum gebracht. Die zugehörigen Spermien, die vom »Original-Ejakulat« des Mannes stammen, wie es die Embryologen nennen, von einer Hodenbiopsie oder, nach tatsächlich aussichtslosem Befund, von einem Samenspender, sind zu diesem Zeitpunkt bereits untersucht und mit Nährlösung aufbereitet. Die noch ausstehende ICSI-Befruchtung an diesem Sonntag ist ein »dankbarer Fall«, wie Helena Angermaier in ihrem weichen Münchner Akzent sagt, die Frau 1982 geboren, der Mann 1984, »das sind erfreuliche Jahrgänge, eher selten bei uns«. Das Durchschnittsalter ihrer Patientinnen ist in den letzten zehn Jahren von 34 auf fast 38 Jahre gestiegen, die Hälfte ist über vierzig Jahre alt. Das Spermiogramm des Mannes war unauffällig; man weiß nicht, warum das Paar seit Jahren keine Kinder zeugen kann und auch eine konventionelle IVF-Behandlung bereits erfolglos blieb. Zu unerforscht sind nach wie vor die vielfältigen Ursachen der Infertilität, die Frage etwa, welche Hürden es beim Eintritt des Spermiums in die Zona pellucida geben kann, welche Protein- oder Enzymdefekte die Verschmelzung der Zellkerne im letzten Moment verhindern. Bei der Mehrzahl der behandelten Paare kann in dieser Praxis der Mann als Quelle der Sterilität identifiziert werden. Deshalb wird die ICSI-Methode, die das Spermium verlässlich an sein Ziel transportiert, weitaus häufiger eingesetzt als die bloße In-vitro-Fertilisation, obwohl sich die Krankenkassen seit der Reform des Gesundheitsrechts im Jahr 2004 nur dann an den Kosten beteiligen, wenn der Spermienbefund ungenügend war oder eine frühere IVF-Behandlung nichts ausgerichtet hat. Verglichen mit der so evidenten Vereinigung von einem Spermium mit einer Eizelle unter dem Mikroskop wirkt das ältere Verfahren aber tatsächlich ungenau und im entscheidenden Moment sich selbst überlassen. Die Erfolgsquote, das Eintreten einer Befruchtung nach 16 bis 20 Stunden, liegt bei IVF demnach auch nur bei 50 Prozent, im Unterschied zu den etwa 80 Prozent bei der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion.
Eine ICSI-Befruchtung dauert – je nachdem, wie hoch die Anzahl der Eizellen und wie langwierig die Suche nach intakten Spermien unter dem Mikroskop ist – zwischen dreißig Minuten und mehreren Stunden. Manchmal, wenn auch die Hodenbiopsie so gut wie keine Samenzellen enthält, verbringt Angermaier halbe Nachmittage mit dem Aufspüren eines beweglichen dunklen Flecks, eines einzigen umherwimmelnden Spermiums unter dem Mikroskop. Zur Vorbereitung der Behandlung reinigt sie zunächst die punktierten Eizellen vom Vormittag; bei dieser Frau sind es 27, ein hoher, aber nicht außergewöhnlicher Wert. Die Eizellen sind jetzt noch vom sogenannten Cumulus umgeben, einer weißlichen Hülle, die so groß ist, dass die Zellen in diesem Zustand mit bloßem Auge in der Petrischale zu sehen sind – eine Ansammlung von winzigen weißen Fetzen in der rosafarbenen Nährflüssigkeit. Helena Angermaier entfernt den Cumulus, indem sie die Eizellen mit der Pipette aufsaugt und in einer Enzymlösung spült. Jetzt ist unter dem Mikroskop auch erkennbar, wie viele Eizellen tatsächlich reif für eine Befruchtung sind, und zwar an der Gestalt des Polkörpers, einer kugeligen Struktur am inneren Rand, in der die Hälfte des ursprünglich doppelten Chromosomensatzes ausgeschieden worden ist. 23 der 27 Eizellen kann die Embryologin verwenden.
Helena Angermaier beschriftet die Petrischale für die ICSI-Behandlung nach einem diffizilen System – in der einen Hälfte eine Anzahl kleiner Kreise, so viele, wie Eizellen vorhanden sind (in diesem Fall also 23), in der anderen vier größere für die Spermienlösung. Ein Teil der großen Felder wird nicht mit dem üblichen Nährmedium bedeckt, sondern mit einer Lösung, die die Konsistenz von Tapetenkleister hat und gewährleisten soll, dass die bewegungsfreudigen Spermien mit der Pipette leichter zu fassen sind. Zuletzt wird die Schale mit einem besonderen Öl versiegelt, damit die Flüssigkeiten mit den Zellen nicht austrocknen, und auf die in Körpertemperatur gehaltene Arbeitsfläche des ICSI-Mikroskops gestellt. Auf beiden Seiten dieses Mikroskops befindet sich ein joystickartiger Hebel. Derjenige, mit dem die eigentliche Steuerung der Pipetten durchgeführt wird, sorgt durch eine hydraulische Vorrichtung dafür, dass sich die Bewegungen der Hand in der mikroskopischen Darstellung um ein Vielfaches verkleinern. Wenn Angermaier diesen Hebel um einen Zentimeter bewegt, macht die entsprechende Bewegung der Pipetten im Mikroskop-Bild nur ungefähr zehn Mikrometer aus, also ein hundertstel Millimeter: ein unerlässlicher Verkleinerungsmodus, wenn man bedenkt, dass die Länge eines Spermiums fünf Mikrometer und der Durchmesser der »Injektionspipette« acht Mikrometer beträgt. Mit der linken Hand steuert Helena Angermaier die zehnmal so breite, an ihrem Ende hohle »Haltepipette«, welche die Eizelle während der Befruchtung durch Erzeugung von Unterdruck fixiert, mit der rechten die Injektionspipette, die das Spermium ansaugt und in die Eizelle spritzt. Heute werden diese Pipetten längst industriell gefertigt; in den frühen neunziger Jahren musste die Embryologin sie noch selbst herstellen. Handwerkliches Geschick gehört zu den elementaren Voraussetzungen für den Erfolg der modernen Reproduktionsmedizin.
Auf einem Computermonitor neben dem Mikroskop lässt sich der Prozess der Befruchtung mitverfolgen. Angermaier fährt zuerst in das Feld der Spermienlösung, das in diesem Fall dicht besiedelt ist mit flirrenden schwarzen Punkten. Sie wählt in kaum nachvollziehbarer Geschwindigkeit ein Spermium aus, eines mit besonders ebenmäßigem Kopf, ohne Furchen (die Frage, ob man vom Aussehen der Samenzellen auf ihre Befruchtungsfähigkeit schließen kann, wird noch Gegenstand der Diskussion sein). Mit der Spitze der Pipette knickt sie zuerst den Schwanz ein, um das Spermium zu immobilisieren – bei der natürlichen Befruchtung würde ohnehin nur dessen Kopf den Zellkern erreichen –, dann saugt sie es ein und fährt mit der Pipette in das andere Feld der Petrischale. Mit der Haltepipette bringt sie die erste Eizelle in die richtige Position: Leichthändig wie ein Jongleur wendet sie die kreisförmige Scheibe mit der etwas dunkleren, rauen Innenfläche und dem hellen Rand in der Nährflüssigkeit hin und her. Alles ist nun vorbereitet für die erste Injektion.
Hier im Labor, mit Blick über die Dächer der Münchner Innenstadt, entsteht also gerade ein Mensch. Wenn alles nach Plan verläuft, wird bis zum nächsten Morgen die Befruchtung eintreten, einige Tage später die bereits vielfach geteilte Zelle in die Gebärmutter der Frau transferiert und, falls sich einer der Embryonen dort einnistet, eine Schwangerschaft diagnostiziert werden können. Die ICSI-Methode, in ihrer äußersten Reduktion, ist die radikale Umsetzung eines Wunschtraums, der die Medizin schon lange beschäftigt hat. Bereits 1878 fanden die ersten erfolgreichen Tierexperimente mit Befruchtungen außerhalb des Mutterleibs statt. Heute werden in den gut 140 deutschen Reproduktionszentren über 10000 Kinder pro Jahr dank der Verfahren der »assistierten Empfängnis« gezeugt. Wie unvorstellbar diese Technologien aber noch zu einer Zeit waren, in der sich die ersten Hilfsmittel künstlicher Befruchtung bereits zu etablieren begannen, darüber geben die medizinischen Lehrbücher und Fachzeitschriften auf vielfältige Weise Auskunft. Der Berliner Arzt Otto Adler etwa räumt im Jahr 1908 – nach den ersten Erfolgen der homologen Insemination, der manuell durchgeführten Befruchtung einer Frau mit dem Samen ihres Ehemannes – prinzipiell ein, dass solche Schwangerschaften möglich seien. »Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, weibliches Ei und männliches Spermatozoon im Reagenzglase zu vereinen und zur Entwicklung zu bringen und werden wohl ewig davon entfernt bleiben.« Und er fügt den schönen Satz hinzu: »Unsere Phiole, deren wir nicht entbehren können, ist und bleibt die Gebärmutter, und in ihrem dunklen Innern allein vollzieht sich geheimnisvoll, unsichtbar unseren Augen, Befruchtung und Entwicklung.«[1] Enoch Heinrich Kisch wiederum beginnt das Kapitel über »Kohabitation« in seinem viele Male aufgelegten Standardwerk über das »Geschlechtsleben des Weibes« mit dem Satz: »Dieser Akt ist der einzige der Willkür des Individuums unterworfene, während alle folgenden Prozesse des Werdenden sich der Beeinflussung des Willens und dem Bewußtsein entziehen«.[2] Von diesem Diktum her lässt sich ermessen, wie fundamental die Reproduktionstechnologien seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in die Vorstellung der Zeugung und das Menschenbild der Medizin eingegriffen haben. Denn im Zeitalter von IVF und ICSI sind nun alle »Prozesse des Werdenden« dem menschlichen Willen unterzogen, und zwar vor allem dem Willen der Laborantin, die unter dem Mikroskop die Fortpflanzungszellen von Mann und Frau auswählt und zusammenbringt. Helena Angermaier weiß natürlich um diese erhabene Position und kommentiert sie mit größter Lakonie: »Bei der natürlichen Befruchtung ist es die Eizelle, die entscheidet; bei ICSI bin es ich.« Aber mit welchen Empfindungen sucht sie die Spermien unter dem Mikroskop aus, im sicheren Wissen darum, dass die Wahl des umherflirrenden Punkts daneben einen ganz anderen Menschen hervorbringen würde, mit anderen Gesichtszügen, anderem Temperament, anderem Lebensschicksal? Fühlt sie sich jeden Tag aufs Neue wie ein göttlicher Schöpfer mit der Pipette? Angermaier weist diese Fragen von sich, betont die routinierte Praxis ihrer Arbeit – und der Besucher muss die ICSI-Behandlung nur selbst eine halbe Stunde lang auf dem Computerbildschirm mitverfolgt haben, um erstaunt zu registrieren, wie schnell das Virtuelle der Prozedur ein Gefühl der Banalität, ja der Langeweile hervorruft. Die erste Injektion eines Spermiums ist noch ein Ereignis, die zweite vielleicht auch, aber schon bei der fünften und sechsten Eizelle muss man sich zwingen, die Konsequenzen dieses Vorgangs im Gedächtnis zu behalten, um das Geschehen auf dem Bildschirm weiterhin in aller Konzentration zu verfolgen. Die Abstraktion der Darstellung ist übermächtig, ein Ensemble von Joystick und Display, und die Handgriffe der ICSI-Laborantin erinnern plötzlich an eine andere hochvermittelte Tätigkeit unserer Zeit, an den computergesteuerten Einsatz von Drohnen in den gegenwärtigen Kriegen – mit dem Unterschied allerdings, dass durch die Bewegung der Steuerhebel im Labor kein Mensch vernichtet, sondern gezeugt wird.
So unaufgeregt verläuft Helena Angermaiers Arbeit, dass der einzigartige Rohstoff in der Petrischale – künftiges menschliches Leben – fast in Vergessenheit gerät. Nur in manchen Momenten wird die Tragweite ihres Tuns erkennbar, etwa an der Eigenheit der Embryologin, mit den Spermien und Eizellen während des Befruchtungsvorgangs fortwährend zu sprechen. »Du da, geh weg«, sagt sie immer wieder, wenn bei der Auswahl eines Spermiums ein ungeeignetes Exemplar in die Nähe der Pipette gerät, oder, nachdem sie eine Eizelle fixiert hat: »So, jetzt habe ich für dich das schönste aller Spermien.« Sie tritt mit den Gameten in Dialog, als wären sie bereits belebte Geschöpfe; sie redet die Zellen fast mit elterlicher Strenge oder Güte an, und in diesen Momenten wird die besondere Beziehung der Embryologin zu ihrem Gegenstand deutlich, in dem natürlich das Verhältnis einer Mutter zu ihren Kindern durchscheint. Helena Angermaier spielt mit dieser Assoziation, spielt sogar mit jenen Mythen und medizinischen Konzepten, die den Einfluss der mütterlichen Empfindungen auf das im Entstehen begriffene Kind physiologisch herzuleiten versuchten. Bis an die Wende zum 19. Jahrhundert kam der Theorie der »mütterlichen Einbildungskraft« große Bedeutung zu, jener Hypothese, dass der Embryo im Mutterleib von seelischen Eindrücken auf die Schwangere in seiner Entwicklung gefördert oder gestört werden könnte.
Helena Angermaier aktiviert diese medizinisch längst überkommenen Lehren noch einmal für das Zeitalter der assistierten Empfängnis. Sie tut dies vor allem im Zusammenhang mit ihrer Leidenschaft für Musik. Wenn sie alleine im Labor arbeitet, läuft den ganzen Tag über Klassikradio im Hintergrund. Angermaier, bekennende Wagnerianerin, besitzt seit langem ein Abonnement für die Münchner Oper, die nur wenige Gehminuten von der Reproduktionsklinik entfernt liegt. Am Sonntag, wenn sie sich die Zeit frei einteilen kann, geht sie regelmäßig dorthin und sieht sich Wagner-Opern an. »In den Pausen«, sagt sie, »komme ich dann oft ins Labor zurück und führe eine ICSI-Behandlung zu Ende, das geht von der Zeit genau auf«. Und dann erzählt sie, dass diese »Sonntagskinder« ihrem Gefühl nach eine besondere Musikalität in die Wiege gelegt bekämen. »Vielleicht werden diese Kinder später eine Affinität zu Wagner entwickeln«, sagt sie, und sie hat diese Hoffnung auch schon mehrere Male bestätigt bekommen. Besonders gut kann sie sich an einen Fall erinnern, einen Sonntag im November 2006 (sie hat das exakte Datum sofort parat), als die »Walküre« im Nationaltheater gegeben wurde. Die erste Pause nutzte sie nach ihrer Gewohnheit, es wurden Zwillinge, und als sie Jahre später den Großvater dieser Kinder traf, mit dem sie persönlich bekannt ist, schwärmte er ihr vom musikalischen Gespür seiner Enkel vor. »Er ist auch Wagnerianer und natürlich hingerissen von dem Gedanken, dass die Kinder unter dem Einfluss des 1. Akts der ›Walküre‹ gezeugt worden sind.« Auf einer Ablage neben den Mikroskopen und Brutschränken steht inzwischen ein eingerahmtes Foto der Zwillinge.
Diese unschuldigen, allenfalls ein wenig exzentrischen Vorlieben der Embryologin weisen aber auf ein fundamentales Problem der Reproduktionsmedizin hin, das in diesem Buch immer wieder eine Rolle spielen wird: Es geht um die Frage, ob die technische Zeugungsweise, also etwa das gewaltsame Eindringen der Injektionsnadel in die Eizelle, Auswirkungen auf die Gesundheit der so entstandenen Kinder habe. Diese Debatte ist nach dem Aufkommen jeder neuen Methode der assistierten Empfängnis unter großen Kontroversen geführt worden. Noch heute bestehen Zweifel, ob die erzwungene Befruchtung durch IVF und ICSI, ihrer vollständigen Etablierung zum Trotz, die Disposition des Lebens nicht auf riskante Weise beeinflusse. Die junge Wissenschaft der »Epigenetik« etwa, die sich mit chromosomalen Prägungsfehlern während der Befruchtung beschäftigt, führt die Häufung mancher Gendefekte bei Neugeborenen auf die Verfahren der Reproduktionsmedizin zurück. Auch Helena Angermaier, eine der arriviertesten Embryologinnen Europas, ist nach dreißig Jahren täglicher Laborarbeit mit menschlichen Keimzellen keineswegs frei von dieser Sorge. »Ich glaube nicht, dass die Art der Entstehung vollkommen spurlos an einem Lebewesen vorbeigehen kann«, sagt sie mit einem für ihre Profession erstaunlichen Maß an Skepsis. Die ersten durch ICSI gezeugten Menschen sind jetzt über zwanzig Jahre alt. Es gibt zahlreiche Folgestudien über Gesundheit und Wachstumsprozess von Kindern und Jugendlichen aus assistierter Empfängnis, und keine von ihnen zeigt eine statistische Abweichung ihrer Entwicklung von den konventionell gezeugten Altersgenossen an. Diese Studien aber, sagt Angermaier, seien nur bedingt aussagekräftig: »Interessant wird es doch erst, wenn diese Menschen einmal vierzig oder fünfzig sind und man erkennen kann, ob es bei ihnen eine größere Neigung zu Krankheiten wie Krebs gibt.« Die Freilegung der seit Menschengedenken im Körperinnern vollzogenen Abläufe ruft Unbehagen hervor. Schon in Goethes morphologischen Studien wird einmal der Grundsatz ausgesprochen: »Alles was lebendig wirken soll, muss eingehüllt sein«.[3] Zweihundert Jahre später stellen die Praktiken der künstlichen Befruchtung dieses Gesetz der geschützten Lebensessenz auf eine elementare Probe.
Die Verfahren der assistierten Empfängnis sind im Jahr 2015 keine Randerscheinungen mehr. Ein halbes Jahrhundert nach Gründung der ersten Samenbanken in den USA und über 35 Jahre nach der Geburt der ersten in vitro gezeugten oder von einer bezahlten Leihmutter ausgetragenen Babys haben dieses Techniken jede Exotik verloren und bestimmen, je nach Rechtslage der einzelnen Länder, den Alltag der Reproduktionsmedizin. Weltweit gibt es bereits über fünf Millionen durch In-vitro-Fertilisation entstandene Menschen. In Deutschland geht derzeit jede vierzigste Geburt auf eine künstliche Befruchtung zurück; vor den Einschränkungen der Kostenübernahme im Jahr 2004 war es sogar jede dreißigste. Die Zahl der durch Samenspende eines Dritten gezeugten Kinder soll sich nach Angaben der Samenbank-Betreiber in Deutschland auf über 100000 belaufen; dieser Wert kann aber, im Gegensatz zu den seit 1982 im »Deutschen IVF-Register« erfassten Geburten, durch kein Verzeichnis nachgeprüft werden. Leihmutterschaft und Eizellspende sind gemäß den Bestimmungen des »Embryonenschutzgesetzes« weiterhin verboten. Die Zahl jener deutschen Paare aber, die den Offerten des Reproduktionstourismus folgen und in Ländern, die diese Verfahren anbieten, eine künstliche Befruchtung mit fremder Eizelle durchführen lassen oder sogar eine Leihmutter engagieren, hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen.
Laut den Angaben der Weltgesundheitsorganisation bleibt heute ein Siebtel aller Paare ungewollt kinderlos. »Steril« wird eine Partnerschaft nach der klinischen Definition genannt, wenn nach einem Jahr des regelmäßigen ungeschützten Geschlechtsverkehrs keine Schwangerschaft eingetreten ist. Bis in die 1960er Jahre hinein eröffnete das Verfahren der Adoption vielen unfruchtbaren Ehepaaren die Möglichkeit, doch noch Eltern zu werden. Drei zeitgleich einsetzende Entwicklungen sorgten dann aber für einen drastischen Rückgang der Anzahl jener Kleinkinder, die in den USA und Europa zur Adoption freigegeben wurden: der Siegeszug der »Antibabypille« als Verhütungsmittel, die gesellschaftliche Akzeptanz unehelicher Kinder und alleinerziehender Mütter sowie die Legalisierung der Abtreibung in zahlreichen Ländern. Die Zahl der in Frage kommenden Adoptivkinder ist heute sehr gering, die Wartezeit für die Paare beträgt viele Jahre.
In die Zeit dieser Umbrüche fällt die endgültige Etablierung der assistierten Empfängnis (wobei sich das Amt der Adoption und das Angebot der Fortpflanzungstechnologien nicht ohne weiteres in Beziehung setzen lassen, weil das eine elternlose Kinder versorgen soll, das andere aber kinderlose Eltern).[4] Neben der Befruchtung außerhalb des Körpers verbreiten sich nun auch Methoden, die Samen- oder Eizellen dritter Personen in den Empfängnisprozess miteinbeziehen. Die »heterologe« oder »donogene« Insemination mit dem Zeugungsstoff eines Samenspenders (auch unter der Abkürzung »DI« bekannt), eine schon seit den 1930er Jahren in den USA angewandte Methode, führt dank neuer Konservierungstechniken des Spermas zur Institution der Samenbank. Eine Zeitungsannonce im San Francisco Chronicle vom 18. April 1975 wiederum, in der sich ein »kinderloser Mann mit unfruchtbarer Ehefrau ein Test-Tube-Baby« wünscht, gilt als erstes öffentliches Leihmutter-Gesuch der Geschichte. Der Inserent ist ein kalifornischer Lehrer, dessen Intelligenzquotient laut eigener Aussage »im Geniebereich«[5] liegt, und der die Vorstellung nicht ertragen will, dass seine außergewöhnlichen Anlagen nicht auf ein leibliches Kind übertragen werden. Auf seine Annonce, erzählt er der Zeitung später in einem anonymen Interview, hätten sich 181 Frauen gemeldet. Das Ehepaar entscheidet sich für eine der Bewerberinnen, ohne sie persönlich kennenzulernen, zahlt ihr ein Honorar von 7000 Dollar, und nach einer Insemination mit dem Samen des Auftraggebers gebiert die Frau im Herbst 1976 eine Tochter. Leihmütter wie diese, die ihr genetisch eigenes Kind für ein anderes Paar austragen wollen, sind allerdings nur bis zum Ende der achtziger Jahre die Regel. Erleichterungen bei der chirurgischen Entnahme von Eizellen und spektakuläre Fälle, in denen das Kind nach der Geburt zum Streitobjekt zwischen den Parteien wird, führen in dieser Zeit zu einer Korrektur des Arrangements. Seit einem Vierteljahrhundert sind Frauen, die gegen Honorierung für andere ein Kind bekommen, nur noch in den seltensten Fällen genetisch mit ihm verwandt. Die Eizelle stammt vielmehr von der sozialen Mutter oder einer Spenderin. Für diese Tätigkeit und ihre Abgrenzung von der heute schon als »klassisch« bezeichneten Leihmutterschaft hat sich im Deutschen keine klare Terminologie herausgebildet. In den USA heißen diese Frauen »gestational surrogates«; in diesem Buch werden sie mit dem Wort »Tragemutter« bezeichnet.
Seit den 1970er Jahren bevölkern also zunehmend Figuren die Welt der Reproduktionsmedizin, die den Prozess menschlicher Fortpflanzung, die Sphäre der intimen Paarbeziehung schlechthin, öffnen und erweitern. Diese Konstellation ist nur schwer in das überlieferte Bild der Kernfamilie zu integrieren. Der Bundesverfassungsrichter Willi Geiger etwa schreibt 1960, im Hinblick auf das in den USA bereits bekannte Verfahren der Samenspende, kategorisch: »Ehe ist die Lebensgemeinschaft zweier Personen verschiedenen Geschlechts, die die Geschlechtsgemeinschaft umfaßt – eine Gemeinschaft, die ihrem Wesen nach nicht der Erweiterung fähig ist.«[6] Ein halbes Jahrhundert nach diesem Verdikt zeigt sich, dass das Wesen der Ehe doch elastischer gewesen ist als gedacht. Dennoch stellen die assistierten Reproduktionstechnologien bis heute die Frage, wie die Organisation von Verwandtschaft und Familie im Modus der Samenspende, Eizellspende oder Leihmutterschaft aufrechterhalten werden kann. Denn diese Techniken bringen fragmentierte Familienkonstellationen hervor; Jahr für Jahr kommen Tausende Kinder zur Welt, die bis zu fünf Elternteile haben. Enorme rechtliche und soziale Anstrengungen sind nötig, damit die problematischen Nähe-Distanz-Verhältnisse, die mit der Entkoppelung von biologischer Verwandtschaft und Familienbildung einhergehen, ausbalanciert werden können. Auf welche Weisen sind die Beziehungen zwischen den Beteiligten zu stärken oder zu anästhesieren? Wie lässt sich der Status der Spender als bloße Materiallieferanten oder Container menschlicher Fortpflanzung regulieren?
Die geläufigen Begriffe der Reproduktionsmedizin deuten in diesem Zusammenhang ein Umfeld altruistischer Gaben an und verschleiern die ökonomischen Bedingungen, die an diese Tätigkeiten geknüpft sind. Man spricht vom »Samenspender« (oder im Englischen vom »donor«), von der Eizellspenderin, von der Leihmutter. Tatsächlich wird vom Verkauf der Zeugungsstoffe und Fortpflanzungsgaben aber ein verzweigter Geldkreislauf aktiviert: Die Ärzte und Vermittler bezahlen die Spender, die Paare wiederum, mit erheblichem Aufpreis, die Ärzte und Vermittler. Eine Befruchtung mit Fremdsamen, die günstigste aller Methoden der assistierten Empfängnis, ist ohne zusätzliche Hormonstimulation der Patientin in Deutschland schon für wenige hundert Euro möglich, eine IVF- oder ICSI-Behandlung kostet pro Zyklus für gesetzlich Versicherte mindestens 3000 Euro, wobei verheiratete Paare, bei denen die Frau nicht älter als 40 und der Mann nicht älter als 55 sind, die Hälfte der Kosten bei den ersten drei Versuchen erstattet bekommen. Mit Abstand am teuersten sind jene Verfahren, die in Deutschland bislang nicht zulässig sind. Für das Engagement einer Tragemutter und einer zusätzlichen Eizellspenderin zahlen Paare in Kalifornien heute bis zu 150000 Dollar.
Über das Milieu der assistierten Empfängnis sind in den letzten zwanzig Jahren zahlreiche journalistische und sozialwissenschaftliche Bücher erschienen. Manche von ihnen, wie zuletzt Liza Mundys Großreportage »Everything Conceivable«, liefern einen facettenreichen Einblick in die aktuellen Verfahrensweisen der Reproduktionstechnologie. Was aber in all diesen mehr oder weniger staunenden, kritischen oder affirmativen Darstellungen ausbleibt, ist das Augenmerk auf der Geschichtlichkeit der Praktiken und Methoden, auf ihren wandelbaren medizin- und biologiehistorischen Bedingungen. Dieses Buch versucht daher zwei verschiedene Zugänge und Schreibweisen miteinander zu verbinden. Es ist zwar an den aktuellen Schauplätzen der Reproduktionsmedizin angesiedelt, den IVF-Kliniken, Samenbanken und Leihmutter-Agenturen in München, Essen und Berlin, Los Angeles und Kiew, und setzt sich aus Gesprächen mit Ärzten, Auftragseltern, Samenspendern, Leihmüttern und den aus assistierter Empfängnis hervorgegangenen Kindern zusammen. Die Beschreibung aktueller Phänomene wird aber immer wieder mit älteren, bis ins späte 17. Jahrhundert zurückreichenden Etappen des Zeugungswissens in Beziehung gesetzt. Dieses Vorgehen mag im ersten Moment wie eine allzu weite historische Auffächerung wirken. Doch was die Einbeziehung der früheren medizinischen und biologischen Vorstellungen – von der Entdeckung der Spermatozoen und Eierstock-Follikel über die aufkommende Zelltheorie bis zu den ersten Konzepten einer genetisch fundierten Vererbungslehre im ausgehenden 19. Jahrhundert – in einem Buch über neue Reproduktionstechnologien notwendig macht, ist die Erkenntnis, dass auch so natürlich und zeitlos wirkende Vorgänge wie die Zeugung eines Menschen oder die Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern eine Geschichte haben. Sowohl die Selbstgewissheit der Ärzte, ihre Tag für Tag bewerkstelligte Umwandlung von Zellmaterial in Lebewesen, als auch die Reflexe der Kritiker, die in der Aufspaltung von Mutterschaft oder der Zeugung in der Petrischale unverbrüchliche Güter der Humanität gefährdet sehen, lassen sich in dieser Hinsicht auf bestimmte Zäsuren des Wissens vom Menschen zurückführen.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts arbeiten die Verfahren der assistierten Empfängnis wie kaum ein anderer Bereich an der Modellierung eines neuen Menschenbildes. Die folgenden Seiten unternehmen den Versuch, dieses Menschenbild durch Gegenwartsbeschreibungen und historische Analysen genauer kenntlich zu machen. Ihr Gegenstand ist, um mit Walter Benjamin zu sprechen, die Reproduktion im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit.
Erstes KapitelDas Wissen von der Zeugung: Eine kurze Geschichte der Empfängnislehren
Die Vereinigung von Samen- und Eizelle im ICSI-Labor, wie sie die Embryologen täglich vornehmen, der Aufstieg der assistierten Empfängnis zu einer weltumspannenden Industrie setzt natürlich eines voraus: das sichere, lückenlose Wissen der Medizin um die Abläufe bei der menschlichen Zeugung. Heute sind diese Prozesse derart selbstverständlich und im Dienste der künstlichen Reproduktion freigelegt, dass der Eindruck entsteht, die Kenntnisse über Befruchtung und Empfängnis müssten, zumindest im groben Zusammenhang, seit langer Zeit gültig sein. Bei der Beschäftigung mit der Geschichte des Zeugungswissens fällt jedoch schnell das Gegenteil ins Auge. Die vermeintlich stabilen Tatsachen menschlicher Fortpflanzung sind überraschend jung. So waren etwa, um nur zwei Beispiele zu geben, der Menstruationszyklus der Frau und die Frage, in welchem Zeitraum eine Schwangerschaft eintreten kann, vor 1930 nicht verlässlich erforscht; die grundlegende Einsicht wiederum, dass »Befruchtung« als Verschmelzung von Samen- und Eizelle aufzufassen sei, wurde erst im Jahr 1876 von Oscar Hertwig verifiziert, zunächst am Seeigel. Daten wie diese vermitteln einen ersten Eindruck davon, wie verschlungen der Weg der Mediziner und Biologen gewesen sein muss, bevor die genaue Rekonstruktion der Empfängnis und schließlich ihre Nachahmung außerhalb des weiblichen Körpers möglich wurde. Es ist deshalb naheliegend, ein Buch über die Verfahren künstlicher Reproduktion mit einer kurzen Geschichte des Zeugungswissens zu beginnen (nicht zuletzt deshalb, weil sich in den hochmodernen Verfahren der Reproduktionsmedizin immer wieder die scheinbar archaischen Vorstellungen früherer Jahrhunderte abzeichnen).
1. Delft, 1677
Unter den vielen Zuspitzungen und Brüchen in der Erforschung menschlicher Fortpflanzung lässt sich ein Ausgangspunkt bestimmen, der vielleicht nicht allzu willkürlich gewählt ist: die 1670er Jahre in der niederländischen Stadt Delft. Eine seltsame historische Koinzidenz bringt hier zwei Forscher zusammen, die unabhängig voneinander die Vorstellung vom Entstehen der Lebewesen in eine neue Richtung führen, der eine für den männlichen, der andere für den weiblichen Anteil der Zeugung. Antoni van Leeuwenhoek entdeckt 1677, bei seinen vielfältigen mikroskopischen Studien, die Spermatozoen in der Samenflüssigkeit. Regnier de Graaf seziert ein paar Jahre zuvor die Eierstöcke von Frauen und erkennt als Erster die spezifisch weiblichen Anteile dieser Organe – die bei Säugetieren bis dahin als nach innen gestülpte, funktionslose Entsprechung der Hoden galten – für die Fortpflanzung des Menschen. Er hält die Follikel in den Eierstöcken zwar für die Eier selbst (erst 1827 wird Karl Ernst von Baer das Säugetier-Ei tatsächlich entdecken), doch er beschreibt die Funktion dieser Bläschen, ihre Veränderung im Prozess der Ei-Reifung, mit großer Genauigkeit. Sie tragen noch heute, als »Graafsche Follikel«, seinen Namen.
Wenn in den ICSI-Labors der Gegenwart in aller Routine mit Spermien und Eizellen hantiert wird, geht dieses Wissen auf die ersten Beobachtungen Leeuwenhoeks und de Graafs zurück. Denn vor 1670, in einer Zeit ohne wissenschaftliche Nutzung des Mikroskops, gab es keinerlei Hinweis auf eine lokalisiend extrahierbare Essenz im Samen des Mannes, genauso wie auch die Herkunft und Beschaffenheit der weiblichen Zeugungsstoffe unerforscht waren. Buffon schreibt 1749, im dritten Band seiner monumentalen »Naturgeschichte«, über die Entwicklung des Zeugungswissens: »In einem Zeitraum von siebenzehn bis achtzehn Jahrhunderten ist in dieser Materie nichts Neues weiter hinzugedacht und erfunden worden« – eine Diagnose, die François Jacob in seiner Studie »Logik des Lebenden«, der unerreichten Messlatte aller Bücher über die Geschichte der Biologie, noch einmal bestätigt.[7] Buffon meint mit seiner Rechnung, dass die antiken Empfängnislehren von Hippokrates, Aristoteles (und Galen 500 Jahre später) noch Ende des 16. Jahrhunderts unverändert übernommen worden sind. Was die Frage nach dem spezifischen Zeugungsstoff der beiden Geschlechter betrifft, hat dieser Befund sogar hundert Jahre länger Gültigkeit, bis in die Epoche von Leeuwenhoek und de Graaf.
Aristoteles’ Konzept der Empfängnis ist Gegenstand seiner späten Schrift »Von der Zeugung der Geschöpfe«. Er entwickelt darin die Auffassung, dass menschliches Leben beim Geschlechtsakt aus dem Samen des Mannes und dem Menstruationsblut der Frau entsteht, wobei das Blut die materielle Substanz des Embryos ausmacht und der Samen allein als schöpferische, bildende Kraft wirkt, ungefähr so »wie aus dem Schreiner und dem Holz ein Bett wird« – ein Vergleich, den Aristoteles in dieser Abhandlung häufig gebraucht.[8] Hippokrates und Galen dagegen gehen von einem Zwei-Samen-Modell aus: Der Embryo entwickelt sich aus dem Zusammenfließen eines männlichen und eines weiblichen Samens in der Gebärmutter; beide Substanzen haben materiellen Anteil an dieser Vereinigung. Das Menstruationsblut der Frau wird laut Hippokrates nur dazu benötigt, den Samenkeim während der Schwangerschaft zu nähren.[9] Wie wirkungsvoll vor allem das aristotelische Zeugungsmodell noch Mitte des 17. Jahrhunderts ist, lässt sich an der einflussreichsten Schrift über Fortpflanzung in dieser Zeit erkennen. William Harvey veröffentlicht 1651, gut zwanzig Jahre nach seinem schmalen, aber bahnbrechenden Traktat über den Blutkreislauf, das viele hundert Seiten lange Werk »Übungen zur Erzeugung der Tiere«, das in seiner Beschreibung des Befruchtungsvorgangs letztendlich die aristotelischen Grundvorstellungen aufrechterhält. Das geschieht allerdings nicht freiwillig. Schon in den ersten Sätzen der Einleitung will Harvey sich gegen die allzu »fehlerhaften und voreiligen Schlüsse«[10] von Galen und dem grundsätzlich verehrten Aristoteles abgrenzen. Das Konzept eines immateriell wirkenden, nur formgebenden Samens verwirft er als philosophische Spielerei. Seine anatomischen Untersuchungen an Hühnern und Hirschkühen stehen vor allem unter der Prämisse, dass sich »alles Leben aus dem Ei« entwickelt, auch das der Säugetiere, bei denen das Ei laut Harvey in der Gebärmutter entsteht. (Diese Vorstellung hat aber noch nichts mit den späteren Entdeckungen de Graafs zu tun; Harveys Konzept des »Eies« bezeichnet auf vage und eher metaphorische Weise die Grundorganisation jedes neuen Lebewesens, sogar derjenigen, die nach seiner Ansicht durch Urzeugung entstehen, also durch Fäulnis und Zersetzung.) Die Kapitel über die Säugetiere am Ende der Abhandlung sind ganz von der Ambition geleitet, möglichst kurz nach der Paarung ein Samen-Ei-Gemisch in der Gebärmutter aufzufinden. Harvey, zu dieser Zeit Leibarzt Charles’ des I., begleitet den König auf die Jagd und bekommt die geschossenen Hirschkühe in den Wochen der Brunst täglich zur Verfügung gestellt, um die Anfänge der Embryo-Entwicklung zu erforschen. Er findet bei den Sektionen zu seiner Verwunderung aber keinerlei Spuren eines sich bildenden Keims. Heute weiß man, dass Harvey die Versuchstiere falsch gewählt hat, weil Hirschkühe erst vier Wochen nach der Brunst ihren Eisprung haben. Doch er hält den »leeren Uterus«, nach Wochen der vergeblichen Bemühungen, mehr und mehr für eine Tatsache des Zeugungsvorgangs, und als sich dieser Befund – in offenkundig fehlerhaften Sektionen – auch bei Hunden und Kaninchen bestätigt, ist für ihn bewiesen, dass nach einer erfolgreichen Paarung weder Samenflüssigkeit noch die weiblichen Zeugungsstoffe in die Gebärmutter gelangen.
Zwischen der Befruchtung und dem wahrnehmbaren Embryo der Hirschkuh, den Harvey erst acht Wochen später in der Gebärmutter entdeckt, besteht eine rätselhafte Verzögerung. Diese Lücke versucht das kurze Supplement »Über die Empfängnis« zu deuten, das dem Hauptwerk angehängt ist. In diesem Text orientiert sich Harvey wieder an den schon verworfenen Theorien und Metaphern Aristoteles’, an der rein schöpferischen Kraft des Samens; er beschreibt, dass die spurlose Empfängnis wie eine immaterielle Ansteckung durch den männlichen Samen erfolgen müsse, »in der Art, wie ein Eisen, das vom Magneten berührt wird, selbst mit diesen Kräften ausgestattet«[11] wird. Harvey geht bei seiner Erklärung der immateriellen Zeugung aber noch einen Schritt weiter und entwickelt ein wahrhaft bemerkenswertes Modell; er erklärt die Empfängnis aus der schieren Einbildungskraft der Frau. Struktur und Funktion der Gebärmutter, schreibt er, ähneln der des Gehirns. Der Koitus rufe daher eine Imagination des Uterus hervor; die Frau werde mit der körperlosen Idee der Schwangerschaft imprägniert.
Das also ist der Status quo der Zeugungslehre Mitte des 17. Jahrhunderts: Empfängnis wird, in Ermangelung wahrnehmbarer Spuren, als Idee verstanden; eine konkrete Bestimmung der befruchtenden Essenzen gilt aufgrund der großen Autorität William Harveys fortan als unmöglich. Dass sich in den zwanzig Jahren darauf dennoch entscheidende Beobachtungen über die Zeugungsstoffe der Frau ergeben, hat genau mit dieser Autorität zu tun: Denn das Diktum vom »leeren Uterus« bringt Anatomen wie Regnier de Graaf dazu, ihr Augenmerk von der Gebärmutter auch auf benachbarte Organe zu verlegen, etwa auf die Eierstöcke. Für Harvey – den letzten Repräsentanten einer Empfängnislehre, »die noch tief in der politischen Ästhetik des Ein-Geschlecht-Modells wurzelt«[12] – sind die Eierstöcke nichts als minderwertige Testikel. Wenn Aristoteles die Frau als »zeugungsunfähigen Mann« bezeichnete, dann ist Harveys Konzept noch genau von dieser Hierarchisierung der Geschlechter geprägt. Den »weiblichen Testikeln«, wie er sie nennt, wird deshalb auch jede Bedeutung im Empfängnisprozess abgesprochen.[13]
In Regnier de Graafs »Neuer Abhandlung über die Zeugungsorgane der Frauen« von 1672 dann ist der Wandel der Perspektive schon an der Terminologie ablesbar: Im Kapitel über die Funktion der Eierstöcke lässt er keine Gelegenheit aus, um zu betonen, dass diese Organe keine »Testikel« seien, sondern spezifisch weibliche Organe mit einem eigenen Namen, so wie er auch in seiner Beschreibung der beiden schmalen Kanäle zwischen den Eierstöcken und der Gebärmutter eine Veränderung des Sprachgebrauchs vornimmt. Bislang hießen diese Kanäle nach ihrem Entdecker Mitte des 16. Jahrhunderts »Fallopische Röhren«, und in der Tradition Galens wurden sie lange Zeit für die Transportleitung des weiblichen Samens gehalten. De Graaf schlägt hingegen die seiner Ansicht nach richtige Bezeichnung »Eileiter« vor. Es sei das Ziel der Abhandlung, heißt es einmal, »deutlich zu machen, dass Frauen und Männer ganz unterschiedliches Material zum Prozess der Zeugung beisteuern«.[14] Regnier de Graaf steht also genau auf der Schwelle zur Etablierung zweier autonomer Geschlechterkategorien in der Medizin; die zweitausend Jahre alte Rede von der Frau als minderwertigem Mann ist in seinen Ausführungen verschwunden.
Die empfängnisgeschichtliche Bedeutung der Schrift geht vor allem auf de Graafs Beschreibung der Eierstock-Follikel zurück, die er zum ersten Mal als Produktionsort der weiblichen Zeugungsstoffe wahrnimmt. In seiner Terminologie sind die Follikel die Eier, und diese irrtümliche Gleichsetzung erscheint ihm umso zulässiger, weil die Anzahl der im Eierstock enthaltenen Bläschen immer exakt der Anzahl der befruchteten Eier entspricht, die er bei seinen Vivisektionen in den Tagen nach der Paarung im Eileiter und in der Gebärmutter der Tiere auffindet. Dass diese im Entstehen begriffenen Embryonen aber etwa zehnmal so klein sind wie die Bläschen, kann er sich nicht erklären: Wie kommen die im Vergleich so riesigen Follikel durch den Eileiter? De Graaf hat dafür verschiedene Deutungen: Einmal sagt er, der Eileiter würde sich nach der Paarung in unvorhergesehenem Ausmaß dehnen wie später der Muttermund bei der Geburt, was aber immer noch nicht die geringe Größe der befruchteten Eier erläutert. An anderen Stellen spricht er von seiner Überzeugung, dass sich der Inhalt der Follikel nach der Befruchtung in flüssigem Zustand in den Eileiter ergießen und erst dort zu einem Embryo gerinnen würde. Bevor das winzige Säugetier-Ei einer Hündin entdeckt wird, vergehen noch eineinhalb Jahrhunderte.
1673, kurz vor seinem frühen Tod, macht Regnier de Graaf die Royal Society in London auf seinen Landsmann Antoni van Leeuwenhoek aufmerksam. Der ehemalige Tuchhändler und wissenschaftliche Autodidakt hat in Delft erstaunliche Erkenntnisse mit seinen selbstgefertigten Mikroskopen erzielt, einer seit einem halben Jahrhundert bekannten Apparatur, die bis dahin nur als Unterhaltungsgegenstand betrachtet wird und in der naturwissenschaftlichen Forschung nicht vorkommt. Leeuwenhoek berichtet von der Existenz unendlich kleiner »Tierchen« im Blut, Speichel oder Regenwasser; er entdeckt die roten Blutkörperchen und, ohne besondere Resonanz, auch jene Lebewesen, die knapp zweihundert Jahre später von Pasteur und Robert Koch als »Bakterien« beschrieben werden und die hygienische Forschung erneuern. De Graaf vermittelt die Korrespondenz mit der Society, dem naturwissenschaftlichen Zentrum Europas. Zeit seines 90-jährigen Lebens publiziert Leeuwenhoek nichts als diese Briefe, die regelmäßig in den »Philosophical Transactions« der Gesellschaft erscheinen.
Vier Jahre nach seiner Einführung in die Royal Society berichtet er dem Präsidenten von einem neuen »Wunder der Natur«,[15] das er unter dem Mikroskop beobachtet habe. Bis zu dieser Zeit ist die Befruchtungsfähigkeit des männlichen Samens komplett rätselhaft geblieben; nach allgemeiner Auffassung hat man es mit einer flüchtigen Substanz zu tun, die allenfalls im Zustand der Verdampfung auf die weiblichen Zeugungsstoffe trifft, als immaterieller »Samengeist«, wie Harvey sagt, als »aura seminalis«. In seinem Brief vom November 1677 nun schildert Leeuwenhoek den Besuch des jungen Medizinstudenten Johan Ham. Er hat ein Glasfläschchen mit menschlicher Samenflüssigkeit bei sich, die angeblich von einem gonorrhoekranken Mann stammt. Ham hat unterm Mikroskop bereits bewegliche »Tierchen« in dem Samen entdeckt; er glaubt, sie seien ein Produkt dieser Geschlechtskrankheit und durch Urzeugung entstanden. Leeuwenhoek untersucht weitere Proben, von einem gesunden Mann, und er schildert seine Überwältigung angesichts der Fülle und Kleinheit der »Tierchen«: »Sie sind winziger als die roten Blutkörperchen«, schreibt er, »und ich behaupte, dass nicht einmal eine Million von ihnen dem Umfang eines großen Sandkorns entsprechen würde.«[16] In einem späteren Brief errechnet er, dass der Samenerguss eines Kabeljaus mehr als die zehnfache Anzahl von »Tierchen« enthalte, als es Menschen auf der Erde gibt. Leeuwenhoek ahnt bereits, dass diese Beobachtung auf allgemeinen Widerstand stoßen wird, »weil es unmöglich scheint, dass eine solch geringe Menge an Flüssigkeit so viele lebende Wesen enthalten kann«.[17] Die Form dieser Geschöpfe im Samen des Menschen und verschiedener Säugetiere, der lange dünne Schwanz, erinnert ihn an Schlangen oder Aale. Leeuwenhoek unternimmt Versuche über die Lebensdauer von Hundesperma, lässt die Proben in einem offenen Glas stehen und stellt fest, dass die letzten »Samentierchen« erst nach 36 Stunden ihre Beweglichkeit verlieren. Zu dieser Zeit glaubt er noch, die »Tierchen« von einer zweiten Struktur in der Samenflüssigkeit unterscheiden zu können, von »Gefäßen«, in denen er die Vorstufe von Nerven, Arterien und Venen vermutet: eine Beobachtung, die er einige Jahre später verwirft. Die diskrete Schreibweise des ersten Briefes von 1677 macht jedenfalls deutlich, wie sehr sich Leeuwenhoek des heiklen Charakters seiner Forschungsgegenstands bewusst ist, und er betont mehrmals, dass er sich zur Gewinnung seines Materials »nicht selbst besudelt« habe, sondern allein auf »Überreste ehelichen Verkehrs« zurückgreifen konnte.[18] Bald wendet sich Leeuwenhoek von der Untersuchung des Ejakulats hin zu der Frage, wo im Körper die »Samentierchen« (oder die »Spermatozoen«, wie man sie seit dem frühen 19. Jahrhundert nennt) produziert werden. Seine mikroskopischen Studien bestätigen die Überzeugung, »dass die Hoden zu keinem anderen Zweck vorhanden sind, als die ›Tierchen‹ zu bilden und sie solange zu beherbergen, bis sie ausgestoßen werden«.[19] In dieser Entdeckung sieht er auch den endgültigen Beweis gegen die verbreitete Annahme, die Samenwürmer würden aus Urzeugung entstehen und nichts mit dem Prozess der Fortpflanzung zu tun haben.
Antoni van Leeuwenhoek ist der erste Forscher, der im männlichen Sperma die bestimmende materielle Quelle für das neue Lebewesen zu erkennen glaubt. Die Bedeutung der Ovarien für die Zeugung, nach de Graafs einflussreicher Abhandlung weithin anerkannt, bestreitet er. Die Gebärmutter übernimmt für ihn allein die Versorgung des Embryos; wie und wo die weiblichen Zeugungsstoffe genau entstehen, bevor sie auf die Spermatozoen treffen, bleibt in seinen Briefen vage und sekundär. Mit der Entdeckung der »Samentierchen« beginnt eine lange Epoche in der Geschichte der Empfängnislehren, die ganz von einer Konkurrenz der Geschlechter geprägt ist. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wird diese Ausschließlichkeit der Standpunkte andauern: Entweder man hält die männlichen Zeugungsstoffe für die entscheidenden bei der Fortpflanzung oder die weiblichen, entweder die Spermatozoen oder die Eierstock-Follikel. Die heute so selbstverständlich und natürlich wirkende Vorstellung, dass Empfängnis das gleichwertige Zutun zweier Arten von Zellen erfordert, dass es, wie der Begriff der »Verschmelzung« nahelegt, um ein symmetrisches Verhältnis der Geschlechter im Zeugungsakt geht, war lange Zeit ein fremder Gedanke. Leeuwenhoek selbst nimmt in den Jahrzehnten nach seiner Entdeckung allerdings eine Außenseiterposition ein. Besondere Skepsis löst unter den Naturforschern die unvorstellbare Verschwendung des männlichen Zeugungsmaterials aus: ein Umstand, der das ganze 18. Jahrhundert hindurch kontrovers diskutiert wird. Wenn es wirklich stimmt, dass im Ejakulat Millionen von »Tierchen« enthalten sind, von denen womöglich ein einziges zur Befruchtung ausreicht (Antoni van Leeuwenhoek selbst vermutet das schon)[20] – wie kann es dann sein, dass bei jedem Geschlechtsakt so viele Spermatozoen vergeudet werden?
2. Evas Eierstöcke, Adams Testikel: Präformationstheorie und Einschachtelungslehre
Seit den 1670er Jahren wird die Theorie der männlichen und weiblichen Zeugungsessenzen kontrovers diskutiert, doch zwei entscheidende Fragen bleiben allen Forschern weiterhin rätselhaft: Wie treten die beiden Stoffe genau in Kontakt zueinander? Und warum entsteht aus dem befruchteten Ei schließlich ein neues Lebewesen? Vor dem Aufkommen der Zellenlehre, mit ihren genaueren Mikroskopen, findet sich hinter den sichtbaren Strukturen des Körpers kein »verborgener Bauplan«, wie François Jacob sagt, finden sich keine »Zellen«, keine »Chromosomen«, keine »DNS«, die den Biologen vom ersten Drittel des 19. Jahrhunderts an immer tiefere und abstraktere Wissensschichten über die Anfänge des Lebens erschließen. Alles, was am Menschen Auskunft geben soll über sein Entstehen, muss dagegen noch den bloßen Augen verfügbar sein, den bescheidenen Vergrößerungsskalen der frühen Mikroskope oder – und das spielt in den Empfängnislehren des 18. Jahrhunderts eine zentrale Rolle – dem spekulativen Verstand.
Um die Frage nach der Herausbildung neuer Lebewesen zu klären, konzentrierten sich die Zeugungstheoretiker von Aristoteles bis Harvey auf das bebrütete Hühnerei. Sie öffneten die Schale in verschiedenen Phasen des Brutvorgangs, und auch wenn Uneinigkeit darüber herrschte, welche Organe zuerst entstehen, stimmten sie doch in einer grundsätzlichen Beobachtung überein: dass sich der Embryo nach und nach aus undifferenzierter Materie entwickelt. »Wenn der Keim sich von den beiden Elternanteilen selbständig gemacht hat«, heißt es bei Aristoteles, »muß er sich selber aufbauen«.[21] Neben dieser Theorie der »Epigenese«, der allmählichen und sukzessiven Entwicklung des Embryos, ist jedoch schon in den Schriften der Kirchenväter vereinzelt von einem ganz anderen Modell die Rede: von der Vorstellung, dass der Embryo bereits vor der Befruchtung im Ei oder im Mutterkörper vorhanden sei, als vollendetes Miniaturbild der ausgewachsenen Gestalt. Das Ereignis der Zeugung wird von den Anhängern dieser »Präformations«-Lehre als bloße Aktivierung des fertigen Keims verstanden, als Auslöser seines Wachstums.[22]
Das Rätsel der Fortpflanzung wird durch die Annahme vorgeformter Keime allerdings nur verschoben. Denn wenn die Embryos schon vor der Befruchtung in vollendeter Gestalt im Körper eines Elternteils existieren – wie sind sie dann dorthin gelangt? Um diese Frage zu lösen, taucht in den 1670er Jahren ein Erklärungsmodell auf, das die Zeugungslehre weit über ein Jahrhundert lang bestimmen wird, auch wenn seine Argumentation von heute aus abenteuerlich erscheint. Der Ursprung jedes einzelnen Lebewesens ist in diesem Modell an den Ursprung des Universums gekoppelt. Nicolas Malebranche schreibt 1674, im ersten Teil des vielbändigen Werks »Über die Wahrheit«, von seiner Überzeugung, »daß alle Körper der Menschen und Thiere, welche bis an das Ende der Zeit entstehen werden, bereits bei der Schöpfung der Welt hervorgebracht worden«[23] sind. Diese Passage gilt als Gründungstext der »Präexistenzlehre«. In Evas Eierstöcken (oder in Adams Testikeln), so die Konsequenz dieser Theorie, haben sich bereits alle jemals zur Welt kommenden Menschen in unendlich kleiner Gestalt befunden. Zur Veranschaulichung und Legitimation seiner Hypothese dient Malebranche das Entstehungsprinzip des Schmetterlings, wie es in diesen Jahren von verschiedenen Naturforschern dargestellt wird. Unter dem Mikroskop häuten sie Raupen und glauben zu erkennen, dass die Raupe die bereits vollkommen gestaltete Puppe umschließt und die Puppe wiederum den fertigen Falter. Die Herausbildung des Tieres sei also gleichbedeutend mit der Auswicklung seiner bereits existenten Stadien. »Einschachtelungstheorie« lautet der fortan gebräuchliche Name für dieses Modell der Empfängnis – wobei die Behauptung, der Prozess der Auswicklung habe mit dem Ursprung der Welt begonnen, am Ende des 17. Jahrhunderts von der Vorstellung erleichtert wird, dass der Schöpfungstag genau berechenbar ist. Gemäß den exakten genealogischen Angaben der Genesis, von Adam über Abraham, Moses und König David zu Jesus, wird die Entstehung der Erde vor dem Aufkommen der Evolutionstheorie auf das Jahr 3760 v.Chr datiert. Die Präexistenzlehre muss also nur etwa 5500 Jahre oder rund zweihundert Generationen zurückrechnen, wodurch die Menge an ineinandergeschachtelten Lebewesen überschaubarer wird.
Im 18. Jahrhundert ist das Wissen von der Empfängnis also von der Abkehr des Interesses am spezifischen Zeugungsprodukt gekennzeichnet. Deshalb kann auch der Begriff der »Reproduktion« zu dieser Zeit noch nicht geläufig sein, wenn über das Phänomen der Zeugung gesprochen wird. Denn die Wiederherstellung des Lebens, von Generation zu Generation, ist ein unvorstellbarer Gedanke. Das Wort »Reproduktion« wird Anfang des 18. Jahrhunderts vielmehr in einem anderen Zusammenhang in die Naturforschung eingeführt, und zwar im Sinne der natürlichen Regeneration von verstümmelten Körperteilen bei Tieren wie Krebsen und Salamandern. Erst Buffon gibt dem Begriff offensichtlich zum ersten Mal die heute gebräuchliche Bedeutung.
In den Jahrzehnten nach de Graafs und Leeuwenhoeks Entdeckungen sind die Naturforscher vom Wunschtraum erfüllt, tatsächlich einen Embryo vor der Befruchtung im Körper aufzufinden, um die Lehre der Präexistenz so anschaulich wie möglich zu machen. Für die Ovisten ist das problematisch, weil sie das Ei selbst nicht genau lokalisieren können. Den Animalkulisten dagegen scheint diese Hoffnung begründeter zu sein, da die »Samentierchen« ja zweifelsfrei unter dem Mikroskop zu bestimmen sind. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts kommt es daher zu spektakulären und lange diskutierten Veröffentlichungen und Korrespondenzen, in denen die Anwesenheit winziger Menschen im Spermium behauptet wird. Leeuwenhoek selbst wendet sich gegen diese seiner Ansicht nach unzulässige Vereinfachung. Er ist zwar davon überzeugt, dass der Embryo aus dem Spermatozoon entsteht und die weiblichen Zeugungsstoffe nur zur Ernährung dienen, und er behauptet seit den frühen 1680er Jahren auch, das Geschlecht des künftigen Lebewesens an der Form des »Samentierchens« erkennen zu können. Doch was er strikt abstreitet, ist die Vorstellung, dass die Gestalt des Lebewesens schon vor der Befruchtung, vor der Versorgung in der Gebärmutter in den Spermatozoen ausgebildet sei.
1694 erscheint Nicolas Hartsoekers berühmter »Essay de Dioptrique«. Besondere Aufmerksamkeit erlangt die Abhandlung durch eine Zeichnung auf den letzten Seiten des Buches, in der die bis dahin radikalste Interpretation des Animalkulismus illustriert wird. Sie zeigt ein Spermium, in dessen Kopf ein Fötus mit klar erkennbaren Körperumrissen hockt, mit Armen, Beinen und sogar Händen und Zehen [ Abb. 1]. Fünf Jahre später veröffentlicht ein völlig unbekannter Forscher namens Dalenpatius einen Brief und einige Illustrationen, die genau diese Hypothese bestätigen sollen: dass der Mensch bereits im Spermatozoon existiere. Er schreibt, er habe mit eigens konstruierten Mikroskopen die Beschaffenheit des menschlichen Samens untersucht und darin nicht nur winzige Salzkristalle gefunden, deren Reibung die Lustgefühle beim Koitus verursachen sollen, sondern auch besonders große und bewegliche Tierchen. In diesen Tierchen, behauptet Dalenpatius, stecke tatsächlich der ausgebildete Körper: »Ich habe einem von ihnen die Haut abgezogen, in der es eingeschlossen war, und habe ganz deutlich, ohne Verhüllung, seine beiden Schienbeine gesehen, seine Brust und zwei Arme.«[24] [ Abb. 2] Das Geschlecht, sagt er, habe er nicht erkennen können, und die Geschöpfe seien auch im Moment der Häutung sofort gestorben. Dalenpatius’ Brief erscheint gleichzeitig in Amsterdam, London und Edinburgh; Antoni van Leeuwenhoek zitiert ihn ausführlich in einem Schreiben an die Royal Society, lehnt das Gesagte und Abgebildete aber als »pure Einbildung«[25] ab. Die aufsehenerregenden Thesen werden im frühen 18. Jahrhundert jedoch immer wieder diskutiert. Erst im Jahr 1741 enthüllt ein Freund das Pseudonym des unbekannten Autors; hinter dem latinisierten Anagramm »Dalenpatius« verbirgt sich der kurz zuvor gestorbene François de Plantade, ein Astronom und Novellendichter, der offenbar einen satirischen Beitrag zur Präexistenztheorie publiziert hat. Doch auch diese Enthüllung kann etwa Buffon nicht davon abhalten, den Brief in seiner »Naturgeschichte« kritisch, aber ausführlich zu paraphrasieren.
Der fertig ausgebildete Mensch im Spermium, nach den zeugungstheoretischen Vorstellungen von Nicolas Hartsoeker (1694) und Dalenpatius (1699)
Über ein Jahrhundert lang steht das Wissen von der Zeugung also im Zeichen der Präexistenz. Die umfassendste Beschreibung ihrer Vorstellungen liefert Charles Bonnet in den beiden Bänden seiner »Betrachtungen über die organisirten Körper« von 1762 und 1768. Ein zentrales Element der Abhandlung besteht darin, die präformierten Gebilde nun verbindlich als »Keime« zu definieren. Jene Sehnsucht der Naturforscher um 1700, in den »Samentierchen« oder Follikeln bereits das Lebewesen selbst aufzuspüren, findet keine Erwähnung mehr. Was die Position und Verbreitung dieser Keime betrifft, stellt Bonnet zwei alternative Konzepte zur Diskussion: zum einen die bekannte Theorie der Einschachtelung in den Eierstöcken, zum anderen aber die neue Vorstellung, dass die Keime in der Luft, im Wasser und in der Erde zerstreut seien und sich die entsprechenden Körper erst suchen würden. Das entscheidende Argument für die Wahrhaftigkeit der Präexistenztheorie hat laut Bonnet mit der komplexen Organisation der Lebewesen zu tun, die unabhängig von der göttlichen Schöpfung nicht gedacht werden könne. Mit Blick auf den skeptischen Buffon fragt er, ob die Kritiker der Einschachtelungslehre wirklich anzweifeln könnten, dass »diese bewunderungswürdige Maschine durch eben die Hand, die den Plan des Weltgebäudes gezeichnet, von Anfange auch schon im Kleinen abgezeichnet sey«.[26] In diesen Worten Bonnets zeigt sich die unauflösliche Vermischung von religiösen und zeugungstheoretischen Anschauungen im 18. Jahrhundert. Vor allem das Konzept des Anfangs ist im Denken der Präexistenzlehre stabil und unhintergehbar. Es ist ein doppelter Anfang – der des Universums und der jedes einzelnen Lebewesens fallen in eins. Die Kategorie »Leben« kann nicht unabhängig von der göttlichen Schöpfung gedacht werden; es gibt keinen Zeitbegriff für das, was vor der Entstehung jeder individuellen Existenz gewesen sein könnte. Hundert Jahre nach Bonnet wird Rudolf Virchow, in seiner Variante der Zelltheorie, den Grundsatz aufstellen, dass jede Zelle aus einer bereits vorhandenen entstehen müsse – ein ganz anderes, gleitendes Konzept vom »Anfang« des Lebens, seine unaufhörliche Verschiebung und letztendlich vielleicht seine Eliminierung. Wo Leben ist, muss immer schon Leben gewesen sein: eine Vorstellung, die Mitte des 18. Jahrhunderts unmöglich ist.
Charles Bonnet repräsentiert vor allen anderen Präformisten auch den anti-empirischen, spekulativen Charakter dieser Empfängnislehre. Die Einschachtelungstheorie, schreibt er, »ist einer von den größten Siegen des Verstandes über die Sinne«.[27] Ihre Wahrheit beglaubigt sich nicht durch naturwissenschaftliche Versuche, sondern durch die Stringenz des theoretischen Systems. Bonnet kommt diese Gewichtung insofern entgegen, als er seit der Kindheit fast taub ist und in seinen frühen Zwanzigern langsam erblindet. Für den Stellenwert der Empirie im Denken der Präexistenzlehre ist es bezeichnend, dass ihr wichtigster Protagonist in seiner Sinneswahrnehmung derart beeinträchtigt ist. Es gibt aber einen Adressaten in Bonnets umfangreicher Korrespondenz, der genau am anderen Ende des wissenschaftlichen Methodenspektrums steht: den italienischen Naturforscher und Priester Lazzaro Spallanzani, Pionier der experimentellen Biologie und der künstlichen Befruchtung. Bonnet begreift ihn, wie er einmal sagt, als ausführendes Instrument seines Denksystems.
Spallanzanis Befruchtungsexperimente mit Fröschen, Kröten und Salamandern, 1780 erstmals gesammelt erschienen, formulieren als Ziel die »völlige Evidenz«[28] der Präformationslehre. Zunächst will er den Nachweis erbringen, dass die unbefruchteten Eier der Amphibien bereits die vorgeformten Kaulquappen enthalten. Da er als einer der ersten Forscher erkennt, dass der Froschlaich zunächst vom Weibchen abgesondert wird und erst dann, außerhalb des Körpers, vom Männchen mit dem Samen besprüht wird, steht die ovistische Lehre für ihn außer Zweifel. Die Eier müssen bereits die Larven sein. Spallanzanis Augenmerk richtet sich nun auf die Frage, welche Funktion der Samenflüssigkeit in diesem äußerlichen Befruchtungsakt zukommt. Er wiederholt einen aufwendigen Versuch, den Réaumur dreißig Jahre zuvor erfolglos unternommen hat: Er zieht den Froschmännchen kleine, aus Harnblasen gefertigte Hosen über, um das Sperma während der Paarung zurückzuhalten. Tatsächlich bleiben die Eier nach dieser Prozedur unbefruchtet; die Samenflüssigkeit scheint also trotz ovistischer Grundhypothese ein notwendiger Bestandteil der Empfängnis zu sein. Doch wie lässt sich der Anteil der männlichen Zeugungsstoffe genau bestimmen?
Die Besonderheit der extrakorporalen Befruchtung bringt Spallanzani auf eine Idee. Weil die Fortpflanzung der Frösche und Kröten jenem »Naturgesetz« widerspricht, dass die Befruchtung »in dem Innersten der Mutter vorgeht«,[29] könnte es bei den Amphibien vielleicht möglich sein, den Begattungsakt künstlich zu imitieren. Mit dieser Methode würde sich die Befruchtungskraft der Samenflüssigkeit produktiver und präziser untersuchen lassen, nicht nur im Ausschlussverfahren wie mit dem Hosenexperiment. Ermutigt von den Briefen Charles Bonnets, führt er seine Versuche in den späten 1770er Jahren durch. In jedem Abriss über die Geschichte der Reproduktionstechnologie taucht Lazzaro Spallanzani heute daher als Begründer dieser Technik auf. Er wird als »Vorläufer« gewürdigt, in direkte Linie zu den medizinischen Verfahren der künstlichen Insemination gestellt, wie sie seit dem späten 19. Jahrhundert zur Behandlung von Sterilität angewendet werden. Doch diese vermeintliche Kontinuität ist eine vorschnelle Interpretation. Spallanzanis Experimente zur künstlichen Befruchtung, und das ist wichtig zu betonen, haben mit den Verfahren hundert Jahre später noch nichts zu tun. Sein Erkenntnisinteresse richtet sich allein auf die Zeugungstheorie, auf seinen Willen, das Gedankengebäude der Präformation und des Ovismus experimentell zu bestätigen. Das Argumentationsfeld, auf das er sich begibt, ist die gerade entstehende Wissenschaft vom Leben; das Problem der »Sterilität« dagegen, die Ambition der Ärzte, unfruchtbaren Paaren mit allen Mitteln zum Kind zu verhelfen, hat sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch nicht als medizinischer und gesellschaftlicher Diskurs verfestigt.
In Versuchen mit der Erdkröte, dem Laub- und dem Wasserfrosch gelingt es Spallanzani jedenfalls, die Eier im Augenblick der Paarung abzufangen und gleichzeitig den Körper des umklammernden Männchens aufzuschneiden, um an die Samenbläschen in den Hoden zu gelangen. Anschließend bestreicht er einen Teil der Eier mit dem Sperma. Nach einigen Tagen beginnen sich diese Eier im Unterschied zu dem unbehandelten Laich zu verändern und in Kaulquappen zu verwandeln: »Ich war also dahin gelangt«, schreibt Spallanzani bewegt, »dieser Art Thiere auf eine künstliche Art das Leben zu geben, indem ich die Natur in ihren Mitteln nachahmte«.[30]