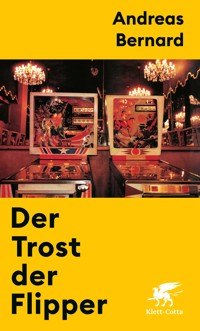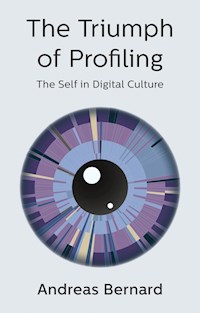15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Nominiert zum Fußballbuch des Jahres beim Deutschen Fußball-Kulturpreis 2022 und für den Bayerischen Buchpreis 2022 "Andreas Bernard war ein sehr talentierter Linksfuß, der mit etwas Glück eine Profilaufbahn hätte einschlagen können. So wie er in diesem Buch unsere Fußballkindheit in München beschreibt, im Verein und auf dem Bolzplatz, so ist es wirklich gewesen." Didi Hamann Wir gingen raus und spielten Fußball« ist ein Buch über eine Fußball-Kindheit im München der siebziger und achtziger Jahre. Es beschreibt die Siege und Niederlagen auf einem kleinen Tartanplatz mit Handballtoren, die jede spätere Erfahrung der Zugehörigkeit oder des Ausgeschlossen-Seins vorweggenommen haben. Es handelt von den Gesetzen, Ritualen und Freundschaften im Spiel. Der Fußball ist Gegenstand des Buches, der mit Liebe zum Detail verhandelt wird, von der idealen Beschaffenheit der Tornetze bis zur Kicker-Stecktabelle, von der Bedeutung der Rückennummern bis zur Sprache der Bolzplätze. Gleichzeitig wird der Sport aber auch zum Ausgangspunkt, um über die kindliche Wahrnehmung einer Großstadt nachzudenken, über den Zusammenhang von Erinnerung und Literatur und über die Prozesse des autobiografischen Schreibens selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Ähnliche
Andreas Bernard
Wir gingen raus und spielten Fußball
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Andreas Bernard
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98077-6
E-Book ISBN 978-3-608-11840-7
Für Nicolas
1. Gummi
Der Sportplatz, auf dem ich das Fußballspielen gelernt habe, ist seit vielen Jahren verwaist. Niemand trifft sich mehr auf den beiden Steinfeldern, deren rötlicher Belag längst abgeblättert ist. Wenn ich heute noch an dieser Stelle vorbeikomme, in der Mitte eines weitläufigen Parks, bietet sich ein trostloses Bild. Die vier Eisentore sind irgendwann enger zusammengeschoben und neu montiert worden, um Platz zu schaffen für einen nachträglich errichteten Basketballkorb. Um dieses Gestänge herum stehen ein paar Jugendliche in hohen Sportstiefeln und werfen Bälle; ansonsten sind die Plätze unbesetzt, so leer wie ein ausgelassenes Schwimmbecken. Allenfalls sieht man einen Vater, der sich in eines der Tore gestellt hat und die unbeholfenen Schüsse seines kleinen Sohnes mit Absicht passieren lässt.
Als ich auf den Steinplätzen meine ersten Spiele machte, waren sie das lebendige Zentrum des ganzen Viertels. Der Ort wurde von allen nur der Abenteuer genannt, obwohl sein offizieller Name, auf grünen Tafeln am Eingang des Parks angebracht, ganz anders lautete. Jeden Tag nach dem Mittagessen fuhr ich mit dem Fahrrad die hügelige Strecke hinauf, bog nach rechts, wo die Bucht mit den Fußballfeldern lag, und vor der letzten Kurve, einem abschüssigen, von hohen Sträuchern umgebenen Fußgängerweg, stellte sich immer die bange Frage, ob auch genügend Spieler da sein würden. Kaum jemals wurde diese Hoffnung enttäuscht. Durch das Gebüsch hindurch erkannte ich die vielen beweglichen Silhouetten und die Fahrräder, die auf der Grasfläche rund um die beiden Steinplätze lagen. Meine Freude dann, wenn klar wurde, dass die Felder besetzt waren (genau umgekehrt wie später beim Flippern, wenn der Weg durch das Lokal von der Unsicherheit erfüllt war, ob der Apparat, der hinten im Gang zu den Toiletten stand, auch frei sein würde): Der Ort vibrierte, der Abenteuer machte seinem Namen alle Ehre, und am späteren Nachmittag konnte es sogar geschehen, dass Spieler für fünf oder sechs Mannschaften um die beiden Plätze herum versammelt waren und die Wartenden, wie Zuschauer auf einer Tribüne, auf den schrägen Grasflächen am Rand zusammensaßen.
Die beste Ankunftszeit, gegen zwei Uhr, war die kurze Phase, in der den verschiedenen Fraktionen, die noch auf ein Tor spielten oder unschlüssig in der Mitte herumstanden, klar wurde, dass nun genügend Leute für ein richtiges Spiel beisammen waren. Eine andere Spannung erfüllte plötzlich den Platz, und die losen, unabhängig voneinander gekommenen Gruppen gingen aufeinander zu:
»Wollen wir ein Spiel machen?«
»Gut, wer wählt?«
Es gelang mir nicht oft, diesen Moment abzupassen. Meistens war schon ein Spiel im Gange, wenn ich am frühen Nachmittag auf die Steinplätze kam, und ich erinnere mich an die Überwindung, die es kostete, mich an den Rand zu stellen und einem Spieler, der mir wie eine Autorität auf dem Feld vorkam, nach einer Weile die Frage zuzurufen: »Entschuldigung, kann ich vielleicht noch mitspielen?« oder »Braucht ihr vielleicht noch einen?« Diese Worte, die Refrains meiner Kindheit, habe ich unzählige Male ausgesprochen: auf Freibadwiesen, auf den Höfen von Landgaststätten, wenn die Eltern nach dem Essen noch länger sitzen bleiben wollten, oder auf improvisierten Fußballfeldern am Urlaubsort. Anfangs zögerte ich oft lange, aus der Angst heraus, eine abschlägige Antwort zu bekommen. Doch es geschah fast nie, dass meine Bitte wirklich zurückgewiesen wurde. Nur hörte ich regelmäßig, dass ich erst einen Zweiten finden müsse, weil die Mannschaftsstärken durch mich ins Ungleichgewicht geraten würden. Ich gewöhnte mir deshalb an, vor dem Fragen die Spieler auf dem Platz zu zählen. Ergab sich eine ungerade Zahl, rief ich meinen Satz mit etwas größerem Mut, und wenn ich dann aufs Feld kam, erwartete ich den ersten Pass, das erste Dribbling mit einer Mischung aus Unsicherheit und der Hoffnung, dass ich meinem Ballgefühl schon trauen könnte.
Ich habe kaum einzelne Gesichter vor Augen, wenn ich an die erste Zeit auf dem Abenteuer denke – eher ein Gewimmel von Oberkörpern, von dem ich als einer der Jüngsten auf dem Feld, einen Kopf kleiner als die anderen, ständig umgeben war. Nur zwei besonders auffällige Spieler sind mir noch in Erinnerung, damals kamen sie mir wie ausgewachsene Männer vor: der eine, Hansi, klein und wendig, mit blondem Flaum über der Oberlippe und einem ärmellosen T-Shirt im Muster der amerikanischen Flagge, der andere ein bulliger, immer lächelnder Türke namens Direk. (Ich baute mir eine Eselsbrücke, um mir den fremd klingenden Namen zu merken: wie Derrick aus dem Freitagabend-Krimi, nur mit vertauschten Vokalen.) Beide konnten sich ganz allein durch die gegnerische Mannschaft dribbeln, und manchmal schoben sie am Ende dem mitgelaufenen Sechs- oder Siebenjährigen großzügig den Ball zu, damit er ins leere Tor schießen konnte.
Direk kam meistens in Anzug und eleganten Schuhen auf den Platz, legte Sakko und Hemd auf einen der Steinhocker neben den Tischtennisplatten und spielte in jener Kluft, die ich später noch oft bei älteren türkischen Spielern (und nicht den schlechtesten) gesehen habe: mit Unterhemd, Anzughose und schwarzen Slippers. Die dünne Sohle seiner Schuhe sorgte dafür, dass er eher über den Platz rutschte als lief, aber seinem unglaublichen Ballgefühl konnte das nichts anhaben. Direk umspielte die mit akkuraten Sportschuhen ausgerüsteten Gegner, ließ den letzten Verteidiger ins Leere laufen, schlitterte ein, zwei Meter und schob mir vor dem hinauslaufenden Torwart den Ball zu. Nachdem ich das Tor erzielt hatte (das nur noch »Formsache« gewesen war, wie ein Kommentator gesagt hätte), kam er im verschwitzten Unterhemd über der auberginefarbenen Hose auf mich zu, legte mir grinsend den Arm um die Schulter, und der herbe Geruch, der in der Luft lag, war für mich das Zeichen der erwachsenen, arrivierten Fußballwelt.
Unterhalb der Steinfelder, am Ende des Abhangs, der zum Gelände des Fußball- und Hockeyclubs führte, gab es noch einen kleinen Sportplatz mit rotem Gummibelag und richtigen Handballtoren. Dieser Platz war immer leer, und weil er keinen sichtbaren Zugang hatte und von einem hohen Zaun umgeben war, hielt ich ihn lange Zeit für einen Teil des Vereins oder vielleicht auch der dahinterliegenden Schule. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich dort zu spielen begann. Im Unterschied zum Abenteuer, dessen Eröffnungsdatum auf den Tafeln am Parkeingang eingraviert ist, hat dieser Ort, an dem ich dann viele Jahre lang jeden Tag verbrachte, in meiner Erinnerung keinen Ursprung. Vielleicht hing die Abkehr von den Steinfeldern damit zusammen, dass ich kurz nach meinem siebten Geburtstag (laut der Ausweiskarte, die ich aufbewahrt habe, ab September 1976) im Fußballverein Mitglied wurde und dadurch bei jedem Training den Gummiplatz im Blick hatte. Es gab natürlich doch eine unscheinbare Eingangstür, und wahrscheinlich haben ein paar Spieler irgendwann damit angefangen, sich vor dem Training dort zu treffen.
Was ich aber noch genau weiß: Von den Steinfeldern hinunter auf den Gummiplatz zu wechseln, kam einer Beförderung gleich. Anstelle der losen Zusammensetzung oben, manchmal nur zu sechst oder siebt, manchmal zu zwanzigst, mit älteren und jüngeren Spielern, guten und schlechten, deutschen und ausländischen, bildete sich hier sofort eine einheitliche Gruppe von Fußballern. Wir waren alle ungefähr im selben Alter, anfangs vielleicht zwischen neun und elf, und bis auf wenige Ausnahmen Vereinsspieler beim benachbarten Club oder den anderen, etwas kleineren, die es in unserem Stadtteil gab. Niemand kam zufällig vorbei, es fehlte die Laufkundschaft wie auf dem Abenteuer, was sicher mit der Abgeschlossenheit des Platzes zu tun hatte, eingebettet zwischen dem großen Vereinsareal auf der einen Seite und dem mit Bäumen bewachsenen Abhang auf der anderen.
Ab Viertel nach zwei während der Schulzeit, in den Ferien schon morgens um neun, trafen auf dem Gummi, wie der Ort bei uns hieß, fast ein Jahrzehnt lang die gleichen Spieler zusammen: Harald, Christian, Stefan, Rainer, Oliver, Jürgen, Martin, Frank; wenig später kamen Thomas, Michael, Wolfgang, Jan, Norbert, Peter, Jörg und ein weiterer Oliver hinzu. Der Klang der Namen und ihrer geläufigen Abkürzungen (»Harry«, »Michi«, »Oli«; Christian und Thomas wurden nur mit ihren Nachnamen »Jonas« und »Huber« gerufen), diese graue, aber solide DIN-Norm männlicher Vornamen der späten sechziger und frühen siebziger Jahre: Im Nachhinein kommt es mir so vor, als wäre die Stabilität der Gemeinschaft sogar ein wenig auf diese Namen zurückzuführen, als hätten sie in ihrer Biederkeit ein verlässlicheres Fundament gebildet als die leichteren, eleganteren Vornamen späterer Jahre, die Leons, Marvins, Lennarts, Tims, die sich vielleicht auf flüchtigere Art verbinden als die schwerfälligen Michaels und Stefans.
Auf dem Gummi wurde der Fußball wichtiger genommen, das ließ sich schon an der Kleidung erkennen. Undenkbar wäre hier gewesen, was oben ständig geschah: dass jemand in Straßenkluft mitspielte, in Jeans und T-Shirt oder, wie die älteren Türken, in Unterhemd, Anzughose und Lederslippers. Nicht nur räumlich bildete dieser Ort also das Mittelglied zwischen Spielplatz und Verein, sondern auch was den Ernst der Sache betraf. Alle kamen wie selbstverständlich in Trainingsanzügen und Sportschuhen, mit glatter Sohle oder kurzen Noppen, und manche besaßen sogar ein originales Bundesligatrikot: Harry ein weißes vom Hamburger SV, mit dem BP-Logo, ich eines vom MSV Duisburg – nicht weil ich ein großer Fan gewesen wäre, sondern weil mir die blau-weißen Querbalken, die der Mannschaft den Spitznamen »Zebras« verliehen hatten, so gut gefielen. Ende der siebziger Jahre war es kein leichtes Unterfangen, ein solches Originaltrikot mit Werbeschriftzug zu bekommen. Es gab meines Wissens nur eine einzige Quelle, und zwar eine Firma, die in der Zeitschrift Kicker inserierte und die Trikots vieler Bundesligaclubs anbot. Ich lag meinen Eltern lange in den Ohren, mir eines vom MSV Duisburg zu bestellen, und als sie dann tatsächlich einwilligten und das Trikot mit dem Schriftzug »Diebels Alt« (dessen Bedeutung mir rätselhaft war) Wochen später vom Postboten gebracht wurde, kam mir seine Existenz fast unwirklich vor. Ausgepackt und glatt gestrichen lag es vor mir auf dem Küchentisch, und es sah genauso aus wie auf den Körpern der Spieler in der Sportschau. Das Trikot war natürlich viel zu groß, ging mir bis fast an die Knie, und meine Mutter trennte mit der Schere kurzerhand ein oder zwei blaue Querbalken ab, damit es mir halbwegs passte: eine Entscheidung, die ich bald sehr bedauerte.
Dass es auf dem Gummi nun um Sport ging, daran hatte der Platz selbst erheblichen Anteil. Sein weicherer Belag, der Tartan (der ursprünglich keine Materialbezeichnung war, sondern, wie man nachlesen kann, der Markenname einer Kunststoffmischung, eingesetzt zum ersten Mal für die Laufbahnen bei den Olympischen Spielen 1968), ermöglichte eine andere Art von Fußball. Er schonte unsere Lederbälle, die nun nicht mehr wie auf dem Abenteuer an den Nähten aufrauten und zu platzen drohten, und erlaubte ein genaueres, besser zu kontrollierendes Spiel, weil der Ball weniger stark aufsprang als auf dem nackten Stein. Gleichzeitig wurden die Aktionen aber auch körperbetonter: eine Grätsche oder ein Flugkopfball war nicht mehr wie oben unweigerlich mit Hautabschürfungen verbunden. (Vertrautes Bild meines Körpers in diesen Jahren: die frischen oder kaum verheilten Wunden an der Außenseite des rechten Oberschenkels, auf den ich als Linksfuß meistens fiel.) Zudem lag der Gummi dank der hohen Bäume ringsum fast immer im Schatten, was das Spielen auch an heißen Sommertagen erträglich machte. Die Felder oben dagegen waren der prallen Sonne ausgesetzt, und die Hitze wurde durch den Steinbelag noch verstärkt.
Der größte Unterschied zwischen den beiden Plätzen betraf allerdings die Beschaffenheit der Tore. Auf dem Abenteuer standen jene klobigen Eisenstangen-Tore, mit denen alle neu gebauten Spielplätze der Stadt ausgerüstet waren: Pfosten, Latte und das Gitter des Netzes aus demselben Guss. Es war das Material des öffentlichen Raums, robust genug, um einer unbeaufsichtigten Meute Tag für Tag ausgesetzt zu werden. Richtige Tornetze, aus elastischem Stoff, wie wir sie aus der Bundesliga und den umliegenden Fußballvereinen kannten, erschienen den Stadtplanern wohl allzu fragil und leicht zerstörbar. Wie verheißungsvoll kam es uns daher vor, nun einen Platz mit Handballtoren gefunden zu haben, auf dem wir unbehelligt spielen konnten. Offiziell gehörte der Gummi tatsächlich zu jenem Gymnasium hinter dem Hauptplatz des Fußballclubs, das ich ab der fünften Klasse besuchte, doch er wurde im Sportunterricht nie genutzt, weil der Weg quer durch das Vereinsgelände viel zu weit gewesen wäre. Wir hatten das Spielfeld also jeden Tag für uns allein, und der Platzwart des Clubs, der für die Aufsicht zuständig war, ließ uns, zumindest in der ersten Zeit, vollkommen in Ruhe.
Mittwoch und Donnerstag zwischen fünf und halb sieben fand das Training im Verein statt, Montag- bis Freitagnachmittag und einen Teil des Wochenendes stand ich auf dem Gummi, und was mir diese beiden Orte über den Fußball beibrachten, verhielt sich ungefähr so zueinander wie eine offizielle Sprachenschule zum Aufenthalt im Land selbst. Das Vereinstraining zerlegte die Grammatik des Fußballs in einzelne Lektionen: Wir feilten an der Syntax der Pass- und Laufwege; wir übten die Konjugation des Schießens ein, von der Grundform der Innenseite über den Imperativ des Vollspanns hin zum unregelmäßigen, selten gebrauchten Partizip der Außenseite; und am Ende jeder Einheit durften wir das zuvor Erprobte in der freien Konversation des Trainingsspiels anwenden, immer wieder unterbrochen von korrigierenden Zwischenrufen des Trainers. Ganz anders ging es auf dem kleinen Platz ein paar Meter weiter zu, hinter der in den Zaun eingelassenen Tür. Dort gab es keine Lehrpläne und keinen Übungsleiter: Jeder Neuling wurde sofort ins Getümmel der Muttersprachler hineingeworfen, musste sich in dem Kauderwelsch zurechtfinden, und auch wenn der Lernprozess ohne jede Ordnung ablief – hier ein Stellungsfehler, dort eine schiefe Eigenart – und des Schliffs des angeleiteten Trainings irgendwann bedurfte (wer nichts als den Gummi kannte, hielt mit zwölf oder dreizehn Jahren nicht mehr mit), sorgte allein diese Ausbildung für die volle Gewandtheit in der Sprache des Spiels. Und genau deshalb sind auch die notorischen Ausdrücke, die sich heute zur Beschreibung dieser Orte eingebürgert haben, so verfehlt. Man spricht vom »Bolzplatz«, auf dem man »kickt«, wenn von einem Fußballfeld wie dem Gummi die Rede ist – Wörter, die das Nicht-ganz-so-Ernste, Richtungslose des Spiels herausstreichen sollen, die Differenz zur professionellen Atmosphäre des Clubs. Aber nichts könnte falscher sein als dieser Gegensatz. Denn der autodidaktische Fußball auf dem kleinen roten Platz hat jedem von uns erst das Rüstzeug dafür mitgegeben, auch an der reglementierten Welt des Vereinssports Gefallen zu finden.
Der neue Fußballstil auf dem Gummi war damals nicht mit jedem Mitspieler von oben vereinbar. Es gab zwar keine Ausschlüsse; niemandem wurde es verwehrt, vom Abenteuer mit nach unten zu kommen. Dennoch war klar, dass manche der alten Weggefährten nicht zu dem Ort passten. Das galt vor allem für diejenigen, die den Fußball nur als Option unter anderen ansahen, die in abgeschnittenen Jeans und Straßenschuhen auf dem Abenteuer aufkreuzten und dann eine Zeit lang mitkickten (hier traf das indifferente Wort einmal zu), bevor sie Fahrradrennen auf dem leicht erhöhten Asphaltweg rund um die Steinfelder veranstalteten oder in den Gebüschen am Rande des Spielplatzes herumstreunten. (Sie waren dann auch die Ersten, die Zigaretten und Feuerzeuge dabeihatten und an den Tischtennisplatten zusammenstanden, um zu rauchen und Dinge anzuzünden; bald waren alle Platten mit schwarzen Rußflecken übersät.) Unter diesen Mitspielern gab es etwa ein Brüderpaar, Rudi und Karli, der eine in unserem Alter, der andere ein paar Jahre darüber. Karli war ein harter, wegen seiner Körperfülle gefürchteter Verteidiger. Rudi aber gehörte auf dem Abenteuer zu den auffälligsten Fußballern überhaupt: Er hatte eine sehr ungewöhnliche Spielweise, führte den Ball, wie Wolfram Wuttke in der Bundesliga, fast nur mit der rechten Außenseite und schoss dank seiner Dribbelkunst Tor um Tor. Auf den Gummi kam er dann trotzdem nicht mit, und diese Distanzierung hatte keineswegs mit seinen fußballerischen Gaben zu tun. Rudi war vielmehr »ein typischer Steinplatz-Spieler«, wie es einer von uns später formulierte: eine Kategorie, die besagte, dass er sich, unabhängig vom Grad des eigenen Talents, nicht so viel aus Fußball machte, und die zudem auf eine bestimmte Grobheit hindeutete, die wir Braveren und Ambitionierteren auf dem Gummi nicht hatten.
Je stärker unser Leben unten vom Fußball geprägt wurde, desto leerer wurde es oben auf dem Abenteuer. Wenn die Erinnerung nicht trügt, kehrten sich damals auch viele andere Spieler von den Steinplätzen ab, doch für sie war dieser Rückzug gleichbedeutend mit der Entscheidung, den Sport komplett aufzugeben. Auf dem Abenteuer war anfangs ein Urgemisch des Viertels versammelt, ein Durcheinander von Trainingshosen und Jeans, T-Shirts und Trikots, Sportschuhen, Lederslippers und sogar Cowboystiefeln (wenn ein älterer Mopedfahrer an den Tischtennisplatten den ins Aus gerollten Ball mit seinen spitzen Stiefeln zurückschoss, unter dem Gejohle der Freunde, hatten wir immer Angst, dass er vielleicht platzen könnte). Jetzt spaltete sich dieses Gemenge auf, in die ernsthaften Fußballer und in die Herumstreuner und Rocker. Rudi und Karli etwa, die in einer Neubausiedlung am Rande des Parks wohnten, feilten bald nur noch in schwarzen Lederjacken an ihren Mopeds herum, und man musste sich hüten, ihnen allein auf der Straße zu begegnen. Wer mit auf den Gummi gekommen war, hatte sich zumindest bis zum Beginn der Lehre oder bis zu den ersten Schulpartys einem unschuldigen, vom Sport bestimmten Alltag verschrieben. Über manche der Ehemaligen, die man im Viertel nur noch selten sah, höchstens im Freizeitheim während der Wintermonate oder an den Autoscootern beim Frühlingsfest, kursierten dagegen bald Geschichten über Diebstähle und illegale Motorradrennen, und es fielen Wörter wie »frisiert«, »Dope« oder »Sozialstunden«, die mir nichts sagten.
Eine andere Abgrenzung dieser Zeit betraf die vielen türkischen und jugoslawischen Spieler oben, die, abgesehen von ein, zwei Ausnahmen (und auch das erst Jahre später), nie auf dem Gummi auftauchten. Diese Distanz hatte nichts mit prinzipieller Antipathie zu tun, auch wenn einzelne aus unserer Gruppe später tatsächlich ausländerfeindliche Reden zu schwingen begannen; sie ging damals allein auf den Unterschied der Spielweisen zurück. Die Türken und Jugoslawen auf dem Abenteuer,