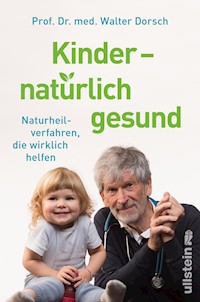
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hilft eine Bachblütentherapie bei Neurodermitis? Kann man ADHS biodynamisch auspendeln? Welche Naturheilverfahren tatsächlich heilende Wirkung haben, weiß der renommierte Kinderarzt und überzeugte Naturheilmediziner Walter Dorsch. Dieses Buch ist seine persönliche Bilanz aus jahrzehntelanger Forschung und Praxis. Wenn der Nachwuchs krank ist, wünschen sich viele Eltern für ihre Kinder eine möglichst natürliche Behandlung und keinen Arzt, der bei einer Erkältung Antibiotika verschreibt. Doch was genau heißt »natürlich«? Welche Naturheilverfahren sind sinnvoll? Der erfahrene Kinderarzt und Naturheilmediziner Walter Dorsch beschreibt, welche Verfahren wann zum Einsatz kommen sollten und wie sie zur Heilung beitragen können. In vielen Fällen sind Pflanzenheilkunde, Hydrotherapie und andere Naturheilverfahren unverzichtbar und ergänzen sinnvoll die klassische Medizin. Doch es gilt zu unterscheiden zwischen obskuren Angeboten und seriöser Anwendung: Dieses Buch ist ein Leitfaden für Eltern, damit sie eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Wenn der Nachwuchs krank ist, wünschen sich viele Eltern für ihre Kinder eine möglichst natürliche Behandlung und keinen Arzt, der bei einer Erkältung Antibiotika verschreibt. Doch welche Naturheilverfahren sind wirklich sinnvoll? Der erfahrene Kinderarzt und Naturheilmediziner Walter Dorsch beschreibt, wie Pflanzenheilkunde, Wasserbehandlung, Akupunktur und andere Methoden zur Heilung beitragen können, und er erklärt, wann sie zum Einsatz kommen sollten. In vielen Fällen sind Naturheilverfahren unverzichtbar und ergänzen sinnvoll die klassische Medizin. Doch gilt es zu unterscheiden zwischen obskuren Angeboten und seriöser Anwendung: Dieses Buch ist ein Leitfaden für Eltern, damit sie eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können.
Der Autor
Prof. Dr. med. Walter Dorsch, geboren 1949, war Professor für Allergologie und Pneumologie an der Universitätskinderklinik Mainz, Leiter des Arbeitskreises „Komplementärmethoden der Deutschen Gesellschaft für Allergie“ und ist Herausgeber des Lehrbuchs Naturheilverfahren in der Kinderheilkunde. Für den ausgebildeten Naturheilmediziner sind Pflanzenheilkunde, Wassertherapie und die Kneipp‘sche Gesundheitslehre grundlegende Bestandteile seines klinischen Alltags. Eine von ihm geleitete Arbeitsgruppe erforschte und entdeckte u.a. die heilsame Wirkung der Zwiebel (allium cepa) bei Asthma bronchiale. Seit über 20 Jahren arbeitet Walter Dorsch in eigener Praxisgemeinschaft in München. Er ist Vater von sechs Kindern, einem Stiefsohn und Großvater von acht Enkelkindern.
Prof. Dr. med. Walter Dorsch
Kinder – natürlich gesund
Naturheilverfahren, die wirklich helfen
Unter Mitarbeit von Ulrike Strerath-Bolz
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1758-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Hans Scherhaufer
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Unseren Kindern und Enkeln
Einleitung
Was einen guten Kinderarzt ausmacht
Bei welchem Arzt fühlen sich Eltern und Kinder am besten aufgehoben, woran erkennt man einen guten Kinderarzt?
Wie bei allen Berufen muss er zunächst sein Handwerk beherrschen. Die Fortschritte der Wissenschaft sind unbestreitbar. Keiner möchte auf sie verzichten. Darauf muss sich der Kinderarzt einstellen und sich ständig weiterbilden. Mindestens ebenso wichtig ist, dass er die Psyche der ihm anvertrauten Kinder versteht und die Sorgen und Ängste der Eltern ernst nimmt. Wenn die persönliche Zuwendung und das Mitgefühl fehlen, fühlt sich jeder Patient, egal ob klein oder groß, schnell verunsichert und womöglich von der »Apparatemedizin« abgestoßen.
Tatsächlich fehlt es im Praxisalltag manchmal an der nötigen Zeit, um Eltern und Kindern zu erklären, welche Maßnahmen sinnvoll sind und warum. Das ist die Realität, und wir müssen stetig daran arbeiten, dass sie sich verbessert. Zudem wird immer wieder kritisiert, dass das einfühlsame Gespräch mit dem Patienten in der Ausbildung junger Ärzte viel zu kurz kommt. Auch das muss sich ändern.
Manche Eltern wenden sich aus diesen und anderen Gründen enttäuscht jenen Ärzten und Heilern zu, die sogenannte alternative Heilmethoden anbieten, eine »ganzheitliche« Medizin versprechen und die klassische Medizin als Schulmedizin verunglimpfen.
Ich plädiere für eine vorurteilsfreie Anwendung von Methoden der klassischen Medizin und von Naturheilverfahren, und zwar so, dass unsere Kinder gesund aufwachsen und die bestmögliche Behandlung erfahren können. Ich möchte nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit auftreten, sondern schildern, womit meine Patienten und ich gute Erfahrungen gemacht haben. Diesen Kindern und ihren Eltern vor allem möchte ich für das Vertrauen danken, das sie mir in vielen Jahren entgegengebracht haben. Ich bin dankbar für alles, was ich von ihnen lernen durfte. Denn Kinder können uns in der Tat viel beibringen – zum Beispiel die Unbefangenheit, mit der sie Dinge infrage stellen, die Erwachsene für sehr normal und kaum des Staunens wert finden. Es kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet ein Kind laut und vernehmlich kundgetan hat, dass es des Kaisers neue Kleider gar nicht gebe, sondern der Kaiser nackt sei. Nur ein Kind war mutig genug, dies auch auszusprechen. In diesem Sinne dürfen wir Kinderärzte kindlich bleiben, auch im hohen Alter. Der stete Umgang mit Kindern und Heranwachsenden, die immer wieder Fragen stellen, auf die die Erwachsenenwelt oft vorschnell endgültige Antworten zu geben versucht, hält uns wach.
Mein Buch soll das persönliche Gespräch zwischen Kinderarzt, Eltern und Kindern nicht ersetzen, sondern das eine oder andere ausführlicher erklären. Ich will versuchen, die Fragen betroffener Eltern so zu beantworten, als würden sie in meiner Praxis vor mir sitzen und ich hätte alle Zeit der Welt, mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören und zu verstehen, was sie im Innersten bewegt.
Die Auswahl der hier vorgestellten Naturheilverfahren ist naturgemäß subjektiv. Sie beruht auf meiner jahrzehntelangen Arbeit in Forschung und angewandter Kinderheilkunde sowie einer wissenschaftlich fundierten Erfahrung in Naturheilkunde. Als Hausarzt kranker Kinder und ihrer Familien bin ich darüber hinaus mit einer Fülle von Fragen und Problemen des alltäglichen Lebens konfrontiert. In unserer Münchner Gemeinschaftspraxis sehen wir Kinder aus allen sozialen Schichten, die Praxis liegt in einem Schnittpunkt verschiedenster Bevölkerungsgruppen. Doch so unterschiedlich die Herkunft meiner jungen Patienten auch sein mag, ihren Eltern ist am Ende eines gemeinsam: Sie wünschen sich natürlich gesunde Kinder.
Wie können wir das erreichen? Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen schildern, was ich für die beste und wirksamste Medizin halte.
Walter DorschMünchen, im Februar 2018
I. Konkurrenten oder Partner? Naturheilverfahren und klassische Medizin
Was bringt den Doktor um sein Brot?
a) die Gesundheit, b) der Tod.
Drum hält der Arzt, auf dass er lebe,
uns zwischen beiden in der Schwebe.
EUGEN ROTH
Der Münchner Satiriker Eugen Roth muss die falschen Ärzte getroffen haben. Zwar wissen wir nicht, ob Kinderärzte unter ihnen waren, und Herrn Roth können wir leider nicht mehr befragen. Dennoch scheint mir, dass es sich bei uns um eine besondere Spezies handelt: Wir Kinderärzte opfern uns auf, Tag und Nacht, lassen uns durch keine noch so schwierige und sinnleere bürokratische Maßnahme entmutigen und liefern selbstverständlich nur gesunde und wohlgeratene Erwachsene in der Erwachsenenmedizin ab. Oder etwa nicht?
Die Gründe, weshalb wir aufgesucht werden, haben sich im letzten Jahrhundert und zu Beginn dieses Jahrhunderts deutlich gewandelt. Die Herausforderungen sind enorm gestiegen: Die Großfamilie ist verschwunden, stattdessen leben viele Kinder in kleinen Familien als Einzelkind oder mit einem alleinerziehenden Elternteil. Viele Eltern stehen unter Leistungsdruck, leiden unter Zeitmangel und sind verunsichert darüber, wie sie ihren Kindern am besten helfen können. Aus diesem Grund werden zunehmend auch Fragen der Lebensführung an uns herangetragen. Es ist eine Aufgabe, der wir uns gern stellen. Wir verstehen sie als Auftrag, der dazu beiträgt, dass der Beruf des Kinderarztes trotz mancher bürokratischer Mühsal befriedigt, ja, glücklich macht. Und weil mir dieses Glück über viele Jahre zuteilgeworden ist, schreibe ich dieses Buch.
Ich sehe mich in erster Linie als Arzt für meine Patienten und freue mich, wenn ich ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Das Kompetenzgerangel zwischen sogenannten Schulmedizinern und einigen eifrigen Verfechtern der Komplementärmedizin betrachte ich eher mit gemischten Gefühlen. Ist der öffentlich ausgetragene Streit zwischen den beiden Lagern wirklich nötig? Statistiken besagen, dass etwa 80 Prozent aller Kinderärzte die Anwendung von Naturheilverfahren befürworten und solche Verfahren auch persönlich anwenden. Wir müssen also zunächst ergründen, woher der Methodenstreit kommt und warum das Gerücht von den verstockten Schulmedizinern noch immer kursiert.
Mächtige Berater
Beim Besuch von Buchmessen drängt sich mir regelmäßig der Eindruck auf, dass angesichts der Fülle an einschlägigen Beratungsbüchern und Leitfäden eigentlich alle Probleme unseres Lebens gelöst sein müssten oder zumindest lösbar sein sollten. Jedes Kind kann schlafen lernen, jedes Kind kann laufen lernen, jedes Kind kann aufs Gymnasium kommen – wenn man den Buchtiteln glauben darf.
Die Realität sieht oft anders aus: Viele Eltern fühlen sich mit pauschalisierten Empfehlungen alleingelassen, und sie sind es auch. Ein Helfer, der den Ratsuchenden ernst nimmt, wird sich immer erst ein Bild von dessen Situation machen, bevor er Ratschläge erteilt. Oft entsteht schon aus der genauen Analyse eines Problems eine Lösung. Dies können Beraterbroschüren und Ratgeberbücher nicht leisten, auch wenn noch so stark betont wird, dass der Mensch in seiner Gesamtheit immer im Mittelpunkt aller Bemühungen steht. Und wenn es über die Bücher hinausgeht, dann wird selbst der raffinierteste Algorithmus als Berater nicht über Allgemeinplätze hinauskommen.
Wie verführbar wir sind, Allgemeinplätzen – im Sinne von nichtssagenden Formulierungen – einen individuellen Sinn zuzuschreiben, zeigt die Bereitschaft vieler Menschen, an Horoskope zu glauben. Hier ein markantes Beispiel: Ein bekannter Astrologieforscher machte die Probe aufs Exempel. Bei einer Fernsehsendung händigte er verschiedenen Versuchspersonen »ein für Sie persönlich erstelltes Horoskop« aus. Resultat: Alle – egal, ob sie Horoskopen skeptisch oder aufgeschlossen gegenüberstanden – waren verblüfft, wie genau dieses Horoskop ihren Charakter traf.
Nun hatten freilich alle Testpersonen ein identisches Horoskop erhalten, das nichts mit ihren persönlichen Daten zu tun hatte. Nur dieses eine Horoskop war individuell erstellt worden, und zwar für einen Massenmörder. Das Ergebnis hat den Heidelberger Forscher kaum überrascht: »Die meisten Menschen finden sich in den Texten von Horoskopen gut wieder, wenn ihnen nur erzählt wird, dies sei ein ›persönlich für sie‹ erstelltes Horoskop.«
Wenn so wenig dran ist, warum glauben dann so viele an Horoskope? Liegt es daran, dass die Formulierungen im Horoskop recht allgemein gehalten sind und man sich darin deshalb leicht wiederfindet? 1998 führte Geoffrey Dean in der Zeitschrift Correlation eine Vielzahl kontrollierter Studien auf, die belegen, dass mehrere bekannte psychologische Mechanismen zu solchen subjektiven Erlebnissen führen können: Selbsterfüllende Prophezeiungen, Selbstzuschreibungen der im Horoskop genannten Eigenschaften, selektive Wahrnehmung und Erinnerung sowie weitere psychologische Prozesse können solche Zusammenhänge vortäuschen.
Wir alle neigen dazu, Leerformeln, an die wir glauben wollen, mit einem Sinn auszustatten, der nicht in ihnen steckt, sondern nur von uns hineingelegt, auf sie projiziert wird. Hieraus erwächst für professionelle Berater, zu denen auch wir Ärzte gehören, eine hohe moralische Verantwortung. Vor allem gegenüber kranken Mitmenschen ist Sorgfalt gefordert. Die Hilflosigkeit, welche die Sorge um die eigene Gesundheit oder – fast noch ausgeprägter – die Sorge um ein krankes Kind auslöst, macht leichtgläubig. Ich habe dies am eigenen Leib erfahren müssen. Mich überkommt heute immer wieder ein heiliger Zorn, wenn ich die fast kriminelle Energie wahrnehmen muss, mit der ratsuchenden Eltern Banales oder Unwirksames angedreht wird – sei es in Form von angeblich energetisch wirkenden Apparaturen oder in Form von angeblichen Medikamenten.
Man möge mich nicht falsch verstehen: Ich bin überzeugter Naturheilkundler, ausgebildeter Arzt für Naturheilverfahren und kämpfe für die Integration seriöser Naturheilverfahren in den klinischen Alltag. Leider ist aber »Naturheilverfahren« in der Öffentlichkeit kein geschützter Begriff. Die Vertreter betrügerischer bzw. erwiesen unwirksamer Methoden preisen ihre Verfahren oft mit dem Vokabular der Alternativmedizin bzw. Naturheilweisen an. Jede noch so abstruse Therapierichtung kann unwidersprochen für sich in Anspruch nehmen, mit natürlichen Mitteln zu arbeiten.
Wir halten also fest – und werden dies noch ausführlich begründen:
Betrug ist keine Domäne einer bestimmten therapeutischen RichtungNaturheilverfahren sind unverzichtbarNaturheilverfahren sollen und müssen die klassische Medizin sinnvoll ergänzenNaturheilverfahren können und wollen eine wissenschaftlich orientierte Medizin nicht ersetzen. Sie sind also keine Alternative zu dieser Form der MedizinIn diesem Sinne gibt es keine seriöse AlternativmedizinLagerdenken und geschlossene Weltbilder
Die Härte der Auseinandersetzung zwischen »Schulmedizin« und »Alternativmedizin« gleicht in ihrer Irrationalität politischen Grabenkämpfen. Deshalb ein kurzer Ausflug in die Politik.
Als der US-Präsident Richard Nixon 1972 wegen der Watergate-Affäre zurücktreten musste, erzwangen amerikanische Gerichte die Herausgabe der Tonbandprotokolle, die es von den gemeinsamen Besprechungen Nixons und seiner Mitarbeiter gab. Die Öffentlichkeit war erstaunt darüber, in welchem Ausmaß kriminelles Handeln, fahrlässige Dummheit, Duckmäuserei und hinterhältiges Intrigieren innerhalb dieser Gruppe für normal gehalten worden war. Psychologen haben sich eingehend mit diesem Phänomen befasst, es als Watergate-Syndrom bezeichnet und einige Charakteristika herausgearbeitet. Man spricht heute von Groupthink, zu Deutsch »Gruppendenken« (vielleicht besser: Rudeldenken, wenn man überhaupt von Denken sprechen will).
Groupthink, ein Begriff, der von dem Sozialpsychologen Irving Janis (1972) geprägt wurde, tritt auf, wenn eine Gruppe fehlerhafte Entscheidungen trifft, weil der Druck der Gruppe zu einer Verschlechterung der »geistigen Effizienz, der Wirklichkeitseinschätzung und des moralischen Urteils« führt. Gruppen, die vom Gruppendenken betroffen sind, ignorieren Alternativen und neigen dazu, irrationale Aktionen zu ergreifen, um andere Gruppen zu entmenschlichen (wörtlich: »dehumanize other groups«). Eine Gruppe ist dann besonders anfällig für Gruppendenken, wenn alle ihre Mitglieder einen ähnlichen Hintergrund aufweisen, wenn die Gruppe von äußeren Meinungen abgeschnitten ist und wenn es in der Gruppe keine eindeutigen Regeln für eine Entscheidungsfindung gibt.
Betrachtet man die Auseinandersetzungen zwischen »Schulmedizin« und »Alternativmedizin« von außen, so kann man – und zwar auf beiden Seiten – fast alle aufgeführten Symptome beobachten: In sich geschlossene medizinische Systeme fühlen sich unangreifbar. Andersdenkende in beiden Gruppen werden herabgesetzt, Abweichler kaum geduldet, Denkhemmungen institutionalisiert. Negative Nachrichten, wie das Ausbleiben eines naturwissenschaftlichen Beweises für die Wirksamkeit der Homöopathie in den letzten zweihundert Jahren, werden ausgeblendet. Wissenschaftler verwechseln den Umstand, dass sie ein bestimmtes Phänomen nicht nachweisen können, mit der Annahme, dass es dieses Phänomen nicht gibt.
Hier passt die schöne Geschichte von Graf Bobby und der verlorenen Uhr:
Ein Passant entdeckt den Grafen, wie er nachts unter einer Laterne seine verlorene Uhr sucht. Er hilft ihm. Nach einer Stunde erfolglosen Suchens stellt er die Frage, ob der Graf sicher sei, dass er die Uhr unter der Laterne verloren habe. Der Graf deutet die Straße hinunter. Auf die Frage hin, weshalb sie beide denn nicht dort suchten, antwortet er: »Weil dort kein Licht brennt!«
Beispiele für dieses Lagerdenken kennen wir alle genug: Mütter müssen sich gegenüber anderen Müttern rechtfertigen, wenn sie ihre Kinder nach den Empfehlungen der Impfkommission impfen lassen wollen. Ärzte werden verdächtigt, Komplizen der (oft genug als kriminell diffamierten) Arzneimittelindustrie zu sein, wenn sie Antibiotika verordnen. Klinikärzte, die sich mit »obskuren Dingen« beschäftigen, wie der Wirkweise von Kalt-Warm-Wechselbädern (die zu allem Überfluss ein Pfarrer erfunden hat), riskieren unter Umständen ihre berufliche Karriere.
Nicht selten tragen die verfeindeten Lager ihre Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit aus und machen Fernsehen, Internet und Printmedien zu Richtern. Der Wahrheitsfindung dient das nicht.
Es gibt aber Heilmittel gegen das Gruppendenken. Entscheidungsexperten haben festgestellt, dass es ganz einfach verhindert werden kann: Wer sich von außen beobachten lässt, wer auch selbst einmal die Außenperspektive einnimmt und Kritik nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung erfährt, wird auch im Verhältnis zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde Gruppendenken vermeiden können. Schon mein Vater – er war selbst Internist – hat mir beigebracht: Der Arzt muss der eigenen Diagnose und der Richtigkeit des eigenen Handelns stets misstrauen, da alles menschliche Handeln immer nur vorläufig und unsicher ist, es trägt das Risiko des Scheiterns in sich. Dieses Denken schützt vor Allmachtfantasien, wie sie aus geschlossenen Weltbildern erwachsen. Darauf hinzuarbeiten wäre aus meiner Sicht ein lohnendes Ziel.
Wissenschaft vs. Wunderglaube
Zwischen Naturheilverfahren und klassischer Medizin wird gern ein Gegensatzpaar konstruiert: Auf der einen Seite steht der verbohrte Schulmediziner, der sich nicht um den Patienten in seiner Gesamtheit kümmert, sondern nur der Apparatemedizin und der pharmazeutischen Industrie verpflichtet ist. Auf der anderen steht der liebevoll zugewandte Herr Doktor, der über die Schulmedizin hinaus Alternativmethoden anwendet und den Menschen in seiner Gesamtheit begreift und heilt.
Dieses Gegensatzpaar ist nach meiner Überzeugung einfach falsch. Arzt und Wissenschaftler nähern sich dem Krankheitsbild eines Patienten nur auf unterschiedliche Art und Weise: Die Aufgabe des Wissenschaftlers besteht darin, aus der Betrachtung vieler Einzelsituationen allgemeingültige Regeln abzuleiten. Der Arzt wird sich mit allem Wissen, das er besitzt, seinem Patienten in dessen individueller Situation zuwenden.
Der Wissenschaftler mag einem System oder einer Therapierichtung verpflichtet sein, zum Beispiel indem er Techniken entwickelt, um Wirkstoffe und Wirkweisen pflanzlicher Arzneimittel zu erforschen. Er ist dazu verpflichtet, subjektive Wertungen und Einschätzungen in seiner wissenschaftlichen Arbeit zu vermeiden. Anders der Arzt, der direkt am einzelnen Patienten arbeitet: Er wird aus der Vielfalt von Behandlungsmöglichkeiten diejenigen aussuchen, die seinem Patienten am besten nutzen. Er wird ein pflanzliches Arzneimittel einsetzen, wenn es in der individuellen Situation seines Patienten besser wirkt und weniger Nebenwirkungen aufweist als ein synthetisches Mittel – und umgekehrt. Er sollte also keiner speziellen Therapierichtung allein verpflichtet sein. Einen guten Arzt vergleiche ich daher gern mit einem versierten Handwerker, der in seinem Werkzeugkasten eine große Anzahl zuverlässiger Werkzeuge vorhält. Er wird nicht wie ein Hobbybastler versuchen, mit dem gleichen Schraubenzieher die Uhr des Großvaters, das eigene Fahrrad und den Mikrowellenherd zu reparieren.
Manche Ratgeber über Naturheilverfahren lesen sich dagegen wie Kataloge, in denen aufgeführt wird, wie durch ein einziges Verfahren jedes Problem gelöst werden kann. Der Leser ist begeistert und fühlt sich wohl in einer vermeintlich sicheren Welt. Das Resultat konnte ich bei verschiedenen Hausbesuchen besichtigen: So manche Hausapotheke enthielt vierzig bis fünfzig verschiedene homöopathische Mittel für jede denkbare Krankheit oder Funktionsstörung. Als Gegenmittel bei so viel Wunderglauben empfehle ich die Lektüre der 1919 erschienenen Abhandlung Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung von Eugen Bleuler. Darin übt der Züricher Psychiatrieprofessor deutlich Kritik an seinen Kollegen und warnt sie eindringlich vor ihrer Selbstgerechtigkeit. Dieser Gefahr sind Ärzte heute nicht weniger ausgesetzt als damals.
Wie Heilung gelingt: Ursache und Wirkung
Im klinischen Alltag lassen sich spezifische und unspezifische Wirkungen therapeutischer Interventionen oft kaum voneinander trennen. Nehmen Sie als Beispiel einen schreienden Säugling, dem seine Mutter den Bauch mit Kümmelöl massiert. Wer wäre hier in der Lage, den pharmakologischen, den physikalischen und den psychosomatischen Anteil zu bestimmen? Oder anders gefragt: Was heilt – das Kümmelöl, die Massage oder die Zuwendung der Mutter? Ähnlich geht es manchmal Therapeuten: Sie erreichen eine Wirkung auf einem Weg, den sie nicht kennen.
FALLBEISPIEL:
Der Erfolg des Heilpraktikers oder: Warum extreme Diäten manchmal helfen
Der Sohn eines Bäckers leidet seit der Säuglingszeit an einem häufig generalisierten Atopischen Ekzem, das in regelmäßigen Abständen (zwei- bis dreimal pro Jahr) stationär behandelt werden muss. Im Alter von sechs Jahren wird ein Asthma bronchiale manifest. Es wird eine Pollenallergie, später auch eine Hausstaubmilbenallergie festgestellt. Eine Hyposensibilisierung gegen Hausstaubmilben und Pollen von früh blühenden Bäumen, Gräsern und Getreiden wird wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Trotz deutlicher Hinweise (Juckreiz im Rachen nach Genuss von Fisch, Nüssen und rohen Äpfeln; Ausschlag nach Hautkontakt mit Hühnerei) wird eine Nahrungsmittelallergie nicht diagnostiziert, auch werden die Angaben des Patienten nicht berücksichtigt, dass das Betreten der Backstube Niesreiz hervorruft, gefolgt von Atemnot in den folgenden Nächten und einer Verschlimmerung des Hautzustands. Fünf Kliniken, darunter Universitätskliniken und Lehrkrankenhäuser, sind an dieser tragischen Entwicklung beteiligt. Erscheinungsfrei war der junge Patient am Ende eines mehrwöchigen Aufenthalts in einer Privatklinik, die von einem Heilpraktiker geleitet wurde und in der alle Kinder die gleiche »allergenfreie Diät« bekamen: keine Eier, keine Milch, keine Nüsse, kein Fisch, nur zerkochtes Gemüse. Der Junge magerte deutlich ab, eindeutige Diagnosen wurden auch hier nicht gestellt.
Erst nach zehn Jahren findet das Leid ein Ende: Aufgrund der für erfahrene Allergologen leicht zu stellenden Diagnosen (Bäckerasthma, Milbenallergie, Pollenallergie und spezifische Nahrungsmittelallergie) waren einfache Maßnahmen zu treffen und erfolgreich: Milbensanierung des Wohnbereichs, Trennung zwischen Backstube und Wohnbereich, Allergenkarenz gegenüber wenigen ausgewählten Nahrungsmitteln bei sonst altersentsprechender Ernährung, symptomatische Behandlung während der Pollenflugzeit. Wir erreichten dauerhafte Beschwerdefreiheit, der alternative Heilpraktiker nicht, trotz immenser Honorare. Und das Kind nahm endlich wieder zu.
FALLBEISPIEL:
Allergenfreie Diät als unbewusste Rache
Kurz vor der Mutter-Kind-Kur hatte sich der Vater von Mutter und Tochter getrennt. Die Mutter war verzweifelt und voll schwarzer Gedanken. Ihr vierjähriges Töchterchen sah dem Vater, der die Mutter so schmählich im Stich gelassen hatte, ungemein ähnlich. In der Kur verschlimmerten sich Wut und Depression der Mutter. Unbewusst lehnte sie ihre Tochter ab, weil das Mädchen sie an den Vater erinnerte. Bei dem betreuenden Arzt beschwerte sie sich über die Unruhe des Kindes. In einer Untersuchung war eine Sensibilisierung gegenüber Hühnereiweiß nachgewiesen worden – wie sich später herausstellte, ohne klinische Relevanz. Der Kurarzt stellte die Fehldiagnose »Hyperkinetisches Syndrom bei Nahrungsmittelallergie« und verordnete dem körperlich und seelisch gesunden Kind eine vierwöchige allergenfreie Elementardiät, also eine Diät, die nicht gut schmeckt und ein Kind in diesem Alter nicht ausreichend mit Kalorien versorgt. Das anfangs lebhafte Mädchen magerte unter der Diät allmählich immer mehr ab, wurde still und fügsam. Die Tragik des geschilderten Falles liegt darin, dass sowohl der Arzt als auch die Mutter die Resignation des Mädchens als Bestätigung ihrer Fehldiagnose erlebten.
Bei der Beurteilung unserer Methoden sollten wir genau zwischen spezifischen und unspezifischen Wirkungen unterscheiden. Ein wissenschaftlich orientierter Arzt möchte schließlich wissen, wie und wodurch er seinen Patienten helfen kann. Je spezifischer eine Wirkung beschrieben werden kann, desto zuverlässiger lässt sich die entsprechende Maßnahme anwenden bzw. das entsprechende Mittel einsetzen. Je unspezifischer eine Maßnahme ist, desto mehr bleibt die Wirkung dem Zufall überlassen. In unserem ersten Beispiel hatte der Heilpraktiker unseren Patienten durch unspezifische Maßnahmen »geheilt«, die seine Lebensqualität sehr eingeschränkt hatten; außerdem war die Heilung nur von kurzer Dauer.
Manche Verfahren, so z. B. die Bioresonanztherapie, behaupten von sich, nahezu jedes Krankheitsbild behandeln zu können. Aber wie heißt es so schön: Wer alles kann, kann nichts. Die Bioresonanztherapie hat keine spezifische Wirkung. Und je unspezifischer eine Wirkung ist, desto mehr entspricht sie einem Placebo. Es ist allgemein bekannt, wie stark Selbst- und Fremdsuggestion unser Gesundheitsgefühl im Guten (Placebo) wie auch im Schlechten (Nocebo) beeinflussen. Die Forschung über Placebo-Wirkungen ist immens wichtig und wird sicher noch viel mehr Einfluss nehmen auf unsere Selbstwahrnehmung und unsere Lebensführung.
In dem Dreiecksverhältnis zwischen Arzt, krankem Kind und betreuendem Elternteil hat aber nach meiner Einschätzung der Einsatz von Placebos als ernst zu nehmendes medizinisches Therapieinstrument keinen Platz. Eltern wissen um ihre eigene intensive Wirkung bei ihren Kindern, wenn sie sie nach Verletzungen oder in seelischen Konflikten auf den Arm nehmen und trösten. Manchmal muss man als Kinderarzt die Eltern daran erinnern. Wenn mich eine Mutter nach homöopathischen Präparaten fragt, erinnere ich sie an ihre mütterlichen Stärken und erkläre dann meinen ganz persönlichen Standpunkt: »Homöopathie hilft sicher dann, wenn drei daran glauben: das Kind, die Mutter, der Doktor. Was mich betrifft, ich glaube nicht. Was ist mit Ihnen?« Ich persönlich halte es nicht für gut, Heilverfahren wie die Homöopathie einzusetzen, ohne davon selbst überzeugt zu sein, wie es manche Kollegen tun mit Begründungen wie: »Das schadet doch nicht!« oder: »Irgendetwas muss ich ja aufschreiben!«, »Ich benutze das eben als Placebo!« oder: »Die Mutter will das so«. Man soll seinen Patienten gegenüber als der Mensch erkennbar sein, der man ist. Man wird dann vielleicht angegriffen, ist aber auf jeden Fall greifbar.
Wissen schaffen!
Es ist zu begrüßen, dass die Bereitschaft von Vertretern der natürlichen Heilmethoden, ihre Methoden einer kritischen wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen, in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist. Dies trifft insbesondere für die Phytotherapie zu, aber auch für die Kneipp’schen Verfahren, Entspannungstechniken, Akupunktur, Yoga und vieles andere mehr.1 Andererseits lässt sich feststellen, dass das Interesse der wissenschaftlich orientierten Medizin an der Erfahrungsheilkunde deutlich zugenommen hat. Es sind also in den vergangenen Jahrzehnten viele Denkhemmungen abgeworfen und viele Gräben überbrückt worden. Exemplarisch sei hier über die Entdeckung verblüffender Wirkungen der Hauszwiebel (Allium cepa) und das wissenschaftliche Echo darauf berichtet:
Die Zwiebel trägt schon seit Jahrhunderten zur Ernährung und Gesunderhaltung der Menschen bei. Die Volksmedizin Europas kennt Zwiebelbonbons gegen Husten, Zwiebelpresssaft bei Insektenstichen und Zwiebelsäckchen bei Ohrenschmerzen. Die Zubereitungsformen variieren: Manche legen die Zwiebel in Zucker ein, manche dämpfen sie, manche quetschen sie, manche hängen Zwiebelscheiben über das Bett ihrer Kinder. Nicht alle Methoden sind gleichwertig: Schon wer sich mit unserer normalen Hauszwiebel am Küchenherd beschäftigt, weiß, wie unterschiedlich geschmorte, gebratene, gekochte oder getrocknete Zwiebeln der gleichen Herkunft schmecken. Den Wissenschaftler fasziniert die Chemie dieser alten Heil- und Naturpflanze, die – je nach Aufbereitung – unterschiedlichste Wirkungen hervorrufen kann.
Wissenswertes über die Geschichte der Hauszwiebel (Allium cepa)
Die Kulturgeschichte der Zwiebel (Allium cepa) ist sehr lang: Sie ist als Kulturpflanze mindestens seit 9000 v. Chr. in Gebrauch, v. a. im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris (Mesopotamien). In Kochrezepten der frühbabylonischen Epoche in Süd-Mesopotamien (1700–1600 v. Chr.) spielte die Zwiebel (Insikillu) eine große Rolle. Im Alten Reich Ägyptens finden sich bereits aus der Zeit zwischen 3000 und 2100 v. Chr. Zwiebeln in Opfer- und Ernteszenen; nicht nur als Volksnahrungsmittel, sondern auch als Lohn für Pyramidenarbeiter. Der Papyrus Ebers erwähnt die Zwiebel als Heilmittel gegen eine Reihe von Infektionskrankheiten und entzündlichen Prozessen, darunter Wurm- und Durchfallerkrankungen. Sie war im klassischen Griechenland geschätzt, Homer erwähnt sie in der Ilias im 8. Jahrhundert v. Chr. als Mittel zur »Stärkung nach schrecklichem Kampf«. Auch im klassischen Judentum genoss sie hohes Ansehen, wie aus der Klage der Israeliten bei Moses nach dem Auszug aus Ägypten (Numeri, 5 f.) hervorgeht: »Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle, es ist nichts da, nichts bekommen wir zu essen außer Manna.« Im alten Rom war die Zwiebel zunächst allgemein beliebt, später war sie verpönt: Plebs und Legionäre blieben »Zwiebelesser«. Marcus Terentius Varro (116–27 v. Chr.): »Unsere Väter und Urgroßväter waren recht brave Leute, obwohl ihre Worte einen recht derben Knoblauch- und Zwiebelgeruch hatten.« Europa unterscheidet seitdem Liebhaber und Verächter der Knolle: Schon der Gesandte Ottos des Großen am byzantinischen Hof ekelte sich vor dem Kaiser von Byzanz, da dieser intensiv nach Zwiebeln und Knoblauch roch und beide Pflanzen zur Zubereitung der Speisen dort ausgiebig Verwendung fanden. Das vorkolumbianische Amerika kennt die Zwiebel auch, die Millionenstadt Chicago ist nach dem indianischen Wort Che ka kwa, kleine Zwiebel, benannt.
Als im Frühjahr 1980 meine Kinder auf dem Lande mehrfach von Bienen und Wespen gestochen wurden, riet mir eine Bäuerin, Zwiebeln aufzulegen. Es half. Für mich lag die Vermutung nahe, dass diese Behandlung auch bei der verzögerten Phase der allergischen Sofortreaktion helfen könnte. Mir war klar, dass in diesen Reaktionen der Schlüssel für den chronischen Verlauf allergischer Erkrankungen liegen müsse. Die Spätreaktionen nach einer allergischen Sofortreaktion der menschlichen Haut ähneln im äußeren Aussehen den Entzündungsreaktionen nach Bienen- oder Wespenstichen. Als junger Wissenschaftler schritt ich zunächst zum Selbstversuch mit Wespengift und Zwiebelsaft auf allergische Reaktionen meiner beiden Unterarme. Ich sah eindeutige Wirkungen und führte – gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern und mit der Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft – eine Fülle von pharmakologischen Untersuchungen durch. Wir träumten davon, ein neues/altes Asthmamittel gefunden zu haben. Die Ergebnisse wurden publiziert und international wahrgenommen. In einer Pressekonferenz haben wir unsere Erkenntnisse präsentiert, aber auch offen auf die Frage geantwortet, welche Nebenwirkungen denn zu beachten wären. Wir erzählten den versammelten Journalisten, dass die Menge an roten Zwiebeln, die man zu sich nehmen müsse, einen relativ unangenehmen Zwiebelgeruch verbreiten würde. Das Echo in der amerikanischen Presse brachte es auf den Punkt: »Onion therapy makes you healthy, but lonely« (»Zwiebeln sind gesund, machen aber einsam«).
Ein Blick in die Chemie der Zwiebel: Sobald die Knolle verletzt wird, spaltet ein Enzym, die Allinase, aus schwefelhaltigen Aminosäuren Bruchstücke ab, die zu verschiedenen Molekülen kondensieren. Hierunter befinden sich u. a. die von uns entdeckten Thiosulfinate und Cepaene, die in verschiedensten Testsystemen starke antientzündliche und antiasthmatische Eigenschaften besitzen.
Heute wissen wir, dass die Zwiebel, sobald sie verletzt wird, über enzymatische Zwischenschritte schwefelhaltige Verbindungen (Thiosulfinate, Cepaene u. a.) entstehen lässt, die ebenso wie ihre synthetischen Entsprechungen eine Vielzahl pharmakologischer Eigenschaften besitzen. Was wir allerdings auch feststellen mussten, war die Tatsache, dass trotz intensiver Maßnahmen die Wirkstoffe nicht nebenwirkungsfrei, nicht geruchsfrei und – vor allem – nicht jahrelang stabil zu erhalten sind, wie man es für ein klassisches Arzneimittel fordert. Trotzdem sind alle Beteiligten stolz darauf, Wirkstoffe und Wirkart eines traditionellen Arzneimittels aufgeklärt zu haben.
Für die Selbstmedikation vor allem in armen Ländern ist die Zwiebel sicher geeignet, wobei bei der Herstellung von volkskundlichen Arzneimitteln die Besonderheiten der komplexen Zwiebelchemie beachtet werden müssen. Der erste Schritt ist immer enzymabhängig, das bedeutet, dass die Knolle noch stoffwechselaktiv sein muss, um die verschiedenen Wirkstoffe entstehen zu lassen. Man darf sie also nicht erhitzen, wenn sie wirken soll. Danach kann man sie nur noch essen.
1 Die Vertreter obsoleter Verfahren, die den Begriff der »Naturheilverfahren« als wohlfeile Tarnung benutzen, müssen von dieser Feststellung ausgenommen werden.
II. Was wirkt und hilft – Natürliche Heilverfahren für Kinder
Naturheilpraxis von Sebastian Kneipp bis heute
Sebastian Kneipp (1821–1897), als katholischer Pfarrer viele Jahre im bayerischen Wörishofen tätig, war eine wahre Kraftnatur. Als junger Mann litt er unter der damals unheilbaren Tuberkulose. Zu der Zeit studierte er in Dillingen und stürzte sich mehrmals pro Woche ins kalte Wasser der Donau, um seine Widerstandskräfte zu stärken. Die ungewöhnliche Kur zeigte Erfolg. Und obwohl Kneipp immer wieder als »Kurpfuscher« verunglimpft wurde und sich heftiger Anfeindungen erwehren musste, entwickelte er aus seiner Erfahrung heraus ein Gesundheitskonzept, dessen Wirkung heute längst nicht mehr infrage gestellt wird. Im Gegenteil, 150 Jahre später überzeugt es mehr denn je.
Kneipps Konzept beruht auf fünf Säulen:
WasserbehandlungOrdnungstherapieGesunde und maßvolle ErnährungBewegungstherapiePflanzenheilkundeIn den vergangenen anderthalb Jahrhunderten wurden diese fünf Elemente nicht einfach von einer Generation an die nächste weitergegeben, sondern tiefgreifend erforscht. Dies gilt vor allem für die Pflanzenheilkunde, die stetig weiterentwickelt wurde. So bildet die Kneipp’sche Gesundheitslehre heute das Rückgrat jeder naturheilkundlich orientierten Kinderarztpraxis. Dazu kommen neue Verfahren wie etwa die Akupunktur, die im 19. Jahrhundert in Europa noch gänzlich unbekannt war.
Die Behandlungsmethoden, die ich im folgenden Kapitel beschreibe, gehen also im Kern auf die Ideen von Pfarrer Kneipp zurück, ergänzt durch all das Wissen, das wir inzwischen hinzugewonnen haben. Daneben möchte ich weitere Heilmethoden vorstellen, die in meiner und in der Praxis vieler anderer Kinderärzte seit Jahrzehnten erfolgreich angewandt werden. Mit ihrer Hilfe begleiten wir gesunde Kinder, leisten umfassende Versorgung in Lebens- und Entwicklungskrisen und können eine Fülle von Krankheitsbildern behandeln. Die Wirksamkeit all dieser Verfahren ist wissenschaftlich belegt. Gemeinsam ist ihnen ein geringer apparativer, aber vergleichsweise hoher persönlicher – und personeller – Aufwand. Sie ergänzen sich wechselseitig, und wie wir sehen werden, ergänzen sie auch sinnvoll die Methoden der klassischen Medizin. Für jedes Kind, für jede Situation werden sie individuell eingesetzt. Ihr Ziel ist es, die Autonomie der kranken Kinder zu stärken und eine Entwicklung neuer Abhängigkeiten zu verhindern.
Die Liste der hier aufgeführten natürlichen Heilverfahren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um meine persönlichen Favoriten aus dreiundvierzig Jahren Erfahrung in Forschung und Praxis.1 Ihre Auswahl und Gewichtung ist nicht für die Ewigkeit in Stein gemeißelt, sondern einem steten Wandel unterworfen. Wir alle, Wissenschaftler und klinisch tätige Ärzte, suchen stets nach besseren Methoden, auch im naturheilkundlichen Bereich. Dieses Buch versammelt das Beste von dem, was wir heute wissen.
Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Bereich, der zu Kneipps Zeiten noch keine große Rolle spielte: der Bereich der Vorsorge, Früherkennung und Prävention, beispielsweise durch Impfungen. Er soll am Anfang dieses Kapitels zusammengefasst dargestellt werden, bevor wir uns den verschiedenen Heilmethoden und ihren Einsatzgebieten widmen. Nicht zuletzt deshalb, weil im Bereich der Vorsorge und Prävention oft die ersten Kontakte zwischen Kinderarzt und Kind bzw. Familie entstehen – und weil Eltern hier viele drängende Fragen haben.
1 Die Auswahl der Verfahren ist zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche, wie sie in unserer Kinderarztpraxis mit den Schwerpunkten Lungenheilkunde, Allergologie, Naturheilverfahren und Psychosomatik ambulant versorgt werden. Auch von Kollegen aus dem Arbeitskreis »Komplementärmethoden und sogenannte Alternativmethoden« der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie werden diese Verfahren empfohlen und angewandt.
Vorsorgen und vorbeugen
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.





























