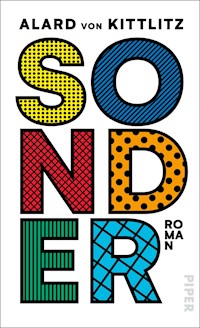19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Amour fou zwischen zwei jungen Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch mehr gemeinsam haben, als sie ahnen. Johanna ist eine Jurastudentin aus Frankfurt, David ein Maler aus Armenien, ein Flüchtlingskind. Eine Ausstellung seiner Kunst in Venedig führt die beiden zusammen, der Glaube an eine schicksalhafte Fügung eint sie. Ihre Gefühle und die Kämpfe mit den Traumatisierungen der Vergangenheit aber drohen sie zu entzweien. Trägt die Hoffnung, durch einander zum jeweils wahren Selbst gelangen zu können? Eine große internationale Lovestory, zeitgenössisch und wahr. »Kittlitz schreibt, wie Netflix erzählt: in großen Bildern, mit passendem Soundtrack, mit Empathie für Antihelden.« DER SPIEGEL
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: FinePic®, München; Boris Jovanovic/Stocksy Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Cleo
Aber den Hektor band ein widriges Schicksal zu bleibendraußen vor Ilios’ Burg und vor dem Skäischen Tore
Ilias, 22. Gesang
I
Johanna erwachte zur Dämmerung. Jemand, hatte sie geträumt, rief sie. Leise, ohne Helena zu wecken, kroch sie aus dem Zelt, pflückte ein Handtuch von der Wäscheleine und lief über die Nadeln des Pinienwäldchens hinunter zum Strand, der noch ganz grau und verlassen lag. Fröstelnd zog sich Johanna aus, sie watete in das kaum bewegte Wasser und schwamm hinaus, bis sie die Sonne im Nacken spürte. Sie drehte sich um und sah das große Gestirn glitzernd über die Baumwipfel steigen. Das schattige Land darunter wirkte unbesiedelt, verheißungsvoll, als sei Johanna der erste Mensch, der es je wahrnahm, als würde sie, zurückgeschwommen, eine neue Welt betreten.
Helena war wach, als Johanna wieder am Zelt anlangte. Die beiden Freundinnen beschlossen, zum Frühstück noch einmal in ein Café zu fahren über der Bucht, ein paar Kilometer die Serpentinen der Küstenstraße hinauf. Sie setzten sich auf den Roller, dessen Sitz von der Morgensonne schon ganz heiß gebacken war, und knatterten im Geruch von Salz, Asphalt und Benzin am heraufblitzenden Meer entlang. Johanna wollte Helena, an der sie sich festhielt, über den Fahrtwind etwas zurufen – dass sie bleiben, nicht abreisen wolle –, aber sie biss sich auf die Zunge, sie behielt diesen Wunsch für sich. Später stopften die Freundinnen ihre Kleider in die Rucksäcke, sie rollten schweigend ihr Zelt zusammen, gaben den Rollerschlüssel an der Rezeption des Campingplatzes ab und stiegen in den Bus zum Bahnhof.
Sie erreichten Venedig am späten Nachmittag. Lange rollte die Bahn über einen Damm, rechts und links glänzte die Lagune fett und windstill. Am Gleis von Santa Lucia wartete bereits Momo, er führte sie aus dem Bahnhof durch die brütend schwüle Hitze des Vorplatzes zu einem wartenden Wassertaxi. Auf der Fahrt zu der Ferienwohnung, die einer Münchner Tante von Helena gehörte, setzte Johanna sich auf das Vordeck in den flackernden Fahrtwind, um Momo und Helena hinten miteinander allein zu lassen. Die Sonne stand weiß im dunstigen Himmel, darunter zogen die Türme, Kuppeln und Dächer der berühmten Stadt vorbei, diese ganzen spitzigen Bögen, alles wies, fand Johanna, beinahe verzweifelt nach oben, fort vielleicht vom vielen Wasser, das die Stadt verschlingen wollte. Und überall an den Ufern die Menschen, Durcheinander, Abertausend tastende Schritte, ein enormes Gedränge, das sich bis auf den von Booten übersäten Kanal fortsetzte, das Gewirr der Stimmen und Sprachen übertönt nur vom Dröhnen des Motors, dem rhythmischen Klatschen des Wassers gegen den Bug. Alles schien wie wuselnde Kulisse, simuliert, niemand gehörte hierher, Johanna zumindest begriff überhaupt nicht mehr, was sie hier sollte.
Bei der sogenannten Ferienwohnung der Tante handelte es sich, wie Johanna bald begriff, tatsächlich um einen kleinen siebenhundert Jahre alten Palazzo unweit des Canal Grande. Das Boot hielt an einem schmalen Steg, über den man durch ein rostiges Eisentor und einen feuchten, tunnelartigen Gang auf den Innenhof des Gebäudes gelangte. In dessen Mitte wuchsen aus gewaltigen irdenen Töpfen riesige Farne, wodurch das bröckelnde Ensemble aus Backstein und Marmor nur noch ruinöser wirkte – als sei alles bereits überwuchert von archaischer Botanik, lange vergessen und nun wiederentdeckt. Während Momo und Helena schnatternd eine Freitreppe hochstiegen, die über gotische Bögen hinauf in das Obergeschoss führte, blieb Johanna lange und fast bestürzt in diesem Innenhof stehen, dessen klein dimensionierte, verfallende Pracht sie anrührte, vor der sie sich, verschwitzt in ihren Running-Shorts und mit dem Rucksack auf dem Rücken, eigenartig taktlos fühlte, fast so, als betrachtete der Hof sie erstaunt zurück: einst waren doch Fürsten und Prinzessinnen im hohen Mantel durch das Portal hereingetreten, das gedankenlose Lächeln im Gesicht.
Die Haushälterin wies Johanna ihr Zimmer, es war dunkel, sauber, ganz einfach eingerichtet, der Boden aus bemalten Fliesen, ein uralt anmutendes riesiges Bett, ein knarrender Schrank, schwere Balken unter der Decke. Der Blick aus dem schießschartenschmalen Fenster ging auf einen stillen Kanal und hohe, verlassen wirkende Häuser gegenüber. Schwalben schossen zirpend über das Wasser. Johanna räumte ihre Kleider in den Schrank, nahm sich eins der steif gewaschenen Handtücher vom Bettende und ging ins Bad. Sie duschte lange und heiß, wusch sich das Salz aus den Haaren und den letzten Sand vom Körper, bis der kleine Raum in Dampf gehüllt war und Tropfen am beschlagenen Spiegel herabrannen. Im Zimmer setzte sie sich auf ihr Bett, stöpselte ihr Handy ein und ging erstmals durch die vielen Mails, die in den vergangenen Wochen eingegangen waren. Die Nachrichten – Werbung, Rechnungen, Newsletter, Universitätskorrespondenz, Einladungen – irritierten sie in ihrem aufdringlichen Ton, in ihrem um künftige Zeit heischenden Inhalt; das kalte Interface, das Rumgewische auf dem Bildschirm, die Gedanken an die Rückkehr, die Wohnung, den Semesterbeginn, alles beengte sie. Ihr war heiß, sie rauchte aus dem Fenster in die schwüle Dämmerung hinaus, was nicht half. Endlich verließ sie ihr Zimmer und fand Momo und Helena im Salon dämmernd, auf Sofas liegend, in rotes und blaues Licht getaucht durch die Buntglasfenster, während sich über ihnen an der hohen Decke träge ein Ventilator drehte.
Es war Helena gewesen, die einige Monate zuvor, am Abend der kleinen Feier zu Johannas dreiundzwanzigstem Geburtstag, den Wunsch nach einem gemeinsamen Urlaub ausgesprochen hatte, aus Sehnsucht, hatte Johanna vermutet, nach jener verblassenden Intimität und Nähe, die sie miteinander zu Beginn der Studienzeit in Berlin gekannt hatten, bevor Helena aus der geteilten Wohnung aus- und mit Momo zusammengezogen war. Johanna hatte vorgeschlagen, Zelten zu gehen: beide hatten das noch nie gemacht, es klang nach kleinem Abenteuer und Verschwisterungsgelegenheit. Das Vorhaben hatte darin bestanden, ohne fixes Ziel an der südwestlichen Küste Italiens umherzudriften, bevor man in Venedig Momo treffen würde, um mit ihm noch für zwei letzte Ferientage die Biennale zu besuchen, zu der Johanna noch nie gereist war.
Gleich am Anfang der Reise aber waren die Freundinnen auf einem Campingplatz bei Maiori gelandet, der im Grunde nur aus einem weitläufigen, sanft bewaldeten Gelände über dem Meer bestand und auf dem man sein Zelt in derart großem Abstand zu den anderen Gästen aufschlagen konnte, dass man sich beinahe alleine fühlte. Johanna und Helena waren in der Abenddämmerung angelangt, hatten ihr rotes Iglu mithilfe des älteren Signore, der das Anwesen verwaltete, auf dem von Baumnadeln gepolsterten Boden aufgestellt und waren, das Knarren der duftenden Pinien im Nachtwind über sich, eingeschlafen. Am ersten Morgen waren sie schon vor dem Frühstück im weichen Meer geschwommen, um sich am Strand von der Sonne trocknen zu lassen, die funkelnden Tropfen auf der noch ungebräunten Haut, vollkommen alleine an dem kleinen, kiesigen Ufer, und auf dem Weg zum Zelt zurück hatten sie in wenigen, sogleich einverstandenen Worten besprochen, nicht weiterzureisen, sondern zu bleiben.
In den Tagen bei Maiori hatten beide viel gelesen, viel geschlafen, Strand und Campingplatz nur selten verlassen, bloß zum Essen waren sie auf dem gemieteten Roller in die umliegenden Städtchen und Dörfer gefahren, meist fort von Küste und Touristen ins Hinterland, um sich an den Plastiktischen kleiner Restaurants niederzulassen, im Schatten der Mauern, eine blendende Piazza, ein bröckelndes Kirchlein vor sich. Abends hatten die Freundinnen auf Klappstühlen in der um sich greifenden Dunkelheit des Campingplatzes gesessen und Wein getrunken, eine Kerze zwischen sich, oder waren manchmal in der leisen Brise hinunter an den Strand gelaufen, hatten sich in den Kies gesetzt und auf das dunkle Meer geblickt, über das weiß gekrönt die Wogen rollten, geredet, oft auch geschwiegen.
Und Johanna war nach einer anfänglichen, diffusen Angst vor der großen Dunkelheit der Nächte und der Ungeschütztheit des Zeltes in eine innere Zeitlosigkeit gesunken, und jeder Tag wäre ihr wie derselbe erschienen, und jede Nacht wie die vorhergegangene – wenn in ihr nicht, was sie vor Helena verschwieg, um es in seiner anfänglichen Zartheit nicht zu vertreiben, von Tag zu Tag jenes Gefühl einer Ahnung gewachsen wäre, das sie auch vor der zersetzenden Kraft des eigenen Denkens zu beschützen trachtete, indem sie es gewissermaßen nur aus den Augenwinkeln beobachtete – als ein Geheimnis auch vor sich selbst. Sie meinte, dass ihr hier, oder bald jedenfalls, etwas ganz Entscheidendes, etwas ausgesprochen Bedeutsames geschehen oder begegnen würde. Diese inhaltlich sehr unbestimmte Erwartung steigerte sich in ihrer Intensität, bis sie sich sogar in ihre Träume schlich, in denen Johanna sich stets an einer Schwelle zu befinden schien, ganz in der Nähe von etwas Unbestimmtem, Verheißenem. Worin dieses Ereignis bestehen, was es ergeben könnte, war ihr vollkommen unklar, aber sie beobachtete ihr leises, nicht unangenehmes Verrücktgewordensein mit Erstaunen und einer zärtlichen, zunehmenden Gespanntheit. Sie fühlte sich, dachte sie irgendwann, als stünde ihr nach langer, anstrengender Reise nun endlich der Eintritt in eine eigentlichere Existenz bevor.
Und auch deswegen war Johanna ungern nach Venedig gekommen: Es war bis zum Ende des Zelturlaubs nichts geschehen. Nichts, niemand war in ihr Dasein getreten, und hier nun, inmitten der Lautstärke und Menschenmassen, der Uneigentlichkeit einer Museumsstadt, würde sich das Gefühl wohl schnell verflüchtigen. Vielleicht, dachte Johanna, während sie mit Momo und Helena zum Abendessen aus der Wohnung ging, hätte sie wirklich noch länger warten, vielleicht alleine noch in Maiori bleiben müssen. Weit wahrscheinlicher ja aber war der ganze seltsame Zustand nur vorübergehende Gestörtheit gewesen, gegenstandslos, albern, Gespinst.
Als die drei am folgenden Vormittag zum Festspielgelände liefen, wirkte die Stadt auf Johanna weiter unecht. Calle Paradiso, Calle Dolera, dieses Labyrinthine, und am großen Kanal alles unter greller Sonne, Wasser, Boote, Türmchen, Zinnen suchten vergeblich Halt in diesem leeren blauen Himmel. Von überall Licht, Flirren, die Welt blendete. Einmal, vor vielen Jahren, als kleines Mädchen noch war Johanna mit ihren Eltern hier gewesen, für ein paar Tage nur, einzig in Erinnerung geblieben war ihr der Flug der Tauben vor den Kolonnaden am Markusplatz und ein Bild von ihrer Mutter, wie sie Blumen ablegte in einer Kirche, am Grab des Komponisten Monteverdi. Nichts von dem, was Johanna sah, schien diese Vergangenheit zu berühren.
Zwischen den Pavillons der Biennale wurde es ihr bald zu heiß. Die Kleider klebten ihr am Leib, und die vielen Leute, die sich unter den Bäumen von Gebäude zu Gebäude schoben, strengten sie an. Alles war so furchtbar eng. Die eigene Empfindlichkeit ärgerte sie, aber schon nach dem zweiten Pavillon wollte sie eigentlich nicht mehr, stattdessen stellte sie abermals verunsichert fest, dass sie mit dieser sogenannten Welt der zeitgenössischen Kunst, die so bedeutend tat, so glamourös erschien, die ihrer Freundin Helena so viel sagte, nicht viel anfangen konnte. Sie kam sich immer dumm vor vor den Arbeiten, sie konnte nicht erkennen, was daran gut oder schlecht sein sollte, worauf sie sich bezogen, sie fühlte sich mit dieser Hilflosigkeit alleine und hatte zugleich den Eindruck, dass ohnehin kaum einer der Besucher hergekommen war, um sich Kunstwerke anzusehen, man betrachtete doch weit eher einander.
Vor dem deutschen Pavillon begegneten Momo, Helena und Johanna unerwartet einem ganzen Tross von alten Klassenkameraden aus der Internatszeit, dem »Dukaten-Set«, wie Helena diesen Zirkel bisweilen spöttisch genannt hatte. Es waren, stellte Johanna, die sich endgültig überfordert abseitshielt, ja wirklich dieselben zehn, zwölf Leute, die immer noch, fünf Jahre nach dem Abitur, miteinander rumhingen, sich immer noch gleich kleideten, nichts schien sich verändert zu haben, bloß dass man nun todernst darüber sprach, welcher Pavillon keineswegs verpasst werden dürfe, was kürzlich Thema auf der Party des Galeristen Zwirner gewesen sei, wie lang im Voraus man im Hotel Bauer reservieren müsse, um in den guten Wochen ein anständiges Zimmer zu bekommen. Johanna begriff, dass diese alten Weggefährten, von denen einige bedeutende Vermögen erben sollten, sich schon im erfolgreichen Identifizieren und Aneignen großbürgerlicher Investitionsobjekte übten, wozu natürlich auch die Kunstwerke gehörten, auch wenn die diesen Leuten zu Schulzeiten noch absolut nichts bedeutet zu haben schienen.
Helena und Momo unterhielten sich freundlich mit ihnen, Johanna blieb still und beobachtete halb fasziniert, halb verärgert, wie alle in dieser Versammlung so taten, als seien sie Momo stets wohlgesonnen gewesen, wahrscheinlich also war ihnen sein Erfolg inzwischen zugetragen worden. Johanna erinnerte noch sehr genau, wie gekränkt dieselbe Gruppe damals, in der Zwölften, reagiert hatte, als Helena, die Königin der Stufe, ausgerechnet mit diesem ruhigen Ägypter von der Büchner, der Stadtschule, zusammengekommen war, und wie Helena sich in der Folge von ihnen gelöst hatte. Als Johanna unter den lachend schnatternden Köpfen den fast kahl gewordenen Karl von Todtleben erkannte, haute sie ab, bevor der sie sehen konnte, und eine Welle von Scham und Wut durchfuhr sie.
Sie verließ das Festivalgelände allein und lief zurück in die Wohnung. Auf ihrem Zimmer versuchte sie zu lesen, aber ihre Gedanken wanderten immer wieder fort von den Seiten und zurück zu den heimlich sie taxierenden Blicken der ehemaligen Mitschüler, zur Heimreise nach Berlin. Sie fühlte sich von allem, durch alles lächerlich in ihrer vermeintlichen Ruhe gestört, sie ahnte bereits die Wiederkehr jener latenten Verwirrung über den eigenen Stand in der Welt, der sie am Meer offenbar hatte entkommen können, während sie in Berlin darüber höchstens deswegen nicht in existenzielle Beunruhigung geriet, weil die meisten ihrer Freunde unter ähnlichen Zuständen zu leiden schienen. Fast alle lebten über dieser Nacht aus Haltlosigkeit, der man systematisch, konzentriert, konzertiert zu widerstehen versuchte durch Vinyasa, Netflix, Tinder, Tanzstudio, Stabi, HIIT, Drinks, Berghain, Biennale-Trip. Es gab, hörte Johanna sich erschrocken denken, wirklich nichts, worauf sie sich in Berlin freute. Sie schaute sich in ihrem Zimmer um und fragte sich plötzlich, ob Helena den gemeinsamen Urlaub nicht womöglich aus Sorge um sie, Johanna, vorgeschlagen haben könnte: ein Retreat.
Am frühen Abend liefen Johanna, Momo und Helena zu einer Bar nahe der Giardini und unterhielten sich, gemeinsam lachend, über die alten Mitschüler, denen sie am Vormittag begegnet waren. Es war angenehmer geworden in der Stadt, eine Brise war aufgekommen, die Luft lau, das Licht der sinkenden Sonne lag nachglühend auf den ockerfarbenen Ziegeldächern, und die Mondsichel schwebte durchsichtig im tiefbabyblauen Himmel über ihnen. Johanna folgte Helena und Momo über kleine Brücken und durch stille, fensterlose Gässchen, in denen die Stadt beinahe verlassen wirkte, und endlich begann sie, deren Schönheit zu erkennen, und fühlte sich darüber beinahe erleichtert. An einem von weiß blühendem Jasmin duftenden, menschenleeren Plätzchen setzten sie sich mit dem Rücken zum Kanal auf eine kleine Mauer, um sich einen Joint zu teilen, als Momo auf das Plakat an einem bröckelnden Palazzo wies.
»David Sakadjian. Das ist doch dieser Maler, von dem du erzählt hattest, Helena. Der den silbernen Löwen gekriegt hat?«
»Ach genau! Das ist ja hier! Ja, das wollte ich mir wirklich gern anschauen. Das hat sogar noch auf. Sollen wir reingehen?«
Die viel besprochene Serie von drei Gemälden, Teil der internationalen Ausstellung, hieß »I know I am august«. Sie wurde in einem fensterlosen Kellergewölbe gezeigt. Außer einer schweigend auf ihr Telefon starrenden Aufsicht befand sich niemand in dem Raum, als Helena, Momo und Johanna eintraten.
»Das wirkt hier so seltsam grenzenlos«, flüsterte Momo. »Wo sind die Wände?«
»Der hat alles mit so einem speziellen Schwarz gestrichen, das das Licht schluckt«, antwortete Helena. »Deswegen kann man die Wände kaum sehen. Sogar den Boden hat er damit bemalt.«
»Deswegen schweben die Bilder so. Und wie hat er das hingekriegt, dass die Grashalme so leuchten vor dem Schwarz?«
»Ich hab gelesen, dass er die Farbpigmente selbst hergestellt hat, gemeinsam mit so einem alten Ikonenmaler in Athen«, sagte Helena. »Vielleicht sind die Farben deswegen so intensiv. Und der Goldgrund verstärkt den Effekt sicherlich.«
»Wie Heiligenscheine wirken diese Goldflächen fast.«
»Das ist schon krass, was der draufhat. Ich glaube, die Beleuchtung changiert hier leicht. Vielleicht soll das Licht so was wie Kerzenschein simulieren. Und die Halme sind in etwa so groß wie ein Mensch. Das erzeugt immer diesen seltsam lebendigen Effekt. Wir übertragen da was.«
»Und weißt du, worum es geht?«
»Nicht wirklich. Der redet nicht über seine eigenen Arbeiten. Ich weiß wenig über ihn. Aber ein schöner Mann übrigens. Nicht viel älter als wir, glaube ich.«
»Schön ist er auch noch«, sagte Momo, verschränkte die Arme und trat ein paar Schritte zurück, um das Triptychon ganz auf sich wirken zu lassen. »Ich finde das immer ein bisschen albern, wenn die so ein Geheimnis um sich machen. Und ein bisschen altmodisch kommen mir diese Grashalme schon auch vor, dieser technische Perfektionismus. Die sind mir zu hübsch.«
Helena stellte sich neben ihn, hakte sich bei ihm unter und betrachtete mit ihm gemeinsam die drei Bilder. »Ich verstehe schon, was du meinst. Der begreift sich als Maler, glaube ich. Das sind schon irgendwie strenge Gemälde. Aber er trifft damit auch einen Nerv. Die Serie hat jedenfalls die Bank of America Collection gekauft.« Sie trat abermals ein paar Schritte zurück und ließ den Blick über die Malereien wandern. »Wisst ihr zufällig«, fragte sie, »was der Titel bedeutet? Was heißt august?«
»Erhaben«, sagte Johanna, die bis dahin nichts zu dem Gespräch beigetragen hatte, die weiter wie gebannt vor den Malereien stand und in die, wie durch ein geborstenes Wehr, machtvoll die seltsame Ahnung der vergangenen Wochen zurückströmte, um in den Bildern endlich ihr Pendant zu finden. Wegen dieser Bilder bin ich hierhergekommen, fühlte Johanna, dieser Raum hat mich gerufen.
II
Ein paar Tage später, zurück in ihrer kleinen Wohnung am Südstern, wanderten Johannas Gedanken noch immer ständig zurück zu den Bildern des Armeniers und der außerordentlichen Erfahrung, die sie bei deren Betrachtung gemacht hatte. Ein paar Male in ihrem Leben hatte sie schon erlebt, dass Kunst sie hinreißen, überwältigen konnte. Bachs Chaconne etwa, gespielt vom Geiger Gidon Kremer, in einer Kirche bei Den Haag, sie hatte neben ihrer Mutter in der ersten Reihe sitzen und dem Violinisten in das ekstatisch verzerrte Gesicht schauen können. Oder die erste Lektüre der Glasglocke, zu Beginn des Studiums, in einem Rutsch auf dem Plastikhocker einer Buchhandlung, dabei das Gefühl, einer verschwisterten Seele so nahekommen zu dürfen, dass sie fast schon sie zu berühren vermeinte. Und ein Besuch in Paris, im vergangenen Winter, bei dem sie in der Dämmerung, fröstelnd, im Grunde nur zum Aufwärmen und Zeittotschlagen vor einem Treffen mit ihrer Freundin Nele, in das Musée de Cluny getreten war, und dort so lange vor der letzten, rätselhaften Tapisserie der Dame mit dem Einhorn gestanden hatte, bis das Museum schloss und man sie gebeten hatte, nun zu gehen. Nie aber hatte Johanna etwas Menschengemachtes mit solcher Kraft transportiert wie die Porträts der Grashalme von diesem David Sakadjian, und niemals hätte sie erwartet, dass überhaupt und dann ausgerechnet durch zeitgenössische Malerei ein Ventil sich finden würde für die rastlos in ihr rotierende, eigenartige Energie der italienischen Ferien.
Endlich und nur widerwillig, weil sie fürchtete, die Arbeit effektlos auf ihrem Computerbildschirm reproduziert zu sehen, ging Johanna doch ins Netz, um mehr darüber zu erfahren. Sie googelte den Titel und erfuhr, dass es sich offenbar um ein Zitat handelte aus einem amerikanischen Gedicht, aus »Song of Myself« von Walt Whitman:
I know I am solid and sound,
To me the converging objects of the universe perpetually flow,
All are written to me, and I must get what the writing means.
I know I am deathless,
I know this orbit of mine cannot be swept by a carpenter’s compass,
I know I shall not pass like a child’s carlacue cut with a burnt stick at night.
I know I am august
»Ich weiß, ich bin kerngesund und fest«, übersetzte sich Johanna, was sie las, »In mir fließen unaufhörlich alle Dinge des Weltalls zusammen, Alle sind an mich geschrieben, und ich muss die Schrift entziffern. Ich weiß, dass ich totlos bin.« Für die nächsten zwei Zeilen reichte ihr Englisch nicht mehr aus, sie fand im Netz eine deutsche Übersetzung: »Ich weiß, meine Kreisbahn kann nicht von eines Zimmermanns Zirkel umspannt werden; Ich weiß, dass ich nicht verlöschen werde wie eines Kindes Feuerreif, der nachts mit glühendem Stock durch die Luft geschlagen wird. Ich weiß, dass ich erhaben bin.«
Johanna, die kaum Lyrik las und von Whitman bislang keine Zeile gekannt hatte, scrollte an den Anfang des langen Gedichts, versank darin, flog zunehmend aufgeregt über die Verse, durch die sich eine triumphierende, berstende Lebendigkeit zu ringeln schien wie eine schillernde Korallenschlange. Als Johanna an das Ende gelangt war, befand sie sich erneut ganz in der Verfassung, in die sie bei der Betrachtung der Grashalm-Bilder des Armeniers geraten war, aufgewühlt, übervoll mit zielloser Kraft, sie fand sich wie bezeichnet in einem namenlosen Kern ihres Wesens, zu dem sie aus eigener Anstrengung kaum je Zugang fand.
Aus einer Art von Ratlosigkeit verließ sie ihre Wohnung, um völlig gegen jede Gewohnheit alleine einen Drink zu nehmen. Sie lief eine ganze Weile durch die noch warme Berliner Spätsommernacht, über breite Straßen, auf denen bisweilen tief die Autos vorüberglitten, am dunklen Kanal entlang, über dessen Wasser von ferne Gelächter wehte und Musik, vorbei an den nach Staub und Sonne duftenden, verschattet aufsteigenden Bäumen und den hohen Laternen, in deren gelbem Schein Gras und verdorrter Löwenzahn aus den Brüchen des Trottoirs krochen.
Es war an diesem Sonntagabend nicht sonderlich belebt im Würgeengel, einer Raucherbar, in deren Schummerlicht man sich unbeobachtet fühlen konnte. Johanna fand einen Platz am breiten Tresen, bestellte einen Old Fashioned, trank alleine und wollte unbedingt alleine sein, wie hätte sie auch sprechen können über das, was in ihr vorging, über Whitman, den Urlaub, die Biennale.
Sie war, das erkannte sie plötzlich und erstaunt, etwa so, wie einem schreckhaft bewusst werden kann, dass jemand sich unbemerkt ganz dicht neben einen gestellt hat, voller Trauer, altbekannter Trauer ja wohl, meinte sie, über den Vater. Natürlich dachte sie jeden Tag an ihn, elf Jahre nach seinem Tod noch immer, als sei er nicht längst schon fort, aber sie begriff erst jetzt, dass sich die eigenartigen Ahnungen der Urlaubstage auch übersetzen ließen in eine Sehnsucht danach, dass sich etwas lange schon Fehlendes bald wieder einstellen möge, dass sich dahinter also womöglich doch bloß die alte Wunde verborgen hatte, angefasst vielleicht durch die Strukturlosigkeit der Zelttage – das Unglück darüber, dass der Vater sie nicht kannte, sie nicht sehen konnte, dass er nicht zu helfen, zu raten, zu vergeben, zu verstehen vermochte, dass sie ohne ihn zu leben hatte und sich danach sehnte, ihm wiederzubegegnen.
Zugleich aber und in größtem Widerspruch fühlte Johanna sich gerade so satt, so glücklich wie lange nicht mehr, wollte ihr die Brust fast zerspringen von einer Art immenser Erleichterung. Denn alles, was sie so unklar gefühlt hatte, war in den beiden Arbeiten, erst in jener des Armeniers, dann in der dahinter verborgenen des amerikanischen Dichters, so erstaunlich genau bezeichnet, bezeugt und erkennbar geworden, dass sie sich abermals kaum des Eindrucks erwehren konnte, in eine schicksalhafte Verbindung getreten zu sein: Hier entlang, tiefer hinein, du bist, so sprach etwas in ihr, auf die eigentlich dir gesetzte Bahn geraten.
I know I am solid and sound,
To me the converging objects of the universe perpetually flow,
All are written to me, and I must get what the writing means.
Diese leis paranoide Art, der Welt zu begegnen, war Johanna im Grunde sehr vertraut. Als Kind hatte sie solche Zustände ständig erlebt, ein Gefühl, von Chiffren umgeben zu sein, von Hinweisen darauf, dass sie sich im Zentrum einer gefügten Welt befand, in der alles von verschlüsselter Bedeutung war, zu flüstern schien in einer großen, geheimnisvollen Sprache. Wenn sie sich in diesem Modus befunden hatte, war es Johanna möglich gewesen, sich gleichermaßen als Nabel der Welt wie als Staubkorn zu erleben, sie stand im Zentrum des Geschehens und war gleichzeitig, ohne Widerspruch, bloß eines von zahllosen Teilchen, die sich im kosmischen Tanz umeinanderdrehten. Es hatte einen ihr objektiv erscheinenden Zauber in der Welt gegeben.
Irgendwann aber – im Ausgang der Kindheit – hatte Johanna die Bereitschaft dazu verloren, sich auf diese Anwandlungen einzulassen, zu verführerisch waren sie ihr aus der Warte der zersetzenden, adoleszenten Reflexion auf einmal erschienen, zu haltlos, zu narkotisierend, zu verdächtig tröstlich in ihrer Wirkung – denn alles, diese Deutungsmöglichkeit war ihr im Tod des Vaters in aller Drastik begegnet, ließ sich auch gänzlich anders betrachten: als enorme Farce, die der Mensch mit faselnder Bedeutung auszukleiden suchte, um an ihrer monströsen Leere nicht zugrunde gehen zu müssen.
In Italien allerdings war Johanna – jetzt erst erkannte sie das in aller Deutlichkeit wieder – erneut in etwas Ähnliches hineingeraten wie diesen Kindheitsmodus, und hatte das, warum, wusste sie nicht, an sich heranlassen können ohne Vorbehalt. Sie gestand sich ein, dass die Anwandlungen sich für sie ungleich befriedigender, richtiger, wahrer angefühlt hatten als alle Formen der vermeintlich nüchterneren Nüchternheit. I know I shall not pass like a child’s carlacue cut with a burnt stick at night, hatte sie bei Whitman gelesen, und dabei ein Bedürfnis gespürt, diese Worte zu greifen, in sie hineinzufahren wie in ein Büschel Kornblumen, sie zu halten wie ein zitterndes Tier: die Wirklichkeit der Welt als etwas nicht endgültig Ausdeutbares, als etwas noch ganz Offenes – als etwas Bemerkenswertes. Und so seltsam im Gleichschritt mit diesem Atmen der Welt fühlte sich Johanna jetzt gerade, dass sie es kaum ertragen konnte, vielmehr, kapierte sie, war sie offenbar zu leiser Betäubung hergekommen, in der Hoffnung, die unhaltbare Schönheit ihres Zustandes durch ein bis vier Cocktails herunterzuregeln. »Ich werde aber nicht verrückt«, hörte sie sich denken, »sondern es wird mir wirklich noch Großes geschehen« – und Johanna schaute sich, leise alarmiert über sich selbst, tatsächlich um, als suchte sie nach einer fremden Stimme, die das ausgesprochen hatte.
Zwei Männer hatten sich neben sie an den Tresen gestellt, um zu bestellen. Die beiden redeten miteinander angeregt auf Englisch. Einer hatte ihr den breiten Rücken zugewandt, vom anderen, dem jüngeren, schmalen, kahl rasierten, sah sie nur für einen Augenblick das dunkle Gesicht, die blitzenden Augen.
»Der hat auch sehr unangenehme Sachen geschrieben«, sagte der Schmale gerade, »wusstest du das? So rassistischer Shit, das erschreckt einen.«
»Wusste ich nicht«, sagte der Breite.
»In seinen Briefen. Das ist hart, das lässt sich nicht leugnen. Aber das Gedicht lässt sich eben auch nicht leugnen. Damit muss man leben können, mit dem Widerspruch. So wie mit Amerika selbst ja übrigens auch. So wundervoll und so schlimm.«
»Geht es in der Arbeit dann eigentlich um Amerika?«
»Ach komm. Du bist ja schon total betrunken«, lachte der Schmale.
»Wieso total betrunken?«
»Mir geht es in erster Linie natürlich darum, ein Bild zu malen. So wie Dürer eben Gras gemalt hat. Oder Anita Albus Blumen. Aber ich bin der Erste, der Heiligenscheine hineingesetzt hat. Das war meine Idee. Und das ist dann wieder das Gedicht. Wie geht das noch mal, warte …The saints and sages in history – but you yourself? Wenn es Heiligkeit gibt, ist alles heilig.«
»Das ist Whitman!«, hörte Johanna sich laut sagen, plötzlich, ohne jede Distanz, und sie schaute am Rücken des Breiten vorbei hoch zu dem Schmalen, der sie mit hellwachen Augen ansah und dann mit vielen weißen Zähnen anlächelte: erstaunt, amüsiert. »Ich weiß genau, woher das ist. Und ich glaube auch, dass ich weiß, wer du bist«, sagte Johanna, denn sie glaubte, sie wusste es, und sie erschrak auf einmal vor der Unwahrscheinlichkeit, der Gewalt dieser Begegnung.
III
»Nein!«
»Doch. David Sakadjian.«
Johanna und Helena am Folgetag, morgens, auf der Choriner Straße, unterwegs zu einem Café in der Oderberger.
»Du bist gestern Abend David Sakadjian begegnet.«
»Ja.« Johanna lachte.
»Das ist doch unglaublich. Dich haben doch die Bilder in Venedig schon so weggehauen. Und dann läufst du dem ein paar Tage später ausgerechnet hier über den Weg.«
»Der war da mit seinem Galeristen aus London, Matthew.«
»Beaumont. Der ist ganz toll, die Galerie macht ganz tolle Sachen. Und was wollen die beiden hier in Berlin?«
»David lebt hier.«
»Ach ja, der David.«
Johanna lachte wieder. Helena guckte sie an. »No way!«
»Nein, keine Sorge, nicht so krass«, sagte Johanna. »Aber wir haben uns echt lang unterhalten. Bis heute morgen eigentlich, bis vorhin.«
»Und findest du den gut?«
»Ist das deine erste Frage?«