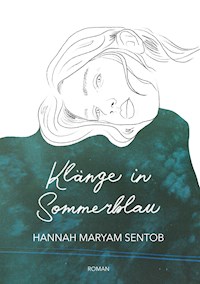
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ilka steht kurz vor ihrem Musikstudium und stellt erschrocken fest, dass sie sich gerade in ihren besten Freund Josh verliebt, der ihr seit dem Tod ihrer Mutter vor über einem halben Jahr nicht von der Seite gewichen ist. Unsicher, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll, lässt sie sich auf einen Sommerurlaub an der Nordsee ein - zusammen mit Josh und dem gemeinsamen Musikensemble. Am Strand lernt sie Hel kennen, die der Freundesgruppe einen mysteriösen Plan vorstellt und im Gegenzug einen abenteuerlichen Sommer verspricht. Ilka wird immer neugieriger, was hinter den Geheimnissen steckt ... und merkt gar nicht, dass sie langsam auch für Hel Gefühle entwickelt. "Sie war das Meer. Wild und nicht zu bändigen, chaotisch, turbulent. Und auf irgendeine Weise beruhigte sie mich."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An das Meer und die Musik.
TRIGGERWARNUNG
Für diesen Roman gilt eine Triggerwarnung für folgende Themen: Depression, Panikattacken, Tod, Trauer, Erwähnung von selbstverletzendem Verhalten, Erwähnung von Suizid.
Diese genannten Themen treten innerhalb des Romans gehäuft auf. Das Lesen kann somit belastend und retraumatisierend sein.
ILKAS PLAYLIST: RESTLESS MUSICIAN
Concerto No. 2 in G minor, Op 8: Summer II Presto – Antonio Vivaldi
45 – Bleachers
River Song – Birdy
The Flight of the Bumblebee – Nikolai Rimsky-Korsakow (Arr. Johnson, Drake)
Cello Suite No. 1 in G Major, I. Prélude – Johann Sebastian Bach
Mariners Apartment Complex – Lana del Rey
august – Taylor Swift
The Blessing Nigun – Giora Feidman
Riptide – Vance Joy
The Lighthouse – Halsey
This Love (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Homemade Dynamite – Lorde
Petrichor – Robarrd
Sweater Weather – The Neighbourhood
Libertango – Astor Piazolla (Yo-Yo Ma, Jorge Calandrelli)
Ocean’s Voice – city of tents
Cruel Summer – Taylor Swift
O Violet – Greyson Chance
Hell Froze Over – Kodaline
Song of the Birds – Pablo Casals, Sol Gabetta
Rue – girl in red
Liar – Noah Cyrus
When the Summer Ends – Savoir Adore
Secrets from a Girl (Who’s Seen it All) – Lorde
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
EPILOG
PROLOG
so trügerisch
das meer
so ruhig und so vertraut
fast liebevoll fragt es nach zweisamkeit
so finster und doch so blau
so unfassbar unendlich weit
fast freudig spürt es die einsamkeit
dort bin ich gern
denn dort bin ich frei
ich weiß es hält zu mir
das trügerische meer
dort kann ich laufen
ganz weit weg
bis ich nichts mehr spür’
und dann kann ich schreien
denn dann bin ich frei
und ich weiß
der wind fängt mich auf
hier bin ich gern
denn hier ist es sicher
hier sind tränen nie salziger als das meer
1
Das Publikum jubelte. Kameras blitzten, die Scheinwerfer wirbelten umher, der Boden vibrierte immer noch durch den Schall des letzten Stücks. Reizüberflutung. Meine Ohren rauschten. Bewegungen nahm ich nur noch in Zeitlupe wahr. Ich schwebte irgendwo dazwischen. Von Momenten wie diesen hatte ich immer geträumt. Wie ich mit einem kleinen Ensemble auf einer Bühne stand, wir das Publikum in den Bann der Musik zogen und die Menschen genau da berührten, wo es emotional und schmerzhaft wurde, und man sich dennoch wünschte, dass dieses Gefühl niemals aufhörte.
Meine Mutter hatte immer gesagt, es sei Magie. Magie oder irgendeine andere Art von spirituellen Energien, die freigesetzt wurden, jedes Mal, wenn wir im Ensemble gemeinsam musizierten. Mit uns wurde die Musik lebendig, hatte sie so oft gesagt. Wie recht sie hatte. Das Zusammenspiel zwischen dem Tremolo des Akkordeons, den tiefen Tönen des Cellos und der Oberstimme in Geige und Querflöte, die sich zu streiten und sich im selben Moment wieder zu vertragen schienen, glich einem künstlerischen Spektakel. Wir verschmolzen mit unseren Instrumenten, harmonierten, als wären wir eins, vergaßen uns selbst zwischen den Stimmen und kreierten eine Melodie, die von dem Rhythmus des Schlagzeugs angetrieben wurde.
Es war der dritte Abend in Folge, an dem die Salonbühne der Musikschule ausgebucht war. Bis auf die Nummer dreiunddreißig, dritte Reihe links, waren alle Plätze besetzt. Nummer dreiunddreißig war der Stammplatz meiner Mutter gewesen, deren Jahresabo ich nach ihrem Tod nicht storniert hatte.
Mittlerweile waren einige der Zuschauenden aufgestanden. Eine weitere Zugabe also. Ein kurzer Blickkontakt mit den anderen reichte aus, um festzulegen, welches Stück wir spielen würden. Wir drehten uns einander zu, die Lichter wurden gedimmt, das Publikum beruhigte sich. Ich schloss die Augen und spürte für einen Moment nur meinen Herzschlag. Ganz leise, kaum wahrnehmbar, entwich dem Cello eine ruhige Melodie. Es war vielmehr ein Gefühl als eine Technik, mit dem ich den Bogen über die Saiten gleiten ließ.
Manchmal machte sie mir Angst, die Musik. Vielleicht, weil sie so oft der Ausdruck meiner Verletzlichkeit war. Es waren Momente von kühnster Intimität, die entstand, wenn ich mich völlig der Musik hingab. Ich fürchtete mich davor, mich in ihr zu verlieren, gar zu ertrinken in Melodien und Klängen, die mich in die Fluten rissen und immer tiefer hineinsinken ließen, wenn ich es zuließ, die Kontrolle abzugeben. Ich fragte mich, ob die Musik meine Ängste eigentlich spürte. Manchmal glaubte ich, Musik war die einzige Instanz, die irgendetwas spürte.
Meine Mutter war an einem grauen Novembertag gestorben. Es war der erste Tag seit Langem gewesen, an dem es nicht mehr regnete. Es hatte sich angefühlt, als hätte meine Mutter all die Tropfen mit in ihren tiefen Schlaf genommen. Als wollte sie, dass keine Träne auf dieser Welt mehr übrig war. Ich hatte mir vorgestellt, wie die Tropfen die Trauer umschlossen hatten und gemeinsam mit ihr in die Erde sickerten.
An den Friedhof grenzte ein Feld, das durch die Nebelschicht, die auf ihm lag, kaum zu sehen gewesen war. Kälte war aus dem Boden emporgekrochen und irgendwo zwischen Rippen und Herz hatte ich ein Stechen gespürt, als ich daran dachte, dass meine Mutter in eben diese Kälte hinuntergelassen wurde. Krähenwetter, erinnerte ich mich. Ich war zu dünn angezogen gewesen; trug den schwarzen Blazer, den ich schon auf meiner Konfirmation getragen hatte. Die Ärmel waren zu kurz geworden. Ich hatte nicht daran gedacht, dass ein Mantel bei den Temperaturen die angemessenere Wahl gewesen wäre. Meine Finger waren bereits blau angelaufen. Doch ich erinnerte mich, dass ich mich über die Kälte gefreut hatte. Ich bildete mir ein, dass solange mein Körper kühl und taub war, alles an ihm abprallen konnte.
Ich hatte am Grab gestanden und mich an den Moment erinnert, als mir aufgefallen war, dass wenn man Nebel rückwärts las, dort Leben stand. Ich ging damals in die erste Klasse und wir durften das erste Mal Wörter schreiben, ohne auf die Buchstabentafel zu schauen. In meinem Kopf herrschte schon immer ein gewisses Chaos, jedoch hatte es wohl mal Zeiten gegeben, in denen das Chaos noch Sinn ergab. Irgendwann, Jahre später, lernte ich, dass es sich um ein Palindrom handelte. Endlich gab es einen Begriff für etwas, das mich lange Zeit beschäftigt hatte.
Nebel wirkte manchmal leblos und konnte sich über das Leben legen, alles unlebendig machen. Doch dieser Nebel war nicht leblos. Er kroch über den Boden, als wolle er ihn vor dem bevorstehenden Tag warnen. Oder vor dem Leben selbst.
Ich hatte mich gefragt, warum man auf Beerdigungen immer Sonnenbrillen trug. Tat man es denjenigen zuliebe, die weinten und es nicht zeigen wollten? Oder denjenigen, die weinen wollten, es aber nicht konnten? Ich hatte keine Sonnenbrille bei der Beerdigung meiner Mutter getragen. Ich wollte, dass man sah, dass ich nicht mehr weinen konnte.
Menschen, von denen ich geglaubt hatte, sie gehörten zur Verwandtschaft, kamen auf mich zu und sagten mir Worte, die man einem Mädchen sagte, das gerade seine Mutter an einer Überdosis Tavor verloren hatte.
Tavor. Ein verschreibungspflichtiges Medikament, das zur Arzneimittelgruppe der Benzodiazepine gehört. Sein Wirkstoff, Lorazepam, greift im Gehirn, wo die Erregbarkeit der Nervenzellen herabgesetzt wird. Dadurch wird die Weiterleitung von Reizen und Signalen umfassend geblockt oder gedämpft. Dies führt zu einer angstlösenden, beruhigenden, schlaffördernden und narkotisierenden Wirkung. Tavor ist für eine Kurzzeitbehandlung von maximal vier Wochen zugelassen, weil schnell eine körperliche Abhängigkeit entstehen kann. Dass meine Mutter es über Monate eingenommen hatte, hatte ich nicht gewusst.
Tante Erna hatte ihre langen Fingernägel in meinen Arm gekrallt, so wie sie es tat, seit ich denken konnte, sich zu mir rüber gebeugt, mich mit ihren dunkelroten Lippen auf die Wange geküsst und gesagt: „Du packst das, Liebes.“
Ich hatte genickt.
Ich hätte mir gewünscht, meine Mutter wäre bereits im Juni gestorben. Im Juni blühten die Margeriten noch. Ich hätte sie frisch vom Feld gepflückt und das gesamte Grab damit ausgelegt. Sie hätte sich bestimmt darüber gefreut. Vielleicht hätte der Duft der Wildblumen ihre dunklen Gedanken verjagt, falls sie auch unter der Erde weiterhin gegen sie ankämpfen musste. Doch meine Mutter entschloss sich, im Herbst zu sterben. Also lagen Hornveilchen auf der nassen Erde, die kalt und zerbrechlich ausgesehen hatten, genauso wie meine Mutter, kurz vor ihrem Tod.
Links und rechts konnte man die Steine kaum noch erkennen, so viel Moos und Efeu hatte über ihnen gehangen. Irgendwann würde auch ihr Grab von Moos und Efeu überwuchert sein und keiner würde sich an die Hornveilchen erinnern, die einst auf ihr lagen. Ich hatte mich gezwungen, den Gedanken zuzulassen, dass meine Mutter nun nicht mehr kämpfen musste. Ein Gedanke, dem es jedoch nicht gelungen war, mich zu trösten. Weder mit Margeriten noch mit Hornveilchen.
Der Korpus fing an zu schwingen, als ich langsam lauter wurde und die Geige irgendwann einsetzte, als wüsste sie ganz genau, wann meine Improvisation bereit für sie war. Ich spürte förmlich, wie wir gemeinsam eine Spannung erzeugten, bei der den Zuhörenden die Luft wegblieb.
In einem Artikel eines Kulturmagazins hatte ich vor Kurzem von einer Studie gelesen, die belegte, dass sich die Pulsfrequenzen der Zuschauenden eines Konzerts einander anglichen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als mir bewusst wurde, dass wir den Herzschlag der über hundert Menschen, die uns ansahen, gerade steuerten. Geige und Cello – als seien sie zwei alte Bekannte, die so taten, als hätten sie sich nichts zu erzählen. Und gleichzeitig brodelte es im Inneren eines Jeden, weil die Geschichten erzählt werden, die Stimmen gehört werden, die Charaktere sich entfalten wollten. Doch wir hielten die Spannung, reizten die Erwartungen des Publikums durch das sich langsam aufbauende Crescendo beinahe ins Unerträgliche aus. Bis dass das Schlagwerk, der Bass des Akkordeons sowie die helle Querflötenstimme in unserem Höhepunkt explosionsartig dazustießen und wir erneut ineinander verschmolzen.
Die ersten Wochen nach dem Tod meiner Mutter hatten nicht vergehen wollen. Es fühlte sich so an, als hätte ich sie im Inneren einer Schneekugel verbracht. Ich hatte die meiste Zeit auf dem Sofa gekauert und mir eingebildet, es befände sich eine Kuppel über mir, die dafür sorgte, dass keinerlei Gefühle an mich herankamen. Alles um mich herum war still, dumpf und grau gewesen. Meine Mutter hatte Schneekugeln geliebt. Irgendwo zwischen den Kisten und Kartons, die noch darauf warteten, sortiert und aufgeräumt zu werden, würde sich sicher die ein oder andere Kugel verstecken.
Ich hatte mir vorgestellt, wie meine Mutter auf mich in meiner Kuppel herunterblickte. Ich hatte mir vorgestellt, dass sie mich ansah, wie sie mich vielleicht in die Hände nahm, so wie sie es manchmal mit ihrer Lieblingsschneekugel mit der Eistänzerin getan hatte, und mich schüttelte, sodass die tausend kleinen weißen Flocken aufgewirbelt wurden und ganz langsam an einer anderen Stelle auf den Boden der Kugel glitten. Ich hatte mir vorgestellt, wie sie lächelte und in den Schneesturm blickte, den sie verursacht hatte. Ich hatte mir gewünscht, dass sie mich in meiner Kugel fallen ließ, dass ich zerbersten würde auf dem kalten Fußboden, dass ich in ebenso viele tausend Teilchen gerissen würde, wie es die Schneeflocken von Natur aus waren.
Als eine Reporterin kurz nach der letzten Zugabe auf die Bühne stürmte, um uns zu fragen, wie wir uns nun, nach unserem Abitur sowie nach dem Abschlusskonzert der Musikschule unseren weiteren musikalischen Werdegang vorstellten, tat ich so, als müsste ich zur Toilette. Bevor die emsige Reporterin mein Cello, das ich neben meinen Stuhl auf der Seite liegend aufgestellt hatte, mit einer Sitzgelegenheit zu verwechseln drohte, schnappte ich es mir und verschwand durch die dicken bordeauxroten Vorhänge der linken Bühnenseite in Richtung Proberäume, um für einen Moment für mich allein zu sein. Kati würde der Reporterin sicher gern für Fragen zur Verfügung stehen.
Ich lehnte mich an einen der Tische, die am Fenster standen, und starrte in die Spiegelwand gegenüber von mir. Neun Jahre lang hatte mich meine Mutter zweimal pro Woche in die Musikschule gefahren. Neun Jahre lang hatte meine Mutter zweimal pro Woche auf einem klapprigen Stuhl vor der Spiegelwand gesessen und mir zugehört, wie ich Cellospielen lernte. Es war lange her, dass ich meine Mutter mit lustigen Melodien zum Lachen hatte bringen können. Es waren die wenigen Momente, in denen ich sie wirklich glücklich gesehen hatte. Sie liebte die Klänge und hatte so oft gesagt, sie würden sie stark machen, sie heilen. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal gelacht hatte, als ich ihr etwas vorgespielt hatte. Irgendwann hatte sie sogar aufgehört zu lächeln. Aber ich war froh darüber, denn irgendwann hatte sie ausgesehen, als würde ihre faltige, dünne Haut um ihren Mund herum einreißen, sobald sie ihre Mundwinkel nach oben zog.
Die Musik heilte nun mich, zumindest bildete ich mir das ein. Die Klänge meines Cellos waren manchmal das Einzige, das mir Halt gab, neben der fragilen Kuppel, die seit einem halben Jahr über mir hing. Obwohl ich spürte, wie sich die Tränen in meinen Augen sammelten, ließ ich nicht zu, dass sie ausbrachen.
In der Schule war ich oft Sensibelchen genannt worden. Anfangs dachte ich, es sei ein Kompliment. Meine Mutter hatte mal gesagt, ich sei hochsensibel. Irgendwann, als ich unbeobachtet war, gab ich das Wort hochsensibel in den Laptop ein, in den meine Mutter einfach immer alles eingab, das sie sich nicht selbst erklären konnte. Dort stand: Hochsensibel – von besonderer Feinfühligkeit, empfindsam, zartbesaitet. Zartbesaitet gefiel mir und ich war stolz darauf, dass wohl eine höhere Instanz dafür verantwortlich sein musste, dass ich Cello spielte.
In meine Klasse ging damals ein Mädchen, das nahezu jeder neuen Lehrkraft sagte, es sei hochbegabt und habe auch schon Tests gemacht, die das bewiesen. Ich hatte mich nie getraut zu sagen, dass ich hochsensibel war, da ich nie einen Test gemacht hatte. Obwohl ich also eine Weile dachte, sensibel zu sein sei etwas Positives, wurde mir dann mit der Zeit klar, dass meine Mitschülerinnen und Mitschüler nur selten Komplimente für mich übrighatten. Und dass das Wort Sensibelchen eher der Kategorie Schimpfwörter für Menschen, die nicht in das Raster passen, das andere für sie vorgesehen haben angehörte.
Eigentlich passte ich nie in irgendwelche Raster. Ich war anders. In der Schule war häufig über diejenigen geredet worden, die anders waren. Anfangs war es meiner roten Locken wegen, die ich bis zum Schulanfang eigentlich gemocht hatte, weil ich damit so aussah wie eine Elfe aus einem Buch, das mir meiner Mutter immer wieder vorlesen musste, bevor ich selbst lesen konnte. Meine vielen Sommersprossen und die undefinierbaren grünen Augen mit den gelblichen Sprenkeln dienten ebenfalls dazu, einen eher herablassenden Umgang mit mir zu legitimieren. Und so lernte ich schnell, dass Äußerlichkeiten wichtig zu sein schienen. Ich wäre gern dunkelhaarig gewesen. Ja, dunkelbraun oder schwarz hätte mir wirklich gut gefallen. Irgendwann kamen zu den Äußerlichkeiten auch andere Eigenschaften dazu, die mir immer wieder bestätigten, dass ich nicht auf das gewöhnliche Raster zugeschnitten war. Ich spielte Cello, und das war ein weiterer Fehler, den man sich als Mädchen, das anders war, eigentlich nicht noch zusätzlich erlauben durfte. In meiner Klasse hatte man vor allem Fußball oder Badminton gespielt. Das hochbegabte Mädchen spielte Klavier, wofür es sehr bewundert wurde. Im Musikunterricht durfte es ununterbrochen die Titelmusik aus Die fabelhafte Welt der Amélie spielen. Ich spielte Bach und Saint-Saëns, wobei es nichts nützte, dass Letzterer ebenfalls Franzose war – die Filmmusik kam deutlich besser an.
Ich wollte gern genauso sein wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Ich wollte dazugehören, cool sein, interessant sein. Ich wollte, dass man sich freiwillig neben mich setzte, mit mir das Pausenbrot tauschte und mich fragte, ob ich am Nachmittag mit ins Freibad kommen wollte. Ich hasste Freibäder, aber ich wollte wenigstens gefragt werden.
Das hatte sich geändert, als meine Cellolehrerin eines Tages gefragt hatte, ob ich Lust hätte, im Ensemble der Musikschule zu spielen. Und so lernte ich Josh, Kati, Charlotte und Maik kennen. Menschen, die ebenfalls nicht ins Raster passten. Doch wir erschufen uns unser eigenes, die einzige Bedingung: Harmonie. Musik verband, Musik heilte, Musik machte uns stark.
Ein lautes Kichern riss mich aus meinen Gedanken. Kati stand auf einmal in der Tür und sah mich mit strahlendem Gesicht an.
„Rate mal, wer in der nächsten Ausgabe der Musikale erscheinen wird!“, rief sie und band sich ihre mittelbraunen Haare, die sie auf der Bühne offen getragen hatte, mit einem Haargummi zusammen.
Ich brauchte einen Moment, um zu reagieren. „Du“, sagte ich und versuchte, so zu klingen, als freute ich mich für sie.
„Ganz genau. Ich habe der Journalistin von Peru erzählt, sie war ganz hin und weg.“ Sie strahlte nun noch mehr, und ihre Stimme klang zwei Oktaven höher. Kati würde ab Oktober für ein halbes Jahr mit Straßenkindern in Lateinamerika ein Musikprojekt auf die Beine stellen. Seit Monaten redete sie von nichts anderem mehr.
„Oh, Kati, das freut mich unheimlich für dich!“
„Übrigens“, sagte sie mit dem typischen Tonfall, in den sie verfiel, wenn sie so tat, als hätte sie den Überblick über alles, was geschah. „Stell dir vor, Josh wurde eben von einem Dozenten aus Wien angesprochen, wegen seines Antrags auf ein Stipendium. Aber du weißt da ja sicherlich mehr als ich …“
Ein Stoß in meinem Unterbauch, der sich schnell in einen immer größer werdenden Knoten verwandelte. Wien? Stipendium? Ich wusste von gar nichts.
„Klar. Hat er mir erzählt“, log ich. Ich spürte, wie sich das Wasser wieder anstaute.
„Charlotte gibt uns übrigens einen aus, hat sie gerade gesagt. Dafür, dass wir sie auf die Theoretische vorbereitet haben. Wollte sie sich für unseren letzten Konzertabend aufheben. Ich hab vorgeschlagen, wir gehen in die Berta.“
„Ich glaube, ich komme nicht mit“, sagte ich. „Ich bin echt müde und muss endlich den ganzen Schlaf der letzten Wochen nachholen.“
„Schlafen kannst du noch das ganze Wochenende. Komm, sei keine Spielverderberin. Sogar Maik kommt mit.“ Sie schaute mich mahnend an.
„Ich fühle mich wirklich nicht so … tut mir leid. Ein andermal gern.“ Ich drehte mich um, sodass sie mein Gesicht nicht mehr sehen konnte und tat so, als sortierte ich meine Noten in den Ordner.
„Wenn du meinst“, murmelte sie. Ich spürte förmlich, wie sie mit den Augen rollte. Sie verließ den Raum und ich war für einen Moment allein. Das dumpfe Stimmengewirr aus dem Foyer mischte sich mit dem in meinem Kopf.
Ich hatte gar nicht gemerkt, dass erneut jemand in den Raum gekommen war. Zwei Arme umklammerten mich leidenschaftlich von hinten, ich wurde sanft an einen Körper gezogen, der einen halben Kopf größer war als ich. Josh roch nach herbem Aftershave und kaltem Schweiß. Wer behauptete, Musizieren sei kein Sport, hatte noch nie knappe zwei Stunden hochkonzentriert auf der Bühne gestanden.
„Du warst großartig, Ilka“, flüsterte er mir ins Ohr und drückte mich fester an sich. Er schien zu spüren, wenn es mir nicht gut ging. Ich klappte den Ordner mit den Noten zu und drehte mich um. Er nahm mein Gesicht in seine Hände und wiederholte fast lautlos: „So großartig“, als könnte er es selbst noch nicht fassen.
„Übertreib mal nicht!“ Ich lachte, nahm seine Hände von meinem Gesicht und legte sie auf meinen Hüften ab. „Du willst doch nur hören, dass du auch nicht schlecht gespielt hast.“
„Hmm, vielleicht.“
„Du warst großartig“, ahmte ich ihn nach. Er lächelte zufrieden, wodurch sich in seiner linken Wange ein Grübchen bildete.
„Wobei …“, fing er an, „der dritte Satz vom Vivaldi hätte ruhig etwas fetziger sein können.“
„Nix da wobei“, sagte ich. „Wir waren gut. Herr Ludwig wirkte zufrieden, das ist alles, was zählt.“
„Ein unvergessliches Konzerterlebnis.“ Josh machte die Stimme unseres skurrilen Ensembleleiters leise nach und umarmte mich erneut. Herr Ludwig war unglaublich stolz auf uns und hatte bei seiner Ansprache sogar eine Träne verdrückt, als er dem Publikum erklärte, dies sei ein Abschiedskonzert, da er uns nun in die Hände der Hochschuldozierenden geben würde.
„Ganz genau.“ Ich musste schmunzeln und befreite mich aus seinen Armen. „Hier besser nicht. Falls du nicht willst, dass Kati wieder irgendwas mitbekommt und schneller Bescheid weiß, was zwischen uns ist, als wir es wissen.“
„Ich weiß nur so viel, wie ich wissen will“, sagte er geheimnisvoll. Ich war mir nicht sicher, ob der Knoten in meinem Unterbauch gerade dabei war, sich zu lösen, oder sich wieder zusammenzukrampfen. „Apropos“, fuhr er fort, „Ich habe gehört, du kommst nicht mit in die Berta? Soll ich dich nach Hause begleiten? Ich hab mir schon gedacht, dass es schlimm wird für dich.“ Er wurde leiser. „Sie wäre bestimmt gern dabei gewesen.“ Der letzte Satz war kaum zu hören. Kein Lösen, ein Krampf.
Ja, hätte ich am liebsten geschrien. Und komm mit, bleib bei mir, halte mich fest, so wie eben, sodass ich keine Angst haben muss, dass mich meine Gedanken in den Kontrollverlust zwingen.
„Nein“, sagte ich. „Das ist nicht nötig. Aber lieb von dir.“
„Dann sehen wir uns Morgen. Alright?“
„Alright“, flüsterte ich, obwohl rein gar nichts alright war. Es war alles all wrong, doch das konnte ich ihm nicht sagen. Nicht hier, nicht jetzt. Ich hätte ihm gern gesagt, wie es sich anfühlte in meinem Bauch, in meinem gesamten Inneren. Dass ich mir wünschte, es wäre wieder kalt. Krähenwetter.
Und dass mein Körper taub wurde und ich nichts mehr spüren musste. Ich wünschte mir, dass ich fallen gelassen würde. Dass ich zerspringen würde. Aber der Sommer stand bevor, und alles in mir schrie, wenn ich daran dachte, dass die Hitze nur noch mehr Gefühle aufkochen lassen würde.
Wollte ihm sagen, dass ich eigentlich nur noch für sie spielte, weil ich hoffte, sie dadurch zurückzuholen. Und dass ich wusste, dass das absurd war; dennoch spielte ich seit Monaten ununterbrochen, in jeder freien Minute.
Wollte ihm sagen, dass mich seit einiger Zeit ein Schmerz durchbohrte, von dem ich nicht wusste, ob es ein Spiegel des Schmerzes meiner Mutter war, oder die lüsterne Realität, die mir beweisen wollte, dass das Leben, so wie ich es mir jahrelang vorgestellt hatte, nur eine Illusion gewesen war. Romantisiert. Verzerrt. Poetisch. Künstlerisch. So war es in Wirklichkeit nicht. Die letzten Monate hatten das bewiesen.
Ich wollte ihm gern sagen, dass ich süchtig war, nach der Musik, weil sie mich ebenfalls taub machte, zwar nicht annähernd so taub wie die Kälte, aber es half. Die Illusion war so erträglicher.
Ich wollte ihm gern sagen, dass ich glaubte, dass ich gerade gefährlich nah dran war, mich in ihn zu verlieben, etwas, das – wie wir vor Jahren beschlossen hatten – nie passieren würde. Doch dass ich seit einiger Zeit ein so seltsames Gefühl in mir trug, wenn wir zusammen waren. Ein Gefühl, von dem ich nicht wusste, ob es echt war oder nur den Schmerz erträglicher machen wollte. Ein Gefühl, als würde man fallen, aber vielleicht auch nur des Fallens wegen.
Wollte ihm gern sagen, dass ich damals nichts von alldem verstanden hatte, womit er versuchte, mich zu trösten, und dass ich nur so getan hatte, als verstünde ich, was er meinte, weil er so weise geklungen hatte und ich mir so dumm vorgekommen war. Aber dass ich jetzt so langsam verstand. Ja, ich begann zu verstehen, doch vielleicht wollte ich auch nur verstehen und hatte eigentlich rein gar nichts verstanden. Denn mein Verstand war taub, das zumindest war klar. Der Fall machte Angst, der Fall tat gut. Befreite und erinnerte mich gleichzeitig an meine größte Angst: Kontrollverlust. Und irgendwie ging mir das alles viel zu schnell, weil die Angst, ihn zu verlieren, auf einmal größer wurde als die Angst vor dem Fallen.
Ich sagte nichts von alldem. Er küsste mich zum Abschied dreimal auf die Stirn, was so viel bedeutete wie Pass auf dich auf. Melde dich, wenn was ist. Diese kleine Geste hatte sich ziemlich schnell zwischen uns etabliert. Schnell dafür, dass er mein bester Freund war und das Küssen lange Zeit nichts als tiefe Verbundenheit ausgedrückt hatte. Diese kleine Geste hatte jedes Mal bewirkt, dass ich mich ein kleines bisschen beruhigte. Vielleicht bildete ich es mir auch nur ein. Ein Placeboeffekt, dessen Wirkung selten enttäuschte.
Als ich die Musikschule verließ, regnete es in Strömen. Es war ein warmer Julitag gewesen, der sich, wie so häufig in letzter Zeit, mit einem Platzregen in die Nacht verabschiedet hatte. Auf der Salonbühne hatte ich von alldem nichts mitbekommen, doch nun sah ich, wie sich Pfützen an den Straßenrändern gebildet hatten, als reihten sich kleine Ozeane aneinander. Der Wind hatte wohl mit voller Kraft durch die Allee gefegt. Abgebrochene Äste lagen auf der Straße, Lindenblüten füllten die Ozeane mit weißen Segelbooten.
Weit und breit war nichts mehr zu sehen von dem großen Trubel, der während des Konzerts geherrscht hatte. Der Regen peitschte von allen Seiten gegen mich, als ich mit meinem Cellokoffer zur Bushaltestelle lief. Ich liebte den Regen. Der Regen schluckte Klänge, der Regen war Klang selbst. Er glitzerte unter den Straßenlaternen, die die verlassenen Gehwege ausleuchteten.
Als ich den Bus um die Ecke biegen sah, rannte ich die letzten paar Meter – später würde kein Bus mehr kommen. Der Fahrer wartete und ich bedankte mich an seiner Kabine, an der ich wie immer nur umständlich mit dem großen Cellokoffer vorbeikam.
Und dort saß ich, auf dem dritten Einzelplatz an der linken Seite des Busses, dort, wo man nur zur Hälfte durch das schmutzige Fenster sehen konnte. Auf der anderen Hälfte klebte ein Festivalplakat. Party, Love & Music – fühl dich frei! stand dort in Neonpink und –grün. Das Röhrenlicht oberhalb der Sitze flackerte irritierend unregelmäßig und ließ den klapprigen Bus neben dem säuerlich-muffigen Geruch noch unattraktiver erscheinen. Es war mittlerweile dunkel geworden. Trotz des flackernden Lichts, des abgestandenen Geruchs und der einzigen zwei anderen Mitfahrenden, die sich in dem letzten Vierer eine Bierflasche gönnten, genoss ich die Fahrt. Ich sah eine Weile in das verdunkelte Glas hinter dem Fahrer, worin sich die beiden Biertrinkenden spiegelten. Der eine schaute auf sein Handy, der andere starrte nach draußen, murmelte dabei irgendetwas, das vermutlich eher an sich selbst gerichtet war.
So ging das eine ganze Weile, der Fahrer hielt nur noch an wenigen Haltestellen, da sowieso niemand ein- oder aussteigen würde. Um diese Zeit schlief man in dieser Stadt.
Ich versuchte, möglichst unauffällig auf meinem Sitz zu sitzen, um die Aufmerksamkeit der angetrunkenen Männer nicht auf mich zu ziehen. So unauffällig, wie man mit einem Cellokoffer neben sich eben sein konnte. Ich war froh über die Müdigkeit, die der inneren Unruhe gar nicht erst eine Chance gab. Ab und zu sah ich auf das schrille Plakat oder auf den Doppelsitz schräg gegenüber von mir. Wenn ich die Augen zusammenkniff, konnte ich die verschmierten Buchstaben einer wohl mal sehnsuchtsvollen Liebeserklärung erkennen, die auf die Rückenlehne geschrieben worden war.
Eigentlich fuhr ich gern mit dem Bus durch die Stadt und die umliegenden Dörfer. Seit meine Mutter mich nicht mehr zur Musikschule fuhr, zögerte ich das Nachhausekommen jedes Mal noch eine Weile hinaus, indem ich einfach umherfuhr. Es war entspannend, lenkte mich ab von meinen wirren Gedanken und inspirierte mich auf irgendeine Weise. Das dachte ich jedenfalls immer. Ich dachte, ich würde auf der Fahrt am aufregenden Alltag teilnehmen. Am Leben der Anderen. Wollte teilhaben an der Welt, die ich mir für all die Menschen ausdachte. Hoffnungslose Verliebte, abenteuerlustige Einzelgänger, geschäftige junge Frauen mit einem Masterplan für ihr Leben. Eine Welt, die für mich so unerreichbar war und doch so nah erschien, wenn ich nur einen halben Meter von dem Schicksal der Personen entfernt auf einem schmierigen Sitz saß.
Ich schloss die Wohnungstür auf und lehnte den nassen Cellokoffer gegen das Schuhregal. Seit dem Auszug aus der Altbauwohnung, in der ich mit meiner Mutter gewohnt hatte, hatte sich in meiner neuen Wohnung nicht viel getan. Noch immer standen Wäschekörbe und unsortierte Kartons mit Büchern, Gegenständen und Kleidung überall verteilt herum.
Ich ging ins Bad, um meine durchnässte Kleidung auszuziehen. Im Spiegel blickte mir ein müdes Gesicht entgegen. Meine Wimperntusche war durch den Regen verschmiert, vielleicht hatte ich auch geweint, ich erinnerte mich nicht mehr. Ich wusch mein Gesicht, zog meine klebrige Seidenstrumpfhose und das schwarze Kleid aus, legte beides über den Badewannenrand und nahm mir stattdessen das alte Shirt, das ich als Nachthemd zweckentfremdet und bereits zum Waschen in den Wäschekorb gelegt hatte, und schlüpfte wieder hinein.
Als ich die Jalousien am Fenster runterziehen wollte, blickte ich über den Innenhof in das benachbarte Haus, wo eine junge Frau auf dem Balkon stand und sich eine Zigarette anzündete. Es hatte mittlerweile aufgehört zu regnen. Der Wind hatte nicht nur die Wolken weitergeschoben, sondern auch sämtliche Strähnen aus ihrem Dutt gelöst. Sie hielt sich ihre dünne Strickjacke zu und blickte in den Himmel. Was denkt diese Frau gerade?, fragte ich mich. Welche Sorgen, welche Wünsche gehen ihr wohl durch den Kopf? Ich beobachtete sie noch eine Weile, ehe sie dann ihre Zigarette ausdrückte, in ihre Wohnung zurückging und die dunklen Vorhänge zuzog.
Langsam machte sich die Erschöpfung der letzten Wochen in mir breit und ich war froh, dass ich zu Hause war, statt in einem siffigen Club zu Technomusik so zu tun, als gäbe es etwas zu feiern.
Jetzt blickte auch ich nach oben in das schmale Stück Himmel, das ich zwischen den hohen Hauswänden noch sehen konnte, und wünschte mich an einen Ort, wo man die Sterne richtig sah und es dem Mond nichts ausmachte, dass man ihn anstarrte, als sei er das Einzige, auf das man sich noch verlassen konnte. Auf sein Zu- und Abnehmen, auf seinen Kreislauf der Energien, die er mit der Erde teilte. Dass er achtgeben würde auf die Gedanken, die man mit ihm teilte, nachts, wenn die Welt schlief und niemand einen weinen hörte.
2
Am nächsten Morgen wurde ich von den Sonnenstrahlen geweckt, die an den Seiten der Gardine in mein Schlafzimmer gelangten. Samstag.
Verschlafen schälte ich mich aus dem Bett und ging in die Küche, wo ich mir einen grünen Tee kochte und wie jeden Morgen hoffte, dass der kaputte Toaster heute nicht ganz kaputt ging. Ohne nachzudenken, zog ich nach exakt zweieinhalb Minuten den Stecker heraus und angelte mit einer Holzzange meine zwei gebräunten Toastscheiben aus dem qualmenden Gerät. Die Springfunktion hatte sich vor ein paar Monaten dazu entschieden, nicht mehr zu springen. Ich stellte fest, dass auf dem Abreißkalender, der oberhalb des Obstkorbs hing, immer noch der sechzehnte März war. Carpe diem stand in verschnörkelter Schrift auf dem Kalenderblatt. Erfolglos versuchte ich mich zu erinnern, was ich am sechzehnten März gemacht hatte.
Ich öffnete die Spotify-App auf meinem Handy und spielte meine Lieblingsplaylist ab. In ihr befanden sich neben sämtlichen Stücken, die wir im Ensemble gespielt hatten, viele meiner aktuelleren Lieblingssongs sowie Lieder, die ich mit den gemeinsamen Treffen mit Josh verband. Kurz: Es war die Playlist, die mich jeden Tag begleitete, egal, in welcher Stimmung ich mich befand. Es war die wohl abwechslungsreichste Playlist, die je erstellt worden war. Von Klassik bis Indie-Pop war alles dabei. Ich fragte mich, ob meine Ohren irgendwann eine Pause brauchten von all der Musik. Doch Pause konnte ich nur schwer ertragen. Die Stille wurde jedes Mal lauter, als die Musik es jemals hätte sein können.
Restless Musician hatte Josh mich vor einiger Zeit genannt. Ich fand, es passte zu mir. Seit Kati von unserem kleinen Insider Wind bekommen hatte, zog sie mich nur noch damit auf. Sagte, ich sei verrückt nach der Musik, Josh sei verrückt nach mir, ich würde durch seine Musik angetrieben werden, doch wir würden uns auf diese Weise immer nur im Kreis drehen – niemals zueinanderfinden.
Kati verstand nicht, was die Musik für mich war. Musik war für mich alles, was ich an Gefühlen niemals zulassen könnte. Sie war für mich wie aus einer anderen Dimension. Eine Dimension, die mit dem einfachen Leben auf der Erde nichts zu tun hatte. Sie war für mich eine Möglichkeit, in die Vergangenheit einzutauchen, wenn ich es wollte, aber auch, mich von ihr abzukapseln, wenn ich es wollte. Ich konnte mich durch die Musik von allem abkapseln, wenn ich wollte. Von jedem. Josh verstand das. Josh verstand viel mehr, als ich immer geglaubt hatte. Josh verstand wahrscheinlich mein gesamtes Inneres viel besser, als ich es selbst je verstehen würde. Wir drehten uns, ja. Aber wir drehten uns einander zu. Der kleine Spalt, der dem Kreis zu seiner Vollkommenheit fehlte, war gerade dabei, sich zu schließen.
Ich hatte die Playlist vor einiger Zeit in Restless Musician umbenannt und ihm einen Screenshot davon geschickt. Als Antwort schickte er mir ein grünes Herz-Emoji. Herz war gut. Grünes Herz bedeutete: Wir waren Freunde. Nur Freunde.
Ich bewunderte meinen besten Freund sehr. Er arrangierte unsere Stücke, experimentierte gern mit Adaptationen von Klassikern und machte die Musik zu unserer Musik. Er kannte sich mit Abstand am besten von uns aus, hatte auf seiner Geige bereits mit dreizehn Jahren an Bundeswettbewerben von Jugendmusiziert teilgenommen und war unter den Musikschullehrkräften in unserer Region seit Langem als Nachwuchskünstler bekannt.
Für Josh war es schon immer klar gewesen, dass er Musik studieren würde. Ich dagegen hatte mir lange Zeit gar keine Gedanken gemacht, was ich nach der Schulzeit machen wollte. Aber er hatte gemeint, ich solle es auch mit der Aufnahmeprüfung versuchen, schaden könne es nicht. Meine Mutter war ebenfalls immer der vollen Überzeugung gewesen, dass ich das Zeug dazu hatte, wie sie immer gesagt hatte. Und siehe da – ich hatte sogar bestanden. Also würde ich ab Oktober Englisch und Musik auf Lehramt studieren.
Erst klang mir das nach einer vernünftigen Zukunftsgestaltung, aber je näher das Studium rückte, desto unsicherer wurde ich, ob es wirklich das Richtige für mich war. Musikstudium? Ich? Ilka? Die, die sich beim Musizieren so oft in einem Drahtseilakt zwischen Anspannung und freiem Fall befand? Zwischen Gefühlen wie Leichtigkeit und Lebenslust, die ich kaum wagte, zuzulassen, um nicht den Sturz ins Leere zu riskieren. Dorthin, wo sehr wahrscheinlich Schmerz und Trauer warteten.
Das Ensemble hatte mir gezeigt, dass Musik mehr bewirken konnte als Leere. Und das, obwohl wir alle so unterschiedlich waren, wie wir nur sein konnten. Aber vielleicht war es genau das, was unsere Musik zu dem machte, was sie war: einzigartig. Wertvoll. Fragil in ihrem Klang und mächtig in ihrer Resonanz.
Jetzt lief ein Song von Bleachers. Die Band hatte Josh mir kurz nach Ostern gezeigt. Wir hatten in seinem Garten die Reste des Karottenkuchens gegessen, die noch von seiner Familienfeier übriggeblieben waren, und den ganzen Nachmittag sämtliche Alben der Band rauf und runter gehört. Joshs kleine Geschwister hatten schon die ganzen Marzipan-Möhrchen heruntergepult, auf jedem Stück war ein Loch gewesen sowie kleine Fingerabdrücke auf der Zuckergussglasur. Er hatte mit ihnen geschimpft, weil er mir versprochen hatte, dass es Karottenkuchen geben würde, und es jetzt ja nur noch der halbe Spaß sei. Ich hatte ihn beschwichtigt und ihm versprochen, dass ich bald einen Karottenkuchen backen würde, den wir dann allein essen könnten. Wochenlang hatte er mich damit genervt, diesen Kuchen zu backen, doch ich war standhaft geblieben, wenngleich ich damit einfach nur bezwecken wollte, dass er weiterhin allein deswegen mit mir flirtete. Nein, auch Muffins mit Marzipan-Möhrchen obendrauf würde es nicht geben, nicht einfach so, ohne Anlass. Ob er denn nicht wisse, wie viel Arbeit das sei. Er machte immerzu seinen niedlichen Schmollmund, mit dem er aussah wie ein kleiner Junge, und jedes Mal vergaß ich für einen Moment, dass wir mittlerweile eigentlich schon achtzehn waren. Erwachsen. Ende des Jahres sogar schon neunzehn. Wie die Zeit verging.
Lange wollte ich nichts lieber, als endlich erwachsen sein. Achtzehn klang für mich immer so unglaublich reif. Nun war ich bereits seit einigen Monaten achtzehn und so richtig hatte sich nichts verändert. Im Gegenteil, ich fühlte mich auf einmal hilfloser und unselbstständiger denn je.
Carpe diem!, dachte ich. Genau. Ich würde zum Markt gehen, und ihm einfach so, ganz ohne Anlass, einen Karottenkuchen backen. Ich bewertete diese Entscheidung als sehr erwachsen und sehr selbstständig.
Um kurz nach halb elf verließ ich das Haus und spürte, dass der Sommer endgültig angekommen sein musste. Wärme ummantelte meinen Körper, die Sonnenstrahlen kitzelten auf meinem Gesicht. Schon bald würden sich meine Sommersprossen vervielfachen. Von dem Regen des Vortags war keine Spur mehr. Die wenigen Menschen, die mir entgegenkamen, wirkten ausgelassen und freuten sich sicher auf den bevorstehenden Sommer, der vielversprechend wirkte. Leichtigkeit lag in der Luft. Ich stöpselte mir die Kopfhörer in die Ohren, Birdy sang River Song, und ich ließ mich mitreißen.
Depressionen veränderten Menschen, sagte man. Aber was, wenn man über Jahre hinweg keine Veränderung mehr erlebt hatte? Ich war damit aufgewachsen, dass meine Mutter eben ein wenig anders war als andere Mütter. Dass sie nicht so viel mit mir unternahm, nicht so viel lachte, und dass es immer mal wieder Zeiten gab, in denen sie nicht mal mehr mit mir sprach. Manchmal war das in Ordnung gewesen, denn ich war auch gern allein. Doch manchmal war ich wütend gewesen und hatte es nicht verstanden, warum sie von dem einen auf den anderen Tag so tat, als gäbe es mich nicht.
Irgendwann verstand ich, dass das nichts mit mir zu tun hatte, sondern dass es ihre Krankheit war, die sie von innen heraus auffraß. So hatte es mir eine Frau mit krausem grauem Haar und einer dicken grünen Brille damals erklärt. Die Frau hieß Irmgard Poschewski und war damals häufig bei uns gewesen, um mit meiner Mutter in der Küche zu reden. Meist hatte meine Mutter währenddessen und danach sehr viel geweint, weshalb ich lange Zeit dachte, Irmgard Poschewski mit dem krausen grauen Haar und der dicken grünen Brille sei in Wirklichkeit eine Hexe, die versuchte, meine Mutter vom Bösen zu überzeugen. Ich fand damals, dass Irmgard sehr nach Hexe klang, aber als ich meine Mutter mal gefragt hatte, ob meine Vermutung stimmte, hatte sie nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass Frau Poschewski eine sehr nette Frau sei, die ihr helfen würde, dass es ihr besser ginge. Wie eine Ärztin, erklärte mir meine Mutter damals. So richtig wollte ich das nicht glauben, also lauschte ich manchmal an der Küchentür – ich hatte nie viel verstanden. Vielleicht sprachen Hexen eine andere Sprache, dachte ich, wenn sie andere überzeugen wollten, auch eine Hexe zu werden. Doch ich wusste, dass sich meine Mutter niemals vom Bösen überzeugen lassen würde. Sie war vielleicht oft traurig, aber sie würde niemals eine Hexe werden.
Irmgard Poschewski kam irgendwann nicht mehr zu uns nach Hause, und als ich meine Mutter fragte, warum die Hexe nicht mehr mit ihr in der Küche redete, sagte sie, dass sie sie nicht mehr brauche. Sie sei jetzt wieder gesund. Auch das glaubte ich ihr nicht, denn das Weinen hörte nicht auf, im Gegenteil, es wurde immer häufiger. Irgendwann, als ich in die dritte oder vierte Klasse ging, führte ich eine Strichliste darüber, wann und wie oft meine Mutter weinte. Irgendwann verlor ich den Überblick über die Striche.
Ich ließ meinen Blick über das frische Gemüse wandern, als sei ich kurz davor, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen.
„Was möchten wir, junge Frau?“, sprach mich die stämmige Marktverkäuferin mit ihrer lauten Singsang-Stimme an und riss nicht nur eine Plastiktüte von dem Haken, um mir meinen Wunsch schnellstmöglich zu erfüllen, sondern mich ebenfalls aus meinen Gedanken. Normalerweise hätte ich beide Kopfhörer aus den Ohren genommen, doch heute hielt ich es nicht aus, ganz ohne die Musik. Und so brummte der Hummelflug von Rimski-Korsakow in meinem linken Ohr weiter, während ich meine Hand hob, um ihr zu signalisieren, dass ich einen Stoffbeutel dabeihatte, die Tüte also nicht brauchte.
„Aaaalles klar, die Jugend denkt nachhaltig, das gefällt mir. Suchen wir das Sommerglück?“, sang sie weiter und schaute sich geschäftig um, ob auch andere Kunden sie gehört hatten.
„Haben Sie Karotten aus der Region?“, fragte ich und ging nicht auf ihren Kommentar ein. Das Glück suchte ich lieber anderswo, entschied ich spontan.
„Die sind weg, da sind Sie zu spät, junge Frau. Karotten aus den Niederlanden tun es sicher auch. Schön knackig, o ja. Können wir da einen Kompromiss finden?“ Die Marktverkäuferin wirkte, als verwende sie gern Worte, die nach etwas Großem klangen, auch wenn sie nicht ganz in die Situation passten.
„Klar, dann nehme ich die da, bitte ohne das Grün.“ Mir war an diesem Morgen nicht nach großen Worten. Ich zeigte auf ein Bund Karotten, von dem ich dachte, dass es sich gut in dem Kuchen machte, bezahlte, bedankte mich und entschied, mich dem Getümmel zu entziehen und auf direktem Weg nach Hause zu gehen. Mit knurrendem Magen, der sich durch die Gerüche von frischem Brot, Gewürzen und Oliven angesprochen fühlte, steuerte ich auf unebenen Pflastersteinen meinen Weg Richtung Supermarkt an, wo ich die Marzipan-Möhrchen und die restlichen Zutaten für den Kuchen kaufen würde. Im Ohr nun Bach, Suite No.1, G-Dur Präludium, in der Hand den Beutel mit den Kompromisskarotten.
Plötzlich vibrierte mein Handy und rutschte auf der mehligen Arbeitsfläche hin und her. Mich rief nie jemand an. Ich hasste Telefonieren. Eine unbekannte Nummer. Klopfenden Herzens nahm das Gespräch an.
Ich fasste es nicht. Ich musste mich kurz kneifen, nachdem ich mein Handy wieder auf den Tisch gelegt hatte. Die Sekretärin der Celloprofessorin, bei der ich die Aufnahmeprüfung für die Hochschule gemacht hatte, hatte mich soeben gefragt, ob ich in der Orientierungswoche mit drei weiteren Erstsemesterstudierenden an ihrem Workshop zu Pablo Casals teilnehmen wollte. Ich hätte seit der Aufnahmeprüfung in der engeren Auswahl gestanden, und nun hätten sie sich endgültig für mich entschieden. Sie würde mir in den kommenden Tagen die Literatur zuschicken, die ich bis Mitte September vorbereiten sollte.
Ich hatte es mir von der Sekretärin dreimal erklären lassen, weil ich die ersten beiden Male vor Aufregung nicht richtig zugehört hatte. Pablo Casals, mein Lieblingscellist, von dem sogar eine illustrierte Biografie in meinem Regal stand. Meine Mutter hatte mir versprochen, irgendwann mit mir nach Barcelona zu fliegen, um auf den Spuren des Künstlers die Stadt zu erkunden. Unser Traum war nie in Erfüllung gegangen.
Ein Workshop zu viert bei der anerkanntesten Celloprofessorin der Hochschule. Ich würde Menschen kennenlernen, die ebenfalls Cello spielten. Menschen, die meine Leidenschaft teilten.
Mit einem riesigen Grinsen im Gesicht verzierte ich den Kuchen und drückte die Marzipan-Möhrchen so tief in den Kuchen, dass der Zuckerguss an den Seiten nach oben quetschte. So tief, dass keine Kinderhände sie herauspulen könnten.
Als ich in Joshs Straße einbog, hörte ich bereits seine Geschwister im Garten toben. Ich wollte gerade durch das offene Tor laufen, da kam er auch schon durch die Haustür gestürmt. Wir hatten nicht ausgemacht, wie wir den Tag miteinander verbringen würden. Mit Josh war das auch nicht nötig. Wir planten selten unsere Treffen, meistens ergab sich irgendwas.
„Lass mich raten, du hast was von Bleachers gehört“, sagte er grinsend, als er unter die Alufolie meiner Kuchenform blickte.
„Richtig!“ Ich freute mich, dass er sich noch an den Tag damals erinnerte.
„Yes! Ein Punkt für mich! Gibt’s denn was zu feiern?“, fragte er neugierig.
„Nein, ich hatte einfach Lust auf Kuchen.“
„Perfekt. Dann lass uns noch ’ne Limo holen und wir setzen uns an den Fluss, okay?“
Josh trug wie immer, ein Hemd und seine altmodische Schiebermütze. Ich fand, mit seinem Kleidungsstil könnte er genauso gut aus einem Film entstammen, der Anfang des letzten Jahrhunderts spielte. Ich liebte diesen Stil an ihm. Er hatte sich nie etwas daraus gemacht, was andere von ihm dachten. Josh hatte eine Ausstrahlung, die für drei Personen gereicht hätte, ohne dabei arrogant zu wirken.
Mir fiel auf, dass ich mir bei meinem Outfit eigentlich nicht sonderlich viel Mühe gegeben hatte. Ich trug eine Jeans, hochgekrempelt bis über die Knöchel, Ringelsocken guckten in ungleicher Höhe aus meinen ausgeleierten Sneakers. Dazu ein einfaches kakifarbenes T-Shirt, meine Zöpfe hatte ich gestern Abend vor dem Schlafengehen schon geflochten, und ich war mir sicher, dass einige Locken bereits herauszufallen drohten.
„Ist dir nicht warm mit der Mütze?“, fragte ich ihn, als wir losliefen, und ich davon abzulenken versuchte, dass er es mal wieder geschafft hatte, mich mit seiner bloßen Existenz zu beeindrucken.
„Die passt so gut zu meinem Hemd, findest du nicht?“ Arrogant nicht. Eitel vielleicht.
„Das beantwortet nicht meine Frage“, neckte ich ihn.
„Sie schützt mich vor der Sonne.“ Er zeigte nach oben, wo diese hing, ohne sich den Himmel auch nur mit einer Wolke teilen zu müssen. „Bevor wir Kuchen essen, muss ich dir was sagen.“
„Oh-oh“, machte ich. „Das klingt nach einem ernsten Gespräch.“ Dann lachte ich, um meine Angst zu überspielen. Insgeheim hoffte ich, dass er mir nicht von seinem Stipendium in Wien erzählen würde. Ich hatte mich mental noch nicht darauf vorbereitet, wie ich reagieren könnte.
Er schaute mich verschmitzt von der Seite an. „Warte ab.“
„Okay, dann muss ich dir vielleicht auch was sagen.“ Früher oder später würde ich ihm das mit dem Workshopangebot sowieso erzählen. Ich hasste es, Dinge geheim zu halten.
Also holten wir uns eine Limonade – ich wie immer Minze-Zitrone, er wie immer Rhabarber – und setzten uns in den Schatten einer Kastanie ans Flussufer. Wir tranken wie immer den ersten Schluck aus der Flasche des jeweils anderen, nur um dann zu sagen, dass wir froh waren, die jeweils eigene Limo ausgesucht zu haben. Ich liebte diese kleinen Eigenheiten, die sich in den letzten zwei Jahren zwischen uns etabliert hatten. Und ich freute mich, dass ich sie wieder zuließ, sogar immer mehr Freude an ihnen fand, während das letzte halbe Jahr von so viel Trauer überschattet gewesen war.
Doch Josh hatte es gerade durch das Auflebenlassen dieser kleinen Eigenheiten geschafft, dass ich wieder mehr und mehr in den Alltag zurückfand. Wir hatten uns in der Zeit nach dem Tod meiner Mutter fast jeden Tag gesehen. Manchmal hatte ich ihn angerufen, ob er vorbeikommen könne, ich könne nicht gut allein sein. Er war immer sofort gekommen, aber es geschah nicht selten, dass ich ihn kurz darauf wieder wegschicken musste, weil ich es nicht ausgehalten hatte, dass jemand da war. Er ließ es mit sich machen. Manchmal drei, vier Tage hintereinander, immer dasselbe. Er war geduldig gewesen, war da, wenn ich ihn gebraucht hatte. Manchmal hatten wir nächtelang durchgeredet. Niemals über das, was geschehen war. Immer über Belangloses. Belangloses war gut. Lenkte ab. Half.
Manchmal hatten wir auch tagelang geschwiegen. Das half ebenfalls. Er ersetzte meine Mutter nicht, niemand konnte das. Aber er war bedingungslos da. Ich konnte manchmal gar nicht fassen, was für ein Glück ich mit meinem besten Freund hatte. Das, was wir teilten, war nicht selbstverständlich. Das, was sich zwischen uns entwickelt hatte, war keine Freundschaft mehr, es war Liebe. Wenngleich auf geschwisterlicher Ebene. Er wurde der Bruder, den ich nie hatte, ein Teil meiner Familie.
Worüber wir ebenfalls nie gesprochen hatten, war, wie sich unsere Beziehung entwickelt hatte. Ich wollte nicht darüber reden, weil ich dann hätte sagen müssen, dass es meiner Mutter zu verdanken war. Ich wüsste, dass er sagen würde, dass sich unsere Freundschaft auch ohne den Tod meiner Mutter so entwickelt hätte, aber wir wüssten beide, dass das nicht stimmte. Also sprachen wir nicht darüber.
„Du zuerst. Was gibt’s?“, fragte ich, nachdem ich bei dem Schluck Rhababerlimonade das Gesicht verzogen und schnell mit einem Schluck Minze-Zitrone nachgespült hatte.
„Also.“ Auf einmal wirkte er ernst. Nicht Wien. Bitte nicht Wien. „Ich weiß, dass du eigentlich diesen Sommer nicht wegfahren willst …“ Vorsichtig schaute er unter seiner Schiebermütze hervor.
„Josh … versuch bitte nicht schon wieder, mich zu überreden.“ In mir machte sich ein unwohles Gefühl bemerkbar. Ich hatte ihm schon so oft erklärt, dass ich den Sommer zum Arbeiten nutzen musste, ein Urlaub also nicht drin war. Das Geld des BAföG-Amts würde für den Umzug, den Semesterbeitrag und erste Bücher nicht ausreichen. Der Workshop im September bedeutete außerdem Üben, Üben, Üben. Doch das zu erzählen, erhöhte die Chance, dass er mir von Wien erzählte.
„Wir fahren ans Meer. Zu meiner Tante“, sagte er, immer noch vorsichtig, mit einer Stimme so ruhig, als habe er Angst, etwas kaputt zu machen.
Meer. Von seiner Tante Aurelia hatte er mir schon oft erzählt. Sie hatte vor einigen Jahren ein Haus an der Nordsee gekauft, auf einem riesigen, verwilderten Grundstück. Ein Eurograb, wie seine Eltern immer schimpften.
„Wer ist wir?“, fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits wusste.
„Wir wollen unser Repertoire aufnehmen. Maik bringt sein ganzes Equipment mit.“
Ich schaute weg. Es war also fix, die anderen würden auf jeden Fall fahren. Ohne mich. Hatten sie gemeinsam überlegt, dass Josh mich überreden sollte? Hatten sie gemeinsam überlegt, wer die besten Chancen hatte? Oder war es lediglich Josh, und nicht den anderen, wichtig, dass ich mitkam?
„Wenn du nicht mitkommst, muss er ein Sample verwenden.“ Und als hätte er meine Gedanken gelesen, fügte er hinzu: „Ich würde mich echt freuen, wenn du dabei wärest“, schaute mich dabei jedoch nicht an. Ich war mir nicht sicher, ob es das erste oder zweite Argument war, das tendenziell mehr Chancen hatte, mich zu überzeugen. Aber nein. Ich konnte nicht. Ich zählte innerlich bis drei und berichtete ihm dann von dem Telefonat mit der Sekretärin von Professor Hertel.
„Die Hertel? Du meinst Frau Professor Doktor Ludmilla Hertel?“
„Hmm ja“, sagte ich gedankenverloren.
„Das ist ja nice! Herzlichen Glückwunsch.“ Er strahlte übers ganze Gesicht. „Darauf erst mal ein Stück Kuchen, oder?“ Josh schnitt den Kuchen mit dem Messer in Stücke, das ich ins Gras gelegt hatte.
„Ihr müsst allein fahren.“ Meine Bauchschmerzen wurden heftiger. Auf einmal hatte ich keine Lust mehr auf Kuchen. Ich wollte nicht auf den Sommer am Meer verzichten, aber so kurz vor dem Studium das Workshopangebot abzulehnen, war unmöglich. Gleichzeitig wusste ich nicht, wie ich überhaupt mit dem Studium beginnen sollte, wenn mir so viel Geld fehlte.
„Dann übst du eben bei Aurelia“, sagte er entschieden, den Mund voller Krümel. Wahrscheinlich hatte ich den letzten Gedanken laut ausgesprochen. Ich schüttelte den Kopf. Für ihn war anscheinend immer alles so einfach zu lösen. „Du übst, ich coache dich. Zwischen all den Aufnahmen haben wir bestimmt mal Lust auf etwas Abwechslung.“
„Josh, du weißt ganz genau, dass ich nicht so schnell bin mit neuer Literatur. Für dich mag das einfach sein, du übst mal eben zwischen den Aufnahmen – du müsstest wahrscheinlich gar nicht üben, und alles wäre perfekt.“ Es klang bissiger, als ich es beabsichtigt hatte. Dass es übertrieben war, wussten wir beide. Auch Josh musste üben, aber längst nicht so viel wie ich. Trotzdem. Vier Wochen brauchte ich mindestens. Ich wollte mich nicht direkt in der Ersti-Woche blamieren.
„Ilka.“ Er legte seine Hand auf meine. Warm war sie. Und groß. Meine sah darunter aus wie die eines Kindes. „Wirklich, wir unterstützen dich dabei. Jeden Tag ein wenig Üben, jeden Tag ein wenig Aufnehmen, jeden Tag ein wenig Strand, jeden Tag ein wenig Abenteuer.“ Josh lächelte mich an. Ich schüttelte den Kopf. Er redete einfach weiter: „Ich habe heute Morgen mit Aurelia telefoniert. Sie will diesen Sommer ihr Dach ausbauen, um sich eine Art Yogatempel zu gestalten. Wir sollen ihr dabei helfen.“ Er rümpfte die Nase und sagte mit gleichgültigem Tonfall: „Das heißt, wenn du nicht mitkommst, werden wir uns erst mal eine Weile nicht sehen, fürchte ich. Dann bist du hier allein, und keiner von uns kann dir beim Üben helfen.“
Aha. Er nutzte nun andere Mittel. „Das ist Erpressung.“ Ich musste schmunzeln.
„Nö. Ich erläutere nur die Fakten.“ Josh setzte sein unschuldiges Lächeln auf, bei dem ich unwillkürlich grinsen musste. Aber was bedeutete eine Weile?
Mein Grinsen verschwand. „Hm. Das heißt, ihr bleibt länger bei Aurelia?“
„Bis Ende der letzten Augustwoche“, sagte er, als würde es auch daran nichts mehr zu rütteln geben. Schnell rechnete ich im Kopf nach. Sechs Wochen, wenn sie kommende Woche wegfahren würden. Ein Monat und zwei Wochen. Sechs Wochen ohne das Ensemble. Sechs Wochen ohne gemeinsame Musik. Sechs Wochen ohne ihn.
„Okay“, sagte ich.
„Okay, du kommst mit?“ Er strahlte und rettete noch so gerade eben einen Krümel vor dem Fall aus seinem Mund.
„Nein. Okay, dass ihr so lange wegfahrt.“
Wir beobachteten eine Weile eine Entenfamilie, deren Mitglieder auf dem Fluss alle brav hintereinander herschwammen. „Und ihr sollt Aurelia jetzt helfen, ihren Yogatempel zu gestalten?“, fragte ich, nachdem sie im Schilf verschwunden waren.
„Na ja, wir sollen ihr helfen, das Dach auszubauen. Dafür dürfen wir kostenlos bei ihr wohnen. Und das Wohnzimmer als Studio umfunktionieren. Ich fürchte, das ist beinahe wieder ein Punkt für mich. Kostenlose Unterkunft, Ilka!“
Ich schaute ihn mit großen Augen an, ignorierte das Spiel mit den Punkten, keine Ahnung, wie er überhaupt darauf gekommen war. Wenn ich mir auch nur vorstellte, wie irgendwer von uns auf einem Dach herumkletterte, wurde mir ganz schwindelig. Er schien meine Sorge förmlich zu spüren, denn er sagte schnell: „Wird easy, Aurelia hat gesagt, ein gewisser Alfred würde ihr helfen. Ich glaube, meine Tante ist ein bisschen verliebt. Das könnte doch lustig werden, was meinst du?“
„Josh, gerade kommen zig Sachen zusammen. Du weißt, dass ich arbeiten muss. Ich brauche das Geld. Ich hab mir das mit dem Studienanfang auch leichter vorgestellt, aber da kommen so viele Kosten auf mich zu. Und das mit dem Workshop bei Frau Professor Hertel hat mich heute Morgen ehrlich gesagt komplett rausgerissen. Ich weiß mittlerweile nicht mal mehr, ob ich mich noch darüber freuen soll oder nicht.“
„Die von deinem Job haben sich doch noch gar nicht gemeldet!“ Typisch Josh. Der Rationale. Wenn es darum ging, mich von etwas zu überzeugen, schaute er nur auf die Fakten und ignorierte alles emotional Aufgeladene. Manchmal hasste ich ihn dafür. Aber er hatte recht. Seit Wochen wartete ich auf eine Antwort von der Stadtbibliothek, die einen Ferienjob ausgeschrieben hatte.
„Sie melden sich schon noch. Ich glaube nicht, dass sich viele beworben haben. Ich hab bestimmt gute Chancen.“ Ich nahm einen Schluck aus meiner Limonade und versuchte danach, die Falsche auf meinem Knie zu balancieren.
„Und was, wenn …“ Er richtete sich auf, kramte in seinem Rucksack, zog sein Handy heraus und wischte kurz auf ihm herum. „Hier.“ Stolz hielt er es mir vors Gesicht, das E-Mail-Postfach geöffnet. „Ferienjob. Am Meer.“ Seine Augen leuchteten auf.
„Was?“ Ich nahm ihm sein Handy aus der Hand und überflog die Nachricht. Viel verstand ich nicht, denn er redete ununterbrochen weiter:
„Mail von Aurelia. Ich hab sie mal gefragt, ob es bei ihr in der Nähe irgendwas gibt, wo du arbeiten kannst. Buchhandel, Imbissbude, Souvenirladen … sowas in der Art. Und dieser Alfred, von dem ich dir erzählt habe, braucht genau in der Zeit, wenn wir da sind, eine Aushilfe für seine Strandbar. Zwanzig Stunden die Woche. Das ist machbar neben der Musik und neben ein bisschen Urlaub mit mir und den anderen. Guck.“ Er zeigte auf den letzten Abschnitt der Mail. „Zehn Euro siebenundfünfzig die Stunde. Plus Trinkgeld. Und ein Cocktail pro Abend geht aufs Haus.“
„Ich trinke keinen Alkohol.“
„Macht nichts, dann gib ihn halt Charlotte oder mir. Ilka, ich mein’s ernst. So eine Möglichkeit bekommst du nicht nochmal.“
„Warum willst du unbedingt, dass ich mitkomme?“ Ich gab ihm sein Handy zurück, meine Hände wurden irgendwie ganz schwitzig.
Er zuckte die Schultern. „Ich will den Sommer mit dir verbringen. Nichts weiter.“ Josh machte eine Pause. Ein wenig zu lang, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. „Du hast fast keine Wahl, ich sehe doch, wie gern du mit ans Meer fahren würdest.“ Er lachte und trank einen großen Schluck seiner Limo.
„Und was ist, wenn ich gar nicht will? Was ist, wenn ich den gesamten Sommer hier in der Kleinstadt verbringen, Cello üben, Bücher sortieren und darauf warten will, dass im Herbst endlich das Studium beginnt?“ Ich musste unwillkürlich über mich selbst lachen. Das war wirklich nicht die schönste Aussicht auf den letzten Sommer vor Beginn des Studiums. Null Punkte in Sachen Pokerface. Er nahm einen meiner Zöpfe und kitzelte damit meine Nase.
„Merkste selbst, oder?“ Sein Grinsen wurde breiter.
„Aber wie stellst du dir das vor? Wir wollen Urlaub machen und ich soll üben und arbeiten? Gleichzeitig?“
„Das kriegen wir schon hin.“
„Warum kommst du damit außerdem erst jetzt um die Ecke?“
„Das war mein Ass im Ärmel.“ Er sah mich schelmisch an. „Und ich fürchte, das ist schon wieder ein Punkt für mich. Damit wären wir bei drei zu null.“ Josh riss die Arme in die Luft und stieß mit seinem Knie fast meine Limonade um, die ich zwischen zwei Grasbüschel gestellt hatte, weil sie auf meinem Knie nicht standhielt. Und nachdem wir eine Weile auf die wandernden Wellen im Fluss geblickt hatten, sagte er: „Warte nur ab, das wird unser Sommer.“
Das kam unerwartet. Genauso das kurze Kribbeln in meinem Unterbauch, höchstens eine Millisekunde, aber es war da. Er sah mich an, konnte den Blick nicht halten, schaute wieder auf den Fluss und murmelte unbeholfen: „Na ja, also, es sei denn, du willst wirklich gar nicht.“
„Doch“, sagte ich. „Du weißt ganz genau, dass ich will. Das macht es mir so schwer.“
„Dann mache ich es dir einfacher“, sagte er und küsste mich blitzschnell auf die Wange.
„Was war das denn?“ Ich war mir nicht sicher, ob ich belustigt oder empört sein sollte. Als er verschmitzt unter seiner Schiebermütze hervorlugte, konnte ich mein Lächeln nicht mehr verbergen. „Na gut, ich überlegs mir, ja? Aber noch hast du nicht gewonnen, trotz drei Punkten Vorsprung“, sagte ich und versuchte, ihm seine Illusion zu stehlen. Endlich nahm auch ich mir ein Stück Kuchen.
Wir hatten uns ins Gras gelegt und in die Krone des Kastanienbaums geschaut, in der das Licht durch die Lücken zwischen den Blättern zu uns nach unten kletterte.
Ein Sommer am Meer? Nicht nur für eine Woche, sondern direkt für über einen Monat. Das klang viel zu sehr nach einem Buch oder einem Film. Ein Sommer am Meer mit einer Person, die potenziell jemand war, für den sich gerade Gefühle entwickelten? Too good to be true, wie Josh immer sagte, wenn er geflasht von etwas war. Ich erwischte mich dabei, wie ich mich eigentlich innerlich schon entschieden hatte, mitzufahren. Doch ich sagte ihm nichts davon. Ich wollte diese Gedanken erst einmal in meiner eigenen Vorstellung real werden lassen. Vielleicht spielte auch mit herein, dass ich ihn einfach nicht so schnell gewinnen lassen wollte.
Und wie ich so in die raschelnde Kastanie schaute, träumte ich vor mich hin, wie wir am Meer entlangliefen und uns zwischen die Dünen setzten, Limo tranken und uns ganz vielleicht ja sogar trauten, zuzugeben, dass da mehr war. Mehr als was eigentlich? Ging mehr eigentlich noch? Am Meer vielleicht.
3
Wir parkten die Autos am Hafen und liefen am Pier vorbei, hinunter zum Meer. Josh und ich hatten gewettet, ob Ebbe oder Flut sein würde. Er hatte gewonnen. Das graubraune Wasser schäumte dort, wo es den Sandstrand berührte und hinterließ einen unebenen Saum. Schäumendes Wasser, das kalt und rau an meinen Füßen kitzelte und mir bewies, dass ich wirklich da war. Ich war am Meer.
Gräuliche Wellen stießen in unregelmäßigen Abständen an den Pier. Uns umgab salzige Luft und Möwengeschrei. Die Luft kratzte in meiner Nase. Für einen Vormittag Mitte Juli war es erstaunlich kühl. Ich fuhr mit der Zunge über meinen Mund und schmeckte Salz auf meiner Oberlippe. Wenn ich diesen Vorgang noch ein paarmal wiederholen würde, würde ich es bald bereuen, keinen Lippenbalsam eingesteckt zu haben. Ich schloss für einen Moment die Augen und atmete tief ein. Schon bald verschwammen die Stimmen der wenigen Strandbesucher mit meinen Gedanken, und meine Gedanken mit dem Rauschen der Wellen.
Ich erinnerte mich, wie meine Mutter mal erzählt hatte, dass das Meer das Einzige sei, was sie trösten könne. Sie sagte, es hätte diese Gabe zu trösten, trotz des Schmerzes, den es in sich aufnehmen musste, wie niemand sonst es konnte. Doch das Meer rächte sich auch. Immer dann, wenn man es nicht erwartete. Und dann war es zerstörerisch, gnadenlos, verräterisch. Diese Geschichten hatten mir als Kind immer Angst gemacht. Ich fand, es klang bedrohlich. Meine Mutter war nie mit mir ans Meer gefahren. Und nun stand ich davor, das erste Mal in meinem Leben, und fragte mich, wie viel ich eigentlich in den vergangenen Jahren verpasst hatte.





























