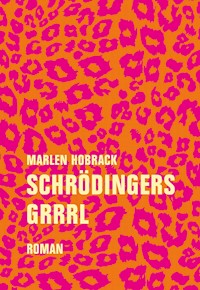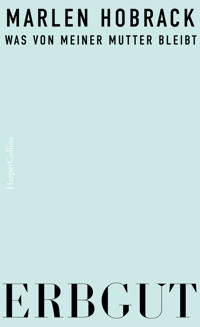Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von arbeitenden Frauen, Fallschirmmüttern und Mittelschichtsfeministinnen – Marlen Hobrack formuliert die Klassenfrage aus weiblicher Perspektive radikal neu.
Die Wäschekörbe waren immer voll – nicht mit Wäsche, sondern mit unbezahlten Rechnungen, die ihre Mutter trotz harter Arbeit nicht pünktlich bezahlen konnte. Wenn Marlen Hobrack an ihre Kindheit in Armut in einem bildungsfernen Haushalt denkt, stellt sie immer wieder fest, wie wenig ihr Aufwachsen mit den Herkunftserzählungen der Mittelschicht gemeinsam hat, zu der sie als erfolgreiche Journalistin zählt. Aber gehört sie als Grenzgängerin zwischen den Klassen wirklich dazu? Als alleinerziehende Ostdeutsche, die mit 19 Mutter wurde?
Prägnant und erhellend räumt "Klassenbeste" mit Mittelklassemythen von Chancengleichheit und sozialem Aufstieg auf – und zeigt, dass jede identitätspolitische Debatte im Kern eine Klassenfrage ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Von arbeitenden Frauen, Fallschirmmüttern und Mittelschichtsfeministinnen — Marlen Hobrack formuliert die Klassenfrage aus weiblicher Perspektive radikal neu. Die Wäschekörbe waren immer voll — nicht mit Wäsche, sondern mit unbezahlten Rechnungen, die ihre Mutter trotz harter Arbeit nicht pünktlich bezahlen konnte. Wenn Marlen Hobrack an ihre Kindheit in Armut in einem bildungsfernen Haushalt denkt, stellt sie immer wieder fest, wie wenig ihr Aufwachsen mit den Herkunftserzählungen der Mittelschicht gemeinsam hat, zu der sie als erfolgreiche Journalistin zählt. Aber gehört sie als Grenzgängerin zwischen den Klassen wirklich dazu? Als alleinerziehende Ostdeutsche, die mit 19 Mutter wurde?Prägnant und erhellend räumt »Klassenbeste« mit Mittelklassemythen von Chancengleichheit und sozialem Aufstieg auf — und zeigt, dass jede identitätspolitische Debatte im Kern eine Klassenfrage ist.
Marlen Hobrack
Klassenbeste
Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet
Hanser Berlin
Für meine Mutter
Arbeit ist die wärmste Jacke. Sie steht nur nicht jedem.
Volksweisheit
Einleitung
Ich stamme aus einem bildungsfernen Elternhaus. So nennt man das soziologisch steif. Mein Vater verließ die Schule nach der achten Klasse und blieb sein Leben lang ein ungelernter Arbeiter, der mal als Umzugshelfer, mal als LKW-Fahrer arbeitete. Meine Mutter verließ die Schule nach der neunten Klasse. Sie brachte es von der Fleischereifachverkäuferin zur Sachbearbeiterin, wurde schließlich verbeamtet und arbeitete insgesamt fünfundzwanzig Jahre lang in einer Justizvollzugsanstalt. Meine beiden Geschwister und ich machten Abitur, studierten und rückten mit unseren Berufen als Pflegeheimleiterin, Lehrer und Journalistin in die Mitte der Gesellschaft.
Unsere Geschichte klingt wie die Einlösung des meritokratischen Versprechens der bürgerlichen Gesellschaft: Arbeite hart, streng dich an, dann wirst du es zu etwas bringen. Doch dieser unerhörte Klassenwechsel ereignete sich in einer historischen Ausnahmesituation: den Nachwendejahren. Alte staatliche Hemmnisse, die den Zugang zur höheren Bildung erschwert hatten, etwa die Kopplung der Studienzulassung an Staatstreue und Armeeverpflichtung, waren durch die Wiedervereinigung beseitigt worden. Zugleich konkurrierten Mittelschichtseltern und Bildungsferne noch nicht um den Zugang zum Gymnasium, einem wichtigen Garanten für den Klassenerhalt oder -aufstieg der Kinder. Das System war für kurze Zeit offen. Bald würden sich auch im ehemaligen »Arbeiter-und-Bauern-Staat« und dem nunmehr neuen Teil der Bundesrepublik die Klassenverhältnisse verfestigen — und das bedeutet konkret, dass der Bildungserfolg der Kinder wesentlich vom Status und Bildungshintergrund der Eltern abhängt.
Das Erzählen über Klasse hat Hochkonjunktur. In den letzten Jahren erschien eine recht lange Liste mal biografisch, mal analytisch eingefärbter Bücher auf dem europäischen Buchmarkt. Christian Baron, Didier Eribon, Édouard Louis oder Darren McGarvey — um nur einige zu nennen — erzählen von Klasse, davon, wie es ist, von ganz unten zu kommen und sich heraufzuarbeiten. Sie zeichnen die feinen Unterschiede auf, wie sie Pierre Bourdieu in seiner gleichnamigen Untersuchung zum Habitus der unterschiedlichen Schichten herausarbeitete,1 die bisweilen schwer in Worte zu fassenden Differenzen. Dabei schaffen sie es, neue, identitätsstiftende Bilder für die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse zu finden.
Die Figur des Arbeiters, zuletzt so gründlich allenfalls in der DDR-Literatur oder der neusachlichen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts beleuchtet, ist plötzlich allgegenwärtig. Doch welche Texte man auch liest, diese Figur ist vor allem eins: männlich. Wenn von Frauen der Arbeiterklasse erzählt wird, dann sind es Frauen von Arbeitern. Diese Frauen haben Anteil am Schicksal der Arbeiterklasse — meist als Opfer ihrer versoffenen, gewalttätigen Arbeitermänner —, aber sie sind in aller Regel nicht Subjekt der Verhandlungen über Klasse.
Nicht nur die Literatur tut sich schwer mit der Erzählung von Arbeiterinnenleben; auch in feministischen Betrachtungen hat die Figur der Arbeiterin einen schweren Stand. Sie kommt zwar in Form der ausländischen Putz- oder Pflegekraft in den Debatten um Care-Arbeit vor; doch sie erscheint in diesen Debatten als mehrfach Marginalisierte. Sie verkörpert als Figur nicht so sehr innergesellschaftliche Konflikte als vielmehr die Verlagerung von Konflikten nach außen. Sie löst als Sozialfigur, als sozialer Typus und Klischeefigur, bei Feministinnen zwar Mitleid oder ein Gefühl von Klassenscham aus, doch sie bleibt in den Darstellungen und Studien ein Opfer der Verhältnisse.
Der Grund für das Fremdeln vieler Feministinnen mit der Figur der Arbeiterin liegt auf der Hand: Es fehlt ein Bild für das, was es bedeutet, eine Arbeiterin zu sein. Es mangelt an konkreten Erzählungen darüber, wie es sich anfühlt, wenn die Funktionen von Produktion und Reproduktion von einem Subjekt und seinem Körper erfüllt werden müssen. Wenn ein Körper Erwerbsarbeit nachgeht und Kinder gebiert. Wenn sich das Subjekt nicht entscheidet zwischen Erwerbstätigkeit und Mutterschaft, sondern sehr selbstverständlich beides lebt.
Weil ich überzeugt bin, dass es Bilder und Geschichten braucht, um über gesellschaftliche Probleme zu sprechen, möchte ich von meiner Mutter erzählen. Ihre Biografie steht stellvertretend für die Biografien all der anderen Frauen, die mich sozialisierten — meiner Tanten, meiner Schwester, der Mütter von Freundinnen und Partnern. Alle sind Frauen, die die ihr Leben lang arbeiteten, und sehr häufig in jenen Berufen, die mit körperlicher Arbeit einhergehen.
Meine Mutter ist heute siebenundsechzig, sie arbeitet, seit sie zwölf war. Das macht fünfundfünfzig Arbeitsjahre. Eine erstaunliche Lebensleistung. Mit viel Fleiß und beeindruckender Resilienz arbeitete sie sich in die Mittelschicht hoch, wurde sogar verbeamtet. Und kehrte schließlich dorthin zurück, wo sie herkam: in die Arbeiterklasse. Seit ihrer Pensionierung arbeitet sie als Putzfrau.
Ziemlich lange druckste ich herum, wenn mich Bekannte fragten, was meine Mutter denn gerade arbeite. Ich hatte Hemmungen, das Wort »Putzfrau« auszusprechen, weil ich fand, dass es ein falsches Bild von ihr vermittelte. Sie arbeitete freiwillig als Putzfrau, sie hätte sich ja auch eine andere Beschäftigung suchen können. Meine Hemmung kommt nicht von ungefähr: Innerhalb unserer sozialen Hierarchie steht die Putzfrau ganz unten. Zumeist nehmen wir sie gar nicht wahr, wollen sie auch nicht wahrnehmen. Mein Unbehagen zu bekennen, welche Tätigkeit meine Mutter ausübt, spiegelt die Mittelschichtsperspektive auf eine ehrenwerte und systemrelevante Tätigkeit wider. Sie ist Klassendünkel.
Eine Biografie lässt sich immer wieder anders erzählen, und so ließe sich auch die Biografie meiner Mutter auf jeweils andere Arten erzählen: als Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen in die Mittelschicht, als Beleg dafür, dass sich harte Arbeit zuletzt auszahlt und dass jeder es zu etwas bringen kann. Ihre Geschichte ließe sich als Aufstieg einer Person erzählen, deren Kinder innerhalb der Mittelschicht weiter aufsteigen konnten, weil ihre Mutter ihnen das Ethos von Leistungsbereitschaft und Arbeitsdisziplin vorlebte. Ihre Geschichte ließe sich als Komödie, als Tragödie oder Farce erzählen. In jedem Fall handelt es sich um eine Geschichte, in der Armut, Arbeit, Gewalt und die Härte der Ereignisse sich immer wieder gegen das Subjekt dieser Geschichte, gegen meine Mutter also, zu verbünden scheinen.
Wir alle sind das Produkt unserer Herkunft, und diese Herkunft ist ein komplexes Gefüge aus Elternhaus, Milieu, Schichtzugehörigkeit, Klasse und der zufälligen zeitlichen Verankerung in einem historischen Abschnitt. Meine Mutter wurde in eine arme, kinderreiche, bildungsferne Familie geboren. Ihre Herkunft prägte ihre Lebensentscheidungen mit einer Selbstverständlichkeit, die nicht ohne Weiteres hinterfragt werden kann.
Herkunft ist etwas, das sich uns einschreibt. Sie markiert nicht einfach den Ausgangspunkt unserer eigenen Biografie und unseres Lebensweges, sie ist gleichsam auch ein Gepäck, das wir mit uns herumschleppen. Manche Menschen wollen nichts sehnlicher, als sich von ihrer Herkunft lösen. Für andere markiert Herkunft einen Halt, einen Platz in der Welt, eine sichere Bank. Viel wird die Nase gerümpft über identitätspolitische Verortungen, die auf Herkunft — gemeint ist damit selten die Klasse, vielmehr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur oder (gewählten) Community — abzielen, dabei bietet sie ein Sicherheitsnetz in Zeiten der Verunsicherung. Identitätspolitik ist nicht nur das, was People of Colour oder Queers betreiben. Je unübersichtlicher und komplexer die gesellschaftlichen Verhältnisse, desto größer ist das Bedürfnis, sich einer Gruppe, einem Stamm, einer Fraktion zuzuordnen: den jungen Ostdeutschen, queeren Migranten oder Schwarzen2 Akademikerinnen.
Seit Jahren nun tobt ein Richtungsstreit zwischen traditionell marxistischer Linker und der »neuen Linken«, wie Vertreter von Identitätspolitik bezeichnet werden. Letzteren wirft man vor, sie würden sich nicht mehr für soziale Gerechtigkeit interessieren, sondern nur noch Luxusanliegen der westlichen Mittelschichten verhandeln. Unter dem Label Identitätspolitik wird je nach politischer Couleur alles subsumiert, was Frauen, Homosexuelle, Queers, trans-Personen, Schwarze usw. betrifft. Deren Anliegen werden den Anliegen der »normalen Bürger« gegenübergestellt. Die Normalbürger, so muss man zwangsläufig folgern, sind dann vor allem weiß, männlich und hetero. Solch eine Konstruktion von Normalität ist offensichtlich problematisch.
Anhand der Biografie meiner Mutter will ich zeigen, dass wir gerade nicht zwischen den Perspektiven Identität oder Klasse wählen sollten, sondern dass wir sie wie Werkzeuge bei der Analyse der ungeheuer komplexen Gegenwart benutzen müssen. Wir sollten sie wie Brillen begreifen, die uns je nach Situation helfen, eine Konstellation genauer zu betrachten. Weder eine Klassenperspektive noch Identitätspolitik sollten als Dogmen verstanden oder instrumentalisiert werden.
Wenn ich in diesem Text feministische Diskurse kritisiere, dann tue ich das als Feministin, die den Blick durch die Klassenbrille wählt. Wenn ich dagegen der Figur des Malochers die Arbeiterin und Putzfrau gegenüberstelle, dann blicke ich durch eine feministische Brille und korrigiere damit die Klassenperspektive. Und zwar nicht in Opposition zur marxistisch-materiellen Analyse, sondern in deren Ergänzung. Wenn ich zusätzlich beide Konstellationen durch eine Ost-West-Brille betrachte, dann nur, um zu zeigen, dass selbst ein leicht veränderter, ideologischer Standpunkt die Dinge in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Ideologisch meint hier nicht »verblendet«, sondern eine bestimmte Auffassung von Welt, wie man in Anlehnung an Antonio Gramsci sagen könnte.3 Zusammengenommen erlauben die unterschiedlichen Perspektiven einen erheblich differenzierteren Blick auf die gesellschaftliche Realität.
Ich werde meine Mutter als Arbeiterin, als Mutter und als Ostdeutsche betrachten. Ihre Biografie dient auch als Abgrenzung und Hintergrund meiner eigenen Biografie. Diese Erzählung ist ebenso eine Erzählung über mich — und über die Prägungen, die ich durch meine Herkunft erfahren habe. Sie führen mir immer wieder die Kluft zwischen meiner Erfahrung, meiner Wahrnehmung der Wirklichkeit und den dominanten Diskursen der sogenannten Mitte vor Augen.
1. Eine Frau ihrer Klasse
Das Arbeitsleben meiner Mutter beginnt mit zwölf. Jenseits des Eisernen Vorhangs proben zu jener Zeit — es sind die späten Sechziger — junge Menschen den Aufstand, sie zelebrieren Musik und Frieden als Gegenkultur, als Antidot zu einem normierten Leben unter kapitalistischen Vorzeichen. Bald schon wird Woodstock zum Höhe- und Endpunkt jugendlicher Rebellion, zu dem Ereignis einer ganzen Generation avancieren. In der DDR gestalten sich die Sommer meiner Mutter profaner. Gemeinsam mit ihrem ein Jahr jüngeren Bruder arbeitet sie in einer Konservenfabrik. Ich stelle mir das so vor: Meine eher kleingewachsene Mutter, in ihrer jugendlichen Inkarnation vielleicht mit einer Schürze bekleidet und ganz sicher mit einem Haarnetz, steht an einem Fließband. Unablässig wälzt das Band scharfkantige Metalldosen um. Die müssen aufgerichtet und mit Suppen, eingekochtem Kompott oder Kirschen befüllt werden. Hier und da schieben sich die Geschwister eine Handvoll Früchte in den Mund. Sie sind stolz darauf, für ihre Mutter Geld mitverdienen zu können. Es sind nur etwa zwanzig Mark pro Woche, so genau erinnert sich meine Mutter heute nicht mehr, wohl aber daran: Das Geld ist überlebenswichtig, denn oft genug hungern die Kinder. Ab und zu erhält die Familie von einem mitleidigen Bäcker Kuchenränder, die alle begierig verschlingen. Was Marie Antoinettes angebliche Bemerkung, die Armen sollten doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben, in ein völlig neues Licht rückt.
Meine Mutter erledigt ihre Arbeit ordentlich, so wie sie es ihr Leben lang halten wird. Ihr Einkommen und das ihres Bruders trägt dazu bei, den Lebensunterhalt der achtköpfigen Familie — sie sind sieben Kinder und ihre Mutter — zu sichern. Vielleicht ist sie ein bisschen stolz, nein, wohl eher nicht, sie kennt es nicht anders. Auch zu Hause arbeitet sie unentwegt, denn die kleinen Kinder wollen versorgt sein, und die Wäsche muss mit der Hand gewaschen werden, das ist mühsam und langwierig. Nur wenige Jahre später wird sie die Schule verlassen müssen, obwohl sie gerne einen Realschulabschluss gemacht hätte. Aber ein Lehrlingsgehalt ist höher als das Kindergeld, das meiner Großmutter zusteht, und so entscheidet sich meine Großmutter gegen die Bildung ihrer Tochter und für die Erleichterung eines prekären Lebens. Wohlgemerkt, es sind die späten Sechziger des 20. Jahrhunderts.
Irgendwann geht die Schicht zu Ende. Meine Mutter und ihr Bruder sind spät dran. Sie haben Angst, meine Großmutter warten zu lassen, denn sie regiert daheim mit harter Hand. Beide schwingen sich auf ihre Fahrräder und rasen los. Rasen, nun ja, das macht mein Onkel. Meine Mutter ist bis heute keine gute Radfahrerin, sportliche Ertüchtigung ist ihre Sache nicht, sie versucht also, im Tritt zu bleiben, während mein Onkel immer schneller fährt. Die beiden Teenager rasen über das brüchige Pflaster der Kleinstadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Dann nähern sie sich rasant einer Kurve, mein Onkel nimmt sie im Schwung, meine Mutter sieht die Kurve zu spät, das Fahrrad knallt an die Bordsteinkante, meine Mutter überschlägt sich und landet im Vorgarten eines Häuschens. Für einige Minuten verliert sie das Bewusstsein. Sie kommt erst wieder zu sich, als sich ein Mann über sie beugt — Glück im Unglück, es ist ein Arzt, der örtliche Frauenarzt. Mit Verwunderung muss sie feststellen, dass ihr Unterarmknochen aus ihrem Arm ragt. Der Frauenarzt schient den Arm notdürftig und ruft einen Krankenwagen.
Die Mitarbeiter des Krankenhauses halten es nicht für nötig, meine Großmutter zu informieren. Oder tun es, aber meine Großmutter macht sich nicht die Mühe, ins Krankenhaus zu kommen. So oder so: Das Kind bekommt eine Narkose, allein, auf sich gestellt, der Arm wird gerichtet. Die Dreizehnjährige, die ja meine Mutter ist — die Geschichte schafft eine seltsame Distanz zwischen mir und ihr —, wird in den Krankenwagen gesetzt, der sie nach Hause fährt.
Als der Krankenwagen vor ihrem Elternhaus hält, ist meine Großmutter sichtlich aufgebracht. Stundenlang musste sie sich ganz allein um die Kinder und den Haushalt kümmern. Meine Mutter weiß in diesem Moment, dass sie die Konsequenzen spüren wird. Vielleicht ist es die Aufregung oder die Narkose oder ihre Angst vor einer Strafe — jedenfalls übergibt sich meine Mutter noch im Krankenwagen.
Die Schweinerei müssen Sie aufwischen, sagen die Sanitäter zu meiner Großmutter. Sie genießen es womöglich, sie zu demütigen, jeder hackt gerne nach unten; vielleicht schauen sie dabei zu, wie meine Großmutter auf den Knien putzt. Sie tut es zähneknirschend. Dann ist der Wagen endlich sauber, die Männer sind weg, und meine Großmutter schließt die Tür hinter sich. Vielleicht ahnt es meine Mutter bereits, vielleicht hat sie es die ganze Zeit über geahnt, aber dieses Mal bekommt sie eine besonders harte Abreibung. Der Kleiderbügel — oder ist es ein Schuh, seltsam, wie Erinnerungen verschwimmen — rast immer wieder auf ihren Kopf. Jetzt weiß sie nicht, was mehr schmerzt: der gerichtete Arm oder ihr Kopf. Irgendwann ist meine Großmutter befriedigt, jedenfalls fertig, Strafe muss sein.
Meine Großmutter hat in den letzten Jahren mehr als einmal geäußert, dass sie sich für ihre Härte schämt. Dass sie wisse, was sie damals getan habe. Aber das Leben war hart, brutal manchmal, und dasselbe galt für sie. Vielleicht hat meine Mutter Verständnis für ihre Mutter. Aber auch das Leben meiner Mutter war hart, und sie wurde es nie, schon gar nicht brutal.
Meine Mutter hat sich nie gegen ihre Mutter aufgelehnt, es gab keine jugendliche Rebellion, sie träumte nicht vom summer of 69. Während eine ganze Generation sich von ihren Eltern nicht nur individuell, sondern kollektiv distanzierte, wollte meine Mutter eigentlich nur geliebt und anerkannt werden.
*
Sich abstrampeln und trotzdem eins auf den Deckel bekommen, the story of my mom’s life. Es ist eine Geschichte voll von Ungerechtigkeiten, und in gewisser Weise eine, die dazu eingeladen hätte, persönliche Niederlagen als die logische Konsequenz eines harten Lebens zu deuten. Sich also als Opfer zu betrachten — der Verhältnisse, der Menschen, der Klasse, der Gesellschaft. Meine Mutter tat das nicht.
Ihre Geschichte, die Härten, die sie als Kind, als Jugendliche, als Frau, als Arbeiterin, als Ehefrau, als Mutter erdulden musste, erfüllen mich mit Wut. Nicht nur auf das System, sondern auch gegen sie. Manchmal möchte ich meine Mutter schütteln, nachträglich, und sie dazu auffordern, sich endlich aufzulehnen. Natürlich konnte sie nichts für all die Ungerechtigkeit, aber hätte sie nicht wenigstens kämpfen können? Warum, zum Teufel, kämpfte meine Mutter nicht gegen die Verhältnisse?
Die Geschichte meiner Mutter zu verstehen — und es gibt einen Teil dieser Geschichte, der gesellschaftlich relevant und erklärungsbedürftig ist — setzt voraus, meine Mutter als das Produkt ihrer Klasse, als Angehörige ihres Geschlechts, auch als Frau, die in der DDR geboren und sozialisiert wurde, zu verstehen. Ließe ich auch nur eine dieser Dimensionen weg, bliebe ihre Biografie, ihr ganz persönlicher Klassenkampf, unverständlich. Während in Deutschland, Großbritannien und den USA ein Richtungsstreit zwischen klassischer, also marxistischer Linker und der neuen Identitätspolitik tobt, bleibt die konkrete Lebenssituation meiner Mutter von diesen Debatten unberührt. Und das hängt wesentlich damit zusammen, dass der Widerspruch zwischen klassenpolitischen und identitätstheoretischen Ansätzen konstruiert ist. Anhand der Biografie meiner Mutter lässt sich zeigen, dass es keine Klassenpolitik ohne identitätspolitische Verortung geben kann und dass ein Ansatz, der wahlweise nur auf Klasse oder Identität (etwa Frausein oder Weißsein) fokussiert, notwendig blinde Flecken erzeugt.
Die Dimensionen Klasse und Identität lassen sich nicht im Sinne einer gesonderten Betrachtung von Klassenlage, Geschlecht oder Herkunft trennen; sie übercodieren einander. Übercodierung meint, dass kein Element vom anderen unberührt bleibt, dass es Überlagerungen gibt.4 Diese Grundannahme, die bereits bei Pierre Bourdieu in den 60er Jahren auftaucht, wird im intersektionalen Feminismus fortgeschrieben: Eine Schwarze Arbeiterin etwa kann als Arbeiterin, als Frau, als Schwarze diskriminiert werden — aber auch als Schwarze Arbeiterin. Es kann sinnvoll sein, sich jeweils mit anderen Frauen, ob Schwarz oder weiß, oder anderen Arbeitern, ob weiß oder Schwarz, weiblich oder männlich, zu solidarisieren. Aber die Diskriminierungssituation als Schwarze Frau der Arbeiterklasse bleibt eine andere als die einer weißen Frau oder eines Schwarzen Mannes.
Meine Mutter ist keine Person of Colour, die irgendwo in einer Fabrik im Fernen Osten schuftet, sie ist nicht das Opfer globaler Ausbeutungsprozesse, sondern der spezifischen Klassenschichtung hierzulande. Sie ist weder lesbisch noch trans, sie experimentiert nicht mit ihrer sexuellen Identität, und ganz ehrlich: Sie versteht die Sprache des Queerfeminismus nicht, und das nicht nur, weil sie kein Wort Englisch spricht und ein erheblicher Teil des intersektionalen Vokabulars englisch ist. Meine Mutter ist der Identitätspolitik als Diskursobjekt fremd. Aber auch ihr ist die Identitätspolitik absolut fremd, sie kennt sie nicht mal dem Namen nach. Sie ist die andere, aber nicht anders genug, dass Marxismus oder Feminismus ihre systemische Position bestimmen könnten. Sie existiert im toten Winkel dieser Theorien.
Mit vierzehn fiel mir zufällig ein Buch über wegweisende Philosophinnen in die Hände, darin die zwei Simones, die mein Denken als Teenagerin und darüber hinaus stark beeinflussten. Neben Simone de Beauvoir ging es in dem Buch auch um Simone Weil. Mir imponierte als Mädchen, dass Weil, die Lehrerin war, aus Solidarität mit den Arbeiterinnen begann, in einer Fabrik zu arbeiten — wo sie sich mehrfach aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und ihrer extremen Kurzsichtigkeit schwer verletzte. Simone Weil erfuhr bei ihrem Sozialexperiment am eigenen Leib, dass man nach zehn Stunden harter körperlicher Arbeit nicht mehr die Kraft hat, politisch zu kämpfen. So bewundernswert Weils Kampf auch war: Die Tatsache, dass dieser Zusammenhang nicht a priori, sondern erst aus der unmittelbaren Erfahrung gewonnen wurde, spricht Bände: über die Entfremdung der Theorie des Marxismus von der Praxis der Proletarier, vor allem der Arbeiterinnen.
Betrachtet man die Biografie meiner Mutter genauer, wird plausibel, warum eine Frau wie sie sich nicht dem Klassenkampf, den großen geschichtsphilosophischen Deutungen des Antagonismus von Proletariat und Bourgeoisie verschrieben hat: Sie hatte zu viel zu tun. Man wird nicht zum Subjekt der Revolution, während man schmutzige Windeln in einem Kochtopf auskocht, in einem Plattenwerk Buch über die sozialistische Produktion führt oder Schweine in Hälften teilt. Meine Mutter träumte nicht vom Klassenkampf. Wäsche von fünf Personen zu schleudern war struggle genug.
Zu dieser Klassenwirklichkeit gehören eine Reihe von Koordinaten, die ich untersuchen möchte. Es sind die Koordinaten Bildung, Zeit und Zweck. Bildung ist ein Kosten- und Zeitfaktor, weswegen Bildung für Frauen der Arbeiterklasse oft ein unerreichbares Privileg war und global betrachtet noch immer ist. Eine längere Ausbildung bedeutet längere Abhängigkeit vom Elternhaus, das eine Person mehr zu ernähren hat. Wer sich bildet und lange zur Schule geht, hat weniger Zeit für anderes, Zweckmäßigeres — für Erwerbs- oder Care-Arbeit etwa.
*
Meine Mutter war eine gute, aber keine herausragende Schülerin. Das überrascht nicht: Das intelligente Mädchen hatte wenig Zeit, sich ihren Hausaufgaben zu widmen. Gleich nach der Schule musste sie ihre Pflichten im Haushalt erfüllen. Ein Zimmer für sich allein zu haben war ein uneinlösbarer Traum; es gab nicht einmal einen Küchentisch, an dem sie ungestört lernen konnte. Meine Mutter hätte gerne ihren Realschulabschluss gemacht, aber das Geld der Familie reichte nicht. Meine Großmutter machte eine einfache Rechnung auf: Das Lehrgeld meiner Mutter war höher als das Kindergeld, das sie im Falle des Schulbesuches meiner Mutter erhalten hätte. Damit war die Sache entschieden. Meine Mutter musste die Schule nach der neunten Klasse, mit gerade einmal fünfzehn Jahren, verlassen.
Etwa zur selben Zeit avancierte in Westdeutschland die katholische Arbeitertochter vom Lande zu einer wichtigen Figur gesellschaftlicher Debatten.5 Im Rahmen der Bildungsexpansion in den 60er Jahren galten viele Bemühungen ihr, die durch ihre Klassen- und Milieuzugehörigkeit am stärksten benachteiligt wurde. Die frühere Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Andrea Nahles beschreibt in ihrem Buch Frau, gläubig, links6 ihren Bildungsaufstieg vor dem Hintergrund dieser Klassenfigur. Bei öffentlichen Auftritten konnten wir an ihr — habituell — diese Herkunft sehen und hören: ihre ulkigen Gesangseinlagen, Bätschi-Rufe oder die Ankündigung, dem politischen Gegner eins »auf die Fresse« geben zu wollen, waren weder damenhaft noch gutbürgerlich.
In der Sozialfigur der Arbeitertochter vom Lande kam das Geschlecht ins Spiel: Die am stärksten benachteiligte Figur war weiblich. Der Zusatz »vom Lande« ist nicht unbedeutend, denn er verweist auf die Notwendigkeit, zwischen Klasse und Milieu zu differenzieren, Herkunft also genauer zu betrachten. Auch Milieus besitzen eine Klassenstruktur, weswegen man von »Klassenmilieus«7 (Michael Vester) sprechen kann. Es macht einen wahrnehmbaren Unterschied, ob man in einer Metropole oder in einem Dorf sozialisiert wird. In diesem einen Punkt machte es keinen Unterschied, in welchem politischen System junge Mädchen der Arbeiterklasse auf dem Lande aufwuchsen: Die Bildung der Töchter stand nicht im Vordergrund.
Egal ob in der BRD oder in der DDR, Familien mussten sich entscheiden, ob ihnen der Aufstieg ihrer Töchter Geld wert war. Es ging nicht nur um die Frage der Emanzipation — ob etwa Väter oder Mütter wünschten, dass ihre Töchter arbeiteten oder lieber Hausfrauen an der Seite eines Versorger-Ehemannes würden. Es ging um viel existenziellere Entscheidungen. Meine Großmutter lebte von einem winzigen Betrag an Sozialhilfe, die Einkommen der ältesten Kinder mussten zur Versorgung der Familie mit dem Nötigsten beitragen.
Weil mein Großvater immer wieder wegen Gaunereien ins Gefängnis wanderte, bis er sich schließlich eine andere Frau suchte, um mit ihr eine neue Familie zu gründen, fiel er nicht nur als Ernährer seiner Familie aus. Er ruinierte auch den Ruf der Großfamilie. Wenn sie sich zwischen dem Bildungsaufstieg ihrer ältesten Tochter und ihrer womöglich besseren Zukunft oder einer Gegenwart, in der es ein warmes Mittagessen gab, entscheiden musste, dann entschied sie sich für das Essen. Das unterschied sie von kleinbürgerlichen Müttern und Vätern, die viel eher bemüht waren, ihrem Kind bessere Zukunftsaussichten zu eröffnen.
Auch meine Großmutter war eine Frau ihrer Klasse. Sie selbst war mit sechzehn aus ihrem Elternhaus geflüchtet, weil ihr Stiefvater sie »begrapscht« hatte, wie es in meiner Familie hieß. Mit siebzehn bekam sie ihr erstes Kind, meinen ältesten Onkel, mit achtzehn gebar sie meine Mutter. Meine Großmutter war so arm, dass sie ohne Dach über dem Kopf, ohne Babykleidung, ohne alles dastand, weswegen das Jugendamt ihr ihren Erstgeborenen zunächst wegnahm. Ihre sieben Kinder würden einige Jahre später noch mal in einem Kinderheim untergebracht werden, als meine Großmutter schwer an Tuberkulose, der Armenkrankheit schlechthin, erkrankte.
Das letzte der sieben Kinder meiner Großmutter wurde im Jahr 1964 geboren. Das war ein Jahr vor der Einführung der Pille in der DDR. Meine Großmutter hätte vermutlich nie Kinder bekommen, wenn es die Pille früher gegeben hätte. Jedenfalls hat sie das einmal angedeutet. Sie war nicht nur eine Frau ihrer Klasse; sie war eine Frau ihrer Zeit.
Die Hausarbeit war für meine Großmutter ein Vollzeitjob. Hinzu kamen das Kochen und der Anbau von Lebensmitteln und Tabak, der zeitaufwendig auf dem Wäscheboden des kleinen Hauses getrocknet werden musste und den verfügbaren Platz für die Großfamilie weiter schmälerte. Obendrein pflegte meine Großmutter ihre bettlägerige Schwiegermutter, um die sich mein Großvater weder sorgen konnte noch wollte. Meine Mutter musste als älteste Tochter jene Aufgaben erledigen, die Frauen eben zufielen, sie stand am Ende der Care Chain. Sie wusch, putzte, betreute ihre jüngeren Geschwister. Es ist die Geschichte eines Aschenputtels.
Meine Großmutter stellte nie infrage, dass es keine andere Aufgabe für ihre Tochter gab, als zu arbeiten. Frauen arbeiteten, Frauen erledigten Frauenarbeit. Frauenarbeit war all das, was wir heute als Care-Arbeit bezeichnen: sich kümmern, um die körperlichen und seelischen Bedürfnisse der Kinder, der Eltern, des Mannes. Hausarbeit, Pflege und Fürsorge. Die Arbeit kam zuerst. Freizeit gab es nicht. Als meine Mutter doch einmal Zeit für sich allein beanspruchte, rächte sich das Schicksal prompt.
Im neunten Schuljahr schlich sich meine Mutter heimlich zum Schulchor. Sie liebte das Singen, liebt es bis heute. Wenn sie das Badezimmer putzt oder die Küchenspüle auf Hochglanz poliert, schallt ihr glockenheller Gesang durch die ganze Wohnung. Mama, du musst doch nicht um deinen Jungen weinen. Heintjes Hitsong verfolgte mich meine gesamte Kindheit hindurch. Ihre Mama weinte nicht, sie wütete, als sie auf dem Schulzeugnis sah, dass meine Mutter am Schulchor teilgenommen hatte. Wieder steckte meine Mutter Prügel ein, wie sie überhaupt für alles, was sie tat oder unterließ, Schläge kassierte. Dass ihr Rücken heute verkrümmt ist und ihr Nacken sich wie ein Fragezeichen wölbt, das hängt womöglich auch mit einem Leben zusammen, in dem sie mehr als einmal den Kopf einziehen musste, um nicht noch mehr Prügel einzustecken.
Mein Mann zeigt sich heute oft verwundert darüber, dass meine Mutter keine Hobbys hat. Warum malt, strickt, kocht oder backt sie nicht? Weil sie ihr Leben lang keine Zeit hatte, eigene Interessen und Hobbys zu entdecken, ihnen nachzugehen und vielleicht sogar ein großes Talent zu entdecken. Allerdings hatte sie eine Nähmaschine besessen, mit der sie sich vor der Wende — wie so viele andere DDR-Frauen — modische Röcke oder Kleider schneiderte. Als Mädchen stieß ich auf Kisten mit Stoffresten und halb fertigen Kleidern. Die Wende hatte die Zeitinvestition in das nützliche Hobby unnötig werden lassen. Kleidung gab es nun billig zu kaufen. Hergestellt von arbeitenden Frauen im Fernen Osten.
Und warum sollte sie in ihrer Freizeit backen oder kochen, wenn es Essen günstig zu kaufen gibt? Die Freude am Handwerk, an all den Tätigkeiten, die Zeit kosten und körperliche Arbeit bedeuten, ist vielleicht nur bei jenen Menschen groß, die Zeit zur Verfügung haben und ihr Leben lang nicht körperlich arbeiten müssen.
*
Meine Mutter ist nicht einfach eine Frau ihrer Klasse; sie ist eine Arbeiterin, die in einem Arbeiter-und-Bauern-Staat sozialisiert wurde. Diese Sozialisation war in mehrerlei Hinsicht folgenreich, weil in diesem Land die Arbeiterklasse sozial und politisch aufgewertet wurde; dasselbe galt für Frauenarbeit, die nun nicht mehr nur Fürsorgearbeit, sondern auch Erwerbsarbeit meinte. In der DDR wurde das Verhältnis von Frauen- und Männerarbeit neu ausgelotet, Bauzeichner, Ingenieur oder Sacharbeiter waren, trotz generischen Maskulinums, auch Frauen. Die Mutter meines Mannes, die mit ihrem Ehemann 1989 nach Hessen auswanderte, erzählt gerne, wie sie damals im Gespräch mit einem Versicherungsvertreter gefragt wurde, ob sie denn eine richtige Bauzeichnerin sei. Eine falsche Bauzeichnerin sei sie jedenfalls nicht, entgegnete ihr Ehemann.
Das Bild der Arbeiterin begegnet dem Betrachter im sozialistischen Realismus immer wieder, und deswegen möchte ich ihre Ikonografie etwas genauer vor Augen führen. Denn die Darstellungen offenbaren einen interessanten Aspekt des Bildes, das man sich im Sozialismus von der arbeitenden Frau machte. An der Ostseite des Dresdner Rathauses befindet sich die Bronzeskulptur einer Trümmerfrau. Auf meinem Weg zum Gymnasium und später zur Universität passierte ich die ikonische, zentral platzierte Plastik täglich. An Gedenk- und Feiertagen sieht man zu ihren Füßen ein Meer aus roten Nelken liegen. Sie ist noch immer ein wirkmächtiges Symbol.
Walter Reinhold schuf die Bronze vermutlich nach dem Modell der Arbeiterin Erika Hohlfeld. Die Trümmerfrau schaut entschlossen in die Zukunft, in ihrer Hand trägt sie einen Hammer, ihre Stiefel sind übergroß und schwer, als hätte sie die Schuhe eines Mannes übergestülpt (try walking in my shoes), über ihrer Hose trägt sie ein Kleid, darüber eine schwere Schürze. Auf dem Kopf hat sie ein Tuch. Ihr Körper wirkt deutlich schmaler, als die darüberliegenden Schichten Kleidung es erahnen lassen. Aber sie ist weder zart noch zerbrechlich. Ihre Hand hält den Hammer, man kann es aus unserer gegenwärtigen, an einer Geschlechterdichotomie geschulten Perspektive nicht anders sagen, mit männlicher Entschlossenheit. Für die Augen der Passanten und Betrachter überlagern sich in der Bronze Schichten von Weiblichkeit (die Körperfigur) und Männlichkeit (Habitus und Kleidung).
Harte Arbeit gilt als männlich, aber es waren die Frauen, die das Land wieder aufbauten, so lautet der Trümmerfrauenmythos. Seit einigen Jahren wird dieser Trümmerfrauenmythos, der sich im kollektiven Gedächtnis beider deutscher Staaten verankerte, entzaubert. Man verschwieg lange Zeit etwa die Beteiligung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern bei der Beräumung von Trümmern. Es waren auch nie nur Frauen, die Trümmer beräumten, und vielerorts waren Männer in der Mehrheit. Der Trümmerfrauenmythos, so wird oft kritisiert, heroisiere den Wiederaufbau, gleichsam in Vorbereitung des späteren Wirtschaftswunders, vernebele aber den Zusammenhang von Schuld und Zerstörung.8
Wie so oft, wenn mit Mythen aufgeräumt wird, räumt man ein wenig zu gründlich auf. In einer soziologischen Analyse des Mythos heißt es etwa: »[I]n Deutschland lagen immerhin 400 Millionen Kubikmeter Trümmer und Schutt, sodass sich geradezu die Frage aufdrängt: Waren die Frauen mit ihren Eimerketten dazu imstande, diese Trümmermassen zu räumen?«9 Es ist richtig, dass die Bilder von Frauen in Kleidern, die fröhlich Eimerketten bildeten, nichts mit der Realität zu tun hatten. Aber warum wirkt es so, als wolle man die Arbeit von Frauen — in der Sowjetischen Besatzungszone bildeten Frauen immerhin die Hälfte der eingesetzten Arbeiter bei der Schuttberäumung —10 unsichtbar machen? Was spricht gegen eine nüchterne Bestandsaufnahme, etwa die, dass Frauen bei der Trümmerbeseitigung arbeiteten, so wie sie andernorts in Fabriken arbeiteten? Und dass man mithilfe des Trümmerfrauenmythos eine Arbeit, die alles andere als attraktiv war, sozusagen schmackhaft machte?11 Genau hierin nämlich wurzelt der Trümmerfrauenmythos: Der Charakter der unangenehmen Arbeit sollte durch die Überhöhung der Arbeiterinnen als Heldinnen des Wiederaufbaus wettgemacht werden.
Pikant ist womöglich, dass in der Sowjetischen Besatzungszone oftmals arbeitslose Frauen die Trümmer räumten.12 Die Bezeichnung »arbeitslos« ist interessant, man kann annehmen, dass das nicht die bürgerliche Hausfrau, die keiner Erwerbsarbeit nachgeht, meint, sondern Fabrikarbeiterinnen, die durch die Vernichtung von Fabriken im Krieg oder ihre Demontage durch die Sowjetunion ihre Arbeit verloren hatten.
Die Arbeit bei der Trümmerbeseitigung war für einige Frauen attraktiv, weil sie als Schwer- und Schwerstarbeiterinnen zusätzliche Essensrationen erhielten, die Ernährungssituation ihrer Familien also aktiv verbessern konnten, was vor allem Alleinerziehende motivierte, die Arbeit zu leisten.13 In Dresden blieben die Trümmerfrauen aufgrund der massiven Zerstörung besonders lange Teil des Stadtbildes. Erika Hohlfeld erhielt 1978 die Auszeichnung als »verdienter Bauarbeiter der Deutschen Demokratischen Republik«.14
Im Zitat von den Eimerketten schwingt ein Vorurteil mit: Weil Frauen ja gar nicht wirklich imstande sind, hart körperlich zu arbeiten, muss der Mythos per se verdächtig sein. Die zarte Frau, die nicht heben und schwer arbeiten kann — jeder, der einer Angestellten in Industrieküchen einmal dabei zugesehen hat, wie sie Kochtöpfe hebt oder Lebensmittelkisten verlädt, wird daran zweifeln. Besonders die DDR forderte, das ist durchaus nicht idealisierend gemeint, das Bild der zarten Frau heraus. Meine Schweigermutter musste sich vor ihrem Studium in der Produktion bewähren — sie verlegte damals mit anderen Studentinnen Eisenbahnschienen, bei Eiseskälte und im Schnee. Die Studentinnen arbeiteten so hart, dass ihr Vorarbeiter höhnte, sie seien die besseren Arbeiter. Und zu den Studentinnen, die in der Leipziger Moritzbastei Schuttberge beseitigten, wiederum im Rahmen der »Bewährung« in der Produktion, gehörte eine junge Studentin namens Angela Merkel.15 Das Bild der gleichberechtigten Ostfrau entsprach nicht unserem heutigen von der erfolgreichen Managerin, die gläserne Decken durchstößt, sondern dem der Baggerfahrerin und Bauarbeiterin, die Schuttberge bewegt.
Direkt vor dem Eingang zu meinem ehemaligen Gymnasium befindet sich eine weitere Bronze, die das Bild der DDR vom Arbeiter propagierte: Der Titel der Plastik von Johannes Peschel lautet »Schüler und Lehrer beim Polytechnischen Unterricht«. Die Plastik zeigt eine junge Frau und einen älteren Mann. Sie hält ein Lineal, der Mann hebt die Arme, womöglich wird er ihr jeden Moment etwas erklären. Man sieht eine Lehrer-Schüler-Situation — und eine für die Zeit neuartige Geschlechtercodierung: Die junge Frau trägt Kopftuch (Arbeitsschutz geht alle an!), der Mann trägt eine Mütze, aber die Positur ist die gleiche: Der Mann steht mit leicht gespreizten Beinen sicher, die junge Frau ebenso. Obgleich der Altersunterschied eine gewisse Hierarchie andeutet, arbeitet der Rest des Bildprogramms an der Beseitigung der Hierarchien.