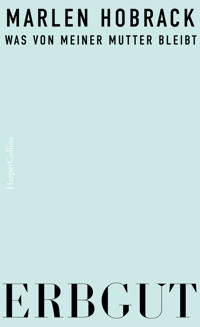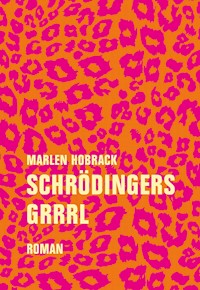
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem Debütroman »Schrödingers Grrrl« erzählt Marlen Hobrack die Geschichte von Mara Wolf – Schulabbrecherin, Anfang zwanzig, depressiv, arbeitslos in Dresden. Ihren Alltag füllt sie mit Instagram, Dating und Online-Shopping. In einer Bar lernt Mara den PR-Agenten Hanno kennen, der von ihr und ihrem schrägen White-Trash-Auftreten begeistert ist. Er engagiert sie für eine Party und überredet sie, sich als Romanautorin auszugeben. Den Roman geschrieben hat ein alter weißer Mann, der genauso wie Hanno und sein Lektor nicht glaubt, dass es sich unter seinem Namen verkauft. Die drei Männer schmieden einen Plan für einen großen literarischen Erfolg, auf den sich Mara einlässt. »Schrödingers Grrrl« ist ein zeitgenössischer Entwicklungsroman, eine Hochstaplerin-wider-Willen-Studie, eine Geschichte über eine junge Frau, die keinen Platz in der Gesellschaft findet, weil sie gar nicht erst daran glaubt, einen beanspruchen zu können. Doch da gibt es die drei Heldinnen – ihre Mutter, ihre beste Freundin Charis und ihre Sachbearbeiterin Frau Kramer in der Arbeitsagentur, die sie nicht im Stich lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In ihrem Debütroman »Schrödingers Grrrl« erzählt Marlen Hobrack die Geschichte von Mara Wolf – Schulabbrecherin, Anfang zwanzig, depressiv, arbeitslos in Dresden. Ihren Alltag füllt sie mit Instagram, Dating und Online-Shopping.
In einer Bar lernt Mara den PR-Agenten Hanno kennen, der von ihr und ihrem schrägen White-Trash-Auftreten begeistert ist. Er engagiert sie für eine Party und überredet sie, sich als Romanautorin auszugeben. Den Roman geschrieben hat ein alter weißer Mann, der genauso wie Hanno und sein Lektor nicht glaubt, dass er sich unter seinem Namen verkauft. Die drei Männer schmieden einen Plan für einen großen literarischen Erfolg, auf den sich Mara einlässt.
»Schrödingers Grrrl« ist ein zeitgenössischer Entwicklungsroman, eine Hochstaplerin-wider-Willen-Studie, eine Geschichte über eine junge Frau, die keinen Platz in der Gesellschaft findet, weil sie gar nicht erst daran glaubt, einen beanspruchen zu können. Doch da gibt es die drei Heldinnen – ihre Mutter, ihre beste Freundin Charis und ihre Sachbearbeiterin Frau Kramer in der Arbeitsagentur, die sie nicht im Stich lassen.
Marlen Hobrack wurde 1986 in Bautzen geboren und lebt in Leipzig. Sie studierte Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften und arbeitete im Anschluss für eine Unternehmensberatung. Seit 2016 schreibt sie hauptberuflich für diverse Zeitungen und Magazine, u. a. den Freitag, taz, Die Zeit, Die Welt und Monopol. 2022 ist ihr Sachbuch »Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet« bei Hanser Berlin erschienen.
MARLEN HOBRACK
SCHRÖDINGERS GRRRL
ROMAN
VERBRECHER VERLAG
Erste Auflage
© Verbrecher Verlag 2023
www.verbrecherei.de
Satz: Christian Walter
Druck: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-95732-549-5
eISBN 978-3-95732-560-0
Printed in Germany
Der Verlag dankt Johanna Barrettund Sylvana Brauer.
Für Herrn Wolf
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
»Rätselhaft muß man nicht allein andern sein,sondern auch sich selbst.«
Søren Kierkegaard, »Entweder – Oder«
»Jeder Satz, jede Äußerung, das Vokabular, dieInterpunktion und die Tippfehler, die bevorzugtenrhetorischen Figuren und besonders betontengrammatischen Funktionen kennzeichnen diesePersona. Diese Persona ist eine Textpersona. ›Ich.‹«
Holger Schulze, »Ubiquitäre Literatur«
DAS PROBLEM liegt im Innern, gleich hinter der Tür. Sobald man sie öffnet, gelangen unschöne Dinge zum Vorschein. Der Briefkasten ist eine Blackbox. Wie Schrödingers Giftbox, in der die Katze sitzt und bevor man die Box öffnet, kann man nicht wissen, ob die Katze tot oder nicht-tot ist.
Bis zum Öffnen ihres Briefkastens war auch Mara erledigt und nichterledigt. Erledigt für den Fall, dass Mahnungen und Rechnungen auf sie warteten. Nicht-erledigt für den Fall, dass sie ausgeblieben waren. Bis zum Öffnen der Box starb sie tausend Tode, nicht nur einen wie die Katze. Augen zu und durch. Mara rammte den Schlüssel ins Schloss. Der Gegendruck verriet ihr, dass der Briefkasten bis zum Bersten gefüllt war. Kasten auf. In einem sonderbaren Anfall Mutes öffnete sie die Umschläge. Darin eine Ausfallrechnung ihrer Zahnärztin in Höhe von 50 Euro. Weil sie sich nicht dazu hatte durchringen können, den Termin abzusagen. Amazon Prime. GEZ. Zalando. H&M. Monki. Zara. Alles Zahlungserinnerungen. Erste Mahnung, zweite Mahnung. Letzte Mahnung. Sie drückte das Briefkastentürchen fest zu. Solange es geschlossen blieb, war sie pleite und nicht-pleite.
Weitergehen. Es musste ja weitergehen. Auch Mara musste weiter zu ihrem monatlichen Termin bei Frau Kramer, ihrer Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt, um die immer gleichen Fragen zu beantworten.
Frau Wolf, wie geht es Ihnen?
Frau Wolf, wann werden Sie arbeiten können?
Frau Wolf, wie soll es weitergehen?
Das waren sicher wichtige Fragen. Mara vermied es, sie zu stellen. Frau Kramers »Einladung«, die keine war, weil man sie nicht nicht-annehmen konnte, strahlte eine größere Dringlichkeit aus als üblich. Ihr Brief erinnerte Mara höflich daran, dass sie ein Attest ihrer Ärztin benötigte, um weiterhin Leistungen vom Jobcenter beziehen zu können, »ohne sich aktiv um Arbeit zu bemühen«. Ein Attest hatte sie nicht; den Termin bei ihrer Ärztin hatte sie vergessen, womöglich bewusst verdrängt. Wer konnte das so genau sagen? Eine ganze Weile schon hatte sie Dinge, die unbedingt erledigt werden mussten, nicht mehr erledigen können. Ihr Leben, ein tägliches Scheitern.
Heute würde sie nicht scheitern. Mara bestieg den Bus zum Amt. Das Arbeitsamt, ein 90er-Jahre-Bau mit türkisblauen Fenstern, lag in unmittelbarer Nähe der Altstadt und gehörte doch einem Paralleluniversum an. Die Prager Straße, auf der Massen von Menschen Mode-, Hi-Fi- und Handytrends shoppten, war zur unsichtbaren Grenze zwischen ihr und der anderen Welt geworden. Menschen wie sie stiegen nicht an der Prager aus. Fürs Shopping nicht liquide genug, blieben sie sitzen, fuhren weiter zum Amt, hinter dem – nur eine Haltestelle markierte die unüberbrückbare Differenz – der Uni-Campus lag.
Die Fahrgäste, die nach dem Halt an der Prager Straße im Bus verblieben, gehörten zwei Gruppen an: Studenten und Jobcenter-Kunden. Natürlich waren die jüngeren Passagiere Studenten, auch wenn es Ausnahmen gab, wie den grauhaarigen Mann um die Fünfzig, den Mara seit einigen Monaten regelmäßig morgens im Bus beobachtete. Stets lag ein Buch oder ein umfangreicher Aktenordner auf seiner Ledertasche, und er studierte sie so aufmerksam, als hinge sein ganzes weiteres Leben davon ab. Den gewaltigen Ordner trug er für gewöhnlich unter den Arm geklemmt. Nicht wie ein Bürokrat, der sich an seine Akten klammerte; der Mann trug seinen Ordner wie eine Bürde. Seinen Gesprächen mit den jüngeren Männern hatte Mara entnommen, dass er Kunstgeschichte studierte, wobei die Männer unter heftigem Augenzwinkern betont hatten, dass man gemeinsam »auf Arbeitslosigkeit« studiere. Dabei hatten sie gelacht.
Die anderen Männer seines Alters waren Jobcenter-Kunden. Leicht zu erkennen an den Blousonjacken, die sie seit den frühen 90er Jahren trugen, als sie zum ersten Mal »in« gewesen waren. Sie wirkten abgetragen. Wie die Lederslippers an ihren Füßen, die jedoch geputzt und poliert waren. Eine Frage der Würde. Diese Männer waren einmal, in einer fernen Vergangenheit, in einer für sie womöglich besseren Welt, unbedeutende Angestellte eines unbedeutenden Unternehmens gewesen, das ihrem Leben – wo schon keinen Sinn – so doch wenigstens Halt gegeben hatte. Diese Männer lechzten nach Struktur und dem Gefühl, dass es einen Unterschied machte, ob sie sich morgens aus dem Bett quälten und ihr lichter werdendes Haar mit Kämmen, die sie in die Brusttaschen ihrer Hemden aus knitterfreier Synthetik stopften, zurückkämmten, als könne ihr geordnetes Haupthaar ihnen die Würde zurückgeben, die ihnen ein indifferenter Arbeitsmarkt genommen hatte.
Man musste kein Einstein sein, um zu erkennen, dass die rundlichen Mütter mit ein bis drei Kindern, die sie in viel zu kleine Kinderwägen gestopft und mit Prinzenrolle, Saftfläschchen und kontinuierlicher Handyvideoversorgung bei Laune hielten, in die Kategorie Jobcenter gehörten. Mara wünschte sich, dass sie ihre Klischees widerlegten, vielleicht um den Zynismus, der ihr über die Jahre der Kundschaft beim Amt zur zweiten Natur geworden war, zu mildern. Aber sie stiegen doch jedes Mal am Arbeitsamt aus, sie drängten sich doch jedes Mal zuerst zur Tür, wobei sie den Rentnerinnen mit Rollatoren und den Blousonjackenmännern mit ihren überladenen Kindertransportern in die Hacken fuhren, was sie grundsätzlich nicht bemerkten, weil ihre Aufmerksamkeit den zwischen Schulter und Kinn geklemmten Handys galt.
Ausnahmsweise fielen auch junge Männer in die Kategorie Jobcenter. Wenn sie nicht gerade Sneakers aus der jüngsten Kollektion eines US-Hip-Hoppers oder hautenge, sich dicht unter ihre flachen Hintern schmiegende stonewashed Jeans trugen, waren sie ganz sicher Abiturienten, die in ihren Wartesemestern Hartz IV beantragten, damit das Amt ihre Krankenversicherung übernahm. Um nicht in unsinnige Maßnahmen geschoben zu werden, hatten sie sich Nebenjobs in irgendeiner IT-Bude gesichert, in der sie wahlweise als Klickschweine oder SEO-Texter arbeiteten. Jedenfalls glaubte das Mara.
Nur eine Gruppe war über jeden Zweifel erhaben. Alle jungen Frauen blieben sitzen, wenn der Halt »Arbeitsamt« ausgerufen wurde. Alle, bis auf Mara. Vielleicht lag es daran, dass diese jungen Frauen strebsamer waren, dass sie sich niemals die Blöße geben würden, zum Arbeitsamt zu gehen, auch nicht zur Überbrückung der Zeit zwischen Einser-Abitur und Medizinstudienbeginn. Vielleicht gerieten sie gar nicht erst in die Situation, irgendetwas überbrücken zu müssen, weil sie ständig zu tun hatten mit ihren Praktika auf Pferdegestüten oder in Kleintierarztpraxen oder ihren Work-and-Travel-Trips nach Neuseeland, ganz zum Missvergnügen ihrer besorgten Eltern, die keineswegs wünschten, dass ihre Töchter in Neuseeland Schafe hüteten und dabei mit irgendeinem sonnengegerbten Kiwi Zärtlichkeiten gegen Filzläuse tauschten. Aber wie läse sich denn ein Curriculum Vitae ohne nennenswerte Arbeitserfahrung im Ausland? Vielleicht waren die jungen Frauen angestellt in den Firmen ihrer Väter, in denen schon ihre Mütter als Angestellte, bisweilen auch als Inhaberinnen firmierten, je nachdem, ob man in der Ehe Gütertrennung vereinbart hatte oder nicht, je nachdem auch, wer mit mehr Geld und somit mehr schützenswertem Kapital in die Ehe gegangen war. Vielleicht arbeiteten sie auch als Live-Speakerinnen in einem Mittelmaßmuseum, das in den Ferien adrett gekleidete Frauen engagierte, um Kunst zu vermitteln, und in dem sie schon seit ihrem 16. Lebensjahr zu den »jungen Freunden« gehörten, weswegen sie einmal monatlich zu den im Museum stattfindenden Partys eingeladen wurden, wo es zwar nicht wirklich Grandioses, aber immerhin Koks gab, das sie mit den gut aussehenden Studenten aus bestem Hause von Mülltonnendeckeln schnieften.
Mara war neidisch. Weil sie ihnen ansah, dass es keinen Gram und Schmerz in ihrem Leben gab, einmal abgesehen von der gelegentlichen Magersucht Schrägstrich Bulimie Schrägstrich nicht näher zu bestimmenden Essstörung, die eigentlich in keinem Lebenslauf einer Mittelschichtsfrau, die etwas auf sich hielt, fehlen durfte. Vielleicht könnten sie eines Tages ein Buch darüber schreiben. Jedenfalls würde sich eine überwundene Essstörung gut auf ihren Instagram-Accounts machen, wenn sie beim Yoga an einem balinesischen Strand fotografiert davon kündeten, dass sie ihre Mitte gefunden hatten. Ihre Mitte! Jetzt waren sie wunschlos glücklich mit etwas Yoga, einem Sellerie-Smoothie in ihrer Hand und dem Strandoutfit, das aus 100 Prozent Organic Baumwolle von einheimischen Näherinnen gefertigt wurde. Link in Bio! Get a 25 % discount with Sarina25.
Im Bus nahm ein Mann neben Mara Platz. Er roch nach kaltem Zigarettendunst und billigem Herrendeospray. Axe, #yougotsomething. Was hatte Mara? Ohne Schulabschluss wurde sie von einer Maßnahme in die nächste geschoben, immer mit dem Ziel, sie dazu zu animieren, endlich einen Abschluss zu machen. Doch nach dem Abschluss würde die Qual mit den Qualifikationsmaßnahmen weitergehen. Dann sollte man »jobfit« gemacht werden, was bedeutete, dass man morgendliche Körperpflege und das Bügeln von Blusen fürs Vorstellungsgespräch trainierte. Hatte man das bewältigt, drohte die nächste Maßnahme. Dort lernte man, wie man einen Computer hochfuhr, dessen Hardware schon 1999 veraltet war. Zum Glück war Mara krank. Krank genug, um den Maßnahmen entgehen zu können.
»Bitte mal aus dem Türbereich treten! Aus dem Türbereich!«, schrie der Busfahrer, weil die Mitfahrenden nicht einsehen wollten, dass der Bus sein Fassungsvermögen für gescheiterte Existenzen überschritten hatte. Vereinzelt schüttelten Rentnerinnen ihre mit Haarlack verklebten Köpfe.
»Junge Frau, darf ich mal?«
»Ich muss auch raus.«
Ein Moment des gegenseitigen Erkennens.
Die Bustür öffnete sich seufzend. Die Menschentraube vor der Tür geriet ins Stolpern, Fußspitze an Vorgängerhacke trippelten die Passagiere auf den makellosen Straßenasphalt hinaus.
Das Amt betrat man durch eine Drehtür. Rein und nicht-rein, wenn man nicht aufpasste, kam man nie wieder raus. Mara begrüßte den Security-Mann – er trug eine schwarze Bomberjacke, schwarze Armee-Hosen mit Taschen auf Oberschenkelhöhe, Dickies-Schuhe und einen millimeterkurzen Haircut – am Fahrstuhl mit »Guten Morgen, Chef!«, obwohl es bereits Mittag war, und wartete auf sein empörtes Schimpfen. Es blieb nicht aus.
Im Fahrstuhl traf Mara auf ihr Spiegelbild. Ihre Haut sah fahl und blass aus, was nicht nur an der blauen Fahrstuhlbeleuchtung lag. Erledigt oder nicht-erledigt, ihr Spiegelbild hatte sich längst entschieden.
Vierte Etage, Mara folgte den Schildern, die sie zu Zimmer 4.03 und Frau Kramer führen sollten. Zu Zimmer 4.10 bis 4.20 ging es rechts entlang, aber wo lag Zimmer 4.03? Das Schild, das die Zimmer 4.01 bis 4.09 auswies, lag umgekippt auf dem Boden. Links oder geradeaus? Mara drehte sich im Kreis. Jede Tür sah gleich aus, aber in manchen Gängen saßen Männer in dicken Anoraks und wippten nervös mit ihren Aldi-Sportschuhen.
Endlich hatte auch sie ihren Platz gefunden. Vor ihr wartete eine junge Frau mit Kinderwagen. Die Frau, die beinahe noch ein Mädchen war, ließ das Gefährt mechanisch auf und ab wippen. Sie betrachteten einander. Kein Erkennen, nur Fremdheit. Mara ließ sich auf den Stuhl neben ihr fallen. Das Warten war das Schlimmste. Erledigt erledigt erledigt erledigt erledigt.
Ein dumpfes »Herein!«
Frau Kramer betrachtete Mara.
PAUL, ICH HÄTTE wissen müssen, dass Geschichten, die mit überfüllten Briefkästen und hervorquellenden Rechnungen beginnen, niemals gut enden. Vielleicht bin ich die Königin der Selbsttäuschung? In meinem Kopf spiele ich unsere erste Begegnung immer wieder durch. Ich erinnere mich an jedes Detail, als wäre es gestern gewesen; jede Erinnerung macht unsere Geschichte lebendiger.
Jetzt bist du fort. Früher rissen Menschen ihre Expartner aus gemeinsamen Bildern. Heute löschen wir Menschen aus unseren Accounts. Vorsichtshalber schaue ich deinen Instagram-Feed durch. Du bist noch da. Du hast dir nicht die Mühe gemacht, mich zu blockieren. Die Zeiten der Blockade sind vorbei, für dich bin ich gestorben.
Ich scrolle deine History rückwärts durch. Keine Spuren von mir, nirgends. Pics or it didn’t happen. Als hätte es uns als Wir nie gegeben. Als hätte ich für dich nie existiert. Auch in meiner Timeline gibt es keine Bilder von dir. Du bist abwesend, fort und doch da, denn die Bilder, die mich zeigen, nahm ich nur für dich auf.
Der 15.11.2017 war der Wendepunkt. »An diesem Tag«, sagt Facebook, traf ich dich zum ersten Mal. Das Bild in meiner Timeline zeigt einen übervollen Esstisch, darauf leere Bier- und Colaflaschen, Kirschlikör, Chips und Sandwiches. Im Aschenbecher am Bildrand qualmt eine Zigarette. Mit diesem Datum begann eine neue Zeitrechnung.
Für einen Moment kann ich die Regeln der Physik auf meiner Timeline außer Kraft setzen. Ich kann die Zeit vor- und zurückdrehen, nachträglich auslöschen, was nicht mehr gefällt oder nie geliket wurde. Und wenn doch etwas schiefgeht und ich erledigt bin, beginne ich einfach von vorn. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Notfalls tut es auch ein neuer Account.
Für dich bin ich so tot, wie Hanno es für mich ist. Hanno und seine »Wahnsinnsidee«. »Das ist der Wahnsinn«, hatte er gesagt, »das wird ein Knaller«. Und als der Knall kam, wollte er von dem Wahnsinn nichts mehr wissen. Jetzt steht mein Name in den Zeitungen, nicht seiner. »Die Hochstaplerin« titeln sie. »Eine neue Felix Krull«. Dabei will ich nur die alte Mara sein.
Der Hass trifft mich in Wellen. Benachrichtigungstöne, ununterbrochen. »Du Betrügerin. Schämst du dich nicht. Schämst du dich nicht?!!!« Mein Leben hat mich mit Scham imprägniert, doch diese Scham ist neu. Ich habe Menschen hintergangen, getäuscht, belogen. Menschen, die ehrliches Mitgefühl für mich hegten.
Irgendwann wird der Shitstorm vorübergehen. Man muss nur den Kopf einziehen, sich wegducken, notfalls alle Apps deinstallieren. Die Meute wird weiterziehen, wenn sich ein neuer, interessanterer Fall auftut. Die Zeitungen haben genug Kommentarspalten mit meinem Fall gefüllt. Es wird einen neuen Anlass für Empörungen geben, einen neuen Fall, der 4000 Zeichen-Kommentare rechtfertigt. »Literaturwissenschaftlich betrachtet«, so prophezeite Hanno allerdings, werde mein Fall noch lange Stoff für Doktorarbeiten liefern.
All die Tweets und Facebook-Kommentare, die mich als »aufmerksamkeitsgeile Nutte« bezeichnen, kann ich ignorieren, sogar die Mails; nicht aber die Briefe. Gute alte Briefe, die, in kleiner Krakelschrift gekritzelt, meinen Namen und meine Adresse enthalten. Mich mit Mord bedrohen. Mir auseinandersetzen, warum ich so verkorkst bin. All das für eine Lüge?
Trotzdem, Paul, bringe ich es nicht über mich, meine Online-Spuren zu löschen. All die Bilder, mein Leben. Pics or it didn’t happen. Ohne die Bilder wäre da nur die Irrelevanz eines Lebens, das aus Rechnungen und einem vollen Briefkasten besteht.
»WIE GEHT es Ihnen?«
Die schwierigen Fragen zuerst. Eben noch hatte Frau Kramer Mara gebeten, Platz zu nehmen. Nun saß Mara vor ihr und versuchte, die braun schimmernden Tränensäcke unter Frau Kramers Augen zu ignorieren. Vermutlich befand sich Frau Kramer selbst gerade in einer schwierigen Lage.
Sie spielten ihr übliches Spiel. Frau Kramer tat so, als könne sie sich an Mara und ihre Fallgeschichte erinnern. Und Mara tat so, als wolle sie wirklich auf Frau Kramers Hilfsangebote, hinter denen Strafandrohungen lauerten, eingehen.
»Naja, also, es geht schon«, antwortete Mara endlich auf Frau Kramers Frage.
»Ihre Problematik – also, die Depression, wie steht es dann damit? Haben Sie mir das neue Attest mitgebracht?«
»Also, das mit dem Attest«, stammelte sie. »Ich kam mal wieder nicht, Sie wissen schon, aus dem Bett, weil es mir so schlecht ging, und deswegen konnte ich nicht zum Arzt gehen und –«
Ihre Stimme erstarb.
Frau Kramer guckte mitleidig, antwortete jedoch mit der Konsequenz einer guten Mutter: »Aber wir brauchen schon etwas Offizielles, Frau Wolf, wirklich, das ist wichtig.«
Mara nickte eifrig. Schweiß brach ihr aus. Besuche bei Frau Kramer machten Mara nervös, weil sie glaubte, ihr eine kohärente Geschichte zu schulden. Warum hatte sie keinen Schulabschluss gemacht? Warum hatte sie den Schulbesuch verweigert? Mara fiel keine Antwort ein. Vielleicht irrte sich Mara, vielleicht wollte Frau Kramer gar keine kohärente Geschichte hören, vielleicht wollte sie nur ihren Job erledigen, der darin bestand, Biografien in Formulare zu zwängen. Eigentlich mochte Mara Frau Kramer, weil sie sich ihr gegenüber korrekt verhielt, und das war im Drehtürenkosmos keine Selbstverständlichkeit.
Maras Augen folgten Frau Kramers Händen, die in Jahrzehnten der Schreibtischtätigkeit eine traumwandlerische Sicherheit beim Zehnfingertastaturschreiben erworben hatten. So musste sie nicht auf die Tastatur schauen, um Worte oder Zahlenkombinationen einzutippen. Mara imponierte, wie flüssig Frau Kramers Finger über den am Rande ihrer Tastatur angebrachten Zahlenblock glitten, Zeige-, Mittel- und Ringfinger geführt von einer Überzeugung, die Anmaßung ähnelte. Immer wieder glichen ihre Augen das Protokoll an ihrem PC mit den Angaben in Maras Antrag ab. Der Antrag war einige Monate alt. Ihre persönlichen Umstände hatten sich seitdem nicht verändert, was das Amt nicht davon abhielt, ihr regelmäßig neue Fragebögen und Bescheide zuzuschicken, die sie nicht las, weil sie sie ohnehin nicht verstand. Nur der Blick auf ihr Konto verriet Mara, ob ihr Hartz-IV-Satz »aus Gründen« gekürzt oder erhöht worden war. Eigentlich war er nur einmal erhöht worden. In Folge von guter Konjunktur oder anstehenden Wahlen – wer wusste das schon so genau?
Mara wollte nicht glauben, dass es Frau Kramer war, die ihr die indifferenten, auf ungebleichtem Recyclingpapier gedruckten Schriftstücke mit Strafandrohungen zukommen ließ. Immerhin strahlte sie eine Form der Zugewandtheit aus, die sich überhaupt nicht in ihren Nachrichten widerspiegelte. Mehr noch, sie kommunizierte in einer ihr fremden Sprache. Wenn Frau Kramer in ihrem Büro von »Wiedereingliederungsmaßnahmen« und »Jobfitness« sprach, setzte sie die Begriffe in imaginäre Anführungszeichen, die ihre Distanz zu den Dingen unterstrichen. In ihren Briefen aber gab es nur Fettgedrucktes, das funktionalen Analphabeten das Lesen unübersichtlicher Bescheide erleichtern sollte.
Bescheide waren beinahe so schlimm wie Gutachten. Auch davon hatte Mara einige erhalten. Diagnosen von Ärzten, die kaum je länger als 45 Minuten mit ihr gesprochen hatten. Weil sie von unzähligen Psychiatern wechselnde Diagnosen erhalten hatte, Frau Kramer jedoch unmöglich ihre Psychobiografie offenbaren konnte, hatte sie sich eine vernünftig klingende Geschichte zurechtgelegt. Tod des Vaters, danach Absturz in der Schule. Depressionen, manchmal begleitet von Selbstverletzungen.
Um möglichst wenig sprechen zu müssen – Sprechen barg die Gefahr, etwas auszusagen, und Aussagen ließen sich dokumentieren, und dokumentierte Aussagen ließen sich als Lügen entlarven –, ließ Mara ihre Wunden für sich sprechen. Um ihrer Rolle in der Geschichte gerecht zu werden, fügte Mara sich vor den Terminen bei Frau Kramer mit einer Rasierklinge oberflächliche Schnitte an den Armen zu. Kleine Kratzer genügten; parallel gesetzt wirkten sie nicht zufällig. Mit frischem Grind überzogen, sahen die Wunden martialisch aus, heilten aber nach einigen Tagen ohne Narbenbildung ab. Mara fühlte sich schrecklich. Weil sie Frau Kramer, die doch immer so korrekt war, boshaft täuschte.
Mara hatte nicht bemerkt, dass Frau Kramer sie aufmerksam musterte.
»Vielleicht wäre es an der Zeit für Sie, eine arbeitsmarktaktivierende Maßnahme ins Auge zu fassen.«
»Natürlich, da haben Sie recht«, pflichtete sie bei und schob wie zufällig ihren linken Pulloverärmel hoch, um die frischen Schnittwunden zu entblößen. Als Frau Kramer die Schnitte bemerkte, schob Mara den Ärmel rasch wieder herunter. Ganz so, als hätte sie, die Irre, ihre Wunden unabsichtlich offenbart.
»Aber das eilt ja nicht«, sagte Frau Kramer gequält. »Erst einmal werden Sie wieder gesund!«
Sie tippte etwas in ihr Formular. Mara glühte vor Erleichterung.
»Sie reichen mir bitte bis zum Ende der Woche ein ärztliches Attest nach, in Ordnung? Und dann sehen wir uns nächsten Monat wieder.«
»In Ordnung.«
Beim Aufstehen griff sie erleichtert Frau Kramers Hand. Die Katze war aus der Box. Mara war nicht erledigt.
HEUTE HAST DU Instagram 78-mal geöffnet. Deine Verweildauer auf der App beträgt 4 Stunden und 42 Minuten. In diesem Zeitraum hast du 2 Bilder gepostet, 147 Bilder geliket. Du hast dich an 9 Diskussionen beteiligt, 12 Personen namentlich genannt, 23 Kommentare geliket. Du hast nun 1325 Follower.
Deine Facebook-Statistik fällt kürzer aus. Facebook ist schließlich etwas für alte Leute. Du hast 46 Minuten auf Facebook verbracht, 15 Beiträge geliket, 2 Beiträge kommentiert und 2 Messenger-Anfragen gelöscht. Du hast nun 872 Freunde. Ein Zehntel davon kennst du persönlich. Gregory hat dir ein Dinosaurier-Meme zugesandt. Einen T-Rex, der traurig ist, weil er nicht masturbieren kann. Du hast mit einem Grinse-Emoji geantwortet.
Auf Twitter hast du 17 Minuten verbracht. Du hast 5 Beiträge angeklickt und 2 Beiträge geteilt. Du hast nun 178 Follower.
Deine Top-Hashtags für diesen Tag sind: #thinsporation, #mua, #grungeaccount, #grungegirl, #kinderwhore, #pastelgrunge #makeup, #lipstick, #depression.
Dein Artikel mit der längsten Verweildauer: »Zehn Tricks, wie du nie wieder prokrastinierst!«
ICH BESUCHTE MUTTER wöchentlich, auch häufiger, wenn ich kein Geld für ein warmes Abendessen übrig hatte oder mich etwas weniger allein fühlen wollte. Natürlich schämte ich mich dafür, dass ich ausgerechnet zu ihr ging, wenn ich einsam war. Natürlich hätte ich ebenso gut zu Mark gehen können, aber manchmal fehlten mir die Nerven für seine endlosen Erzählungen über Wurmlöcher, elfdimensionale Räume und Quantensprünge. Natürlich hätte ich zu Ben gehen können, doch auch das war schwierig, schließlich hasste er mich ein bisschen. Und Charis, die liebevolle Charis, die mich an sich drückte und sich all meine Geschichten anhörte, überforderte mich. Ich ertrug ihre Lebendigkeit nicht, das Rauschen und Flirren, das sie umgab.
Mutter. Mutti. Wie sagt man mit 23? Mutter, das klingt zu unpersönlich. So habe ich sie nie genannt. Mama, das war vorbei, ja, dafür war es zu spät. Mutti. Das ging gerade noch so. Zehn Minuten Fußweg bis zu Mutti. Das war keine große Entfernung, nur ein Katzensprung, zu nah, um etwas Abstand zu gewinnen. Abnabeln leider verpasst. Zehn Minuten Fußweg, da riss die Nabelschnur nicht einmal ein.
Vorsichtshalber checkte ich mein Smartphone. Fünf neue Instagram-Nachrichten in nur einer Stunde. Ein guter Tag. 80 Likes in zwei Stunden. Die Welt hatte schon schlechter ausgesehen. Wenn nur Mutter diese Welt sehen könnte, meine persönliche Erfolgsgeschichte. Leider wusste sie nicht einmal, was ein soziales Netzwerk war.
Weil ich den kurzen Fußweg zu Mutti im Schlaf bewältigen konnte, blieben meine Augen auf mein Handy gerichtet. Ein Fußweg von meiner Wohnung zu der meiner Mutter, das entsprach dem Äquivalent von zwei Stunden Instagram-Timeline. Als ich vor der Tür meiner Mutter anlangte, hatte ich mich zwei Stunden in der Zeit zurückbewegt und fünf Influencerinnen bei ihren Morgenroutinen zugeschaut. Zeit war relativ, da hatte Mark vollkommen recht.
Ich stieß die Tür zu Mutters Wohnung auf. Die Wäschesituation war erneut eskaliert. Gleich hinter der Tür lagerte ein frischer Berg mit Bettzeug. Er war neu, anders als der Berg mit benutzten löchrigen Feinstrumpfhosen, die Mutti nicht wegwarf, weil man sie noch tragen konnte, etwa an kalten Tagen, unter Hosen, unter denen man die Löcher ohnehin nicht sah. Auch das Häufchen mit den orange- und zartrosafarbenen Schlüpfern links vor der Wohnzimmertür war neu. Mutti trennte ihre Wäsche streng, was man von dem Müll, der sich in der Küche türmte, nicht sagen konnte. Allein im Flur lagen fünf Wäschehäufchen, fein säuberlich sortiert in Weiß, Bunt, Hellbunt, Handtuchbunt und BH-Bunt. »Blusen immer separat waschen, sonst knubbelt die Baumwolle.« Von Mutter hatte ich alles Wichtige übers Waschen gelernt, bei ihr jedoch scheiterte es häufig an der praktischen Umsetzung.
Ich öffnete die Wohnzimmertür. Hinter ihr stapelten sich, bedrohlich hoch, leere, volle und halbleere QVC- und HSE-Kartons. Mutter hatte wieder einmal bestellt, obwohl sie wirklich nicht genug Geld für das überteuerte Gerümpel der Shopping-Kanäle besaß. Ihre neuesten Schätze waren eine ganze Batterie elektrischer Stumpenkerzen, die in Neonfarben leuchteten, sowie vier Aufbewahrungsboxen mit Kaminabbildung, die – ich hörte die Werbung der Shoppingkanäle regelrecht in meinen Ohren klingen – »ein so richtig heimeliges Gefühl in der Wohnung verbreiten«.
Muttis Kartonwirtschaft folgte einer eigenen Logik. Die halbleeren Kartons gingen nach Prüfung der Waren auf Tauglichkeit zurück an den Absender, wobei mindestens die Hälfte der Produkte durchfiel, auch weil sie sich nicht mehr erinnerte, dass sie sie je bestellt hatte. Die vollen Kartons warteten darauf, ausgepackt zu werden. Vielleicht würde sie das nie tun; bisweilen ging es ihr eher darum, die Dinge zu bestellen, mit der netten Dame am Telefon zu plaudern.
Die Dinge mussten jedenfalls nicht in ihren Schränken liegen, um sie glücklich zu machen, da diese ohnehin überquollen vor Pillendöschen, Bettwäsche- und Handtuchgarnituren sowie Streifenfrei-Fensterputztüchern. Dabei putzte Mutti ihre Fenster nie.
»Hier bin ich!«
Muttis Kopf erhob sich nur kurz von ihrem Sudokuheft, das vor ihr auf dem abgenutzten Couchtisch lag. Eine Antwort erklang nicht; stattdessen dröhnten die Stimmen der Ermittler ihres Lieblingsfernsehkrimis aus den Lautsprechern ihres Flatscreenfernsehers. Den besaß sie seit einigen Monaten, bezahlt von der Abfindung in Höhe von 700 Euro, die sie nach ihrer Kündigung von ihrem letzten Arbeitgeber erhalten hatte.
»Kannst du mal Kaffee ansetzen?«, fragte sie, noch immer vertieft in ihr Heft. Für die Sudokus hatte sie eine eigentümliche Lösungsstrategie entwickelt. Sie gab nichts auf die Regeln der Kombinatorik, setzte stattdessen probend und radierend »nach Gefühl« die Zahlen in Kästchen, immer bereit, sie wegzuradieren und auszulöschen, wenn sie nicht passten. Das taten sie selten.
Lange Zeit war mir ihr Rätseln ein Rätsel gewesen. Es ging ihr nicht um den Spaß an der Logik; die Zahlenrätselei hatte lediglich eine andere Form der Zahlenprüfung ersetzt. Damals, als Mutters Schuldenberg noch größer als ihre Wäscheberge gewesen war, hatte sie Stunden damit zubringen können, Listen mit den monatlich zu leistenden Ratenzahlungen zu führen. Ganze A4-Blöcke hatte sie mit Fixkosten, Raten fürs Auto, Sofas, die sie längst nicht mehr besaß, für Fernseher und Geschirrspüler, mit den nächsten QVC-Raten und den überfälligen GEZ-Gebühren gefüllt.
Mutters Berechnungen hatten darauf basiert, sich asymptotisch dem Tag X zu nähern. Am magischen Tag X, der am Ende der Blöcke mit Daten wie »Mai 1996« oder »Februar 2014« vermerkt war, würden alle Schulden getilgt, alle Raten bezahlt sein, behauptete sie. Natürlich scheiterte das Vorhaben an den immer neuen Raten und Schulden, die sie sich bei ihrem schmalen Gehalt und der noch schmaleren Rente aufbürdete. Trotz allem hat Mutti das Rechnen nie aufgegeben.
In der Küche roch es unangenehm; Muttis Mülleimer quollen wieder einmal über. Hartnäckig versuchte ich, die alte Filtertüte in den Biomüll zu quetschen; der Behälter blieb danach halboffen stehen. Zögerlich öffnete ich den Vorratsschrank, an dessen Türen Lebensmittelmotten auf kleinste Erschütterungen lauerten. Von Zeit zu Zeit nährte Mutters enormer Vorrat von Lebensmitteln Legionen von Motten, deren feine Gespinste die Innenseiten der Reis-, Tee- und Nudelkartons überzogen. Kaffee war das einzige unbedenkliche Lebensmittel in diesem Schrank. Ich betrachtete die Raupen, die sich in den Mehlresten auf dem Schrankeinlegeboden suhlten. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich nicht ein Video machen sollte. Aber die 90er waren vorbei, und Instagram war nicht MTV.
Stattdessen ging ich zurück ins Wohnzimmer, wo ich mich neben Mutti aufs Sofa fallen ließ. Sie rätselte noch immer, dennoch entging ihr mein Versuch, heimlich das Programm zu wechseln, nicht.
»Ich gucke das.«
»Dann ist ja gut.«
Manchmal fragte ich mich, warum sie mich wie Luft behandelte, warum sie meine Nähe wünschte, aber durch mich hindurchsah, als sei ich unsichtbar; ein Geist, der sich nur durch die Dinge, die er bewegte, bemerkbar machte. Sie saß nur da, tagein, tagaus, wie verwachsen mit dem Sofa, während sich der Ring aus Verpackungsmüll immer dichter um sie schloss. Kartons auf dem Esstisch, dem Sofa, auf den Stühlen und dem Sessel. Berge gewaschener und gefalteter Wäsche, die nie ihren Weg in die Schränke fand. Es war unmöglich geworden, durch Mutters Kokon aus Karton und Baumwolle zu ihr hindurchzudringen.
Mutti hatte immer in ihrer eigenen Welt gelebt. Vielleicht gab es deshalb keine Bilder, die uns zeigten; vielleicht hatte ich deshalb keine Erinnerungen an meine Kindheit. Pics or it didn’t happen.
Mutters Augen tränten wieder. Das lag wohl an der Dunkelheit, die tagsüber in ihrem Wohnzimmer herrschte, weil sie die Vorhänge geschlossen hielt. »Die da drüben starren immer in mein Wohnzimmer«, schimpfte sie empört, sobald sich Menschen in den umliegenden Häusern ihren Fenstern näherten.
»Dann gehe ich mal den Kaffee holen.«
Ich zog die Kanne aus der Maschine, wobei ein letzter Kaffeetropfen zischend auf der Heizplatte der Maschine landete.
»Mach das wieder sauber!«, schimpfte Mutti aus dem Wohnzimmer.
Sie mochte keine Wassertropfen. Ihre Spüle hielt sie makellos sauber, egal wie viel Geschirr sich ringsum stapelte. Geschirr spülte sie im Spüler, allerdings nur dann, wenn ihre Motivation es hergab. Ich wischte die Kaffeemaschine sorgfältig aus, spülte den Lappen, tupfte sogar die Wassertropfen vom Edelstahl der Spüle, um keinen Streit zu provozieren.
Im Wohnzimmer lief nun nicht mehr Law & Order, sondern CSI New York. Immerzu wurden irgendwo Mörder oder Vergewaltiger gesucht. Mutter schaute selten etwas anderes, wobei sie in letzter Zeit True-Crime-Serien bevorzugte. All die entführten Kinder und verstümmelten Frauen wären zu viel für die härtesten Kerle; Mutter steckte all das weg. Während ich den letzten Schluck Kaffee schlürfte, schloss der Ermittler im Fernsehen symbolisch die Akte des nunmehr gelösten Falles.
»Dann gehe ich jetzt mal«, sagte ich.
Mutter nickte mir unentschlossen zu.
»Im Kühlschrank liegt noch ein Beutel für dich.«
Vorfreudig riss ich den Kühlschrank auf. Mutter hatte einen riesigen Fressbeutel für mich gepackt. Der Beutel nahm beinahe die Hälfte des geräumigen Kühlschranks ein und wäre genug Proviant für eine zwölfköpfige Reisegruppe gewesen. Im Beutel stapelten sich Wurst- und Käsepackungen, Trinkschokolade in Plastikbechern, Joghurts, Milchschnitten und anderer Süßkram. »Wie lieb von dir«, rief ich ins Wohnzimmer hinüber.
Schließlich schloss ich die Wohnungstür hinter mir und atmete durch. Noch immer hing der süßlich-faule Geruch der Wohnung an mir. Ich schüttelte mich. Ein Bild flackerte in meinem Kopf auf: Die Schrankmotten zuckten im Rhythmus der Kaffeetropfen.
FRAU KRAMER ließ nicht locker. Sie hatte mir per Mail einen Fragebogen zugeschickt, in dem in winzig kleine Zeilen gepresst Worte wie »Schulausbildung« und »Qualifikationen« standen. Der Fragebogen könne mir helfen, mich selbst zu ordnen, meine Qualifikationen zu erfassen, hatte sie mir in ihrer Mail mitgeteilt. Womit Frau Kramer wohl meinte, dass ich erfasst werden sollte; von dem System, in das mich bisher noch niemand erfolgreich integriert hatte. Oder es verhielt sich doch anders, und es ging gar nicht um eine Einordnung in das System, die auf mögliche Eingliederungsmaßnahmen und weitere Anträge hinauslief. Vielleicht ging es einzig und allein darum, Frau Kramer zu helfen, mich in ihrem Computerformularsystem abzulegen. Unter H wie hoffnungslos. Als ich Frau Kramer kennenlernte, hatte sie noch versucht, mich dazu zu überreden, meinen Schulabschluss nachzuholen. »Eine junge, intelligente Frau wie Sie. Ich verstehe gar nicht, warum. Und ihre Noten waren doch auch. Das passt ja gar nicht ins Bild. Eine gute Schülerin und dann das. Wie konnte es denn nur dazu kommen?« Inzwischen hatte sie die Hoffnung wohl aufgegeben.
Meine Augen wanderten erneut über das Formular. Die Spalten waren winzig klein, und sofern man nicht ein griffiges Wort hatte für das, was man war – Bäcker, Lehrerin, Polizist – war der Versuch, sich einzupassen, hoffnungslos. Trotzdem gab ich nicht auf. Für Frau Kramer, die sich immerhin Mühe mit mir gab. Noch einen Anlauf. Wer bin ich?
Frau. Deutsch. 23. Geboren wo? Abschluss. Abgangszeugnis 9. Klasse. Dreikönigsgymnasium Dresden. Notenschnitt. Schlecht. Zuletzt jedenfalls. Ein halbes Jahr zuvor: Einserschülerin. Was war in der Zwischenzeit passiert? Nichts. Dieses Nichts war das Problem. Die Psychologen hatten mich aufgegeben, weil sie keinen Leidensdruck feststellen konnten, und ohne Leidensdruck, so der Grundsatz, konnte man niemanden behandeln. Sie hatten allerdings nicht gründlich nach meinem Leid geforscht. Und so probierte ich Diagnosen an, wie andere Menschen Kleider. Es gab so viele Maras wie Diagnosen.
Nachname. Wolf. Vorname. Mara. Mara Wolf, wer bist du? Das Formular sagt, dass du eine Frau bist. Mara – das ist ein praktischer Name, weil er gut in die Formularspalten passt.
»Mara, das ist so ein Meerschweinchen, nicht wahr?«, hatte Mark mich gefragt, als er mich kennenlernte. Hallo, I bims, 1 Mara, lol. Mark war mein einziger Freund gewesen, bis ich das Netz mit seinen ungezählten Chatrooms und Foren für mich entdeckt hatte.
Man nehme 1 Mara und setze es in ein Netz. Mara sitzt allein in ihrem Zimmer, aber da, in ihrem Computer, gibt es ein Fenster zur Welt, und sie kann treffen und sprechen und hören, wen sie will. Immer schön auf Distanz, immer aus der Ferne. Plötzlich hat Mara Freunde, Nina123 und Luise86. Littlegothgirl und nerdbase. Gregory und Matthias, Amy und Josh. Freunde über Freunde, und niemand weiß, wer diese Mara ist, was okay ist, denn Mara weiß es ebenso wenig. Zum Glück existierte Instagram nicht, als ich die Schule verließ. Es gab keine Bildkacheln, keine Selfies, nur alberne Avatare. In Chatrooms ging es allein um den getippten Text, unbedarfte Versuche, Freundschaften mit gesichtslosen Menschen zu schließen, weswegen man auch nicht befürchten musste, sein Gesicht zu verlieren. Ben sagt, die Chatrooms seien meine Fantasiewelt gewesen und dass ich noch immer in einer Fantasiewelt lebe. Der Chat allerdings ist keine Fantasie, solange die anderen antworten, solange die anderen nicht verstummen. So wie catgirl90, die nicht mehr auftauchte, und das, wo sie doch zuvor so traurig gewesen war. Nach einer Weile fragten wir, ihre Chatfreunde, nicht mehr nach, was denn wohl aus catgirl90 geworden war. Ihr Profil blieb wie eingefroren, das Bild zeigte den immergleichen Katzenavatar, nichts veränderte sich mehr. Das Netz hatte sie konserviert.
Deshalb wusste das Netz so viel von mir. Besser als das Netz kannte mich nur Frau Kramer. Sie kannte sogar meine Atteste, die meine Diagnose enthielten, die lediglich mit einer Zahl codiert war, sich aber mithilfe des ICD-10 leicht entschlüsseln ließ. Frau Kramer hatte damit Zugang zu meinem innersten Inneren, der gut gehüteten Blackbox. Frau Kramer musste all das wissen, weil sie meinen Antrag sonst leider nicht bearbeiten könne. Also gab ich ihr, was sie wollte. Nur keine Deutungshoheit. Wer ich sein wollte, das wusste nur das Netz. Wenn ich Social Media nur genug von mir selbst verriet, wenn es mir gelang, ein zweites Ich in die Welt zu setzen, würde es irgendwann die Informationen zu meinem wahren Selbst überlagern. Da war ich mir ganz sicher.
MUTTIS VORRÄTE ernährten mich tagelang. Das versetzte mich in die komfortable Lage, meine kleine Höhle nicht mehr verlassen zu müssen; nicht einmal, um einen Nachschub an Katzenfutter zu besorgen. Immerhin blieb mir so mehr Zeit, mich auf meine Instagram-Karriere zu konzentrieren und endlich gute Bilder zu machen. Ich wartete bereits sehnlichst auf die neueste Klamottenbestellung, die noch immer nicht eingetroffen war. Die Tracking-Software hatte die immer gleiche, entmutigende Botschaft vermeldet: Warten auf Versandbestätigung. Schon befürchtete ich, dass es sich der Online-Shop anders überlegt hatte, dass nicht einmal er mehr an meine Solvenz glaubte, dass er mir nie wieder etwas zusenden würde. Dann, kurz nach Mitternacht, die erlösende Meldung: »Dein Paket befindet sich auf dem Weg.«
Den ganzen Vormittag hatte ich damit zugebracht, auf meinem Bett zu lauern. Auf keinen Fall würde ich die Wohnung verlassen, um zu riskieren, dass keiner der Nachbarn auf das Klingeln des Boten reagierte, auf dass das Paket im Versandnirvana zwischen Lieferantenfahrzeug und Paketstation festhinge. Endlich erklang das erlösende Geräusch der ins Schloss fallenden Lieferwagentür. Es war nur eine Frage von Sekunden, bis der freundliche Mann mit dem geflochtenen Kinnbart an der Tür klingeln würde. Meine Nervenenden britzelten. Da war es, das verheißungsvolle Klingeln. Ich sprintete zur Tür, schreckte den Kater auf, der es sich auf dem Turm von halbvollen Versandhauspaketen gemütlich gemacht hatte. Halb irre raste er in den Flur, überholte mich auf dem kurzen Weg und blieb mit aufgerissenen Augen vor der Tür stehen. Wie in Trance drückte ich den Türöffner und wartete ungeduldig auf den Klang der schweren Schritte auf der Holztreppe. Ich wusste, dass der Bote auf mein Entgegenkommen wartete; unentschlossen trat ich aus meiner Tür, stapfte langsam dem unteren Treppenabsatz entgegen.
»Eine Unterschrift brauche ich. Aber du kennst das ja.«
Ich nickte und kritzelte mit meiner Fingerkuppe meinen Namen auf das Display seines Scanners.
Oben angekommen platzierte ich das Paket feierlich auf meinem Bett. Für einen Moment verweilte ich vor der Box, betrachtete den schlichten Karton, genoss die Spannung, die sich in mir ausbreitete und die sich oft genug nach dem Öffnen des Pakets verflüchtigte. Weil sich der chemische Geruch der Waren im Raum entfaltete. Weil sich die Polyesterteile billig und kratzig anfühlten.
Ich löste die Plastikstreifen, die das Paket fest verschlossen hielten, schüttete schließlich den gesamten Inhalt des Paketes auf meinem Bett aus. All die Tütchen mit den kleinen und großen Geschenken. Der Ratenkauf ermöglichte mir immer neue Geschenke an mich selbst.
Ben nannte das verantwortungslos. Ben sprach von »Fast Fashion«, seit er eine Doku auf Youtube gesehen hatte. Dabei betrieb ich doch nur eine weitere Form der Kreislaufwirtschaft, denn die wenigsten Sachen blieben bei mir. Ich trug sie nur für Fotos, verpackte sie erneut, ließ sie zurückgehen, damit andere sich daran erfreuen konnten.
Ich riss Beutel um Beutel auf. Mit jedem Teil gewann ich an Fahrt, rupfte die Kleidchen von ihren Bügeln und schlüpfte eilig in die Kleider. Die Hälfte landete sofort auf dem Retourenstapel. Ich war noch immer zu dick, selbst Teile in 38 wollten partout nicht über meine Hüften passen. Jetzt rächte sich das Leben auf Basis von Muttis ungesunden Schnäppcheneinkäufen aus der Angebotsecke des Discounters.
Endlich entdeckte ich das Königsteil, jenes Stück, das mir wirklich stand, »das etwas für mich tat«, wie es die Modeinfluencerinnen zu sagen pflegten. Ein Meshkleid mit grünem Tigerprint, das sich an meinen Körper schmiegte und meine breiten Schenkel kaschierte. Zeit für Fotos.
Da leuchtete eine Messenger-Benachrichtigung auf meinem Handydisplay auf.
»Hey.«
»Hey.«
»Na?«
»:)«
»Wie geht’s?«
»Geht so.«
»Kann man mit dir mal was unternehmen?«
Ich klickte auf »Blockieren« und öffnete die Kamera.
Ich hasste, was ich sah. Zu viel Gesicht, zu viel Nase, zu viel Wangenknochen. Zu viele zu große Poren. Ich tippte auf den »Verschönern«-Modus und drehte ihn herauf auf Zehn. Von meinem Gesicht blieb nur ein grober Fleck; ich hatte mich zu einem Pfannkuchen weichgezeichnet. Ich reduzierte den Effekt auf Fünf: Das war das korrekte Verhältnis von Fakt und Fake. Dann knipste ich dutzende Bilder. Keines gelang. Licht oder Pose stimmten nicht, der Kamerawinkel verzerrte meine Armlänge; meine Brüste wirkten unnatürlich groß oder zu klein. Als ich endlich das richtige Foto gefunden hatte, klickte ich auf »verbessern«: Kleinere Nase, weichgezeichnetes Gesicht, optimierte Augen, weißere Zähne. Eine komplette Bitchectomy. Ich war nicht zu hässlich; ich war nur zu arm. Mit dem nötigen Kleingeld würde ich ungefiltert in der Welt verkehren können.
»HIER IST NOCH FREI, nehme ich an?«
Mara blickte auf. Vor ihr stand ein Mann mittleren Alters, ganz in Schwarz gekleidet, ein Astra in der Hand und schaute auf sie herab.
»Ja.«
Sie bereute ihre Zustimmung umgehend. Eigentlich wartete sie auf Charis, die gleich ihre Kollegin an der Bar ablösen würde, was bedeutete, dass sie die ganze Nacht über Zeit für Mara haben würde, ihr von Zeit zu Zeit eine kostenlose Cola und ein mit Salzstangen gefülltes Longdrinkglas über den Tresen reichen würde.
»Puh, danke«, stöhnte der Mann, während er sich auf den Ledersessel neben ihr fallen ließ. »Die Bar ist echt voll, außerdem faselt dort ein Hippie über die Bedrohungen der Freiheit durch die Intervention der Silicon Valley-Kapitalistenmafia im Wahlkampf.«
Mara sah zur Bar hinüber. Dort saß Ben, der es seit Wochen auf Charis’ Kollegin an der Bar abgesehen hatte, weswegen er unentwegt am Tresen herumlungerte und die Männer um ihn herum in Gespräche verwickelte. Mara hatte sich eine Pause von ihm nehmen wollen. Also hatte sie sich in die hinterste Ecke des Raumes verdrückt, neben dem Eingang zu den Toiletten, wo gemütliche Sofas standen, aber der Geruch der WCs herüberwehte.
»Mh«, sagte sie, blickte zurück auf ihre Zeitschrift, nur um über deren Rand hinweg zur Tür zu linsen. Wo blieb Charis nur?
»Ich heiße Hanno.«
»Ja«, sagte Mara, als sei die Feststellung zwangsläufig.
»Bist nicht so gesprächig, was?«
»Ja. Ich meine: nein, ich meine: Ich warte auf jemanden.«
»Cool, dann können wir gemeinsam warten.«
Er streckte die Hand aus; Mara blieb nichts anderes übrig, als danach zu greifen. Sie betrachtete ihn. Ein Berufsjugendlicher; nicht, dass man ihm das mittlere Alter nicht ansah. Man sah jedoch, dass er sein Leben nicht mit harter Arbeit zugebracht hatte. Sein dichtes blondes Haar hatte er mit etwas Gel aufgestylt; es erinnerte an eine kurze Version einer 80er-Jahre-Punkfrisur.
»Dein Name lautet wie?«, er bewegte die Hand, als müsste er ihren Gedanken auf die Sprünge helfen.
»Mara.«
»Oh, das ist ein schöner Name. Ich dachte, du bist so ne Mandy.«
Mara verzog das Gesicht.
»Nur Spaß. Kommst du aus Dresden? Hört man gar nicht?«
Niemand in Maras Alter, der etwas auf sich hielt, sprach Dialekt.
»Du siehst süß aus, wenn du dich ärgerst«, sagte er grinsend.
Wo blieb Charis?
»Sorry, mal im Ernst: Was machst du? Siehst interessant aus. Dein Look und so. Nicht so uniform. Weder dieser uniforme Ossistudentenlook, den man hier überall in der Kneipe sieht, noch der ubiquitäre Hipsteraufzug.«
»Ich mache nichts.«
»Cool. Wie macht man das so – nichts?«
»Es ist wirklich nicht schwer, weißt du. Man lässt sich treiben und die Tage vergehen.«
»Aus Protest?«
»Nö. Alternativlosigkeit.«
»Eine junge, alternativlose Frau. Das gefällt mir.«
Mara überlegte, ob er einer dieser Loverboys war, vor denen Frauenzeitschriften manchmal warnten. Einer, der Frauen anmachte, einlullte und zwangsprostituierte. Dafür wirkte er zu harmlos.
»Machst du Musik, Kunst, Performance?«
»Ich mache nichts. Wirklich gar nichts. Nur ein paar Fotos.«
»Ah, Model?«
Beide lachten laut auf.
»Du nimmst mich nicht ernst.«
»Nimm’s nicht persönlich. Berufskrankheit.«
»Welcher Beruf?«
»Agent. Kolumnist. Vernetzer. Ich bringe spannende Menschen zusammen.«
»Also machst du auch nichts?«
Er lachte. »Sehr gut. Du bist ganz interessant, Mara. Im Gegensatz zu dieser Stadt. Geht mir tierisch auf den Sack.«