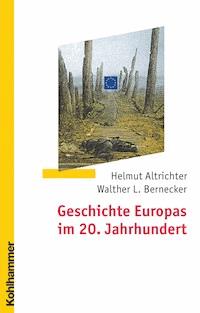12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sowjetunion ging vor mehr als drei Jahrzehnten unter, doch ihr Erbe wirkt bis heute nach. Das vorliegende Buch bietet ein chronologisches, knapp gefasstes Porträt der einstigen Supermacht und zeigt ihre Entwicklung von den Anfängen über den Bürgerkrieg, den Stalinismus, den Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg bis hin zur Auflösung unter Gorbatschow. Ein Ausblick fragt, wie die Schatten des Imperiums die russische Politik immer noch prägen, bis hin zum Angriff auf die Ukraine. Wer einen bestimmenden Faktor in der Geschichte des 20. Jahrhunderts und die einzelnen Phasen seiner Geschichte sowie die Nachwirkungen in der Gegenwart verstehen will, der findet in diesem Buch eine brillant geschriebene und vorzüglich dokumentierte Darstellung. Es wäre falsch, eine Geschichte der Sowjetunion nur als Geschichte der Schwäche, der Krise und des Scheiterns zu schreiben. Damit wäre kaum zu erklären, warum die Sowjetunion immerhin mehr als zwei Generationen Bestand hatte, warum sie Jahrzehnte wechselhafter Entwicklungen im Innern und nach Außen, den Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg überlebte; warum sie in ihrem Selbstverständnis wie in dem ihrer Gegner zur Weltmacht aufstieg, mit einem militärischen Potential, das der Westen lange Zeit als lebensbedrohlich empfand. Wer die einzelnen Phasen der sowjetischen Geschichte verstehen will, findet in Altrichters Buch eine brillant geschriebene und vorzüglich dokumentierte Darstellung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Helmut Altrichter
Kleine Geschichte der Sowjetunion 1917–1991
C.H.Beck
Es wäre falsch, eine Geschichte der Sowjetunion nur als Geschichte der Schwäche, der Krise und des Scheiterns zu schreiben. Damit wäre kaum zu erklären, warum die Sowjetunion immerhin mehr als zwei Generationen Bestand hatte, warum sie Jahrzehnte wechselhafter Entwicklungen im Innern und nach Außen, den Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg überlebte; warum sie in ihrem Selbstverständnis wie in dem ihrer Gegner zur Weltmacht aufstieg, mit einem militärischen Potential, das der Westen lange Zeit als lebensbedrohend empfand. Wer die einzelnen Phasen der sowjetischen Geschichte verstehen will, findet in Altrichters Buch eine brillant geschriebene und vorzüglich dokumentierte Darstellung.
Helmut Altrichter, geb. 1945, Dr. phil., war von 1990 bis 2012 Universitätsprofessor für osteuropäische Geschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Wichtigste Veröffentlichungen: Konstitutionalismus und Imperialismus. Der Reichstag und die deutsch-russischen Beziehungen 1890–1914, Frankfurt 1977; Staat und Revolution in Sowjetrussland 1917–1922/23, Darmstadt 1981 (2. Aufl. 1996); Die Bauern von Tver. Vom Leben auf dem russischen Dorfe zwischen Revolution und Kollektivierung, München 1984; Russland 1917. Ein Land auf der Suche nach sich selbst, Paderborn 1997; Russland 1989. Der Untergang des sowjetischen Imperiums, München 2009; Quellenbände sowie Aufsätze, Beiträge und Rezensionen zur deutschen, russischen und sowjetischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in Sammelbänden und Fachzeitschriften.
Inhalt
Einleitung
I. Russland vor der großen Wende
1. Erschütterung und Reform
2. Krieg und Revolution
3. Die Provisorische Regierung
4. Ihr Scheitern
II. Die Oktoberrevolution 1917
1. Die Errichtung des Rätestaates
2. Der Umbruch von Wirtschaft und Gesellschaft
3. Die Rolle der bolschewistischen Partei
4. Existenzsicherung und weltrevolutionäre Hoffnung
III. Bürgerkrieg und Kriegskommunismus (1918–1921)
1. Die Zentralisierung der Macht
2. Die Militarisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
3. Auf dem Weg in die Einparteiherrschaft
4. Der Kriegskommunismus
IV. Die „Neue Ökonomische Politik“ (1921–1928)
1. Die Liberalisierung der Wirtschaftsverfassung
2. Der Neuaufbau der Räte
3. Der Wandel der Parteiorganisation
4. Von der RSFSR zur UdSSR
V. Stalins Revolution von oben (1928–1932)
1. Die Ausschaltung der innerparteilichen Opposition
2. Die forcierte Industrialisierung
3. Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft
4. Mobilisierung und Repression
VI. Der „Aufbau des Sozialismus in einem Lande“ (1932–1939)
1. Auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaft
2. Die Wirtschaftsplanung und ihre Ergebnisse
3. Der Stalinistische Staat
4. Von der „kollektiven Sicherheit“ zum Pakt mit Hitler
VII. Der „Große Vaterländische Krieg“ (1939–1945)
1. Im Bund mit dem nationalsozialistischen Deutschland
2. Der deutsche Überfall
3. Staat und Gesellschaft im Kriege
4. Die Sowjetunion in der Kriegsallianz
VIII. Der Aufstieg zur Weltmacht (1945–1953)
1. Der Wiederaufbau der sowjetischen Wirtschaft
2. Die Disziplinierung von Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft
3. Die Doppelherrschaft von Partei- und Staatsbürokratie
4. Die Formierung des Sowjetimperiums
IX. „Tauwetter“ und Entstalinisierung (1953–1964)
1. Der Kampf um die Nachfolge
2. Die Entstalinisierung von Staat und Gesellschaft
3. Der vermeintlich kurze Weg zum kommunistischen Wohlfahrtsstaat
4. Friedliche Koexistenz oder Weltrevolution?
X. Zwischen Entspannung und Erstarrung (1964–1982)
1. Das politische System: Von der Stabilisierung zur Stagnation
2. Zwischen Markt und Macht: Grenzen des Wirtschaftswachstums
3. Nonkonformes Denken, Samizdat und Menschenrechtsbewegung
4. Das Dilemma der Entspannungspolitik: Ziel oder nur Mittel?
XI. Von der Reform zur Auflösung (1982–1991)
1. Auf der Suche nach einer neuer Politik
2. Von der Systemreform zum Systemwandel
3. Der Zerfall der Staatsideologie
4. Das Ende der Sowjetunion
XII. Ausblick
1. Die wilden 90er Jahre
2. Der Ausbau der Zentralgewalt
3. Die „gelenkte Demokratie“
4. Mit Gewalt zurück zu alter Macht?
Tabellen und Schaubilder
Wichtige Daten der sowjetischen und postsowjetischen Geschichte
Karten
Abkürzungen
Literaturhinweise
Bildnachweise
Personenregister
Einleitung
Mehr als 30 Jahre ist es her, dass die „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ zerfiel, der Warschauer Militärpakt und der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) sich auflösten, Ost und West sich anschickten, wieder zu bloßen Himmelsrichtungen zu werden. Eine Epoche ging damit zu Ende: die Ära des Kalten Krieges, der Teilung der Welt. Gewiss, es war eine maßlose Übertreibung, wenn der stellvertretende Chef des Planungsstabes im amerikanischen Außenministerium (Francis Fukuyama) Anfang der 90er Jahre in der liberalen westlichen Demokratie den „Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit“ und in ihrem Sieg über den Kommunismus das „Ende der Geschichte“ schlechthin sehen wollte; entsprechend heftig war die Kritik. Doch dass das Faktum eine tiefe Zäsur, ein Jahrhundertereignis markierte, blieb davon unberührt.
Ende Dezember 1991 war Michail Gorbatschow als sowjetischer Staatspräsident zurückgetreten, nachdem zwei Wochen zuvor drei der wichtigsten Teilrepubliken (Russland, Weißrussland und die Ukraine) den Staat für aufgelöst erklärt und eine neue „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (GUS) gegründet hatten. In ihr gab es nicht mehr, was die Sowjetunion – in ihrem Selbstverständnis und dem ihrer Gegner – über Jahrzehnte ausgemacht hatte: Die kommunistische Partei hatte ihr Machtmonopol und ihren Führungsanspruch verloren; in weiten Teilen des Landes war ihr jegliche Aktivität verboten, ihr Vermögen beschlagnahmt und treuhänderischer Verwaltung unterstellt. Mit ihr hatte auch der Marxismus-Leninismus als Staatsideologie ausgedient. Vergessen war, dass der Übergang zur sozialistischen Planwirtschaft einst als Sieg über die „Anarchie des Marktes“ gefeiert worden war. Was Anarchie des Marktes ist, hatte man inzwischen am eigenen Leibe erfahren, und die Situation der Gesamtwirtschaft ließ sich nur als chaotisch bezeichnen. Vergleichbares galt für die Gesellschaft. Die ethnischen Gruppen und Nationalitäten, von denen noch Mitte der 80er Jahre gesagt worden war, dass sie ein einheitliches Volk, „das Sowjetvolk“ bilden, lagen miteinander im Konflikt, und statt wie vorgesehen „brüderliche Freundschaft“ zu zeigen, herrschte mancherorts seit dem Ende der 80er Jahre der offene Bürgerkrieg. Was im Zeichen von Aufklärung und Umbau, „glasnost’“ und „perestrojka“ begonnen worden war, hatte eine unbeherrschbare Eigendynamik entwickelt, endete in Chaos und Auflösung.
Längst war die Krise der Führungsmacht auch zur Krise des Sowjetimperiums geworden. Ihre Symptome waren seit Ende der 80er Jahre unübersehbar. In Ungarn hatte im Mai 1988 der kommunistische Parteichef Kádár seinen Rücktritt erklärt und damit den Weg für tiefgreifende Wirtschafts- und Verfassungsreformen freigemacht, die dem Sozialismus die Vorherrschaft und schließlich den Kommunisten die Macht kosteten. Bei einem Besuch in Moskau Anfang Juli 1988 hatte der ungarische Partei- und Regierungschef Grósz die Zusicherung erhalten, dass sich die Sowjetunion in die inneren Angelegenheiten Ungarns nicht einmischen werde und die sowjetischen Truppen abgezogen würden. In Polen hatten neue Streikwellen im Sommer 1988 zum ersten offiziellen Kontakt zwischen dem Innenminister und dem Führer der (seit 1981) verbotenen Gewerkschaft „Solidarität“ geführt. Im Januar 1989 billigte das Zentralkomitee der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ein Programm des gewerkschaftlichen und politischen Pluralismus. Bei den Parlamentswahlen im Juni 1989 erzielten die oppositionellen Bürgerkomitees der „Solidarität“ einen hohen Wahlsieg. Ende August 1989 wurde Tadeusz Mazowiecki mit überwältigender Mehrheit zum (seit mehr als 40 Jahren ersten) nichtkommunistischen Regierungschef Polens gewählt. In Prag forderten Großdemonstrationen im November 1989 die Beendigung der kommunistischen Einparteiherrschaft, die Aufnahme eines echten Dialogs mit der Opposition und demokratische Reformen. Die sich verschärfenden Auseinandersetzungen zwangen Staatspräsident Gustáv Husák, Leitfigur des Regimes seit dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten 1968, zum Rücktritt; Präsident der Bundesversammlung wurde Alexander Dubček, bis zum Einmarsch Parteichef und Symbol des „Prager Frühlings“, und Staatsoberhaupt der Schriftsteller Václav Havel, im Februar 1989 noch wegen „Rowdytums“ zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. In die gleiche Zeit und den gleichen Zusammenhang gehörten der Sturz Todor Schiwkows in Bulgarien (am 10. November 1989), die Festnahme und Hinrichtung Nicolae Ceauşescus (am 25. Dezember 1989) in Rumänien und die stürmischen Ereignisse in der DDR, die von Großdemonstrationen im Oktober über den Sturz Erich Honeckers als Staats- und Parteichef zur Öffnung der Berliner Mauer (am 9. November 1989) und zum raschen Ende des SED-Regimes führten. Die anschließenden Zwei-plus-Vier-Gespräche kamen im Herbst 1990 zu einem Abschluss und gaben dem vereinten Deutschland die volle Souveränität zurück.
Im November 1990 paraphierten die Verhandlungsführer der 16 NATO-Mitglieder und der 6 Staaten des Warschauer Vertrages in Wien den Vertrag über konventionelle Abrüstung in Europa, gleichzeitig war auch bei den parallel geführten Verhandlungen der KSZE-Staaten über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen eine Einigung erzielt worden. Sie ebnete den Weg für ein Gipfeltreffen, zu dem sich Ende des Monats die Staats- und Regierungschefs der KSZE-Staaten in Paris versammelten. Sie verabschiedeten die „Charta von Paris“, in der sie „das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas“ für beendet erklärten. Für die meisten ihrer Mitglieder hatten Warschauer Pakt und RGW damit wohl endgültig ihre Bindekraft verloren, selbst wenn sie erst ein halbes Jahr später, im Sommer 1991, offiziell zu Grabe getragen wurden, wovon einleitend bereits die Rede war. Es war ein Begräbnis dritter Klasse: Zur Auflösung des RGW kamen nur noch Beauftragte der Regierungen, nicht (wie noch im Januar geplant) die Regierungschefs nach Budapest, und die Unterzeichnung des knappen Protokolls zur Beendigung des Warschauer Vertrages erfolgte Anfang Juli 1991 in Prag, nachdem in den Wochen zuvor die letzten sowjetischen Truppen die Tschechoslowakei und Ungarn bereits verlassen hatten.
Hatte die bolschewistische Revolution, hatten die Oktobertage des Jahres 1917, wie der amerikanische Journalist John Reed schrieb, „die Welt erschüttert“, so waren der Zerfall der Sowjetunion und die Auflösung des Sowjetimperiums kaum weniger welterschütternd. Wenn dies erst allmählich ins Bewusstsein drang, so wohl auch deshalb, weil diese erneute Revolution, zumindest im Zentrum der Macht, weitgehend friedlich verlief und auch die Staaten Osteuropas sich ohne den spektakulären Bruch, gleichsam auf samtenen Pfoten davonmachten. Hatte der Aufstieg der Sowjetunion das 20. Jahrhundert – das „Zeitalter der Extreme“ (Eric Hobsbawm) – entscheidend mitgeprägt, so setzte ihm der Zerfall des Sowjetreiches gleichsam ein vorzeitiges Ende, folgte auf das „lange“ 19. Jahrhundert, das bis zum Ersten Weltkrieg reichte, das „kurze“ 20. Jahrhundert. Aus Krieg und Revolution geboren, wurde es Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre sang- und klanglos als „Jahrhundert abgewählt“, wie Timothy Garton Ash mit Blick auf die friedlichen Revolutionen Osteuropas schrieb.
Für den 1997 verstorbenen französischen Historiker François Furet war der Fall des Kommunismus zugleich das „Ende einer Illusion“, einer universellen Faszination, die weite Kreise von Intellektuellen, vor allem auch in West- und Südeuropa, in ihren Bann gezogen hatte. Es war der Fall einer Idee, die sich in den Köpfen länger hielt als in der Realität, im Westen länger als im Osten; denn „als politischer Mythos und als soziale Idee“, so sein Befund, „hat [der Kommunismus] sein Scheitern und seine Verbrechen lange überdauert, vor allem in jenen europäischen Ländern, die dem Druck dieser Herrschaftsform nicht unmittelbar ausgesetzt waren“. Sein Buch, eine Beschreibung dieses Phänomens und eine Abrechnung mit ihm, kletterte, als es Mitte der 90er Jahre erschien, in den französischen Bestsellerlisten rasch auf Platz 1. Noch weiter ging eine Gruppe von französischen Intellektuellen, auch sie meist ehemalige Linke, die in einem „Schwarzbuch des Kommunismus“ eine weltweite Bilanz dieser großen Illusion versuchten, kommunistische „Unterdrückung, Verbrechen und Terror“ beschrieben und sich dabei auch auf Quellenfunde und Untersuchungen stützen konnten, die die neue Öffnung der Archive erst möglich gemacht hatte. Barg schon das Unternehmen selbst genügend politischen Zündstoff, so erst recht das Vorwort des Hauptherausgebers (Stéphane Courtois), der die Ergebnisse provokativ zusammenfasste und die Opferzahlen über die Zeiten und Räume hinweg aufaddierte. Für ihn gehörten die Massenverbrechen kommunistischer Parteien und Regime von Anfang an zum System, geschahen im Namen einer Doktrin, deren rücksichtslose Durchsetzung Teil des Programms war; sie erfüllten alle Kriterien von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, wie sie für die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert wurden; insofern sei der kommunistische „Klassengenozid“, die Vernichtung sozialer Gruppen um ihrer bloßen Existenz willen, dem nationalsozialistischen „Rassengenozid“ durchaus an die Seite zu stellen; in der Summe der weltweiten Opfer habe er ihn sogar noch übertroffen. Heftig diskutiert und in zahlreiche Sprachen übersetzt, stieg auch dieses Buch Ende der 90er Jahre rasch zum Bestseller auf.
Die Heftigkeit der Debatten ließ es bereits ahnen: Das Ende der Sowjetunion hat viele Aspekte, von ihren unmittelbaren außen- und innenpolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen, mentalen, ideellen und kulturellen Folgen in ihrem ehemaligen Machbereich ganz zu schweigen. Die Aufarbeitung dieser Vergangenheit wird uns noch lange beschäftigen, zumal die Befassung mit ihr durch die Öffnung der Archive, so zögerlich sie in manchen Bereichen noch immer (oder schon wieder) sein mag, auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Das galt und gilt insbesondere für die dunklen Seiten des Regimes. Doch nicht nur hierzu sind in den letzten 20, 30 Jahren eine ganze Reihe von Quellenbänden und quellengesättigten Studien erschienen; sie warfen neue Schlaglichter auf die Revolution und den Bürgerkrieg, die forcierte Industrialisierung und die Zwangskollektivierung, die Entwicklung des stalinistischen Staates in den 30er Jahren, die Wellen des Terrors und der Deportationen, die sowjetische Gesellschaft der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit, der 50er und der 60er Jahre, die Entwicklung der sowjetischen Außenpolitik und der Komintern. Soweit sie erst nach Erscheinen unserer „Kleinen Geschichte der Sowjetunion“ herauskamen, wurde versucht, ihre Ergebnisse in die nachfolgenden Auflagen einzuarbeiten.
Sie alle bestätigten freilich auch einmal mehr, dass, wer nach den Ursachen, den Wurzeln des Zerfalls fragt, weit in die Zeit vor Gorbatschow zurückgehen muss. Er stößt dabei immer wieder auf vier ineinandergreifende Entwicklungsstränge. Sie betreffen die Ideologie und das politische System, das Nationalitätenproblem und den außenpolitischen Konkurrenzkampf und verweisen auf Kernprobleme der Gesamtentwicklung.
So bestand ein Grundproblem des Regimes von Anfang an darin, dass der Marxismus zwar zur Staatsideologie erklärt wurde, Russland aber – die Urväter beim Wort genommen – 1917 gar nicht „reif“ für eine marxistische Revolution gewesen war. Da half auch leninistische Rabulistik nichts: Das Zarenreich war ein Agrarstaat, die Industriearbeiterschaft, auf die sich der neue Staat vor allem stützen wollte, eine Minderheit, und die Zuversicht, die fortgeschritteneren Staaten des Westens würden dem russischen Beispiel folgen und die Verhältnisse „im Weltmaßstab“ wieder zurechtrücken, erwies sich als ein bloßer Wunschtraum. Im Lauf der 20er Jahre musste man dies allmählich einsehen. Vor die Entscheidung gestellt, den Irrtum zuzugeben, die Errichtung eines sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems auf die lange Bank zu schieben oder die Voraussetzungen dafür in kürzester Frist nachzuholen, entschied man sich Ende des Jahrzehnts für den letztgenannten Weg: für eine forcierte Industrialisierung und die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Es war eine Entscheidung gegen die eigene Bevölkerung, gegen den erklärten, zumindest erkennbaren Willen ihrer Mehrheit; sie trotzdem zu fällen, perpetuierte – auf unabsehbare Zeit – die Diktatur, von wem auch immer sie ausgeübt wurde: der bolschewistischen Einheitspartei, ihrem Zentralkomitee, ihrem Politbüro oder ihrem Ersten Sekretär.
Die ideologische Fixierung prägte auch das politische System. Die 1917 neben den Bolschewiki existierenden Parteiorganisationen und die berühmten Interessenvertretungen der Arbeiter und Soldaten, die „Räte“ (sovety), die sich im gleichen Jahr zu Hunderten gebildet und zu regionalen und überregionalen Organisationen zusammengeschlossen hatten, sie überlebten den Bürgerkrieg nicht. Die nichtbolschewistischen Parteien waren seit Anfang der 20er Jahre de jure verboten, und der zur gleichen Zeit begonnene „Wiederaufbau der Räte“ kam de facto einer Neugründung gleich: Sie wurden weisungsgebundene Verwaltungsbehörden ohne Einfluss auf die Richtlinien der Politik, hatten auszuführen, was die bolschewistische Partei beschloss. Doch die Entwicklung zur Staatspartei veränderte auch die Bolschewiki; das Bemühen, aus einer populistischen Sammlungsbewegung eine schlagkräftige Organisation zu machen, engte den Spielraum innerparteilicher Diskussion und Demokratie immer mehr ein. Seit die Entscheidung für die forcierte Industrialisierung und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft gefallen war, hieß Partizipation auch für die Gremien der Partei nunmehr Akklamation und Umsetzung höherenorts getroffener Entscheidungen. Ein ins Gigantische wachsender Repressionsapparat half, die Politik innerstaatlich durchzusetzen, und nahm dabei die Parteimitglieder keineswegs aus.
Repression und Terror wurden zu Stützpfeilern des politischen Systems. Das galt auch im Verhältnis zu den Nationalitäten. 1917 hatte Lenin noch gehofft, der proletarische Aufstand im Zentrum und der Aufstand der unterdrückten Nationalitäten an der Peripherie des zaristischen Vielvölkerstaates würden sich ergänzen und die russische Revolution zum Anfang vom Ende des Imperialismus wie des Weltkapitalismus werden. Doch die erhoffte Wechselwirkung blieb aus, ja der Austritt der Nationalitäten (der Finnen und der baltischen Völker, der Polen, der Weißrussen und der Ukrainer, der Völker des Kaukasus und der mittelasiatischen Gebiete) aus dem russischen Staatsverband schwächte Räterussland, statt es zu stärken. Deshalb versuchte die bolschewistische Staatsführung mit allen Mitteln, diese Entwicklung zu stoppen und rückgängig zu machen: durch Konzessionen, durch die Unterstützung prosowjetischer Kräfte oder auch durch den Einmarsch der Roten Armee. Zwar erkannte sie das Recht der Nationalitäten auf Austritt „prinzipiell“ an, doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei ein Austritt „durch und durch konterrevolutionär“ und deshalb keinesfalls hinzunehmen. Tatsächlich gelang es, die meisten in den Staatsverband zurückzubringen und mit ihnen 1922/23 die „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ zu gründen; nur Polen, Finnland und die Baltischen Staaten behaupteten ihre Unabhängigkeit. Die Ende der 20er Jahre eingeleitete Politik sollte auch die nationale Frage endgültig lösen: Aus der Sowjetunion sollte ein einheitlicher Wirtschaftsraum, aus seiner Bevölkerung eine moderne Verkehrsgesellschaft, aus den über 100 Nationalitäten und ethnischen Gruppen ein Volk, das Sowjetvolk, werden, mit einer gemeinsamen Weltanschauung, einem einheitlichen Staats- und Geschichtsbewusstsein und mit Russisch als gemeinsamer Verkehrssprache. Wie rigoros die politische Führung dieses Ziel verfolgte, zeigen nicht zuletzt ihre Maßnahmen zur An- und Umsiedelung ganzer Völkerschaften in den 30er und 40er Jahren.
Dass sich dennoch so etwas wie ein Wir-Gefühl einstellte, hing zentral mit der Bedrohung von außen, dem deutschen Überfall zusammen. Dass sich der Gegner Ausrottung und Versklavung zum Ziel gesetzt hatte, ließ Volk und Führung zusammenrücken, machte den Zweiten Weltkrieg zum großen einigenden Kollektiverlebnis. Dass ihn die Sowjetunion überstand, in seinem Verlauf Ostpolen und die baltischen Gebiete „zurückgewann“, ihren Einflussbereich im Westen bis an die Elbe vorschob und als zweite Weltmacht aus dem Ringen hervorging, schien der bisherigen Politik recht zu geben, die forcierte Industrialisierung und die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft eingeschlossen. Mit dem Erreichten schienen die Voraussetzungen geschaffen, um auf höherer Ebene – im weltpolitischen Rahmen – den Konkurrenzkampf mit dem kapitalistischen Westen erneut aufzunehmen und zu einem siegreichen Ende zu bringen. Noch Chruschtschow war getragen von dieser Zuversicht und noch Breschnew ohne einen Blick für die Gefahr, damit die eigenen Kräfte gewaltig zu überspannen.
Die skizzierten Entwicklungen von Partei und Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, Nationalitäten- und Außenpolitik bilden Eckpfeiler unserer Darstellung. Und doch wäre es falsch, eine Geschichte der Sowjetunion nur als Geschichte der Schwäche, der Krise und des Scheiterns zu schreiben. Damit wäre kaum zu erklären, warum sie immerhin mehr als zwei Generationen währte, Jahrzehnte wechselhafter Entwicklungen, im Innern und nach Außen; warum sie den Bürgerkrieg wie den Zweiten Weltkrieg überlebte; warum sie in ihrem Selbstverständnis wie in dem ihrer Gegner zur Weltmacht aufstieg, mit einem militärischen Potential, das der Westen noch vor wenigen Jahren als lebensbedrohend empfand; warum sie eine solche Faszination auch auf Intellektuelle außerhalb des eigenen Machtbereichs ausübte, wovon oben schon die Rede war. Wer die einzelnen Phasen ihrer Geschichte verstehen will, die Hoffnungen, die sie trugen, die Ängste, die sie auslösten, muss sie gesondert betrachten. Selbst wenn es ihm vielleicht widerstrebt, mit Altmeister Ranke anzunehmen, dass jede von ihnen „unmittelbar zu Gott“ gewesen sei: Dass jede historische Entwicklung nur in ihrer Zeit und aus ihrer Zeit wirklich zu begreifen ist, gilt auch hier. Wie die Entwicklung nach 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion, im größten ihrer Nachfolgestaaten, in Russland, weiterging, davon berichtet ein abschließender „Ausblick“. Er beschreibt die wilden, ja chaotischen 90er Jahre (unter Jelzin) und die nachfolgende Entwicklung (unter Putin), hin zu einer „gelenkten Demokratie“, mit Repressionen und manipulierten Wahlen im Innern und einer imperialen Gewaltpolitik nach außen, mit dem Ziel, Russland zurück auf die weltpolitische Bühne zu bringen mit Drohungen und Interventionen gegenüber dem „nahen Ausland“, den Nachbarn.
I. Russland vor der großen Wende
Das Russische Reich am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Wer auf eine Landkarte schaute, sah ein riesiges Staatsgebiet, das von der Ostsee bis zum Pazifik, vom Kaspischen bis zum Eismeer reichte. Erworben war es in einem die Jahrhunderte übergreifenden Prozess. Er begann mit der Einigung des Zentralgebietes um Moskau im 14. und 15. Jahrhundert. Ihr folgte das Ausgreifen an den Unterlauf der Wolga und nach Westsibirien, in die Ukraine und nach Ostsibirien in den beiden Jahrhunderten darauf. Im 18. Jahrhundert stieß man in breiter Front nach Westen, an die Ostsee und an die Schwarzmeerküste vor. Und im 19. Jahrhundert kamen noch Finnland und Zentralpolen, das Transkaukasusgebiet und Mittelasien sowie in Fernost die Amurregion hinzu (vgl. Karte 1 im Anhang). Das so erworbene Territorium war zweieinhalb mal so groß wie das restliche Europa und fast dreimal so groß wie die USA.
Wer das Staatsgebiet in nordsüdlicher Richtung durchschritt, passierte gleich mehrere Klima- und Vegetationszonen (vgl. Karte 2). Die vegetationsarmen arktischen Tundren gingen allmählich in Nadelwald, die Tajga über. In den Nadelwald mischten sich Laubhölzer und dominierten immer mehr, je weiter man in den wärmeren Süden vordrang. Dann hörte auch der Laubwaldbestand allmählich auf und machte einer Steppenzone Platz. Sie ging noch weiter südlich in Halbwüsten und Wüsten über. Schon wer von St. Petersburg in die alte Hauptstadt Moskau kam, weiter ins Zentrum der Ukraine, nach Kiew, fuhr und von dort nach Odessa am Schwarzen Meer, sah die Unterschiede: Der Nadelwald, der um St. Petersburg und vor allem nördlich davon dominierte, ging auf dem Weg nach Moskau in Mischwald über. Kiew lag bereits an der Grenze zwischen Laubwald und Steppe. Auf dieser Reise sah man zugleich, dass die Bedeutung der Landwirtschaft von Nord nach Süd immer mehr zunahm, die ursprüngliche Vegetation verdrängte, und dass sie auf den Steppengebieten zwischen Kiew und Odessa die günstigsten Voraussetzungen fand: Hier in der südlichen Ukraine, nördlich von Schwarzem Meer und Kaukasus, lagen die fruchtbaren Schwarzerdeböden, sie machten das Gebiet zur Kornkammer des Reiches. Einen vollständigen Eindruck von den riesigen Unterschieden gewann freilich nur, wer die Fahrt über das Schwarze Meer und den Kaukasus hinweg in die Halbwüsten und Wüsten Mittelasiens und in die dünnbesiedelten Regionen Sibiriens fortsetzte, sah, wie hier Klima und Vegetation zu einer nomadischen oder halbnomadischen Lebensweise zwangen oder eine dem Westen völlig fremde Oasenkultur hervorgebracht hatten.
Schon im europäischen Teil Russlands waren die Unterschiede zwischen den Sprachen und Religionen – zwischen den Russen, Weißrussen, Ukrainern, Finnen, Esten, Letten, Litauern, Polen, Rumänen, Deutschen, Georgiern und Armeniern, zwischen russisch-orthodox, römisch-katholisch, protestantisch und jüdisch geprägten Regionen – groß. Wer jedoch von St. Petersburg aus über die Wolga hinweg, auf die Gebiete vor und jenseits des Ural, nach Sibirien und Mittelasien blickte, zu den Tschuwaschen, Tataren und Baschkiren, Kalmücken und Tschetschenen, Jakuten und Burjaten, Usbeken, Kasachen, Kirgisen und Tadschiken hatte den Eindruck, in andere Welten zu schauen, in Kulturen und Kulturstufen, die geprägt vom Islam, Buddhismus oder Naturreligionen türkisch, mongolisch oder persisch sprachen.
Das Staatsgebilde wurde zusammengehalten von Formen traditionaler Herrschaft, der Autokratie des Zaren. Sie stützte sich auf eine im 18. Jahrhundert geschaffene und im 19. Jahrhundert ausgebaute zentralisierte Verwaltung. Dazu war das gesamte Land in rd. 100 administrative Einheiten (Gouvernements, teilweise auch Gebiete genannt) aufgeteilt worden, die im europäischen Russland jeweils einem Gouverneur, in den Randgebieten, zu mehreren zusammengefasst, einem General-Gouverneur unterstanden. Daneben gab es Formen lokaler und regionaler, städtischer und ländlicher Selbstverwaltung, die – in ihren Zuständigkeiten beschränkt und in ihren Tätigkeiten überwacht – an den Fundamenten der zarischen Selbstherrschaft nicht rühren sollten. Sie taten es dennoch und der Zar war gewarnt: Schon einmal, 1905/06, während des erfolglosen und unpopulären Krieges gegen Japan, hatten sich Bürger, Arbeiter und Bauern gegen das absolutistische Regime erhoben.
1. Erschütterung und Reform
Es begann, sofern ein Anfang überhaupt zu bestimmen ist, mit Protestaktionen der liberalen Intelligenz. Sie traf sich, um das öffentliche Versammlungsverbot zu umgehen, zu „privaten“ Einladungen, auf Banketten. Ein überparteiliches Gremium aller Berufsstände wurde gegründet und ein Programm erstellt: Es forderte allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlen zur einer verfassungsgebenden Versammlung, eine Arbeiterschutzgesetzgebung, den Achtstundentag sowie Landzuteilungen für die Bauern.
Der Protest der gehobenen Schichten, aus liberalem Bürgertum und Adel, wäre wohl wirkungslos verhallt, hätte ihm das Auftreten der Arbeiterschaft nicht Stoßkraft gegeben. Gewiss, Russland war in erster Linie noch immer ein Agrarstaat, die Großindustrie erst im Aufbau begriffen und die Arbeiterschaft erst eine schmale Schicht. Aber sie konzentrierte sich an wenigen Stellen, allen voran in den Städten Moskau und St. Petersburg, und besaß dadurch besonderes Gewicht. Das zeigte sich schon an jenem Sonntag im Januar 1905, als sich in St. Petersburg, der Hauptstadt, ein Protestzug von weit über 100 000 Arbeitern formierte, um dem Zaren eine Bittschrift zu überreichen. Der Zar sollte von ihrer Armut und Rechtlosigkeit erfahren, sie vor Willkür und Despotismus in den Fabriken schützen. Der Marsch der Arbeiter endete in einer blutigen Katastrophe, als Truppen in die Menge schossen.
Der „Blutsonntag“ löste eine landesweite Streikwelle aus. Den Arbeitern ging es dabei vor allem um wirtschaftliche Belange, doch in den Randgebieten des Reiches (in Polen, im Kaukasus und auf dem Baltikum) verbanden sich damit auch nationale Fragen. Gewerkschaftsgründungen begleiteten diese Entwicklung. War die Arbeiterbewegung im Sommer etwas abgeflaut, so nahm sie im Herbst einen neuen Aufschwung. Diesmal ging die Streikwelle von Moskau aus, griff auf St. Petersburg über, und weil sich die Eisenbahner anschlossen, nahm der Protest die Züge eines Generalstreiks an. Anders als noch im Frühjahr standen nun eindeutig politische Ziele im Vordergrund, es ging um die Reform des Gesamtstaates. Auf dem Höhepunkt der Streikbewegung bildete sich in St. Petersburg ein „Rat der Arbeiterdeputierten“. Über die Koordinierung des Streiks hinaus wurde er binnen weniger Tage allgemeines politisches Vertretungsorgan der Arbeiter, Zentrum der revolutionären Bewegung und Vorbild für ähnliche „Räte“ draußen im Lande.
Aus wirtschaftlicher Not griffen auch die Bauern zur Selbsthilfe (wobei sich in den Randgebieten – wie bei den Arbeitern – die ökonomischen Forderungen mit nationalen verbanden). Die Bauernunruhen begannen im Zentrum, griffen rasch auf das ganze russische Schwarzerdegebiet über und erfassten im Laufe des Sommers den Westen bis hinauf zum Baltikum. Auch jenseits des Kaukasus, in Georgien, revoltierten die Bauern. Sie verweigerten Steuern und Abgaben, nahmen adelige Felder und Wälder in Besitz; Gutshöfe gingen in Flammen auf. Kaum hatte sich die Lage im Herbst etwas beruhigt, brach die Bewegung gegen Ende des Jahres erneut los, heftiger als zuvor. Das Zentrum der Bauernrevolten lag nun an der mittleren Wolga; doch sprang der Funke über, und der schwelende Konflikt verwandelte sich erneut in einen revolutionären Flächenbrand. Er erfasste den ganzen Süden von Bessarabien bis zum Ural, den Kaukasus, den Westen und die baltischen Provinzen.
Die Regierung schlug die Revolution nieder. Im Dezember 1905 wurde der Petersburger Arbeiterrat verhaftet; ein nachfolgender Moskauer Aufstand brach bis Ende des Jahres zusammen. Die Kämpfe gegen die aufrührerischen Bauern zogen sich noch bis ins Jahr 1907 hin. Doch das Rad der Geschichte ließ sich nicht mehr zurückdrehen; die Bevölkerung war politisch bewusster geworden, ihr Verhältnis zur Autokratie, zur Selbstherrschaft des Zaren, fortan gebrochen. Politische Parteien waren entstanden, und der Zar hatte in einem „Oktobermanifest“ die Wahl eines Parlaments, einer „Duma“, versprochen, ohne deren Zustimmung zukünftig kein Gesetz mehr verabschiedet werden sollte.
Das Reformversprechen wandte sich vor allem an die unzufriedenen bürgerlichen Kreise und jene, die die soziale Revolution der Besitzlosen zu fürchten begonnen hatten. Das neue (indirekte und ungleiche) Parlamentswahlrecht begünstigte Adel und Besitzbürgertum; in der Hoffnung, dass die Bauern im Grunde konservativ und zarentreu geblieben seien, räumte man auch ihnen eine beachtliche Stimmenquote ein. Als sich diese Annahme als falsch erwies und zu „radikalen“ Mehrheiten in der Duma führte, oktroyierte die Regierung (1907) einfach ein neues Wahlrecht; es machte die konservativen, meist adeligen Grundbesitzer zur vorherrschenden, praktisch alles entscheidenden Gruppe.
Hatten sich die Arbeiter während der Revolution vielfach höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen erkämpft, so ging viel davon in der Zeit danach wieder verloren. Die Rechte der Gewerkschaften wurden stark eingeschränkt, die Organisation von Streiks blieb nach wie vor verboten. Von den großen Reformprojekten zur Arbeiterfrage, die man in den Monaten der Revolution erwogen hatte, wurden lediglich die Regelungen zur Unfall- und Krankenversicherung weiterverfolgt und verwirklicht.
Auch die Bauern erreichten ihr Hauptziel, mehr Land vom Staat, dem Adel, den Kirchen und Klöstern zu bekommen, nicht. Zwar wurden die Ablösezahlungen, die die Bauern seit ihrer Befreiung aus der Leibeigenschaft (1861) zu entrichten hatten, noch 1905 abgeschafft. Doch die notwendige Reform der Agrarverhältnisse suchte Ministerpräsident P. A. Stolypin auf anderen Wegen: Er förderte mit allen Mitteln die Auflösung der alten Landgemeinde und die Bildung leistungsfähiger Farmbetriebe – auf Kosten der Zwergwirtschaften und Kümmerexistenzen im Dorf.
War der neue Kurs in der Lage, die Probleme zu meistern? Man kann daran – mit guten Gründen – zweifeln. In jedem Falle setzte dies eine lange friedliche Entwicklung voraus. Statt dessen stürzte sich Russland nur wenige Jahre später in das Abenteuer des Weltkrieges.
2. Krieg und Revolution
Die patriotische Stimmung, die im Sommer 1914 geherrscht hatte, hielt nicht lange vor. Der militärische Vorstoß nach Westen kam schon im Herbst zum Stehen, seit 1915 waren die Fronten festgefahren. Bis Anfang dieses Jahres hatte die Armee bereits 1,8 Millionen Mann (an Toten, Verwundeten und Kriegsgefangenen) verloren. Die zwei Millionen Neurekrutierten, die sie ersetzen sollten, erhielten nur noch eine Grundausbildung von wenigen Wochen. Auch ihre Bewaffnung blieb mangelhaft, weil die militärische Führung nur für einen kurzen Krieg geplant hatte. Sie verstärkten in der Armee das demokratische, radikale, rebellische Potential, die Zahl jener, die nicht mehr bereit waren, nur noch in den Kategorien von Befehlen und Gehorsam zu denken.
Je länger der Konflikt dauerte, um so deutlicher wurde, dass auch die Wirtschaft darauf nicht vorbereitet war. Selbst in kriegswichtigen Bereichen wie Kohle und Stahl kam es rasch zu empfindlichen Engpässen. Zwar konnten manche Lücken unter Aufbietung aller Kräfte geschlossen, zivile Unternehmen auf militärische Produktion umgestellt werden. Doch andere Lücken blieben, und jede Anstrengung in einem Bereich, lief Gefahr, umso größere Löcher in anderen Bereichen aufzureißen. Da die Devise hieß: „Alles für die Armee“, bekam die Zivilbevölkerung die Ausfälle besonders deutlich zu spüren. Mit der Not stieg – seit 1915 – die Protestbereitschaft, die Zahl der Demonstrationen und Streiks. Lange Schlangen vor den Geschäften gehörten schon im zweiten Kriegsjahr zum Alltag, wobei es bald ebenso zur täglichen Erfahrung wurde, dass die zur Verfügung stehenden Waren zur Versorgung aller Wartenden nicht ausreichten. So gewann der Hunger jene Bedeutung, die ihn zum tragenden Element der Oppositionsbewegung werden ließ.
Auch in der Duma wuchs der Unmut. Die Mehrheit schloss sich zu einem interfraktionellen „Block“ zusammen und forderte im Spätsommer 1915 öffentlich Reformen: eine Regierung, die sich auf das Vertrauen des Volkes stützen könne; die Abkehr von einer Regierungspraxis, die sich gegen jede eigenständige Tätigkeit der Gesellschaft wende; wer aus politischen oder religiösen Gründen inhaftiert worden war, sollte amnestiert werden; die Schikanen gegen Polen, Juden und Ukrainer müssten endlich aufhören; die Legalisierung von Gewerkschaften und die Zulassung von Arbeiterzeitungen waren weitere Punkte. Der Opposition des Parlaments schlossen sich andere wichtige und traditionsreiche Organisationen an: die Organisationen der ländlichen Selbstverwaltung und der Kongress des Städteverbandes. Um den Krieg siegreich beenden zu können, so machten beide auf ihren Tagungen im Herbst 1916 deutlich, waren politische Reformen unumgänglich.
Doch die Warnungen blieben ungehört. Der Zar hatte auf die Forderungen des Progressiven Blocks kaum reagiert, statt das Parlament an der Verantwortung zu beteiligen, schränkte er dessen Aktivitäten ein und unterstellte die Abgeordneten bis weit hinein ins „bürgerliche Lager“ polizeilicher Überwachung. Gegen den Rat seiner Minister übernahm er 1915 auch den militärischen Oberbefehl, ohne den militärischen Durchbruch damit erzwingen und seine Stellung mit Erfolgen festigen zu können. Während er im Hauptquartier weilte, geriet die Politik unter den Einfluss der Kaiserin, deren Hofaffären und deren Beratung durch jenen ominösen sibirischen Bauern Rasputin kaum geeignet waren, Vertrauen in die Regierungspolitik zu wecken. So verspielte die Krone ihren letzten Kredit.
Wie geheimdienstliche Ermittlungen ergaben, hatten in Duma- und Unternehmerkreisen bereits Planspiele begonnen, wie die Reformen auch gegen den Willen des Monarchen durchzusetzen wären. Im Januar 1917 waren progressive Industrielle, Mitglieder der liberalen Kadettenpartei und Abgeordnete des Moskauer Stadtparlaments zu vertraulichen Gesprächen zusammengekommen, um für den „Eventualfall“ zu planen. Doch nicht diese Überlegungen, sondern Hungerunruhen und Demonstrationen der hauptstädtischen Arbeiterschaft brachten den Stein ins Rollen. Der Jahrestag der ersten Revolution wurde im Januar 1917 zum Ventil. Seither rissen die Streiks und Demonstrationen in Petrograd, wie St. Petersburg seit Kriegsausbruch hieß, nicht mehr ab. Und als der Zar Ende Februar befahl, die Unruhen mit Waffengewalt zu unterdrücken, war ihm die Macht bereits entglitten: Die eingesetzten Truppen liefen zu den Aufständischen über. Der Zar dankte ab, Russland wurde Republik.
3. Die Provisorische Regierung
In der Februarrevolution entlud sich ein doppelter Konflikt: die wachsenden Spannungen zwischen Autokratie und Gesellschaft und die tiefe Unzufriedenheit der hauptstädtischen „Massen“ mit der etablierten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung. Dabei waren die hauptstädtischen Massen eindeutig die aktive, treibende Kraft, während die „bessere“, bürgerlich-liberale Gesellschaft jede andere Problemlösung (einen Staatsstreich eingeschlossen) der Revolution vorgezogen hätte. Schon um eine erfolgreiche Fortführung des Krieges nicht zu gefährden. Nur zögernd war sie bereit, die von den Massen geschaffenen Verhältnisse anzuerkennen und nach vollzogenem Sturz der Autokratie die Regierungsgeschäfte zu übernehmen.
So wurde ein Übergangskabinett, die „Provisorische Regierung“, gebildet, mit dem Vorsitzenden des Verbandes der ländlichen Selbstverwaltungskörperschaften (Fürst Lwow) als neuem Ministerpräsidenten und Innenminister. Die neue Regierung schickte „Kommissare“ in die Ministerien und wichtigsten öffentlichen Einrichtungen und unterstellte sie ihrer Aufsicht. Sie bemühte sich, die Soldaten zurück in die Kasernen zu bringen, um Ruhe und Ordnung auf den Straßen wiederherzustellen. Und sie entsandte ihre Kommissare in die Provinz. Der Verwaltungs- und Repressionsapparat des Zarismus brach auch dort erstaunlich schnell und ohne größeren Widerstand zusammen; die bisherigen Träger der Staatsmacht wurden entmachtet, der Polizei- und Justizapparat, auf den sie sich gestützt hatten, zerfiel.
Ein Bündel von Reformen folgte: Die bürgerlichen Grundrechte, die Rede-, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit wurden verkündet; alle Standesprivilegien sollten fallen, und die Nationalitäten und Religionen einander künftig gleichgestellt sein; in Stadt und Land waren die lokalen Selbstverwaltungsorgane auf der Grundlage eines allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts neu zu bestellen; die verhasste zaristische Polizei sollte durch eine Volksmiliz mit gewählter Leitung ersetzt werden und eine Justizreform folgen; das Streikrecht wurde gewährt und eine politische Amnestie beschlossen; vor allem aber sollte möglichst rasch eine „Konstituierende [verfassungsgebende] Versammlung“ gewählt werden, sie hatte über das künftige Schicksal Russlands zu entscheiden.
Dieses Programm wurde von einer breiten Parteienmehrheit getragen. Nur die Rechte und die extreme Linke lehnten es ab. Die Rechten hielten an der zaristischen Autokratie fest. Der extremen Linken aber gingen die Reformen nicht weit genug: Auf die „bürgerliche“ Revolution sollte sogleich eine „sozialistische“ folgen. Das war die Position der Bolschewiki, der Anhänger W. I. Lenins. Eben aus dem Schweizer Exil zurückgekehrt, entwickelte er Anfang April das Gegenprogramm: Es propagierte nicht nur die „augenblickliche Beendigung des imperialistischen Krieges“ und „keinerlei Unterstützung der Provisorischen Regierung“. Es forderte darüber hinaus die sofortige Enteignung des adeligen Grundbesitzes, die Nationalisierung des gesamten Bodens, die Verstaatlichung der Banken und die Einführung der Arbeiterkontrolle in den Fabriken. Lenin setzte dabei auf die Arbeiterausschüsse und Soldatenkomitees, die sich nach dem Vorbild von 1905 gebildet und zu regionalen und überregionalen Organisationen zusammengeschlossen hatten: Diese „Räte“ (russisch sovety, eingedeutscht „Sowjets“) sollten zum Rückgrat des neuen Staates werden. Ein vollständiger „Rätestaat“ – von unten nach oben – sei, so sagte Lenin, fortschrittlicher und demokratischer als der westliche Parlamentarismus. Deshalb müsse man der Provisorischen Regierung die Unterstützung verweigern.
4. Ihr Scheitern
Im Frühjahr 1917 waren die Bolschewiki eine unbedeutende Minderheit, und die Räte, denen sie die Staatsmacht übertragen wollten, zeigten wenig Interesse, sie tatsächlich zu übernehmen. Das änderte sich erst im Sommer und Herbst. Als schwerwiegender Fehler erwies sich nun, dass die Provisorische Regierung den Krieg an der Seite der Westalliierten fortgesetzt hatte, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung seiner längst überdrüssig war.
Uneins in der Haltung zum Krieg und den Prioritäten staatlicher Politik stürzte die Regierung bereits im April in ihre erste Krise. Der Außenminister (Miljukow) musste gehen, die Regierung wurde umgebildet, die gemäßigte Linke (Sozialrevolutionäre und Menschewiki), bisher tonangebend in der Sowjetführung, kooptiert und auf eine staatstragende Rolle verpflichtet. Doch das Problem blieb und verschärfte sich erneut, als die Regierung im Juni mit einer militärischen Offensive an der Westfront den großen Durchbruch zu erzielen hoffte – und kläglich scheiterte.
Mit dem Krieg blieben auch die Versorgungsprobleme, die den Anstoß zum Sturz des Zarismus im Frühjahr geliefert hatten: Die immer undurchsichtiger werdende Wirtschaftslage; der offenkundig nicht aufzuhaltende Verfall des Transportsystems; der Mangel an Rohstoffen und Energie, der immer mehr Räder stillstehen ließ; die sprunghaft steigenden Lebensmittelpreise, die die Lohnerhöhungen aufgefressen hatten, bevor sie durchgesetzt waren – sie ließen die Menschen auch in den Sommermonaten nicht zur Ruhe kommen. Materielle Not, das Gefühl, im Recht zu sein, und die Furcht, vertröstet zu werden, die Abstumpfung, die der Krieg mit sich brachte, und die Angst vor der Zukunft setzten die Hemmschwelle der Gewalt weit herab.
Gewalt gegen Personen und Institutionen, Raubüberfälle und Vandalismus, Plünderungen von Häusern und Geschäften, verbale und tätliche Angriffe auf Offiziere, eigenmächtige Verhaftungen und Lynchjustiz – die bürgerliche Boulevardpresse berichtete täglich von neuen Vorfällen. Die Soldaten in den Garnisonen des Hinterlands bestimmten selbst, wieweit sie sich an Dienst- und Disziplinarvorschriften hielten, und wurden nicht selten zur Plage für ihre Umwelt. Auch auf dem Lande schienen die Kapital- und Eigentumsdelikte, die Brandstiftungen, das wilde Holzfällen, die „Requirierung“ von Gutsvieh und Getreidevorräten ständig zuzunehmen.
Während sich die Wahlvorbereitungen für die Konstituierende Versammlung in die Länge zogen und die Termine mehrfach verschoben werden mussten, drängten die Bauern, die überfälligen Agrarreformen endlich in Angriff zu nehmen. Angesichts des immer dramatischeren Verfalls der Wirtschaft sahen die Arbeiter ihre im Februar erkämpften Errungenschaften schwinden und die eigene Zukunft düster. Auch den Soldaten an der Front bot die Regierung wenig Perspektive; wann und wie sie den Krieg zu beenden gedachte, war nach dem Fehlschlag der Juni-Offensive unsicherer denn je. Entsprechend schwer fiel es, mit patriotischen Appellen, mit Mahnungen zu Besonnenheit und Geduld, mit Warnungen vor Anarchie und Chaos noch Gehör zu finden.
Dass ein Sozialist (A. Kerensky) im Sommer das Amt des Ministerpräsidenten übernahm und das Kabinett mehrfach umgebildet wurde, konnte den Verfall der Staatsmacht nicht stoppen. Putschversuche von links (im Juli) und rechts (im August) demonstrierten deren Schwäche. Dass die Regierung nach den Juliunruhen die Bolschewiki verbot, schuf ihr nur vorübergehend Luft. Denn als im August der Oberkommandierende (General Kornilow) nach der Macht griff, um mit Ruhe und Ordnung auch die Schlagkraft der Armee wiederherzustellen, schienen Teile des liberalen Koalitionspartners mit den Forderungen des Generals durchaus zu sympathisieren – was einmal mehr zeigte, dass die Regierung in den sie bisher stützenden Parteien keine Basis mehr hatte, von den breiten Schichten der Bevölkerung ganz zu schweigen. Und auch an der Peripherie (namentlich in Finnland und in der Ukraine) wurden die Stimmen lauter, die der Petersburger Regierung das Recht absprachen, weiterhin für sie zu entscheiden, die „Unabhängigkeit“, zumindest „Autonomie“ forderten.
II. Die Oktoberrevolution 1917
Die ungelösten Probleme, die wachsenden Schwierigkeiten, der Autoritätsverfall der Regierung – das alles kam den Bolschewiki zugute. Seit dem Spätsommer befand sich die Partei im politischen Aufwind: Seit September hatte sie in Petrograd und Moskau, den beiden größten und wichtigsten Städten, die Mehrheit der Räte hinter sich. Nun schien Wladimir Ilitsch Lenin der Augenblick günstig: Die Bolschewiki mussten in die Offensive gehen, die Provisorische Regierung stürzen und die Räterepublik ausrufen. Weiter auf die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung und „formale Mehrheiten“ zu warten, wäre „Verrat an der Sache des Proletariats“ und ein „Verbrechen an der Revolution“. Lenin setzte seine Auffassung in der Parteiführung durch: Mitte Oktober beschloss das bolschewistische Zentralkomitee die Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes.
Die Mittel zur Durchführung bot der Apparat des Petrograder Arbeiter- und Soldatenrates. Zwei Wochen später wagten die Bolschewiki die Machtprobe. In der Nacht vom 6. auf den 7. November (nach dem russischen Kalender war es der 24./25. Oktober) besetzten bewaffnete Arbeiterbrigaden die wichtigsten Punkte der Stadt; die Provisorische Regierung wurde abgesetzt, eine neue, rein bolschewistische Regierung gebildet und der Übergang der Staatsmacht an die Räte verkündet. So folgte auf den Sturz des Zarismus im Frühjahr, der „Februarrevolution“, nur wenige Monate später ein erneuter Umsturz, die bolschewistische „Oktoberrevolution“.
Kaum einer übersah die Folgen dieses Vorgangs. Viele Beobachter glaubten, auch die neue Regierung werde sich nicht lange halten. Doch auf den politisch-militärischen Umsturz folgten rasch weitere Schritte: Sie gingen auf die Forderungen der Arbeiter, Bauern und Soldaten ein, sicherten der Regierung das Überleben und veränderten Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Russlands von Grund auf.
Abb. 1: Die Revolution beseitigt die Symbole des „Alten“: Im Taurischen Palais, dem Sitz der Duma (wo zunächst bis zur Übersiedelung in den Smolny auch der Petrograder Arbeiter- und Soldatenrat residiert), wird das Portrait des Zaren (Nikolaus II.) aus dem Rahmen geschnitten und das Zarenwappen von der Rednertribüne entfernt. Nach der Oktoberrevolution fallen auch die Monumente der Vorgänger (auf unserem Bild: das große Denkmal Zar Alexanders III. an der Moskauer Erlöserkathedrale, das auf Beschluss des Rates der Volkskommissare abgetragen wird). Und die Revolution schafft sich neue Monumente: Vor dem Smolny (dem Amtssitz des Sowjet seit Sommer 1917 und des „Rates der Volkskommissare“ nach der Oktoberrevolution) wird 1918 ein Karl-Marx-Denkmal enthüllt, vor dem „Palast der Arbeit“ (ebenfalls in Petrograd) das Denkmal des „roten Metallarbeiters“. Auch den „Revolutionären“, Garibaldi, Blanqui und Lassalle, den Schriftstellern A. Radischtschew, A. Herzen, T. Schewtschenko und Heinrich Heine werden 1918/19 in der Stadt Monumente errichtet.
1. Die Errichtung des Rätestaates
Der neue Staat sollte ein Rätestaat sein, so hatte es Lenin verkündet: ohne Parlament und zentrale Bürokratie, ohne Berufsbeamtentum und stehendes Heer; mit einer Massenbeteiligung an der politischen Willensbildung und allen Formen direkter, unmittelbarer Demokratie.
Die Leitidee war einfach. Auf allen Ebenen hatten Räteversammlungen die Macht zu übernehmen: in jedem Dorf und in jeder Stadt, in den Bezirken, Landkreisen und Gouvernements. Die Spitze der Pyramide bildete eine gesamtstaatliche Räteversammlung, der „Allrussische Rätekongress“, der von den unteren Sowjetorganisationen gewählt wurde. Er war die höchste Instanz im Sowjetstaat, trat zu periodischen Tagungen zusammen und wählte aus seiner Mitte ein „Zentrales Exekutivkomitee“. Das Zentrale Exekutivkomitee übernahm zwischen den Tagungen des Rätekongresses die oberste Gewalt. Das Grundschema dieser Organisation hatte sich bereits vor dem Oktoberumsturz ausgebildet, die Bolschewiki konnten daran anknüpfen.
Auch die neue Regierung, der „Rat der Volkskommissare“, sollte eine Räteregierung sein: Sie war – laut Gesetz – dem Sowjetkongress und seinem Zentralen Exekutivkomitee verantwortlich, wurde von ihnen gewählt und entlassen. Zu allen wichtigen Bereichen des staatlichen Lebens hatte sie „Kommissionen“ zu bilden, die „in engem Kontakt mit den Massenorganisationen“ der Arbeiter, Bauern und Soldaten die Regierungsgeschäfte erledigten. Solange die Bolschewiki noch auf eine Mehrheit in der Konstituierenden Versammlung hofften, bezeichneten sie den Rat der Volkskommissare als Provisorium. Doch als sich die Konstituante – im November endlich gewählt – den bolschewistischen Plänen widersetzte, wurde sie nach nur einer Sitzung aufgelöst und das Provisorium zur Dauerlösung erklärt.
Die gleichen Prinzipien wie bei der Räteorganisation sollten auch beim übrigen Staatsaufbau gelten: So wurden – per Dekret – alle bestehenden Gerichtsinstitutionen aufgelöst, einschließlich der Staatsanwaltschaft und der Advokatur. Gewählte Laienrichter sollten künftig die Rechtsprechung übernehmen und nach „revolutionärem Gewissen“ und „revolutionärem Rechtsbewusstsein“ entscheiden. Als Ankläger oder Verteidiger konnte jeder unbescholtene Staatsbürger fungieren. In der Armee wurden noch im Dezember 1917 alle Dienstränge, Orden und Titel abgeschafft und die Rechte aller Armeeangehörigen einander angeglichen. Die Soldaten sollten sich ihre Vorgesetzten künftig selbst wählen. Ja die neue „Rote Armee der Arbeiter und Bauern“ sollte keine straff organisierte Kaderarmee mehr sein, sondern eine „Miliz“, beruhend auf der „allgemeinen Bewaffnung des Volkes“.
Das alles waren Willenserklärungen, Projekte. Die Realität sah anders aus. Schon der Ausbau der Räteorganisation stand vor erheblichen Schwierigkeiten. Räte, Sowjets, gab es vor allem in Städten und Garnisonen; auf dem Dorf waren sie erst noch zu schaffen. Doch die Bauern hielten an den älteren Formen der Selbstverwaltung, den „Dorfversammlungen“ (russ. schody) fest. Außerdem: die Zuständigkeiten der lokalen, regionalen und zentralen Sowjets waren nirgends genau abgegrenzt. So betrieben alle ihre eigene Politik, meist darauf bedacht, sich von oben nicht dreinreden zu lassen. Regierungsverlautbarungen, Gesetze und Verordnungen hatten allenfalls den Charakter von Empfehlungen. Und an der Spitze der Räteorganisation bildeten sich die angekündigten Regierungskommissionen nicht. Statt dessen übernahmen die Volkskommissare die vorhandenen Ministerien – und mit ihnen einen Großteil der alten Beamtenschaft. Das stärkte die Regierung gegenüber Rätekongress und Zentralem Exekutivkomitee, der neue/alte Apparat machte sie beiden überlegen.
Die Aufhebung aller bestehenden Gerichte verschlimmerte noch die vielerorts chaotischen Zustände. Die Grenzen zwischen den neugeschaffenen „Revolutionären Tribunalen“ und blanker Lynchjustiz waren fließend. Noch dazu schuf sich die Regierung – Mitte Dezember 1917 – eine „Außerordentliche Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution und Sabotage“ (bekannt vor allem unter ihrer russischen Abk. ČK, deutsch auch Tscheka), die sich mit ihren Terrormethoden in den innenpolitischen Auseinandersetzungen rasch einen zweifelhaften Ruhm erwarb.
Auch bei der Reorganisation der Armee verlief die Entwicklung bald in anderen Bahnen. Die im Winter 1917/18 rasch aufgestellten Verbände waren den deutschen Truppen nicht gewachsen gewesen (vgl. unten II,4). So wurde die Milizidee stillschweigend beiseite gelegt und der Aufbau einer regulären Armee begonnen, mit allgemeiner Wehrpflicht, strenger Disziplin und fester Bestallungsordnung.
2. Der Umbruch von Wirtschaft und Gesellschaft
Im Selbstverständnis der Bolschewiki war der ersten, „bürgerlichen“ Etappe der Revolution die zweite gefolgt: Sie hatte die Provisorische Regierung gestürzt und die „Diktatur des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft“ errichtet. Dem „bürgerlichen und gutsherrlichen Russland“ war der Kampf angesagt, die „Schaffung einer sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“ fortan das Ziel.
Schon am Tag nach dem Oktoberumsturz legte die neue Regierung ein „Dekret über Grund und Boden“ vor, das den Grundbesitz des Adels und der Krone, der Kirche und der Klöster entschädigungslos enteignete. Das gesamte lebende und tote Wirtschaftsinventar der konfiszierten Ländereien ging in das Nutzungsrecht des Staates und der Gemeinden über. Das Privateigentum an Grund und Boden sollte überhaupt abgeschafft, Land nie mehr verkauft und gekauft, verpachtet und verpfändet werden; der Boden sollte allen gehören und das Nutzungsrecht künftig jeder Staatsbürger besitzen, der ihn mit seiner Hände Arbeit bebaute. So hatten es im Sommer 1917 Bauernvertreter gefordert, und so wurde es nun Gesetz. Eine Umverteilung größten Ausmaßes, eine Agrarrevolution folgte.
Knapp drei Wochen später erließ der Rat der Volkskommissare eine Verordnung, die in allen Betrieben, die Lohnarbeiter beschäftigten oder Heimarbeit vergaben, die „Arbeiterkontrolle“ einführte. Die Mitsprache der Belegschaften bezog sich auf alle Bereiche, auf die Produktion und Finanzierung ebenso wie auf die Lagerhaltung und den Verkauf. Die Entscheidungen der Arbeiterkontrollorgane waren für die Betriebsführung verbindlich, das Geschäftsgeheimnis wurde aufgehoben. Die Organe der Arbeiterkontrolle sollten sich auf lokaler und regionaler Ebene zusammenschließen und in einem „Allrussischen Rat der Arbeiterkontrolle“ gipfeln.
Sozialistische Wirtschaft sollte auch Planwirtschaft sein. Zu diesem Zweck wurde noch im Dezember ein „Oberster Volkswirtschaftsrat“ errichtet. Ihm oblag die Organisation der Volkswirtschaft und die Aufsicht über die Staatsfinanzen. Er sollte dafür allgemeine Normen, nach Möglichkeit auch einen „Plan“ entwickeln und die Tätigkeit der lokalen und zentralen Wirtschaftsorgane „koordinieren“. Zu diesem Zweck hatte der Oberste Volkswirtschaftsrat auch das Recht, Enteignungen und Zwangszusammenschlüsse von Betrieben vorzunehmen. Die Nationalisierung der Banken folgte nur wenig später: Alle existierenden Banken wurden zur Staatsbank zusammengeschlossen und das Bankwesen zum Staatsmonopol erklärt.
Der Umbruch der Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse zielte auf alle Bereiche, alle Stände und Schichten, die Kirche und die Schule, die Ehe und die Familie. So wurden die Standes- und Rangeinteilungen, einschließlich der Titel und Bezeichnungen abgeschafft, die Standesorganisationen aufgelöst und ihr Besitz eingezogen. Die Kirche wurde vom Staat getrennt, Religion zur Privatsache erklärt und das Eigentum der Kirche konfisziert. Sie sollte auch keinerlei Einfluss auf die Schule mehr haben, alle Schulen wurden staatlicher Verwaltung unterstellt und der Religionsunterricht verboten. Die neue Familiengesetzgebung erkannte nur noch die Zivilehe an, erleichterte die Scheidung und stellte uneheliche und eheliche Kinder einander gleich. Und das war nur der Anfang: Eine wahre Flut von Dekreten und Verordnungen erläuterte, ergänzte und modifizierte diese Bestimmungen.
Wichtige Weichen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik waren damit gestellt. Doch die beschlossenen Maßnahmen entwickelten auch ihre Eigendynamik, die die Staatsführung nicht geplant und wohl auch nicht erwartet hatte. So stellte das Bodendekret den Bauern frei, wie sie das Land künftig nutzen wollten: als Einzelbauern, im Gemeindeverband oder im Rahmen einer Kollektivwirtschaft. Die überwältigende Mehrheit der Bauern entschied sich für die Gemeinde – und damit auch gegen die Form kollektiver Bodenbestellung, wie sie von den Bolschewiki propagiert wurde. In den Augen der Bauern hatte sich die Gemeindeverfassung seit Jahrhunderten bewährt. Ihre Eigentümlichkeit bestand darin, dass die Gemeinde als ganze über den Boden verfügte und den einzelnen Höfen nach der Zahl der Esser oder der männlichen Arbeitskräfte Parzellen zuteilte. Von Zeit zu Zeit wurde der Boden neu verteilt, nach Meinung der Bauern ein gerechtes Verfahren. Nun wurden einfach die konfiszierten Länder des Adels, der Kirche und der Klöster in die Umverteilung einbezogen, und die alte „Dorfgemeinde“ (russ. mir oder obščina, sprich: obschtschina) ging gestärkt aus der Revolution hervor.
Bei der Einführung der Arbeiterkontrolle war offen geblieben, welche Rechte künftig noch dem Unternehmer zustehen sollten, und die politische Führung hatte dazu auch keine einheitliche Meinung. Die Arbeiterkontrollorgane legten ihre neuen Befugnisse extensiv aus, zeigte sich Widerstand, so griff man sehr schnell zum Mittel der Enteignung. Die Zahl der „sozialisierten“, „kommunalisierten“ und „nationalisierten“ Betriebe ging schon im Winter 1917/18 in die Hunderte. Nicht nur Großunternehmen waren davon betroffen, nein, auch und vor allem Klein- und Kleinstbetriebe.