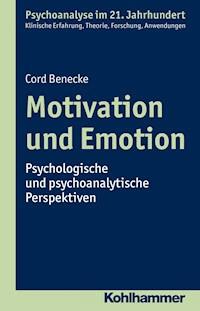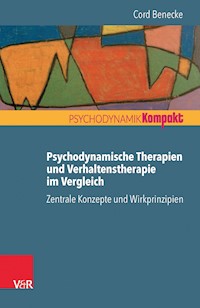Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Lehrbuch stellt die Komplexität der Klinischen Psychologie und Psychotherapie in ausgewogener Weise dar, indem auf die aktuellen Konzepte der unterschiedlichen theoretischen Orientierungen eingegangen wird. Als integrierender roter Faden wird die in allen modernen Modellen zentrale Dimension der Emotionsregulierung herausgearbeitet. Emotionale Prozesse bilden den Kern psychischer Störungen und sind gleichzeitig hochgradig vernetzt mit anderen psychischen Dimensionen wie kognitiven Prozessen, unbewussten Konflikten, Beziehungsmustern etc. Die Bearbeitung von emotionalen Prozessen kann als gemeinsamer Nenner moderner Psychotherapien gesehen werden, wie auch die Ergebnisse der Psychotherapie-Prozessforschung zeigen. Das Lehrbuch zeichnet sich durch eine starke Vernetzung der unterschiedlichen Themen aus. Dadurch gelingt eine ausgewogene und konsistente Darstellung des gesamten Fachgebietes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1383
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cord Benecke
Klinische Psychologie und Psychotherapie
Ein integratives Lehrbuch
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher
Umschlagabbildung: »Und wieder blüht’s im Felsengarten« (J.G.)
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-021696-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-024968-4
epub: ISBN 978-3-17-024969-1
mobi: ISBN 978-3-17-024970-7
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Dank
Einleitung
Teil I: Grundlagen
1 Was ist Klinische Psychologie und Psychotherapie
2 Historische Entwicklung der Klinischen Psychologie
3 Paradigmen, Therapietheorien, klinische Modelle
3.1 Allgemeine Struktur von Psychotherapietheorien
3.2 Allgemeines psychologisches Krankheitsmodell
4 Emotionstheorien
4.1 Traditionen der Emotionspsychologie
4.2 Definitionen von Emotion
4.2.1 Basisemotionen und Emotionsdimensionen
4.2.2 Emotionsausdruck
4.3 Anlass und Funktion von Emotionen
4.3.1 Auslöser von Emotionen
4.3.2 Motive und Emotion
4.3.3 Funktionen von Emotionen
4.4 Emotionen und weitere bio-psychische Aspekte
4.4.1 Emotionale Physiologie
4.4.2 Emotionen und Gedächtnis
4.4.3 Emotion und Vorstellung
4.5 Emotionsregulierung
4.5.1 Kognitive Regulierungsstrategien
4.5.2 Aufmerksamkeit und Exekutive Funktionen
4.5.3 Unbewusste Emotionen und deren Regulierung
4.5.4 Interpersonelle Emotionsregulierung – emotionale Kommunikation
4.5.5 Empathie als Basis intersubjektiver Prozesse
4.6 Entwicklung des Selbst und der Emotionsregulation
4.6.1 Emotionen und Selbstempfinden im ersten Jahr
4.6.2 Ich-Andere-Unterscheidung und Selbstkonzept im zweiten Lebensjahr
4.6.3 Die »Theory of Mind« als Basis kognitiver Regulierungsprozesse
4.6.4 Selbstdefinitionen und Motivregulierung im Schulalter
4.6.5 Identitätsentwicklung in Pubertät und Adoleszenz
4.6.6 Entwickelte Motivregulation und Identität
5 Biologische Modelle
5.1 Grundkonzept biologischer Modelle
5.2 Hirnstrukturen und ihre Funktion bei emotionalen Prozessen
5.2.1 Funktionelle Neuroanatomie emotionaler Prozesse
5.2.2 Emotionale Neuro-Chemie
5.2.3 Die Neurobiologie der Empathie
5.2.4 Neurobiologie der Emotionsregulierung
5.2.5 Das Ich im Hirn
5.3 Genetik, Neurophysiologie, Umwelteinfluss
5.3.1 Gen-Umwelt-Interaktionen: Untersuchungen an Tieren
5.3.2 Gen-Umwelt-Interaktionen: Untersuchungen bei Menschen
5.4 Zusammenfassung
6 Psychoanalytische Modelle
6.1 Strömungen der Psychoanalyse
6.2 Psychoanalytische Grundkonzepte
6.2.1 Psychoanalytische Motivationstheorien
6.2.1.1 Triebe, Sexualität und Libido bei Freud
6.2.1.2 Neuere psychoanalytische Motivationstheorien
6.2.2 Unbewusst – vorbewusst – bewusst
6.2.2.1 Freuds Theorie des Unbewussten
6.2.2.2 Vergangenheits- und Gegenwartsunbewusstes
6.2.3 Psychische »Instanzen«
6.2.3.1 Es – Ich – Überich
6.2.3.2 Abwehrmechanismen und andere Ichfunktionen
6.2.3.3 Selbst und Narzissmus
6.2.4 Psychoanalytische Entwicklungsmodelle
6.2.4.1 Das klassische Modell der Libido-Entwicklung
6.2.4.2 Weitere psychoanalytische Entwicklungstheorien
6.2.4.3 Internalisierungsprozesse und die Entwicklung affektiver Kerne im Selbst
6.3 Komponenten psychoanalytischer Störungstheorien
6.3.1 Pathogene Konflikte
6.3.2 Psychoanalytische Persönlichkeitsmodelle
6.3.2.1 Charaktertypologien
6.3.2.2 Dimensionale Strukturkonzepte
6.3.3 Repräsentanzen und Beziehungsmuster
6.3.4 Zusammenfassung: Allgemeines psychoanalytisches Störungsmodell
6.4 Emotionen in psychoanalytischen Modellen
6.4.1 Triebe und Affekte heute
6.4.2 Abwehr als Form der Affektregulierung
6.4.3 Liebe, Sexualität, Körper und Affekt
6.5 Zusammenfassung
7 Verhaltenstherapeutische Modelle
7.1 Lerntheoretische Modelle
7.1.1 Lerntheoretische Grundlagen
7.1.2 Psychische Störungen als gelerntes »Fehlverhalten«
7.2 Kognitive Modelle
7.2.1 Grundlagen der Kognitionspsychologie
7.2.2 Psychische Störungen als Folge dysfunktionaler Kognitionen
7.2.3 Weiterentwicklungen der kognitive Modelle
7.2.3.1 Das Konsistenztheoretische Modell von K. Grawe
7.2.3.2 Das Modell der Planstrukturen nach F. Caspar
7.2.3.3 Das Schema-Modell von J. E. Young
7.2.3.4 Metakognitionen: Eine neue »Welle« in der Verhaltenstherapie?
7.3 Unbewusstes, Emotionen und Beziehung in den »kognitiven« Modellen
7.3.1 Das Unbewusste und die Bedeutung früher Erfahrungen in verhaltenstherapeutischen Modellen
7.3.2 Motivation und Emotionen in verhaltenstherapeutischen Modellen
7.3.3 Strukturelle Störungen in verhaltenstherapeutischen Modellen
7.4 Zusammenfassung
8 Humanistische Modelle
8.1 Persönlichkeitstheorie der Gesprächspsychotherapie
8.1.1 Gesprächstherapeutische Entwicklungsmodelle
8.1.2 Die »voll entwickelte Persönlichkeit«
8.1.3 Beziehungstheorie bei Rogers
8.1.4 Emotionen im gesprächstherapeutischen Modell
8.1.5 Das Emotionsmodell von Lesley Greenberg
8.2 Humanistische Störungstheorie(n)
8.2.1 Gesprächstherapeutische Störungstheorien
8.2.2 Das Modell der Doppelten Handlungsregulation
8.2.3 Die existenzielle Perspektive
8.3 Zusammenfassung
9 Systemische Modelle
9.1 Historische Entwicklung systemischer Modelle
9.2 Exkurs: Selbstorganisation und dynamische Systeme
9.2.1 Einige Grundbegriffe dynamischer Systemtheorien
9.2.2 Psychische Attraktoren, oder: Wie geordnet sind Patienten?
9.3 Grundlegendes Störungsverständnis
9.4 Einige Systemische Modelle im Überblick
9.4.1 Das Mailänder Modell
9.4.2 Die Heidelberger Schule
9.4.3 Personzentrierte Systemtheorie
9.5 Zusammenfassung
10 Risiko- und Schutzfaktoren
10.1 Risiko-Faktoren
10.2 Salutogenese und Resilienz
10.3 Fazit zu den Risiko- und Schutzfaktoren
11 Fazit zu den Grundlagenmodellen
11.1 Emotionsdynamiken
11.2 Affektive Kerne und emotionale Vernetzungen
11.3 Prozedural-dynamische Regulierungsprozesse
Teil II: Psychische Störungen
12 Psychische Gesundheit
12.1 Was ist psychisch gesund? Definitionsprobleme
12.2 Psychologische Bedingung psychischer Gesundheit
12.3 Exkurs: Gesundheitspsychologie
13 Psychosoziale Krisen
13.1 Krisen-Definition
13.2 Krisen-begünstigende Faktoren
14 Definitionen psychischer Störungen
14.1 Epidemiologie psychischer Störungen
14.2 Auswirkungen und Kosten psychischer Störungen
15 Klassifikation psychischer Störungen
15.1 International Classification of Diseases: ICD-10
15.2 Diagnostische und Statistische Manual: DSM-IV/-5
16 Diagnostik
16.1 Beziehungsaufbau und allgemeiner Eindruck
16.2 Störungsdiagnostik – Klassifikationen und Dimensionen
16.3 Verfahrensspezifische Diagnostik
17 Depression und andere Affektive Störungen
17.1 Klassifikation der Affektiven Störungen
17.1.1 Depressive Episoden und Dysthymie
17.1.2 Manische und bipolare affektive Störungen
17.2 Epidemiologie, Komorbidität, Risikofaktoren
17.2.1 Prävalenz, Verlauf und Komorbidität
17.2.2 Risikofaktoren
17.3 Klinische Modelle der Depression
17.3.1 Psychoanalytische Modelle der Depression
17.3.2 Verhaltenstherapeutische Modelle der Depression
17.3.3 Neurobiologie der Depression
17.3.4 Weitere Modelle zu Depression
17.4 Forschungsbefunde zur Depression
17.5 Fazit zur Depression
18 Suizidalität und Suizid
18.1 Epidemiologie und Risikofaktoren
18.2 Erklärungsmodelle für Suizidalität
19 Angststörungen
19.1 Klassifikation der Angststörungen
19.1.1 Panikstörung und Agoraphobie
19.1.2 Soziale Phobie
19.1.3 Spezifische Phobien
19.1.4 Generalisierte Angststörung
19.2 Epidemiologie, Komorbidität, Risikofaktoren
19.3 Klinische Modelle von Angststörungen
19.3.1 Psychoanalytische Modelle von Angststörungen
19.3.2 Verhaltenstherapeutische Modelle von Angststörungen
19.3.3 Weitere Modelle von Angststörungen
19.4 Aktuelle Forschungsbefunde zu Angststörungen
19.5 Fazit zu Angststörungen
20 Zwangsstörungen
20.1 Klassifikation der Zwangsstörung
20.2 Epidemiologie, Komorbidität, Risikofaktoren
20.3 Klinische Modelle der Zwangsstörungen
20.3.1 Psychoanalytische Modelle der Zwangsstörungen
20.3.2 Verhaltenstherapeutische Modelle der Zwangsstörungen
20.3.3 Biologische Modelle der Zwangsstörungen
20.4 Aktuelle Forschungsbefunde zu Zwangsstörungen
20.5 Fazit zu Zwangsstörungen
21 Somatoforme Störungen und psychosomatische Erkrankungen
21.1 Klassifikation der Somatoformen Störungen
21.2 Psychosomatische Erkrankungen
21.3 Epidemiologie, Komorbidität und Risikofaktoren somatoformer Störungen
21.4 Klinische Modelle der Somatoformen Störungen
21.4.1 Psychoanalytische Modelle der Somatoformen Störungen
21.4.2 Verhaltenstherapeutische Modelle der Somatoformen Störungen
21.4.3 Weitere Modelle der Somatoformen Störungen
21.5 Aktuelle Forschungsbefunde zu Somatoformen Störungen
21.6 Fazit zu Somatoformen Störungen
22 Essstörungen
22.1 Klassifikation der Essstörungen
22.1.1 Anorexia Nervosa
22.1.2 Bulimia Nervosa
22.1.3 Binge-Eating-Disorder und Adipositas
22.2 Risikofaktoren für Essstörungen
22.3 Klinische Modelle der Essstörungen
22.3.1 Psychoanalytische Modelle der Essstörungen
22.3.2 Verhaltenstherapeutische Modelle der Essstörungen
22.3.3 Systemische Modelle der Essstörungen
22.4 Aktuelle Forschungsbefunde zu Essstörungen
22.5 Fazit zu Essstörungen
23 Posttraumatische Störungen
23.1 Traumadefinitionen
23.2 Traumafolgestörungen
23.2.1 Akute Belastungsreaktion
23.2.2 Posttraumatische Belastungsstörung – PTBS
23.2.3 Andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung
23.2.4 Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung
23.2.5 Anpassungsstörung
23.2.6 Spezialfall Sexuelle Gewalt
23.3 Verlaufsmodelle der psychischen Traumatisierung
23.4 Klinische Modelle der Traumafolgestörungen
23.4.1 Psychoanalytische Modelle der Traumafolgestörungen
23.4.2 Verhaltenstherapeutische Modelle der PTBS
23.4.3 Neurobiologische Aspekte der PTBS
23.5 Fazit zu Traumafolgestörungen
24 Persönlichkeitsstörungen
24.1 Dimensionale Persönlichkeitsdiagnostik im DSM-V
24.2 Paranoide Persönlichkeitsstörung
24.3 Schizoide Persönlichkeitsstörung
24.4 Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung
24.5 Abhängige/Dependente Persönlichkeitsstörung
24.6 Anankastische/Zwanghafte Persönlichkeitsstörung
24.7 Histrionische Persönlichkeitsstörung
24.8 Narzisstische Persönlichkeitsstörung
24.9 Dissoziale/Antisoziale Persönlichkeitsstörung
24.10 Emotional instabile/Borderline-Persönlichkeitsstörung
24.10.1 Ätiologie und Risikofaktoren der Borderline-Persönlichkeitsstörung
24.10.2 Psychoanalytische Modelle der Borderline-Persönlichkeitsstörung
24.10.3 Kognitiv-behaviorale Modelle der BorderlinePersönlichkeitsstörung
24.10.4 Forschungsbefunde zu Borderline-PS
24.10.5 Fazit zu Borderline-Persönlichkeitsstörung
25 Schizophrenie und andere psychotische Störungen
25.1 Klassifikation psychotischer Störungen
25.1.1 Schizophrenie
25.1.2 Weitere psychotische Störungen
25.2 Klinische Modelle der Schizophrenie
25.3 Emotionale Kommunikation und Schizophrenie
26 Psychische Störungen in Kindheit und Jugend
26.1 Epidemiologie und Komorbidität
26.2 Persistenz und Verlauf
26.3 Geschlechtsunterschiede
26.4 Ausgewählte Störungen bei Kindern und Jugendlichen
26.4.1 Frühe Regulationsstörungen
26.4.2 Depression, Angst und Zwang bei Kindern und Jugendlichen
26.4.2.1 Depression bei Kindern und Jugendlichen
26.4.2.2 Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen
26.4.2.3 Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen
26.4.3 Externalisierende Störungen
26.4.3.1 Hyperkinetische Störungen
26.4.3.2 Störung des Sozialverhaltens, Dissoziale Störung und Gewaltverhalten bei Kindern und Jugendlichen
26.4.4 Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen?
27 Fazit zu den »Störungsbildern« und das Komorbiditätsproblem
Teil III: Interventionsformen
28 Definitionen: Psychotherapie, Beratung, Prävention
28.1 Psychotherapie
28.2 Beratung und Krisenintervention
28.3 Prävention und Gesundheitspsychologie
29 Rahmenbedingungen, Ausbildung und Versorgungsstrukturen
29.1 Deutschland
29.2 Österreich
29.3 Schweiz
30 Allgemeine Wirkfaktoren und Prozessmodelle der Psychotherapie
30.1 Konzepte »universeller« Wirkfaktoren
30.2 Allgemeine Prozessmodelle basierend auf dynamischen Systemtheorien
31 Psychoanalytische Therapien
31.1 Psychoanalytische Wirkprinzipien und Techniken
31.1.1 Die Beziehung als Mittel und Feld der Veränderung
31.1.1.1 Übertragungsbeziehung und ihre therapeutische Nutzung
31.1.1.2 Förderliche Regressionen – der »analytische Prozess«
31.1.1.3 Neue Beziehungserfahrungen und Identifizierungen
31.1.1.4 Verstehen – was und wie?
31.1.2 Einsicht in unbewusste Hintergründe vermitteln
31.1.2.1 Deutungsarbeit
31.1.2.2 Das Prinzip der dynamischen Fokussierung
31.1.3 Strukturbildende therapeutische Arbeit
31.1.3.1 Stützende und Ich-Funktionen stabilisierende Techniken
31.1.3.2 Strukturdynamische Fokussierung
31.2 Psychoanalytische Diagnostik und Indikation
31.3 Behandlungsformen psychoanalytischer Therapien
31.3.1 Psychoanalytische Einzeltherapien
31.3.1.1 Psychoanalyse
31.3.1.2 Psychoanalytische Kurz- und Fokaltherapie
31.3.1.3 Psychodynamische Psychotherapien
31.3.2 Manualisierte Psychoanalytische Therapien
31.3.2.1 Beispiel: Supportiv-expressive Psychotherapie von Luborsky
31.3.2.2 Beispiel: Panik-Fokussierte Psychodynamische Psychotherapie
31.3.2.3 Beispiel: Strukturbezogene Psychotherapie nach Rudolf
31.3.2.4 Beispiel: Übertragungsfokussierte Psychotherapie nach Kernberg
31.3.2.5 Beispiel: Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT)
31.3.3 Psychoanalytische Gruppentherapien
31.1.4 Psychoanalytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
32 Verhaltenstherapien
32.1 Verhaltenstherapeutische Diagnostik
32.2 Behaviorale Methoden
32.2.1 Konfrontationsmethoden (exposure therapy)
32.2.2 Kompetenztraining (skill-trainings)
32.2.3 Operante Methoden
32.2.4 Selbstkontroll- bzw. Selbstmanagementmethoden
32.3 Kognitive Verhaltenstherapie
32.3.1 Grundmodell der »kognitiven« Verhaltenstherapie
32.3.2 Vorgehen in der kognitiven Therapie
32.3.3 Arbeiten mit Emotionen und Vergangenheit in der kognitiven Therapie
32.3.4 Die therapeutische Beziehung in der Kognitiven Therapie
32.3.5 Akzeptanz-basierte Techniken
32.4 Manualisierte verhaltenstherapeutische Methoden
32.4.1 Verhaltenstherapie bei Angst und Depression
32.4.1.1 Beispiel: Verhaltenstherapie bei Depression (Beck/Hauzinger)
32.4.1.2 Beispiel: Verhaltenstherapie bei Panikstörungen (Margraf/Schneider)
32.4.1.3 Beispiel: Transdiagnostische Verhaltenstherapie für »emotional disorders«
32.4.2 Verhaltenstherapien bei Persönlichkeitsstörungen
32.4.2.1 Beispiel: Kognitv-behaviorale Therapie nach Beck
32.4.2.2 Beispiel: Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT)
32.4.2.3 Schematherapie nach Young
32.5 Verhaltenstherapeutische Gruppenpsychotherapie
32.6 Verhaltenstherapeutische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
33 Humanistische Psychotherapien
33.1 Gesprächspsychotherapie
33.1.1 Zentrale Wirkprozesse der Gesprächspsychotherapie
33.1.1.1 Verändern durch Anerkennen (Bedingungsfreies Anerkennen)
33.1.1.2 Verändern durch Verstehen (Einfühlendes Verstehen)
33.1.1.3 Verändern durch Begegnen
33.2 Emotionsfokussierte Therapie von Greenberg
33.3 Humanistische Gruppenpsychotherapie
33.4 Humanistische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
34 Systemische Therapien
34.1 Systemische Diagnostik
34.2 Systemische Methoden
34.2.1 Strukturelle und strategische Methoden
34.2.2 Symbolisch-metaphorische Methoden
34.2.3 Zirkuläre Methoden
34.2.4 Lösungsorientierte Methoden
34.2.5 Narrative und dialogische Methoden
34.2.6 Systemische Familienrekonstruktion
34.3 Settings und behandelte Systeme
35 Traumatherapien
35.1 Behandlungsbeginn
35.2 Stabilisierung und Ressourcenaktivierung
35.3 Trauma-Exposition
35.4 Integration und Neuorientierung
36 Ethik in der Psychotherapie
36.1 Allgemeine, aktuell gültige ethische Grundsätze
36.2 Unethisches Verhalten von Psychotherapeuten
36.2.1 Sexueller Missbrauch und andere Formen von Ausbeutung
36.2.2 Übernahme von »Werten« als ethisches Problem
36.3 Ethik und Unethik des Gesundheitssystems
Teil IV: Psychotherapie-Forschung
37 Geschichte der Psychotherapieforschung
38 Wirksamkeitsforschung
38.1 Designfragen, Wirksamkeiten und Evidenzen
38.1.1 Efficacy und Effectiveness – Fragestellung und Design
38.1.2 Messung der Veränderungen
38.1.3 Beurteilung der Wirksamkeits-»Evidenz« von Psychotherapie
38.2 Exkurs: Wirksamkeit von Pharmakotherapie
38.2.1 Effekte von Antidepressiva
38.2.2 Placebos – nicht nur Nichts
38.2.3 Pharmakotherapie im Vergleich mit Psychotherapie
38.3 Befundlage zur Wirksamkeit von Psychotherapie
38.3.1 Wirksamkeit einzelner Verfahren
38.3.2 Das Dodo-Bird-Verdikt: Haben wirklich alle gewonnen?
38.3.3 What works for whom? – einmal anders
38.3.4 Dosis-Wirkungs-Effekte?
38.3.5 Neurobiologische Veränderungen durch Psychotherapie
38.4 Wirtschaftlichkeitsanalysen im Bereich Psychotherapie
38.4.1 Gesundheitsökonomische Studiendesigns
38.4.2 Befundlage zu Kosten-Wirkungsrelationen von Psychotherapie
38.5 Fazit zur Wirksamkeit von Psychotherapie
39 Prozessforschung
39.1 Methoden der Prozessforschung
39.1.1 Prozess-Fragebögen
39.1.2 Stunden-Ratings
39.1.3 Methoden zur Erfassung von Prozessvariablen auf der Mikroebene
39.2 Ergebnisse der Prozessforschung
39.2.1 Allianz, Beziehung und Bindung im therapeutischen Prozess
39.2.2 Therapeutische Interventionen und deren Zusammenhang mit dem Behandlungsergebnis
39.2.3 Patientenverhalten und -erleben im Zusammenhang mit dem Behandlungsergebnis
39.2.4 Nonverbale dyadische Muster im therapeutischen Prozess
39.2.5 Die Analyse nicht-linearer therapeutischer Prozesse
40 Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie
40.1 Formen von negativen Effekten
40.2 Gründe für Fehlentwicklungen
40.3 Fehlentwicklungsprophylaxe?
41 Fazit zu den Psychotherapie-Modellen und der Psychotherapieforschung
41.1 Bausteine einer Emotionsdynamischen Psychotherapie
41.2 Veränderungsziele und Wirkprozesse
41.3 Veränderungsstrategien und -Methoden
Literaturverzeichnis
Vorwort und Dank
Das vorliegende Lehrbuch basiert auf den Skripten meiner Vorlesungen, die ich seit nun fast zehn Jahren im Fachgebiet Klinische Psychologie und Psychotherapie halte. Anfangs schrieb ich die Skripten nur für mich als Gedächtnisstütze, später formulierte ich sie immer weiter aus, um sie den Studierenden zur Nachbearbeitung und Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stellen zu können. Dabei war und ist es mir ein Anliegen, die Vielfalt der theoretischen und klinischen Ansätze möglichst ausgewogen darzustellen, deren jeweilige Besonderheiten sowie auch »schulenübergreifende« Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist.
Viele Menschen haben auf ganz unterschiedliche Weise dazu beigetragen, dass es dieses Buch nun gibt und dass es so geworden ist, wie es ist. Besonders hervorheben möchte ich dabei Doris Peham, Astrid Bock und Dietmar Kratzer, mit denen ich in Innsbruck jahrelang eng zusammengearbeitet habe und denen ich viel verdanke. Svenja Taubner, Timo Stork, Johannes Zimmermann, Nadine Scharnowski, Sven Rabung und Gerhard Dammann haben jeweils Teile des Manuskripts gelesen, und durch ihre Anregungen hat der Text sehr gewonnen. Gerhard Roth wollte eigentlich »nur« die Neuro-Passagen auf »grobe Schnitzer« überprüfen, hat dann aber doch gleich den kompletten Text gelesen und mir sehr wertvolle Rückmeldungen gegeben. Rhea Eschstruth, Katharina Rek, Katharina Krasnow und Carmen Meiwes Turrión haben meine schludrige Rechtschreibung korrigiert. Rhea Eschstruth habe ich zudem zu verdanken, dass aus meinen schlichten Folien echte Abbildungen geworden sind. Ruprecht Poensgen vom Kohlhammerverlag hatte überhaupt erst die Idee zu diesem Lehrbuch und hat das ganze Projekt seitdem geduldig und sehr unterstützend durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Celestina Filbrandt hat das Manuskript redigiert und es zu einem Lehrbuch gemacht. Nicht zuletzt danke ich meinen Patienten, von denen ich wohl am allermeisten gelernt habe, und meinen Studierenden, die mich durch ihre Fragen immer wieder auf Trab halten.
Einleitung
Das Lehrbuch gliedert sich in vier Hauptteile.
Teil I Grundlagen: Nach einem historischen Abriss der Klinischen Psychologie sollen aktuelle grundlegende Konzepte der Krankheitslehre, der Ätiologie, der Psychogenese sowie der psychischen Erkrankungen zugrunde liegenden Kerndimensionen vorgestellt werden. Neben der Darstellung emotionstheoretischer und neurobiologischer Grundlagen werden die grundlegenden Modelle aus dem psychoanalytischen, dem verhaltenstherapeutischen, dem humanistischen und dem systemischen Umfeld vorgestellt. Dabei wird besonders auf die aktuellen Weiterentwicklungen klinischer Grundkonzepte eingegangen, die eine starke Annäherung der verschiedenen »Schulen« erkennen lassen. Sodann werden die empirisch gesicherten Risiko- und Schutzfaktoren und das bio-psycho-soziale Modell dargestellt. Zum Abschluss wird ein Versuch unternommen, die Gemeinsamkeiten der aktuellen klinischen Grundlagenmodelle herauszuarbeiten: Einen roten Faden durch die modernen klinischen Grundlagenmodelle bildet die Emotionstheorie. Emotionen stehen im Zentrum dynamischer psychischer Prozesse und sind hochgradig vernetzt mit allen klinisch relevanten Dimensionen.
Teil II Psychische Störungen: Nach der Darstellung der Probleme bei der Definition von psychischer Gesundheit werden die wichtigsten psychischen Störungen ausführlich beschrieben. Neben der Klassifikation und den diagnostischen Kriterien stehen insbesondere die Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung der jeweiligen Störungen im Vordergrund. Es werden unterschiedliche Störungsmodelle zu den jeweiligen Störungen dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf den psychoanalytischen und den verhaltenstherapeutischen Modellen liegt. Zudem werden in eigenen Abschnitten aktuelle Forschungsbefunde zu den Störungen beschrieben. Die Störungskapitel enthalten anschauliche Fallbeispiele. Den Abschluss bildet eine Diskussion der Komorbiditätsproblematik.
Teil III Interventionsformen: Dieser Teil gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze klinisch-psychologischer Interventionsformen und Psychotherapie. Nach der Darstellung der Konzepte zu allgemeinen Wirkfaktoren wird auf die wichtigsten Psychotherapie-Verfahren eingegangen. Dabei werden jeweils die allgemeinen Behandlungsprinzipien und Techniken, die sich aus den in Teil I beschriebenen Grundlagenmodellen ableiten, beschrieben. Zudem wird auf ausgewählte, aktuelle Psychotherapie-Manuale zur Behandlung spezieller Störungen (z. B. Depression, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen) gesondert eingegangen, sodass die therapeutischen Strategien anschaulich werden. Weitere Anwendungsformen, wie Gruppentherapien und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, werden ebenfalls beschrieben. Den Abschluss dieses Teils bildet ein Kapitel zur Ethik in der Psychotherapie.
Teil IV Psychotherapieforschung: Es wird ein Überblick über Historie, zentrale Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse der Psychotherapieforschung gegeben. Besonderes Augenmerk liegt einerseits auf der Untersuchung der Wirksamkeitsfrage und andererseits auf der Untersuchung therapeutischer Prozesse und deren Zusammenhang mit dem Behandlungsergebnis. Dabei zeigt sich, dass insbesondere die emotionalen Prozesse im Verlauf einer Psychotherapie eine entscheidende Rolle spielen. Den »Risiken und Nebenwirkungen« von Psychotherapie ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Aus den Gemeinsamkeiten der verschiedenen Psychotherapiemodelle sowie aus den Befunden der Prozessforschung werden zum Abschluss Bausteine einer »emotionsdynamischen« Psychotherapie abgeleitet: ein Integrationsversuch unter besonderer Berücksichtigung der Veränderung der Emotionsregulierung als zentrale Dimension therapeutischer Prozesse.
Teil I: Grundlagen
1 Was ist Klinische Psychologie und Psychotherapie
Der Begriff »Klinische Psychologie« wurde vom Amerikaner Ligthner Witmer (1867–1956) geprägt. Witmer studierte und promovierte bei Wilhelm Wundt am Institut für experimentelle Psychologie in Leipzig. Zurück in den USA gründete er 1896 die erste Psychological Clinic an der Universität von Pennsylvania. Hier wurden vornehmlich Kinder mit Leistungsproblemen untersucht und behandelt; es handelte sich also eher um eine Erziehungsberatungsstelle. 1917 wurde die American Association of Clinical Psychologists gegründet, die schon 1919 als Sektion in die American Psychological Association (APA) aufging.
Aus dem Institut von Wundt ging eine weitere für die Klinische Psychologie wichtige Person hervor: Emil Kraeplin (1856–1926), der später ganz wesentliche Impulse in der Psychiatrie setzte (siehe unten). Als weiterer Impulsgeber kann noch ein Mediziner betrachtet werden: Sigmund Freud (1856–1939). Abgesehen von seinen grundlegenden Arbeiten zum Verständnis und der Therapie psychischer Störungen, setzte Freud sich dafür ein, dass auch Nicht-Mediziner den Zugang zur Psychotherapie erhielten.1
»Kraeplin und Freud – beide Mediziner und keine Psychologen – können als wesentliche Impulsgeber für die deutschsprachige und internationale Klinische Psychologie angesehen werden. Die beiden Namen stehen aber auch für zwei unterschiedliche Selbstverständnisse der Klinischen Psychologie, die bis heute in der Wissenschaft und Praxis vielfach als widersprüchlich gesehen werden: Kraeplin als Protagonist der empirischen Klinischen Psychologie, Freud als Repräsentant eines hermeneutischen Wissenschaftsverständnisses, das vor allem in der Tiefenpsychologie ihren Niederschlag fand« (Baumann & Perrez 1998, Baumann & Perrez 1998, S. 11). Wie sich zeigen wird, sind diese beiden »Selbstverständnisse« heute bei Weitem nicht mehr so widersprüchlich, wie häufig dargestellt: Klinische Psychologie ist immer eine Mischung aus verstehenden Zugängen und empirischer Forschung.
Definition Klinische Psychologie:
Klinische Psychologie ist diejenige Teildisziplin der Psychologie, die sich mit psychischen Störungen und psychischen Aspekten somatischer Erkrankungen befasst, mit deren Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen, Klassifikation und Diagnostik, deren Verbreitung sowie deren Prävention und Behandlung
Mittlerweile wurden die meisten Lehrstühle für Klinische Psychologie umbenannt in Klinische Psychologie und Psychotherapie.2 »Aus Sicht der wissenschaftlichen Klinischen Psychologie wird Psychotherapie als Teilgebiet der Klinischen Psychologie gesehen, bzw. es wird ein besonderes Nahverhältnis postuliert. … Der traditionelle Psychotherapiebegriff bezeichnet eine Teilmenge der klinisch-psychologischen Interventionsmethoden, nämlich jene Methoden, die auf die Therapie gestörter Funktionsmuster (Syndrome) und gestörter interpersoneller Systeme bei psychischen Störungen bezogen sind« (Baumann & Perrez 1998, S. 9). Das sehen vor allem viele nicht-psychologische Psychotherapeuten ganz anders: Da die Psychotherapie sich nicht ausschließlich aus der akademischen Psychologie entwickelt hat, wird eine Definition wie die von Baumann und Perrez als Einverleibung empfunden.3
Mit der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master wird sich die Studienlandschaft wahrscheinlich in Zukunft recht bunt gestalten. So ist zu erwarten, dass relativ spezialisierte Masterstudiengänge entstehen, wahrscheinlich auch und gerade im Überschneidungsbereich der jetzigen Klinischen Psychologie und Psychotherapie.
Die Klinische Psychologie und Psychotherapie gilt als sogenanntes Anwendungsfach. Dies suggeriert, dass hier Erkenntnisse aus anderen Fächern, den Grundlagenfächern (Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie etc.) zur Anwendung gebracht werden. Dies ist sicher nur sehr bedingt der Fall. Zwar gehen die Erkenntnisse der Grundlagenfächer in die klinisch-psychologische Konzeptbildung ein, oder sollten dies zumindest, allerdings existierte immer schon eine gewissermaßen eigene klinisch-psychologische Grundlagenforschung, die teilweise nur wenig Bezug zum Mainstream der »eigentlichen« psychologischen Grundlagenfächer hat. Eine solche klinische Grundlagenforschung ist nicht zuletzt deshalb notwendig, weil ein Großteil der in den anderen Grundlagenfächern betriebenen Forschungen für Fragestellungen der Klinischen Psychologie nur sehr begrenzte Relevanz hat bzw. die aus klinischer Sicht relevanten Phänomene dort nicht untersucht werden. Vielfach erscheint der Input der klinisch-psychologischen Grundlagenforschung in die anderen Grundlagenfächer weit höher als umgekehrt – man denke nur an grundlegende Modelle der Persönlichkeitspsychologie, an die Entwicklungspsychologie, an die Entwicklung kognitiver Modelle, an die Bedeutung unbewusster Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, an die Bedeutung von Emotionen und Emotionsregulierung etc.; selbst die Neurowissenschaften bemühen sich zunehmend um einen Dialog mit den »Klinikern«, da die klinischen Modelle geeignet erscheinen, den gemessenen neuronalen Prozessen eine psychologische Bedeutung zu geben.
1 »Nun, für den Kranken ist es gleichgültig, ob der Analytiker Arzt ist oder nicht …« (Freud 1926b, S. 279).
2 Hintergrund dieser um die Psychotherapie erweiterten Bezeichnung waren zu einem wesentlichen Teil »politische« Aspekte im Umfeld der Auseinandersetzungen um das deutsche Psychotherapeutengesetz, nachdem der Deutsche Ärztetag 1992 das Fach »Psychiatrie« in »Psychiatrie und Psychotherapie« umbenannt und das Fach »Psychsomatische Medizin« eingeführt hatte (ab 2003 »Psychosomatische Medizin und Psychotherapie«).
3 Neuerdings gibt es vermehrte Bestrebungen, ein eigenes akademisches Fach namens »Psychotherapiewissenschaften« (z. B. Fischer 2011) zu etablieren. Dabei wird argumentiert, dass die psychotherapeutischen Konzepte ihre Wurzeln gleichfalls in Medizin, Philosophie, Theologie, Pädagogik und Sozialwissenschaften haben, und die psychologische Verankerung nur einen geringen Teil der historischen Entwicklung ausmacht.
2 Historische Entwicklung der Klinischen Psychologie
Psychische Störungen existieren wohl schon solange es Menschen gibt. Die Erklärungen dieser Phänomene wechselten allerdings drastisch. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Historie von Konzepten zur Erklärung von psychischen Störungen sowie die entsprechenden Behandlungsmethoden gegeben werden. Die Darstellung folgt im Wesentlichen der Gliederung von Davison et al. (2002), einerseits gekürzt, andererseits um etliche Aspekte ergänzt. Eine schöne »Kulturgeschichte« psychischer Störungen und deren »Behandlung« findet sich in Nissen (2005)4.
Dämonologie
Das Grundmuster des dämonologischen Störungsmodells ist folgende Vorstellung: Ein »fremdes« Wesen ergreift »Besitz« von einer Person und verursacht die psychische Störung.
Im alten Babylon gab es für jede Krankheit einen eigenen Dämon; der Dämon »Idta« war für »Wahnsinn« zuständig. Auch der Teufel hat eine lange Tradition: Jesus heilt einen Mann mit »unreinem Geist«, indem er den Teufel austreibt und in eine Herde Schweine jagt – die Besessenheit geht auf die Tiere über und sie stürzen sich ins Meer (Marcus 5, 8–13)5. Dämonenaustreibung geschah üblicherweise mittels ausgefeilter Gebetsriten, Lärmritualen, übel-schmeckendem Gebräu, oder drastischer: Auspeitschen oder Nahrungsentzug, um den Körper für den Dämon/Teufel »unbewohnbar« zu machen.
Noch heute gibt es offizielle Exorzisten in der katholischen Kirche. Lange Zeit galt Anneliese Michel aus Klingenberg als der letzte offiziell durchgeführte Exorzismus in Deutschland (Wolff 2006; Goodman & Siegmund 2006). 2008 wurden allerdings weitere Fälle bekannt: Im Erzbistum Paderborn beispielsweise habe es zwischen 2000 und 2008 laut Bistumssprecher 18 ernstzunehmende Anfragen von Menschen gegeben, die glaubten, vom Teufel besessen zu sein; in drei Fällen wurde ein Exorzismus durchgeführt. Voraussetzung sei, dass die Prüfung durch einen Pastoralpsychologen und einen Psychiater das Fehlen einer psychischen Störung bestätigt, dann werde die »Liturgie der Befreiung« in Auftrag gegeben, d. h. die Austreibung des Bösen durch einen Exorzisten. Exorzismus sei in Frankreich und Italien, vor allem aber in Afrika und Lateinamerika deutlich häufiger als in Deutschland6.
Aber schon früh gab es auch deutlich nettere Behandlungsformen. Im ägyptischen Tempel des Imhotep (Gott der Heilung) war die wichtigste Therapie der Schlaf im Tempel, auch die künstlerische Betätigung der Kranken wurde als heilend betrachtet. In Griechenland wurden die Tempel des Asklepios (griechischer Gott der Heilkunst) in der Nähe von Heilquellen oder auf Bergen errichtet; auch hier war der Tempelschlaf eine wichtige Methode: den Kranken erschien Asklepios im Traum und erteilte Rat; dazu gab es Bäder, Diät und Körperübungen. Wenn das alles nichts half, wurden die Befremdlichen allerdings auch schon mal mit Steinen aus dem Tempel gejagt.
Somatogenese I
Allgemein gehen somatogenetische Erklärungen von folgender Grundannahme aus: Eine Störung im Soma verursacht die Störung des Erlebens und Verhaltens.
Hippokrates (460–377 v. Chr.) gilt als Begründer der modernen Medizin. Er absolvierte seine Ausbildung im berühmten Asklepios-Tempel von Kos. Hippokrates trennte die Medizin von Religion und Magie. »Seelische Verwirrungen« seien nicht Strafe der Götter, sondern hätten natürliche Ursachen, wahrscheinlich Störungen im Gehirn als Sitz des Intellekts und der Gefühle. Hippokrates unterschied drei Kategorien psychischer Erkrankungen: Manie, Melancholie, Gehirnfieber (Phrenitis). Er lieferte differenzierte Beschreibungen noch heute gültiger Erkrankungen (wie Epilepsie, Alkoholsucht, Paranoia etc.). Als zentrale Ursachen sah er Ungleichgewichte der vier »Säfte« (Blut, schwarze Galle, gelbe Galle und Schleim): so seien Trägheit/Dummheit durch zu viel Schleim (Phlegma) verursacht, Melancholie durch zu viel schwarz Galle, Reizbarkeit/Ängstlichkeit durch ein Zuviel an gelber Galle, ein launisches Temperament durch zu viel Blut.
Frühmittelalter und Mittelalter
Gewissermaßen das »Manual« zur Hexenbekämpfung erschien 1486 mit dem Malleus Maleficarum (»Der Hexenhammer«) von den Dominikanermönchen Heinrich Kramer und Jakob Sprenger, in dem die konstitutionelle Anfälligkeit von Frauen für Zauber, Magie und Teufelspakte dargelegt wird. Insbesondere die Sexualität der Frauen sei sehr gefährlich, und die Männer seien ständig in Gefahr, diesem üblen weiblichen Zauber zum Opfer zu fallen. Entsprechend liefert das Werk gewissermaßen Diagnosekriterien zum Erkennen von Teufelsbefall und beschreibt Methoden zur Teufelsaustreibung.
So obskur und grausam die »Behandlungsmethoden« wie Dämonen- oder Teufelsaustreibung heute anmuten, sie ergeben sich stringent aus dem damaligen »Störungsverständnis«: ist die Ursache einer (leidvollen) psychischen Erscheinung die Besessenheit durch ein fremdes Wesen, ist es konsequent, Maßnahmen durchzuführen, die dieses Wesen aus den Befallenen vertreiben.
Das gilt noch heute: Aus den Störungsmodellen sollte sich möglichst stringent die Therapie ableiten. Mit kritischer Distanz betrachtet, wirken heutige Behandlungstechniken oft nicht weniger obskur: Einen Phobiker zu »zwingen«, sich solange dem Objekt seiner Angst auszusetzen, bis die Angst nachlässt, erscheint doch arg grausam; ebenso ein sich hinter der Couch in Abstinenz und Neutralität übender und hin und wieder Deutungen von sich gebender Therapeut gegenüber einem offensichtlich bedürftigen Patienten; oder die Vorstellung, man könne durch das bloße Angebot einer wertschätzenden Beziehung für 50 Minuten wöchentlich die »Heilung« einer chronischen psychischen Störungen erreichen; oder die Annahme, eine leidende Familie könne durch ein paar provokante »System-Verstörungen« zu einem nachhaltig gesünderen Miteinander gebracht werden. Diese zugegebenermaßen karikaturhafte Darstellung soll verdeutlichen, dass auch heute die Frage der Stringenz zwischen (mehr oder weniger) wissenschaftlichen Störungsmodellen und den daraus abgeleiteten Behandlungsmethoden immer wieder kritisch zu hinterfragen ist.
Die Phase der Asyle
Bis zum 15. Jahrhundert gab es keine Hospitäler für psychisch Kranke in Europa, dafür aber viele für Leprakranke. Nach Ende der Kreuzzüge ging die Lepra zurück und man wandte sich vermehrt den Geisteskrankheiten zu und nutzte u. a. die alten Lepraeinrichtungen zur Internierung psychisch Kranker – die Asyle.
In London wurde 1547 das Piority of St. Mary of Bethlehem eröffnet, ein Asyl für Geisteskranke; »Bedlam« (Volksmund für »das Hospital«) wurde zum Synonym für Aufruhr und Chaos. Das Asyl wurde zu einer der größten Touristenattraktionen Londons: gegen Eintritt konnten die »Verrückten« besichtigt werden. In Wien kam es 1784 zur Eröffnung des »Narrenturms«. Auch hier gab es Besichtigungen, die Passanten konnten durch die Zwischengänge die »Narren« betrachten. Der Narrenturm beinhaltet heute eine skurrile Sammlung von »Instrumenten«, mit denen die »Irren« traktiert wurden. In den USA sah Benjamin Rush (18. Jahrhundert in Philadelphia) die Ursache psychischer Störungen in einem »Blutandrang im Gehirn« – entsprechend verordnete er Aderlässe bis zu fünf Litern: die Patienten wurden tatsächlich ruhiger (!). Als weitere Behandlungsmethode versetzte er die Patienten in Angst und Schrecken (z. B. wurden sie in einem Sarg unter Wasser gedrückt).
Die Wende im Umgang mit psychisch Kranken wird allgemein durch das Wirken von Philippe Pinel (1745–1826) gesehen, der seit 1793 die Leitung des Pariser Asyls La Bicêtre innehatte. Bis dahin wurden die Patienten mit Ketten an den Wänden gehalten, vor ihnen ein Napf. Pinel ließ die Ketten entfernen, brachte die Patienten in hellen Räumen unter, verordnete Spaziergänge etc. – viele konnten tatsächlich geheilt entlassen werden. Gemäß den Idealen der Französischen Revolution waren auch Geisteskranke Menschen mit Würde. Als Ursache für Geisteskrankheit wurde eine Kombination aus Disposition und persönlichen Lebensereignissen gesehen; Emotionen verstand Pinel als Bindeglied zwischen Körper und Seele (eine recht moderne Sicht). Die Therapie bestand wesentlich in tröstlichem Zuspruch und sinnvoller Tätigkeit. Eine ähnliche Entwicklung erfolgte dann in England, USA usw. – die Hospitäler hatten meist eine starke religiöse Ausrichtung.
Der Beginn der modernen Auffassungen kann durch eine Parallelentwicklung beschrieben werden: ein Wiederaufgreifen der Somatogenese einerseits, und die Entwicklung von Modellen der Psychogenese andererseits.
Somatogenese – reloaded
Wilhelm Griesinger nahm Mitte des 19. Jahrhunderts das Konzept der Somatogenese (Hippokrates) wieder auf: Für jede psychische Störung sollte eine physiologische Ursache spezifiziert werden.
Emil Kraeplin (1856–1926) veröffentlichte 1883 das erste Lehrbuch der Psychiatrie mit einem Klassifikationssystem. Er ging von physiologischen Ursachen für die von ihm beschriebenen Syndrome (= Gruppe von Symptomen) aus. Auch wenn die ursächlichen physiologische Dysfunktionen noch nicht bekannt waren und spezifische Therapien noch nicht verfügbar, so sollten doch zuverlässige Verlaufsprognosen möglich sein. Kraeplin unterschied zwei Hauptgruppen schwerer psychischer Störungen: Dementia praecox (heutige Schizophrenie) und Manisch-depressive Psychose.
Weiterhin stand die Suche nach somatischen Ursachen im Vordergrund. Es wurden weitreichende Fortschritte bei der Erforschung des Nervensystems gemacht. Man fand beispielsweise bei senilen und präsenilen Psychosen degenerative Veränderungen in Gehirnzellen, bei Oligophrenie strukturelle Pathologien.
Gewissermaßen paradigmatisch für die somatogenetische Sicht wurde die Progressive Paralyse, die durch psychische Symptome wie bei Geisteskranken charakterisiert ist7. Es kursierten verschiedene Ursachenmodelle für die progressive Paralyse: weil häufig Matrosen betroffen waren, wurde die Ursache im Seewasser vermutet; Griesinger meinte, weil häufig Männer erkrankten, sei die Ursache im Alkohol-, Tabak- und Kaffeekonsum zu finden. Erst mit Louis Pasteur und der Keimtheorie der Krankheiten konnte eine spezifische somatische Ursache gefunden werden: die progressive Paralyse ist die Spätfolge einer Syphilis.
Psychogenese
Besonders in Frankreich und Österreich entwickelte sich mehr oder weniger zeitgleich eine andere Ursachenperspektive: Psychische Störungen basieren auf psychischen Funktionsstörungen. Die Ursachen psychischer Störungen gründen im Psychischen selbst, und entsprechend gilt es, die Eigengesetzlichkeit des Psychischen zu erforschen, um psychische Störungen zu verstehen.
Die »Parade-Krankheit« für diese Modellentwicklung war die damals sehr verbreitete Hysterie (heute Konversionsreaktion bzw. Histrionische Persönlichkeitsstörung). Sie zeichnete sich durch eine Vielzahl von Symptomen aus, z. B. sogenannte »Handschuh-Anästesie«, Lähmungen, hysterische Blindheit, Taubheit, Erinnerungslücken etc.
Franz Anton Messmer (Wien/Paris; 1734–1815), führte erste systematische Hypnosen durch und beeinflusste dadurch die Behandlung von psychischen Krankheiten. In der Folge gab es einen wahren Boom von psychogenen Erklärungsmodellen.
Jean Martin Charcot (1825–1893) favorisierte ursprünglich die Somatogenese zur Erklärung der Hysterie. Das änderte sich, als einige seiner Studenten einer gesunden Frau unter Hypnose hysterische Symptome suggerierten. Charcot ließ sich täuschen und hielt sie für eine echte Hysterikerin, und war sehr verwundert, als die Studenten die Frau weckten und alle Symptome sich in Nichts auflösten. Heinroth (1793–1843) übersetzte die Arbeit von Esquirol (1827) und betonte in seinem Kommentar die Wechselwirkungen zwischen psychischen und physischen Prozessen sowie die Bedeutung psychischer Konflikte für die Entstehung psychischer Erkrankungen. Ideler (1795–1860) entwickelte (immer noch recht aktuelle) Konzepte, die von einem »Antagonismus der Gemutstriebe« (Ideler 1835), von einem »zwiespältigem Gemutszustand« und »logischen Widersprüchen des Bewusstseins« (ebd., S. 518) ausgehen; Ideler (1838) beschreibt einen »inneren Zwiespalt im Gemut« durch den »Kampf der unterdruckten Triebe gegen den vorherrschenden Trieb« sowie durch den »Widerstreit der Gefühle«. Hagen (1814–1888) verstand stabile Wahnbildungen (»fixe Ideen«) als Ergebnis eines »unbewußten« Erklärungsversuchs zur Linderung von Angst und zum Füllen einer »Lücke«. Wilhelm Griesinger (1817–1868) ging davon aus, dass innerpsychische Konflikte (»heftige innere Kämpfe«) einen »Riss in das Ich« bringen könnten, was zu »Geisteskrankheiten« führe (Griesinger 1861). Ludwig Meyer (1827–1900) stellte die Stimmung ins Zentrum psychischer Prozesse und hob ihre Bedeutung für psychische Erkrankungen hervor (Meyer 1854).
Die psychogene Perspektive, inklusive der Bedeutung von inneren Konflikten und den damit verknüpften Emotionen, war also schon in der Welt, als Breuer und Freud ihre Modelle und Behandlungsmethoden entwickelten (vgl. Scharfetter 2005; Böker 2005). Zeitlich parallel entwickelte Pierre Janet (1859–1947), Schüler von Charcot, seine Ideen, und nahm an, dass sich bei der Hysterie aufgrund einer Nervenschwäche Teile von Gedanken, Emotionen und Empfindungen abspalten, was er als »Dissoziation« bezeichnete.
Einen gewichtigen Beitrag leisteten Josef Breuer und seine Patientin Anna O., die er zwischen 1880 und 1882 behandelte. Anna O. litt unter einer Vielzahl hysterischer Symptome: Lähmungen, Beeinträchtigungen von Sehen, Hören und Sprechen, zuweilen Absencen (während derer sie vor sich hin murmelte und offensichtlich von quälenden Gedanken heimgesucht wurde). Breuer hypnotisierte Anna O. und gab ihr eigene Wortfetzen aus dem Gemurmel zurück, was sie dazu brachte, freier zu sprechen – danach erfolgte oft eine Besserung der Symptome. Breuer erprobte die Methode bei weiteren Patientinnen und stellte fest, dass diese wirksamer war, wenn sich die Patientinnen unter Hypnose an die zugrunde liegenden Ereignisse erinnerten und die dazugehörigen Affekten zum Ausdruck brachten – er nannte dieses Vorgehen die Kathartische Methode.
Im Jahr 1895 erschienen die »Studien über Hysterie« von Josef Breuer und Sigmund Freud (Breuer & Freud 1895), mit einem Kapitel Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene, einigen Krankengeschichten (u. a. Anna O.) sowie das Kapitel Zur Psychotherapie der Hysterie. Diese Schrift gilt noch heute als »Meilenstein der Klinischen Psychologie« (Kriz 2001), da hier erstmals für eine umschriebene Störungsgruppe eine rein psychologische, in sich relativ stringente Erklärung vorgelegt wurde, woraus sich eine psychologische Behandlungsstrategie ableiten ließ, die an mehreren Fallbeispielen veranschaulicht wurde.
4 Nissen 2005 beschreibt zwar die »Kulturgeschichte seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen« – in Bezug auf frühere Jahrhunderte ist diese aber nicht von der der Erwachsenen zu trennen.
5 Eine sehr schöne Übersicht über Teufelsvorstellungen gibt Peter Stanford 2000 in Der Teufel – Eine Biographie
6 »Im Kampf gegen das Böse«, Süddeutsche Zeitung vom 20.05.2008, Nr. 116, 12.
7 Klinisch werden drei psychotische Verläufe der Progressiven Paralyse unterschieden: 1) demente Form mit Affektstörungen und Antriebsminderung; 2) agitierte Form mit Veränderung der Persönlichkeit, Neigung zu Größenwahn; 3) halluzinatorische Form mit einer der Schizophrenie ähnelnden Symptomatik.
3 Paradigmen, Therapietheorien, klinische Modelle
In diesem Kapitel soll, nach einer kurzen Erläuterung des Begriffs »Paradigma« und allgemeinen Bemerkungen zur Struktur des Wissens in der Klinischen Psychologie, ein grobes Schema eines »allgemeinen psychologischen Störungsmodells« vorgestellt werden, welches dann gewissermaßen als Folie zur Beschreibung der unterschiedlichen »schulen«-spezifischen Modelle dient. Die den zentralen »Paradigmen« in der Klinischen Psychologie inhärenten Grundannahmen sowie die davon jeweils ausgegangenen Konzeptentwicklungen werden in den darauf folgenden Kapiteln dargestellt werden. Allerdings wird dort nicht mehr von Paradigmen gesprochen, sondern von Modellen, da, wie ersichtlich werden wird, sich die Grenzen zwischen den »Paradigmen« zunehmend auflösen.
Allgemein ist ein Paradigma ein System grundlegender Annahmen, die eine bestimmte Gesamtheit wissenschaftlicher Fragestellungen beschreiben und dabei sowohl die Art der Konzepte festlegen, die als legitim angesehen werden, als auch die
Wichtige Paradigmen in der Klinischen Psychologie:
• Das biologische Paradigma
• Das psychoanalytische Paradigma
• Das lerntheoretische Paradigma
• Das kognitive Paradigma
• Das humanistische Paradigma
• Das systemische Paradigma
• Das bio-psycho-soziale Paradigma
Methoden, die zur Erhebung und Interpretation von Daten herangezogen werden können (Kuhn 1981). Paradigmen können also auch als Leitbilder wissenschaftlicher Arbeit betrachtet werden. Im Bereich Klinische Psychologie beinhalten diese dann eben auch die Leitbilder therapeutischer Arbeit.
Allerdings gilt wohl auch: »Paradigmen sind selbstgeschaffene, hauchdünne Barrieren gegen den Schmerz der Ungewissheit« (Yalom 1989a, S. 26), weil die Festlegung auf ein bestimmtes Paradigma das Welt- und Menschenbild ordnet und strukturiert. Dies ist einerseits sehr hilfreich, andererseits werden die nicht zum jeweiligen Paradigma gehörenden Aspekte meist mehr oder weniger deutlich als »unwichtig« erklärt.
Wie sich herausstellen wird, sind diese Paradigmen bei Weitem nicht mehr so klar abgegrenzt, vor allem, weil sich innerhalb der Paradigmen die grundlegenden Annahmen so sehr differenziert haben, dass die Überschneidungspunkte heute in vielen Bereichen bei genauer Betrachtung größer sind als die Differenzen.
Daher spreche ich im Folgenden nicht von Paradigmen, sondern von Modellen. Auch wenn es große Überschneidungen in den Modellen gibt, halte ich eine gesonderte Darstellung der Modelle mit ihren »Grundannahmen«, auch den historischen, nach wie vor für wichtig, nicht zuletzt, um die teilweise bizarren Auseinandersetzungen zwischen den sogenannten Psychotherapie-»Schulen« zu verstehen.
Die Gesamtheit der Annahmen und Konzepte zu psychischen Störungen und deren Behandlung bezeichne ich als Psychotherapie-Theorie. Die Psychotherapietheorien sind laut Krause (Krause 2009) gegenwärtig parawissenschaftlich, da keine existierende Theorie die Integration aller relevanten Dimensionen auch nur annähernd leistet. Dennoch sind diese Theorien und Modelle wichtig, da sich der Therapeut/die Therapeutin sonst schnell im Beliebigen verliert.
3.1 Allgemeine Struktur von Psychotherapietheorien
Psychotherapietheorien
I) Metatheorie/allgemeine Störungstheorie
• allgemeine Motivationstheorie
• allgemeine Entwicklungspsychologie
• allgemeine Persönlichkeitstheorie
• basale psychische Dimensionen
• grundlegende psychische Prozesse
• psychische Gesundheitstheorien
– allgemeine Störungstheorie
II) Spezifische Störungstheorien
• Klassifikation, Epidemiologie und Verlauf bestimmter Störungen
• störungstypische Konfiguration psychischer Dimensionen
• Ätiologie und Pathogenese bestimmter Störungen
• störungstypische Auslösung und Aufrechterhaltung
III) Veränderungsziele
• Wirkprozesse
• Veränderungsstrategien
• Veränderungsbedingungen
– Veränderungstheorien
– Theorie der Beziehung
– Konkrete Strategien
– Therapeutenpersönlichkeit
– Phasen-Konzepte
• Methoden
• Techniken/Interventionen
• Wirkungen
IV) Psychotherapieforschung
• Wirksamkeitsforschung
• Prozessforschung
Da die Vielfalt der Theorien und Modelle innerhalb der klinische Psychologie und Psychotherapie schnell verwirrend und unübersichtlich wird, erscheint es sinnvoll, sich die allgemeine Struktur klinisch-psychologischer bzw. Psychotherapietheorien zu vergegenwärtigen.
Insgesamt sollten Psychotherapietheorien (aller »Schulen« bzw. »Verfahren«) Aussagen über die im Kasten (Psychotherapietheorien) aufgelisteten Bereiche machen können. Alle diese Punkte können verfahrensspezifisch sehr unterschiedlich ausformuliert bzw. gehandhabt werden. Die vier Ebenen beeinflussen sich wechselseitig. Gleichzeitig werden die klinischen Theorien wiederum von Entwicklungen in Nachbardisziplinen (z. B. der Allgemeinen Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Humanethologie, Soziologie, Hirnforschung, Genetik etc.) beeinflusst.
I) Metatheorie/Allgemeine Störungstheorie: Diese Theoriegruppe beinhaltet grundlegende Konzeptionen der menschlichen Psyche. Hier werden üblicherweise auch Aussagen über basale menschliche Motivsysteme, über die grundlegenden psychischen Dimensionen und deren Entwicklungsbedingungen gemacht. So gehören die allgemeine Strukturtheorie der Psychoanalyse (mit den Instanzen Es, Ich, Überich) hier ebenso hinein wie das SORKC- oder das ABC-Modell der Verhaltenstherapie, die gesprächstherapeutische Theorie der Aktualisierungstendenz oder die allgemeine Kommunikationstheorie der systemischen Therapie. Auf dieser Theorieebene werden grundlegende Aussagen über die das menschliche Verhalten und Erleben konstituierenden Prozesse gemacht, aus denen sich dann sowohl allgemeine Persönlichkeitstheorien als auch allgemeine Störungs- und Gesundheitstheorien ableiten (Letztere werden allerdings selten ausformuliert). Die allgemeinen Störungstheorien beschreiben die (paradigmentypischen) grundlegenden Annahmen bezüglich psychische Störungen verursachende, auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen und Prozesse sowie die für das Verständnis psychischer Störungen relevanten Dimensionen, wie z. B. dysfunktionale Kognitionen, unbewusste Konflikte, strukturelle Beeinträchtigungen, Inkongruenzen etc.
II) Spezielle Störungstheorie: Unterhalb der Metatheorien bzw. der allgemeinen Störungstheorien gibt es die differenziellen Krankheitslehren, störungsspezifische Modelle, die gewissermaßen Anwendungen der Metatheorie auf bestimmte psychische Störungen darstellen und die für die jeweiligen Störungen mehr oder weniger spezifische Konfigurationen beschreiben. Diese Theorieebene beinhaltet Klassifikationen, Befunde bezüglich Verbreitung (Epidemiologie) und typischen Verläufen bestimmter Störungen sowie die (wiederum schulenspezifischen) Modelle bzgl. der zugrundeliegenden psychischen Konstellationen, inklusive Modelle zur Ätiologie, Pathogenese und Aufrechterhaltung bestimmter Störungen.
III) Veränderungstheorie: Eine Veränderungstheorie beinhaltet alle Aspekte, die sich auf die Veränderung, Linderung oder Heilung psychischer Störungen beziehen. Sie besteht wiederum aus verschiedenen Unterpunkten:
Veränderungsziele:
Bei den Veränderungszielen lassen sich grob zwei Bereiche unterscheiden:
a. der Bereich der Beschwerden/Symptome/Syndrome und
b. der Bereich der (inneren bzw. systemgenerierten) Krankheitsdispositionen; diese leiten sich direkt aus der jeweiligen Störungstheorie ab.
Auf Seiten des Patienten dürften üblicherweise die Veränderungsziele im Bereich der Beschwerden und Symptome gesehen werden und selbstverständlich sollte auch dem Therapeuten daran gelegen sein; Therapeuten brauchen aber (ausgehend vom jeweiligen Störungsmodell) klare Vorstellungen darüber, was sich im Patienten verändern muss, damit die Beschwerden nachhaltig abklingen, die Symptome möglichst dauerhaft verschwinden oder zumindest abschwächen. In allen Therapieschulen beinhaltet der letztgenannte Bereich die »eigentlichen« Veränderungsziele auf Seiten des Therapeuten, aus denen sich die Veränderung im Beschwerde/Symptom-Bereich »ergibt«. Beispiele für Veränderungsziele in diesem Bereich wären »Ersetzen« dysfunktionaler Kognitionen durch funktionalere, Entwicklung von Selbsttransparenz und Selbstkongruenz, Entwicklung von Affektkontrolle, Entwicklung von Bindungsfähigkeit, Bewusstheit über innere Konflikte und Flexibilisierung von Abwehr, Integration von Selbst- und Objektrepräsentanzen, Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit und einer mentalisierten Affektivität, Entwicklung struktureller Funktionen etc. – Veränderungen in diesen Bereichen »bewirken« dann die Veränderungen auf der Symptomebene.
Wirkprozesse:
Hier wäre zu klären, durch welche (überwiegend) inneren Prozesse die oben genannten Veränderungsziele erreicht werden können. Also beispielsweise: Wie entwickelt sich (bei einem Erwachsenen) die Mentalisierungsfähigkeit? Was genau ist kognitive Umstrukturierung und wie geschieht sie psychisch? Was ist eine Regression im Dienste des Ichs? Was ist eine emotionale Einsicht? Was ist Nachreifung? Wie löst sich eine Blockade der Aktualisierungstendenz auf? etc. Hier sind beispielsweise alle Arten von Lernprozessen anzuführen inklusive Modelllernen, Identifizierungsprozesse, (Wieder-)Erleben und »Aushalten« bisher vermiedener/abgewehrter Affekte mit anschließender Reflexion und psychischer Integration, Erleben korrigierender emotionaler Erfahrungen, Trauerarbeit, neuronale Bahnung neuer prozedural-dynamischer Regulierungsprozesse etc. Je nach Hintergrundmodell haben die postulierten Wirkprozesse eine unterschiedlich starke Verbindung zur Ätiologie und/oder Entwicklungspsychologie.
Dieser Bereich der Wirkprozesse wird in der klinischen Literatur im Grunde genommen meist ausgespart oder bleibt recht vage. Die eigentlichen Wirkprozesse basieren letztlich auf Konzepten der psychologischen Grundlagenfächer, wie der Allgemeinen Psychologie, Lern- und Gedächtnispsychologie, Neuropsychologie und Neurobiologie etc. Bestehende Unklarheiten oder fehlende Konzepte in diesen Disziplinen schlagen sich direkt in der Vagheit der klinischen Formulierungen nieder bzw. führen zu schulenspezifischen eigenen Theoriebildungen, die aber häufig die Verbindung zur Grundlagenforschung verlieren.
Veränderungsstrategie:
Eine Veränderungsstrategie sollte auf einem theoretischen Modell über die äußeren und inneren Bedingungen der Initiierung von Wirkprozessen basieren. Die Veränderungsstrategie ist gewissermaßen die Formulierung eines Grobformats einer jeden Behandlung. Sie sollte mindestens die folgenden Punkte beinhalten:
a. Veränderungsbedingungen: Als Teil der Veränderungsstrategie wären allgemeine Bedingungen zu nennen, die als Voraussetzung für die Aktivierung der oben genannten Wirkprozesse gelten bzw. diese fördern; z. B. allgemeine Rahmenbedingungen der Behandlung, Behandlungsmotivation, die therapeutische Allianz etc. Sollten diese Bedingungen nicht gegeben sein oder Schwierigkeiten erwartet werden, müssen wiederum spezifische Strategien herangezogen werden, die die Schaffung der allgemeinen Veränderungsbedingungen ermöglichen können.
b. Theorie der therapeutischen Beziehung: Jedes Therapiemodell sollte auch eine Theorie über die Bedeutung und Funktion der therapeutischen Beziehung, auch jenseits der therapeutischen Allianz beinhalten, z. B. als zentrales Lern-»Medium«, als Übertragungsfeld etc. Diese Theorie der therapeutischen Beziehung wiederum sollte klären, was eine »gute« therapeutische Beziehung ist (und was eine »schlechte«) und in welcher Weise die Realisierung einer solchen »guten« Therapiebeziehung die Wirkprozesse aktiviert.
c. Konkrete Strategien: Hier wären die üblichen schulenspezifischen Strategien zu nennen, wie z. B. Herstellung und Förderung einer regressiven Übertragungsbeziehung, Durcharbeiten unbewusster Konflikte, Förderung struktureller Funktionen, kognitive Umstrukturierung etc., aber auch schulenübergreifende Strategien, wie z. B. die allgemeinen Prinzipien von Grawe (Klärung, Problemaktualisierung, Problembewältigung, Ressourcenaktivierung). Hier wären auch Konzepte bzgl. sequenzieller Hierarchien von Veränderungsbereichen anzusiedeln, also welche störungsrelevanten Aspekte prioritär gegenüber anderen bearbeitet werden sollten.
d. Bedeutung der Therapeutenpersönlichkeit: Veränderungstheorien beinhalten idealiter auch Konzepte über die Bedeutung der Persönlichkeit der Therapeuten, über veränderungsfördernde und -hemmende Eigenschaften, über die wichtigsten Anforderungen an die Person des Therapeuten jenseits der Kompetenz in der Anwendung von bestimmten Techniken.
e. Phasen-Konzepte: Alle Therapieverfahren sollten zumindest rudimentäre Phasenkonzepte beschreiben. Je nach Phase (die nicht gradlinig verlaufen müssen; es gibt auch zirkuläre, spiralförmige etc. Prozesse) sind meist auch unterschiedliche Interventionsformen auf Seiten des Therapeuten indiziert. Phasenkonzepte geben Patienten, aber vor allem den Therapeuten notwendige Orientierungen, auch zur Einordnung des gerade ablaufenden Geschehens. So gibt beispielsweise ein nahendes Behandlungsende in gewissen Rahmen immer auch bestimmte Themen und Fokussierungen vor. Verleugnungen des Abschieds und der damit verbundenen Emotionen sind auch bei Therapeuten nicht selten.
Methoden:
Dies wären Konkretisierungen der Strategien mit Beschreibungen der Vorgehensweise (und deren Begründung)8. Beispiele:
• Psychoedukation und »Kontrakt«: Informationen über Störung und geplante Behandlung sowie der damit verbundenen Aufgabenverteilung, Rahmenvereinbarungen etc.;
• Sokratischer Dialog, Hausaufgaben etc. zur Umsetzung der kognitiven Umstrukturierung;
• Fokusformulierung; am dynamischen Fokus orientierte Deutungsarbeit;
• Analyse der Übertragung durch Klärung, Konfrontation und Deutung;
• Gestaltung der therapeutischen Beziehung;
• etc.
Interventionen/Techniken:
Hier sind die konkreten Handlungen, die konkrete Umsetzung der Methoden auf der Handlungsebene angesiedelt.
Gemäß dem Axiom »Man kann nicht nicht kommunizieren« wäre aber jedes Verhalten des Therapeuten auch als Intervention zu verstehen: Man kann nicht nicht intervenieren. Patienten (zumindest das Unbewusste der Patienten) unterscheiden gewöhnlich
Beispiele für Interventionen/Techniken:
• Die konkrete »Deutung« in der Psychoanalyse.
• Die konkrete »Reizkonfrontation« in vivo in der Expositionstherapie.
• Die konkrete Arbeit mit der »Spaltentechnik« in der Kognitiven Therapie.
• Die konkrete Äußerung zur »Vertiefung emotionaler Erlebensinhalte« in der Gesprächstherapie.
• Die konkrete »paradoxe Intervention« in der Systemischen Therapie.
nicht zwischen therapeutischer Intervention und sonstigem Verhalten des Therapeuten, daher hat jedes Verhalten (ob nun dem jeweiligen Manual entsprechend, therapeutisch bewusst intendiert oder nicht) eine Wirkung, und sollte in diesem Sinne vom Therapeuten versucht werden zu reflektieren.
Wirkungen:
Die Wirkung der durch die vorherigen Punkte (Bedingungen, Strategien, Methoden, Interventionen) realisierten »Therapie« wäre im gelungenen Fall die Aktivierung der oben genannten Wirkprozesse, in deren Folge sich dann eine Entwicklung in Richtung der Veränderungsziele in Gang setzt.
Es lassen sich wiederum verschiedene Wirkungsebenen und Wirkungsarten unterscheiden:
Mit insession-outcome ist die direkt in einer Sitzung bzw. Behandlungseinheit erreichte Wirkung gemeint – dies kann z. B. eine emotionale Einsicht sein, eine Angstreduktion während einer Exposition, eine neue Sichtweise auf sich selbst, eine neu auftretende emotionale Reaktion etc.
Als global outcome wird die Wirkung der gesamten Therapie bezeichnet – also die Frage der »Heilung« im weiteren Sinne: Symptomveränderung, Klassifikation als Patient/Nichtpatient, Lebensqualitätsveränderungen, verändertes Gesundheitsverhalten etc. Hier spielt auch die Frage der Nachhaltigkeit der erreichten Wirkungen eine große Rolle (ein Aspekt, der in der Ergebnisforschung bisher unzureichend berücksichtig wurde).
Bei gelungenen Psychotherapien scheint es eine Art Wirkungsausbreitung zu geben:
• vertikal: immer mehr Lebensbereiche und -aspekte des Patienten verändern sich.
• horizontal: insbesondere nach Langzeitbehandlungen setzt sich der »Verbesserungsprozess« bei etlichen Patienten auch noch Jahre nach Beendigung der Behandlung fort (Teil IV: Forschung).
Die Wirkungen gehen also im gelungenen Fall üblicherweise über die zu Beginn einer Behandlung formulierten Ziele hinaus. Allerdings kann es auch bei der Anwendung von Psychotherapie zu »unerwünschten Wirkungen« kommen – auch über diese »Risiken und Nebenwirkungen« und insbesondere über die Bedingungen, unter denen diese mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten, sollte eine Psychotherapie-Theorie Aussagen machen können (Kap.40).
IV) Psychotherapieforschung: Der Nachweis der Wirksamkeit stellt mittlerweile eine zentrale Forderung an jedes Psychotherapieverfahren dar. Über die Art und Weise, wie solche Nachweise zu erbringen sind, besteht allerdings kein Konsens. Des Weiteren sollten Psychotherapieverfahren nicht nur zeigen können, dass mit diesem Verfahren relevante Veränderungen erzielt werden können, es sollte zusätzlich untersucht werden, wie diese Veränderungen zustande kommen.
Die vier Theorie-Ebenen entsprechen im Wesentlichen den Hauptteilen (Teil I bis Teil IV) dieses Lehrbuches.
3.2 Allgemeines psychologisches Krankheitsmodell
Allgemein definiert, ist Krankheit ein Zustand oder Prozess, der durch eine spezifische Verursachung (Ätiologie), einen voraussehbaren Verlauf (Prognose), beschreibbare Manifestationen (Symptome oder Syndrome) und mehr oder weniger voraussehbare Behandlungsergebnisse (Therapie) charakterisiert ist. Die Zusammenhänge dieser Aspekte werden in der Krankheitslehre oder auch Nosologie dargestellt.
Meist werden Modelle psychischer Störungen in Anlehnung an das sogenannte Medizinische Modell konzipiert (z. B. Schulte 1998). In einem solchen Modell wird von einer »direkten« Wirkung der »Krankheitsursachen« (biologische, psychische, soziale Ursachen) auf die »Krankheit« ausgegangen, die durch pathologische Veränderungen in der Person, einem »Defekt«, definiert ist. Die Krankheit manifestiert sich dann in den Symptomen und Beschwerden, dem »Kranksein«, welches wiederum »Krankheitsfolgen« (Krankenrolle, Einschränkungen des normalen Rollenverhaltens) mit sich bringt.
»Beschwerden, Abweichungen körperlicher Funktionen und Verhaltensauffälligkeiten (das Kranksein) sind auf eine primäre Störung im Sinne eines spezifizierbaren Defekts zurückzuführen (der möglicherweise noch nicht bekannt ist). Dieser Defekt ist in der Person gelegen und bildet die eigentliche Krankheit … Nach dem klassischen biomedizinischen Krankheitsmodell ist dieser Defekt (nicht unbedingt die Ursache) körperlicher Art« (Schulte 1998, S. 20).
Für organische Erkrankungen macht das im Wesentlichen Sinn. Für eine Übertragung auf psychische Störungen muss ein solches Modell allerdings in mehreren Punkten ausgeweitet werden.
Erstens existiert, zumindest innerhalb der gebräuchlichsten Nomenklaturen psychischer Störungen (DSM-IV und ICD–10, Kap.15) eine grundlegend abweichende Definition von Krankheit/Störung: Die einzelnen Störungen sind hier definiert durch das Vorhandensein von bestimmten Symptomen bzw. deren gemeinsames Auftreten (im Detail Teil II: Psychische Störungen) und nicht durch einen dahinter liegenden »Defekt«. Eine bestimmte Konstellation von Symptomen ist hier die Störung/Krankheit. Ein Rekurs auf diesen Symptomen zugrunde liegende Prozesse oder Veränderungen findet in DSM und ICD nicht statt und wird explizit abgelehnt. Insofern ist im DSM und ICD »Störung« identisch mit »Kranksein« im medizinischen Modell, Konzepte analog zu »Krankheit« existieren nur paradigmenspezifisch, nicht allgemein.
»Die Verwendung des Begriffs der psychischen Krankheit stellt gegenüber seinen historischen Vorläufern im religiösen und moralischen Bereich, wie ›Verhexung‹, ›Besessenheit‹, ›Strafe Gottes‹ oder ›Verworfensein‹, einen großen zivilisatorischen Fortschritt dar. Auch wenn man ›Krankheit‹ als soziale Konstruktion ansieht, so erscheint sie uns doch als eine bewahrenswerte Form der Erfindung. … Die Bezeichnung Krankheit bewahrt die Betroffenen vor exorzistischen Praktiken und Quälriten, vor sozialer Abwertung und Ausgrenzung, vor Überforderung am Arbeitsplatz und in der Familie. Sie bietet im System moderner Gesundheitswesen zugleich eine Anspruchsgrundlage für die Finanzierung qualifizierter professioneller Hilfe« (Schweitzer & Schlippe 2007, S. 18).
Zweitens werden die »pathologischen Veränderungen« alleine, d. h. ohne gleichzeitiges Vorhandensein spezifischer Symptome, wiederum üblicherweise nicht als »Krankheit« bezeichnet, da ein Mensch auch mit solchen psychischen Veränderungen ohne manifeste Symptomatik durchs Leben kommen kann – allenfalls stellen diese Veränderungen »Krankheitsdispositionen« dar: das Vorliegen bestimmter psychischer Veränderungen erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung psychischer Störungen, macht also vulnerabel.
Ob es bei Vorliegen bestimmter Dispositionen zur Symptommanifestation kommt, hängt wiederum auch ganz entscheidend von den jeweiligen aktuellen Lebensbedingungen ab, die zu Kompensationen oder eben Dekompensationen beitragen können9. Dieser Sachverhalt findet klinisch u. a. seinen Niederschlag darin, dass der sogenannten »Auslösesituation« oder den »kritischen Lebenslagen« eine große Bedeutung beigemessen wird.
Im Grunde fehlt der Klinischen Psychologie ein für Krankheit im medizinischen Modell analoger allgemein akzeptierter Begriff, da Störung nicht die eigentlichen pathologischen Veränderungen bezeichnet, sondern die klinischen Manifestationen, und über die der Störung zugrundeliegenden pathologischen Veränderungen kein Konsens besteht.
Ergänzend zum medizinischen Modell sollte ein psychologisches Krankheits- bzw. Störungsmodell außerdem die Psychogenese, d. h. die psychische Verarbeitung der »Ursachen«, mit einbeziehen.
Halten wir uns also an die gegenwärtige Nomenklatur mit der Präferenz für den Begriff der psychischen Störung, so könnte ein grobes Allgemeines Psychologisches Störungsmodell ungefähr folgende Komponenten haben (Abb.3.1):
Für das »Kranksein« bzw. die Störung gibt es einigermaßen konsensuelle Kategorien (kategoriale Diagnostik gemäß DSM-IV oder ICD–10; aber auch das wird nicht von allen Therapeuten/Schulen in gleichem Maße erfasst, geschweige denn gleich gewichtet). Auch bei der Beschreibung der Störungsfolgen käme man wahrscheinlich noch einigermaßen überein.
Bei den zugrunde liegenden Dingen wie Störungsdisposition, Psychogenese und Ätiologie gehen die Konzepte innerhalb der verschiedenen Therapierichtungen dann allerdings recht weit auseinander.
»Krankheit« bzw. Störungsdisposition wären in der Kognitiven Verhaltenstherapie beispielsweise die »pathogenen Überzeugungen« oder »irrationalen Gedanken«, in der Psychoanalyse wäre das beispielsweise ein »unbewusster pathogener Konflikt« oder ein »niedriges Strukturniveau«, in der Gesprächspsychotherapie z. B. eine ausgeprägte »Selbstinkongruenz«. Entsprechend wird dann schon bei der Diagnostik auf ganz unterschiedliche Dinge fokussiert, mit recht unterschiedlichen Methoden.
Der wichtige Aspekt der Psychogenese, also der psychischen Verarbeitung von Erfahrungen und deren Bedingungen, findet oft nur sehr wenig Beachtung. Ohne diese Dimension kommt es aber zu reduktionistischen und letztlich falschen »Kurzschluss«-Modellen nach dem Motto: »Weil er als Kind vernachlässigt wurde, hat er jetzt eine Depression«; oder »Weil sie sexuell missbraucht wurde, hat sie jetzt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung«. Hier wird eine direkte lineare Kausalität angenommen, die falsch ist (Kap.10). Gleiches gilt für die
Abb. 3.1: Allgemeines psychologisches Störungsmodell.
biologischen Dispositionen, wie beispielsweise Temperamentsfaktoren; hier geht die reduktionistische Argumentation ungefähr so: Er kam mit einem »schwierigen« Temperament auf die Welt, daher ist er heute delinquent; oder: Sie wurde mit einem »ängstlichen« Temperament geboren, daher hat sie heute ihre Sozialphobie. Der Weg von einem ätiologischen Faktor zur Manifestation einer bestimmten psychischen Störung ist wesentlich komplexer und vor allem sehr variantenreich. Zwar finden sich bei bestimmten Störungen gehäuft bestimmte Erfahrungen (z. B. ist ein hoher Prozentsatz von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sexuell missbraucht worden), diese Realerfahrungen unterliegen aber einer (individuellen und hoch-komplexen) psychischen Verarbeitung, und diese Verarbeitung im Verbund mit Folgeerfahrungen und deren Verarbeitung »entscheidet« letztlich darüber, ob eine psychische Störung resultiert und wenn ja, welche.
Die Pfeile in Abbildung 3.1 deuten an, dass es zwischen den Bereichen vielfältige Rückkopplungsprozesse gibt. Üblicherweise tragen diese Rückkopplungen zur Aufrechterhaltung der Störung bei. Zudem (nicht in der Abbildung enthalten) verlaufen viele dieser Rückkopplungen über die soziale Umwelt, beispielsweise dergestalt, dass die psychische Störung die sozialen Beziehungen beeinflusst und die Reaktionen der Sozialpartner wiederum (meist aufrechterhaltende) Wirkung auf die Störungskomponenten haben.
Die einzelnen Felder des allgemeinen Störungsmodells wurden im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich gefüllt. Auch heute noch finden sich »schulenspezifische«, teilweise sehr unterschiedliche Beschreibungen und Erklärungsmodelle (Beispiele in Abb.3.2).
Da es bezüglich der wichtigsten Störungsdimensionen letztlich keinen übergreifenden Konsens gibt, existiert streng genommen auch kein allgemeines Störungsmodell, sondern das in Abbildung 3.1 vorgestellte Schema gibt eher einen allgemeinen Rahmen für die jeweiligen Störungsmodelle vor.
Abb. 3.2: Störungsdimensionen.
Aus den unterschiedlichen Störungsmodellen leiten sich entsprechend unterschiedliche Behandlungskonzepte ab.
Bevor nun auf die Grundlagen-Modelle näher eingegangen wird, soll ein Blick auf die Emotionstheorie geworfen werden, da die emotionale Dimension als besonders geeignet erscheint, eine integrative Perspektive zu eröffnen.
8 Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie Deutschland definiert Methoden deutlich breiter: dort beinhalten sie auch Störungs- und Behandlungstheorien.
9 Beeindruckende Beispiele für epidemisch auftretende schwere psychische Erkrankungen nach dem Zusammenbruch der DDR schildert Geyer 1994.
4 Emotionstheorien
Aufgrund der zentralen Bedeutung von Emotionen bzw. emotionalen Prozessen sowohl für die Krankheitsmodelle als auch für die Psychotherapie, soll hier eine kurze Einführung in die Emotionstheorie gegeben werden. Auf die Bedeutung der Emotionen innerhalb der unterschiedlichen klinischen Theorien und der Therapierichtungen wird in den entsprechenden Kapiteln eingegangen.
4.1 Traditionen der Emotionspsychologie
Merten (2003) ordnet die Vielzahl der Emotionstheorien vier Traditionen zu (siehe auch Otto et al. 2000), die allerdings zum Teil erhebliche Überschneidungen aufweisen, sodass eher von Schwerpunkten der Betrachtung gesprochen werden muss, als von klar abgrenzbaren Theorien:
Evolutionsbiologische Tradition: Ausgehend von Darwin werden Emotionen als phylogenetisches Erbe verstanden, als Ergebnis von Selektionsprozessen. Emotionen (wie jedes andere »Verhalten« auch) sind in dieser Sichtweise klar funktional in Hinblick auf den »ultimativen Zweck« der Fitness-Maximierung, der Gen-Reproduktion. In dieser Tradition wird meist nach der Universalität emotionalen Verhaltens gesucht, z. B. nach entsprechenden Vorläufern bei unseren nahen »Verwandten«. Emotionen werden in der Evolutionspsychologie als ordnungsstiftende Metaprogramme konzipiert, die kognitive Subroutinen aktivieren, kalibrieren und deren Leistungen in Einklang bringen, und so zu einer adaptiven Verhaltensgenerierung beitragen (Cosmides & Tooby 2000). Zur Kritik an der Dominanz primär evolutionspsychologisch-funktionalistischer Emotionstheorien siehe Ulich und Mayring (2003).
Physiologische Tradition: Hier liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung der physiologischen, in jüngster Zeit vermehrt der neurobiologischen und neurochemischen Prozesse. Ausgehend von James (1884) und Lange (1885) werden Emotionen im Wesentlichen als physiologische Prozesse verstanden. In diese Tradition fallen Bemühungen, peripher-physiologische und viszerale Muster für bestimmte Emotionen zu finden. Aber auch die sogenannte Facial-Feedback-Hypothese, der zufolge bestimmte Gesichtsausdrücke Emotionen hervorrufen (oder zumindest mitbedingen), gehört in diese Tradition. Die lange Zeit dominante Zwei-Faktoren-Theorie von Schachter und Singer (1962), der zufolge eine unspezifische physiologische Erregung durch die situationsbedingte kognitive Interpretation zu gänzlich unterschiedlichen »Gefühlen« führt, gilt heute als überholt (Scherer & Wallpott 1990). Die sich in den letzten Jahren stark entwickelnde neurobiologische Erforschung der Emotionen (Damasio 1996; LeDoux 1998; Roth 2001), der zufolge Emotionen als »Hirnzustände« (LeDoux 1998, S. 325) betrachtet werden, gehört schwerpunktmäßig ebenfalls dieser Tradition an (ausführlicher Kap.5).
Appraisal Tradition: In dieser Linie stehen die mit Emotionen verbundenen kognitiven Bewertungsprozesse im Vordergrund des Forschungsinteresses. Dieser Ansatz ist insbesondere bei der Frage der Auslösung von bestimmten Emotionen dominierend: die individuellen, subjektiven Bewertungsprozesse sind hier die entscheidenden Komponenten dafür, ob und wenn ja welche Emotion in einer Person entsteht (z. B. Scherer 1990; Frijda 1986; Lazarus 1991a; Kap. 4.3.1). Eine immer wieder geführte Debatte bezieht sich auf die Frage, ob primär die Kognitionen Emotionen auslösen oder umgekehrt (vgl. z. B. LeDoux 1998). Deneke (2001) bezeichnet diese Debatte als »überflüssig wie ein Kropf …, wenn man auf neurophysiologischer Ebene die Komplexität und den Wechselwirkungscharakter der Teilprozesse betrachtet, die uns fühlen lassen« (Deneke 2001, S. 109).
Sozialkonstruktivistische Tradition: Hier stehen kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse auf das emotionale Erleben im Fokus der Betrachtung. In diesen Theorien werden Emotionen als kulturell geprägte Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster verstanden, die wichtige Funktionen im Zusammenleben der sozialen Gemeinschaft erfüllen und deshalb durch ein System von (auch unbewussten, impliziten) Normen und Regeln kontrolliert werden (Harré 1986; Averill 1975).
Eine ausführliche Darstellung dieser Emotionsforschungstraditionen findet sich in Merten (2003; siehe auch LeDoux 2003; Ulich & Mayring 2003). Die aus meiner Sicht beste Zusammenfassung der Emotionstheorien findet sich kurioserweise in einem Buch über Träume (Döll-Hentschker 2008).
Die klinischen Emotionskonzepte greifen in unterschiedlichem Ausmaß auf diese Traditionen zurück. Eine Integration steht meines Erachtens noch aus.
4.2 Definitionen von Emotion
»Ich benutze das Wort Emotion, obwohl es in der deutschen Sprache nicht das geläufigste für das Objekt unseres Interesses ist. Freud benutzte das Wort Affekt ebenso wie sein Zeitgenosse Wundt aus der akademischen Psychologie. ›Gefühl‹ hat einen Überhang in Bezug auf die bewusste innere Erfahrung und Affekt den Beiklang des heftigen, unkontrollierbaren. Gemütsbewegung ist ein zu langes Wort. Emotion ist das beste« (Frijda 1996, S. 206).
Der Begriff Emotion wird als Oberbegriff verwendet, der alle (auch unbewusste) Aspekte, Komponenten und Varianten emotionaler Prozesse umschließt. Gefühl bezeichnet eine bewusst erlebte Emotion. Unter Stimmungen werden üblicherweise Zustände von längerer Dauer, niedrigerer Intensität und geringerer Objektbezogenheit verstanden (Otto et al. 2000, S. 13). Die Begriffe Emotion und Affekt werden üblicherweise synonym verwendet, tendenziell wird Affekt eher dann gebraucht, wenn es (auch) um unbewusste Prozesse geht, Emotion eher im allgemeinen Sinne als Oberbegriff.
»Jeder weiß, was eine Emotion ist, bis er gebeten wird, eine Definition zu geben« (Fehr & Russell 1984; zitiert aus Otto et al. 2000, S. 11) – dies schlägt sich in der Emotionspsychologie darin nieder, dass eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Definitionen von Emotion formuliert wurden (siehe Kleinginna & Kleinginna 1981). Allerdings zeichnet sich eine zunehmende Einigkeit darüber ab, Emotionen als Prozesse zu verstehen, an denen verschiedene Reaktionskomponenten bzw. Subsysteme beteiligt sind (Scherer 1984, 1990, 2000; Krause 2012). Je nach Fokussierung auf einzelne Teilkomponenten oder Subsysteme, gelangt man zu unterschiedlichen Definitionen.
Definition Emotion:
(1) »Eine Emotion wird üblicherweise dadurch verursacht, dass eine Person – bewusst oder unbewußt – ein Ereignis als bedeutsam für ein wichtiges Anliegen (ein Ziel) bewertet …
(2) Der Kern einer Emotion sind Handlungsbereitschaften (readiness to act) und das nahe legen (prompting) von Handlungsplänen; eine Emotion gibt einer oder wenigen Handlungen Vorrang, denen sie Dringlichkeit verleiht. So kann sie andere mentale Prozesse oder Handlungen unterbinden oder mit ihnen konkurrieren …
(3) Eine Emotion wird gewöhnlicherweise als ein bestimmter mentaler Zustand erlebt, der manchmal von körperlichen Veränderungen, Ausdruckserscheinungen und Handlungen begleitet oder gefolgt wird« (Oatley & Jenkins 1996; Übersetzung Otto et al. 2000, S. 16).
Abb. 4.1: Komponenten des Affektsystems (nach Krause 2012; modifiziert).
Krause et al. (1992) untergliedern »Emotionen« bzw. das »Emotionssystem« in mehrere Komponenten, wodurch auch eine Unterscheidung von Affekt, Gefühl und Selbst- bzw. Fremdempathie möglich wird. Das Vorhandensein der ersten drei Komponenten (1–3) in Abbildung 4.1 bedarf keiner selbstreflexiven Anteile und wird als Affekt bezeichnet. Bei Hinzutreten der Wahrnehmungs- bzw. Erlebenskomponente wird von Gefühl gesprochen, wobei dies noch keine sprachlich-semantische Fassung beinhalten muss. Erst wenn auch letzteres gegeben ist (5), mit »einem ›realen‹ Wissen über den Verursacher und den Erleber des Affekts« (Krause et al. 1992, S. 242), wird von Selbst