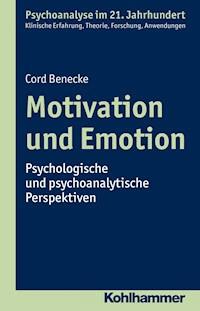
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Band werden die allgemeinpsychologischen sowie die psychoanalytischen Motivations- und Emotionstheorien behandelt. In Teil 1 werden die allgemeinen Motivationstheorien den psychoanalytischen gegenübergestellt. Dabei wird besonders auf die starken Wandlungen der Motivationskonzepte in der psychoanalytischen Theoriebildung eingegangen. In Teil 2 werden die Ansätze der psychologischen Emotionsforschung dargestellt, um dann die psychoanalytische Sichtweise der Emotionen und Affekte zu beschreiben. Hierbei geht es vor allem um die Frage nach der Existenz unbewusster Emotionen. Ergebnisse der klinischen Emotionsforschung zeigen interpersonelle Beziehungen als das Manifestationsfeld von Motiven und Emotionen. Abschließend werden die erarbeiteten Bausteine in ein Modell der Emotionsdynamik integriert sowie eine mentalisierungstheoretisch basierte Neukonzeption des Triebbegriffs vorgeschlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Psychoanalyse im 21. Jahrhundert
Klinische Erfahrung, Theorie, Forschung, Anwendungen
Herausgegeben von Cord Benecke, Lilli Gast, Marianne
Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Berater der Herausgeber
Ulrich Moser
Henri Parens
Christa Rohde-Dachser
Anne-Marie Sandler
Daniel Widlöcher
Cord Benecke
Felix Brauner
Motivation und Emotion
Psychologische und psychoanalytische Perspektiven
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-022278-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-029893-4
epub: ISBN 978-3-17-029894-1
mobi: ISBN 978-3-17-029895-8
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Geleitwort zur Reihe
Die Psychoanalyse hat auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Bedeutung und Faszination verloren. Sie hat sich im Laufe ihres nun mehr als einhundertjährigen Bestehens zu einer vielfältigen und durchaus auch heterogenen Wissenschaft entwickelt, mit einem reichhaltigen theoretischen Fundus sowie einer breiten Ausrichtung ihrer Anwendungen.
In dieser Buchreihe werden die grundlegenden Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse allgemeinverständlich dargestellt. Worin besteht die genuin psychoanalytische Sichtweise auf Forschungsgegenstände wie z. B. unbewusste Prozesse, Wahrnehmen, Denken, Affekt, Trieb/Motiv/Instinkt, Kindheit, Entwicklung, Persönlichkeit, Konflikt, Trauma, Behandlung, Interaktion, Gruppe, Kultur, Gesellschaft u. a. m.? Anders als bei psychologischen Theorien und deren Überprüfung mittels empirischer Methoden ist der Ausgangspunkt der psychoanalytischen Theoriebildung und Konzeptforschung in der Regel zunächst die analytische Situation, in der dichte Erkenntnisse gewonnen werden. In weiteren Schritten können diese methodisch trianguliert werden: durch Konzeptforschung, Grundlagenforschung, experimentelle Überprüfung, Heranziehung von Befunden aus den Nachbarwissenschaften sowie Psychotherapieforschung.
Seit ihren Anfängen hat sich die Psychoanalyse nicht nur als eine psychologische Betrachtungsweise verstanden, sondern auch kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche sowie geisteswissenschaftliche Perspektiven hinzugezogen. Bereits Freud machte ja nicht nur Anleihen bei den Metaphern der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts, sondern entwickelte die Psychoanalyse im engen Austausch mit geistes- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen. In den letzten Jahren sind vor allem neurowissenschaftliche und kognitionspsychologische Konzepte und Befunde hinzugekommen. Dennoch war und ist die klinische Situation mit ihren spezifischen Methoden der Ursprung psychoanalytischer Erkenntnisse. Der Blick auf die Nachbarwissenschaften kann je nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand bereichernd sein, ohne dabei allerdings das psychoanalytische Anliegen, mit spezifischer Methodik Aufschlüsse über unbewusste Prozesse zu gewinnen, aus den Augen zu verlieren.
Auch wenn psychoanalytische Erkenntnisse zunächst einmal in der genuin psychoanalytischen Diskursebene verbleiben, bilden implizite Konstrukte aus einschlägigen Nachbarwissenschaften einen stillschweigenden Hintergrund wie z. B. die derzeitige Unterscheidung von zwei grundlegenden Gedächtnissystemen. Eine Betrachtung über die unterschiedlichen Perspektiven kann den spezifisch psychoanalytischen Zugang jedoch noch einmal verdeutlichen.
Der interdisziplinäre Austausch wird auf verschiedene Weise erfolgen: Zum einen bei der Fragestellung, inwieweit z. B. Klinische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Entwicklungs-psychopathologie, Neurobiologie, Medizinische Anthropologie zur teilweisen Klärung von psychoanalytischen Kontroversen beitragen können, zum anderen inwieweit die psychoanalytische Perspektive bei der Beschäftigung mit den obigen Fächern, aber auch z. B. bei politischen, sozial-, kultur-, sprach-, literatur- und kunstwissenschaftlichen Themen eine wesentliche Bereicherung bringen kann.
In der Psychoanalyse fehlen derzeit gut verständliche Einführungen in die verschiedenen Themenbereiche, die den gegenwärtigen Kenntnisstand nicht nur klassisch freudianisch oder auf eine bestimmte Richtung bezogen, sondern nach Möglichkeit auch richtungsübergreifend und Gemeinsamkeiten aufzeigend darstellen. Deshalb wird in dieser Reihe auch auf einen allgemein verständlichen Stil besonderer Wert gelegt.
Wir haben die Hoffnung, dass die einzelnen Bände für den psychotherapeutischen Praktiker in gleichem Maße gewinnbringend sein können wie auch für sozial- und kulturwissenschaftlich interessierte Leser, die sich einen Überblick über Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse verschaffen wollen.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
Cord Benecke, Lilli Gast,
Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Inhalt
Geleitwort zur Reihe
Vorwort
1 Motivation
1.1 Psychologische Motivationstheorien
1.1.1 Allgemeine Motivationstheorien
1.1.2 Das »Zürcher Modell sozialer Motivation«
1.2 Exkurs: Motivationstheorie der Affektiven Neurowissenschaft
1.3 Psychoanalytische Motivationstheorien
1.3.1 Triebe, Sexualität und Libido bei Freud
1.3.2 Neue psychoanalytische Motivationstheorien
1.3.3 Motive und pathogene Konflikte
1.4 Empirische Ergebnisse zu Motiven im klinischen Kontext
1.4.1 Operationalisierung durch Annäherungs- und Vermeidungsziele
1.4.2 Operationalisierung durch unbewusste Konflikte
1.4.3 Ausblick: Psychodynamisches Denken in der empirischen Forschung
1.5 Zwischenfazit zur Motivation
2 Emotionen
2.1 Psychologische Emotionstheorien
2.1.1 Evolutionsbiologische Tradition
2.1.2 Physiologische Tradition
2.1.3 Appraisal Tradition
2.1.4 Sozialkonstruktivistische Tradition
2.2 Psychoanalytische Emotionstheorien
2.2.1 Freud und die Affekte
2.2.2 Emotionen in der modernen Psychoanalyse
2.2.3 Unbewusste Emotionen?
2.2.4 Identität im Zeitalter der Interdisziplinarität
2.3 Emotionsregulation
2.3.1 Ebenen der Emotionsregulation
2.3.2 Affektregulierung – psychoanalytisch betrachtet
2.3.3 Mentalisierte Affektivität und ihre Entwicklung
2.3.4 Affekte und psychische Struktur
2.4 Emotionen und Emotionsregulation bei psychischen Störungen
2.4.1 Emotionales Erleben
2.4.2 Nonverbale, emotionale Kommunikation
2.4.3 Nonverbale, interaktive Emotionsregulation
2.4.4 Adapative/maladaptive Emotionsregulation und psychische Störungen
2.4.5 Emotionen im therapeutischen Prozess
2.5 Zwischenfazit zu Emotionen
3 Psychodynamisches Integrationsmodell der Motivation und Emotion
3.1 Phylogenetisches Unbewusstes
3.2 Das Vergangenheitsunbewusste
3.2.1 Prozedural-dynamische Regulierungsprozesse
3.2.2 Selbst-Objekt-Affekt-Repräsentanzen und Triebe
3.3 Das Gegenwartsunbewusste
3.3.1 Selbst-Objekt-Vorstellungen, Motivkonflikte und sekundäre Bebilderung
3.3.2 Zweite Zensur
3.4 Ebene des Bewusstseins
3.4.1 Mentaler Puffer
3.4.2 Handlungen vs. Verhalten
3.5 Intersubjektive Teufelskreise
4 Ein Triebverständnis für die moderne Psychoanalyse?
4.1 Triebtheorien von Laplanche und Kernberg
4.2 »Trieb« aus Sicht der Mentalisierungstheorie
4.3 Beispiele für »Triebe« im neuformulierten Sinne
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
In diesem Band werden aktuelle Theorien zu Motivation und Emotion vorgestellt, welche eine zentrale und vielleicht die grundlegendste Untersuchungsebene psychischer Prozesse insgesamt darstellen. Für die Wissenschaft der Psychoanalyse insgesamt lässt sich in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklung ausmachen, für das Aufstellen eigener Konzeptualisierungen den interdisziplinären Dialog zu suchen und eine empirische Fundierung eigener Theorien anzustreben. In diesem Band werden deshalb nicht nur die Theorien der aktuellen Psychoanalyse vorgestellt – einschließlich einer knappen Darstellung ihrer Wurzeln in der klassischen Psychoanalyse –, sondern es wird ausführlich auf die psychologische Forschung zu dieser Untersuchungsebene Bezug genommen. Ein Fokus des Buches besteht darin herauszuarbeiten, hinsichtlich welcher Ansichten und Herangehensweisen die Psychoanalyse klassische und möglicherweise liebgewonnene Auffassungen aufgrund empirischer Ergebnisse aufgeben sollte, ohne jedoch die ihr eigene Identität im Zeitalter der Interdisziplinarität zu verlieren. Ein weiterer roter Faden des Buches besteht darin zu untersuchen, welche Auffassungen aktuelle Ansätze der anderen klinischen »Schulen« zu den beiden Themenbereichen vertreten, und dabei besonders zu berücksichtigen, inwiefern sie sich inzwischen an die genuin psychodynamischen Auffassungen annähern bzw. wo sie nach wie vor von diesen zu unterscheiden sind.
Der Band gliedert sich in drei größere Kapitel und eine »Zugabe«: Im ersten Kapitel werden die allgemeinpsychologischen Motivationstheorien den psychoanalytischen gegenübergestellt. Dabei wird besonders auf die starken Wandlungen der Motivation in der psychoanalytischen Theoriebildung eingegangen. Am Beispiel der unterschiedlichen Operationalisierungen der Motivation in psychoanalytischen gegenüber psychologisch-klinischen Theorien versuchen wir aufzuzeigen, in welcher Hinsicht trotz zarter Annäherungsversuche nach wie vor starke Differenzen zwischen beiden Wissenschaftsbereichen bestehen.
Im zweiten Kapitel werden die Emotionstheorien dargestellt. Dabei werden anfangs die Traditionen und Ansätze in der psychologischen Emotionsforschung beschrieben, um dann die psychoanalytische Sichtweise der Emotionen/Affekte darzustellen, wobei sich dieser Teil insbesondere mit der Frage der Existenz unbewusster Emotionen auseinandersetzt. In allen hier dargestellten Wissenschaftsbereichen lässt sich in der jüngeren Vergangenheit ein Fokus auf die Untersuchung der Fähigkeit zur Emotionsregulation erkennen. Wir widmen diesem Themenbereich deshalb eine ausführliche Behandlung und gehen besonders auf die Ansichten, Forschungsergebnisse und Konzeptualisierungen der Mentalisierungstheorie ein, welche innerhalb der aktuellen Psychoanalyse (und darüber hinaus) ein inzwischen viel beachteter Ansatz ist.
Im dritten Kapitel wird der Versuch unternommen, die in verschiedenen (wissenschaftlichen und klinischen) Feldern erarbeiteten Bausteine in einem Modell der Emotionsdynamik zu integrieren. Wir füllen die in der Psychoanalyse vielbeachtete Konzeptualisierung des Unbewussten von Sandler und Sandler mit Konzepten, die innerhalb der aktuellen Psychoanalyse entwickelt worden sind, und ergänzen das Modell um Auffassungen und Konstrukte aus den anderen Wissenschaftsbereichen, sofern sie zu einem besseren Verständnis im psychodynamischen Sinne beitragen können. Das Ziel des Modells besteht darin, zu einem besseren Verständnis der Psycho-Logik motivational-emotionaler Prozesse beizutragen und zu einem kritischen Denken über die jeweils eigenen Fachgrenzen hinaus anzuregen.
Abschließend, gewissermaßen als Zugabe, skizzieren wir in Kapitel 4, wie das originär psychoanalytische Konzept vom Trieb heute neu gedacht werden könnte. Stand für Freud und die klassische Psychoanalyse dieses Konzept lange Zeit im Mittelpunkt der Theoriebildung, hat die Psychoanalyse es in ihrer Weiterentwicklung zunehmend aus den Augen verloren. Angesichts des sich in verschiedenen Wissenschaften abzeichnenden Paradigmas unter dem Stichwort des Embodiment, unter welchem die Abhängigkeit psychischer Zustände von physischen Prozessen untersucht wird, ist es für eine »Psychoanalyse im 21. Jahrhundert« interessant zu diskutieren, inwiefern das ihr eigene Konzept des Triebes, von Freud als Schnittstelle zwischen Psyche und Soma konzeptualisiert, heute gedacht werden könnte. Wir verstehen unsere dort angestellten Überlegungen in diesem Sinne nicht als abgeschlossene, ausgearbeitete Theorie, sondern vielmehr als einen Debattenanstoß.
1 Motivation
Was treibt den Menschen an? Eine Wissenschaft, die die menschliche Psyche zu erklären versucht, muss mit Hilfe ihrer Theorien sicherlich auch Antworten auf diese Frage liefern, um ein umfassendes Verständnis vom Menschen geben zu können. In den Wissenschaften der Psychologie und der Psychoanalyse wird diese Frage in ihren Motivationstheorien berücksichtigt. In diesem Kapitel stellen wir die Antwortversuche der aktuellen psychologischen und psychoanalytischen Theorien bezüglich dieser vermeintlich einfachen Frage vor und ordnen sie in ihren jeweiligen wissenschaftsspezifischen historischen Kontext ein.
Wir beginnen mit einer Darstellung der Herangehensweise der Psychologie an diese Frage und stellen knapp die historische Entwicklung der psychologischen Motivationstheorien dar. Dabei zeigt sich, dass die Psychologie zunächst einen Fokus auf angeborene, körperlich verankerte Systeme hatte, die sie als »Instinkte« oder »Triebe« bezeichnete. Noch im Behaviorismus, also Mitte des 20. Jahrhunderts, war innerhalb der Psychologie die Auffassung populär, dass sich der Antrieb mit Hilfe einer einzigen Kraft, einem »general drive«, erklären ließe, die dem Organismus seine Energie liefere. Mit der kognitiven Wende änderten sich jedoch die psychologischen Theorien, sodass nun die Frage nach dem Antrieb eines Menschen durch seine »zukünftigen Ziele« und »persönlichen Motive« beantwortet wurde, die durch einen bestimmten »Anreiz« in der Umwelt aktiviert würden. Diese Herangehensweise dominiert bis heute die Motivationstheorien der Psychologie (Kap. 1.1.1). Demgegenüber hat das deutsche Forscherehepaar, Doris Bischof-Köhler und Norbert Bischof, eine ausführliche Motivationstheorie ausgearbeitet, die nicht in der kognitivistischen Tradition steht. Da ihr »Zürcher Modell sozialer Motivation« innerhalb der modernen Psychoanalyse ausführlich diskutiert worden ist, behandeln wir es gesondert von den anderen Motivationstheorien der Psychologie (Kap. 1.1.2).
In einem kurzen Exkurs wird anschließend das Modell der affektiven Instinkte von Jaak Pankepp, dem Begründer der Affektiven Neurowissenschaften, vorgestellt. Ähnlich wie das »Zürcher Modell« kritisiert auch Panksepp den kognitiven »Mainstream«, der den Menschen – verkürzt gesprochen – vom Kopf her denkt. Er konzentriert sich stattdessen auf die Erforschung von evolutionär geprägten Instinktsystemen, die wir aus dem Tierreich geerbt haben.
In der Psychoanalyse war Motivationstheorie lange Zeit gleichbedeutend mit Triebtheorie. Sigmund Freud konzeptualisierte Triebe als aus dem Körper in die Psyche drängende Kräfte und machte die um dieses Verständnis herum aufgebaute Triebtheorie zum Kernelement der Psychoanalyse (Kap. 1.3.1). Nach ihm wurde die psychoanalytische Motivationstheorie jedoch zunehmend um weitere Elemente erweitert. Ausgehend von der Frage, wie »Triebe« in Abgrenzung zu »Instinkten« zu denken seien wurden weitere Motive in die psychoanalytische Konzeptualisierung integriert: In der aktuellen Psychoanalyse wird beispielsweise von einem primären angeborenen Bindungssystem ausgegangen und werden Grundmotive zur Selbstwertregulierung bzw. Identitätsbildung angenommen (Kap. 1.3.2). Für die klinische Praxis nutzbar gemacht wurden diese neueren psychoanalytischen Motivationstheorien besonders vom Arbeitskreis OPD, der mit der »Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik« ein Instrument entwickelte, mit der sich die jeweiligen Grundmotive und ihre Bewältigung durch den Patienten diagnostizieren lassen (Kap. 1.3.3).
Aus aktuellen Ansätzen der KVT sticht hinsichtlich einer motivationspsychologischen Fundierung die Konsistenztheorie hervor, die von Klaus Grawe und seinem Forschungsteam entwickelt worden ist. Auf der Grundlage ihrer Theorie wurden motivationale Aspekte, operationalisiert als per Selbstauskunft berichtete Ziele, im klinischen Kontext untersucht (Kap. 1.1). Demgegenüber wird in der Psychoanalyse Motivation als Ausdruck unbewusster Motivkonflikte verstanden, und es wurden mit Hilfe der OPD-Konfliktachse Zusammenhänge mit psychopathologischen Syndromen aufgezeigt. Wir stellen diese psychoanalytischen Forschungsergebnisse bezüglich motivationaler Prozesse dar (Kap. 1.4.2) und diskutieren Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der psychologischen Forschungsmethodik (Kap. 1.3).
1.1 Psychologische Motivationstheorien
Einführung
Ausgehend von den frühen Instinkt- und Triebtheorien der Psychologie, die Motivation durch das »Drängen« innerer Kräfte beschreiben, legen wir den Schwerpunkt auf die aktuellen Theorien, in denen Verhalten mit Hilfe von Zielzuständen und äußeren Anreizen erklärt wird. Weil es sich hier um ein Buch mit psychoanalytischem Schwerpunkt handelt, kann an dieser Stelle nicht ausführlicher auf die Geschichte der Motivationspsychologie eingegangen werden (siehe dazu besonders Rheinberg & Vollmeyer 2012). Es werden die Theorien zu verschiedenen Anreiztypen dargestellt und mit der Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation verglichen. Mit dem Zürcher Modell stellen wir einen Ansatz der aktuellen Psychologie vor, der ein starkes Gewicht auf den Einbezug ethologischer Erkenntnisse legt und damit die phylogenetische Abstammung des Menschen auf der grundlegendsten Ebene der Psyche berücksichtigt.
Lernziele
• Einen Eindruck bekommen, wie sich die psychologischen Motivationstheorien seit ihren Anfängen bis heute weiterentwickelt haben
• Das Erbe der kognitiven Wende in den Theorien zu Zielen und Anreizen erkennen, die in der aktuellen Psychologie vorherrschen
• Demgegenüber mit dem »Zürcher Modell« eine Motivationstheorie kennenlernen, die einen grundsätzlich anderen Ansatz zur Grundlage hat
• Kritisches Hinterfragen, ob Motivationstheorien nur den Menschen erklären oder das Erbe des Menschen aus dem Tierreich berücksichtigen sollten
• Reflexion darüber ermöglichen, inwiefern psychologische Motivationstheorien für die aktuelle Psychoanalyse interessant sein können
1.1.1 Allgemeine Motivationstheorien
Die Motivationspsychologie beschäftigt sich damit, »Richtung, Ausdauer und Intensität von Verhalten zu erklären«. Insbesondere wird versucht, »angestrebte Zielzustände und das, was sie attraktiv macht«, zu erklären (Rheinberg & Vollmeyer 2012, S. 13). DeCharmes (1979) bezeichnet Motivation als »so etwas wie eine milde Form der Besessenheit« (zitiert nach Rheinberg 2006), da sich Motivation im Erleben häufig in Form von »Angezogensein«, Wollen, »Gedrängtsein«, Verlangen, Spannung etc. abbildet.
Definition Motivation
Motivation ist »die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zustand« (Rheinberg & Vollmeyer 2012, S. 16).
Motivation kann niemals direkt beobachtet, sondern immer nur erschlossen werden: Motivation ist somit ein hypothetisches Konstrukt, eine Abstraktion. Schneider und Schmalt (2000) konstatieren: »Motive, die wir als überdauernde Verhaltens- und Bewertungsdispositionen auffassen, können wir beim derzeitigen Stand der Forschung nur als hypothetische Konstrukte verstehen – gedachte Wirkgrößen also, deren Erfindung notwendig erschien, um die beobachteten Stabilitäten, aber auch die vorhandenen interindividuellen Unterschiede zu erklären« (ebd. S. 23). Dementsprechend herrscht (nicht nur innerhalb der klinischen Theorien) ein relatives Begriffswirrwar bezüglich der Termini Triebe, Motive, Bedürfnisse, Wünsche, Ziele etc. vor. Somit ist die Begriffsverwendung häufig sehr unscharf, und so unterschiedliche Phänomene wie die »des Hungers und Durstes, der Ängstlichkeit, der Neugier und der Sexualmotivation, aber auch des Leistungs-, Anschluss- und Machtstrebens« werden als »Motivsysteme« bezeichnet (ebd., S. 14).
Grundsätzlich können Motivationsmodelle grob danach unterschieden werden, ob sie motiviertes Verhalten als eher von innen angetrieben oder eher als von etwas angezogen betrachten. Instinkt- und Triebtheorien werden der ersten Kategorie zugeordnet: Es wird meist, zumal bei Trieben, davon ausgegangen, dass sich über die Zeit Spannungen aufbauen, die nach befriedigender Entladung verlangen bzw. – im Falle von Mangelzuständen wie Hunger oder Durst, die mit unlustvollen Empfindungen einhergehen – zu appetitiven Handlungen drängen, um den unlustvollen Spannungszustand zu beseitigen. All diese Theorien verbindet die Herangehensweise, in der Motivation die grundlegende Ebene der Psyche zu sehen und sie aus körperlichen Prozessen herzuleiten.
Bischof (2009) nennt für diese Kategorie psychologischer Motivationstheorien Beispiele aus dem Behaviorismus (Hull) und der Psychoanalyse (Freud): In beiden Theorien wurde in ihren klassischen Ausgestaltungen die menschliche Motivation auf eine psychische Energie zurückgeführt. Hull nannte diese eine, sämtlicher Motivation zugrunde liegende Triebkraft general drive (D), welche sich in seinem Verständnis aus körperlichen Bedürfnissen speist. Dieser Trieb D beeinflusst gemeinsam mit erlernten Reaktionen auf bestimmte Reize, die Hull als »Gewohnheitsstärke« bezeichnet, das menschliche Verhalten. Der Trieb energetisiert das Verhalten, und die Gewohnheitsstärke gibt ihm die Richtung. Die behaviorale Triebtheorie von C. L. Hull wird beispielsweise in Rudolph (2003) sowie in Heckhausen & Heckhausen (2010a) näher erklärt.
Auch die Psychoanalyse geht in ihrer klassischen Triebtheorie von einer psychischen Energie aus, die allen motivationalen Prozessen zugrunde liegt. Freud unterschied in seinen verschiedenen Versionen der Triebtheorie jedoch immer zwischen zwei unterschiedlichen Triebkräften; in seiner letzten und bekanntesten Triebtheorie unterschied er Eros und Todestrieb voneinander. Wir werden in Kapitel 1.2.1 ausführlich auf Freuds Triebtheorien eingehen.
Eine weitere Gruppe von Theorien, die motivationale Prozesse auf eine psychische Energie zurückführt, sieht Bischof (2009) in einer neurophysiologischen Entdeckung begründet: Mit der Entdeckung der formatio reticularis durch Moruzzi und Magoun (1949), einer Region im Hirnstamm, sind neurophysiologische Prozesse des aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems (ARAS) als »allgemeine Kraftquelle für das zentrale Nervensystem« (Bischof 2009, S. 226) in den Fokus gerückt. Solche Theorien gehen von einer unspezifischen Erregung oder Aktivation aus, die erst nachträglich aufgrund einer Bewertung in spezifische Motivationshandlungen überführt werde. Die berühmteste Theorie dieser Kategorie wurde von Schachter und Singer entwickelt (Kap. 2.1). Auch aktuelle Motivationstheorien der Affektiven Neurowissenschaften heben die Bedeutung der Regionen des ARAS hervor. Da im Hirnstamm besonders Informationen aus inneren Körperprozessen verarbeitet werden, gilt auch für diese Theorien, dass das Psychische aus dem Körperlichen hergeleitet wird (vgl. Panksepp & Biven, 2012; Solms & Panksepp, 2012). In der aktuellen Motivationspsychologie spielen diese Trieb- und Instinkttheorien eine eher untergeordnete Rolle. Sie beschäftigt sich stattdessen fast ausschließlich mit Modellen der zweiten Kategorie: Es wird nach dem zukünftigen Zielzustand, den eine Person herbeiführen möchte, gefragt. Motive werden hier im Sinne der Ziele als überdauernde Vorlieben einer Person verstanden. Die Motivationspsychologie fragt dazu einerseits nach Ober-Kategorien unterschiedlicher Zielzustände (Motivlisten). Diesbezüglich sind »schon die verschiedensten Aufstellungen und Klassifikationen von Motiven vorgestellt worden. Solche Listen muten häufig willkürlich an« (Schneider & Schmalt 2000, S. 23). Andererseits wird danach gefragt, was diese Zielzustände überhaupt so anziehend macht, welchen Anreiz die Zielzustände für eine Person haben.
Hierfür geht die aktuelle Motivationspsychologie in wesentlichen Aspekten auf Kurt Lewin (1931; 1951) zurück. Ein Aspekt in Lewins Feldtheorie stellt bis heute die wesentliche Grundannahme der Motivationspsychologie dar: seine universelle Verhaltensgleichung. Lewin ging davon aus, dass weder Faktoren der Person (Triebe, Bedürfnisse) noch der Umwelt (situative Reize, Zwänge) jeweils allein das Verhalten hinreichend erklären können. Verhalten ist demnach immer eine Funktion aus Person- und Umweltfaktoren – eine Position, die seitdem grundlegend für die Motivationspsychologie ist (vgl. Rheinberg & Vollmeyer 2012).
Ausgehend von Lewins universeller Verhaltensgleichung füllte die Motivationspsychologie die Personenvariable mit konkreten Motiven. Wenn es um die Inhalte der Motive geht, so bezieht sich die gesamte Motivationspsychologie mehr oder weniger stark auf Murray (1938). Murray postulierte neben den primären physiologischen Bedürfnissen wie Hunger und Durst weitere sekundäre Bedürfnisse (needs), die erst im Verlauf der Ontogenese erworben werden. Obwohl individuell erworben und trotz der Vielfalt der sekundären Bedürfnisse ging Murray davon aus, dass es bestimmte übergeordnete Klassen von sekundären Bedürfnissen gibt, die universell bei einer großen Anzahl von Menschen vorliegen. Murray beschrieb 20 solcher sekundären Bedürfnisse. Von diesen erlangten insbesondere das Anschlussbedürfnis (need affiliation), das Leistungsbedürfnis (need achievement) sowie das Unabhängigkeitsbedürfnis (need autonomy) in der weiteren Erforschung der Motivation Bedeutung.
Ist ein solches Bedürfnis bei einer Person vorherrschend, so äußert sich dies darin, dass das aktuelle Denken, Wünschen, Wahrnehmen und Handeln der Person von diesem Bedürfnis beeinflusst wird, was zu einer Art themenspezifischem Person-Umweltbezug führt. Zur Messung dieser aktuell vorherrschenden Präferenz entwickelte Murray den Thematischen Apperzeptionstest (TAT), der eines der bekanntesten projektiven Testverfahren der Psychologie insgesamt darstellt und das in der Person aktuell vorherrschende Motiv erfasst. Dabei wird den Probanden eine Reihe von Bildern mit unbestimmten Szenen vorgelegt, zu denen eine Geschichte erzählt werden soll (Abb. 1.1). Trotz häufiger Kritik am TAT sind die Testgütekriterien bei entsprechender Instruktion und Auswertung durchaus zufriedenstellend (Schultheiss & Pang 2007; Gruber & Kreuzpointer 2013; Lang 2014).
Abb. 1.1: TAT-Bildbeispiel
Seit McClelland und sein Team das Konzept von Murray in den 1950er Jahren aufgriffen, sich aber auf drei »Grundmotive« konzentrierten, beschäftigt sich die Motivationspsychologie hauptsächlich mit diesen drei Motiven: Dem Anschlussmotiv, dem Leistungsmotiv und dem Machtmotiv (McClelland 1985; Heckhausen & Heckhausen 2010b).
Werden – bezogen auf Lewins Gleichung – in der Person also die Motive lokalisiert, so ist die »Umwelt-Seite« der Motivation durch so genannte Anreize gekennzeichnet.
Definition Anreize
»Alles was Situationen an Positivem oder Negativem einem Individuum verheißen oder andeuten, wird als ›Anreiz‹ bezeichnet, der einen ›Aufforderungscharakter‹ zu einem entsprechenden Handeln hat. Dabei können Anreize an die Handlungstätigkeit selbst, das Handlungsergebnis und verschiedene Arten von Handlungsfolgen geknüpft sein« (Heckhausen & Heckhausen 2010b, S. 5).
In der obigen Definition sind drei Anreiztypen genannt: die Handlungstätigkeit selbst, das Handlungsergebnis und die Handlungsfolgen können jeweils ganz eigenständige (und mitunter konfligierende) Anreize besitzen. Heckhausen und Heckhausen (2010b) zählen die ersten beiden zu den intrinsischen, die Folgen zu den extrinsischen Anreizen. Die Unterscheidung zwischen den drei Anreiztypen wird an den folgenden Beispielen deutlich:
• Tätigkeitszentrierter Anreiz: Ein Freizeitsportler geht regelmäßig im Wald laufen, weil er das Laufen selbst genießt. Die fließenden Bewegungen im Rhythmus mit dem Atem erzeugen in ihm ein Gefühl von Leichtigkeit und »Einssein« mit sich, seinem Körper, der Bewegung und Umgebung. Er weiß weder, wie lang die Strecke ist, die er meistens läuft, noch stoppt der Zeit, die er dafür braucht.
• Ergebniszentrierter Anreiz: Ein Anderer geht ebenfalls regelmäßig laufen, aber das Laufen selbst ist ihm kein sonderlicher Genuss. Er hat eine Stoppuhr dabei und erfreut sich daran, wenn er einen Leistungszuwachs feststellen kann, z. B. wenn er seine Strecke in kürzerer Zeit absolviert. Er setzt sich diesbezüglich immer wieder eigene Ziele, und deren Erreichen gibt ihm ein gutes Gefühl.
• Zweckzentrierter Anreiz: Ein Dritter geht auch regelmäßig Laufen. Für ihn ist weder das Laufen selbst noch das Erreichen selbstgesetzter Leistungsziele ein Quell positiver Gefühle. Seine Ärztin hat ihm dringend angeraten, Sport zu treiben, um sein Übergewicht abzubauen und seine Cholesterin-Werte positiv zu beeinflussen. Zudem hofft er, dass sich der Sport auch positiv auf seine Leistungsfähigkeit im Beruf auswirkt, er dadurch vielleicht sogar die Karriereleiter aufsteigt und mehr verdient und damit (hohe körperliche Fitness, hohe berufliche Position, hohes Gehalt) auch wieder mehr Chancen hat, eine Partnerin zu finden.
In dieser Kategorisierung liegt bereits ein weiteres Unterscheidungsmerkmal: Die Motivationspsychologie befasst sich nicht nur mit den Zielen oder Zwecken motivationalen Verhaltens, sondern die obige Definition schließt ebenfalls die Möglichkeit ein, dass die Handlung selbst den Anreiz darstellt und um ihrer selbst willen ausgeführt wird. Dies wird neuerdings als intrinsische Motivation bezeichnet. Unter intrinsischer Motivation wurde schon Vielerlei verstanden: Meist geht es darum, dass eine Person aus »eigenem Antrieb« handelt, im Gegensatz zu extrinsisch motiviertem Verhalten, das »von außen« gesteuert oder angetrieben wird (Rheinberg 2010). »Allerdings setzt sich in jüngster Zeit zunehmend die Tendenz durch, den Begriff intrinsische Motivation einheitlich für solche Motivationsformen anzuwenden, die allein um der Tätigkeit und nicht der Ergebnisse willen durchgeführt werden« (Rheinberg & Vollmeyer 2012, S. 153). Damit fällt die Unterscheidung intrinsisch vs. extrinsisch mit derjenigen zwischen tätigkeits- vs. zweckzentrierten Anreizen zusammen. Intrinsisch motiviert ist ein Verhalten also dann, wenn der Vollzug der Tätigkeit selbst als positiv erlebt wird, und die mit dem Verhalten erzielten Ergebnisse oder Folgen in den Hintergrund treten.1
Die intrinsische Motivation wurde in der Psychologie besonders in der Selbstbestimmungstheorie (SDT) erforscht, die auf Deci und Ryan (1985) zurückgeht. Sie gehen von drei grundlegenden Bedürfnissen nach Kompetenz (effectancy), Selbstbestimmung (autonomy) und sozialer Eingebundenheit (affiliation) aus. Um die intrinsische Motivation zu fördern, müssen im Sinne der SDT diese drei Grundbedürfnisse von der äußeren Umgebung befriedigt werden. Besonders im pädagogischen Rahmen wird auf dieser theoretischen Grundlage diskutiert, wie dadurch selbstgesteuertes Lernen geschaffen werden kann. Hier zeigt sich auch, dass positive, belohnende Anreize nicht immer zu einer Verstärkung der Motivation führen müssen: Die intrinsische Motivation kann durch äußere Anreize auch untergraben werden, wenn die Bedürfnisse nach Selbstbestimmung und Autonomie verletzt werden (vgl. Deci et al. 1999). Die psychologische Forschung spricht in diesem Zusammenhang von einem overjustification effect. Kommt es hingegen nicht zu einer solchen Behinderung der intrinsischen Motivation, kann im Sinne eines tätigkeitszentrierten Anreizes ein Flow-Erleben entstehen. Flow bezeichnet dabei einen Zustand des gänzlichen Aufgehens in eine laufende Tätigkeit, wobei das Bewusstsein völlig vom Tätigkeitsvollzug absorbiert ist (Rheinberg 2010). Leser, die sich für dieses Thema interessieren, seien auf die Schriften und Vorträge von Mihály Csíkszentmihályi verwiesen.
Doch auf der Umwelt-Seite der Lewin‘schen Gleichung spielen nicht nur Anreize eine Rolle, sondern auch Erwartungen. Ein Verhalten kann insgesamt von sehr unterschiedlichen Erwartungstypen beeinflusst sein:
• Situation-Ergebnis-Erwartung: Wie wahrscheinlich führt die Situation auch ohne eigene Handlungen zu einem gewünschten Ergebnis?
• Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Wie wahrscheinlich führt das eigene Handeln zu einem gewünschten Ergebnis?
• Wirksamkeitserwartung: Wie wahrscheinlich ist es, dass ich die erforderliche Handlung auch ausführen kann?2
• Ergebnis-Folgen-Erwartung: Wie wahrscheinlich führt ein Ergebnis zu den gewünschten Folgen?
So führt etwa eine hohe Situations-Ergebnis-Erwartung zu einem geringen Handlungsanreiz. Eine geringe Situations-Ergebnis-Erwartung kombiniert mit einer hohen Handlungs-Ergebnis-Erwartung, hoher Selbstwirksamkeitserwartung und hoher Ergebnis-Folgen-Erwartung hingegen hat einen hohen Handlungsanreiz. Bei dem Freizeitsportler im dritten obigen Beispiel (zweckzentrierter Anreiz) dürfte zwar der Anreizwert hoch sein, die Ergebnis-Folgen-Erwartung realistischerweise aber eher niedrig, weil die Folgen-Erwartung an das Laufen völlig überfrachtet erscheinen. In der Psychotherapieforschung konnte empirisch gezeigt werden, dass bei Menschen mit psychischen Störungen besonders die Wirksamkeitserwartung eingeschränkt ist (Grawe 1995). Psychotherapien müssen deshalb auch eine »aktive Hilfe zur Problembewältigung« (ebd., S. 138) ermöglichen, um dem Patienten die Selbstwirksamkeit im Sinne Banduras zurückzugeben.
Das Zusammenspiel von Anreizen und Erwartungen wurde in so genannten Erwartungs-x-Wert-Modellen insbesondere in Bezug auf die Leistungsmotivation ausführlich beschrieben und untersucht. Die Erwartungs-x-Wert-Theorien »haben eine wichtige Gemeinsamkeit: Der ›Wert‹ (die Valenz) eines Ziels oder einer Handlungsalternative und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ziel erreicht (oder die Handlung erfolgreich abgeschlossen) wird, determinieren gemeinsam die Wahl dieser Handlungsalternative« (Rudolph 2003, S. 118). Dabei müssen die einer Handlungsentscheidung zugrundeliegenden Erwartungen und Werte nicht notwendigerweise bewusst repräsentiert sein (Schneider & Schmalt 2000), da auch komplexe Verhaltensmuster von niederen Tieren mit Hilfe der Erwartung-x-Wert-Modelle vorhersagbar sind.
Spätestens hier wird die Unterscheidung zwischen Verhalten und Handlung wichtig. Im Unterschied zu Verhalten, das auch als reine Gewohnheit oder automatisierte Reaktion erfolgen kann, bezeichnet Handeln gemäß Max Weber dasjenige menschliche Verhalten, mit dem der Handelnde einen Sinn verbindet. »Als Handlung gelten in diesem Sinne alle Aktivitäten, denen eine ›Zielvorstellung‹ zugrunde liegt« (Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 310). Besonders in den empirischen Studien zu der unten ausgeführten Konsistenztheorie des klinischen Psychologen Klaus Grawe finden Zielkonstrukte eine hervorgehobene Bedeutung (Kap. 1.4).
Selbst bei einer die Handlungen begünstigenden Anreiz- und Erwartungskonstellation erfolgt die Handlung aber nicht von selbst. Die zusätzlich benötigten volitionalen Prozesse wurden im so genannten Rubikon-Modell (Heckhausen et al. 1987) beschrieben. Der Begriff der Volition bezieht sich dabei auf »Prozesse und Phänomene, die mit der konkreten Realisierung von Zielen im Handeln zu tun haben« (Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 314). Der entscheidende Schritt zum Überschreiten des Rubikon besteht dabei darin, einen persönlichen Wunsch in ein konkretes Ziel umzuwandeln: »Wie einst Julius Cäsar durch Überschreiten des Rubikons den Bürgerkrieg ausgelöst hatte, und sich jetzt bemühen musste, diesen zu gewinnen, so vollzieht sich mit der Umwandlung eines Wunsches in ein Ziel die Abkehr vom Abwägen des Nutzens eines Wunsches in ein Festlegen auf seine tatsächliche Realisierung« (Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 311 f.).
Das Rubikon-Modell benennt vier verschiedene Phasen der Umsetzung einer Motivation in eine Handlung und anschließende Bewertung.
1. In der prädezisionalen Phase wägt eine Person ab, welche von den vielen Wünschen, die mehr oder weniger fortlaufend von den Motiven »produziert« werden, sie überhaupt in die Tat umsetzen möchte. Hier werden die unterschiedlichen Wünsche hinsichtlich ihres Wertes bei Zielerreichung (ergebnis- oder zweckzentrierter Anreiz) und ihrer Realisierbarkeit gegeneinander abgewogen. Am Ende dieser Phase wird ein verbindliches Ziel gesetzt – es entsteht eine Zielintention (Intentionsbildung), womit der »Rubikon« vom Wunsch zum Ziel überschritten ist, was mit einem Gefühl der Verpflichtung einhergeht, dieses Ziel in die Tat umzusetzen (ausgedrückt als Volitionsstärke).
2. In der präaktionalen Phase »gilt es für einen Handelnden, sich Gedanken darüber zu machen, auf welche Weise er das am Ende der 1. Phase gesetzte Ziel auch wirklich realisieren will. … Am günstigsten erweist es sich in dieser Phase, Pläne zu entwickeln, die bestimmen, wann, wo und auf welche Art und Weise man eine zielförderliche Handlung durchführen möchte« (Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 312). Diese Phase wird der Volition zugeordnet. Einerseits wird konkret geplant (z. B. um erwartete Realisierungsschwierigkeiten zu überwinden) und/oder auf günstige Gelegenheiten zur Umsetzung der Handlung gewartet: Das Zusammenwirken der Volitionsstärke und dem Grad der Günstigkeit der Gelegenheit wird Fiattendenz genannt. Fiattendenzen unterschiedlicher Ziele einer Person können dabei gewissermaßen in Konflikt geraten, wobei das Ziel mit der höchsten Fiattendenz den Zugang zur Exekutive gewinnt: Es kommt zur Intentionsinitiierung, d. h. zur Initiierung von entsprechenden Handlungen.
3. In der aktionalen Phase, also der eigentlichen Handlungsphase, versucht ein Handelnder, die in der präaktionalen Phase gefassten Pläne zur Realisierung des am Ende der prädezisionalen Phase gefassten Ziels in die Tat umzusetzen. »Dies wird am besten durch beharrliches Verfolgen des Ziels und durch Anstrengungssteigerungen bei Auftreten von Schwierigkeiten erreicht«, wobei die Volitionsstärke gewissermaßen »einen Grenzwert für die Anstrengungsbereitschaft« darstellt und die Handlungsdurchführung »durch die mentale Repräsentation des Ziels [geleitet wird], auf welches sich ein Handelnder verpflichtet hat. Hierbei ist die Repräsentation des Ziels nicht bewusstseinspflichtig, d. h. das Ziel muss nicht im Bewusstsein gegenwärtig sein« (Achtziger & Gollwitzer 2010, S. 313).
4. Die postaktionale Phase setzt nach Abschluss der auf die Realisierung eines Ziels gerichteten Handlung ein und stellt wiederum eine motivationale Aufgabe dar: Das erreichte Handlungsergebnis wird bewertet. Fällt diese Bewertung positiv aus, so kann das Ziel deaktiviert werden (Intentionsdeaktivierung)3. Bei nicht vollständig positiver Evaluation ergeben sich meist drei Möglichkeiten: a) Das Anspruchsniveau in Bezug auf die Zielerreichung wird angepasst; b) es werden neue Handlungen in Angriff genommen, um das Ziel doch noch zu erreichen; c) das Ziel wird trotz negativer Evaluation deaktiviert, was am besten gelingt, wenn schon ein neues Ziel vor Augen ist (Achtziger & Gollwitzer 2010).
Abbildung 1.2 versucht, die in der allgemeinen Motivationspsychologie zur Erklärung von Verhalten bzw. Handlungen beschriebenen Elemente in einer Grafik zu integrieren.
Abb. 1.2: Elemente psychologischer Motivationstheorien (Synopse aus: Achtziger & Gollwitzer 2010; Heckhausen & Heckhausen 2010b; Rheinberg 2010; Rheinberg & Vollmeyer 2012)
1.1.2 Das »Zürcher Modell sozialer Motivation«
Aus den aktuellen psychologischen Theorien zur Erklärung der menschlichen Motivation möchten wir ein Modell herausheben und gesondert behandeln, welches wir für besonders überzeugend halten. Es handelt sich dabei um das »Zürcher Modell sozialer Motivation«, welches das Forscherehepaar Norbert Bischof und Doris Bischof-Köhler entworfen hat. Sie wurden für ihre Forschungen im Jahr 2003 mit dem Deutschen Psychologiepreis ausgezeichnet. Das »Zürcher Modell« besticht durch seinen integrativen Ansatz und beschreibt die funktionale Verknüpfung von Motivation, Emotionen und Handlung unseres Erachtens besonders schlüssig. Es könnte sich perspektivisch auch als übergeordnetes Rahmenmodell zur Erklärung klinisch-psychologischer Phänomene eignen (vgl. Arbeitskreis OPD 2006; Krause 2012).
Im Gegensatz zu den anderen Motivationstheorien der Psychologie gehen Bischof (2009) und Bischof-Köhler (2011) zur Herleitung ihres Modells von einer anderen Grundlage aus. Norbert Bischof war zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere Schüler des Ethologen Konrad Lorenz4 und hebt den wichtigsten Einfluss seines Lehrers hervor: »Sein eigentliches, durch den Nobelpreis zu Recht gewürdigtes Verdienst lag vielmehr darin, eine biologisch fundierte Motivationspsychologie begründet zu haben« (Bischof 2009, S. 543). Diese ethologischen Wurzeln veranlassen Bischof (2009) zu einer scharfen, mitunter bissigen Kritik an der kognitivistischen Tradition der aktuell dominanten Lehrmeinung der akademischen Psychologie (vgl. Bischof 2009, Kap. 18). Auch wenn wir einen Austausch mit der Psychologie für die Psychoanalyse in verschiedenen Fragen für äußerst fruchtbar halten, teilen wir grundsätzlich Bischofs kritische Haltung gegenüber dem Kognitivismus. Wir werden auf diesen Aspekt bei der Erklärung der »psychologischen Emotionstheorien« (Kap. 2.1) zurückkommen. Für Bischof ist – neben anderen Kritikpunkten – eine Herangehensweise vieler psychologischer Theorien zentraler Angriffspunkt: Er hält viele Theorien der Psychologie für wenig überzeugend, »weil es das Handicap des Kognitivismus ist, dass seine Vertreter allein am Menschen interessiert sind. Sie würden nie darüber nachdenken, warum Schimpansen, wenn sie denn wirklich unter dem Selektionsdruck gestanden hätten, eine Mitteilungssprache zu entwickeln, nicht auch ihre Toten begraben. Oder warum sie sich beim Geschlechtsakt nicht schämen, obwohl sie sich doch im Spiegel erkennen. Der Kognitivismus lässt nichts von der tiefen anthropologischen Bedeutung solcher Fragestellungen ahnen« (Bischof 2009, S. 521). Zur Begründung der Motivationstheorie des »Zürcher Modells« durchleuchtet Bischof – seinen Lorenz‘schen Wurzeln folgend – deshalb die Hintergründe der menschlichen Motivation im Tierreich. Wir teilen auch diese Ansicht, dass der Mensch hinsichtlich motivationaler und emotionaler Prozesse besonders stark durch die phylogenetische Entwicklung vorgeprägt ist und werden in unserem Integrationsmodell darauf zurückkommen (Kap. 3.1).
Stehen bei anderen Motivationstheorien der aktuellen Psychologie Ziele von Menschen im Zusammenhang mit Anreizen hoch im Kurs, zäumen Bischof und Bischof-Köhler stattdessen das Pferd genau anders herum auf. Grundlegend werde das Verhalten von Tieren durch Instinkte beeinflusst, welche Bischof (2009) in Anlehnung an William James als »Mechanismus [definiert], der es dem Organismus ermöglicht, ohne Einsicht und Erfahrung adaptiv zu reagieren« (S. 313). Als Reaktion auf einen auslösenden Schlüsselreiz lässt sich ein »gerichtetes Appetenzverhalten« beobachten, welches durch einen hohen Erbanteil charakterisiert ist (»Erbkoordination«). Die menschliche Motivation hat sich im Sinne des Zürcher Modells im Laufe der evolutionären Entwicklung aus diesen instinktiven Verhaltensreaktionen herausgebildet, wobei der Mensch größere Fähigkeiten aufweist, sie zu reflektieren; bzw. in den Worten des Systemtheoretikers Bischof gesprochen: Phylogenetisch betrachtet haben sich die »Freiheitsgrade der finalen Systeme« erhöht. Der phylogenetische Hintergrund des Menschen lässt Bischof (2009) von fünf basalen Motivsystemen ausgehen, durch die menschliche Motivation wesentlich geprägt werde: Bindung/Sicherheit, Exploration/Erregung, Autonomie (mit den Teilsystemen: Dominanz, Geltung und Kompetenz bzw. Eigenwert) sowie Sexualität und Fürsorge.5
Hinsichtlich dieser fünf Motivsysteme gilt: Aus dem gerade aktivierten Motiv (Soll-Wert) und der Wahrnehmung der Umwelt (Ist-Wert) ergibt sich die jeweilige Lage, die wiederum Antriebe (Appetenz oder Aversion) und Emotionen hervorbringt, aus welcher sich die Handlungsbereitschaft (Action-Readiness) ergibt. »Der Antrieb löst bestimmte Verhaltensweisen aus, wobei zielführende Handlungen und kommunikativ wirksame Ausdrucksbewegungen unterschieden werden können; die Letzteren übermitteln anderen Gruppenmitgliedern Informationen über die motivationale Verfassung des Individuums« (Bischof-Köhler 2011, S. 89).
Bindung/Sicherheit: Über die Existenz eines basalen Bindungsmotivs besteht kaum Zweifel, auch wenn die Bezeichnungen variieren. Bowlby konzipierte die Bindung (in Abgrenzung zur psychoanalytischen Triebtheorie und zur behavioristischen Lerntheorie) als eigenständiges Motivsystem, das dem Schutz des Säuglings diene, wobei dieser Schutz am sichersten in der Nähe der Mutter gewährleistet sei. Auch er gelangte zu seiner Theorie durch einen Dialog mit der Ethologie, genauer gesagt durch die Weiterentwicklung des Postulats einer »Appetenz nach Ruhezuständen« der Zoologin Monika Holzapfel. Die Aktivierung des Bindungsmotivs führt zu aktiv Bindung herstellenden Verhaltensweisen (z. B. Weinen, Lächeln, Anklammern, Nachfolgen) beim Kind. Bischof (2009) und Bischof-Köhler (2011) verstehen Bindung ebenfalls als » eigenständiges primäres Motiv«, betrachten dies aber als Bestandteil des » Sicherheitssystems, das die Regulation des Verhaltens zu Vertrauten gewährleistet« (Bischof-Köhler 2011, S. 118). Ein hoher Sollwert im Sicherheitssystem bildet sich als Abhängigkeitsbedürfnis ab und aktiviert Bindungsverhalten. »Die Funktion der Bindungsmotivation besteht präzise formuliert darin, das Kind in der Nähe von Vertrauten zu halten, denn diese sind mit hoher Wahrscheinlichkeit verwandt und deshalb brutpflegemotiviert« (Bischof-Köhler 2011, S. 101).6
Exploration/Erregung: Das Erregungssystem ist gewissermaßen das motivationale Gegenstück des Sicherheitssystems und reguliert das Verhalten gegenüber Fremdem und Neuem. »Eine Motivgröße dieser Art muss gefordert werden, wenn man die Phänomene der sozialen Neugier und der Fremdenfurcht erklären will« (Bischof 2009, S. 420). Dieses zweite Motivsystem, ein »Produkt aus Fremdheit und Nähe« (S. 421), wird mit dem achten Lebensmonat voll funktionstüchtig. Ein hoher Sollwert des Erregungssystems bildet sich als Unternehmungslust ab. Auch diesbezüglich besteht eine starke Parallele zur Bindungstheorie Bowlbys: Erst eine ausreichende Sicherheit ermöglicht es, Erregung als faszinierend zu erleben und nicht als furchteinflößend.
Autonomie: Bischof (2009) sieht diesbezüglich einen blinden Fleck der Bindungstheorie: »Die Dynamik der Ablösung des Jugendlichen aus seiner Herkunftsfamilie bleibt ausgeblendet; der adoleszente Verselbstständigungswunsch wird bagatellisiert, wenn nicht gar pathologisiert« (S. 418). Der notwendige Ablösungsprozess eines jeden Menschen ließe jedoch nur einen Schluss zu: »Wir unterstellen damit ein Motiv zur Durchsetzung einer dauerhaften, von anderen Gruppenmitgliedern nicht zu störenden Kontrolle der eigenen Lebensumstände« (ebd., S. 425). Es »spiegelt das Erlebnis wider, Einfluss auszuüben, sich bei sozialen Konflikten durchzusetzen und zu behaupten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und ganz generell bei der Bewältigung von Problemen Erfolg zu haben. Beim Erwachsenen korrespondiert das Autonomiegefühl mit dem sozialen Status« (Bischof 2009, S. 141).7 Das Autonomiesystem wird in verschiedene Teilsysteme untergliedert: das Macht- bzw. Dominanzmotiv (wird von den Autoren als evolutionär ursprünglich angesehen), das Geltungsmotiv (ersetzt Macht/Zwang durch Leistung und prosoziales Verhalten, das von anderen geschätzt und anerkannt wird) und das Kompetenz/Leistungs- bzw. Eigenwertmotiv (das als spezifische motivationale Neuerwerbung des Menschen angesehen wird, siehe unten).
Sexualität: Sexualität »stellt, evolutionsbiologisch betrachtet, eine der rätselhaftesten Lebenserscheinungen dar« (Bischof 2009, S. 410). Biologisch gesehen hat die biparentale Fortpflanzung erhebliche Kosten und ist kompliziert und störungsanfällig. Dennoch ist sie der Regelfall. Es wird davon ausgegangen, dass der Vorteil in »der Erhaltung und Gewährleistung genetischer Variabilität« (ebd., S. 413) liegt. Aus diesem Grunde sei auch von biologisch verankerten Inzestbarrieren auszugehen, da die Paarung naher Verwandter »mit fast allen Kosten der Biparentalität belastet« wäre, aber deren Vorteile einbüßen würde. Daher erlischt bei Tieren, die in einem Familienverbund leben, die Bindung an diesen Verbund mit dem Beginn der Geschlechtsreife, und es kommt zu einer Umpolung der Beziehungen während der Pubertät, meist durch Distanzierung und Repression.8 Da es beim Menschen nur sehr unzuverlässige »Verwandtschaftsindikatoren« gibt, gilt die Vertrautheit als »Verwandtschaftsindikator«; die Wahrnehmung von Vertrautheit triggert laut Bischof entsprechend das in seinem Verständnis phylogenetisch entwickelte Inzesttabu.
Fürsorge: Es wird von einer genetisch verankerten »Anlage zur Hilfsbereitschaft gegenüber nahen Verwandten« (Bischof 2009, S. 406) ausgegangen, was sich in einem übergeordneten Sinne als Fürsorgemotiv niederschlägt. Deren basale Realisierung ist die Brutpflege. Allerdings »muss diese Antriebsthematik jedoch auf allgemeine Verwandtenfürsorge ausgedehnt werden und bildet dann eine Basis für eine biologisch begründbare altruistische Motivation« (Bischof 2009, S. 453). Auch hier spielt die wahrgenommene Vertrautheit eine entscheidende Rolle.
Die Motivsysteme sind nicht unabhängig voneinander, sondern untereinander stark vernetzt: So gilt z. B. eine hinreichende Sicherheit als Voraussetzung für Explorationsverhalten; andererseits reduziert ein hoher Autonomieanspruch das Sicherheitsbedürfnis stark (was dann z. B. dazu führt, dass auf Bindungsverhalten anderer u. U. sehr aversiv reagiert wird). Die Motivsysteme sind außerdem dynamisch und haben im Verlauf der Ontogenese wechselnde Intensitäten (z. B. hohes Sicherheitsbedürfnis im Säuglings-/Kleinkindalter, minimales in der Pubertät; Anstieg der Fürsorgemotivation bis ins frühe Erwachsenenalter) sowie situativ bedingte Aktivierungen und Hemmungen. Das Modell beschreibt vielfältige, differenzierte motivdynamische »Regelkreise« unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Motivsystemen, auf die wir jedoch hier nicht näher eingehen können.
Während das oben skizzierte Motivationsmodell im Wesentlichen für alle sozial lebenden Säuger gilt, benennen Bischof (2009) und Bischof-Köhler (2011a) auch das »spezifisch Menschliche« in der Antriebsorganisation.
Dazu zählen einerseits die Entwicklung eines kognitiven Moduls zur Reflexion auf Bezugssysteme, verbunden mit der Fähigkeit, »auf mentale Zeitreise zu gehen«, sodass die eigenen Antriebe und deren Veränderung über die Zeit reflektiert werden können. Hierdurch werden neue Formen der exekutiven Kontrolle möglich, die die »Instinkte aus der Machtposition bedingungslos fordernder Befehle in den dynamisch reduzierten Status emotionaler Appelle« (Bischof 2009, S. 465) umwandeln. Auch Schimpansen sind in gewisser Weise zu einer solchen imaginierten Phantasie in der Lage, doch für sie gilt: »Das Zeitverständnis dient dem momentan aktualisierten Antrieb, aber es transzendiert ihn nicht« (S. 380), sodass »die Kognition […] nicht mehr aber nicht weniger [ist], als der Widerhall gegenwärtiger Bedürfnisse in einer vorweggenommenen Umwelt« (S. 381). Nur der Mensch hingegen kann die Imagination einer vorgestellten Zukunft aus der Abhängigkeit des aktuell aktivierten Antriebs lösen, »um künftige eigene Motivlagen repräsentieren zu können« (S. 398). In expliziter Anlehnung an Freuds Terminologie unterscheidet Bischof (2009) diese verschiedenen Prinzipien in den Begriffen der Primär- und der Sekundärzeit. Viele der in diesem Zusammenhang von Bischof (2009) und Bischof-Köhler (2011) genannten kognitiven Fähigkeiten werden auch in der Mentalisierungstheorie der modernen Psychoanalyse behandelt (Kap. 2.3).
Neben dieser übergeordneten Fähigkeit, die drängenden Instinkte und Motive auf ihren Platz zu verweisen und zur Räson zu bringen, benennt Bischof als zweites »spezifikum humanum« mit motivationalen Neuerwerben einen inhaltlichen Aspekt: Neben religiöser Sinnsuche und dem moralischen Imperativ (sowie Ästhetik, Vergeltungsdrang und Besitzstreben, gemäß Lersch 1956), ist insbesondere das Eigenwertstreben9 von besonderer Bedeutung. Das Eigenwertstreben ist Ergebnis einer Ausdifferenzierung des Autonomieanspruchs, der auf einer basalen Ebene in Form des Macht- bzw. Dominanz-Motivs auftritt (welches die Gefolgschaft durch Stärke und Zwang verbunden mit prosozialen Handlungen sichert), während die Umsetzung der Geltungsmotivation auf Zwang verzichtet und stattdessen auf Leistung und prosozialem Verhalten beruht (und damit von der Anerkennung der Gruppenmitglieder abhängig bleibt); beim Eigenwert (Selbstwert) kommt es zu einer Entkoppelung von dieser externen Bewertung. Hinsichtlich der phylogenetischen Entwicklung dieser drei Subsysteme des Autonomiemotivs fasst Bischof (2009) zusammen: »Wir werden also damit zu rechnen haben, dass sich eine zumindest rudimentäre Form von Geltungsmotivation bereits vor dem Tier-Mensch-Übergang verselbstständigt hat. Anders steht es indessen beim dritten […] unterschiedenen Zweige des Autonomiestrebens, der in der Terminologie von Lersch Eigenwertstreben heißt. Hier haben wir es sicher mit einem Motiv zu tun, von dem man erst auf menschlichen Niveau reden kann« (S. 477).
Die beiden Bereiche menschlicher Spezifika hängen zusammen, da die motivationalen Neuerwerbe auf dem kognitiven Neuerwerb





























