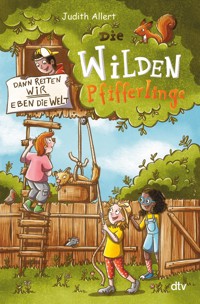7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn das Leben eine unschöne Wendung nimmt ... dann steig in den Bus und mach ein Abenteuer draus! Nach Opas Tod spielt Samys Familie total verrückt. Mama denkt nur noch an die Arbeit, Papa ist so fröhlich, dass es wehtut, die Zwillinge nerven ohne Ende, und Oma sagt gar nichts mehr. So kann es nicht weitergehen! Die Rettung klemmt in der Sofaritze: ein Zettel mit Opas letztem Wunsch, einer Reise ans Meer. Also machen sich die sechs auf den Weg – mit Opas Asche in einer Knäckebrotdose! Was als harmloser Trip beginnt, wird schnell zum chaotischen Abenteuer. Zwischen Pannen, Zoff und schrägen Begegnungen lernt die Familie, dass sie gemeinsam alles schaffen und wie kraftvoll Erinnerungen sind. Eine witzige und hoffnungsvolle Geschichte über den Verlust eines geliebten Menschen, das Zulassen aller Gefühle und den Zusammenhalt der Familie. Für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Judith Allert
Knäckebrothelden – oder wie man seine Familie rettet
Hilfe!
Nach Opas Tod spielt Samys Familie total verrückt. Mama denkt nur noch an die Arbeit, Papa ist so fröhlich, dass es wehtut, die Zwillinge nerven ohne Ende, und Oma sagt gar nichts mehr. So kann es nicht weitergehen! Die Rettung klemmt in der Sofaritze: ein Zettel mit Opas letztem Wunsch, einer Reise ans Meer. Also machen sich die sechs auf den Weg – mit Opas Asche in einer Knäckebrotdose! Was als harmloser Trip beginnt, wird schnell zum chaotischen Abenteuer. Zwischen Pannen, Zoff und schrägen Begegnungen lernt die Familie, dass sie gemeinsam alles schaffen und wie kraftvoll Erinnerungen sind.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Für meine wunderbar verrückte Familie(Aber bitte nicht zu viel interpretieren – ich erzähle einfach gern Geschichten!)
Noch zwei Kilometer.
Zwei Kilometer!
Die Tür des Polizeiautos ging auf.
Finny schnappte nach Luft.
»Samy müssen wir auch verstecken, nicht nur Opi«, flüsterte er mit großen, angsterfüllten Augen.
»Was meinst du, Finny?« Mütterliches Stirnrunzeln. Graben, tief wie eine Erdspalte.
»Na, weil er …« Finny schlug sich schnell die Hand vor den Mund.
Mama blickte mich chilischarf durch den Rückspiegel an. »Was meint er, Samuel?«
»Also …« Ich schaute aus dem Fenster. Noch war keiner ausgestiegen »Es ist besser, wenn die Polizei Finny und mich nicht sieht. Alles andere erkläre ich später.«
»Sam, was ist los? Raus mit der Sprache!«
Papa sagte immerhin noch Säm und das war ja wohl mein Heldenname.
»Ist zu kompliziert … Vertraut mir, okay? Ich erkläre euch gleich alles!« Na ja, etwas verzweifelt klang ich schon. Denn ich hätte mir jetzt absolut kein bisschen mehr vertraut. Nach meinen folgenden Sätzen erst recht nicht mehr:
»Und gib mir mal deinen Lippenstift, Mum … Und Lenchens Barbie-Jacke brauch ich! Und ihr Knirpse dahinten spielt jetzt tote Zwingele, ja? Aber diesmal ist es kein Spiel. Es ist ernst! Todernst! Kapiert?«
Ich war laut geworden. Hatte schnell geredet. Lenchen und Finny guckten mich starr an und nickten. Wackeldackelmäßig. Tock. Tock. Tock.
Die Polizistin stieg aus – und Mama reichte mir Lenchens übergroße pinke Glitzerjacke nach hinten.
Und den Lippenstift.
»Saaaaamy! Was sind sterbliche Überreste?«
Das war Lenchen. Mal wieder. Ich kriegte es gerade noch hin, meine Suppe nicht quer über den Tisch zu spucken.
Dabei sollte ich ja langsam Übung haben im Merkwürdige-Fragen-Beantworten. Das ist schließlich nur eine von ungefähr zehntausend, mit denen mich meine kleine Schwester in den letzten Tagen gelöchert hatte. Lenchen zwirbelte eine ihrer Zottelhaarsträhnen zwischen den Fingern und sah mich neugierig an. Papa räusperte sich und lächelte mir zu. Hätte nur noch gefehlt, dass er fröhlich summte. Das machte er immer. Summen wie ein Bienchen, und das meistens noch im Ringelshirt. Und seit zwei Wochen sogar noch viel mehr als früher. Papa war zum Superbienchen mutiert.
Mama griff nach ihrem Handy und wischte schwer beschäftigt darauf herum. Als ob darin die Welt wäre und alles drum herum nur Spam. Gegenüber von mir saß Omi. Sie starrte mal wieder reglos vor sich hin. Wie eine Omi-Hülle ohne irgendwas drin. Der Rest von ihr war … verloren gegangen. Oder in ein anderes Universum gerutscht. Und ich? Na ja, einer musste hier ja diesen ganzen Wahnsinn schaukeln! Also los:
»Hm … Sterbliche Überreste … Na ja … Das ist, hm … das, was übrig bleibt, wenn ein Mensch gestorben ist. Sein letzter Rest oder so.«
Kein Wunder, dass ich so stotterte.
Ich kapierte es ja selbst nicht.
Wieso sterblich? Was soll an einem Toten bitte schön noch sterben? Gestorbener als tot kann man nicht sein! Oder hat es was damit zu tun, dass die Seele in den Himmel fährt? Oder man ein Engel wird? Aber an das glaubt ja nicht jeder. Für viele sind tote Menschen nur noch Würmerfutter. Oder ein Häufchen Asche in einer Dose. Und für mich? Keine Ahnung! Absolut keine Ahnung! Ich hatte da ja auch bisher noch nie drüber nachgedacht. Klar, als ich klein war, hatte ich mal feierlich einen Vogel beerdigt, der gegen die Scheibe geknallt war. Und ich war auf den Beerdigungen von entfernten Verwandten gewesen, die ich zwei-, dreimal in meinem Leben gesehen hatte. Googeln oder YouTube hilft in so einer Situation auch nicht viel. Es ist einfach so was von verzwickt, die Sache mit dem Tod. Wie soll man was verstehen – und dann auch noch der kleinen Schwester erklären –, was eigentlich gar nicht da ist? Nur … als Loch. Ein riesengroßes, unsichtbares Loch voller Nichts. Eins, das ziemlich wehtut. Aber oft, ganz oft, fühlt es sich auch einfach nur total merkwürdig an.
Und unecht.
Und megadämlich.
Aber so was von!
Lenchen sah auch nicht so aus, als ob sie sehr zufrieden mit meiner Antwort war. Bevor sie noch was sagen konnte, fragte Papa-Bienchen grinsend: »Mag jemand Limo?«, und klirrte mit einer Flasche und Gläsern herum.
Ich murmelte ein Danke und nahm einen großen Schluck.
Trotzdem brannten meine Augen und so ein blöder, dicker Kloß – mindestens drei Kilo schwer und groß wie eine Grapefruit – drückte von innen gegen meinen Hals.
Nicht schon wieder heulen!
Nicht mehr an diese Sache denken. Auf was anderes konzentrieren: Suppeschlürfen! Ich nahm meinen Löffel und tauchte ihn in meiner Schüssel unter. Wenn ich mir einfach vorstellte, Opa wäre nur mal kurz draußen. Nicht so richtig, richtig weg … Zumindest eine Schüssel Suppe lang.
Also: Löffeln, ab in den Mund, herunter damit. Löffeln, ab in den Mund, herunter damit. Bis Lenchen ihren Löffel in die Suppe platschen ließ und fragte: »Muss Finny nicht essen? Dann will ich auch spielen!«
Ihr Zwillingsbruder war in seinem Zimmer. Er hatte mal wieder einen auf Finny gemacht. Wenn er etwas wollte, machte er entweder auf zuckersüß und putzig – oder verfiel in eisiges Schweigen und wurde starr wie eine Statue. Das war fast noch wirksamer als die süße Variante. Je steifer Finny wurde, desto weicher wurden meine Eltern. Und den süßen Finny hatte ich seit zwei Wochen nicht gesehen. Deshalb hatte er noch bei seinen Spielzeugautos bleiben dürfen. So lange, bis er alle der Größe und der Farbe nach sortiert hatte. Lenchen sprang auf, Mama wollte sie noch festhalten, aber sie war schneller.
Mama eilte ihr nach.
Keine halbe Minute später erklang ein Lenchen-Schrei.
Ich schrie sofort mit. Gleichzeitig sprang ich von meinem Stuhl auf. Stürmte Richtung Tür. Blieb nur leider an der Ecke der Küchentheke hängen.
»Autsch! Ah! Verdammt!« Stöhnend sackte ich in mich zusammen.
»Alles gut, Samy?« Papa legte mir die Hand auf die Schulter.
»Jaja, alles gut. Nur ein Kratzer«, sagte ich laut. Und leise für mich korrigierte ich:
»So weit alles gut.«
Und Mama rief gleichzeitig von draußen: »Alles gut hier, keine Sorge!«
Alles gut.
Keine Sorge.
Na klar.
Als ich wieder gerade stand, war auch Papa zur Tür raus.
Oma saß noch am Tisch. Jedenfalls ihr Körper. Ich biss mir fest, ganz fest auf die Lippe.
»Bis gleich, Omi …« Sie reagierte nicht.
Dabei war Oma immer für uns da. Gewesen. Egal ob Pflaster, Pfannkuchen oder … P … P … Keine Ahnung. Völlig egal, was. Zu Oma konnte man einfach immer. Für jedes P der Welt – während Opa schmunzelnd seine Heldengeschichten erzählt, irgendwelche Dinge hinter Ohren vorgezaubert und dabei ganz nebenbei alles geschaukelt hatte. (Die ganze Welt ungefähr.) Früher. Damals. Es war einmal.
So ein großes Pflaster, für die Wunde, die Opa hier mitten in uns reingerissen hatte – das gab’s nirgends.
Mein kleiner Bruder lag in seinem Bett.
Reglos.
Fast.
Er blinzelte.
»Finny ist tot«, beharrte Lenchen. »Deshalb hab ich geweint.«
Sie deutete auf ihre Augen, die so gar nicht nach Weinen aussahen. Trocken wie die Wüste Sahara.
»Du hast geschrien. Und deinen großen Bruder unglaublich erschreckt«, sagte Mama.
»Quatsch«, log ich, während ich immer noch spürte, wie mein Herz aus meiner Brust und sonst wohin hüpfen wollte.
»Wie lange dauert tot?«, fragte mein kleiner Bruder, bemüht, seine Augen zuzuhalten.
Lenchen schnaubte.
»Tote können nicht reden. Und Totsein dauert ewig!«
Finny setzte sich auf. »Das heißt, Opi ist für immer tot?«
Seine Unterlippe bebte.
»Ach, Finny …« Mama hob hilflos die Hände. »Darüber haben wir doch schon gesprochen.«
»Hundertdrölfzig Mal«, murmelte ich.
»Jetzt will ich!«, rief Lenchen und quetschte sich zu Finny ins Bett. Sie legte die Arme eng an ihren Oberkörper, schloss die Augen und machte sich ganz steif. Da legte sich Finny auch noch mal flach hin.
»Hihi, wir liegen im Doppelsarg! Ist doch lustig, oder?«, fragte Lenchen kichernd.
Sehr belustigt sah mein Bruder nicht aus. Er nickte ernst: »Wir sind tote Zwingele.«
Dabei wusste er längst, wie das richtig hieß. Immerhin war er da schon seit fast sechs Jahren Zwilling. Aber plötzlich kramte er wieder alte Babywörter hervor. Na gut. Nicht plötzlich. Hatte genau zwei Wochen vorher angefangen. Am Tag der Tage.
Und Mama verbesserte Finny nicht mal. Obwohl es ihr sonst immer ohne Ende wichtig war, dass er ordentlich redet. Überhaupt sind »sauber« und »ordentlich« ihre Lieblingswörter. Ihr zweiter Vorname ist »Desinfektionsspray und Feuchttücher« (sie hat bei so einem Online-Händler ein Abo. Alle drei Monate kriegt sie ein Paket. Kein Scherz), und wenn der letzte Tag auf Erden angekündigt wäre, würde sie das garantiert erst mal in ihrer Handy-App notieren. In dem Moment hatte der Wahnsinn wenigstens was Gutes – die Knirpse stellten für ein paar Minuten keine gruseligen Fragen. Stattdessen kniffen beide feste die Augen zu und pressten die Lippen aufeinander.
»Ich muss … noch mal telefonieren«, sagte Mama und verdünnisierte sich aus dem Kinderzimmer.
Papa sah ihr eine Sekunde lang nach. Dann grinste er und klatschte in die Hände: »He, ihr zwei Zwergchaoten. Wie wäre es mit ein paar Keksen?«
Was zu einer sehr schnellen Wiederbelebung führte.
Auf dem Weg zur Küche zupfte Finny mich am Ärmel. Ich beugte mich zu ihm herunter.
Und dann flüsterte er ganz leise (und ziemlich warm und feucht – Finny spuckt immer so, wenn er aufgeregt ist) in mein Ohr: »Wir müssen was machen! Opi darf nicht für immer und ewig tot sein!«
Und ich biss mir wieder ganz fest auf die Lippen. Zum ungefähr tausendsten Mal. Zum tausendsten Mal, seit Opi gestorben war.
Krebs. Blöder, doofer Mistkrebs. Der hatte Opi schon jahrelang verfolgt und es war auch nicht das erste Mal gewesen, dass es ihm nicht gut ging. Vor einem halben Jahr war es schon mal so richtig schlimm gewesen. Das heißt – für Opi war nie was richtig schlimm. Wo die Welt halb leere Gläser sah, waren bei ihm alle halb voll. Was für andere tödliche Krankheiten waren, waren für ihn Kratzer. Mein Opa hatte Angst vor gar nichts und schaukelte alles. Das war einer seiner Lieblingssätze: »Das schaukeln wir schon!« Und mit »wir« meinte er sich. Egal ob der Rasenmäher der Nachbarin streikte, ein alter Herr (also, ein richtig alter Herr) aus der Seniorenresidenz dringend einen Fahrer brauchte oder Opi einen tödlichen Tumor loswerden musste. Und dafür musste er nicht mal kämpfen wie … ein wildes Nilpferd oder so. (Ich hab da mal ein Video gesehen. Nilpferd gegen Löwe – weil der das Baby-Nilpferd killen wollte. War nicht lustig für den Löwen!) Nee, bei Opi lief so was total lässig ab. Weil im Gegensatz zum Nilpferd hatte er keinen Schiss. Nie. Vor nichts. Er grübelte nicht, er machte einfach. Alles, was nötig war. Er hat die Chemos in sich reinlaufen lassen, als wären sie Limo. Hat sich in sämtliche Röhren schieben lassen, als wären es nette, kuschelige Mini-Hotels. Mit Sauna, Massage und All-you-can-eat.
Ja, und so was hatte der dämliche Krebs natürlich noch nicht gesehen. Der war in seiner Krebsehre gekränkt und hat seine fiesen Zangen eingefahren. Die Ärzte waren baff. Wir aber nicht! Weil wir nicht mal eine Sekunde daran gedacht hatten, dass Opa, unser Held, das hier nicht auch hinkriegen würde. Weil wir nicht mal eine halbe Sekunde daran dachten, dass es eine Welt ohne Opa geben könnte. Genau wie Opa keine Sekunde bereit war, uns und die Welt zu verlassen.
Okay, Opi war nicht mehr so fit wie vorher – »Ich fühl mich, als könnte ich Bäume ausreißen«, hatte er immer gesagt – und nun reichte es nur noch für kleine Ästchen. Er ging jetzt immer leicht gebückt und seine Füße schlurften langsam über den Boden. Ein bisschen sah er aus wie eine Schildkröte. Eine alte, gemütliche und sehr nette Opa-Schildkröte. Aber die Hauptsache war, er war da! Hier, bei uns! Er durfte abends ein Bierchen schlürfen. Er guckte mit mir Fußball (obwohl ich Fußball total langweilig finde – aber es war einfach schön, neben ihm zu sitzen), hörte klassische Musik, pfiff die Melodien mit und lobte Omas Essen, nachdem er jedes Mal mindestens zweimal Nachschlag verlangt hatte. Er machte Quatsch mit den Kids, hielt Pläuschchen mit den Nachbarn und sogar bei seinen Ehrenämtern schlurfte er zumindest auf einen Sprung noch vorbei. In der Bücherei (da war er so was wie der Märchenonkel), im Altenheim (Opi war mit seinen nicht mal fünfundsiebzig nicht alt, also bitte!), im Fußballverein. Wobei seine Krankheit die ganze Zeit nicht eine Sekunde lang Thema war. Opi hatte viel Besseres zu erzählen. Eine von seinen tausend verrückten Heldengeschichten – darüber, was er früher, als er jung war, so alles geschaukelt hatte. Auf Opi-Art. Zum Glück. Denn Opi ohne seine Geschichten, das wäre gewesen wie Weihnachten ohne Baum und Sommer ohne Mückenstich. Kurz gesagt, eigentlich war Opi fast wie immer: Immer gut gelaunt. Immer für andere da. Weshalb wir dachten, wir hätten ihn für immer.
Falsch gedacht.
Ich ließ den Löffel in die Suppe platschen.
Nicht nur, weil sie inzwischen kalt war. Ich zwinkerte und zwinkerte und zwinkerte. Nicht heulen. Bitte nicht. Dann würde auch Finny wieder weinen. Und Papa würde, keine Ahnung, mir vermutlich Schokolade in den Mund stopfen und dabei Pirouetten drehen. Mama würde schon wieder für ein megawichtiges Telefonat ganz schnell nach draußen müssen. Lenchen würde noch mehr aufdrehen. Und Oma … Na ja, die würde nach wie vor so dasitzen. Gruselgeisterhaft.
»Ich … Ich muss … Ich kann … Also, ich kann nicht …«, murmelte ich und stand auf.
Finny sah mich mit großen Augen an: »Bist du jetzt für immer traurig, Sami?«
»Nein … Also Quatsch … Alles gut. Ich muss nur mal …« Ich murmelte irgendwas in mich hinein, dann huschte ich aus der Küche.
Aus dem Augenwinkel sah ich Oma. Sie hatte noch immer keinen Ton gesagt. Machte einfach keinen Mucks. Finny kletterte auf ihren Schoß und drückte sich an sie. Ein dünnes Rinnsal lief Omas Wange herunter und ich fragte mich genau wie mein kleiner Bruder, wie das hier jemals wieder anders werden sollte.
Anders als traurig.
Schnell mit einem Buch ins Bett verkrümelt. Lesen klappt bei mir eigentlich immer. Wegträumen. Flüchten. Jemand anders sein. Wenigstens in Geschichten. Normalerweise.
Diesmal aber ploppte eine andere Geschichte in meinem Kopf auf.
Opis letzte.
Dabei hatte alles – also, dieses verdammte Sterben – erst recht harmlos angefangen. Erst war es nur Fieber. Dann war Opi auf einmal total schwach. Schon konnte er kaum noch ein paar Schritte gehen.
Mann. Es ging so verdammt schnell!
Wieder mal Krankenhaus.
Diesmal kam er gar nicht mehr dazu, halb leere Gläser vollzuzaubern. Er hat das alles da schon gar nicht mehr richtig mitgekriegt. Er hat uns nicht mal mehr erkannt.
Aber bis fast ganz zum Schluss hat er geglaubt, dass alles gut wird.
Als ich das allerallerletzte Mal mit ihm gesprochen habe, zu Hause, hat er gelacht. Für eine große Geschichte hat es nicht mehr gereicht, für ein paar Anekdoten schon. Deshalb sag ich mir die ganze Zeit: Für ihn war es besser so.
Er hatte keine Angst vor dem Tod. Oder vor dem Abschied.
Er ist als Held gestorben.
Leider ändert das nichts daran, dass wir das jetzt ausbaden müssen.
Das ohne ihn.
Wer sagt uns jetzt, dass das das Leben ein Klacks ist und wir schon alles schaukeln?
Genau: keiner! Denn der Heldenplatz in der Familie ist ab sofort nicht mehr besetzt.
(Ich hatte mit einem Helden so viel gemeinsam wie eine Nacktschnecke mit einer Sambatänzerin.)
»Scheiße!«
Ich schmiss das Buch in die Ecke und schloss die Augen. Ach was. Ich presste meine Lider fest aufeinander, damit es ja kein Mininanomilliliter salzige Flüssigkeit nach draußen schaffte.
Blöderweise war ich der totale Schisser.
Zweiter Vorname, sozusagen.
Hier mal eine kurze Erläuterung, wovor ich so Angst habe. (Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Man weiß ja nie, was als Nächstes passiert!)
– Angst vor Hunden (wurde mal sehr böse von einem angeschaut, als ich klein war)
– Angst vor Wespen (bin allergisch – übelste Erstickungsgefahr!)
– Ja, okay, Angst vor ziemlich allen Tieren (egal ob Fell, Fühler oder F… Fussel an der Nase)
– Angst vor Höhe (da muss ich nichts zu erklären – versteht ja wohl jeder!)
– Angst vor Gewitter (siehe oben)
– Angst vor klebrigen Ekeldingen (Kaugummis, die unter Tischplatten pappen, und man fasst rein und kriegt den Glibber nie wieder ab)
– Angst davor, dass Finny etwas Schlimmes passieren könnte
– Angst davor, dass Lenchen etwas Schlimmes passieren könnte
– Angst davor, dass – um es kurz zu machen – irgendjemand aus der Familie etwas Schlimmes zustoßen könnte!Ja und topaktuell nicht zu vergessen:
– Angst vor dem Leben ohne Opa – mit allem, was dazugehört (unter anderem, dass Omi ein Gruselgeist bleibt. Für immer und ewig und immer)
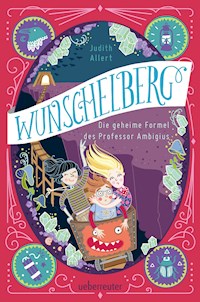
![Die wilde Baumhausschule. Nachsitzen um Mitternacht [Band 3] - Judith Allert - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/484359cb0e3052d16f1f9a0f7d734ad2/w200_u90.jpg)
![Die wilde Baumhausschule. Raubtierzähmen für Anfänger [Band 1] - Judith Allert - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/44053882ea6a99643515e168236675d6/w200_u90.jpg)