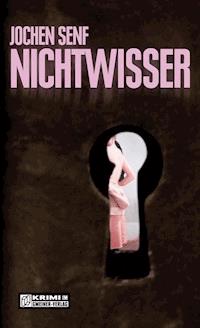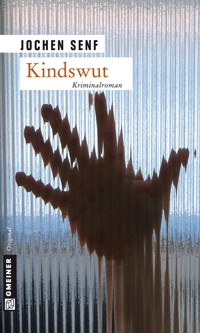Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fritz Neuhaus
- Sprache: Deutsch
Unvermittelt wird Fritz Neuhaus, ein Lebenskünstler mit ausgeprägten Schnüfflerqualitäten, in einen Strudel gefährlicher Ereignisse gezogen: Im Gebäude des "Radio Berlin Brandenburg" übergibt ihm ein Fremder sechs Chipkarten verschiedener Krankenkassen. Warum, erfährt Neuhaus nicht. Doch bereits am nächsten Morgen erhält er einen "Hinweis": Ein Schlägertrupp klingelt ihn aus dem Bett, der deutlich an den Karten interessiert ist. Und Fritz Neuhaus hat noch immer keine Ahnung, worum es eigentlich geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Senf
Knochenspiel
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Lutz Eberle
ISBN 978-3-8392-3094-7
Widmung
Für Anna
1
Die Müllabfuhr war es nicht. Die klingelte immer zweimal kurz. Es war bestimmt auch keine liebe Fee, die Brötchen bringen wollte. Um halb acht morgens. Dafür war das Klingeln zu lang. Eine Fee tupfte nur auf die Klingel. Ich lag wach in meinem Bett und wartete auf das Brodeln der Espressomaschine in der Küche nebenan. Ich liebte es, aus dem Bett zu springen, zur dampfenden und zischenden Espressomaschine zu eilen, im wehenden weißen Bademantel, um den heißen Kaffee in die vorgewärmte Tasse zu gießen. Der aufsteigende Duft! Die mit kräftigen Farben aufgetragenen rosafarbenen Blüten und die dunkelgrünen Blätter auf der Tasse leuchteten.Zucker und Milch hatte ich schon vorher in die Tasse gegeben. Diese satte, nicht allzu helle, braune Farbe des Kaffees in der geblümten Tasse! Ich hörte die Vögelein zwitschern im Geäst, wenn der Kaffeestrahl die Tasse füllte! Auch im Winter, bei Sturm und Hagel! Egal! Äthiopischer Wildkaffee! Ohne dieses Ritual war der Tag kein Tag. Vervollständigt wurde er im ›Dollinger‹. Ich holte mir die Zeitung, dann erst brachte mir Doris einen Cappuccino, überwölbt von einem Gebirge aus geschäumter Milch mit einer Haube aus Zimt und Schokolade. Köstlich, wenn die gespitzten Lippen von dieser Melange beim ersten Hineintauchen gestreichelt wurden.
»Einer mit Piff«, sagte Doris und zwitscherte ganz kurz wie eine Nachtigall.
Es schellte wieder. Die Müllabfuhr schellte nie ein zweites Mal. Ich hörte ein leises Grunzen vor der Wohnungstüre. Da war jemand. Vielleicht ein Kurier von einem Paketdienst. Ich hatte eine Kiste Pfälzer Riesling, Gut Annenberg bestellt. Ich sprang aus dem Bett, knüpfte den Bademantel zu, ging zur Wohnungstüre. In diesem Augenblick brodelte der Kaffee. Er war fertig. Kaffeeduft verbreitete sich. Ich öffnete die Türe. Sie machten keine Fisimatenten. Kein ›Guten Morgen, wie geht’s denn so?‹ oder ›Entschuldigen Sie die Störung.‹ Ich bekam zur Begrüßung eine satte Ohrfeige verpasst, einen Stoß vor die Brust, und noch eine Ohrfeige von dem anderen Kerl, und noch eine von dem, der mir zuerst eine verpasst hatte. Ein eingespieltes Team. Die Ohrfeigen klatschten. Die Türe fiel ins Schloss. Meine Backen brannten. Der Bademantel hatte sich geöffnet. Ich hatte nichts drunter. Eine peinvolle Situation. Nackt und geschlagen. Wie schnell das ging.
»Los, anziehen.«
Ich ging ins Wohnzimmer, wo meine Kleider auf dem Sofa lagen. Die beiden Kerle folgten mir. Mit fliegender Eile zog ich eine Unterhose an, streifte die Hose darüber, den beiden den Rücken zugewandt, jeden Moment einen weiteren Schlag erwartend. Es war ein Tritt ins Gesäß.
»Mach schon«, sagte einer der beiden. Ich zog den Bademantel aus und zog mir das Hemd über den Kopf. Wieso wehrte ich mich nicht? Warum befolgte ich ihre Anweisungen? Ich hatte gar keine Chance zu reagieren. Wer rechnet denn schon um diese Uhrzeit mit einem Überfall? Es ging ruckzuck. Türe auf, ein paar in die Fresse. Eine dumpfe Wut kroch in mir hoch. Diese ganz schwarze Wut, wie sie in Teerkesseln beim Straßenbau brodelte. Bei ständiger Überfeuerung. Der Teermeister war ein Teufelsbub. Ich überlegte.
»Was wollen Sie?«
Einer der beiden setzte sich in Bewegung. Er war groß und schlaksig und trug einen anthrazitfarbenen Anzug. Dazu ein weißes Hemd. Er war etwa 35 und hatte einen Bürstenhaarschnitt mit ausrasiertem Hals. Er war hellblond und kaute einen Kaugummi. Das kräftige Kinn rotierte wie bei einem dumpf wiederkäuenden Ochsen. Dabei schmatzte er. Dieses Geschmatze war furchtbar. Ich fröstelte innerlich. Jeder Affe hatte mehr Ausdruck im Gesicht als er. Seine Augen blickten irgendwie ständig in die Ferne, auf der Suche nach irgendwas. Es war der typische Blick eines Hirntoten. Jedenfalls stellte ich mir einen hirntoten Blick so vor. Er ging in die Küche. Ich und der andere, so ein Schlotterkerlchen, folgten ihm. Der Wiederkäuer öffnete den Kühlschrank, dann das Tiefkühlfach. Beides war leer. Ich wollte den Kühlschrank schon seit Wochen abtauen und mit heißem Essigwasser auswaschen. Er war folglich leer.
»Nichts.«
»Hm, Hm«, knurrte der Schlottermann und knallte mir wieder eine. Was suchen die, überlegte ich. Bestimmt keine dicke Wurst oder einen stinkenden Münster Käse. Der Wiederkäuer ging in mein Wohnzimmer, riss Bilder von der Wand, schaute dahinter, leerte einige Bücherregale.
»Was, bitte …«
Wumm! Wutendladung. Mit dem Handrücken. Wieder auf die Nase. Das schmerzte. Ich verkniff mir weitere Fragen. Der andere war ein Kleiner, Hagerer, mit einem nervösen Zucken im Gesicht, als wollte ihm die Gesichtshaut wegfliegen. Ein echter Hänfling. Das Gezucke verlieh ihm den Ausdruck einer gewissen Blödigkeit. Besonders, wenn er einen Superzucker mit einer Bewegung des Kinns, von rechts nach links, in einem Halbbogen, wegschnipste wie eine lästige Heuschrecke, die ihm über das Gesicht krabbelte und jetzt fortsprang. Er hatte Ringe an jedem Finger. Auch er trug einen anthrazitfarbenen Anzug und ein weißes Hemd. Diese Anzüge waren wohl die Firmenkleidung. Seine Haut war gelblich fahl, mit tiefen Falten, die sich bei dem Gezucke wurmartig wanden. Jetzt zuckte er gerade gewaltig. Eine Art Gesichtsbeben, das die Nase in Schwingungen versetzte. Dieser Mensch würde an jedem Ort einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht gerade von Vorteil in seiner Branche.
»Los, setzen.« Der Hellblonde zeigte auf einen Küchenstuhl. Ich setzte mich nicht.
»Was wollen Sie?«
»Fresse«, und schon wieder rumste es. Ein ganz fieser Typ, dieser Gesichtszucker, so ein Schlag ohne Vorwarnung von hinten auf den Hals. Normalerweise würde ich diesen Zuckakrobaten auseinandernehmen. Ich setzte mich. Ich war Anhänger der germanischen Langzeitrache. Ich schwor den beiden Rache. Ganz furchtbare. Ich freute mich schon darauf, wie ich ihnen das Fell über die Ohren ziehen würde. Der Zwerg würde zucken wie ein Wahnsinniger. Die ganze Visage würde auseinanderfliegen. In Myriaden zuckender Gesichtshautzellen würde er sich auf und davon machen. Wie eine Wolke winziger Fruchtfliegen im Sommer über faulendem Obst. Diese verfluchten Scheißkerle.
»Also los, wo ist das Zeug? Die Chips?«
Wovon sprach er? »Was für ein Zeug?«
»Wir bringen dich schon noch zum Sprechen. Sieh dich um!« Der Zwerg stiefelte los. Er hatte Gamaschenschuhe an, die zu groß waren, mit hohen Absätzen. Um die Schuhe nicht zu verlieren, musste er die Stiefelspitzen immer oben halten. Normales Abrollen der Fußsohlen ging nicht. Es sah aus, als würde er jeden Moment nach hinten umkippen. Er kippte nicht, inspizierte die Wohnung und kam wieder.
»Nichts.«
»Kein Behälter? Nichts?«
»Nichts.«
»Hm«, grunzte der Hellblonde und zog ein paar Gummihandschuhe aus der Jackentasche des Anzugs und streifte sie über. »An die Arbeit.«
Mir wurde blümerant. Das sah nicht gut aus.
»Er hat dir nichts gegeben?«
»Wer, was?«
Peng. Voll aufs Auge mit der Faust. Wie sah ich wohl aus inzwischen? Blut floss aus der Nase. Eine Lippe schwoll an. Das Auge glühte.
»Gestern. Paternoster. Und?«
»Keiner hat mir was gegeben.«
Ich wusste wirklich nicht, was er wollte. Außerdem war mein Erinnerungsvermögen durch den Überfall und die Schläge deutlich eingeschränkt. Ich begriff gar nichts. Als wäre ich aus meinem Bett direkt in eine fremde, ferne Galaxie gesaust. Was, verdammt, wollten die? Der Zwerg war ins Wohnzimmer gegangen und kam mit dem Gürtel des Bademantels zurück. Der Hellblonde hatte den Wassererhitzer mit Wasser gefüllt und ihn angestellt. Sehr schnell begann das Wasser zu summen. Erst ganz leise, bis es dann bald kochend heiß brodeln würde. Der Zwerg machte sich mit dem Bademantelgürtel an meinen Händen und Armen zu schaffen. Dabei zuckte er ganz wild. Mit der Nase, dem Kinn, den Wangen, den Augenbrauen. Unendliches Stirnrunzeln, wie Wellen bei Sturm.
»Jetzt werden wir dich mal fixieren.« Er wollte meine Arme, hinterrücks über die Stuhllehne gezwängt, an dem Stuhl mit dem Gürtel festbinden. Er zerrte an mir herum, als wäre ich ein zu rupfendes Suppenhuhn, das nicht in den Topf wollte. Der Wasserkessel begann zu brodeln und dampfte. Das gefiel mir nicht. Ich musste etwas unternehmen. Die Espressomaschine war fast in Reichweite auf dem Küchentisch.
»Du hast den Typen doch gekannt?«, erkundigte sich der Hellblonde. Ich machte einen Satz auf die Espressomaschine zu, packte sie, sie war tierisch heiß, und knallte sie dem Hellblonden ins Gesicht. Der Kaffee spritzte. Das ging sehr schnell. Den Trick hatte ich schon mal verwendet. Der Kerl schrie gellend auf. Ich trat ihm zwischen die Beine. Dem Zwerg schlang ich den Bademantelgürtel um den Hals und schleifte ihn zur Wohnungstüre. Sein Mund war weit geöffnet, er krächzte und gurgelte und fuchtelte mit den Armen. Die Beine strampelten. Er wollte sich am Türrahmen festhalten. Seine Fingernägel schrappten über den Lack. Ich warf ihn die Treppe runter. Der Hellblonde erholte sich. Ich brüllte, so laut ich konnte. Er hatte seine Jacke geöffnet und stand vornübergebeugt da. Sein Hemd war kaffeenass. Er trug ein Pistolenhalfter. Er fummelte nach seiner Pistole. Ich war schneller. Ich hielt ihm die Pistole unter die Nase.
»Raus!«
Er stolperte zur Tür. »Wir sehen uns wieder«, sagte er noch. Zu mehr Gegenwehr war ich nicht in der Lage. Ich warf die Wohnungstüre zu und lehnte mich, schwer atmend, gegen die Flurwand. Die weiß gestrichene Küche war voller Kaffeeflecken. Ich verschnaufte, der Atem wurde ruhiger. Mit einer Stoffserviette wollte ich die Kaffeeflecken von der Wand wischen. Es wurde nur schlimmer. Ich würde die Küche komplett neu streichen müssen. Ich machte mir einen neuen Kaffee. Die Blumen der Kaffeetasse mit dem Zucker und der Milch drin leuchteten unberührt von allem wie bei Sonnenschein. Draußen, im Hinterhof, lärmten Spatzen. Eine einsame Taube gurrte im Geäst.
2
Kurz vor neun Uhr saß ich, trotz des Überfalls, im ›Dollinger‹. Doris servierte mir gerade den Cappuccino. Das war eine Bevorzugung, denn vor neun bekam im ›Dollinger‹ keiner was. Nur Sondergäste. Das waren ganz wenige.
»Wie siehst du denn aus?«
»Ach Gott, ja.«
Doris war diskret und fragte nicht länger. Außerdem kannte sie mich.
»Jaja«, sagte sie und brachte mir noch ein Glas Wasser. »Wo warstn die janze Zeit? Hab dir ja richtich vamisst.«
»Jaja.«
»Allet klar.« Das klang wie: ›Du und die Weiber. Immer das gleiche.‹
Nach dem Überfall hatte ich mich erst nicht aus der Wohnung getraut. Ich stand unter Schock und stand kichernd in der Küche und trank den frisch gekochten Kaffee. Unter Schock kicherte ich immer. Ganze Lachsalven konnten sich entwickeln. Es gab einfach zu viele Komiker, die ständig meine Wege kreuzten. Aber warum passierte das ständig mir? Komische Begegnungen, die ja so komisch nicht waren! Die in mir einen unbändigen Lachreiz auslösten. Nachdem ich mich wieder gefangen hatte, schlich ich, wie in Feindesland, die Treppen runter. Nach den beiden Gestalten spähend. Sie waren verschwunden. Nicht auszumalen, was sie mit mir angestellt hätten, wenn ich mich hätte an den Stuhl fesseln lassen. Übergossen und verbrüht werden von dem kochenden Wasser. Was wollten die von mir? Ich versuchte, mich zu erinnern. An gestern. An einen Paternoster. Was hatte der Paternoster mit dem Überfall zu tun? Welche Chips suchten sie? Sehr mysteriös.
Doris lag im Übrigen mit ihrer Vermutung richtig. Ich war schon seit Wochen nicht mehr im Dollinger gewesen. Vor nicht einmal zwei Monaten hatten ich und Jean, der Besitzer vom ›Dollinger‹, diese hundsgemeine Rothaarige samt Compagnon in ihrem knallroten Sportwagen an der Kreuzung Stuttgarter Platz Ecke Windscheidtstraße in die Luft gesprengt. Keine 40 Meter vom ›Dollinger‹. War das ein Knall! Ich hatte gar keine andere Wahl, als die Rothaarige ins Jenseits zu befördern. Sie oder ich! Dabei hatte Jean die Explosion ausgelöst. Aus Verspieltheit. Vor mir auf dem Tisch vor dem ›Dollinger‹, neben dem Cappuccino, stand der kleine Apparat. Jean fummelte an den Drähten herum und drückte auf den kleinen Knopf, weil ihm danach war.
»Wo hastn das her? Niedlich!«
Wumm!! Funktionierte einwandfrei. Gelbe Stichflamme. Meterhoch. Hatte ich mir im Internet bestellt. Anonym natürlich und postlagernd. Die Polizei sprach von Terroristen, die einen Anschlag auf deutsche Verfassungsorgane verübt hatten. Welche Organe, sagte die Polizei nicht. Außerdem wollte ich Barbara Vogelweide nicht im Dollinger antreffen. Sie wusste, dass es mein Stammlokal war, mein Wohnzimmer. Ich ging ihr aus dem Weg. Barbara wusste, dass wir die Explosion ausgelöst hatten. Dass es keine Terroristen waren, sondern ein Kneipenwirt und ich. Da war ich mir sicher. Aber nicht deswegen mied ich sie. Sie wusste etwas über mich, was ich nicht wusste, und auch gar nicht im Detail wissen wollte. Ich hatte meine Mutter, angeblich, in der Badewanne ersäuft, während sie sich im heißen Wasser an mir verlustierte. Erzählte mir die Rothaarige, bevor sie samt Auto in die Luft ging. Ich fühlte mich nach der Explosion frei wie ein Vogel, wie eine wippende Bachstelze. Dieses Gefühl wollte ich mir unbedingt bewahren. Außerdem wusste ich nicht im Geringsten, wie ich Barbara Vogelweide als wippende Bachstelze begegnen sollte. Mit meinen 48 Jahren war ich vor ein paar Wochen explosionsartig gerade auf die Welt gekommen. Als wäre ich ein Außerirdischer, der auf der Erde landete und plötzlich wie ein Mensch funktionieren sollte. Ich wusste bis dahin gar nicht, was eine Frau ist, und von mir als Mann wusste ich auch nicht mehr. Ich hatte ein lexikalisches Humanwissen, Kategorie Mensch, in meinem Kopf gespeichert wie auf einer Festplatte, ein rein theoretisches Fachwissen mit vielen Unterabteilungen, konnte es aber in keiner Weise auf mich anwenden. Ich hatte mich bis dahin jeden Tag neu erfinden müssen mangels Betriebsmasse. Mal war ich so, dann so, und an jede neue tägliche Erfindung meiner selbst glaubte ich ganz fest.
Ich schaute die Leonhardtstraße hinunter. Vor den kleinen Läden und den Cafés saßen Mütter mit ihren Kindern. Die Kinder lärmten. Der Spielplatz gegenüber füllte sich. Knirpse sausten brüllend auf ihren Rollern und kleinen Fahrrädern vorüber, als verfolgten sie einen Säbeltiger. Sie trugen knallbunte Sturzhelme. Kleine Mädchen schoben im Pulk Kinderwägen. Die Welt hatte sich solide eingeteilt. Mütter und Kinder. Plaudernd in den Cafés. Aber weit und breit kein Mann. Als wären sie weggezaubert. Als gäbe es sie gar nicht. Niemand vermisste sie. Wo sind die denn alle? In meinem Leben hatte es nie einen Mann gegeben, keinen Vater, keinen Onkel, keinen Freund, nichts. Immer nur Frauen. Wie kam ich gerade jetzt darauf? Ich schaute an mir herunter. Du bist also ein Mann, dachte ich. Das wars dann aber auch schon. Kein Gedanke über meine Männlichkeit entwickelte sich in mir weiter.
3
Paternoster. Der Paternoster im Gebäude des Radios Berlin Brandenburg, des RBB, der im alten Rundfunkgebäude. Da war ich gestern. Hinter einer Wolke von Scham erinnerte ich mich. Ach ja, die Chips. Na logisch, na klar doch. Mich zogen immer wieder unwiderstehlich Schränke an, in die ich mich in meiner Kindheit immer verkrochen hatte. Eingehüllt in den Duft von Mottenkugeln wie in ein schweres, stoffloses Tuch. Die Mottenkugeln standen in Schälchen im Schrank und schützten die kostbaren Pelze meiner Mutter. Von dem schweren Duft wurde ich trunken, und ich erträumte mein Leben in dieser Trunkenheit. Der trunkene Schrank. In dem ich die Welt erfuhr. Durch die Schlüssellöcher der Schranktüren. Ich hatte keine andere Perspektive. Ich floh nach Berlin. Ich war 18 Jahre alt, kurz vor dem Abitur, und ich hatte mir ein strenges Schrankverbot auferlegt. Ein Gelübde abgelegt. Ich wollte leben, nicht in Schränken verkümmern.
Aber der Paternoster im RBB zog mich unwiderstehlich an. Er wurde mein kleines Geheimnis, das ich am liebsten auch vor mir verschwiegen hätte. Wer schon wurde sich selbst gegenüber gerne wortbrüchig?
Gestern war ich wieder in der weiten Halle des RBB. Von der aus die steinernen Treppen hochstiegen, in Galerien mündeten, die sich in unendlich langen Gängen verzweigten. Die Halle war leer. Von Weitem sah ich, halb versteckt hinter einer eckigen Steinsäule aus hellem Granit, den Paternoster, sein ständiges, unaufhörliches Gleiten. Ein Rauf und Runter in einem gleichmäßigen Atemzug. Ich hatte mich vergewissert, dass niemand mich sah, bevor ich in dem Paternoster verschwand. Es war wie das Betreten einer anderen Welt. Wie ein Aus-dem-Stand-heraus-Fliegen. Ich verwandelte mich in einen Vogel. In eine Bachstelze. Der Paternoster ruckelte ganz sacht, während er nach oben schwebte. Ich schloss die Augen und ließ mich tragen. Ein ungeheures Gefühl von Leichtigkeit befiel mich. Als wäre ich eine einzelne Feder. Das alte Holz roch. Bisweilen ächzte es. Ich drehte immer erst ein paar Runden, bevor ich das eigentliche Spiel spielte. Ich glitt vom Parterre bis in den obersten Stock, bis zum obersten Gipfel, und der Paternoster schwebte wieder nach unten. Auf und ab. Es war jedes Mal ein Ziehen in der Magengegend, wenn der Paternoster auf dem Scheitel oben angekommen war und wieder seine Reise nach unten begann. Jedes Mal hatte ich die Befürchtung, ich würde jetzt kopfabwärts sausen. Zerschmettern auf dem steinernen Kellergrund. Der Paternoster ächzte und stöhnte und ruckelte jetzt heftiger. Es war aus! Ich war verloren! Ich würde abstürzen, wie Ikarus abgestürzt war. Der Paternoster besann sich. Er glitt friedlich abwärts. Ich stand fest auf beiden Füßen. Ich fasste wieder Vertrauen. Jetzt konnte ich befreit spielen. Das Spiegelspiel, das Inselhüpfen. Ich wusste, dass es ein kindisches Spiel war. Aber ich konnte mich darin verlieren. Schmerzfrei. Ohne Erinnerungen. Ich wollte nichts wissen. Nichts von Barbara Vogelweide. Von niemandem. Von meiner Mutter, die nach meiner Flucht nach Berlin vor 30 Jahren von mir ertränkt in der Badewanne aufgefunden wurde, erst recht nicht. Einen Vater hatte es nie gegeben. Nur ich sein. Frei sein. Spielen. Hüpfen. Ich. Einfach nur ich. Und keine Mühlsteine um den Hals haben, die mich in Abgründe niederzogen.
In die Rückseite der Zelle des Paternosters war ein großer Spiegel eingelassen. Es gab nicht in allen Zellen Spiegel. Nur in wenigen. Ich wusste nicht, warum das so war. Es war eben so. Vielleicht waren es Zellen für weibliche Angestellte. Die Sekretärinnen warfen einen letzten Blick auf ihre Garderobe. Zupften an den Nähten ihrer Strümpfe, am Kragen ihrer Jacken, ordneten die perlmuttenen Knöpfe ihrer Blusen. Ich wusste es nicht.
Der Spiegel war blind. Abgenutzt. Von der langen Zeit. Von den vielen Blicken. Nur hie und da blitzte es auf zwischen den Blindstellen. Und auch nur, wenn Licht in die Zelle des Paternosters fiel, ehe sie wieder, wenn auch nur ganz kurz, in schattiges Dunkel glitt, um erneut ins Licht zu schweben. Dann konnte ich mich sehen in den kleinen Spiegelstücken, die mich widerspiegelten. Es waren funkelnde Inseln in einem Meer von Blindheit. Ich sah nur Ausschnitte meines Gesichtes in den kleinen, gezackten Spiegelstücken. Die Nase oder ein Auge oder nur den Teil eines Auges, das Ohrläppchen sah ich, ein Nasenloch, das ich aufblähte wie ein Ochse, oder ich klimperte mit den Augenlidern, zog den Mund breit, und dann wanderte ich weiter in meiner Spiegelinselwelt. Manche der Spiegelstücke waren in sich gebrochen, als wären winzige Kometen eingeschlagen. Sternenförmig breiteten sich die Wellen vom Zentrum des Aufschlags aus. In diesen Sternen geschahen Verwandlungen, als wohnten in ihnen Zauberer. Das Augteil vervielfältigte sich oder wurde schief und krude, wie in einem Zerrspiegel auf der Kirmes, nur viel kleiner, viel winziger, viel zarter und voller Geheimnisse. Jedes Mal veränderte sich alles, je nachdem, wie ich mein Gesicht hielt, es bewegte, drehte, wie ich grimassierte. Es war nicht vorherbestimmbar. Immer eine Überraschung. Es war köstlich. Ich klatschte in die Hände vor Vergnügen, wenn zum Beispiel meine Nase mir trompetenförmig aus den Splittern entgegensah. Oder mein Auge mich anstierte wie das eines Fabelwesens. Es war meine Märchenwelt, in der ich unbeschwert und von niemandem gestört spielen durfte.
Ich hatte ihn nicht bemerkt. Ich war versunken. Er mischte sich ganz unauffällig in meine splitternde Fabelwelt, hüpfte mit über die Blindstellen, die stumpfen Inseln bis zum nächsten Spiegelstück. Sein leises Lachen mischte sich in meines. Erst langsam bemerkte ich in meiner Freude, meiner Versunkenheit, dass da ein Fremder war, ein Gast, ein Mitspieler, der mit mir wetteiferte. Ich brach das Spiel abrupt ab und drehte mich um. Wer war dieser Eindringling?
Vor mir stand in gebückter Haltung, die Hände auf die Knie gestützt, ein Koloss, ein Berg, ein fleischiges Ungetüm, das mich freundlich anstrahlte, mich beiseite schob und in den Spiegel grimassierte. Mit den Zeigefingern fasste er sich in die Mundwinkel und zog den Mund breit. Dazu rollte er mit den Augen. Dann richtete er sich auf und der Paternoster verdunkelte sich schlagartig. Der Mensch füllte mit seinem breiten Rücken den Rahmen des Paternosters aus.
»Schade.« Er lächelte. »Machen Sie das öfter?«
Ich war furchtbar verlegen, fühlte mich ertappt, entblößt, um mein Geheimnis beraubt. Er hatte dichtes, weißblondes, kurz geschnittenes Haar und eine riesige, fleischige Nase, die gebirgsartig aus seinem Gesicht ragte, das von Tälern, Hügelchen, Knuppeln und gebüschartigen Bartstoppeln durchzogen war. Tief liegende, hellblaue Augen, die selbst in der Dunkelheit glommen. Zwei lange, fast senkrechte Furchen durchzogen schluchtartig diese Gesichtslandschaft, in der man mit den Blicken ohne Unterlass spazieren gehen konnte. Von den Backenknochen stürzten sie abwärts, an dem breiten, immer noch freundlich lächelnden Mund vorbei, bis zu den Kinnladen, wo sie aufschlugen. Ein Gesicht voller unbändiger Energie, fast kriegerisch. Es fehlte nur der Helm. Der Kürass um die mächtige Brust. Er trug einen sandfarbenen, völlig verknitterten Leinenanzug, soweit ich das erkennen konnte. Darunter ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift ›Hau den Lukas‹. Dieses Ungetüm von Mann lächelte mich nach wie vor an, wobei er seinen Schädel hin und her wiegte. Was war er, wenn er nicht lächelte? Mars, der Kriegsgott? Ich war beeindruckt. Vielleicht auch nur, weil er mich überrascht hatte. Ich fühlte mich wehrlos, überrumpelt. Ein Stück weit ausgeliefert. Entblößt. Ich öffnete mich in meinem Spiel nicht für die Welt, nur für mich. Für niemand anders. Wer war ich? Diese Frage stellte ich mir von Insel zu Insel.
Der Paternoster glitt ins Dunkel, überwand den Gipfel, und wir schwebten wieder nach unten. Er schien meine Verlegenheit zu spüren. Noch vor kurzer Zeit wäre ich in eine meiner äußeren Häute geschlüpft, hätte ein Gespräch begonnen, angesichts dieser Masse Mensch vor mir, über Schwerkraft oder Schwerelosigkeit oder hätte Betrachtungen angestellt über die Zufälligkeiten eines Spiels wie dem Spiegelspiel, das wir gerade gemeinsam gespielt hatten. Diese Fähigkeit, in Blitzeseile mein Selbst auszutauschen, wie ein Chamäleon, das die Farbe wechselt, war mir in den letzten Monaten abhanden gekommen. Ich war auf diese Erde aufgekracht wie ein Komet aus dem Weltall. Alle schützenden Hüllen barsten. Ich fühlte mich diesem Fremden gegenüber wie ein Sohn, den der Vater bei einem verbotenen Spiel überrascht hatte. Das machte den Sohn wehrlos. Überraschungen dieser Art aber kannte ich nicht. Ich kannte keinen Vater. Ich war wie erstarrt.
»Es war mir ein Vergnügen.«
Er verließ den Paternoster. Ich schwebte bis ins Parterre, verließ den Paternoster und durchlief die große Halle. Die Pförtner grüßten, als ich das Gebäude verließ. Er wartete draußen auf mich.
»Hier.« Er drückte mir ein paar Chipkarten in die Hand. Es waren die Chipkarten von Krankenkassen. Zuoberst erkannte ich die der AOK. Er war bestimmt zwei Meter hoch und tänzelte dennoch leichtfüßig auf seinen Fußspitzen, die in pinkfarbenen Lederturnschuhen steckten.
»Es sind Rätsel. Sie haben mir Ihr Spiel gezeigt. Ich zeige Ihnen mein Spiel. Spielen Sie. Es sind sehr ähnliche Spiele. Es geht um Tod, um das Leben und um Einsamkeit. Um Schmerz. Vor dem Tod. Oder danach. Spielt im Grunde keine Rolle. Und um Sehnsucht geht es. Fragt sich nur, wonach.«
Dann ging er langsam das Trottoir hinunter, Richtung Busbahnhof. Seine Gestalt wurde immer kleiner. Die eines Riesen mit wiegendem Gang, dessen Alter unbestimmbar war.
Nie in meinem Leben hatte ich mir die Frage nach meinem Vater gestellt. Plötzlich war diese Frage da. Wo ist er? Wer ist er?
Mein Schatten, der mir in der Sonne folgte, war bestimmt der eines kleinen Jungen. Ich wagte es nicht, mich nach ihm umzudrehen.
Ich ging schnurstracks ins ›Dollinger‹. Ich war das Rumgedrücke in fremden Lokalen leid. Diese Aushäusigkeit nervte auf Dauer. Das ›Dollinger‹ war meine Heimstatt. Sollte doch kommen, wer wollte. Barbara oder sonst wer. Zum Teufel aber auch! Ich bestellte bei Doris einen Cappuccino. Ich holte die Chipkarten aus der Jackentasche. Es waren sechs Chipkarten von verschiedenen Krankenkassen.
4
Das alles ließ ich Revue passieren. Doris kam mit einem feuchten Tuch und tupfte meine Schwellungen ab. Dann musste ich einen Eisbeutel auflegen.
»Doris, wie sieht das denn aus? Was sollen denn die Leute denken?«
»Kann icke wat dafür? Wat machstn ooch für Dinga?«
Das ›Dollinger‹ füllte sich. Die Leute starrten mich an, als wäre ich ein Kirmesboxer, der auf Kundschaft wartete. In was war ich schon wieder reingerasselt? Was hatte dieses Mannmonster, das mir gestern vor dem RBB die Chipkarten wie einen Veilchenstrauß, in rätselhafte Worte verhüllt, überreicht hatte, mit diesen Schlägern zu tun, die mir gerade die Visage poliert hatten? In meiner Wohnung? Offensichtlich auf der Suche nach etwas, das ich in meiner Hosentasche trug. Sechs Chipkarten. Spiel mir das Lied vom Tod, dachte ich. Oder was bedeuteten die rätselhaften Worte meines Mitspielers im Paternoster? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Eins jedenfalls war klar. Wer derart zur Sache ging, frühmorgens, wie diese beiden Galgenvögel mit mir in meiner Wohnung gerade eben, hatte handfeste Gründe. Es waren keine Zuckerpuppen, die zum Schmusen gekommen waren. Sie hätten mich ausgequetscht. Mir das kochende Wasser wer weiß wohin geschüttet. Ich wollte mir nicht ausmalen, bis zu welchem Ende sie mich welcher Tortur unterzogen hätten. Was wollten sie wissen, was ich nicht wusste? Sie mussten diesem Menschen, der wie ein Rübezahl wirkte, der sich verlaufen hat, zum RBB gefolgt sein. Sie mussten gesehen haben, dass er mir etwas überreicht hatte. Die Chipkarten. Oder was auch immer sie gesucht hatten in meiner Wohnung. Am frühen Morgen.
Das Eis kühlte. Ich dachte an Barbara. An Thomas Bosic und seine Schwester Lea. Die mit uns nach Berlin gekommen waren vor fast zwei Monaten. Barbara und ich hatten sie in einem Flüchtlingslager im Saarland gefunden. Sie lebten dort wie Ausgesetzte. Ein Geschwisterpaar aus Bosnien. Er 17, sie 16. Thomas war, wenige Tage nach der Ankunft in Berlin, wieder in die Illegalität abgetaucht. Er fürchtete seine Abschiebung. Er hatte im Saarland eine Tankstelle überfallen. Er lebte da bereits in der Illegalität. Eins ergab sich aus dem anderen. Lea und Thomas hatten mit ansehen müssen wie vor ihren Augen, 800 Menschen von Serben massakriert wurden. Familienangehörige, der Vater, Geschwister des Vaters. Freunde. Bekannte. Wildfremde. Kinder. Alte. Sie saßen in einem Schrank, der auf dem Acker stand, auf dem das Gemetzel stattfand. Schwer gezeichnet, waren sie mit ihrer Mutter ins Saarland ins Flüchtlingslager Schlabbach gekommen. Die schwer kranke Mutter war kurz nach dem Überfall auf die Tankstelle von der saarländischen Polizei in ein Flugzeug verfrachtet und abgeschoben worden. Kurz nach ihrer Ankunft in Bosnien starb sie. Die Geschwister waren außer sich. Thomas wollte jeden deutschen Polizisten umbringen. In seinen Augen war er ein Versager, der seine Mutter nicht hatte beschützen können. Er war kein Mann. Er war ein Weichei. Ohne Ehre, ohne Kraft, ohne Mut. Er stürmte in seiner Verzweiflung eine Polizeiwache und beschimpfte die Polizisten.
»Ich töte euch.«
Aus einem Streifenwagen stahl er angeblich während einer Demo einem Polizisten die Dienstpistole. Bewiesen war gar nichts. Es waren Behauptungen.
»Der hat doch auch eine Tankstelle mit einer Pistole überfallen. Klar war der das. Und hier hat er Kollegen bedroht.«
Man hatte Thomas Bosic auf einem Video identifiziert, das die Polizei von der Demo gemacht hatte. Wahrscheinlich war Thomas einfach so mitgelaufen. Demonstrieren war nicht unbedingt seine Sache. Der Polizist bekam ein Disziplinarverfahren an den Hals. Wieso lag die Pistole griffbereit im Dienstwagen? Der Polizist war stinksauer. Die ganze Polizei fühlte sich von Thomas Bosic vorgeführt. Man suchte ihn. Und was wohl machte Lea, diese Zarte, Liebe, diese Unzerbrechliche? Ich wusste es nicht. Ich beschloss, Barbara anzurufen. Ich hatte mich lange genug um dieses Gespräch gedrückt. Es musste ein Ende haben. Ich fühlte mich erleichtert und bestellte bei Doris noch einen Cappuccino.
»Mir auch einen«, sagte eine Stimme und setzte sich zu mir.
Mein Gott! Nahm es heute denn überhaupt kein Ende? Erst diese beiden Ganoven, und jetzt diese leibhaftige Fledermaus an meinem Tisch. Meine Leib- und Magen-Psychologin, die mir seit Jahren zusetzte, nachdem ich ihr von mir erzählt hatte. Ich war sturzbetrunken damals. Seitdem war ich ihr bevorzugter Sanierungsfall.
»Erst musst du mal beziehungsfähig werden. Aber das kriegen wir schon hin. Alles andere kommt von alleine.«
Ich wollte mir auf keinen Fall vorstellen, was von alleine kommen würde. Lebenslanges An-sie-gekettet-Sein. Sie trommelte immer mit ihren langen, krallenartigen Fingernägeln auf die Tischplatte. Geierkrallen, die in filigran gehäkelten, hauchdünnen schwarzen Handschuhen steckten. Ein Hauch von Gespinst, auf dem Ringe funkelten. Stil hatte sie. Auch jetzt trommelte sie. Ratatatata. So wie Buschmänner trommelten, um die Geister und den bösen Zauber aus ihren Hütten zu vertreiben. Sie hatte lange schwarze Haare und sah ein bisschen aus wie Juliette Gréco mit Magersucht. Sie trug immer einen langen, schwarzen Ledermantel. Sie huschte durch die Gegend wie eine Fledermaus. Geräuschlos, blitzschnell suchte sie ihre Opfer, um sie auszusaugen. Sie trank den Seelenschmerz anderer wie Vampire Blut.
»Fritz, das tut dir doch gut, wenn ich dir zuhöre.«
Sie schaute mich an. Von ihren Wimpern bröckelte Wimperntusche. Kleine Bröckchen. Sah aus wie Fliegendreck.
»Was ist denn mit dir passiert!«, fragte sie und schlug die Hände ineinander.
»Ich hatte eine Begegnung.«
»Fritz, wieso passiert das immer nur dir?«
»Keine Ahnung.« Vor mir auf der Tischplatte lagen die Chipkarten. Ich wollte sie wegstecken in meine Hosentasche. Sie war schneller. »Maria, her damit!«
Was sie mal hatte, rückte sie nicht wieder raus. Sie hatte einen kleptomanischen Zug. Sie fächerte die Chipkarten auf wie Spielkarten.
»Woher hast du die?« Sie mischte die Chipkarten, um sie wieder aufzufächern. Sie runzelte die Stirn. Dann warf sie die Chipkarten auf den Tisch und beugte sich über sie wie eine Hexe beim Studieren von Zauber und Verwünschung. Gleich würde Rauch aufsteigen und sie mit mir auf einem Besen wegfliegen.
»Willkommen im Club«, sagte sie und wühlte in ihrer Handtasche. Sie förderte einen Füllfederhalter, ein kleines Notizbuch und einen Haftnotizblock zutage. Sie blätterte in dem Notizbuch und schrieb jeweils sechs Namen und Adressen auf eine Haftnotiz, die sie dann auf je eine der Chipkarten klebte.
»Das hilft dir weiter«, sagte sie und gab mir die Chipkarten zurück. Sie machte mich neugierig. Sie schaute mich mit ihren wässrigen, algengrünen Augen an. »Also wenn du nichts sagst, gehe ich mal.«
Sie machte Anstalten, sich zu erheben. Das Luder. Sie wusste genau, dass sie mich an der Angel hatte. Ich war mir unsicher, ob sie keine Show abzog und mich nur bluffte, um zu erfahren, woher ich mein blaues Auge hatte. Sie war trickreich im Ergattern intimer Nachrichten. Die waren der Klebstoff, mit dem sie Menschen fest an sich band, um sie auszusaugen. Sie spann unsichtbare Netze. Sie wusste über fast jeden am Stutti alles. Ein Vampir mit dem Elan einer behänden Spinne. Es würde mich nicht wundern, wenn sie zu Hause in einem Geheimarchiv eine Datei über die Anwohner rund um den Stuttgarter Platz führen würde. Mit allen Amouren, Intrigen, Fehltritten, Betrügereien, Süchten, Skrupeln, Gemeinheiten, Klatschereien, Verleumdungen, üblen Nachreden, Neidexzessen, Skandalen und Eifersuchtsdramen, zu denen jedermann mehr oder weniger fähig war. Meistens saß sie im ›Lentz‹. Oft alleine. Sie musterte die Anwesenden. Dabei trommelte sie mit den Fingern. Manchmal beidhändig, manchmal einhändig. Trommelte sie einen Wirbel, war das eine Ankündigung. Der Wirbel brach ab, sie erhob sich und setzte sich an einen anderen Tisch, um mit den Gästen dort ein Gespräch zu beginnen. Es ging dabei immer um etwas ganz Bestimmtes. Es war nie einfach mal eine Plauderei oder ein Scherzen.
»Jetzt bleibe mal sitzen.«
Sie setzte sich wieder. Ich schaute mir die Zettel an, die sie auf die Chipkarten geklebt hatte. Sie hatte eine gestochen scharfe, schöne Schrift. Es waren die Adressen von fünf verschiedenen Arztpraxen in Berlin.
»Aha. Und wieso hilft das ausgerechnet mir weiter? Ich habe damit nicht das Geringste zu tun.«
Sie zog die Stirnfalten kraus. »Du bist an der Reihe.«
Jetzt war sie am Drücker. Ich musste ein bisschen was erzählen, um mehr von ihr zu erfahren.
»Mich haben heute Morgen zwei Kerle in meiner Wohnung überfallen. Sie suchten etwas in meinem Kühlschrank. Sie fragten mich nach diesen Chipkarten. Und nach einem älteren Mann, der mir gestern diese Chipkarten gegeben hat. Ich soll ein Rätsel lösen, sagte der Mann. Alles etwas sonderbar.« Ich schaute sie an. »Und jetzt kommst du wie bestellt und kritzelst mir diese fünf Adressen auf diese Zettelchen. Was soll das? Kennst du diese Herren etwa?«
»Nur den, der dir die Chipkarten gegeben hat.« Sie steckte das Notizbuch in ihre Tasche und drehte den Füllfederhalter zu. »Mehr weiß ich auch nicht.«
Ich holte tief Luft. »Was bindest du mir denn da für einen Bären auf? Ich zeige dir sechs Chipkarten und du ordnest denen fünf Adressen von Ärzten zu. Das ist doch wie abgesprochen.«
Sie erhob sich. »Du wirst das schon hinkriegen.« Sie ging.
»Ja, was denn? Verdammt noch mal!«, rief ich hinterher. Ihr schwarzer Ledermantel wehte um ihre Knöchel. Gleich würde sie abheben und im Zickzack einer Fledermaus über den Stutti fliegen.
Ich war es gewohnt, auf undurchschaubare Art Aufträge zu bekommen.Oft, ohne den Auftraggeber und das Warum zu kennen. Ich folgte einem unsichtbaren Ariadnefaden, der sich in mein Leben geschlängelt hatte, sich, oft quälend langsam, dann wieder in heftigen Sprüngen, zu einem dichten Netz verwob, Masche für Masche, von dem ich trickreich eingesponnen wurde wie in einen Kokon, der nicht wusste, welcher Käfer aus ihm schlüpfen würde. Ich hatte es, aus Gründen des Überlebens, als Kind gelernt, ein Warnsystem zu entwickeln, das mich alle Finten, Überfälle, Strangulierungen, Übergriffe, Grenzverletzungen, Nötigungen und Grausamkeiten meiner Umgebung voraussehen ließ, um ihnen zu entkommen. Es gelang nicht immer. Das waren schmerzhafte Erfahrungen, die ich unbedingt vermeiden wollte. Die Angst vor Schmerzen beflügelte mich, meine Vermeidungsstrategien zu verfeinern. Ich lernte es, den Attacken einen Tick voraus zu sein. Wie ein Bullterrier, der mit seiner feuchten Nase im Wind schnüffelte, die Ausdünstungen, Gerüche und Düfte des kommenden Schmerzes roch und darauf lauerte, dem Gegner an die Gurgel zu gehen, bevor es ihn erwischte. Die Angst vor dem Schmerz ließ mich ständig Grenzen überschreiten. Manche legten es mir als Größenwahn aus. Andere sagten, er kommt aus einer anderen Welt. Was sollte ich gegen mein Warnsystem tun, das wie eine zweite Haut auf meiner Haut lag? Ich betrat zum Beispiel das Gebäude einer Konzernzentrale, blieb stehen, schloss die Augen, und schon hörte ich die Fäden der Korruption, der Intrigen, des miesen Mobbings sirren wie die zu stark gespannten Seiten einer kostbaren Violine, die wieder klingen wollte. Voll, rein, das Herz erhebend bis in alle Ewigkeit. Es widerte mich an, alles Niedrige. Ich balancierte auf einem Hochdrahtseil. Meine oberste Regel lautete: Angreifen, wenn nötig, mit Brachialgewalt. Ich wurde nie direkt engagiert. Ich bekam einen Wink, eine Andeutung, einen vagen Hinweis, eine lose Spur, der ich zu folgen begann. Die ich aufdröselte. Diese sechs Chipkarten waren eine solche Spur. Da war ich mir sicher.
Was sollte ich jetzt tun? Ich könnte der Reihe nach die aufnotierten Arztpraxen aufsuchen und mich dort nach den Besitzern der Chipkarten erkundigen, in deren Besitz ich gelangt war. Viel erreichen würde ich damit nicht. Keine Praxis würde mir Auskünfte über einen ihrer Patienten geben. Die ärztliche Schweigepflicht ließ das nicht zu. Ich konnte mich als Patient ausgeben und eine der Chipkarten auf den Tresen legen. »Ich habs im Kreuz.«
Ich studierte die Chipkarten. Zwei waren von privaten Versicherungen, vier von gesetzlichen Krankenkassen. Es waren vier Frauen und zwei Männer. Die Männer waren 32 und 36 Jahre alt. Mit meinen 48 Jahren ging ich als 30-Jähriger in keiner Arztpraxis mehr durch. Bei allem Bemühen. Das fiel also flach. Eine der Frauen war uralt, 86. Was wollte die denn hier in meinem Sextett? Die beiden anderen Frauen waren 18 und 19 Jahre alt. Die dritte 26.Also noch jung. Alle waren gesetzlich versichert bei der AOK. Die uralte auch. Nur die beiden Männer waren Privatpatienten. Was sollte ich machen? Ich könnte zu den Krankenkassen gehen. »Mein Neffe hat seine Chipkarte verloren. Er ist beruflich verhindert. Er bat mich, bei Ihnen eine neue zu bestellen.«
»Da muss er erst mal eine Verlustmeldung ausfüllen. Ich gebe Ihnen ein Formular mit«, würde die Sachbearbeiterin sagen.
»Mein Neffe ist aber Legastheniker und des Schreibens nicht mächtig.«
Das schied also auch aus. Ich beschloss, Irina aufzusuchen. Sie hatte eine Agentur und schloss Versicherungen, Policen und Geldgeschäfte jeglicher Art ab. Sie war Russin und ein Schlitzohr der Sondergüte. Sie betätigte sich auch in Immobilien, womit sie viel Geld verdiente. Ihr Hobby waren alte Motorräder – »Komm, Fritz, machen wir Runde«, pflegte sie zu sagen –, und sie leistete sich ein nobles Antiquitätengeschäft in der Schlüterstraße, wo sie sich meistens auch aufhielt. Ich liebte sie. Sie war von erheblicher Leibesfülle, über einen Meter achtzig groß, trotzdem beweglich wie eine Sambatänzerin, und sie hatte herrlich langes, dickes schwarzes Haar, das sie durch ein Tuch zu einem Knoten bündelte. Das Haar fiel ihr kataraktartig bis zur Hüfte. Das Schönste waren ihre tiefblauen, großen Augen. Sie leuchteten, als hätte sich das Azurblau des Himmels über der Provence in ihnen versammelt. Ich wollte nie genau wissen, in welche Geschäfte Irina noch verwickelt war. Ihr gehörten in Charlottenburg mehrere Häuser. Ich hatte ihr vor Jahren aus der Patsche geholfen. Sie war einem Anlagebetrüger verfallen. Einer stockschwulen Tunte, einer Nippesfigur mit silbergrauem Toupet, der um sie herumscharwenzelte wie ein wild gewordener Auerhahn. Irina gurrte wie eine Taube und schwang ihre übermächtigen Arschbacken durch die Gegend wie ein Pfau sein Rad. Sie war wie von Sinnen. Ich hatte ihm seine Allüren und Absichten ausgetrieben, indem ich ihn hinter Gitter brachte. Es war ein Betrüger großen Stils. Ein echter Profi. »Werde ich dir niemals vergessen, Fritz. Warst du mein Retter.«
Irina thronte hinter ihrer erhöhten, mächtigen Kasse, einem Wunderwerk aus Bronze, Holz und Messing mit vielen Hebeln und Knöpfen und einem Läutwerk, das jedes Mal mächtig bimmelte, ratterte und schnarrte, wenn Irina den Preis der gekauften Ware eingab, der in großen Ziffern auf der Vorderseite des Ungetüms, unübersehbar für den Kunden, der wohl angesichts dieses lärmenden Ungeheuers jeden Preis bezahlt hätte, sichtbar wurde. Perfekt wurde dieses Szenarium, wenn die vielen Uhren in ihrem Laden, zeitmäßig exakt aufeinander abgestimmt, unisono auf einen Schlag schlugen. Uralte Kuckucksuhren mischten sich mit dem halligen Gongschlag einer viktorianischen Standuhr oder dem blechernen Gemeckere einer ordinären Küchenuhr aus dem Biedermeier. Es war herrlich schaurig. Eine Symphonie bester zeitgenössischer Musik, die jedes Trommelfell sprengte. Irinas Alter war schwer einzuschätzen. Sie hatte eine helle, glatte Haut.
»Fredericus!«, rief sie, als sie mich beim Eintreten sah. »Du vernachlässigst mich!« Sie wuchtete ihren massigen Leib von dem erhöhten Stuhl und walzte auf mich zu. Sie drückte mich an ihren mächtigen Busen, eine Brosche schabte über meine Nase, und ich hielt die Luft an wie bei einem längeren Tauchgang. Dabei tönte sie: »Welche Freude, welche Freude!«
Dann wurde ich erlöst. Wir setzten uns auf winzige Rokokostühle an einen ebenso winzigen Rokokotisch. Die Stühle hielten stand und ein Mädchen servierte Champagner. Das gehörte zum Standard. Dazu gab es getrüffelte Pralinen.
»Immer extra für dich«, sagte sie und schob mir eine in den Mund. Sie war köstlich. Irina kam immer ohne Umschweife gleich zur Sache.
»Was bringt dich zu mir, mein Held?«
Ich erzählte ihr alles und zeigte ihr die Chipkarten.
»Ich muss etwas über die Inhaber dieser Karten erfahren.«
Irina schaute sich die Karten an. »Oh oh!« Und wieder: »Oh oh!«
Ich nahm mir noch eine Praline.
»Mein kleiner Täuberich, wer hat dir denn das gegeben?«
»Na, dieser Herr.«
Irina legte eine der Chipkarten auf den Rokokotisch. »Der Mann von dieser Karte ist der Sohn eines Freundes von mir. Kommt er aus Riga. Eltern sind eingewandert vor zehn Jahren nach Berlin. Sohn vor einem Jahr. Ist seit einem Vierteljahr spurlos verschwunden. Polizei unternimmt nichts. Sohn war Pathologe. Ich erkenne sein Geburtsdatum hier auf der Karte. Kann nur er sein. Großes Elend in der Familie. Alle anderen Karten kenne ich nicht. Ich rufe mal bei Versicherungen an. Kennen mich doch alle. Aber wie kommt diese Karte von Sohn zu dir? Erste Spur seit drei Monaten. Eltern verzweifelt. Merkwürdig.« Sie erhob sich und verschwand in ihrem Büro. Ich hörte ihre Stimme, wie sie telefonierte. Ich schaute mich um. Irinas Laden funkelte. In Vitrinen lagen auserlesene Colliers, Ringe, Broschen; von der Decke hingen herrliche Lampen, kristallene Lüster, die glitzerten und strahlten, überall hingen und standen Spiegel, die diese glänzende Pracht hundertfach widerspiegelten und die mich magisch anzogen. Ich stellte mich vor einen Wandspiegel und sah mich in anderen Spiegeln widergespiegelt. Wer von diesen glänzenden Spiegel-Ichs war mein wahres Ich? Natürlich wusste ich es. Es nicht zu wissen, wäre aber viel schöner. Ich drehte mich um meine Achse und schloss die Augen. Mir wurde schwindlig.
Irina kam zurück. Noch benommen von meiner Dreherei, setzte ich mich wieder auf den Rokokostuhl. Irina klemmte sich in ein Sesselchen. Ihr Hintern drohte, die mit Blattwerk filigran verzierten Holzlehnen des Sesselchens wegzusprengen. Die Blätter hielten stand. Sie ließ sich von der jungen Angestellten ein Likörchen bringen. Ich bekam einen Espresso mit einem spanischen Weinbrand.
»Es ist tatsächlich Pavel Schäfer aus Riga, wie ich gesagt habe. Der verschwunden ist. Der andere junge Mann ist ein Dialysepatient. Wartet seit vier Jahren auf Niere. Habe ich hier seine Wohnadresse. Alte Frau lebt in Altersheim. Ist oft auf Intensivstation. Immer wieder winziges Restleben auf winzig kleiner Flamme. Sie kann nicht sterben. Kriegt sie Reanimation. Vollbremsung vor dem großen Crash. Hier die Adresse von Altersheim und Intensivstation. Jetzt bitte hör zu. Klingt nach Knaller. Erika Fromm. Ist gestorben vor halbem Jahr an Verkehrsunfall, Motorradunfall. Wieso gibt es immer noch Chipkarte von ihr? Und nu Superknaller: Andere Frau auch tot. Anna Wuttke. Auch Verkehrsunfall, mit Fahrrad.Vor vier Monaten. Beide Frauen lebten bei den Eltern. Habe ich Wohnadressen von allen Leuten hier aufgeschrieben. Und hier ist noch Martha Auler. Eine Borderlinerin. 32 Jahre alt und schon Seelenknacks. Hat sie keine Adresse wie der Dialysepatient. Musst du alles gucken.« Sie gab mir den Zettel mit den Anschriften der Karteninhaber. »Ist dir aufgefallen, dass die beiden toten Frauen bei gleicher Ärztin waren? Hier, schau mal auf Notiz von deinem Vampir.«