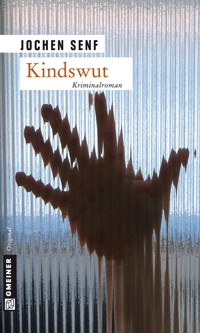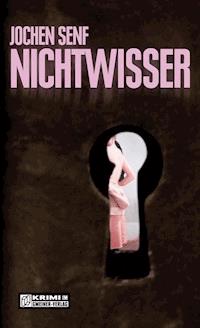
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fritz Neuhaus
- Sprache: Deutsch
Fritz Neuhaus, ein kleiner »Schnüffler« und Moralist aus Berlin, gerät unversehens in eine heikle Lage. Sein chaotisches Leben ist schon schwierig genug; seine Kindheitserinnerungen und seine verkorkste Mutterbeziehung tun ein Übriges. Als dann noch eine geheimnisvolle rothaarige Frau auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse: Die Rothaarige ist eine Agentin von Interpol und hat Kenntnis von mysteriösen Vorgängen in einem Flüchtlingslager nahe Saarbrücken. Ausgestattet mit einem Koffer voll brisanter Inhalte schickt sie Fritz Neuhaus in eine »Schlacht« mit ungewissem Ausgang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Senf
Nichtwisser
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © www.sxc.hu
ISBN 978-3-8392-3308-5
1
Vor wenigen Tagen war ich noch wohlauf. Ich trank morgens meinen Milchkaffee am Stuttgarter Platz in Berlin in meinem Stammlokal ›Dollinger‹ und las die Zeitung. Im ›Dollinger‹ gab es eine vorzügliche Küche bei moderaten Preisen. Den ›Patron‹ Jean, einen Franzosen und echten Piraten aus der Bretagne, hatte es an die Spree verschlagen. Ihm ging kein Wein aus dem Weg. Jean war Fischexperte. Sein Loup de Mer auf Wurzelgemüse mit einem Safrandip und Kroketten war köstlich. Eine Freude, wenn die frischen Austern aus der Bretagne morgens in viereckigen Körben, aus denen Wasser tropfte, entladen wurden. Gezackte Algenspitzen drängelten sich bräunlich-grün und fleischig glänzend, noch nass vom Meer, zwischen den Korbritzen. Der Stutti roch nach salzigen Wellen, als hauchte eine Seeprise vom Meer her über den Platz. Das ›Dollinger‹, ein Geheimtipp der Berliner Gastronomie, der seinesgleichen suchte.
Jetzt war alles anders. Ich wusste ohne Scherz nicht, ob ich die nächsten Stunden oder Tage überhaupt überleben würde. Es ging um Kopf und Kragen. Ich lebte mit der Verzweiflung eines Menschen, der eine Flaschenpost in die Wogen des Atlantiks warf, in Gischt sprühende Brecher, die auf mich zurasten, um mich zu verschlingen, mit der schmalen Aussicht, dass irgendein Mensch in dieser Wasserwüste, dass ein Leser den Brief, in dem ich um mein Leben schrieb, finden, öffnen, lesen und verstehen würde. Sie werden längst begriffen haben, lieber Leser dieser Zeilen, dass es das alles gar nicht gab, nur in meinen Gedanken. Sie waren die aussichtslose Hoffnung des Verfassers einer Flaschenpost. Aber ich wendete mich in meiner Fantasie und Verzweiflung lieber an eine nicht existierende Person als an überhaupt niemanden. An welches Gestade wird die gläserne Post treiben? In die richtigen Hände? Aber was waren die richtigen Hände? Mein Leben war allen Händen entglitten.
Vor vier Tagen war mein Weltbild noch heil. Jean servierte mir Austern mit Sauce Vinaigrette. Ich ruhte in meinem Weltbild wie in sämig geschlagenem Kartoffelpüree, frisch serviert mit gebratener Boudin. In einem Schälchen wurden in Speck gebratene Zwiebeln serviert, die ich über das Kartoffelpüree goss.
Das Bild war restlos zerbrochen. Als hätte man einen Spiegel fallen lassen, in dem ich mich gerade eben noch heil, Austern schlürfend, erblickte, das Glas mit kaltem Muscadet hebend. Nun, tausendfach zersprungen, wurdeich aus vielen Spiegelsplittern widergespiegelt bis zum Schwindligwerden. Ich fühlte mich nach all dem, was mir in den letzten Tagen widerfahren war, als hätte sich ein fremder Stachel in mich gebohrt, der geisterartig fremd in mir hauste, mir die Sinne zerfetzte, als hätte eine böse Mutter ihren kalten Blick in mich gesenkt bis zur Vereisung. Wie sonst konnte man das ertragen, was ich in letzter Zeit zu ertragen hatte? Aber wie kam ich auf meine Mutter?
Ich wendete mich an einen Leser meines in Gedanken geschriebenen Berichtes, um zu überleben. Was mich durchaus erheiterte. Es gab diesen Leser ja gar nicht!
»Hallo, Sie da«, sagte ich in der S-Bahn in Berlin zu meinem Gegenüber, »könnten Sie mir einen Gefallen tun? Hauen Sie der Rothaarigen neben Ihnen eins auf die Nuss! Dem Luder. Trauen Sie ihr ja nicht über den Weg!«
»Da ist niemand«, sagte mein Gegenüber. »Eben«, sagte ich. »Tun Sies trotzdem.«
Diese Rothaarige existierte. Mit ihr fing alles an. Im ›Dollinger‹. Noch ein Momentchen Geduld. Erst muss ich die Präliminarien klären. Erzähle mir keiner etwas von Zufällen! Meine Mutter! Eine Schlingpflanze, ein Geier mit scharfen Krallen, die ihren dolchartigen Schnabel ins Söhnchen hackte.
Ich hatte schon immer das Gefühl, in alle vier Winde zerstreut zu sein. Ähnlich meiner Großmutter, die auch die zersprungenste Tasse wieder zusammenklebte. Mit unendlicher Geduld klaubte sie jeden Tassen- oder Tellersplitter und jede Scherbe vom Boden auf, auf dem die Tasse zerbrochen war, als handele es sich um eine Kostbarkeit aus fernen Zeiten. Mit spitzen Fingern führte sie die Uhutube entlang den Bruchrändern, feine Uhufäden zogen sich von Splitter zu Splitter, überzogen schließlich spinnennetzartig die Finger meiner Großmutter samt den zusammenzufügenden Bruchstücken, bis sich schließlich aus diesem Knäuel von Fäden, Fingern und Splittern eine neue Tasse herausbildete wie aus einem Kokon. Ganz behutsam setzte sie die neu zusammengefügte Tasse auf den Tisch, zupfte noch an diesem oder jenem Fädchen, bepustete alles, »damit es trocknet«, sagte sie. Wie vermisste ich meine Großmutter! In diesem bunkerartigen Bauch eines Walfischs!
Den Menschen, von denen ich erzählen werde, erging es weitaus schlimmer als mir. Ich war nur Zuschauer. Das bloße Zuschauen genügte, um mich in die Situation auf Leben und Tod zu bringen, in der ich war. Nur war ich mir nicht sicher, ob die Gründe meiner jetzigen bedrohlichen Situation nicht tiefer und weiter zurücklagen und ob ich solche Situationen, wie unter einem Zwang stehend, nicht immer wieder heraufbeschwörte. Ich könnte sie ja vermeiden.
Man sagte, Menschen suchen sich Menschen nach dem Muster aus, nach dem sie auch gestrickt sind. Wer strickt, häkelt nicht.
Das sagte auch meine Großmutter beim Kleben ihrer Tassen: »Gleich und gleich gesellt sich gerne!«
Das meinte sie abwertend. Ihren Mann meinte sie, meinen Großvater, »der ein Filou war«, sagte mein Großonkel, der Bruder meiner Großmutter, ein Pferdeschmied, der Brauereigäule im fernen Saarland behufte. Für die Geigenkünste meines Großvaters hatte er wenig übrig. Dieser Großvater, ein Geiger auf der Durchreise im Saarland, überraschte meine Großmutter im Heu, das sie ungeschwängert nicht verließ. Meine Mutter war das Ergebnis dieser Kurzweil. Der Vater schnell über alle Berge.
Da war kein Himmel voller Geigen hinterher, da war harte Zucht. Das Leben meiner Mutter ein einziger,verdächtiger Heuhaufen voller Unzucht, derer sie verdächtigt wurde ohne jeden Anlass. Das Schicksal ihrer Mutter, meiner Großmutter, sollte ihr erspart bleiben. Der Heuhaufen wurde immer wieder und wieder gewendet. Kein Fädchen Pferdehaar vom Fidelbogen oder vergleichbar Verwerfliches sollte darin sein. Ein mütterlicher Scherbenhaufen von Anfang an in meinem Leben, den auch meine Großmutter nicht mehr kleben konnte. Vielleicht hoffte meine Großmutter, mit dem Kleben von zerbrochenen Tassen, immer wieder und wieder, sich ein neues, vergebliches Glück zu erkleben. Ein bisschen Lebensfreude zumindest, das ihr die Bitterkeit, die Erinnerung an den Filou vertrieb, der sich für immer in ihr Herz eingeschlichen hatte. Adieu, adieu. Oh, Schmerz!
Sie betrieb mit ihrer Tochter ein Pelzgeschäft. Beide waren Kürschnerinnen. In Saarbrücken im Saarland, wo die Hochöfen qualmten, in der Katholisch-Kirch-Straße, in einem uralten Handwerkerhaus mit steilem Giebel und einem roten Ziegeldach, das, einer brütenden Glucke gleich, das Haus bewachte. Gegenüber lag die schönste barocke Basilika, die von St. Johann, die ich je gesehen habe. Täglich strömten Orgelklänge durch die Altstadt und die Gesänge des Gemeindechores belebten das Ohr. Kein Bettler an der Pforte der Basilika kam zu kurz. Die alten Pflastersteine glänzten satt, bei Regen oder Sonne.
Gleich und gleich gesellte und gesellt sich gern. Wie die Mutter, so die Tochter. Da half kein Die-Stecknadel- im-Heuhaufen-Suchen! Die Nadel machte, was sie wollte! Zwischen Himmel und Erde geschah es. Auf dem Maifest unten an der Saar auf den Wiesen. Auf einer Schiffschaukel. »Wollen wir mal gemeinsam?«, fragte der Bremser des Schiffschaukelunternehmens, ein sehniger, schwarzhaariger Mann mit feurig blauen Augen. Da war alles klar. Meine hellblonde Mama mit den Sommersprossen auf der Nase kletterte mit dem Bremser in die Schiffschaukel. Ein Wippen und Heben, ein immer mächtiger werdendes Hin und Her, ein Steigen und Schwellen hub an. Zwischen Himmel und Erde, bei einem Überschlag, die Beine stachen gemeinsam ins blaueste Blau, die Schenkel pressten sich, musste es passiert sein, die Blicke in die Augen, die sich verzehrten. Da war kein Bremsen mehr. Ich entstand. Im Schatten einer frisch gebundenen Strohgarbe an den Ufern der Saar auf einem frisch gemähten Weizenfeld. Wo die Stoppeln in die Rücken stachen.
»Hat das gestochen«, kicherte meine Mutter immer nach dem dritten Cognac, den sie über alles liebte. Der Bremser war am nächsten Tag verschwunden. Was solls! Meine Mutter war nie ein Kind der Traurigkeit.
Ich könnte meine Kindheit nicht beschwören. Ich bastelte sie mir zusammen aus Bruchstücken, Aufgeschnapptem, aus Zwängen, Ängsten und Erfundenem. Ich liebte das Leben als Puzzle. Ich war süchtig danach. Je undurchsichtiger, vager, ungenauer, desto besser. Eine Fülle von Verdachtsmomenten, Verdächtigungen, Denunziationen, Unwahrscheinlichkeiten, unbewiesenen Behauptungen, Ausrastungen, Aufwerfungen, Intrigen, Gemeinheiten, Deformationen und Zerstückelungen an den Bruchstellen von jedweder Existenz verwandelten mich in einen Bullterrier, der, einmal zugeschnappt, sich verbiss, immer tiefer ins Gewebe drang, mit schnüffelnder Nase auf der Fährte ins tiefste Blutsich vorarbeitete, die Muskeln durchtrennte, in beißsüchtige Trance geriet, mit tiefem Knurren die Beute schüttelte und fetzte und nie mehr losließ, bevor nicht alles klar beschieden war. Nichts war klar beschieden. Das war es nie! Aber ich wollte es! Jetzt unbedingt!
Hin und wieder ertappte ich mich bei einer stillen Wut. Aber auf wen und auf was? Auf meine Mutter, die mich zwischen Himmel und Erde, beim Auf und Ab einer Schiffschaukel, auf einem Stoppelfeld empfangen hatte?
»In der Ferne hörte man das Rattern der Berg- und Talbahn, das schrille, aufnervende Kreischen der Frauen, die Stimmen der Losverkäufer. Der Hochofen glühte rot im Nachthimmel«, sagte meine Mutter. »Ich zerkratzte ihm mit den Fingernägeln den Rücken. Ich zerbiss ihm den Mund. Er heulte zum bernsteingelben Mond wie ein Wolf. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich mit ihm gegangen.« Sie schwieg. »Eine Frau liebt immer nur einen. Egal, wie viele danach kommen. Das ist auch schön. Aber eine Frau liebt immer nur einen.« Sie musterte mich. Dann sagte sie, schon leicht beschickert: »Du siehst ihm nicht ähnlich mit deinem blonden Büschel auf dem Kopf. Vielleicht bist du gar nicht von ihm«, und goss sich noch einen kleinen Cognac ein. »Blond war der Nächste. Ein Konditormeister.«
Eine Bachstelze fing wippend Fliegen, fing Fliegen, wippend. Ihr Flug passte sich dem Zickzack der Fliegen an. Wippend kriegte man die Fliegen schneller. Ich wurde zur Bachstelze und fing wippend die Fliegen im Haus. Es klappte. Ich wusste nicht, warum ich zur Bachstelze wurde. Seitdem hatte ich einen wippenden Gang. Manchmal hüpfte ich richtig. Vor Freude oder vor Trauer. Oder einfach des Wippens wegen. Ich musste nicht wippen. Oder? Das Wippen erzeugte, je nach Geschwindigkeit und Wipphöhe –, ob nur ein leichtes Anheben des hinteren Fußballens oder ein jähes Hochschnellen auf die Fußspitzen –, einen angenehmen Schwindel, einen Rausch im Kopf, den ich je nach Bedürfnis – oder soll ich sagen: nach Bedürftigkeit? – entsprechend variieren konnte. Alles wurde unscharf, verschwamm. Wohligkeit breitete sich aus in mir. Ein Schwebezustand, bei dem ich dachte, bald hebst du ab wie ein Vogel, wie eine Bachstelze, und fliegst weg. Einfach so. Allem entfliegen. Wie gerne hätte ich das jetzt getan. Entfliegen.
Neben dem Pelzgeschäft lag die Wohnung. Parterre. Im Obergeschoss waren die Büro- und Lagerräume und die Arbeitsräume. Ich weiß nicht mehr, wie viele Angestellte meine Mutter hatte, die aus den Pelzen Mäntel, Jacken, Mützen und viele andere schöne Sachen machten. Es gab ein paar Kammern, in denen Kürschnergesellen wohnten. Im Haus war immer Leben.
Betrat man die Wohnung parterre, gelangte man ineinen langen, breiten Gang, von dem rechts und links die Zimmer, die große Küche, Vorratsräume und der Salon mit dem Kamin abzweigten. Der Gang mündete in einer französischen Verandatür, die in den Garten führte und die im Sommer aufgeklappt wurde. Licht flutete in den Gang, wenn die Sonne schien, und es roch nach Gras und Blumen. Ein großer Kirschbaum versperrte den Blick.
In diesem Gang stand ein mächtiger Berliner Schrank aus dem Biedermeier. Das polierte Birkenholz leuchtete hellgelb und funkelte, wenn die Sonne drauf fiel.
Dieser Schrank wurde meine Heimstatt. In ihn entfloh ich. Ich setzte mich in die Finsternis des Schrankes, in dem die Pelze meiner Mutter hingen. Nerzmäntel, Zobeljacken, Fuchsschwänze, Biberfellkappen. Kostbarkeiten. In kleinen Gefäßen waren rosafarbene Mottenkugeln zwischen die Felle gehängt. Diesen Geruch der Mottenkugeln trank ich in der Finsternis in großen Zügen. Bis zur völligen Benommenheit. Das war wie Wippen. Durch die Schlüssellöcher des alten Schrankes sah ich hinaus in den Flur. Kunden gingen vorbei, Gesellen mit Fellen beladen, während ich durch eines der Schlüssellöcher linste, besoffen vom Mottenkugelduft. Die Menschen, die ich im Kreisrund des Schlüsselloches wie durch ein Fernglas erspähte, waren so weit weg. Sie schwebten in Hüfthöhe vorbei. In dieser Höhe waren die beiden Türschlösser des Schrankes angebracht. Ich sah die Vorbeigehenden nur in Ausschnitten, bruchstückhaft. Schwebeteile, die ich im eng begrenzten Ausschnitt des Schlüsselloches sah. Menschliche Fragmente. Einen Unterarm mit Bauch, eine Handtasche, eine Hüfte mit Hand, selten einen Kinderkopf, einmal einen Blumenstrauß, dann eine schnüffelnde Hundeschnauze direkt vor dem Schlüsselloch. Einmal lugte ein Auge durch das Schlüsselloch. Ich fühlte mich ertappt in meiner lulligen Besoffenheit, hielt atemlos die Luft an. Das Auge blinzelte und verschwand. Kein Geräusch drang in den Schrank. Die Pelze schluckten jedes Geräusch. Schlüssellochstummfilm. Mottenkugelrausch. Jetzt kannst du rufen, so laut du willst, dachte ich, niemand wird dich hören. Dein Atem beim Rufen wird die stummen Bilder von Menschenteilen nur noch weiter wegtreiben wie der Wind den Nebel. Nebelfetzen. Menschenfetzen. Geister.
Dann lief in meinem Schlüssellochkino die Priesterweihe, der Hauptfilm. Ich nenne ihn so, weil darin der Priester aus der barocken Basilika schräg gegenüber unserem Haus, ganz jung noch und italienischer Abstammung, ein schöner Mann, und meine Mutter die Hauptrolle spielten. Zuerst tauchte meine Mutter in meinem Schrankkino auf. Ihr Po. Und ihre Hand mit dem schweren silbernen Armreif. Die Hand eines Mannes tauchte auf und die aufgesetzten Taschen seines schwarzen Jacketts. Der Mann hüstelte, als hätte er einen Pfropfen im Hals. Am Hüsteln erkannte ich den Priester. Das Hüsteln war sein Tick. Seine Hand legte sich auf den Po meiner Mutter. Die Hand verschwand, den Po betastend, abwärts. Tauchte wieder auf im Schlüsselloch, den Rock meiner Mutter hochschiebend. Bis zum Slip, den die Hand jetzt herunterschob, das weiße Fleisch jetzt, das die Hand knetete wie der Bäcker den Brotteig. Meine Mutter stöhnte. Der Priester hüstelte pirouettenartig ein langgezogenes Hüsteln. Ihre Becken schlugen, erst ganz langsam, immer schneller rhythmisch gegeneinander. Begleitet vom anschwellenden Stöhnen meiner Mutter und einem Hüstelstakkato, das an Tempo deutlich zunahm. Was machten die da? Ich dachte an die Antriebskolben meiner Spielzeugeisenbahn, wenn die Lok Fahrt aufnahm. Die Hand meiner Mutter befingerte jetzt den Hosenlatz des Priesters. Kurzer Filmriss. Hüfte, Po, Hosenlatz verschwanden. Jetzt das Geschehen wieder im Schlüssellochausschnitt. Fleischiger Kolben ragt aus dem Hosenlatz des Priesters, schiebt sich zwischen die hellweißen Schenkel meiner Mutter. Ein äußerst intensives Stöhnen und Hüsteln, ein vereinter, linear sich verströmender Dauerton im höchsten Diskant ohne module Schwankungen – dann ein helles Kinderlachen. Ein Ausruf meiner Mutter. Wieder Filmriss. Schlüsselloch leer. Kurz darauf segelte ein Regenschirm vorbei. Ein bunter Kinderregenschirm, schräg gehalten. Mit einem gelben Plastikentchen auf der Schirmspitze.
Dann geschah es. Es wuchs mir. Aus der Hose durch die Schranktür. Ein knüppelähnliches Gebilde, die Keule eines Rübezahls. Ich stemmte mich mit den flachen Händen gegen die Schranktüren, voller Angst vor diesem Gebilde, das mir völlig fremd war, voller Angst, mitgerissen zu werden durch das enge Schlüsselloch hinaus in den Gang, ins Haus. Schmerzende Härte! Die vielen Menschen im Haus! Die Kunden! Ich wusste nicht, wie und was mir geschah. Es ängstigte mich, was mir da übermächtig gewachsen war, nicht zu wachsen aufhörte, so schien es mir, und übermächtig nun zuschlug, den Gang zertrümmerte, die wertvollen Stiche von den Wänden riss, die Skulpturen – die Lieblinge meiner Mutter – zerschmetterte, in den schattigen Garten eindrang, in diese ovalrunde, südländische Idylle, in diese Blütenpracht, in dieses Bienengesumme, und dort alles kurz und klein schlug. Kurz und klein. Endlose Trümmer. Gefällte Palmen, das Gewächshaus, der Stolz meiner Mutter, zertrümmert, Katzen hingestreckt auf den Terrakottafliesen, Blutlachen, Vogelleichen im Geäst der dunkelschattigen Kastanien.
Noch heute bin ich befremdet über diese unaufhaltsame Wut, die offensichtlich ihren Ursprung in einem mir bis dahin unbekannten Unterleibsschlegel monströsen Ausmaßes mit der Härte einer Brechstange hatte. So jedenfalls kam es mir vor.
Kunden liefen durch den Gang an diesem Schrank vorbei, aus dem dieser gewalttätige Schlegel ragte. Wohin mit dieser Unübersehbarkeit? Sofort kam meine Mutter gelaufen. »Fritz, was machst du denn da Unanständiges?« Sie kam nicht. Die Kunden liefen achtlos vorbei, als ragte da nichts. Kein Ästlein. Kein Hälmchen. Nichts. Ich allein im Schrank. Das Auge am Schlüsselloch. Ich wagte es nicht, den schützenden Schrank zu verlassen. »Eine gute Mutter hat den Röntgenblick«, sagte meine Mutter immer wieder. »Ich sehe alles. Mir entgeht nichts.« Was würde sie sehen, wenn sie mich anschaute mit ihrem Röntgenblick? Würde sie wissen, dass ich sie und den Priester beobachtet hatte? Ohne genau zu wissen, was da passiert war. Es war bedrohlich, fremd. Ich wollte die Augen verschließen und alles vergessen: den Po, die Hand am Po, den Kolben zwischen den weißen Schenkeln, ein Ding, wie es auch mir wuchs.
Der Röntgenblick würde das alles sehen, die Hand des Priesters an ihrem nackten Po, das Ding, das mir wuchs. Es ihr zwischen die Schenkel hineinzurammen, war mein Begehren. Wieso gerade ich? Es hätte mir niemals wachsen dürfen, ich hätte es niemals sehen dürfen, ich hätte niemals diese Wut haben dürfen, ich hätte dieses Ding wegstopfen müssen, davon war ich, obwohl ich nicht wusste, warum, überzeugt. Das Ding in meiner Hose, alles, was ich gesehen hatte, sollte ewig Geheimnis bleiben. Kein Röntgenblick sollte in mein Geheimnis dringen.
Endlich verließ ich den Schrank. Es dämmerte schon. Ich eilte fieberhaft durch das Haus. Halleluja! Gebenedeit sei die Jungfrau Maria! Alles war unbeschädigt, die Bilder hingen, die Skulpturen standen, die Blüten dufteten, der Garten, die Seelenoase meiner Mutter, wie sie sagte, atmete betörend, die Katzen fläzten, die Vögel zwitscherten, die Kunden betasteten den weichen Pelz. Alles war intakt. Nichts kaputt. Niemand war durchbohrt. Aus der Basilika tönte zur Messe mächtig die Orgel. Bestimmt war meine Mutter dort. »Der Priester hat so eine wunderbare Stimme«, schwärmte sie immer, wenn sie vom Kirchgang zurückkam. Das Geheimnis meiner Hose war unentdeckt geblieben. Ich war glücklich und erschöpft zugleich. Ich war fest entschlossen, dieses Ereignis, das mir die Hose sprengte, für immer im Schrank einzusperren. Ich betrat ihn nie mehr, in der Hoffnung, dass die berauschenden Ausdünstungen der Mottenkugeln das Zelluloid meines Schlüssellochfilms mit der Zeit zerfressen würden.
Manchmal, später, wenn ich an dem Schrank vorbeilief, dachte ich an den Film. Er wurde aber blasser. Zersetzte sich. Im Übrigen gab es neue Filme. Cineastische Ereignisse, vor denen dieser Kinderfilm verblasste. Davon wusste ich aber noch nichts.
Heute gibt es in den Apotheken und Drogerien keine Mottenkugeln mehr, außer in großen Fünfkilobehältern. Damit könnte man Schrankkollonaden füllen. Geheime Höhlen der Lust und des Rausches. Aber Mottenkugeln können mich heute nicht mehr berauschen.
Jahre später, kurz vor dem Abitur, erkundigte ich mich in einer Apotheke am Markt nach Mottenkugeln. Ganz beiläufig. Ich genierte mich. Das Verlangen war plötzlich wieder da, nachdem ich es im Schrank doch für immer eingesperrt hatte. Es gab keine Mottenkugeln mehr. Es gab Lavendelsäckchen und geruchloses Papier gegen Motten. Ich war wieder wie besessen von Mottenkugeln. Ich verließ die Apotheke dann sehr schnell, wenn ich wieder nach Mottenkugeln gefragt hatte und es keine gab. Schimpfte mit mir, hielt das alles für ein kindliches Überbleibsel. Aber immer wieder überfiel mich eine Sehnsucht nach dem Geruch dieser Mottenkugeln zwischen den Pelzen meiner Mutter, die sanft meine Wangen umschmeichelten und kitzelten. Wo mir zum ersten Mal die Lust kam. Angesichts der Hand des Priesters am Po meiner Mutter, der er seinen Speer in den Schoß rammte. »Der Priester hat einen Speer, Fritzi, wusstest du das?«, kicherte meine Mutter bei einem Cognäcchen wenige Tage nach dem Stummfilmereignis Priesterweihe. Ich wusste natürlich nichts. Meine Mutter gickelte nur wie ein beschickertes Hühnchen und goss sich noch einen Cognac in den Schwenker. Ich wusste jetzt, dass sie nichts wusste. Ihr Röntgenblick hatte damals versagt. Oder wusste sie doch, oder wussten beide, dass ich im Schrank meinen einäugigen Blick durch das Schlüsselloch spannte?
Meine Mutter raschelte immer. Sie trug seidene Röcke und seidene Blusen. »Ich liebe Seide«, sagte sie, »die Königin unter den Stoffen. Sie kühlt die Haut. Sie prickelt. Prickelnde Gänsehaut. Schaurig schön«, scherzte sie. Meine Mutter war jung damals. Sie bekam mich mit siebzehn.
Jeden Nachmittag, bevor die Glocken der Basilika zur Messe läuteten, nahm meine Mutter ein Bad. »Kommst du?«, fragte sie. »Du bist doch mein kleiner Bademeister.« Es war mir immer peinlich, ihr zu folgen. Wenn uns jemand sähe? Meine Mutter entkleidete sich in meiner Anwesenheit im Schlafzimmer, an das das Bad angrenzte. Die Seide raschelte. Stück für Stück glitt sie von ihrem schlanken Körper und fiel zu Boden: der Rock, die Bluse, der Unterrock, der Büstenhalter. Spitze, feste Brüste, rosafarbene Brustwarzenhöfe. Sie löste den Strumpfträger. In kleinen Windungen der Hüfte, unterstützt von abgespreizten Fingern, wanderte das Höschen über ihre weißen, vollen Schenkel, entblößte das Schamhaar, diesen sanft geschwungenen Hügel, rutschte über die Knie, fiel auf ihre Füße, die sie anmutig, einen Fuß nach dem anderen, aus dem Höschen hob. Mit einer schnellen Bewegung schleuderte sie das Höschen, das mit dem Saum gerade eben noch an ihrer Zehe hing, fort. Dabei sah sie mich an. Ich wollte wegrennen und traute mich nicht. »Hebst du das Höschen für mich auf?«, fragte sie wieder und lächelte. Ich hob es auf und musste es über einen Stuhl legen. »Wenn ich mal alt bin und alleine, musst du mich beschützen«, sagte sie. »Du darfst mich nie verlassen.« Sie starrte einen Moment vor sich hin. »Alleine bin ich sowieso. Du kannst jetzt das Wasser einlassen.« Ich ging ins Bad und ließ das Wasser ein. Meine Mutter folgte. Vor einem Spiegel entfernte sie mit einer Pinzette von ihren Brüsten, ihrem Bauch, ihren Schenkeln Haare und kleine Unreinheiten. Ich stand am Rand der Badewanne und beobachtete sie. »Mach das Wasser nicht zu heiß«, sagte sie, »und vergiss das Badesalz nicht.« Ich streute Badesalz ins Wasser. Diese nackte Frau mit diesem straffen Po mit diesen Grübchen über den Backen knapp unter der schmalen Taille, die in einen geraden, muskulösen Rücken aufstieg, der in einen langen Hals mündete. Er war unter dem dichten, blonden, langen Haar nur zu ahnen, das, von keiner Haarnadel gehalten, den Rücken bedeckte. Es war meine Mutter, die an mir vorbeischritt zur Badewanne, mit diesem Lächeln, ein Lächeln mit Augen, mit dem Blick, der sagte: »Ich will, dass alle mich wollen.« Ein ganz zart gerötetes Lächeln, wie die im Garten gerade erblühten Pfingstrosen. Volle, rote Lippen waren es, die immer leuchteten unter dem hellblonden Haar meiner Mutter, die an der Badewanne stehen blieb, mit der Zehenspitze die Temperatur des Wassers prüfte, dieses dunkle Nest zwischen ihren Beinen, das sichtbar wurde, wenn sie das Bein hob, und dann das andere, und wenn sie dann langsam ins Wasser glitt. Für einen Moment schien sie vollständig abwesend. Sie ließ, auf dem Rücken liegend, im Wasser fast schwebend, die Wärme in sich eindringen. »Seifst du mir den Rücken ein?«, bat sie dann. Ich seifte ihren Rücken ein. Dann sagte sie – immer wieder sagte sie, Tag für Tag – zwischen den Schaumkronen ihres Badesalzes den Satz: »Kommst du?« Ich wusste, dass diese Aufforderung, zu ihr ins Bad zu steigen, folgen würde. Mich entkleiden meinerseits. Dann ins Wasser. Dennoch die bange Hoffnung, dass dieser Satz ausbliebe, und stattdessen beruhigt das Bad verlassen, beruhigt die Treppe hinuntergehen, die Straße betreten, in die Basilika gehen, der Orgel lauschen, die man durch das leicht geöffnete Badezimmerfenster hörte. »Kommst du?« Flüchten können, ganz weit, entfliegen, über die Grenzen der Stadt hinweg, über den Horizont hinaus, unauffindbar für diesen Satz »Kommst du?« Stattdessen sich entkleiden, ins Wasser zu ihr steigen, mit den Händen den Schaum fächern. Sie blies in ihn, Schaumfetzen stoben zu mir. Das Wasser schwappte leicht. Ganz leises Abtropfen der Wassertropfen von den Fingerspitzen ins Wasser, das Winken ihrer Hand mit einer winzigen Ungeduld. Sie benetzte mein Gesicht mit Wasserspritzern. Ich erstarrte, ich dachte mich ganz weit fort. Ich spürte die Hand, die sich ins Wasser zwischen meine Beine senkte, wo der erste Flaum sprießte. Ein sanftes, peinigendes Kraulen. Eine Steifheit, die nicht sein durfte. Mit der ich nichts zu tun hatte. Die Badezeit zog sich unendlich. Im heißen Badewasser dachte ich an tiefgefrorenes Fischfilet. Danach ging meine Mutter in die Basilika zur Messe, die der Priester hielt. Ich lag noch im Badewasser, bis diese Spannung nachgelassen hatte. Wie konnte ich all dem für immer entkommen? Mein Herz pochte.
Eines Tages reichte mir die Apothekerin am Markt ein Döschen. »Für Sie«, sagte sie. »Es kostet nichts.« Es war mittags. Die Sonne schien. Die Bistros waren voll, Stimmen überall, Rufe der Gäste, Begrüßungen und Hallo. Kellner in weißen Schürzen mit ihren Tabletts, die über die Köpfe hinwegsegelten. Ich hatte die Apotheke verlassen und öffnete neugierig das Döschen. Rosafarbene Kugeln schimmerten mir entgegen. Mottenkugeln. Ich wurde schamrot. Bestimmt hatte jeder die Mottenkugeln gesehen. Der St. Johanner Markt hielt den Atem an und die Menschen starrten auf mich. Ich ging mit geradem Rücken ganz beherrscht nach Hause, das Döschen in meine rechte Faust gesperrt. Ich ging in mein Zimmer, holte meinen Koffer vom Schrank, packte ihn und verließ Saarbrücken. Mit ein paar Mark in der Tasche trampte ich nach Berlin. Das war vor genau 30 Jahren. Ich war damals achtzehn, kurz vor dem Abitur, meine Mutter war 35. Ich hatte nichts. Nur mich. Ich habe meine Mutter seitdem nie wieder gesehen. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ich war nie mehr zu Hause. Als wäre es das nie für mich gewesen. Als wären meine Kindheit und Jugend eine undurchschaubare, nebulöse Angelegenheit. Ein schwarzes Loch, in das ich niemals fallen wollte. Das Döschen mit den Mottenkugeln hatte ich in den Mülleimer geworfen. Man kann seiner Geschichte nicht entkommen. Das merkte ich erst viel später. Jetzt. In diesem Augenblick.
2
Ich sah sie schon von Weitem. Erst als schwankendes Pünktchen, das sich näherte, aus dem Pünktchen wurde eine Frau mit einem Koffer, und bald leuchtete ihr brandrotes Haar in der Sonne. Sie trug ein hellbeiges Kostüm mit großen Perlmuttknöpfen, die in der Morgensonne silbrig blitzten. Sie bewegte sich schnurgerade auf mich zu. Der Koffer zog leicht ihre rechte Schulter herunter. Mit der linken Hand trug sie einen Aktenkoffer. Sie stellte den sichtbar schweren Koffer an der Kreuzung ab, verschnaufte, schaute in den viel zu teuren Italienerladen direkt an der Ecke, wo 100 Gramm entkernte schwarze Oliven acht Euro kosten, nahm den Koffer wieder auf und kam, immer noch gut 50 Meter von mir entfernt, mühsam auf ihren hochhackigen Schuhen stöckelnd, direkt auf mich zu, als wären wir verabredet. Es war genau in dem Moment, als ich, vor dem leeren ›Dollinger‹ sitzend – es war gerade neun Uhr morgens und die Bedienung namens Doris noch ziemlich verpennt –, als ich mir, mit dem ›Tagesspiegel‹ in der Hand, Sorgen um mich und meine Zukunft machte. »Doris, wo bleibt denn der Milchkaffee?«, rief ich.
Am Abend zuvor hatte mir eine am Stuttgarter Platz bekannte Psychotherapeutin, mit ledriger Haut bespannt wie eine Buschtrommel, im ›Lentz‹, einem 68er-Lokal, zum wiederholten Mal getrommelt, dass ich dringend einer Therapie bedürfe. »Ich brauche keine Therapie«, erwiderte ich. »Ich weiß«, sagte sie. Ihr Trommelschlag wurde jetzt ganz sanft und fast Moll, wie sie mit ihren Fingerspitzen auf die Tischplatte trommelte, was mich ziemlich nervös machte. Dieses Gehacke! Ich habe eine ausgeprägte Geräuschphobie entwickelt in Berlin, besonders gegen Pfeifen und Schmatzen, und sie schmatzt beim Sprechen. Nur leicht, aber sie schmatzt. Sie schaute mir mit ihren feuchtkalten Augen in die Augen: »Du brauchst eine Frau. Du kriegst aber keine bei deinen Blessuren. An ihnen musst du arbeiten.« Ihr Blick mit den aufgeklebten Wimpern, an deren Rand die Tusche bröckelte, sagte, dass sie es sein werde, die Tag und Nacht rund um die Uhr erst mit mir arbeiten und dann meine Frau werden würde. Ihr Mund spitzte sich und wurde ganz schrumpelig. Sie war Ende 30. Ich war froh, dass ich keine Titten habe, als ich ihr in den Ausschnitt blickte. Ich hatte ihr vor Jahren völlig betrunken von mir erzählt, nachdem sie sich als Therapeutin vorgestellt hatte. Ich musste ziemlich besoffen gewesen sein in dieser Nacht. Seitdem verfolgte sie mich. »Ich habe selten einen Mann erlebt, der sich so in eine Frau einfühlen kann wie du«, hatte sie an jenem Abend gesagt. »Man merkt es dir an, wie tief Frauen in dich gedrungen sind«, sagte sie. »Es wachsen Söhne ohne Väter heran. Muttersöhne sind die sensibelsten. Ein ganz neuer Typ Mann entsteht. Ein verweiblichter ohne Machogetue, aber ein Mann, dessen Haut sich über meine spannt wie ein schützendes Dach. Du brauchst Hilfe!« Ich meide jetzt das ›Lentz‹, obwohl die Buletten am Platz die besten sind.
Ich machte mir Sorgen, weil ich pleite war und tatsächlich schon lange keine Affäre mehr hatte. Vielleicht hing ja das eine mit dem anderen zusammen. Seit 30 Jahren lebte ich in Berlin nach dem Motto: Eine Minute vorher hatte ich es nicht gewusst, der Zufall kam um die Ecke, sagte Hallo und war da. Und alles lief von selber.
»Hallo«, sagte die Rothaarige, blieb etwa 10 Meter vor mir stehen, setzte erschöpft den Koffer ab, ein recht kompaktes Ding aus gelbem Rindsleder, und schaute mich an. Ich guckte hinter mich, ob nicht jemand hinter mir saß, den sie anschaute. Aber da saß niemand. Sie konnte nur mich meinen. Sie schaute mich immer noch an. Sie hatte hellgraue Augen. Es waren diese Augen, in die man ohne Absprache, ohne Vorwarnung, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, wie ins endlos Leere, ohne jeden Halt und Widerstand, hineinfiel. Ich fiel. Ich habe bis heute nicht aufgehört zu fallen. Ich war wehrlos. Ich bin gespannt, wo ich aufschlage. An eine geplante Ziellandung glaube ich nicht.
Doris brachte den Milchkaffee. Die Rothaarige stand neben ihrem Koffer.
»I need you«, sagte sie grinsend. »help me. Schön, dass Sie da sind.«
Ich stand auf, wie benommen, konnte es nicht fassen, dass sie mich meinte, ging zu ihr, nahm den wirklich sehr schweren, obwohl gar nicht so großen Koffer, ging zurück zu meinem Tisch, sie folgte mir, ich stellte den Koffer ab, sie blieb stehen, wir schauten uns an, ein Gefühl verzehrte mich wie sich schnell ausbreitendes Buschfeuer.
»Sie sind doch Fritz? Fritz Neuhaus?«, fragte sie.
»Ja« sagte ich und war nicht erstaunt, dass sie meinen Vornamen wusste, so, als träfen wir uns nicht das erste Mal, aber ich war neugierig, wieso sie meine Hilfe brauchte.
»Setzen wir uns doch.«
Wir setzten uns. Sie stellte den Aktenkoffer neben sich. »Ich nehme auch einen Milchkaffee. Mit einem Amaretto.« Ich ging ins ›Dollinger‹ und bestellte. Ich musste am Tresen tief Luft holen. Die mir bis dahin unbekannte Freude, die ich so unerwartet heftig plötzlich spürte, machte mich atemlos. Ich war unerklärlich aufgeregt. Es tat fast weh. Ich musste leise über mich lachen. Mann, Mann. Es hatte mich wie ein rasch aufgezogenes Unwetter erwischt. Ich wartete, bis Doris den Milchkaffee gemacht hatte, und nahm ihn samt dem Amaretto mit zu ihr an den Tisch. Wir tranken gleichzeitig. Die geschäumte Milch schmeckte weich und angenehm. Ich betrachtete die Frau, die aus der Ferne als rasch wachsender Punkt mit einem schweren Reisekoffer und einem Aktenkoffer in mein Leben getreten war. Sie trank in kleinen Schlücken und leckte sich den Schaum von den vollen, geschwungenen Lippen, die in den Mundwinkeln leicht nach oben anstiegen, sodass sie ständig von einem Lächeln umspielt waren. Sie nippte am Amarettoglas. Ihre Lippen schoben sich dabei wie dunkelrot fleischige Schnecken über den Rand des Glases. »Köstliche Melange.« Dann trank sie wieder ein Schlückchen vom Milchkaffee. Sie hatte eine helle, marmorne Haut mit ganz kleinen Sommersprossen.
»Aaahh«, machte sie und stellte die Tasse ab. »Das tut gut.« Sie wischte sich den Restschaum von der Nase, die durchaus prägnant war. Gerade und fest. Ebenso das etwas keck vorspringende Kinn unter dem vollen Mund, das das ganze Gesicht energisch stützte. Diese Frau strahlte Entschlossenheit aus. Am Gestade des ›Dollinger‹, wo Jean gerade von Meerwasser triefende Austern- und Krebskörbe auslud. Eine Piratin auf Kaperfahrt, mit der ich die Welt eroberte? Es roch nach Tang. »Wie in der Bretagne«, sagte sie, »in Concarneau. Sie waren auch schon dort. Da staunen Sie, dass ich das weiß.« Ich war oft in Concarneau, dieser alten Piratenstadt mit hohen, wehrhaften Festungsmauern. Ich sah die Frau an wie eine alte Bekannte. Sie sah mich an. ›Will mich‹, sagten die Augen, ›und du kriegst alles, was du willst, es hängt von dir ab.‹ Ich kannte diesen Blick und ich würde für sie alles tun, um ihn festzuhalten, bevor er entwischte. Für immer und unausweichlich. Mich fröstelte. Es würde kein Ende geben. Ich wusste es. Bestenfalls ein halb erträglicher Abschied. Eher Flucht in Panik, Hals über Kopf. Anschließend Vernichtung und Rückzug in höhlenartige Zustände mit narkotisierender Hektik. Es war mir egal. Wie immer es auch enden würde. Ich hatte gar keine andere Chance. Oder ich müsste mich aufgeben. Und diese Frau vor mir im ›Dollinger‹ morgens kurz nach neun war überwältigend. Ich wollte sie. Komme, was wolle.
»Woher wissen Sie das?«, fragte ich. Sie schaute auf die Uhr, als wollte sie bald aufbrechen. »Ich habe Sie studiert. Fritz Neuhaus, 48 Jahre, geboren in Saarbrücken, kam mit 18 mittellos nach Berlin, heute eine Mischung aus Schnüffler, Moralist, Zyniker, zerstört Firmen, saniert, was er zerstörte, aufkaufte, sich unter den Nagel riss, macht mit den gleichen korrupten Methoden, was seine Gegner tun: plündern, ausbeuten, vermehren. Ein Global Player, der nie zur Ruhe kommt, ständig auf der Flucht vor sich selbst.« Sie hielt inne und sah mich belustigt an. »Ich komme mit festen Absichten zu Ihnen. Sie sind mein Mann.« Sie hatte meine geheimen Verschlusssachen beschrieben. Sie verblüffte mich. Ich hielt mich ja für unsichtbar. Zumindest zu Teilen. Betrat jemand diesen Bereich, machte ich das steinerne Mondgesicht. Ich dachte an dünne Sicheln, die in den Nachthimmel schnitten. Scharf und spitz, ritschratsch, sensten sie im raschen Schwung von rechts nach links, ritschratsch, immerzu, die Nachtschäfchen im falschen Pelz weg. Schlitzten ihnen das Fell auf, legten den Wolf frei oder die Wölfin. Ich wusste, wie es ist, wenn die tollsten Sachen mich wider Willen unters Joch nahmen. Das ging niemanden etwas an. Nicht einmal mich. Ich hatte es in mir weggesperrt. Es führte ein wölfisches Eigenleben, dem ich möglichst unbeteiligt beiwohnte. Ein Ich im Ich, zu dem ich nicht ›Du‹ sagte. Jemand, der die Drecksarbeit für mich erledigte.
Sie fuhr fort. »Er verdient viel Geld damit, er ist ein Meister des Puzzles, des Aufspürens von Bruchstücken, des Zusammenfügens, des Herstellens von Zusammenhängen, die keiner vermutet; er ist einer, der sagt, das Interessante an der Korruption und der Gemeinheit ist nicht sie selbst, sondern das, was sie verbirgt. Die Fratze hinter dem Glamour ans Licht zerren. Dann erst lässt sie uns los. Oder wir kommen nie zur Ruhe und können uns bestenfalls betäuben. Fritz Neuhaus, der Anwalt und Bankier der Armen, Flüchtigen, Unterdrückten und Gestrandeten. Ich kenne Ihre Aufsätze.« Der Spott war unüberhörbar.
War das schon der Anfang vom Ende? Meine Freude zerbröselte. Warum nicht einfach mal die kleinen Sachen machen, die heiteren am Wegesrand, dachte ich und wusste, dass es kein Ende war, aber auch kein Anfang. Einfach den Koffer von ihr nehmen. »Ich habe lange auf dich gewartet, ich wusste, dass es dich gibt, die ganze Zeit. Komm, wir gehen«, sagte ich, und dann gingen wir, und der Koffer schlug mir gegen das Bein, und ich umfasste sie mit dem anderen Arm, tauchte mein Gesicht in ihr Haar und wäre am liebsten nie angekommen. Immer und ewig die Straße runter ohne anzuhalten. Nie ein Ende. Immer nur Anfang. Schritt für Schritt.
Jean hatte einen Korb voll lebender Krebse fallen lassen. Der Korb zerplatzte. Die Krebse krabbelten in alle Richtungen davon, die Zangen zwickten wahllos in die Luft, Tangreste hingen an ihnen, mit steilen Stielaugen suchten die Krebse das Meer. »Verfluchter Mist«, schimpfte Jean und begann, zwischen den Stühlen herumzukriechen, um die Krebse einzusammeln.
»Was verschafft mir das Vergnügen Ihres Interesses an meiner Person?«, fragte ich die Rothaarige, anstatt ihren Koffer zu nehmen und mit ihr ins Glück zu spazieren.