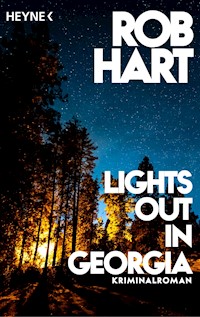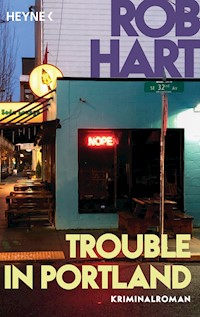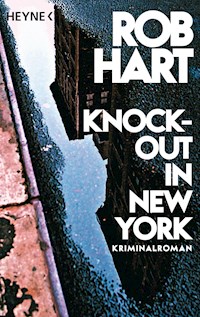
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die McKenna-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ash McKenna erledigt jeden Auftrag: sucht Vermisste, überbringt Drohbotschaften, macht gefährliche Botengänge. Barzahlung nach getaner Arbeit, aber manchmal tut es auch eine Flasche Whiskey. Nicht sein Traumberuf, aber er hält ihn in seinem geliebten East Village bei Laune. Bis ihm eines Tages Chell – die Frau, die er liebt – eine Voicemail mit einem Hilferuf hinterlässt. Eine Nachricht, die er erst abhört, nachdem ihre Leiche gefunden wurde. Ash macht sich feinfühlig wie eine Abrissbirne auf die Jagd nach dem Mörder und verwickelt sich immer mehr in die Machtkämpfe der New Yorker Hipster-Unterwelt. Als ihm klar wird, wer der Mörder ist, trifft er eine weitreichende Entscheidung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Ähnliche
Buch
Ash McKenna erledigt jeden Auftrag: sucht Vermisste, überbringt Drohbotschaften, macht gefährliche Botengänge. Barzahlung nach getaner Arbeit, aber manchmal tut es auch eine Flasche Whiskey. Nicht sein Traumberuf, aber er hält ihn in seinem geliebten East Village bei Laune. Bis ihm eines Tages Chell – die Frau, die er liebt – eine Voicemail mit einem Hilferuf hinterlässt. Eine Nachricht, die er erst abhört, nachdem ihre Leiche gefunden wurde. Ash macht sich feinfühlig wie eine Abrissbirne auf die Jagd nach dem Mörder und verwickelt sich immer mehr in die Machtkämpfe der New Yorker Hipster-Unterwelt. Als ihm klar wird, wer der Mörder ist, trifft er eine weitreichende Entscheidung …
Autor
Rob Hart hat als Journalist, als Kommunikationsmanager für Politiker und im öffentlichen Dienst der Stadt New York gearbeitet. Er ist Autor einer Krimiserie und hat zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht. Rob Hart lebt mit Frau und Tochter auf Staten Island.
Bisher erschien bei Heyne sein Bestseller Der Store.
ROB HART
KNOCK-OUT IN NEW YORK
Aus dem Amerikanischenvon Heike Holtsch
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelNEW YORKEDbei Polis Books, Hoboken
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2015 by Rob Hart
Copyright © 2020 der deutschen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © plainpicture/Thomas Marek
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24536-8V001
www.heyne.de
Für meine Großmutter Anna.
Irgendwie glaube ich, sie wäre von diesem Buch nicht begeistert. Andererseits war Oz – Hölle hinter Gittern auf HBO eine ihrer Lieblingssendungen. Und abgesehen davon, stolz wäre sie auf jeden Fall. Also, wer weiß? Jedenfalls ist es schade, dass sie es nicht mehr lesen kann.
»Die meisten Städte sind Nomen. New York ist ein Verb.«
John F. Kennedy
EINS
Ein jähes Krachen, und auf einmal bin ich wach.
Sonnenlicht scheint mir auf die Hände. Sieht aus wie verschütteter Whiskey. Eine weiße Wand. Eine zerwühlte blaue Bettdecke. Der Stiefel in meinem Gesicht drückt meinen Kopf auf den Holzboden.
Aber nein. Das muss vom Kater kommen. Dauert eine Weile, bis mir das bewusst wird.
Mein Nikotinspiegel ist im Keller. Ich brauche dringend eine Zigarette und einen Schluck Wasser. Dann weiterschlafen und so tun, als wäre nichts passiert. Und bloß nichts überstürzen.
Ich höre Rauschen und Knacken. Dann eine Stimme: »10-36 Code 2, Zehnte Ecke C.« Autounfall, drei Blocks weiter Richtung Osten, keine Verletzten, Ausrücken nicht nötig.
Ich bin also in meinem Apartment. So weit, so gut.
Irgendwo vibriert mein Handy. Eigentlich vibriert der ganze Fußboden. Es fühlt sich an, als würde mir jemand Nägel in den Kopf schießen. Ich will mich aufsetzen, schaffe es aber erst beim zweiten Versuch. Jede Bewegung schmerzt. Das Handy liegt hinter dem Nachttisch. Muss beim Vibrieren runtergefallen sein. Davon bin ich wohl wach geworden. Ich habe drei Sprachnachrichten.
Erst mal brauche ich frische Luft. Ich vergewissere mich, dass ich meine Hose anhabe, und klettere durch das Fenster auf den Absatz der Feuerleiter. Draußen ist es bitterkalt, und mein Kopf wird ein bisschen klarer. Jedenfalls weiß ich wieder, wo ich bin. Das ist ja schon mal was.
Dem Stand der Sonne und den Menschenmassen auf der First Avenue nach zu urteilen, ist es etwa vier Uhr nachmittags. Und es ist so eiskalt, dass ich am liebsten wieder reinklettern würde, um meinen Hoodie zu holen. Aber mit dem Kater wird mir jede Bewegung zu viel.
In dem rostigen Gitter über der Feuerleiter steckt eine halb volle Wasserflasche. Die ist von mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich öffne sie und trinke, während ich zuschaue, wie die Stadt ein- und ausatmet. Und ich zerbreche mir den Kopf darüber, was gestern Abend passiert ist.
Ich war in meinem Büro. Seit ein paar Wochen läuft irgendein Irrer hier rum, der es auf Frauen abgesehen hat. Begrapscht sie und haut dann ab. Aber erst, wenn alle Bars und Clubs geschlossen sind und sie allein nach Hause gehen. Und immer in der Nähe vom Tompkins Square Park.
Ich habe schon ein paar Aufpasser organisiert. Frauen, die zu Fuß nach Hause wollen, können anrufen und Begleitung anfordern. Hab auch einen Lockvogel losgeschickt: Ein hübsches Mädchen hat schon ein paarmal zwischen vier und fünf Uhr nachts ein paar Runden um den Park gedreht, mit Rückendeckung von einem Schlägertypen, der nicht lange fackelt. Feige, wie so ein Grapscher nun mal ist, reicht vermutlich ein einziger platzierter Schlag, und dann hat sich das Ganze erledigt.
Aber das ist schon eine Woche her, und seitdem ist nichts mehr passiert. Keine Spur von dem Irren. Ich war ziemlich frustriert, dass ich ihn noch nicht geschnappt habe. Also habe ich getan, was ich in solchen Fällen immer tue: mir eine Flasche Jameson gönnen.
Richtig erinnern kann ich mich nur noch bis zur Hälfte der Flasche. Danach ist alles verschwommen. Die Oberfläche des Tresens verzerrt durch den Boden leerer Gläser. Um mich herum Menschenmassen. Weiß gekachelte Wände von U-Bahn-Stationen. Dann der Holzboden in meinem Schlafzimmer.
Ich habe es immerhin bis in meine Wohnung geschafft.
Als ich mir den Schlaf aus den Augen reiben will, sehe ich, dass auf meiner Handfläche etwas geschrieben steht: Du hast es versprochen. Meine Handschrift, aber sonst fällt mir nichts dazu ein.
Wieder vibriert das Handy. Es ist die Mailbox. Ich tippe meine PIN ein, stelle auf Lautsprecher und lehne mich mit dem Kopf gegen die kalte Backsteinwand.
»Hi, ich bin es. Chell.«
Chell. Sie spricht ihren Namen so grob aus, als wäre er ein Schimpfwort.
Vielleicht soll er das ja auch sein.
Dann redet sie weiter. Langsam, kontrolliert. Als ob das, was sie sagt, eigentlich nicht das ist, was sie in Wahrheit sagen will. »Ich bin ziemlich sauer auf dich. Aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich hab das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Da ist so ein Typ, der war auch schon … Also, der ist mir unheimlich. Bin an der Vierten, Ecke B. Kannst du kommen und mich einsammeln? Nach allem, was passiert ist, sollten wir sowieso miteinander reden. Ich gehe jetzt zu deinem Apartment. Für den Fall, dass du zu Hause bist oder sonst irgendwo in der Nähe: Ich nehme die First Avenue. Kannst du mir ein Stück entgegenkommen? Bitte!«
Ich höre die zweite Nachricht ab. Erst nichts und dann ein Klicken.
Die dritte Nachricht ist von Bombay. »Wo steckst du, Alter? Mach den Fernseher an! Oder ruf mich zurück. Es ist wegen Chell. Sie ist tot.«
*
Auf NY1 läuft die Story in Endlosschleife. Von einem Helikopter aus zoomt die Kamera auf einen Schrottplatz im Jamaika-Viertel von Queens. Zwischen alten Autoreifen und Altmetall stehen Schaulustige auf der Brachfläche. Aber der Hubschrauber fliegt zu hoch, als dass man mehr erkennen könnte als die Farbe der Klamotten, die die Leute anhaben. Auf der Straße steht eine Armada von Polizeiwagen und dazwischen ein einzelner Krankenwagen, ohne Blaulicht.
Die Szenerie schrumpft zu einem kleinen Viereck neben einem Moderator, der auf betroffen macht und in getragenem Bariton berichtet, dass Chell auf diesem Schrottplatz gefunden worden sei, zusammengeschnürt mit Packband. Man gehe von einem sexuellen Gewaltdelikt aus, einen Verdächtigen gebe es jedoch noch nicht.
Er nennt sie bei ihrem vollständigen Namen.
Die Kaffeemaschine piept, um anzuzeigen, dass der Kaffee fertig ist. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, welchen aufgesetzt zu haben. Ich schenke mir einen Becher ein, stelle ihn in den Kühlschrank, um den Kaffee abkühlen zu lassen, und stemme die Hände gegen die glatte, weiße Oberfläche der Kühlschranktür.
Ich kann nicht mehr denken. Ich brauche eine Zigarette. Ohne eine zu rauchen, kann ich nicht klar denken.
Keine Packung mehr neben der Spüle. Wenn ich noch Zigaretten hätte, würden sie dort liegen. Im Aschenbecher auf der Fensterbank sind ein paar Kippen, abgeraucht bis zum Filter. Ich könnte zu der Bodega in der Nähe runtergehen, da gibt es alles, was man so braucht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die Tür zu öffnen und in eine Welt zu treten, in der Chell wirklich tot ist.
Keine weiteren Anrufe oder Nachrichten auf meinem Handy, aber was ich abgehört habe, klingt mir noch in den Ohren wie einer dieser grottigen Songs, die man nicht mehr aus dem Kopf kriegt.
Da verqualme ich zwei Packungen am Tag, und es ist nicht eine einzige Kippe da, die ich mir noch mal anzünden könnte.
Keine Zigaretten im Kühlschrank oder unter der Spüle oder im Badezimmerschränkchen. Auch keine Packung, die sich unter den Haufen Klamotten neben dem Bett oder hinter das Sofa verirrt hat. Ich ziehe die Schublade auf, in der meine Socken liegen. Was weiß denn ich, was mir im Vollrausch so einfällt.
Aber nein, außer Socken ist da nur ein dünnes Haargummi. Mit einem einzelnen roten Haar in der Länge, dass es Chell bis zur Schulter reichte.
Ich grabe die Fingernägel in die Handballen, bis ich kaum noch Luft bekomme. Ich lege die Arme um den Oberkörper, als könnte ich damit in mir verschließen, was mich fast zerreißt.
Chell ist tot.
*
Es war irgendwann im August, und es war so heiß, dass man den Teer auf den Straßen riechen konnte.
Wir wollten eine Sonnenbrille für dich kaufen. Was Brillen angeht, hattest du einen Tick. Sie mussten farblich zu deinen Haaren passen, die irgendwo zwischen Feuerwehrauto- und Flammenrot lagen.
Es gab nur zwei Optionen: Canal Street oder St. Mark’s Place. Letzteres lag näher, also klapperten wir sämtliche Straßenhändler auf dem kurzen Streifen zwischen der Zweiten und Dritten ab, vorbei an den asiatischen Touristen vor den Karaoke-Bars und den ewig Gestrigen, die noch nicht gehört haben, dass Sid Vicious längst tot ist.
Ich wollte nur noch in den Schatten, aber du in deinem schwarzen Tanktop, den dunklen Shorts und mit so weißer Haut, als hättest du deinen Lebtag nie einen Sonnenstrahl abbekommen, bist an jedem Brillenstand stehen geblieben. Mit deinen langen, schlanken Fingern hast du eine Sonnenbrille nach der anderen aufgesetzt. Und ich habe jedes Mal die Achseln gezuckt. Als ob meine Meinung etwas gezählt hätte.
Gekauft hast du dann eine Brille mit schmalen Gläsern und einem dicken Plastikgestell, mit Strass an den Seiten.
Gefallen hat sie mir nicht, schon deshalb nicht, weil sie deine Augen verdeckt hat. Aber das hätte ich niemals gesagt. Und ich wäre ohnehin nicht dazu gekommen, denn du bist sofort zum nächsten Stand weitergelaufen, hast mir einen der Hüte auf den Kopf gesetzt und gesagt: »Den schenke ich dir zum Geburtstag.«
»Ein Hut ist doch gar nicht mein Stil.«
»Nichts ist dein Stil. Deshalb brauchst du ja auch ein paar Accessoires.«
Du hast mir einen Spiegel vors Gesicht gehalten, und eigentlich stand mir der Hut gar nicht schlecht. Ein Fedora, wie in den alten Gangsterfilmen. Zwanzig Dollar wollte der Straßenhändler dafür haben, aber du hast ihn auf fünfzehn runtergehandelt.
Und dann hast du gesagt: »Herzlichen Glückwunsch!«
Dabei feiere ich meinen Geburtstag überhaupt nicht. Ein weiteres Mal so lange gelebt zu haben, bis die Erde einmal um die Sonne gekreist ist, halte ich nun wirklich nicht für eine nennenswerte Leistung. Wenn jemand, der weiß, wann ich Geburtstag habe, mir einen Drink spendiert, sage ich natürlich nicht nein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir nie gesagt hatte, wann mein Geburtstag ist.
Den restlichen Tag sind wir einfach durch die Stadt gelaufen. Nichts Besonderes. Aber jetzt fallen mir Kleinigkeiten wieder ein, und ich sehe sie so deutlich vor mir, dass ich es kaum aushalten kann.
Wir sind an einem Eiswagen stehen geblieben. Eine Kugel Vanilleeis für mich und eine mit Schokoladenstückchen für dich. Damit haben wir uns in den Union Square Park gesetzt und einer Trommelgruppe zugehört. Dann sind wir in den Strand Bookstore gegangen, einerseits wegen der Bücher, aber auch wegen der Klimaanlage. Gegen Abend haben wir alle möglichen Bars und Lounges abgeklappert, in denen Happy Hour war. Als wir genug davon hatten, sind wir zu mir gegangen und aufs Dach geklettert. Wir haben Mandarinen gegessen und die Schalen über die Brüstung geworfen. An die Wand gelehnt, saßen wir da und haben die zwölf Sterne gezählt, die man über der hell erleuchteten Stadt überhaupt sehen konnte. Irgendwann sind wir eingeschlafen und erst am nächsten Vormittag mit Sonnenbrand und total dehydriert wieder aufgewacht.
Wenn ich daran zurückdenke, ist es, als könnte ich deine neongrünen Flipflops auf dem Bürgersteig hören und als hätte ich die Mischung aus Lavendel und Zigarettenrauch in der Nase, die dich immer umweht hat. Ich sehe vor mir, wie du mit vorgeschobener Hüfte dastehst. Höre dein herzhaftes Lachen. Damit bist du überall aufgefallen.
Dabei kann ich mich nicht einmal erinnern, wann ich dich zum letzten Mal gesehen habe.
*
Mein Kaffee ist jetzt zu kalt, aber ich trinke ihn trotzdem. Ich sitze auf dem Sofa und warte darauf, dass NY1 neue Informationen bringt. Aber die Reporter reden nur über das Wetter, die Arbeitsbedingungen von Lehrern und irgendeinen Sexskandal in der Politik. Alle zwanzig Minuten schaltet der Moderator zurück zu dem Schrottplatz in Queens, als wollte er den Zuschauern immer wieder vor Augen führen, wie traurig das Ganze ist.
Wahrscheinlich wird die Berichterstattung noch den ganzen Tag so weitergehen. Chell war hübsch, eine Weiße, und ziemlich aufreizend gekleidet, sodass die Reporter gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: einerseits rauskehren, wie betroffen sie sind, und ihr in derselben Sendung das Image einer Schlampe verpassen. Genau der richtige Stoff für Primetime und Titelseiten. Wäre sie eine Schwarze gewesen und in Harlem umgebracht worden, wäre sie nicht mehr als eine Randnotiz in den Kurznachrichten.
Ein weiteres Mal nennt der Moderator ihren richtigen Namen – den nicht einmal ich gewusst hätte, wenn ihr nicht irgendwann der Führerschein aus der Handtasche gerutscht wäre. Für mich war sie einfach nur Chell. Und ich war für sie immer Ashley – weil ich den Fehler gemacht hatte, ihr zu erzählen, dass mich sonst alle nur Ash nennen.
Die Berichterstattung wird auf einmal von einem Werbespot unterbrochen.
Ich habe immer noch Mühe, das Ganze zu begreifen. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Und trotzdem schwirrt da etwas in meinem Hinterkopf herum. Ich klettere aus dem Fenster und hole mein Handy. Da es auf der Feuerleiter gelegen hat, ist es eiskalt. Ich höre mir Chells Sprachnachricht noch einmal an, und dann noch ein paarmal, bis mir endlich bewusst wird, was mich daran irritiert.
… so ein Typ, der war auch schon … Das hat sie gesagt.
Präteritum. Vergangenheit.
Also kannte sie ihn.
Das heißt, ich kann ihn ausfindig machen.
Und das ist gut. Sobald ich ihn habe, werde ich mich nämlich mal in der gebotenen Offenheit mit ihm über die Umstände ihres Todes unterhalten.
Plötzlich vibriert das Handy, und vor Schreck lasse ich es beinah fallen. Meine Mutter. Ich ignoriere den Anruf und texte an Bombay: Wo sind die anderen?
Es dauert kaum eine Sekunde, da kommt schon die Antwort: Wo denn wohl?
Ich ziehe mich aus und gehe duschen. Das Wasser ist so heiß, dass ich mich fast verbrühe. Aber ich bleibe darunter stehen, bis es lauwarm wird. Gleich noch eine Ibuprofen, dann werde ich dem Kater schon beikommen. Vielleicht sollte ich den beschlagenen Spiegel abwischen, um festzustellen, wie ich überhaupt aussehe. Aber das weiß ich auch so. Ich müsste mich rasieren und bräuchte dringend einen Haarschnitt. Aber so übermüdet, wie ich bin, ist mir all das zu anstrengend. Abgesehen davon wüsste ich nicht, wen ich damit beeindrucken sollte.
Während ich mich anziehe, klopft es an der Tür. Ich ziehe den Reißverschluss an der Jeans hoch, und dann warte ich erst mal ab. »Mister McKenna, hier ist die Polizei«, höre ich eine leise, aber autoritäre Stimme.
Ich gehe automatisch in die Hocke, und erst dann fällt mir ein, dass man mich gar nicht sehen kann. Hastig ziehe ich mich weiter an. Und noch hastiger, als ich höre, dass jemand versucht, die Tür aufzuschließen. Der Vermieter vielleicht. Natürlich habe ich das Schloss ausgetauscht, als ich eingezogen bin. Das wird er schon noch merken.
Mit den Cops zu reden ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Ich habe doch selbst nicht die leiseste Ahnung, wo ich letzte Nacht war. Ich weiß, dass ich Chell niemals etwas angetan hätte, aber das wissen die ja nicht. Und wenn sie mich im Vorfeld ein bisschen durchleuchtet haben, wäre eine Unterhaltung mit denen ganz bestimmt kein Vergnügen.
Gemurmel vor der Tür. Dann summt mein Handy. Nummer unbekannt. Ich ignoriere den Anruf, schalte das Handy aus und stecke es in die Hosentasche.
Die Novemberluft draußen ist kalt, das weiß ich ja schon. Also ziehe ich meinen grauen Marineüberzieher mit dem breiten Kragen an. Der Filzhut, den Chell mir zum Geburtstag geschenkt hat, liegt auf dem Kühlschrank. Ich schlage ihn gegen mein Bein, um den Staub abzuklopfen. Dann schiebe ich meinen Schirm durch eine der Gürtelschlaufen und werfe einen letzten Blick zur Tür.
»Mister McKenna, sind Sie zu Hause? Wir müssen unbedingt mit Ihnen sprechen.«
Ich steige durch das Fenster auf den Absatz der Feuerleiter. Unten auf der Straße ist niemand. Ich ziehe das Fenster runter und klettere aufs Dach.
Die untergehende Sonne färbt die Wolkenstreifen orange, und ich bleibe an die Brüstung gelehnt für einen Moment sitzen, betrachte den endlos weiten Abendhimmel und atme tief durch.
Dann laufe ich bis zum Ende des Blocks. Auf dem Dach des letzten Gebäudes vergewissere ich mich, dass die Tür zum Treppenhaus weder abgeschlossen noch alarmgesichert ist. Als ich unten auf der Straße bin und geprüft habe, dass die Cops meinen Fluchtplan nicht durchschaut haben, hole ich den iPod aus der Manteltasche, stecke mir die Stöpsel in die Ohren und drehe Iggy Pop voll auf.
Search and Destroy.
Wie passend.
ZWEI
Die Apocalypse Lounge ist so überfüllt, dass die Leute bis raus auf den Bordstein stehen. Voller als sonst. Was allerdings auch nicht schwer ist. Der kleine Laden in Alphabet City liegt ein bisschen abseits von den trendigen East-Village-Bars, sodass man hier normalerweise noch seine Ruhe hat. Der Schuppen besitzt nicht mal eine volle Schanklizenz, deshalb gibt es nichts Härteres als Wein und Bier. Obwohl für mich natürlich immer eine Flasche Jameson unter dem Tresen steht.
Die meisten Leute, die sich hierher verirren, drehen sich direkt wieder um und gehen. Hingeschmierte Graffiti an den Wänden. Zerkratzte, wackelige Tische und Stühle, von irgendwo zusammengesucht. Das Namensschild, bestehend aus einem Stück galvanisiertem Metall, hängt wie eine Guillotine über der Tür und schwingt bei jedem Windstoß hin und her.
Der Name ist gewissermaßen Programm.
Heute sind so viele Leute hier, weil es für Chell eine Gedenkfeier gibt. In Zeiten von Verlust und Verwirrung ist das Apocalypse unser Zufluchtsort, nicht unsere Familien. Wobei viele von uns so tun, als hätten sie gar keine.
Während ich mich bis zur Tür durchdrängle, nimmt keiner Notiz von mir. Dann bleibe ich erst mal stehen. Die schmierigen Schaufensterscheiben sind schon von der feuchten Luft beschlagen. Die Leute stehen Schulter an Schulter mit ihrem Wein- oder Bierglas und übertreffen sich gegenseitig in ihrer Trauer. Jeder kannte Chell natürlich am besten, selbst die, die kaum wussten, wer sie überhaupt war.
Am liebsten würde ich mich unbemerkt in mein Büro schleichen. Aber schon hat mich jemand entdeckt, und es geht ein Raunen durch die Menge. Dann ist es plötzlich fast totenstill. Nur noch ein melancholischer Song von Elliott Smith dröhnt aus den Lautsprechern. Wurde natürlich passend zur Stimmung ausgewählt. Es gibt kaum jemand, der mich nicht anstarrt.
»Na, ihr dämlichen Arschlöcher?«, sage ich in die Runde.
Diejenigen, die es gehört haben, lachen. Dabei sollte es eigentlich kein Witz sein.
Bombay bahnt sich einen Weg durch die Menge und reißt mich so schwungvoll in seine Arme, dass wir fast durch die Tür taumeln. Er klammert sich an mich, als wäre er derjenige, der Trost braucht. Er trägt Khakihosen und ein schwarzes Hemd. Ganz gegen seine sonstige Gewohnheit: Fallschirmspringerhosen und Poloshirts in Neonfarben. Sein Schädel ist frisch rasiert, und er riecht nach Seife und Rotwein. Ohne zu lächeln, lässt er mich wieder los. Sonst sehe ich ihn nur dann nicht grinsen, wenn er gar nicht da ist.
Er will etwas sagen, schluckt aber nur. »Vergiss es!«, sage ich.
Bombay nickt, und ich spüre ein weiteres Paar Arme. Eine kurze, feste Geste, wie ein Handschlag. Lunettes weiß gefärbtes Haar sieht aus, als hätte sie sich gerade erst aus dem Bett gequält. Die Augen hinter der schwarzrandigen Brille sind rot und verquollen. Sie zieht den Kragen ihres Flanellhemds lang und wischt sich damit die Nase ab. Auch ihr fällt nichts ein, was sie sagen könnte.
»Kommt in ein paar Minuten runter in mein Büro«, sage ich zu den beiden.
Bombay und Lunette sehen mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Vielleicht haben sie erwartet, dass ich am Boden zerstört bin. Aber ich habe einen Job zu erledigen.
Dave, hinter der Bar, hat sein Hemd ausgezogen und arbeitet mit freiem Oberkörper. Als er sich bückt, sieht man jeden Knochen unter der Haut. Er taucht wieder auf und stellt die Flasche Jay vor mir auf den Tresen. Ich greife danach, aber dann kämpfen zwei Seelen in meiner Brust. Letzten Endes schiebe ich die Flasche zu ihm zurück.
»Ich brauche einen klaren Kopf«, sage ich und füge hinzu: »Wenn du gleich einen Moment Zeit hast, kommst du dann mal kurz in mein Büro?« Er nickt. Ohne mich schief anzusehen. So macht man das als guter Barkeeper.
Als ich mich umdrehe, versuchen alle möglichen Leute, mich anzusprechen. Wie ich mit Chells Tod klarkomme, wollen sie wahrscheinlich wissen. Allein das ist schon schlimm, aber noch schlimmer sind die Blicke. Nach dem Motto: Der hat doch schon mal wen unter tragischen Umständen verloren, und jetzt auch noch das!
Aber bevor auch nur einer den Fehler machen kann, mich danach zu fragen, bin ich schon auf dem Weg die Treppe hinunter.
*
Obwohl oben das Leben tobt, ist es im Keller menschenleer. Die beiden Toilettenräume, jeder sowohl für Männer als auch für Frauen, sind nicht besetzt. Ich hänge das Außer-Betrieb-Schild an die rechte Tür und ziehe sie hinter mir zu.
Die nackten Betonwände sind mit Stickern von Bands beklebt, sogar zwischen dem Waschbecken und den frei liegenden Rohren. Nur das Regal gegenüber der Toilettenschüssel ist nicht beklebt. Das Holz ist zwar ziemlich zerkratzt, aber das Regal ist sauber, und bis auf ein paar Rollen Klopapier und einen Stapel von Good Housekeeping liegt nichts darauf.
Ich greife unter das dritte Regalbrett von unten, löse den Metallhaken und schwinge das Regal in den unbeleuchteten Korridor dahinter. Im Dunkeln taste ich nach dem Griff der schweren Stahltür, die zu meinem Büro führt.
Mein Büro – so nenne ich den Raum, obwohl er natürlich nicht mir gehört. Eigentlich hat er keinen besonderen Namen und steht allen zur Verfügung, die in seine Existenz eingeweiht sind. Es ist bloß so, dass ich von dort aus arbeite.
Wenn mehr als acht Leute hier sind, wird es eng. Auf dem Boden zwischen den beiden schwarzen Ledersofas liegt ein brauner Teppich mit Blumenornamenten, und die auberginefarbenen Wände lassen den Raum einerseits größer, andererseits aber auch kleiner erscheinen. Der Aschenbecher aus Mattglas auf dem Sofatisch ist sauber. Ich ziehe ihn zu mir herüber und zünde mir eine Zigarette an. Dann setze ich mich, lege die Beine auf den Tisch und warte auf die anderen.
Bombay, Lunette und Dave kommen zusammen rein und lassen sich mir gegenüber auf das andere Sofa fallen. Keiner will den Anfang machen. Alle lavieren um das Thema herum und warten darauf, dass ich etwas sage. Etwas, was ihnen zeigt, dass ich noch eine menschliche Seite habe.
Ich reibe über die Handfläche, auf der die Worte Du hast es versprochen nach dem Duschen verblasst, aber noch lesbar sind, und frage: »Hat jemand von euch mich gestern Abend noch mal gesehen, nachdem ich aus dem Apocalypse weg bin?«
Zur Antwort bekomme ich nur ausdruckslose Blicke.
Also sage ich: »Gut. Dann weiter. Chell ist an der Ecke Vierte und B verschwunden. Jemand muss was mitgekriegt haben. Ich will wissen, wann jeder von euch Chell das letzte Mal gesehen hat. Und ob sie was gesagt hat, was ich erfahren sollte.«
Dave streicht sich über die Schenkel und starrt auf den Boden. »Sie war vorgestern Abend hier. Aber soweit ich mich erinnere, hat sie nichts gesagt, was wichtig sein könnte. Tut mir leid, aber ich muss wieder rauf. Ich will Bess nicht so lange hinter der Theke allein lassen. Keine Ahnung, ob sie das schafft.«
Nachdem Dave gegangen ist, weist Lunette mit dem Kopf auf meinen Hut und sagt mit ihrem russischem Akzent, der sich wie feine Wurzeln durch ihre Worte zieht: »Steht dir gut.«
»Echt? War mir nicht sicher, ob ich ihn überhaupt aufsetzen soll. Ich dachte, wenn ich damit ankomme, lacht ihr mich nur aus.«
»Nicht an einem Tag wie heute.« Sie weicht meinem Blick aus, und als sie sich mir wieder zuwendet, hält sie den Kopf gesenkt. »Ihre Leiche ist noch nicht mal kalt. Willst du dir nicht wenigstens ein paar Minuten Zeit zum Trauern nehmen?«
»Wer auch immer das getan hat, läuft da draußen frei rum. Und wenn er noch wen umbringt, geht das auf mein Konto.«
»Darum kümmern sich doch die Cops«, wirft Bombay ein.
»Denen traue ich das aber nicht zu. Außerdem ist das hier unser Viertel.«
Lunette nickt, nicht zustimmend, sondern um zu signalisieren, dass sie versteht, was ich meine. Dann sagt sie: »Am Sonntag haben Chell und ich ein Katerfrühstück gemacht. Da schien bei ihr alles okay zu sein.«
»Worüber hat sie gesprochen? Gab es jemand, der ihr auf die Nerven ging?«
»Sie hat nichts in der Art erwähnt.«
Während ich meine Zigarettenkippe im Aschenbecher ausdrücke, fragt Bombay: »Was hast du jetzt vor?«
»Weiß ich noch nicht genau. Aber um mir ein paar Anregungen zu holen, habe ich mir schon mal das Alte Testament besorgt.«
»Du willst ihn also umbringen, den Typen, der das getan hat?«
»Wenn ich das Glück habe, ihn vor den Cops in die Finger zu kriegen.«
»Das kannst du doch nicht machen!«
Ich stehe auf, und Bombay zuckt zurück. Ihn zu schlagen, käme mir niemals in den Sinn, aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das auch ihm klar ist. »Wir sind hier in den Staaten«, sage ich. »Da kann ich verflucht noch mal machen, was ich will.«
»Ash, du musst darüber reden«, sagt Lunette. »Können wir bitte einfach nur darüber sprechen?«
Ich sollte nicht alles an ihnen auslassen. Abgesehen von meiner Mutter und Chell sind Bombay und Lunette die einzigen beiden Menschen, die mir was bedeuten. Und sie meinen es gut mit mir. Das weiß ich genau. Aber ich will nicht darüber reden. Über Tote zu sprechen bringt sie nicht zurück.
Das, was ich vorhabe, auch nicht. Aber ich würde mich um einiges besser fühlen.
Deshalb sage ich nur: »Im Moment gibt es nichts zu reden.«
*
Tibo sitzt in der einzigen Nische, die das Apocalypse überhaupt hat, etwas abseits vom Tresen, gegenüber der Treppe. Er wohnt in dem Block Ecke Vierte und B. Deshalb gehe ich direkt zu ihm, als ich aus dem Keller komme. Er hat ein paar Seekarten auf dem Tisch ausgebreitet und sich darübergebeugt, während Mikey auf ihn einredet. Ich bleibe vor dem Tisch stehen, und Mikey hebt den Kopf. Aber Tibo nicht. Das Gesicht von einer Masse an Dreadlocks verdeckt, hält er weiter den Kopf gesenkt.
»Es tut mir so leid, Ash«, sagt Mikey. »Ich kann das mit Chell noch gar nicht glauben. Also wenn du jemand zum Reden brauchst, Mann, ich bin da.«
»Halt einfach die Klappe, Mikey.« Ich klopfe auf den Tisch, und jetzt hebt auch Tibo den Kopf, offenbar erstaunt, dass er sich in einer Kneipe befindet. »Hast du Chell in der letzten Zeit gesehen?«
Er nickt. »Gestern Abend.«
»Komm mit. Besprechung.«
Tibo packt die Seekarten zusammen, und wir bahnen uns einen Weg durch die Menge nach draußen. Wie aus dem Nichts zieht er eine selbst gedrehte Zigarette hervor und steckt sie sich an. Er wartet gar nicht erst, bis ich ihn ausfrage. »Ich war zu Hause und hab am Fenster gesessen, und da hab ich gesehen, wie sie auf der Straße unten vorbeigegangen ist. Spät. An die genaue Uhrzeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war halt ein bisschen benebelt.« Mit einem Achselzucken fügt er hinzu: »Aber mit Sicherheit nach Mitternacht. Bin nämlich erst gegen zwölf nach Hause gekommen.«
»War jemand bei ihr?«
»Ein paar Leute.«
»Hast du wen erkannt?«
Tibos Augen bewegen sich auf und ab, als würde er einen Aktenschrank durchforsten. »Die sind mir bekannt vorgekommen. Einer war dabei, den würde ich wiedererkennen. Schon älter. Gut aussehend.« Dann streckt er den Kopf vor. »Warte mal. Da war noch einer. Aber der hatte eine Tüte über dem Kopf.«
»Was soll das heißen, eine Tüte?«
»So einen Beutel. Einen schwarzen Sack.«
»Hast du gesehen, wohin sie gegangen sind?«
»Richtung Osten. Mehr kann ich von meinem Fenster aus nicht sehen.«
»Ist dir sonst noch was an denen aufgefallen? Irgendwas, was dir nicht normal vorgekommen ist?«
Tibo windet sich, als würde es ihm Schmerzen bereiten, sich zu erinnern.
»Chell hatte so ein komisches Kleid an. Sah nach Vintage aus. Wie in den Dreißigerjahren, mit Hut und so.«
Nichts, womit ich sie schon mal gesehen hätte. So wie ich sie kannte, sah sie eher nach Bondage als nach Vintage aus.
»Wenn du willst, kann ich mich umhören«, sagt Tibo. »Um rauszufinden, was das sollte. Aber mal was andres, Mann. Die Cops waren hier und haben nach dir gefragt.«
Plötzlich wird mir jeder Einzelne bewusst, der vor dem Apocalypse steht. Ich scanne mit den Augen die Gesichter, die mir nicht bekannt vorkommen und mir ein wenig zu seriös erscheinen. »Wann?«
»Vor zehn Minuten. Alle haben auf ahnungslos gemacht. Ein paar Leuten haben sie ihre Karte gegeben. Willst du eine?«
»Scheiße noch mal, nein! Aber danke für die Info.«
Als ich mich umdrehe und gehen will, fragt Tibo: »Hast du zufällig eine Taucherausrüstung?«
Mein Repertoire an schlagfertigen Antworten ist im Moment nicht verfügbar, also sage ich nur: »Warum?«
»Ach egal. Lange Geschichte.«
Dann macht sich Tibo auf den Weg die Straße entlang zu seinem Heimatplaneten.
Chell war also letzte Nacht hier unterwegs. Damit kann ich arbeiten.
*
Die meisten Leute, die mich kennen, bezeichnen mich als Privatdetektiv. Dabei ist das eigentlich nicht korrekt. Um in New York offiziell Privatdetektiv zu werden, braucht man drei Jahre Berufserfahrung. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die nachweisen soll. Dann muss man eine staatliche Prüfung ablegen, die ein paar Hundert Dollar kostet. Und die Lizenz muss man auch noch alle zwei Jahre verlängern.
Das würde mehr Geld und Aufwand bedeuten, als ich für irgendetwas aufzubringen bereit wäre. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich mit so einer Lizenz an die Spielregeln halten muss, und das entspricht eigentlich nicht meinem Geschäftsmodell.
Ich betrachte mich eher als eine stumpfe Speerspitze. Ich werde mit etwas beauftragt – Leute ausfindig machen, Sachen finden, Dinge transportieren, unangenehm rüberkommen –, dann mache ich das, und wenn es erledigt ist, kassiere ich mein Geld. In manchen Fällen akzeptiere ich als Bezahlung auch Alkohol oder Drogen. So ein Tauschhandel kann nämlich durchaus etwas für sich haben.
Bombay hat mal aus Scherz gesagt, ich solle Werbung machen, aber bislang brauchte ich das gar nicht. Leute, die mit meiner Arbeit zufrieden sind, geben meine Nummer weiter, und dann klingelt irgendwann das Telefon und jemand hat einen Auftrag für mich. Den nehme ich an oder auch nicht.
Es ist nicht mein Traumberuf (als Kind wollte ich Archäologe werden), aber ich kann meine Rechnungen bezahlen, was heißt, dass ich meinen Job wohl ziemlich gut mache.
*
Mein Magen fängt schon an, sich selbst zu verdauen, bis mir endlich auffällt, dass ich den ganzen Tag lang noch nichts gegessen habe. Also kehre ich erst mal in dem Pizzaladen an der Ecke ein, und da sitzt Good Kelly an einem der weißen Plastiktische. Sie stochert in einer Spinatrolle herum und winkt mich zu sich. Ihr neongrüner Mantel und die schwarzen Haare lassen ihre blasse Haut im grellen Licht fast leuchten.
»He«, sagt sie zur Begrüßung, und sofort verdüstert sich ihr Gesicht, weil wir ja traurig sein müssen. »Wie kommst du klar?«
»Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, ohne wie ein Arschloch zu klingen«, antworte ich.
»Es tut mir so leid. Und ich komme mir wie der letzte Hohlkopf vor, weil ich dich gleich so überfalle. Aber ich wollte dich sowieso anrufen. Du müsstest mir nämlich einen Gefallen tun.« Sie wischt sich den Mund ab und legt die Serviette über den Rest der Spinatrolle. »In ein paar Tagen ziehe ich um, und ich bräuchte jemand, der mir beim Verladen der schweren Sachen hilft.«
»In welches Viertel ziehst du denn?«
»Ganz weg.«
»Aus Soho?«
»Aus New York.«
»Ehrlich jetzt?«
Sie steht auf und schiebt den Stuhl an den Tisch. »Ich würde dir das Ganze gern genauer erklären, aber ich habe eine Verabredung mit Harley und bin schon spät dran. Es wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Soll ich dir Bescheid geben, wann genau?«
»Klar helfe ich dir. Aber wohin ziehst du denn jetzt?«
»Austin, Texas.«
»Bist du verrückt geworden?«
»Da kriege ich ein ganzes Haus für die Miete, die man hier hinblättert, wenn man sich nur ein Paar Bowlingschuhe leihen will. Ich erzähle dir alles ganz genau, wenn du vorbeikommst.« Sie legt mir eine Hand auf die Schulter. »Kann ich mich darauf verlassen?«
»Kannst du doch immer. Aber warum in aller Welt willst du nach Texas?«
»Wird allmählich Zeit.«
»Noch eine Sache, bevor du gehst: Hast du mich oder Chell gestern Abend gesehen?«
»Weder dich noch sie«, antwortet Good Kelly stirnrunzelnd.
Sie macht den Eindruck, als wollte sie noch etwas ergänzen, gibt mir dann aber nur einen Kuss auf die Wange. Ihre Lippen fühlen sich warm an, und ein bisschen fettig von der Spinatrolle.
Kelly ist geborene New Yorkerin. In ihren Adern fließt dasselbe wie in meinen: das kalkhaltige Wasser, das einem in den U-Bahn-Stationen von der Decke auf den Kopf tropft. Von daher kann ich kaum glauben, was sie mir da gerade erzählt hat.
Ich brauche dem Typen hinter der gläsernen Auslage gar nicht zu sagen, was ich will. Er gibt mir ein Stück Pizza, und ich schiebe ihm zwei Dollarscheine rüber. Während ich die Pizza auf dem weißen Papptablett balanciere, gehe ich nach draußen und sehe Good Kelly hinterher, bis sie in der Menschenmenge verschwindet. Die hell erleuchteten Straßen sind verstopft, die diversen Geräusche übertönen sogar den Verkehrslärm, und die ganze Stadt ist in Bewegung. Wie will man denn ohne das leben?
*
Die letzte Nummer, die ich von Ginny habe, funktioniert nicht mehr, also mache ich einen Abstecher zum Chanticleer. In dem mit Samtkordeln abgetrennten Raucherbereich steht eine gelangweilte Dragqueen mit Flitter in der blonden Perücke, der im Licht der Straßenlaternen leuchtet. »Ist Ginny da?«, frage ich.
»Wer?«, fragt sie prompt zurück und bläst den Rauch in meine Richtung.
»Schon gut.«
Das müsste reichen. Es wird sich herumsprechen. Und eigentlich ist es mir so ganz recht. Um den Nerv für eine Audienz bei der Queen der Lower East Side aufzubringen, braucht man nämlich eine gewisse Zeit.
Ich laufe erst mal ein bisschen herum und fasse meine bisherigen Ergebnisse zusammen.
Ich gehe von der Annahme aus, dass Chell ihren Mörder kannte. Vermutlich hatte er einen Wagen oder konnte sich zumindest einen besorgen. Ihr Anruf kam um vier Uhr nachts, und laut der Berichterstattung im Fernsehen wurde sie um neun Uhr morgens gefunden. Bleibt ein Zeitraum von fünf Stunden, in dem sie ermordet wurde. Das heißt, es muss hier in der Gegend passiert sein oder im Auto. Wenn es im Auto passiert ist, war es vermutlich ein Van. Ohne Fenster.
Für ihre seltsame Aufmachung und den Mann mit dem Sack über dem Kopf habe ich keine Erklärung parat. Aber das war vor ihrem Anruf. Sobald ich mehr darüber weiß, kann ich auch genauer bestimmen, wer bei ihr war, als sie ermordet wurde.
Ich merke gar nicht, wohin ich gehe, bis ich mich an der Ecke Vierte und B wiederfinde. Von hier aus hat Chell mich angerufen. Ich bleibe eine ganze Weile stehen und rauche eine Zigarette nach der anderen, bis ich Kopfschmerzen bekomme. Dabei gibt es dort nicht viel zu sehen.
Da ist ein koreanischer Imbiss, der häufiger geschlossen als geöffnet hat. Als Chell angerufen hat, war er bestimmt längst dicht. Auf der anderen Straßenseite ist eine Bar, aber die ist viel zu trendig für mich. Niemand steht zum Rauchen auf dem Bürgersteig. Also muss es einen Innenhof geben, was wiederum bedeutet, die Chance, dass jemand etwas gesehen hat, ist äußerst gering. Sonst gibt es nur Wohnblocks und ein Gebäude, das nach einer Schule aussieht.
Viele der Fenster gehen auf die Straße hinaus. Hinter den meisten ist es jetzt dunkel, aber einige sind noch hell erleuchtet. Hinter einem beigefarbenen Rollo sehe ich jemand herumlaufen. Aber es würde ein Jahr und einen Tag dauern, sämtliche Wohnungen abzuklappern.
Jedenfalls ist die Straße um die Zeit völlig verlassen, und man fühlt sich wie am Ende der Welt. Wenn jetzt jemand käme und mich in einen Van zerren wollte, würde es niemand mitbekommen. Nirgendwo ist etwas mit Flatterband abgesperrt. Dabei müssten die Cops hier alles durchkämmt haben. Aber vielleicht auch nicht, weil sie davon ausgehen, dass Chell nicht hier ermordet wurde.
Ich gehe in die Hocke und lasse die Finger über den rauen Asphalt gleiten. Der Bürgersteig fühlt sich kalt an, und obwohl ich weiß, dass das nicht möglich ist, kommt es mir vor, als würde ein Hauch von Lavendel durch die kalte Novemberluft wehen. Das Stück Pizza liegt mir so schwer im Magen wie Granit. Ich muss mich zusammenreißen, um es bei mir zu behalten.
Vor weniger als vierundzwanzig Stunden war sie genau hier, und dann war sie weg, wie ausgelöscht, bis sie tot in Queens gefunden wurde. Ich kann nur hoffen, dass sie ihrem Mörder in der Zwischenzeit das Leben zur Hölle gemacht hat.
Das kann er schon mal als Vorgeschmack betrachten.
Der Türsteher aus der Bar gegenüber kommt heraus und stellt sich neben die Tür. Ein großer, kräftiger Typ mit einem Nacken vom Umfang meines Oberschenkels und einem Schädel, als hätte ihn jemand mit dem Rasenmäher geschoren. Nach dem Motto: Ich bin viel zu groß und zu stark, als dass ich etwas darauf geben würde.
»He!«, rufe ich ihm zu, während ich die Straße überquere. »Hast du gestern Nacht auch hier an der Tür gestanden?«
Er nimmt keine Notiz von mir, bis ich vor ihm stehe.
»Könntest du so freundlich sein, meine Frage zu beantworten, Hulk?«
Mit einer schnelleren Bewegung, als ich sie einem so massigen Typen zugetraut hätte, nimmt er die Sonnenbrille ab. Die Augen sind blutunterlaufen und die Pupillen groß wie Untertassen. Alles klar: Bodybuilder, Steroide. »Was fällt dir ein, wie redest du mit mir?«, schnauzt er mich an.
»Bin mir nicht sicher, ob das schon ein kompletter Satz war, aber ich will es mal gelten lassen.« Ich nicke mit dem Kopf zur anderen Straßenseite. »Gestern Nacht stand da an der Ecke ein Mädchen. Sie hat mich noch angerufen, und dann wurde sie ermordet. Deshalb muss ich unbedingt wissen, ob du letzte Nacht auch hier den Türsteher gemacht hast, damit ich dich fragen kann, ob du irgendwas gesehen hast.«
»Nein.«
»Dass ich mich aber auch immer so unklar ausdrücken muss. Nein, ich kann dich nicht fragen, oder nein, du hast nichts gesehen?«
»Hab gestern nicht gearbeitet.«
»Lohnt sich die Mühe zu fragen, wer dann?«
»Warum verschwindest du nicht einfach?«
Ich mache einen Schritt auf ihn zu, und er zuckt zurück. Aber nur weil er es nicht gewohnt ist, dass jemand ihn so aggressiv angeht. »Ich weiß, du bist ein harter Typ, aber ich bin einfach nicht schlau genug, dass ich die Sache auf sich beruhen lasse. Einen Namen, mehr will ich nicht. Wenn du dein großes, weiches Herz dafür erwärmen könntest, ihn mir zu nennen, bin ich sofort wieder weg.«
Er reißt die Augen auf und überlegt wahrscheinlich, ob er mich einfach umschubsen soll. Ich stemme die Beine in schulterbreitem Abstand fest auf den Boden. Wenn er auf mich losgeht, gehe ich ihm an den Hals. Der Luftröhre ist es nämlich egal, wie viel man stemmen kann. Aber lieber wäre mir, diesen Weg nicht beschreiten zu müssen. Deshalb stelle ich mit an Euphorie grenzender Begeisterung fest, dass sich die Situation entspannt.
»Steve heißt der Typ«, sagt er, nachdem er sich die Sonnenbrille wieder aufgesetzt hat. »Arbeitet aber erst in ein paar Tagen wieder. Sonntag, glaube ich.«
»Na also, geht doch. Besten Dank.« Ich halte ihm die Hand hin, aber er geht wieder in den Statuenmodus. Was ich als Wink betrachte, jetzt lieber zu verschwinden.
*
Diese Stadt. Sie verlangt einem einiges ab. Sie zerfällt, und immer wieder geben wir alles, um sie zusammenzusetzen.
Verdammt, ich kann kaum noch klar denken. Ich brauche unbedingt Schlaf. Richtigen Schlaf. Nach zu viel Whiskey das Bewusstsein zu verlieren ist nämlich nicht dasselbe.
Ich hole mein Handy aus der Hosentasche, um nach der Uhrzeit zu sehen. Leider habe ich vergessen, den Akku aufzuladen. Deshalb tut sich nichts.
Von weitem höre ich die Sirene eines Feuerwehrautos. Es kommt näher. Als es an mir vorbeifährt, nehme ich den Fedora ab und halte ihn mir vor die Brust. Einer der Feuerwehrmänner sieht es durch das Seitenfenster und hält den Daumen hoch. Ich nicke ihm zu, und erst als das Feuerwehrauto außer Sichtweite ist, setze ich den Hut wieder auf und gehe weiter.
An der Ecke zur Zehnten stecke ich mir eine Zigarette an und wäge meine Optionen ab. Viele habe ich ohnehin nicht. Ich weiß verflucht noch mal nicht, was ich hier überhaupt treibe. Ich habe schon öfter Leute aufgespürt. Aber wenn man einen Namen und ein Foto hat, ist das auch nicht allzu schwer.
Ich muss einen Blick in die Zeitung werfen. So spät, wie es mittlerweile ist, müsste bald die Morgenausgabe der Post ausliegen. Die Post mag hier in der Stadt einen schlechten Ruf haben, aber was die Berichterstattung über Verbrechen angeht, stellt sie alle anderen in den Schatten.
Aber erst mal muss ich das Handy aufladen.
Sofort denke ich an Chells Apartment. Da liegt mein zweites Ladekabel.
Da sollte ich jetzt vielleicht hingehen.
Die Cops haben es sicher schon durchsucht, und da es kein Tatort ist, ist bestimmt keiner mehr dort.
Einen Becher Kaffee, und ich bin wieder so weit. Vielleicht auch zwei, damit mein Denkapparat anspringt, bevor ich mich auf den Weg nach Brooklyn mache. Noch besser wären ein paar Nasen Koks, dann würde ich den Fall wahrscheinlich im Vorbeigehen lösen und hätte bis zum Morgengrauen noch Zeit, einen Wolkenkratzer zu bauen. Aber ich besinne mich wieder auf das, was ich mir vorgenommen habe: klaren Kopf bewahren.
Als Allererstes muss ich einen Zwischenstopp im Badezimmer einlegen. Ich gehe um die Ecke zu dem Block, wo sich mein Apartment befindet. Vor dem Haus steht ein schwarzer Impala. Limousine, neuestes Modell, getönte Scheiben. Das kann nur eins bedeuten. Ich überlege, ob ich sofort wieder kehrtmachen soll. Aber erstens würde das einen schlechten Eindruck machen, und zweitens muss ich dringend pinkeln. Also ziehe ich die Schultern hoch und hoffe, dass sie nicht wissen, wie ich aussehe.
Aber natürlich stehen sie schon hinter mir, sobald ich den Schlüssel ins Schloss stecke.
Es sind zwei. Ein großer Latino, dünn wie eine Zigarette, und ein kleinerer Typ, der aussieht, als hätte man ihn grob aus einem Sandsteinklotz gehauen. Der größere ist offenbar der Anführer.
»Mister McKenna«, spricht er mich an. Er klappt seine Brieftasche auf und hält sich den Dienstausweis vor die Brust, als wäre der ein Schutzschild. »Ich bin Detective Medina, und das ist Detective Grabowski. Wir haben Sie schon gesucht.«
DREI
»Wollen wir nicht reingehen?«, fragt Medina.
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil ich Sie nicht kenne.«
Medina stößt einen Seufzer aus. »Wir sind die Guten.«
»Habt ihr das Abner Louima auch erzählt, bevor ihr ihm einen Besenstiel in den Hintern gerammt habt?« Medina scheint genervt und kurz davor zu sein, mir über den Mund zu fahren. Aber dann überlegt er es sich anders und sagt: »Der Idiot, auf dessen Konto das ging, sitzt immer noch seine dreißig Jahre ab. Und Sie können nicht von einem auf alle anderen schließen.«
»Klar kann ich das. Aber was haben wir denn überhaupt zu besprechen?« Ich will sie hinhalten. Vermutlich merken sie das. Dabei wäre es mir lieber, ich könnte ihnen zumindest eine ausweichende Antwort auf die Frage geben, wo ich letzte Nacht war. Leider fällt mir da beim besten Willen nichts ein.
Du hast es versprochen.
Wer hat was versprochen?
Und das sind längst nicht die einzigen Fragen. Wie viel habe ich getrunken? Und was sagt das über mich als Mensch aus?
So wie Medina mit mir redet, könnte man meinen, er wolle sich mit mir anfreunden. Aber dafür steht er zu weit weg, und seine Körperhaltung drückt zu viel Wachsamkeit aus. Schlechter Schauspieler. »Wir wüssten gern, wo Sie gestern Abend waren.«
Frag deine Frau, liegt es mir schon auf der Zunge. Aber stattdessen antworte ich: »Ich war fast den ganzen Abend hier. Vorher nur kurz was trinken.«
»In welchem Club?«
»Vermutlich in den meisten.«
»Könnten Sie etwas genauer werden?«
»Worum geht es hier eigentlich?«
»Sie wissen ganz genau, worum es geht.«
Mit einer gespielten Abwehrgeste hebe ich die Arme. »Um genau zu sein: Ich weiß es nicht. Also warum erzählen Sie es mir nicht einfach?«
Medina klappt ein abgewetztes Notizbuch auf, das nicht größer als seine Handfläche ist. Er liest Chells richtigen Namen ab, als wäre er ihm kurzzeitig entfallen, und dann fragt er: »Sie hat Sie letzte Nacht angerufen?«
»Hat sie.«
»Warum?«
»Das spielt doch wohl keine Rolle mehr.«
Medina holt seine Zigaretten hervor und steckt sich eine an. Er hält mir die Packung hin, aber ich winke ab. »Haben Sie einen Grund für Ihre provokante Haltung?«
Schon die Art, wie er danach fragt, ist die reinste Provokation.
»Vielleicht den, dass ich emotional ziemlich fertig und total erschöpft bin und Sie mich um den Schlaf bringen. Vielleicht, weil Sie hier Ihre Zeit verschwenden, anstatt den Idioten zu schnappen, der sie umgebracht hat. Und vielleicht kann ich Cops im Allgemeinen nicht viel abgewinnen. Außerdem muss ich dringend pinkeln. Vielleicht kommen da also mehrere Gründe zusammen.«
»Sie sind nicht der Einzige, der einen langen Tag hinter sich hat. Von daher können wir es gern kurz machen. Indem Sie uns einfach erzählen, was sie bei ihrem Anruf letzte Nacht gesagt hat.«
Jetzt sagt auch Grabowski mal etwas, in knirschendem Ton, als ob er eine Kippe austreten würde. »Du könntest ein bisschen kooperativer sein, Junge. Dann brauchen wir uns hier nicht länger die Nacht um die Ohren zu schlagen.«
Die haben mich nicht durchleuchtet, sonst wären sie weniger freundlich. Ich setze mich auf den kalten Treppenabsatz und zünde mir eine Zigarette an. Wenn ich mich irgendwie kooperativ zeige, lassen sie mich vielleicht tatsächlich in Ruhe.
»Sie hatte das Gefühl, von jemand verfolgt zu werden. Deshalb hat sie mich angerufen und gefragt, ob ich sie nach Hause bringen kann. Wie Sie sich vermutlich denken können, habe ich die Nachricht nicht rechtzeitig bekommen.«
»Können wir uns die Nachricht anhören?«
»Die ist nicht hilfreich.«
»Das entscheiden wir. Also?«
Ich überlege kurz. Warum eigentlich nicht? Die beiden wirken gar nicht so übel. Aber das denkt man bei allen. Wenn sie die Nachricht hören wollen, können sie sich ruhig noch ein bisschen mehr Mühe geben. Es ist ja nicht so, dass sie nicht selbst drankämen. Dank diesem dämlichen PATRIOT Act.
»Nein«, sage ich also. »Da kommen Sie doch selbst ran.«
»Mit dem entsprechenden Beschluss, ja«, sagt Medina.
»Dann holen Sie ihn sich doch.«
»Wissen Sie was?« Medina schnippt die Zigarettenkippe auf die Straße. »Wir haben schon mit einigen Leuten gesprochen, und die sagen, Sie hätten sie ziemlich gut gekannt. Wenn sie Ihnen tatsächlich so viel bedeutet hat, warum wollen Sie dann nicht, dass wir ihren Mörder finden?«
»Darum geht es nicht.«
Grabowski murmelt so laut, dass wir es hören können: »Scheint Ihnen ja nicht allzu viel auszumachen.«
Ich wende den Kopf, sodass ich Grabowski in die Augen sehen kann. »Jeder geht auf seine eigene Art mit Trauer um. Ich neige dazu, meine Gefühle zu unterdrücken, bis ich irgendwann explodiere.«
Er reagiert nicht darauf. »War letzte Nacht jemand bei Ihnen, der bezeugen kann, dass Sie hier waren?«
»Nicht dass ich wüsste.« Ich hebe die Arme über den Kopf und strecke mich. »Also, warum holt ihr euch nicht einfach den entsprechenden Beschluss? Ein Arschloch zu sein ist zu meinem Glück ja nicht strafbar. Was für mich heißt, dass ich jetzt überhaupt nicht mit euch reden muss.«
»Wenn Sie es nicht waren, haben Sie doch nichts zu befürchten«, sagt Medina.
»Ich habe sowieso nichts zu befürchten.«
»Was hast du eigentlich für ein Problem, Junge?«, fragt Grabowski.
Darauf fällt mir nichts Schlaues ein, also antworte ich nur mit einem Achselzucken. Und dann stehen sie beide da, übermüdet und entnervt. Medina gibt mir seine Karte. Er macht sich nicht mehr die Mühe, noch etwas zu sagen, bevor sie sich umdrehen und gehen.
Mit einem Blick über die Schulter sagt Grabowski: »Wir bleiben in Kontakt.«
Die beiden scheinen zwar in Ordnung zu sein, aber darauf will ich es lieber nicht ankommen lassen. Nicht nach dem letzten Mal, wo ich auch das Richtige tun wollte. Ich warte, bis auch Medina sich noch mal kurz umdreht, damit er sieht, wie ich seine Karte auf den Boden werfe.
*
Warum Chell unbedingt in Brooklyn wohnen wollte, habe ich nie verstanden.
Aber ich habe da so meine Vermutung. Wahrscheinlich war es für sie aus Ohio stammend leichter, dorthin zu ziehen als in ein anderes Viertel. Die Gebäude in Brooklyn sind zwar auch hoch, aber nicht so hoch.
Ihr Apartment war größer als meins, und trotzdem verging kein Tag, an dem sie nicht im East Village war. Mit dem Geld, das sie für U-Bahn und Taxis ausgegeben hat, hätte sie schon fast das Haus neben meinem kaufen können.
Brooklyn mag ganz nett sein, aber wahrscheinlich in erster Linie für Rentner. Selbst wenn noch nicht Sperrstunde ist, kommt man sich da wie in einer Geisterstadt vor. Mir begegnen nur sechs Leute, während ich mit meinem überrösteten Kaffee aus der Bodega am anderen Ende der Straße zu dem Haus gehe, wo Chell gewohnt hat. Und ob der Typ in dem schwarzen Wagen vor dem Gebäude ein Cop ist oder ob er nur auf jemand wartet, ist mir nicht klar.
Auf der Fahrerseite liegen haufenweise Zigarettenkippen am Boden. Der Wagen ist zwar kein Impala, sondern ein Ford Focus, aber das heißt keineswegs, dass es sich nicht um einen Undercovereinsatz handelt. Für mich heißt das jedenfalls, dass es keine gute Idee wäre, jetzt den Ersatzschlüssel unter dem Basilikumtopf hervorzuholen und die Tür aufzuschließen.