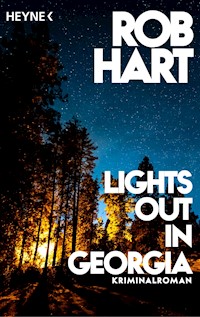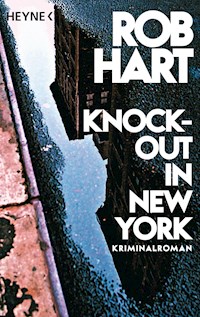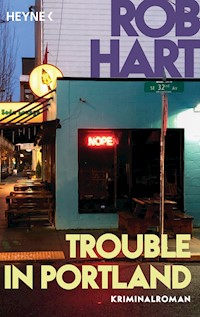
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die McKenna-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Lässig, cool und schlagfertig
Ash McKenna ist gut darin, Leute aufzuspüren – aber nicht darin, einer guten Prügelei aus dem Weg zu gehen. Um seiner düsteren Vergangenheit in New York City zu entfliehen, zieht der Amateurdetektiv nach Portland, Oregon, wo er einen Job als Türsteher in einem veganen Stripclub annimmt. Als ihn die Tänzerin Crystal bei der Suche nach ihrer kleinen Tochter um Hilfe bittet, tritt er unbarmherzigen Drogendealern auf die Füße und wird in den Skandal um einen der mächtigsten Männer der Stadt verwickelt. Ash ist wild entschlossen, das Mädchen sicher zurückzubringen—selbst wenn er dafür alle Grenzen überschreiten muss...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Ähnliche
DAS BUCH
Ash McKenna ist gut darin, Leute aufzuspüren – aber nicht darin, einer guten Prügelei aus dem Weg zu gehen. Um seiner düsteren Vergangenheit in New York City zu entfliehen, zieht der Amateurdetektiv nach Portland, Oregon, wo er einen Job als Türsteher in einem veganen Stripclub annimmt. Als ihn die Tänzerin Crystal bei der Suche nach ihrer kleinen Tochter um Hilfe bittet, tritt er unbarmherzigen Drogendealern auf die Füße und wird in den Skandal um einen der mächtigsten Männer der Stadt verwickelt. Ash ist wild entschlossen, das Mädchen sicher zurückzubringen – selbst wenn er dafür alle Grenzen überschreiten muss …
DER AUTOR
Rob Hart hat als politischer Journalist, als Kommunikationsmanager für Politiker und im öffentlichen Dienst der Stadt New York gearbeitet. Die Dystopie »Der Store« ist sein erster Roman. »Trouble in Portland« ist nach »Knock-out in New York« der zweite von fünf Teilen der Krimireihe um Privatermittler Ash McKenna. Rob Hart lebt mit Frau und Tochter auf Staten Island.
ROB HART
TROUBLE IN PORTLAND
Aus dem Amerikanischenvon Heike Holtsch
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe CITY OF ROSEerschien erstmals 2016 bei Polis Books, Hoboken
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 02/2022
Copyright © 2016 by Rob Hart
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © mauritius images / Frank DiMarco / Stockimo / Alamy
ISBN 978-3-641-24537-5V003
www.heyne.de
Für meine Eltern. Was immer man beim Lesen dieses Buches auch denken mag, sie haben bei meiner Erziehung einen tollen Job gemacht.
»Und nun läufst du nach Haus zu deiner Mutter. Sag ihr, es ist alles in Ordnung und es wird jetzt Ruhe sein.«
Aus: Mein großer Freund Shane
EINS
Ein schlapper Schlag, ohne Schwung aus der Hüfte, bloß aus der Schulter und in so hohem Bogen, dass es auch eine Neonröhre hätte sein können. Er trifft mich seitlich am Kopf, direkt unter dem Ohr. Ein Außenstehender mag das vielleicht für einen guten Treffer halten, aber ich selbst merke kaum was davon.
Der Milchbubi in Retro-Shirt und viel zu enger Jeans, der den Treffer gelandet hat, schüttelt sich die Finger aus und tänzelt mit herausforderndem Blick und dämlichem Grinsen vor mir herum, als hätte er gerade erst entdeckt, was für ein harter Typ er ist.
Zufrieden, weil er es mir so richtig gezeigt hat, packen seine Kumpels ihn an den Armen und zerren ihn mit einem riesigen Getue von mir weg. Als ob sie mir damit einen Gefallen täten.
Ich muss fast laut loslachen.
»Das … hast du nun davon«, lallt der Milchbubi. »Du blöde Schwuchtel mit deinem blöden Hut.« Er reißt sich von seinen Kumpels los, streckt seine Hühnerbrust raus und plustert sich vor mir auf. »Nächstes Mal kannst du dich auf was gefasst machen!«
Die anderen beiden warten auf meine Antwort, aber ich zucke nur mit den Schultern. Auf so einen Schwachsinn habe ich keine passende Erwiderung, jedenfalls keine, die nicht ein paar ausgeschlagene Zähne beinhalten würde. Es gab Zeiten, da hätte ich das ernsthaft in Betracht gezogen. Aber jetzt beobachte ich einfach nur, wie diese drei Schwachköpfe mit Gelächter unter dem dunkelblauen Nachthimmel in Richtung der nächsten Straßenecke verschwinden.
Kontrolliere deinen Ärger, bevor er dich kontrolliert.
Tief ein- und ausatmen.
Ein paar Leute sind nach draußen gekommen. Sie tun so, als wollten sie bloß eine rauchen, dabei wollen sie in Wirklichkeit sehen, was hier los war. Und jetzt sind sie wahrscheinlich enttäuscht, weil der Gehsteig nicht voller Blut ist. Ich tippe mir an die Krempe meines Cowboy-Strohhuts und gehe wieder rein ins Naturals.
Da die drei Idioten weg sind und die meisten anderen vor der Tür stehen und rauchen, ist es drinnen fast leer. Drei Männer und zwei Frauen hocken mit ihren Drinks an der Bar, die sich vor der Wand rechts neben der Tür befindet. Ein Stück links davon, vor der erhöhten Bühne, hängen zwei junge Pärchen rum. Für die war der Streit offenbar nicht interessant genug. Die Stehtische rings um die Bühne sind alle leer. Auf einigen stehen ein paar zeitweilig verwaiste Drinks.
Calypso ist auf der Bühne und tanzt zu »Under Pressure« von David Bowie und Freddie Mercury. Mit einer Hand an der Messingstange wirbelt sie herum, streckt den Hintern raus und schleudert ihren dunklen Lockenkopf nach vorn und in den Nacken, während die beiden Pärchen ihr Dollarscheine zuwerfen. Ihre dunkle Haut wirkt bei der schummrigen Beleuchtung fast schwarz, und der glitzernde Fetzen zwischen ihren Beinen im Schwarzlicht noch heller.
Tommi steht hinter der Bar und sieht zu mir rüber, sie tut so, als hätte sie nicht das Ganze durchs Fenster mitverfolgt. Als ich mich an die Bar setze, stellt sie mir ein Glas Eiswasser hin und räumt ein anderes Glas ab, um es zu spülen.
»Brauchst du auch noch ein bisschen Eis für dein Gesicht, Ashley?«, fragt sie und betont meinen vollen Namen, als hätte ich mir etwas vorzuwerfen.
»Hat der Typ mich etwa getroffen? Hab ich gar nicht gemerkt.«
Sie dreht sich um und stellt das gespülte Glas zu den anderen vor die in allen Regenbogenfarben schillernde Batterie an Flaschen. Dann stützt sie sich mit ihren massigen Armen, die übersät sind von verblassenden Tattoos, auf den Tresen und beugt sich zu mir herüber, damit ich bei der lauten Musik auch jedes Wort verstehe.
»Ich bin ja Pazifistin«, sagt sie. »Und wie du weißt, will ich keinen Ärger in meinem Laden. Aber das heißt nicht, dass du dich nicht verteidigen darfst. Besonders, wenn so ein Arschloch auf großkotzig macht und rumstänkert. Alle hier wären auf deiner Seite gewesen und hätten bezeugen können, dass du dich nur verteidigen wolltest.«
Pazifistin. Aha.
Ausgerechnet Tommi, die eine Schreckschusspistole mit Klebeband unter dem Tresen befestigt hat, direkt links neben der Spüle. Ist wie mit einem Kondom, sagt sie. Besser man hat eins und braucht es nicht als umgekehrt. Merkwürdige Art von Pazifismus.
Was ich ihr begreiflich machen will, ist Folgendes: Hätte ich mir diesen Typen vorgeknöpft, hätte das Best-Case-Szenario so ausgesehen, dass er mir oder sogar dem ganzen Laden mit einem Anwalt gekommen wäre. So sind diese Typen nämlich.
Auch im Worst-Case-Szenario hätte ich ihm eine verpasst, aber dann hätte ich nicht mehr aufgehört. Und den ganzen Ärger braucht Tommi bestimmt nicht. Ebenso wenig wie ich.
»Sie sind doch jetzt weg«, sage ich. »Und keiner wurde verletzt.«
»Du hättest aber verletzt werden können.«
»Wohl kaum.«
Nach dem Bowie-Mercury-Song läuft »Wasted Life« von Stiff Little Fingers. Calypso hat einen ziemlich guten Musikgeschmack. Und durch die Spiegel hinter dem Tresen und hinter der Bühne sieht es aus, als wäre da ein ganzes Heer von Tänzerinnen.
»Ist schon komisch« sagt Tommi kopfschüttelnd.
»Was ist komisch?«
»Ich hatte gehört, du wärst jemand, der ordentlich austeilt. Der Typ, der dich empfohlen hat, sagte, du wärst richtig gefährlich. Da dachte ich mir, genau so jemanden könnte ich hier gebrauchen. Und dann kriege ich einen Typen, der sich ins Gesicht schlagen lässt und den ganzen Abend lang keine zwanzig Worte rausbringt.«
Ich nehme einen Schluck von meinem Eiswasser. Es ist so kalt, dass es an den Zähnen wehtut. »Enttäuscht?«
Tommi lacht auf – ein Geräusch, das klingt, als käme es von ganz tief unten aus einer Höhle. »Weiß nicht. Vielleicht. Du bist anders, als ich erwartet hatte.«
Achselzuckend trinke ich noch einen Schluck. Meine Wange fühlt sich ein bisschen geschwollen an und brennt.
Bei den letzten Takten von »Wasted Life« sammelt Calypso ihre Klamotten und die zerknitterten Dollarscheine ein. Hinten, an der Tür zur Küche und zur Umkleide, wartet schon Carnage, im Schulmädchen-Outfit und mit rotem Irokesenschnitt, der scharf wie eine Kreissäge mindestens dreißig Zentimeter von ihrem Kopf absteht.
Dank Alleskleber. Das ist nämlich der Trick, hat sie mir erzählt.
Bis Carnage auf der Bühne ist, läuft keine Musik. Wir sind hier in einem Low-Budget-Laden. Einen DJ könnte sich Tommi gar nicht leisten. Deshalb geht die Tänzerin, die von der Bühne kommt, erst mal zu dem staubigen iPod, der mit dem Boxensystem verbunden ist, und gibt die Songs für die nächste Tänzerin ein. Nicht gerade professionell, und irgendwie hat diese Stille in einem Stripclub auch etwas Beklemmendes. Aber es ist okay.
»Wann verrätst du uns denn ein bisschen mehr über dich als nur deinen Namen?«, fragt mich Tommi.
Ich zähle etwas an meinen Fingern ab.
»Was soll das?«, fragt Tommi.
»Hab meine zwanzig Worte für heute Abend schon verbraucht. Also, was steht noch an?«
Kopfschüttelnd, als hätte ich sie jetzt aber so richtig enttäuscht, sagt Tommi: »Toiletten checken und unten alles klarmachen. Morgen kommt eine Bierlieferung.«
Auch so etwas, was Tommi sich noch nicht leisten kann: einen Hausmeister. Ich bin schon im Begriff, mich an die Arbeit zu machen, aber in dem Moment beugt sich Tommi noch mal zu mir rüber. »Und bevor du dann später gehst, sprich mal mit Crystal. Sie braucht Hilfe bei irgendwas und denkt, dafür bist du vielleicht der Richtige.« Tommi zieht eine Augenbraue hoch. »Nach heute Abend frage ich mich allerdings, ob sie damit nicht falschliegt.«
Ich frage gar nicht erst nach einer Erklärung – denn mal ehrlich, die ist mir ziemlich egal –, sondern tippe mir nur an den Hut und drehe mich um.
Mittlerweile läuft auch schon der nächste Song – irgendein Heavy-Metal-Stück, das ich nicht kenne –, und Carnage wirbelt auf der Bühne herum. Sie stößt sich von der Stange ab bis zu einer der dicken Ketten, die in jeder Ecke der Bühne bis zur Decke hochreichen, federt zurück und stoppt so knapp vor dem Bühnenrand, dass sie nicht ins Publikum fällt.
Als ich an ihr vorbeigehe, zwinkert sie mir zu. Das Arschloch, das ich vorhin höflich hinauskomplimentiert habe, hatte nach ihr gegrapscht, was dann zu dem kleinen Showdown draußen vor dem Laden führte. Ich nicke Carnage kurz zu und klopfe laut an die Tür der Damentoilette. Keine Antwort. Also werfe ich einen Blick hinein und sehe, dass sie einigermaßen sauber ist. Später, wenn der Laden zu ist, werde ich da noch mal durchwischen.
Die Herrentoilette raubt mir allerdings jegliche Hoffnung, dass ich an dem Abend glimpflich davonkomme. Der Pfütze auf den breiten grauen Fliesen in der hinteren Ecke nach zu urteilen, hat jemand die Toilette um einiges verfehlt. Penetranter Ammoniakgeruch schlägt mir entgegen. Ich drehe mich sofort wieder um, gehe zu der Nische, wo die Putzmittel stehen, und hole Eimer und Wischmopp.
Dann mache ich mich daran, die Pisse eines betrunkenen Arschlochs aufzuwischen.
Woran erkennt man, wie groß eine Stadt wirklich ist? An der Anzahl der Stripclubs zum Beispiel.
Zu Hause, vor sechs Monaten und einer Million Jahren, war ich nur in einem Stripclub, in irgendeinem dieser Industriegebiete von Queens. In einem anonymen, schwarz gestrichenen Backsteingebäude, das im Dunkeln kaum auffiel.
Draußen standen die Leute Schlange. Es ging überhaupt nicht vorwärts. Ich war wegen des Junggesellenabschieds von einem Kumpel dort, und da einer von den Leuten, die auch eingeladen waren, den Besitzer kannte, konnten wir an der Schlange vorbeigehen. Drinnen gab es dann für uns »Bottle Service«, das heißt, zwei Flaschen mittelmäßigen Wodka und ein paar Kanister Orangen- und Cranberrysaft, solche, die man im Supermarkt kaufen kann. Ich setzte mich an die Bar, bestellte mir einen Whisky und verbrachte den Rest des Abends damit, mir die Frauen vom Leib zu halten, die vor mir rumstrippten, um mir das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Wie ein Schwarm sonnengebräunter, glitzernder Fliegen schwirrten die um mich rum, und immer wenn man dachte, jetzt sind sie endlich weg, waren sie auch schon wieder da. Der Abend nahm ein schlimmes Ende, als der Junggeselle in einer privaten Nische ohnmächtig wurde und ein paar der Girls trotzdem einen Lapdance mit ihm veranstalteten und später für ihren Aufwand ein paar Tausend Dollar von uns haben wollten.
Aber so ist das eben in New York, und wenn man damit nicht zurechtkommt – selbst schuld.
In Portland ist das ganz anders. Hier liegen die Stripclubs nicht hinter schwarzer Farbe versteckt in einer verlassenen Gegend. Sie sehen aus wie Bars. Manchmal erkennt man sie von außen überhaupt nicht, sondern erst wenn man reingeht und feststellt, dass genauso viele Frauen da sind wie Männer. Klar gibt es auch diese Läden für irgendwelche Verrückte, die gern einen Haufen nackter Frauen sehen. Aber ansonsten ist in Portland in einen Stripclub zu gehen ungefähr so, als ginge man in einer anderen Stadt zum Bowling.
So was wie Lapdance gibt es hier nicht. Die Stripperinnen dürfen einen nicht mal berühren. Das ist per Gesetz verboten. Und ob jemand denkt, man könnte mal eine angrapschen, oder ob jemand von vornherein weiß, dass das gegen die Regeln ist, ist ein großer Unterschied.
Weniger hohe Erwartungen sorgen meistens auch für weniger Stress.
Was ich an den Stripclubs hier in Portland aber am liebsten mag, ist, dass es überall, wo Alkohol ausgeschenkt wird, auch etwas zu essen geben muss. Und wir reden hier von einer Stadt, in der Essen ziemlich ernst genommen wird. Ein schlechtes Essen muss ich hier erst mal finden, es sei denn, ich habe es gemacht. Auf jeder Speisekarte steht mindestens ein Gericht mit dem Zusatz »hausgemacht«. Wenn man nicht selbst Gemüse einlegt, hat man schon längst verloren.
Es gibt einen Club, dessen Besitzer auch noch einen Bauernhof betreibt. Da kriegt man für ein paar Dollar ein saftiges Steak und kann beim Essen zugucken, wie die Girls sich vor einem ausziehen. Was das über die amerikanische Seele aussagt, soll jemand beurteilen, der sich besser damit auskennt als ich.
In dem Club arbeite ich jedenfalls nicht.
Im Naturals ist alles vegan. So neu ist dieses Konzept auch nicht, denn Tommi ist schon die Dritte, die der Ansicht ist, dass nicht-tierische Produkte und Titten gut zusammenpassen.
Fast das ganze Mobiliar ist secondhand, und wenn die Musik zu leise ist, hört man die Bühnenbretter knarren. Der Teppich müsste unbedingt mal ausgetauscht werden. Aber über den Teppich will ich mir nicht zu viele Gedanken machen.
Wie es scheint, schmeckt den Leuten das Essen, das größtenteils aus Hummusgerichten, Tacos mit schwarzen Bohnen und Popcorn mit Kreuzkümmel besteht. Daran, den Code für Nachos mit veganem Käsedipp zu knacken, arbeitet Tommi gerade, kommt aber nicht so recht weiter.
Sie hat auch schon Pläne für den leer stehenden Laden nebenan. Sobald richtig Geld reinkommt, will sie einen Durchbruch machen und ihr Lokal vergrößern. Irgendwann demnächst. Bis dahin läuft es eben noch im kleineren Stil.
Tommi nimmt das Ganze wirklich ernst. Der Name ihres Ladens ist für sie so sehr Programm, dass sie im Naturals nicht einmal Girls mit künstlichen Brüsten auftreten lässt. Auch das ist wahrscheinlich eine Besonderheit, die man würdigen sollte.
Es ist zwar nicht der Job, den ich mir als Kind erträumt habe – Archäologe –, aber übergangsweise ist er gar nicht so schlecht. Jedenfalls bringt er genug zum Leben ein, bis ich mir überlegt habe, was ich als Nächstes mache.
Was hoffentlich bedeutet: irgendwo anders und das möglichst bald.
Als ich mit den Edelstahloberflächen in der kleiderschrankgroßen Küche fertig bin, glänzen sie richtig. Die Küche zu putzen ist das Einzige, was eigentlich nicht zu meinem Job gehört. Aber Sergio musste früher weg, und da habe ich angeboten, es zu übernehmen. Warum denn auch nicht? Sonst würde ich doch sowieso nur allein in meinem Apartment sitzen und die Wände anstarren.
Fast zwei Stunden habe ich gebraucht, um alles sauber zu machen und aufzuräumen. Alle anderen sind mittlerweile gegangen, und nachdem ich Crystal hoffentlich erfolgreich aus dem Weg gegangen bin, brauche ich jetzt nur noch abzuschließen. Aber als ich aus der Küche komme, sitzt sie plötzlich an der Bar, wie aus dem Nichts. Ich weiß gar nicht, wo sie war, während ich geputzt habe.
Sie trägt ihre Alltagskleidung: ein schwarzes T-Shirt und eine enge graue Jeans mit einem Stück nackter cremeweißer Haut dazwischen, dazu schwarz-weiße Stoff-Sneakers. Ihre kleine rote Handtasche steht neben einer Flasche Bier auf dem Tresen. Auf der mir zugewandten Seite ist ihr Haar stoppelkurz, auf der anderen hängt es ihr wie ein Vorhang über Schulter und Rücken bis fast zur Taille. Ihr Gesicht ist leicht gerötet, frisch abgeschminkt.
Kerzengerade sitzt sie da, als wolle sie vor jemandem posieren. Aber so sitzt sie eigentlich immer.
Als ich auf sie zugehe, steht sie auf. Ihr Tonfall ist ungezwungen und ihre Körperhaltung auch, aber ihre Augen, diese kristallklaren blau-grünen Augen, wirken so fokussiert, als würde sie etwas Zerbrechliches vor sich hertragen.
»Hey, Ash. Was macht dein Gesicht?«, fragt sie mich.
Als ich näher komme, weht mir ihr Duft entgegen. Irgendetwas mit Citrus.
»Der Typ hat ausgeholt wie ein Mädchen. Da hättest du wahrscheinlich einen härteren Schlag«, antworte ich.
Aber sie lacht nicht darüber, sondern fragt mich direkt: »Können wir rausgehen?«
Also gehen wir nach draußen. Ich ziehe die Tür zu und verriegle sie mit dem Vorhängeschloss. Die Straße ist menschenleer, das Laternenlicht schimmert gelblich, und es riecht nach Meer.
Crystal holt eine lange, dünne Zigarette hervor. Mit dieser zwischen den Lippen und einem kleinen weißen Feuerzeug in der Hand sieht sie mich an. »Ich weiß, die sind eigentlich für Mädchen, aber willst du auch eine?«
Um ehrlich zu sein, ja. Schon wenn ich die Zigarette sehe, spüre ich den ersten Zug und das Nikotin, das mir in den Kopf steigt. Aber ich hatte ja beschlossen, meinen Körper nicht mehr ständig mit Gift vollzupumpen. Es ist nämlich noch nicht allzu lange her, da war mein Blut eine Mischung aus Whisky, Nikotin und allen möglichen Drogen, die ich in die Finger bekam.
Ich schüttele den Kopf und lehne mich gegen die Tür. »Du wolltest mit mir sprechen?«
»Ich hab so einiges über dich gehört. Dass du, als du noch in New York gewohnt hast, Privatdetektiv warst.«
Oh, Scheiße! Das kann sie nur von Tommi haben.
Als ich diesen Job im Naturals bekam, nachdem ich in New York so ziemlich alles in meinem Leben verbockt und beschlossen hatte, in die Welt hinaus zu ziehen – oder zu fliehen, je nachdem, wie man es nimmt –, da merkte ich erst mal, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt eine Arbeit zu finden, wenn man niemanden kennt. Und wenn man nicht über markttaugliche Fähigkeiten verfügt, ist es noch um einiges schwieriger. Also telefonierte ich von zu Hause ein paar Bars ab, weil ich mir dachte, irgendjemand wird schon jemanden kennen, der jemanden kennt, der mir einen Job als Barkeeper oder Tellerwäscher besorgen kann.
Daraufhin erzählte mir mein Freund Dave, in dessen Bar ich vorher gearbeitet hatte, von der Eröffnung eines Stripclubs, für den noch ein Türsteher gesucht wird. Eigentlich wollte ich keinen Job als Türsteher, weil ich fürchtete, das könnte meine pazifistischen Bestrebungen torpedieren. Aber dann hörte ich, dass es in Portland recht zivilisiert zugehen soll. Abgesehen davon hatte mein Konto schon Staub angesetzt, und meine Hoffnung auf einen anderen Job schwand immer mehr.
Meine offizielle Bezeichnung lautet auch gar nicht Türsteher. Ich habe nämlich überhaupt keine Lizenz als unbewaffneter Personenschützer, aber das interessiert hier keinen. Ich habe auch noch genug anderes zu tun, sodass ich bei einer Kontrolle einfach sagen könnte, ich wäre der Hausmeister. Tommi hält es gern einfach. Und diesbezüglich bin ich ganz auf ihrer Linie.
Also zog ich den Job in Betracht, und weil Dave mich als echten Gewinn darstellen wollte, hat er Tommi mehr über mich und darüber, was ich vorher gemacht habe, erzählt, als mir lieb war.
Und so stehe ich jetzt da.
»Ich war kein Privatdetektiv mit Lizenz und so weiter«, erkläre ich Crystal. »Das war anders, als man sich diesen Beruf vorstellt. Ich war eher der Mann fürs Grobe. Die Leute haben sich an mich gewandt, wenn sie etwas geregelt haben wollten, und dann habe ich das erledigt. Manchmal haben sie mich dafür bezahlt oder anderweitig entschädigt. Aber diese Art von Arbeit mache ich nicht mehr.«
Crystal zieht kräftig an ihrer Zigarette und bläst den Rauch aus. »Ich brauche Hilfe. Eigentlich kenne ich dich kaum, aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.«
»Bedaure, aber …«
»Es geht um meine Tochter. Sie ist verschwunden.«
Wie eine Woge rollen Crystals Worte durch den gelblichen Lichtnebel auf mich zu.
Und ehe ich mich beherrschen kann, höre ich mich fragen: »Was ist passiert?«
»Ihr Vater, also mein Exfreund, hat sie aus dem Kindergarten abgeholt. Obwohl er das gar nicht darf.«
»Klingt nach einem Sorgerechtsstreit.«
»Dirk und ich waren nie verheiratet. Also gab es keine Scheidung. Deshalb stand auch kein Sorgerecht oder Besuchsrecht oder so etwas zur Debatte. Er hat einfach nicht das Recht, sie bei sich zu haben.«
Ich zucke die Achseln. »Dann geh doch zur Polizei.«
Sie sieht mir mit einem Blick in die Augen, als wolle sie ein Loch hineinbrennen. Um mir klarzumachen, dass das, was sie als Nächstes sagen wird, nichts ist, wofür sie sich schämen müsste. Ich kenne diesen Blick, auch wenn es mir noch nie gelungen ist, ihn selbst aufzusetzen.
»Ich war mal abhängig«, sagt sie. »Als ich schwanger wurde, habe ich sofort damit aufgehört und mir geschworen, dass ich nie wieder was anrühre. Aber für die Cops bin ich eine Ex-Junkie-Stripperin. Die würden mir meine Tochter wegnehmen. Hast du eine Ahnung, was für eine totale Scheiße Kindern passieren kann, wenn sie in Pflege kommen?«
Ich nicke. »Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber machst du dich nicht ein bisschen zu sehr verrückt?«
»Das ist nicht einfach irgendeine unbegründete Angst«, gibt Crystal in einem Ton zurück, als hielte sie mich für ein ziemliches Arschloch, womit sie möglicherweise recht hat. »Ich kenne eine Frau, die ist in der gleichen Situation wie ich: alleinerziehende Mutter, tanzt auch in einem Club und hat keine Familie. Da ist der totale Mist abgelaufen, weil irgendein Sozialarbeiter, der päpstlicher ist als der Papst, der Meinung war, dass das für eine Mutter nicht geht. Er hat ihr einen richtigen Job als Kellnerin besorgt, wodurch sie natürlich große finanzielle Einbußen hatte. Da hat der Sozialarbeiter dann gesagt, sie verdient zu wenig. Jetzt darf sie ihren Sohn nur noch unter Beobachtung sehen, bis diese Scheiße geklärt ist. Das ist doch schrecklich! So ein Risiko gehe ich nicht ein.«
»Okay. In dem Punkt muss ich dir recht geben.«
»Ich brauche doch nur jemanden, der ihn findet und meine Tochter da wegholt. Damit will ich auch gar nicht sagen, dass mein Ex gefährlich ist, sondern nur, dass er vielleicht eher auf jemanden hört, der mindestens genauso groß ist wie er. Wenn ich da auftauche … geht das bestimmt nicht gut aus.«
»Wie meinst du das?«
»Er hat mich früher schon mal geschlagen. Ich würde zurückschlagen. Und ich will nicht, dass meine Tochter so etwas mitbekommt. Außerdem weiß ich nicht mal genau, wo er überhaupt ist.«
Das wirkt wie ein zündender Funke in meiner Brust. Ich mag es grundsätzlich nicht, wenn Männer Frauen schlagen. Und dennoch. »Ich mache diese Art von Jobs nicht mehr. Und wenn er dich schlagen würde, wäre das etwas, was man sofort klären müsste. Wenn deine Tochter da in Gefahr ist …«
»Er hat mich nicht gut behandelt. Aber meine Tochter schon. Wenn er nicht so verkorkst wäre, würde er vielleicht sogar einen guten Vater abgeben. Ich bin mir sicher, dass er ihr nichts antut. Aber das heißt nicht, dass er sie einfach mitnehmen kann. Jedenfalls ist es nicht so, dass man Angst vor ihm haben müsste.«
Das hört sich an, als wollte sie ein verschrecktes Kleinkind beruhigen.
Am liebsten würde ich jetzt sagen: Wenn du wüsstest.
Stattdessen sage ich: »Wende dich an Hood. Oder an jemand anderen, den du kennst. Tut mir leid. Aber ich bin nicht der Richtige für so was. Viel Glück. Das meine ich ganz ehrlich.«
Ihr Gesicht nimmt einen scharfen Zug an. Ich drehe mich um und mache mich auf den Weg zu meinem Apartment – ohne ihr die Möglichkeit zu geben, noch etwas zu sagen.
Ich gehe durch die West Burnside Street, vorbei an den Obdachlosen, die auf dem Gehsteig sitzen. Ich weiß nicht, warum die immer ausgerechnet da kampieren. Vielleicht ist in der Nähe eine Unterkunft. Und vielleicht hat die eine magische Anziehungskraft. Einige hauen mich um Kleingeld an, aber die meisten kennen mich schon und versuchen es gar nicht erst, weil sie kapiert haben, dass ich ihnen sowieso nichts gebe.
Und das liegt nicht an irgendeiner Geisteshaltung, sondern schlichtweg daran, dass ich nichts übrig habe.
Es ist eine laue Nacht, fast sommerlich warm, sodass ich um die Zeit im T-Shirt rumlaufen kann, ohne das Gefühl zu haben, ich wäre falsch angezogen.
An der Burnside Bridge wird es etwas kühler. Auf dem Fußgängerweg ist niemand, und wenn nicht gerade eins der wenigen Autos vorbeifährt, ist es so still, dass ich das Plätschern des Willamette unter mir hören kann.
Als ich die Brücke zur Hälfte überquert habe, bleibe ich stehen, obwohl ich in der frischen Luft Gänsehaut bekomme. Ich stütze die Arme auf das Geländer und schaue über den Fluss: auf die bescheidenen Ausmaße der Stadt, die gedämpften Lichter und die Häuser, die nicht hoch genug scheinen.
Gewissermaßen die Junior-Version einer Stadt.
Aber um ehrlich zu sein, erinnert mich all das an meine ursprüngliche Heimat. An West Brighton auf Staten Island, wo ich aufgewachsen bin. Eine Mischung aus Vorstadt und Großstadt, die für meinen Geschmack ein bisschen zu viel von Ersterer hatte. Wo man alles zu Fuß erreichen konnte, auch wenn es manchmal etwas länger dauerte. Da herrschte nach Anbruch der Dunkelheit auf den Straßen auch immer gespenstische Stille.
Und ich muss zugeben, dass ich diesen vertrauten Anblick auch mit ein bisschen Geringschätzung betrachte.
Irgendwie komme ich mir immer noch vor wie ein Tourist. Sechs Monate bin ich jetzt hier, aber es könnte immer noch sein, dass ich von einem Moment auf den anderen meine Sachen packe und zurückfliege, dahin, wo mir alles normal vorkommt.
Um mein East-Village-Apartment herum war immer alles in Bewegung, immer lebendig, immer irgendwelche Lichter. So viele, dass der Himmel kaum noch zu sehen war, und so hell, dass man nachts meinen konnte, es wäre Tag. Hier hingegen ist nur Stille und Feuchtigkeit. Überall ist es grün und schattig. Stille Häuser und Leute, die immer im Halbschlaf zu sein scheinen.
Mein Rhythmus und der Rhythmus dieser Stadt laufen noch nicht synchron. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit, wenn ich länger hierbleibe – was ich vermutlich nicht tun werde. Das ist nicht der richtige Ort für mich. Aber ich weiß noch nicht, wohin ich als Nächstes will. Europa wäre eine Möglichkeit. Ich war noch nie in Europa. Aber um dahin zu kommen, müsste ich mich als blinder Passagier auf ein Schiff schmuggeln oder so.
Und bis dahin werde ich wohl weiter bei jedem Geräusch zusammenzucken, denn hier hört man nicht ständig Sirenen, vorbeiratternde Züge oder lärmende Menschenmassen.
Ich mache mich wieder auf den Weg, und irgendwie habe ich das Gefühl, als ob mich dieser Citrus-Duft verfolgt. Tut mir leid für Crystal und ihre Tochter, aber ich will das einfach nicht mehr, dieses Gefühl von angeschwollenem Fleisch unter meiner Haut und von Blut an meinen Fingern, die sich schmierig anfühlen, wenn ich sie zur Faust balle.
Ist recht angenehm, ein Leben ohne dieses Gefühl.
Heute war der erste Abend seit Langem, an dem ich mir einen Schlag eingefangen habe, und selbst da muss ich überlegen, auf welcher Seite mich dieser Schwachkopf überhaupt getroffen hat.
Mich kopfüber in eine Situation stürzen, in der ich wieder austeilen müsste? Nein danke. So bin ich nicht. Nicht mehr. Dann lieber den Pfad der Rechtschaffenheit und so weiter.
Auf der South East 7th Avenue halte ich mich rechts. Noch ein paar Blocks bis zu meinem Apartment. Da rast ein Auto an mir vorbei und fährt einen halben Block weiter auf den Gehsteig. Der Fahrer steigt aus und rennt auf die andere Straßenseite, verschwindet im Gebüsch.
Ich gehe weiter. Ich will nicht an Crystal und ihre Tochter denken, aber ich tue es trotzdem.
Etwas daran macht mir zu schaffen: dass es um ein Kind geht. Und Crystal hat ja recht. Ich selbst traue den Cops doch auch nicht.
Mir fällt ein, was mein Vater immer sagte, was er mir immer wieder einschärfen wollte: Es gibt Gute und Böse, und die Guten müssen füreinander einstehen. Die Bösen gewinnen nur, wenn man sie lässt. Diese Worte haben mich schon oft genug in Schwierigkeiten gebracht. Aber dadurch sind sie nicht weniger wahr.
Als ich an dem Wagen auf dem Gehsteig vorbeilaufe, geht mit einem leisen Geräusch der Kofferraum auf, wie ein sperrangelweit geöffneter Mund. Ich bleibe stehen, um ihn mir genauer anzusehen. Denn hier ist niemand, und im ersten Moment denke ich, vielleicht habe ich diesen Mechanismus irgendwie ausgelöst.
Da höre ich hinter mir Schritte, aber ehe ich mich umdrehen kann, legt sich ein Arm um meinen Hals und drückt zu. Dann spüre ich etwas Hartes im Rücken. Jede Wette, dass es eine Pistole ist. Angesichts der Stelle kann ich nur hoffen, dass es eine Pistole ist. Spucke sprüht mir ins Ohr, als eine raue Stimme sagt: »Gib mir dein Handy! Ganz langsam. Und dreh dich nicht um!«
Ein Mann. Kräftig. Etwa so groß wie ich. Mehr kann ich nicht feststellen. Verschiedene Szenarien gehen mir durch den Kopf. Und alle enden damit, dass ich erschossen werde. Da rücke ich lieber mein Handy raus, wenn das bedeutet, dass ich den Typen dann los bin. Aber der offene Kofferraum deutet darauf hin, dass es sich hierbei nicht bloß um einen Überfall handelt. Trotzdem greife ich ganz langsam in meine Hosentasche, ziehe das Handy heraus und halte es hoch.
Der Arm um meinen Hals wird gelockert, die Hand schnappt sich das Handy. Der Druck in meinem Rücken wird stärker.
»Jetzt rein da!«, sagt der Mann. »Wir fahren ein Stück. Und wenn ich das leiseste Gefühl habe, dass du mich verarschen willst, erschieße ich dich.«
Ich nehme meinen Hut ab, werfe ihn in eine Ecke des Kofferraums und klettere hinterher, mit dem Gesicht nach unten. Dann schließt sich die Kofferraumhaube.
ZWEI
In gewisser Weise finde ich das Ganze sogar amüsant. Es ist nämlich beileibe nicht das erste Mal, dass ich gezwungen werde, in einen Kofferraum zu steigen. Von daher beunruhigt es mich weniger, als dieses Arschloch vermutlich denkt.
Aber nicht, dass ich begeistert darüber wäre.
Ich versuche mir zu merken, wie oft wir in welche Richtung abbiegen, aber da ich mich in dieser Stadt so gut wie gar nicht auskenne, gebe ich es nach kurzer Zeit auf und taste stattdessen lieber den Kofferraum nach einer Waffe ab. Er ist vollkommen leer. Ich schaffe es sogar, mich ein Stück aufzurichten und in den Radkasten unter der Matte zu greifen, aber auch da: nichts. Nicht mal ein Reservereifen.
Ich wünschte, ich hätte daran gedacht, einen Blick auf das Nummernschild zu werfen, bevor dieser Typ mich hier reinverfrachtet hat. Das wäre immerhin schon mal etwas, und ich bräuchte mir nicht ganz so dämlich vorzukommen. Aber vorerst bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auszustrecken, so gut es geht, und es mir einigermaßen bequem zu machen. Na dann.
Ich habe keine Ahnung, wer der Typ sein könnte. In dieser Stadt habe ich es mir bislang noch mit niemandem verdorben. Alle, denen ich vorher ans Bein gepinkelt habe, sind dreitausend Meilen weit weg, und auch da ist das meiste immerhin so weit geklärt, dass ich nicht das Gefühl habe, ständig einen Blick über die Schulter werfen zu müssen.
Vielleicht ist es einfach mein Karma, und jetzt wird abgerechnet.
Ich habe in meinem jungen Leben schon eine Menge Scheiße gebaut, und solche Dinge lassen sich nicht einfach für immer bereinigen, bloß weil man es gern so hätte. Irgendwann muss man den Tribut ans Universum entrichten. Vielleicht ist es jetzt bei mir so weit.
Im Dunkeln kann man die Zeit schwer abschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gefahren sind, als der Motor abgestellt wird. Der noch warme Wagen macht ein wiederkehrendes Ping-Geräusch, dann höre ich knirschende Schritte, die sich dem Heck nähern.
Die Kofferraumhaube springt auf, und im ersten Moment denke ich, ich sehe nicht richtig. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Dass der Typ, der mir eine Waffe vors Gesicht hält, eine lächerliche, dürftig angepinselte Hühnermaske aus Gummi trägt.
Aber die trägt er tatsächlich. In Rot und Gelb und Weiß, mit leeren Augenhöhlen, die mir entgegenstarren.
Dazu einen anthrazitfarbenen Trainingsanzug. Dem Schnitt und dem Stoff nach zu urteilen, sogar einen richtig teuren. Von ihm selbst kann ich bis auf die gebräunte Haut an den Händen nichts erkennen. In der einen Hand hält er einen kleinen silberfarbenen Revolver, und mit der anderen packt er mich und zerrt mich aus dem Kofferraum. Ziemlich kräftig für seine Größe. »Auf die Knie!«, sagt er.
Ich knie mich auf den Asphalt. Er hat mich in die Richtung geschoben, dass ich die Nummernschilder nicht sehen kann. Wäre ja auch zu schön gewesen.
Wir befinden uns auf der Rückseite eines Lagerhauses. Das erste Morgenrot züngelt unten am Himmel, aber es ist bedeckt, deshalb wirkt alles grau in grau. Es regnet auch, aber nur ein wenig, sodass man sich nicht aufzuregen bräuchte, wenn man ohne Schirm draußen unterwegs wäre.
Die Welt ist schön bei solchem Wetter. Strahlendes Sonnenlicht, bei dem man alle Konturen gnadenlos scharf erkennt, ist immer zu viel. Der Regen macht die Welt erträglicher.
Ich lege den Kopf in den Nacken und schmecke das klare Wasser auf den Lippen. Wenn jetzt die Abrechnung des Universums kommt, wenn das mein letzter Moment auf dieser Erde ist, dann will ich an den Regen denken, wenn eine Kugel mir das Leben wegpustet.
Der Typ tippt mir mit der Waffe an die Schläfe. Genervt, weil er mich aus diesen angenehmen Gedanken reißt, sehe ich ihn an. »Jetzt pass mal gut auf!«, sagt er. »Du wirst diesem Mädchen nicht helfen! Ist das klar?«
Sportlich. Weiß. Keine sichtbaren Narben oder Tattoos, jedenfalls nicht an Händen und Handgelenken, denn mehr sehe ich nach wie vor nicht. Irgendeinen Akzent kann ich nicht heraushören, gedämpft durch die Maske schon mal gar nicht. Aber er war rasend schnell auf dem Laufenden, wenn man bedenkt, dass meine Absage an Crystal gerade mal zwanzig Minuten her war, als er mich geschnappt hat.
»Nimm das Ding ab und droh mir wie ein Mann!«, sage ich zu ihm.
Sein Gesicht kann ich nicht sehen, also kann ich auch keine Reaktion daraus ablesen, aber wie mir scheint, erstarrt er ein wenig, bevor er sagt: »Halt die Klappe. Und hör mir gut zu! Bleib von dem Mädchen weg. Wenn du dich da einmischst, jage ich dir eine Kugel ins Gesicht. Ich finde euch jederzeit, und überall. Die Cops können euch nicht helfen. Die gehören uns nämlich. Hast du das kapiert?«
Eine Frage habe ich dann doch: »Dient diese Maske einem besonderen Zweck oder dem Ausdruck deiner Persönlichkeit?«
Habe ich ihn jetzt so weit gebracht, dass er mich erschießt?
Kann sein.
Der Typ macht einen Schritt auf mich zu. Er riecht nach Rasierwasser. Antiseptisch. Er hält mir die Waffe an die Stirn, drückt fest zu. Das Metall fühlt sich kalt an, hart und teilnahmslos.
Ziemlich dumm von ihm, mir so nahe zu kommen. Ich könnte auf seine Beine losgehen und unter dem Lauf der Waffe durchtauchen, bevor er Zeit hat, einen Schuss abzugeben. Vielleicht hätte er nicht mal die Zeit, überhaupt abzudrücken. Meine Hände sind nicht gefesselt. Ich brauche ihn bloß niederzuschlagen. Wäre ein netter Spaß.
Aber ich tue es nicht.
Stattdessen konzentriere ich mich wieder auf den Regen. Er wird stärker. Kühl, aber nicht zu kalt, und die Luft riecht nach Grün. Es ist absolut still, bis auf meinen stoßweisen Atem und das stärker werdende Plätschern auf dem Asphalt. Steinchen bohren sich in meine Knie. Das Gelände ist umzäunt mit verrostetem Maschendraht, aber die Fläche dahinter umgeben dichte Bäume, deren Blätter schwer vom Regen herunterhängen und hin und her wehen, als wollten sie auf sich aufmerksam machen.
Der Mann macht einen scharfen Atemzug, fast so, als würde er die Nase hochziehen.
Die Steinchen auf dem Asphalt knirschen, als er sein Gewicht auf beide Beine verlagert.
Mein Leben läuft nicht wie ein Film vor mir ab, und ich bin dankbar dafür.
Mit voller Wucht explodiert etwas in meinem Gesicht, aber vollkommen geräuschlos. Vielleicht war der Schuss so laut, dass ich nichts mehr höre. Vielleicht habe ich nicht das Glück eines leichten Todes.
Als ich auf den Asphalt sinke, frage ich mich, wann es wohl um mich herum schwarz wird.
Aber der Schmerz hält an, pocht mit ohrenbetäubender Lautstärke.
Meine Wange schlägt auf dem Boden auf. Das war kein Schuss. Dieser Bastard hat mir mit der Pistole eins übergezogen. Ich liege mit dem Gesicht halb in einer Pfütze, versuche Luft zu bekommen und kriege dreckiges Wasser in die Nase. Und während ich huste und würge, höre ich den Chicken Man sagen: »Da hast du dein Handy zurück.«
Lautes Splittern.
Das Öffnen einer Wagentür. Aufheulender Motor. Der Auspuff bläst mir die Abgase ins Gesicht. Ich drehe mich auf die Seite und versuche das Nummernschild zu erkennen oder sonst irgendetwas Auffälliges, aber da rollt der Wagen schon auf der Straße davon.
Jetzt ist es um mich herum wirklich still.
Mittlerweile bin ich total durchnässt. Mein Gesicht schmerzt. Also rolle ich mich auf den Rücken und bleibe für eine Weile so liegen. Lausche dem Regen – der auf einmal deutlich weniger beruhigend wirkt.
Na ja, immerhin eines kann ich für mich verbuchen: einen richtig harten Schlag an den Kopf abgekriegt, aber trotzdem noch bei Bewusstsein. Und wenn ich keine Gehirnerschütterung davontrage, habe ich echt Glück gehabt.
Nicht dass ich im Moment mehr ausrichten könnte, als einfach nur hier liegen zu bleiben. Mir ist schwindelig, und ich habe das Gefühl, ich muss mich gleich übergeben. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre darin ein kleiner Ziegenbock, der um sich tritt und rauswill.
Es fallen keine Tropfen mehr. Am Himmel geht die Sonne jetzt richtig auf, steht aber noch nicht sehr hoch, nur so viel, dass das Grau ein wenig heller wird, wie schmutziger Schnee. Hat der Regen erst gerade aufgehört oder schon, als das Auto wegfuhr? Meine Gedanken wabern wie Rauchschwaden, sodass ich sie nicht konkret greifen kann.
Es dauert eine ganze Weile, aber irgendwann schaffe ich es, aufzustehen und mich auf den Beinen zu halten. Fühlt sich an, als würde ich wieder fallen. Okay, also vielleicht doch eine Gehirnerschütterung. Was nicht so toll wäre, denn ich weiß zwar, dass es so etwas wie eine Krankenversicherung gibt, aber nur rein theoretisch. Wie so was in der Praxis funktioniert, könnte ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ich gehe erst mal durch, was ich mit Sicherheit weiß:
Wie ich heiße: Ashley McKenna.
Wo ich bin: Vermutlich noch irgendwo in Portland.
Ich schließe die Augen und versuche mir den Text von »Thunder Road« von Bruce Springsteen ins Gedächtnis zu rufen. Das war der erste Songtext, den ich jemals auswendig konnte, also muss ich ihn irgendwo abgespeichert haben. Die ersten paar Zeilen fallen mir auf Anhieb wieder ein. Das heißt, mein Gehirn funktioniert noch, vorerst jedenfalls.
Als Nächstes suche ich nach meinem Handy. Ist gar nicht so leicht zu finden, denn es hat fast die gleiche Farbe wie der Asphalt. Aber nachdem ich ein paarmal im Kreis herumgetappt bin, sehe ich es in einer Pfütze liegen und hebe es auf. Das Display ist gesprungen, sieht aus wie ein Spinnennetz.
Dieser dämliche Hühnerkopf!
Immerhin hat der Drecksack meinen Cowboyhut verschont. Der lag zwar die ganze Zeit im Regen, aber für einen Strohhut ist er ziemlich robust. Sieht ein wenig schief aus, also biege ich ihn wieder zurecht und setze ihn auf.
Meine Beine fühlen sich jetzt ganz okay an. Trotzdem humpele ich ein wenig, aber das fällt wohl kaum ins Gewicht, denn im Moment besteht mein ganzer Körper nur aus Schmerz. So, als könnte jeden Moment etwas reißen. Wo genau bin ich hier überhaupt? Auf dem Parkplatz hinter einem Lagerhaus, das leer zu sein scheint. Das ist alles, was ich weiß.
Leeres Portemonnaie, Handy kaputt und keine Ahnung, wo ich bin.
Oh, Mann! Was für ein beschissener Morgen.
Durch die nasse Kälte, die mir in die Knochen fährt, und auch dadurch, dass ich in Bewegung bin, lässt meine Benommenheit allmählich nach. Das Schwindelgefühl zumindest. Mir ist nur noch ein bisschen schlecht. Und mir tut das Gesicht weh.
Die Gegend hier besteht fast nur aus Werkstätten und Lagerhallen, und die Straßenamen kommen mir alle unbekannt vor. Also richte ich mich nach dem Verkehrsfluss und gehe in die Richtung, in die auch vereinzelte Autos an mir vorbeifahren, bis ich die NW Yeon Street erreiche. Demnach müsste ich mich im Nordwesten Portlands befinden, ungefähr zwei Kilometer nordwestlich vom Naturals. Bis dahin schaffe ich es doch locker zu Fuß.
Ich schlage also die südliche Richtung ein und laufe weiter. Auf dem Weg zu meinem Apartment komme ich ohnehin an dem Club vorbei, also werde ich den erst mal ansteuern. Wenn es sich bis dahin immer noch anfühlt, als säße etwas in meinem Körper nicht mehr richtig fest, könnte ich mir ein bisschen Geld aus der Kasse nehmen und mir für den Rest des Wegs ein Taxi rufen.
Aber ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich auch noch die restliche Strecke zu Fuß zurücklegen werde. Denn obwohl ich übermüdet bin und mein Gesicht immer noch pocht, tut es gut, zu laufen.
Es gibt vieles, was mir hier fehlt. Wichtiges, wie meine Freunde. Und Nebensächliches – zum Beispiel, mir auf dem Heimweg noch im Mamoun’s ein Schawarma zu holen. Eine weitere dieser Nebensächlichkeiten, die ich vermisse und wodurch mir erst klar wurde, dass es sich doch um etwas Wichtiges handelt, ist, dass ich es gewohnt bin, überall zu Fuß hinzulaufen. Das war für mich die einzige verlässlich wiederkehrende körperliche Ertüchtigung.
Aber hier kann man das gar nicht so einfach. Die Stadtviertel gehen nicht ineinander über. Bürgersteige werden einfach unterbrochen. Plötzlich steht man ohne Vorwarnung vor einer Schnellstraße, die einem den Weg versperrt. Und dann ständig diese Brücken.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind gar nicht so schlecht, aber von New York bin ich verwöhnt. Wenn ich da aus dem Haus ging, hatte ich sechs Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Hier muss man erst mal die Busstrecken auswendig lernen. Und hier gibt es Straßenbahnen. Wirken ein bisschen komisch. Öffentliche Verkehrsmittel fahren hier auch nicht rund um die Uhr und nicht überallhin, was ich natürlich suboptimal finde und von daher keinesfalls befürworte.
Und wenn man sich ein Taxi nehmen will? Dann kann man nicht einfach auf die Straße springen und den Arm ausstrecken. Man muss vorher anrufen, und dann wartet man auch noch eine Stunde darauf. Das ist doch wohl grausam!
Viel bin ich hier noch nicht herumgelaufen. Und selbst das wenige beschränkt sich in erster Linie auf den Weg von meinem Apartment zur Arbeit. Vielleicht sollte ich mir irgendwann ein Auto kaufen. Aber bis dahin gehe ich zu Fuß. Das tut gut. Dann habe ich Zeit zum Nachdenken.
Und es gibt eine ganze Menge, worüber ich nachdenken sollte.
Das Naturals ist eigentlich noch gar nicht geöffnet, aber draußen vor der Tür steht schon Hood in einer alten Jeans und einem farbverschmierten Sweatshirt und raucht eine. Ich begrüße ihn mit einem Kopfnicken und er mich mit einem Schulterklopfen. Dann zieht er wieder an seiner Zigarette, bläst den Rauch aus und sagt: »Was für eine Scheiße ist dir denn passiert?«
Ich bleibe stehen, hin- und hergerissen, ob ich ihn nach einer Zigarette fragen soll. Aber nein, ich will nicht schwach werden. Außerdem raucht er Newports, und das macht mir die Entscheidung, ihn nicht anzuschnorren, direkt ein bisschen leichter.
»Du siehst aus, als hättest du ganz schön was draufgekriegt«, bemerkt Hood.
Ich taste mein Gesicht ab und zucke zusammen. Fühlt sich schlimm an. Und sieht wahrscheinlich noch schlimmer aus.
»Jetzt sag doch was, Mann!«
»Alles okay bei mir«, gebe ich mit einem Lachen zurück.
Hood ist ein netter Typ. Die Leute denken immer, er wird Hood genannt, weil er schwarz ist. Das ist doch rassistisch. In Wirklichkeit wird er nämlich so genannt, weil er so riesig scheint wie der Mount Hood, dieser schneebedeckte Berg, den man im Hintergrund von Portland über den Horizont aufragen sieht. Hoods Hals ist breiter als meine Oberschenkel, und von da an abwärts wird dann alles noch breiter. Wenn ich den umhauen müsste, wüsste ich überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. Er erinnert mich ein bisschen an jemanden, den ich von zu Hause kenne. Aber der wichtigste Unterschied ist, dass Hood wirklich nett ist, und Samson dagegen immer den Eindruck machte, als würde er überlegen, ob er mir die Nase brechen soll.
Hood redet auf diese Art, die manche von uns Weißen, die keine Ahnung haben, als »Ghetto Slang« bezeichnen würden. Aber in Wirklichkeit ist er der totale Nerd. Wenn man auf die Idee kommt, Doctor Who zu erwähnen, kriegt man direkt einen zwanzig Minuten langen Vortrag darüber zu hören, warum die Neuauflage der Serie nicht so gut ist wie das Original. Ich habe mal mitbekommen, wie er einen Typen damit zugetextet hat. Der machte ein Gesicht, als würde er alles dafür geben, dass ihm jemand unbemerkt ein paar Drogen zusteckt. Hood ist auch derjenige, der so etwas wie einem Freund hier am nächsten kommt. Wobei mir gerade auffällt, dass ich nicht mal seinen Nachnamen kenne. Oder seinen richtigen Vornamen. Es sei denn, der lautet tatsächlich Hood.
»War das der Typ von gestern Abend?«, fragt er mich.
»Jemand anders.«
»Wie viele Leute wollen dich denn noch fertigmachen?«
»Offenbar zu viele. Was machst du hier eigentlich schon so früh?«
»Crystal wollte was mit mir besprechen. Sie kommt gleich. Und ich muss drinnen sowieso noch ein paar Reparaturen machen.«
Ich kratze mir die Wange – und zucke wieder direkt zusammen. »Also … das klingt jetzt vielleicht etwas nebulös, aber vielleicht lässt du mich lieber mit ihr reden. Ich glaube, ich weiß schon, worum es geht.«
»Wie du willst, Mann. Ich hab ihr gesagt, sie soll hierherkommen, weil mit der Elektrik im Umkleideraum was nicht stimmt und ich das vor heute Abend noch hinkriegen will.«
»Dann kümmere ich mich um Crystal.«
Hood zuckt die Achseln und schnippt seine Zigarette auf die Straße. Dann gehen wir rein. Im Fernseher über der Theke läuft irgendeine Science-Fiction-Serie, die mir unbekannt ist. Mit Robotern und Raumschiffen. »Was ist das?«
»Battlestar Galactica. Kennst du das etwa nicht?«
»Natürlich nicht.«
»Scheiße, Mann. Läuft auf Netflix. Aber wenn du willst, kann ich dir auch die DVD-Box leihen.«
»Lass mal.«
»Dude, das ist Battlestar! Und du kennst das noch nicht mal?«