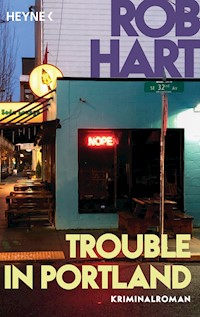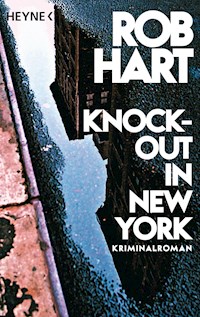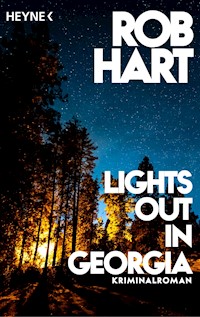
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die McKenna-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Trotz aller guten Vorsätze ist das Leben von Privatermittler Ash McKenna ein Scherbenhaufen. Sein überstürzter Umzug von New York an die Westküste war der Versuch, die Erinnerungen an seine tragische Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch auch in Portland gab es nichts als Ärger. Nun hat Ash einen Toten auf dem Gewissen und flüchtet in die dunkelste Ecke von Georgia, wo er in einer Aussteigerkommune unterkommt. Aber der Tod folgt ihm wie ein Schatten. Nachdem ein Mitglied der Gemeinschaft auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, ist sich Ash gar nicht mehr sicher, ob diese Hippies wirklich so friedlich sind, wie sie tun. Und er muss sich entscheiden: Ergreift er erneut die Flucht, um der Polizei und seinen Dämonen zu entkommen oder setzt er seine Schnüfflernase ein, um die Tat aufzuklären?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Ähnliche
Das Buch:
Trotz aller guten Vorsätze ist das Leben von Privatermittler Ash McKenna ein Scherbenhaufen. Sein überstürzter Umzug von New York an die Westküste war der Versuch, die Erinnerungen an seine tragische Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch auch in Portland gab es nichts als Ärger. Nun hat Ash einen Toten auf dem Gewissen und flüchtet in die dunkelste Ecke von Georgia, wo er in einer Aussteigerkommune unterkommt. Aber der Tod folgt ihm wie ein Schatten. Nachdem ein Mitglied der Gemeinschaft auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, ist sich Ash gar nicht mehr sicher, ob diese Hippies wirklich so friedlich sind, wie sie tun. Und er muss sich entscheiden: Ergreift er erneut die Flucht, um der Polizei und seinen Dämonen zu entkommen oder setzt er seine Schnüfflernase ein, um die Tat aufzuklären?
Der Autor:
Rob Hart hat als politischer Journalist, als Kommunikationsmanager für Politiker und im öffentlichen Dienst der Stadt New York gearbeitet. Er ist der Autor des Erfolgsromans »Der Store«. »Lights Out in Georgia« ist nach »Trouble in Portland« und »Knock-out in New York« der dritte Teil der Krimireihe um Privatermittler Ash McKenna. Rob Hart lebt mit Frau und Tochter auf Staten Island.
ROB HART
LIGHTS OUT IN GEORGIA
Aus dem Amerikanischenvon Heike Holtsch
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe South Village erschien erstmals 2016 bei Polis Books, Hoboken
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 06/2022
Copyright © 2016 by Rob Hart
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock.com
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24539-9V001
www.heyne.de
Für Amanda
Für alles
»Wir leben nicht
Wir schrammen nur von Tag zu Tag
Mit nichts als Streichhölzern und Sarkasmus in den Taschen
Und warten dabei bloß auf etwas, worauf zu warten sich lohnt.«
Aus »Dogma« von KMFDM
EINS
Ich habe einen Typen umgelegt.
Die Frau hinter der Glasscheibe starrt mich an, als wäre ich in etwas Verfaultes getreten und als hätte es sich genau jetzt von der Sohle einer meiner Stiefel gelöst, um in der Hitze weiter zu verrotten. Das jagt mir Angst ein. Habe ich es vielleicht gerade laut ausgesprochen? Dass ich jemanden getötet habe. Für einen Moment bleibe ich reglos stehen, als hingen diese Worte noch in der Luft. Und frage mich, ob mich sonst noch jemand anstarrt.
Denn es stimmt. Ich habe wirklich einen Typen umgelegt. Und manchmal fangen meine Stimmbänder an zu vibrieren, als ob ich jeden Moment damit herausplatzen wollte.
Wenn ich irgendwo an der Kasse stehe: Mit Karte bitte, und übrigens, ich bin ein Mörder.
Wenn ich auf den nächsten Bus warte: Das dauert ja ewig! So ewig wie meine Verdammnis.
Wenn ich ein paar Worte mit jemandem wechsele: War echt schön in Portland, abgesehen davon, dass ich einen Totschlag begangen habe und abgehauen bin, um die Frau zu beschützen, in die ich mich gerade erst verliebt hatte.
Niemand starrt mich an. Auch die Temperatur in dem Raum hat sich nicht verändert. Vielleicht hat mir mein Gehirn einfach nur einen Streich gespielt. Weil mein Schuldzentrum darauf anspricht, dass ich hier bin.
»Sir?«
Es war nicht mit Absicht. Ein guter Anwalt würde vermutlich sogar auf Notwehr plädieren. Wobei ich mir allerdings ziemlich sicher bin, dass er damit nicht durchkäme, weil ich die Leiche abseits eines Wanderwegs im Wald vergraben habe. Ganz gleich, ob gerechtfertigt oder nicht, ich habe ein Licht gelöscht, das nicht mehr anzumachen ist.
Manchmal frage ich mich, ob man es mir bei genauerer Betrachtung ansehen kann. Wie bei einem Stereogramm – einem dieser psychedelischen 3D-Bilder, in denen man, wenn man lange genug darauf starrt, einen Vogel oder das Peace-Zeichen erkennt. Und wenn man mich länger ansieht, entdeckt man anstelle eines Vogels oder Peace-Zeichens eine finstere Kluft, die meine Seele spaltet. Aus der sowohl Hass als auch Reue aufsteigen.
»Sir!«
Ich schrecke zurück, vor den grauen Wänden, dem abgetretenen Teppichboden. Vor dem bläulich weißen Neonlicht. Die Frau hinter der Scheibe hat noch immer den Blick auf mich gerichtet. Brillengläser dick wie die Böden von Cola-Flaschen vor ihrem quadratischen Gesicht, schiefergraues Haar zu kleinen Löckchen aufgedreht. Laut dem schwarzen Namensschild mit der weißen Schrift, das an ihrer leuchtend grünen Bluse steckt, heißt sie Rhonda.
»Verzeihung«, sage ich.
»Die Formulare«, sagt Rhonda und zeigt auf den Schlitz unter der Glasscheibe. Ich schiebe den Stapel Papiere hindurch. Sie blättert die Formulare durch, wirft einen prüfenden Blick auf die ausgefüllten Kästchen. »Hmm, Ashley.« Den Namen lässt sie sich auf der Zunge zergehen, so wie die meisten Leute, wenn sie ihn zum ersten Mal hören.
»Das bin ich«, sage ich. »Die moderne Version von ›A boy named Sue‹.«
»Guter Song.«
Rhonda lächelt mich an, und plötzlich wirkt ihr Gesicht nicht mehr ganz so scharfkantig.
Scheinbar sind wir jetzt Freunde.
»Können Sie sich ausweisen?«, fragt sie.
Ich schiebe meinen Führerschein unter der Glasscheibe hindurch, und Kopien meines Sozialversicherungsausweises und meiner Geburtsurkunde, dann noch meine Kreditkarte und den Bibliotheksausweis des Staates Georgia, den ich mir gestern zugelegt habe.
Der Bibliotheksausweis war mein Trumpf. Als ich vor neun Monaten aus New York wegging, habe ich meine offizielle Adresse nicht ändern lassen. Und da ich jetzt in einem Staat, in dem sich nicht mein offizieller Wohnsitz befindet, einen Pass beantrage, brauche ich zusätzlich noch etwas, womit ich mich ausweisen kann. Scheint eine ziemlich niedrige Hürde, deshalb frage ich mich, was das Ganze überhaupt soll.
Rhonda sieht von den Papieren auf. »Haben Sie einen Beleg für Ihre geplante Reise?«
Auch die Kopie meines Tickets schiebe ich unter der Glasscheibe hindurch, für einen Flug nach Prag in zwei Wochen. Rhonda wirft einen Blick auf das Ticket und sagt: »Da müssen Sie sich unbedingt die Knochenkirche ansehen.«
»Knochenkirche?«
»Das Sedletz-Ossarium unter der Allerheiligenkirche in Kutná Hora. Ist beeindruckend.«
»Mache ich.«
Im Stillen wiederhole ich den Namen dieses Ortes noch mal, um ihn mir zu merken. Obwohl ich Sightseeing ehrlich gesagt nicht auf dem Plan habe. Ich habe lediglich einen Job in Aussicht, und das auch nur vage, bei einer Firma, die Verwandten eines alten Freundes gehört. Der eigentliche Grund, das Land zu verlassen, ist der Tote.
Dabei ist es nicht so, dass die Cops hinter mir her wären. Ich bin nicht auf der Flucht. Aber ich bewege mich am Rand eines tiefen Abgrunds, und ich hatte schon immer vor, mir die Welt anzusehen. Wenn es einen richtigen Zeitpunkt dafür gibt, dann ja wohl jetzt.
Wobei ich mich natürlich frage, ob die Tschechische Republik ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten hat. Darüber sollte ich mich wohl mal informieren.
Rhonda tippt abwechselnd auf ihrer Tastatur herum und knallt Stempel auf die Formulare, scheinbar willkürlich und mit solcher Kraft, als wäre sie total sauer auf den Papierstapel.
»Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen«, sagt sie dann. »Die Fotos?«
Die hätte ich auch fast vergessen, dabei halte ich sie schon bereit. Ohne noch einen Blick darauf zu werfen, schiebe ich sie unter die Glasscheibe. Ich hatte sie mir kurz angeschaut, nachdem ich sie in einem Drug Store ein paar Häuser weiter hatte machen lassen. Und da hätte ich mich beinahe nicht erkannt, mit dem buschigen Bart, den ich mir habe wachsen lassen, seit ich aus Portland weg bin. Ich dachte nämlich, anders auszusehen wäre von Vorteil. Und ein Bart ist ja eine preisgünstige Verkleidung. Jedenfalls ist mir damit sicher nicht ganz so unbehaglich zumute, wenn ich einem Cop über den Weg laufe.
Doch wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich mich selbst eigentlich gar nicht sehen will.
Aber immerhin habe ich einen dichten Bartwuchs, auch wenn sich dieses dämliche Gestrüpp bei der hohen Luftfeuchtigkeit hier ständig klamm und kratzig anfühlt.
»Kurz vor Ihrer Reise müssten Sie Ihren Pass dann erhalten«, sagt Rhonda. »In der Regel nach sieben bis acht Tagen. Manchmal auch nach sechs, je nachdem, wie viel die Kollegen in der Bearbeitungsstelle zu tun haben. Die Gebühren für die beschleunigte Ausstellung und Über-Nacht-Zustellung betragen …«
Ich schiebe das exakt abgezählte Geld unter der Scheibe durch.
Rhonda nimmt es entgegen, bestätigt mit einem Kopfnicken, dass der Betrag stimmt, und legt die Scheine zu dem Stapel Papiere. Sie gibt mir meinen Führerschein, den Bibliotheksausweis und meine Kreditkarte zurück. Schließlich ringt sie sich noch ein erschöpftes Lächeln ab. »Gute Reise, Sir. Und vergessen Sie nicht die Knochenkirche. Sedletz-Ossarium.«
»Merke ich mir. Vergesse ich bestimmt nicht.«
Dann drehe ich mich um und gehe. Der Raum ist fast leer. Nur auf zweien der Bänke sitzen Leute und warten. An der Tür steht mit verschränkten Armen ein Wachmann. Als ich reinkam, war der noch nicht hier. Groß und kräftig, kahl geschorener Schädel, der im kalten Licht glänzt, und ein Gesicht, als würde er geradezu Ausschau nach etwas halten, was ihm die Laune verdirbt. Unsere Blicke begegnen sich, eigentlich nur zufällig, aber dann kommt es doch zu einem längeren Augenkontakt.
Erst denke ich, so ist das manchmal mit Fremden, ein Moment, der schnell vergeht und den man sofort wieder vergisst. Aber dann denke ich: Erkennt der mich etwa?
Ist mein Name in irgendeinem Computerprogramm aufgetaucht, und die Frau hinter dem Schalter hat den lautlosen Alarmknopf gedrückt? Oder dem Wachmann ein Handzeichen gegeben? Ist das jetzt der Moment, in dem mein Leben um mich herum zusammenstürzt?
Die Welle trifft mich mit voller Wucht.
Sie rauscht in meinen Ohren und zieht mich runter in die Finsternis. Flutet meine Augen, meine Nase und meine Kehle, bis mir die Luft wegbleibt. Panik sticht mich mit ihrem spitzen Finger. Die Sauerstoffzufuhr zu meinen Lungen ist gekappt. Mit aller Kraft versuche ich, sie wieder aufzubauen, aber es ist, als hätte ich einen Motor abgewürgt. Als würde ich durch die Dunkelheit geschleudert, ohne zu wissen, wo oben und unten ist.
Der Wachmann kommt auf mich zu.
Es tut mir so leid, Dad. Es tut mir so leid, Chell.
Ich bin benommen, kurz davor, zu Boden zu gehen. Da packt mich der Wachmann unter den Armen, zieht mich hoch und fragt: »Alles okay, Kiddo?«
Das Schleudern hört auf. Ich spüre wieder festen Boden unter den Füßen. Ich sehe mich um. Sehe den Wachmann an, dann Rhonda, und dann die Leute im Wartebereich. Alle starren mich an. Alles ist plötzlich total still.
Ich nicke. »Ja. Bin nur … erschöpft. Entschuldigung.«
»Brauchen Sie Hilfe? Soll ich Ihnen vielleicht ein Taxi rufen?«
Ich schüttele den Kopf und mache mich davon. Stolpere aus dem Raum, vorbei an den Fahrstühlen, und stoße die Tür zum Treppenhaus auf. Die drei Treppenabsätze falle ich mehr runter, als dass ich gehe. Als ich endlich draußen bin, sinke ich auf die Knie und muss mich übergeben. Ich weiß gar nicht, was ich da hochwürge. Heute habe ich noch nichts gegessen. Fast alles nur Flüssigkeit.
Als nichts mehr kommt, lehne ich mich mit dem Rücken gegen die Backsteinmauer. Wie eine Decke legt sich die morgendliche Hitze über mich. Das ist angenehm und wird auch noch für eine oder zwei Minuten so bleiben, wie immer, wenn man aus einem stark klimatisierten Gebäude kommt.
Ich klappe meine Umhängetasche auf und hole die mit Isolierband umwickelte Wasserflasche heraus. Ich schraube den Deckel ab, spüle mir den Mund mit etwas Whisky und spucke aus. Dann nehme ich einen kräftigen Schluck. Ein Viertel der Flasche kriege ich runter. Schmeckt säuerlich, ein bisschen metallisch.
Nach ein paar Sekunden trinke ich noch einen kleinen Schluck. Jetzt spüre ich, wie meine Synapsen in Watte gepackt werden.
Lief doch besser, als ich dachte.
ZWEI
Nach einer halben Stunde Fußmarsch ist es heißer, als ich mir jemals hätte vorstellen können. In New York kann es auch heiß werden, aber nicht so. Nicht so mörderisch heiß, als würde man bei lebendigem Leib geröstet.
Nicht eine einzige Wolke ist am Himmel, die Industriegebiete von Atlanta schimmern strahlend blau. Immerhin schön anzusehen. Darauf versuche ich mich zu konzentrieren, und nicht auf mein durchgeschwitztes T-Shirt, das klebt wie eine zweite Haut.
Die Tankstelle ist überfüllt mit Autos, auf dem Weg von oder zu der Schnellstraße. Ich behalte die Angestellten im Blick. Ein paar der Leute im Camp haben mir erzählt, hier sei der ideale Ort, um eine Mitfahrgelegenheit zu finden, aber nur solange der Geschäftsführer einen nicht bemerkt. Ich achte darauf, welche Autos in Richtung der Auffahrt nach Süden stehen, und scanne mit den Augen die Gesichter der dazugehörigen Leute. Vielleicht sieht ja jemand nett aus.
Ich habe immer noch den Geschmack von Erbrochenem im Mund. Vielleicht sollte ich kurz reingehen, um mir ein Päckchen Kaugummi und eine Flasche Wasser zu kaufen. Aber dann müsste ich ein ganzes Stück wieder zurücklaufen. Und ich will endlich von hier wegkommen. Ich nehme noch einen Schluck aus meiner Tarnflasche. Das Isolierband fängt schon an sich zu lösen, sodass man die bräunliche Flüssigkeit hin- und herschwappen sieht.
Ich sehe mich noch mal um und entscheide mich dann für einen älteren Typen: T-Shirt, Cargoshorts, Tattoo-Sleeves an beiden Armen. Buddy-Holly-Brille und Cowboyhut. Tankt gerade einen metallic blauen Wagen auf, der aussieht wie ein Rasierapparat.
Sein Cowboyhut ähnelt dem, den ich mal hatte, und augenblicklich wird mir der Verlust schmerzlich bewusst. Ich hatte diesen Hut wirklich gern.
Ich gehe zu dem Typen. »Richtung Süden?«
Er lächelt mich an, als wären wir alte Freunde. »Yes, Sir.« Mit breitem Südstaatenakzent.
»Brauchen Sie Gesellschaft?«
Er sieht mich stirnrunzelnd an, wahrscheinlich weil es klang wie eine Anmache. Deshalb füge ich hastig hinzu: »Ich suche nur jemanden, der mich ein Stück in Richtung Sterling mitnimmt. Möglichst weit in Richtung Süden. Ich kann Ihnen auch Spritgeld geben.«
»Steig ein, Junge«, sagt der Typ achselzuckend. »Ein Stück kannst du mitfahren.«
Während er die Zapfpistole zurück auf den Haken knallt, setze ich mich auf den Beifahrersitz, und dann höre ich das metallische Klickgeräusch, als er den Tankdeckel zuschraubt. Die graue Innenausstattung des Wagens ist makellos, und obwohl er nicht mehr ganz neu scheint, riecht er so. Der Typ steigt ein, lässt den Motor an, und sofort bläst mir ein kühler Luftstrom ins Gesicht. Angenehm eisig.
Der Typ reicht mir die Hand. »Bill.«
Ich schüttele sie. Sein Handschlag fühlt sich an wie ein Schraubstock. »Johnny.«
Er fährt los, in Richtung I-85.
»Also Johnny, wie kommt es, dass ein kräftig gebauter junger Mann wie du an einer Tankstelle landet und fremde Leute wegen einer Mitfahrgelegenheit anspricht?«
Ach, Scheiße. Ich hatte gehofft, er wäre eher von der Sorte stark und schweigsam. Wie zur Hölle kann man denn einen Cowboyhut tragen und eine Schwatzbacke sein? Also antworte ich: »Hatte was zu erledigen und konnte keine Rückfahrt kriegen. Manchmal muss man eben improvisieren.«
Bill fährt auf die Auffahrt, gibt Gas und fädelt sich in den Verkehr ein, zwischen den anderen Autos hindurch bis auf die linke Spur, wo er dann mit Bleifuß weiterfährt. Die Tachonadel steigt auf über 80 Meilen pro Stunde, was zum Verkehrsfluss passt. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen scheinen hier im Süden ohnehin nur Empfehlungen zu sein. Aber da ich noch dreihundert Meilen vor mir habe, finde ich das ermutigend.
»Ich fahre nach Savannah«, sagt Bill. »Bis runter zur I-95 kann ich dich mitnehmen. Was hältst du davon, Junge?«
»Das ist schon fast die ganze Strecke«, antworte ich. »Mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte.«
Er schaltet das Radio ein und drückt auf die Senderwahltaste, bis AC/DC läuft. Aber er stellt es so leise, dass wir uns weiter unterhalten können.
»New Yorker, oder?«, fragt er.
»Ja, ein waschechter«, gebe ich zurück.
»Hab ich am Akzent gehört. Nicht so deutlich wie in den Gangster-Filmen, aber erkennbar. Wollte immer mal nach New York. Aber hat sich nie ergeben. Wenn ich doch mal hinkomme, was sollte ich als Erstes machen?«
Sofort wieder umkehren. Diese Stadt ist einfach die Pest. Sie hat Chell verschluckt. Und mich fast umgebracht. Wozu ich, ehrlich gesagt, aber auch gehörig beigetragen habe.
»Gehen Sie ins Mamoun’s auf der MacDougal und holen Sie sich ein Shawarma. Das Beste, was Sie je gegessen haben werden.«
»Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist, aber ich werde es mir merken.«
Eine Weile lang fahren wir schweigend weiter. Es ist ein angenehmes Schweigen. Brian Johnson singt von »dirty deeds done dirt-cheap«. Es ist so kühl, dass ich fast anfange zu zittern, als der Schweiß in meinem T-Shirt gefriert. Das muss ich genießen, denn sobald ich aussteige, stehe ich wieder in der brütenden Hitze.
»Was machst du denn so, Junge?«, fragt der Typ.
Die meisten Leute bezeichnen mich als Amateur-Privatdetektiv, aber ich selbst betrachte mich eher als stumpfe Speerspitze. Man gibt mir einen Job, und den erledige ich dann. So war es jedenfalls mal. Zurzeit versuche ich mich nämlich gerade als Koch, weil ich etwas lernen will, das nichts damit zu tun hat, andere Leute zusammenzuschlagen.
Aber all das zu erzählen wäre viel zu kompliziert. Also fasse ich es möglichst einfach zusammen. »Muss ich mir noch überlegen.«
»Und das ausgerechnet in Sterling? Da ist doch nichts los.«
Eben, denn vor allen Dingen muss ich abtauchen.
»Ich wohne da erst mal bei Freunden«, gebe ich zurück.
»Du bist aber nicht gerade redselig.«
»Diese Hitze laugt einen ja auch total aus.«
»Wem sagst du das!«
»Aber erzählen Sie doch mal«, fange ich an, um von mir abzulenken. »Was machen Sie denn so, Bill?«
»Ich bin Tier-Masturbator«, antwortet er. »Einfacher ausgedrückt: Ich hole Kühen und Pferden einen runter.«
Darüber muss ich dann doch lachen. »Moment mal, wie bitte?«
Mit einem herzhaften, dröhnenden Lachen gibt Bill mir einen Klaps aufs Knie, und ich zucke unwillkürlich zusammen. Dann sagt er: »Von einem solchen Job hast du bestimmt noch nie gehört, oder?«
»Nein, tatsächlich nicht. Und ich frage mich gerade, wo Sie Ihre Hand vorher hatten.«
Er hebt den Zeigefinger in meine Richtung. »Ist nicht das erste Mal, dass ich so was zu hören kriege. Aber klar, klingt ja auch ziemlich verrückt. Meine offizielle Berufsbezeichnung lautet Veterinärtechniker. Sei es für eine Forschungsstudie zu Infektionskrankheiten oder für Gentests – tierisches Sperma wird immer gebraucht.« Er tippt sich mit dem Daumen an die Brust. »Und da komme ich ins Spiel.«
»Dann gefällt Ihnen Ihr Job also?«
»Dadurch bin ich oft an der frischen Luft, arbeite mit Tieren. Und ich sorge dafür, dass es ihnen gut geht. Mein Labor betreibt Pionierforschung, und zwar mit dem Ziel, die kombinierte Immundefizienz bei Pferden auszurotten.«
»Keine Ahnung, was das ist.«
»Für Pferde jedenfalls eine schlechte Nachricht, Junge«, sagt Bill. »Ist nicht gerade der spektakulärste Job, den man sich vorstellen kann, ganz bestimmt nicht. Aber jemand muss ihn ja machen, und ich bin zufällig der Richtige dafür.«
»Was genau bedeutet das denn: der Richtige dafür?«
»Geduld, ruhige Hände, und man darf sich nicht allzu ernst nehmen.«
»Klar, leuchtet ein.«
Bill scheint wirklich ein netter Typ zu sein, und wie es ebenfalls scheint, lässt er sich nicht davon abhalten zu reden. Also frage ich ihn: »Wir haben noch ein ganzes Stück Fahrt vor uns. Wollen Sie mir nicht mehr darüber erzählen, was man in Ihrem Job so macht?«
Er lächelt und sagt erstaunt: »Die meisten Leute interessiert das überhaupt nicht.«
»Wieso das denn nicht? Mir ist vorher noch nie jemand begegnet, der Tieren beim Masturbieren hilft, weder als geregelte Arbeit, noch sonst irgendwie.«
»Na gut. Also, dafür gibt es drei verschiedene Methoden: mit künstlichen Scheiden, elektrischen Stimulatoren oder althergebrachter Handarbeit …«
Dann legt er mit seinen Erklärungen los und hört auch so bald nicht wieder auf. Aus meiner Sicht perfekt. Denn erstens interessiert es mich wirklich, und zweitens will ich keine Fragen mehr über mich selbst beantworten. Also höre ich mit halbem Ohr zu, werfe an den passenden Stellen mal »ach« oder »tatsächlich« ein und lasse die Außenwelt an mir vorbeiziehen.
Bäume und Asphalt und Streifen wolkenlosen Himmels.
Georgia in der brütenden Hitze des August.
Ich stehe bis zu den Knien im Schlamm und höre das Schürfen der Schaufel in der Erde, während der Regen mir auf den Rücken prasselt. Als mir etwas in den Arm stößt, hebe ich den Kopf, und da lächelt mich Bill vom Fahrersitz aus an.
»Bist eingedöst, Junge«, sagt er. »Brauchtest wohl mal eine Mütze Schlaf, deshalb habe ich dich nicht geweckt.«
Wir stehen an einer einsamen Tankstelle neben Momma’s BBQ, also genau da, wohin ich wollte. Dabei hatte ich gedacht, ich würde heute nur bis Savannah kommen. Als Bill meinen verwirrten Blick sieht, erklärt er: »Ich hatte es nicht eilig. Da dachte ich mir, ich fahre dich die ganze Strecke. Musst du noch ein Stück weiter in die Stadt?«
»Nein, hier ist es genau richtig«, antworte ich und greife in meine Hosentasche. »Warten Sie, das Spritgeld …«
»Ach was, nicht nötig, Junge«, gibt er zurück.
»Wirklich nicht? Soll ich mich nicht daran beteiligen? Also war die Fahrt wirklich gratis?«
»Wirklich gratis.«
Ich sehe ihn einen Moment lang an, aber hinter der Sonnenbrille kann ich nicht viel erkennen. »Ganz bestimmt?«, vergewissere ich mich noch einmal.
»Du scheinst aber ziemlich misstrauisch zu sein.«
»Ich bin aus New York«, sage ich. »Da bin ich es nicht gewohnt, dass jemand etwas Nettes tut, ohne eine Gegenleistung zu verlangen.«
»Tja, so schlecht ist die Welt eben doch nicht«, gibt Bill zurück und streckt die Hand aus. »Und hier wolltest du wirklich hin?«, fragt er, während wir uns die Hände schütteln.
»Ich muss zu diesem Restaurant da«, antworte ich. »Könnte also gar nicht besser sein.«
Bill nickt. »Dann mach es gut.«
»Sie auch.«
Ich öffne die Wagentür und halte für einen Moment inne. Vielleicht sollte ich ihm meinen richtigen Namen sagen. Vielleicht schulde ich ihm das. Aber dann streife ich den Gedanken ab, steige aus dem segensreich klimatisierten Wagen und stehe in der sengenden Sonne.
Nachdem ich die Beifahrertür geschlossen habe, fährt Bill zurück auf die Straße und winkt mir noch einmal zu. Ich sehe ihm hinterher und wundere mich noch immer. Wie viele Meilen Umweg ist er gefahren? Um die hundert? Komisch. Dass Menschen ohne ersichtlichen Grund nett zu einem sind, ist echt komisch.
Ich drehe mich um zu der Tankstelle. Sie sieht verlassen aus. Bei einem flüchtigen Blick im Vorbeifahren hätte man denken können, sie wäre geschlossen, denn eins der Fenster ist vernagelt, und drinnen brennt kein Licht. Aber der Besitzer ist da. Er sitzt in einem Schaukelstuhl im Schatten der offenen Tür. In seinem Overall. Und so verächtlich, wie er mich und wahrscheinlich jeden anstarrt, sieht er aus wie ein Brückentroll.
Das Momma’s scheint ebenfalls leer. Ursprünglich ein normales zweistöckiges Haus mit umlaufender Veranda und großen Erkerfenstern, sieht es eigentlich gar nicht aus wie ein Restaurant. Das Einzige, was darauf hindeutet, ist das weiße Schild über der Veranda mit dem roten, von Hand gepinselten Schriftzug Momma’s.
Demnach, was ich gehört habe, lief der Laden früher irre gut. Es gab nur Fleischgerichte, bis die für den Rest des Tages aus waren. Wenn man also sicher etwas abbekommen wollte, musste man sich schon im Morgengrauen anstellen. Aber seit dem Platzen der Immobilienblase ist die Gegend ziemlich verlassen, und die neu eröffneten Restaurants liegen alle ein Stück weiter entfernt, da, wo mehr los ist. Trotzdem läuft das Momma’s wohl noch recht gut, aber es ist kein Vergleich mehr zu vorher.
Hier wird auch die Post für uns hinterlegt. Da die Postautos nicht bis hinunter zum Camp fahren, müssen wir uns die Post hierher schicken lassen. Im Gegenzug beliefern wir Luanne, die Besitzerin des Restaurants, mit Kräutern und frischem Gemüse.
Die Eingangstür ist verschlossen, also gehe ich mit hallenden Schritten auf der Veranda um das Haus herum und folge dem Geruch nach über Apfelholz geräuchertem Fleisch. Luanne ist hinter dem Haus und taucht gerade einen Wischmopp in einen Plastikeimer mit einer zähen roten Flüssigkeit. Dann beugt sie sich vor in einen Räucherofen, der aus den Überresten eines dicken Propangastanks besteht. Die Fleischstücke rauchen und prasseln, als Luanne sie mit der Tunke bestreicht. Da ich das Frühstück ausgelassen habe, würde ich am liebsten den Kopf in den Räucherofen stecken und sehen, ob ich etwas abstauben kann.
Als sie meine Schritte hört, lässt sie den Mopp in den Eimer sinken und dreht sich lächelnd zu mir um. Dieses Lächeln treibt mir Gedanken in den Kopf, die sich für einen Gentleman eigentlich nicht gehören. Ihre Hände sind voll roter Barbecue-Sauce, so als hätte sie sie in Blut getaucht. Mit dem Rücken ihres Unterarms streicht sie sich den Schweiß von der Stirn. Und wie sie da steht, die langen Gliedmaßen etwas abgewinkelt, mit diesem Lächeln, das scheint, als wäre ihr Gesicht einzig und allein fürs Lächeln gemacht, und der bronzefarbenen Haut, die im Sonnenlicht schimmert … Verflucht!
»Wie geht’s, Ash?«, fragt sie.
»Gut bis mittelprächtig.«
»Kann ich jetzt schon was für dich tun?«, will sie wissen, und das mit einem Unterton, bei dem man sich nur wundern kann, dass wir nicht augenblicklich nackt dastehen.
»Einen Gefallen vielleicht«, sage ich. »In den nächsten Wochen kommt ein Päckchen für mich. Das ist ziemlich wichtig. Wenn es da ist, kannst du es dann an einem sicheren Ort für mich aufbewahren?«
Sie nickt. »Klar. Ich sorge dafür, dass du es unbeschädigt bekommst.«
»Danke, Mädchen«, sage ich, in der Hoffnung, der Atmosphäre mit dem Wort »Mädchen« die sexuelle Spannung zu nehmen. Und es wirkt, zumindest ein bisschen. Mit etwas weniger Körperspannung bückt sie sich nach dem Eimer.
»Das war’s?«, fragt sie.
»Das war’s. Morgen oder übermorgen kommen wir mit ein paar Körben vorbei. Hast du bis dahin noch genug?«
»Mehr als genug, so alles in allem.«
»Bis dann«, sage ich und tippe mir an die Stirn, bevor ich mich umdrehe und gehe. Wobei ich ihren Blick in meinem Rücken spüre. Und wünschte, ich könnte zurückgehen. Aber Luanne ist nett. So nett, dass ich lieber nichts riskieren will. Sie hängt hier fest und versucht, das Restaurant ihrer Mutter am Laufen zu halten, in diesem Ort, der immer mehr zu einer Geisterstadt wird. Und ich neige dazu, derartige Bande zu durchtrennen. Wenn auch meist nicht mit Absicht, aber es ist eindeutig zu einem Muster geworden, das mir Unbehagen bereitet.
Die Sonne steht in einem solchen Winkel, dass eine Seite der Straße im Schatten liegt. Ich ziehe mein T-Shirt aus und klemme es mir an den Gürtel. Der Fußmarsch dauert ziemlich lange, aber wenn ich an den Bäumen entlanggehe, brauche ich keinen Sonnenbrand zu fürchten. Na immerhin. Die drohend nüchterne Stimme meldet sich, also trinke ich noch einen Schluck Whisky, leere die Flasche und mache mich auf den Weg in Richtung der flirrenden Hitzestreifen über dem Asphalt in der Ferne.
Die Straße führt immer geradeaus durch die Einöde. Abgesehen davon, dass gelegentlich ein Auto vorbeifährt, passiert hier absolut nichts. Ich könnte nicht einmal sagen, wie weit ich überhaupt schon gelaufen bin. Ich wünschte, ich hätte mein Handy heute Morgen mitgenommen. Aber als mir auffiel, dass ich es vergessen hatte, war ich schon auf halbem Weg nach Atlanta.
In dem Moment, als ich mich frage, ob ich vielleicht an unserem Abzweig vorbeigelaufen bin, entdecke ich ihn dann doch, versteckt hinter einer Baumreihe. Ein Trampelpfad, auf den nur ein verwittertes Schild aus Holz hindeutet, in das eingeritzt wurde: SOUTH VILLAGE.
Und darunter: GEGR. 1973.
Auf dem Waldweg sind die Baumkronen über mir so dicht, dass meine Augen einen Moment brauchen, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Hier ist es auch um gut zehn Grad kühler. So kühl, dass ich fast schon friere.
Während ich über den weichen Waldboden laufe, habe ich das Gefühl, zwei Augenpaare sind auf mich gerichtet. Die beiden Augenpaare, die mich auf dem Weg durch den Wald immer begleiten. Aber hier ist niemand, der mich beobachtet. Vom Verstand her weiß ich das auch. Aber trotzdem sind diese Augen immer da, und ihre Blicke bohren sich in meinen Rücken.
Ich ignoriere sie. Und ich wünschte, ich hätte noch Whisky.
Ich konzentriere mich auf die Bäume und Büsche. Zwergpalmen und Magnolien und Zedern und Stechpalmen, Kiefern und Myrte. Wahrscheinlich gibt es hier mehr Bäume, als ich je zuvor in meinem Leben gesehen habe. Bäume sind schön. Der Wald ist so groß und so dicht, dass es scheint, als wäre man in einer anderen Welt. Es ist absolut still, bis auf die Schritte meiner Sneakers auf dem Boden und manchmal ein Geräusch von einem Tier. Das Zwitschern eines Vogels oder das Schwirren eines Insekts.
Mir fällt Bill wieder ein.
Stolz zu sein auf eine Arbeit, die ein bisschen komisch ist, ist bestimmt ein sehr schönes Gefühl.
Nach einer halben Meile bin ich bei der Brücke angekommen, die über den Bach führt. Ich bleibe stehen, um sie zu überprüfen. Angeblich hat sie gewackelt, als eine der Besucherinnen darüberfuhr. Sagte die Besucherin, aber die scheint mir ohnehin ein bisschen überdreht. Ich trete auf den Brettern herum und rüttele am Geländer. Fest wie einbetoniert. Aber ein Auto hat natürlich wesentlich mehr Gewicht als ich. Um ganz sicherzugehen, dass die Brücke noch befahrbar ist, muss ich wohl jemanden mitnehmen, der sich besser mit so etwas auskennt. Doch fürs Erste stellt sie keine Gefahr dar.
Von der Brücke aus ist es nicht mehr weit bis zur Zentrale. Die erste Kuppel ist die größte, aus dunklem Holz, voller Moos und so groß wie ein kleines Haus. Dahinter sind noch mehr Kuppeln, in unterschiedlichen Größen und willkürlich angeordnet. So als wären riesige Pilze aus dem Waldboden geschossen. Die einzigen Farbtupfer, das einzig Künstliche, sind die Leinen mit tibetanischen Gebetsflaggen, die kreuz und quer zwischen den Kuppeln gespannt sind, wie Lichterketten zu Weihnachten, manche so hoch wie die Baumkronen.
Auf der Veranda vor der Zentrale und auf den Wegen, die zu den Kuppeln und um sie herum führen, ist niemand zu sehen. Auf der Lichtung davor auch nicht. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise laufen hier ständig Leute rum, die irgendwelchen Pflichten nachkommen, oder einfach abhängen oder an Workshops teilnehmen. Nicht mal eine akustische Gitarre ist zu hören.
Und sonst spielt immer irgendjemand auf so einer Gitarre.
Aber jetzt höre ich nur das Flattern der Gebetsflaggen.
Demnach findet wohl gerade eine gemeinsame Aktivität statt. Irgendwas, zu dem ich, auch wenn mir jemand etwas davon gesagt hätte, sowieso nicht gegangen wäre. Vielleicht sind sie alle unten am See. Ist genau das richtige Wetter, um mal ins Wasser zu springen. Ich laufe an der Zentrale vorbei zum Speisehaus und dort die Stufen hinauf ins überwältigende Chaos der Hauptküche.
Dabei sollte ich eigentlich erst mal zu meinem Bus gehen und mir ein frisches T-Shirt anziehen. Aber die Mühe mache ich mir nicht. Stattdessen werfe ich mein Shirt in die Ecke und ziehe mir die Schürze über den Kopf. Dann schalte ich den Fenster-Ventilator ein, der wenigstens so viel Bewegung in die Luft bringt, dass ich nicht direkt eingehe, wenn ich die Herdplatten anstelle.
Beinahe stolpere ich über Mathilda, die etwas vom Boden aufpickt. Aber sie hebt nicht mal den Kopf, sondern gackert nur, als wolle sie mich darauf hinweisen, dass ich rücksichtsvoller sein soll, weil man auch als Huhn nicht ständig gestört werden möchte.
»Ja, du kannst mich auch mal«, sage ich zu ihr.
Nur mit Schürze und ansonsten nacktem Oberkörper zu kochen, während auch noch ein Huhn in der Küche rumläuft, entspricht vermutlich nicht den Hygienebestimmungen, aber ich bin eben rebellisch. Und davon mal abgesehen: Hier vergeht doch sowieso kein Tag, an dem nicht irgendjemand nackt irgendwo rumläuft.
Mir knurrt der Magen. Auf dem Herd steht ein mit Frischhaltefolie abgedecktes Backblech. Ich nehme die Folie ab, darunter liegen mehrere Reihen vor Öl glänzender Gebilde, die aussehen wie trockene Zweige, bestreut mit körnigem Meersalz. Aesop hat also Pilze geröstet. Aesops geröstete Pilze mag ich gern. Aber die muss er selbst sammeln. Ich weiß nämlich nicht, welche essbar und welche tödlich sind. Er kennt sich damit aus, und er röstet sie immer im Backofen, bis sie zu kleinen Geschmacksbomben werden.
Ich nehme mir eine Handvoll, stopfe sie mir in den Mund, und nachdem ich mir die fettigen Hände an der Schürze abgewischt habe, spüle ich sie mit einem Schluck Whisky aus der Plastikflasche runter, die ich unter der Spüle hinter den Reinigungsmitteln gebunkert habe. Danach geht es schon etwas besser. Dann fülle ich meinen Flachmann auf und stecke ihn wieder in die Tasche meiner Cargoshorts.
Nachdem ich mir noch ein paar Hände voll Müsli in den Mund geschoben habe, gehe ich in die Speisekammer, um die Zutaten für das Abendessen zu holen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was heute auf der Karte steht, aber allmählich wird es Zeit, etwas auf den Herd zu bringen.
Was ich vorfinde, sind aufgereihte Dosen ohne Etiketten.
Plötzlich höre ich aus der Hauptküche Schritte. Und dann steht Aesop da. Mit kalkweißem Gesicht. Zumindest soweit ich es unter seinem gigantischen Bart erkennen kann. Der reicht ihm nämlich bis auf die Brust. Er trägt auch kein T-Shirt, sein muskulöser Oberkörper ist voller Tattoos. Irgendwelches Zeug – Tribals und Gesichter und Symbole und Wörter, alles in Schwarz-Weiß. Einiges davon sieht kompliziert und professionell gemacht aus, aber manches auch verschwommen und unregelmäßig, eindeutig selbst oder von irgendjemandem gestochen. Die Art von Tätowierungen, wie man sie im Knast machen lässt, oder sturzbesoffen nach einem langen Abend, wenn irgendein idiotischer Freund irgendwo Nadel und Tinte aufgetrieben hat. Was von beidem es war, habe ich ihn noch nicht gefragt.
»Können wir vielleicht mal klären, wer hier die Etiketten recycelt, und darum bitten, sie erst abzumachen, wenn wir den Inhalt der Dosen verwendet haben, und nicht schon vorher?«, frage ich Aesop. »Sonst essen wir Bohnen und Gemüse und wer weiß was durcheinander, alles, was diese Konserven in den nächsten Wochen noch so an Überraschungen bereithalten.«
»Ash!«
»Was ist los?«
»Crusty Pete ist tot.«
»Ach du Scheiße!«
DREI
Der Baum sieht aus, als wäre eine riesige Hand aus dem Boden gewachsen, die sich nach den Blättern ausstreckt und eine ausgeblichene Holzkiste festhält. Vor der Tür des Baumhauses eine Leiter an den aufragenden Ästen zu befestigen war nicht möglich, deshalb wurde sie an einem Baum daneben befestigt und beide Bäume mit einer Hängebrücke verbunden.
Diese Brücke ist nicht mehr da.
Alle sind gekommen. Da das Camp voll belegt ist – alle Mitarbeiter im Dienstplan eingetragen und sämtliche Baumhäuser vermietet –, heißt das, vierzig Leute stehen um den Baum herum. Mit gesenkten Köpfen, wie erstarrt.
Zweige knacken unter unseren Schritten, als Aesop und ich nähertreten, und einige heben die Köpfe, darunter ein paar bekannte Gesichter, aber die meisten habe ich noch nie gesehen. Manche weinen, ein paar andere halten sich an den Händen, und wieder andere stehen einfach nur da. Bestürzung und Trauer, wie auf einem Gemälde festgehalten. Die Leute gehen zur Seite und lassen uns durch. Mitten im Gedränge steht Tibo und hat sich so tief runtergebeugt, dass seine Dreadlocks fast den Boden berühren. Er betrachtet Pete, als handelte es sich tatsächlich um die Szene auf einem Gemälde.
Pete liegt ausgestreckt auf dem Boden, die Gliedmaßen seltsam verrenkt und den Kopf unnatürlich abgewinkelt. Er hat kein Shirt und keine Schuhe an, nur eine Cargohose, deren Gürtel fest um seinen asketischen Körper geschnürt ist. Sein langes rotes Haar hängt in Strähnen über sein Gesicht, die aussehen wie Flammen.
Mir bleibt sofort die Luft weg. Unter den Bäumen ist es kühl, aber in meinem Nacken steigt Hitze auf. Niemand starrt mich an, aber trotzdem fühlt es sich so an, als würden mich alle anstarren.
Der Typ da erschrickt ja gar nicht. Ist bestimmt nicht das erste Mal, dass er einen Toten sieht.
Richtig tot sieht nämlich anders aus als tot im Film. Die Haut nimmt keinen bläulich kühlen Farbton an. Das Gesicht erstarrt nicht in einem friedlichen Ausdruck. In der Wirklichkeit erschlaffen Gelenke und Muskeln einfach. Nichts bleibt, außer Haut und Fleisch. Wenn man einen Toten sieht, weiß man, dass da nur noch eine leere Hülle ist.
Ich spüre einen solchen Druck im Kopf, als würde mein Gesicht aufgeblasen wie ein Ballon und meine Haut gleich platzen.
»Ash.«
Da liegt die Hängebrücke. Auf dem Waldboden. Sie sieht aus wie die, auf der Indiana Jones im Tempel des Todes feststeckt, zwischen den Nazis auf der einen Seite und einem verrückten indianischen Totenkult auf der anderen. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Hängebrücke hier nur ein paar Meter über dem Waldboden hing und nicht wie bei Indiana Jones ein paar Hundert Meter über einem Fluss, in dem es vor Krokodilen nur so wimmelt. Über diese Brücke hier bin ich selbst schon gelaufen. Und ich dachte, sie hält.
»Ash!« Tibo steht jetzt neben mir und raunt mir zu: »Ich brauche deine Hilfe.«
Ich nicke nur, und er dreht sich um zu den versammelten Mitarbeitern und Gästen und sagt: »Das ist ein tragischer Zwischenfall, und zwar einer, der untersucht werden muss. Könntet ihr bitte alle zur Zentrale gehen? Wir werden jetzt den Sheriff anrufen und ihm sagen, dass es einen Unfall gegeben hat.«
Ein paar der Leute machen sich auf den Weg, aber eigentlich nur die Gäste und die ganz neuen Mitarbeiter, also diejenigen, die Pete nicht kannten. Aber die meisten rühren sich nicht von der Stelle. Ignorieren Tibos Anweisung und starren auf den Boden, als könnte Pete es sich plötzlich anders überlegen und wieder aufstehen, weil er beschlossen hat, doch nicht tot zu sein.
»Bitte! Ich meine euch alle. Ich weiß, das ist nicht einfach«, sagt Tibo, diesmal lauter.
Noch ein paar Leute gehen. Tibo hält Cannabelle im Vorbeigehen am Arm fest. »Du rufst die Cops, okay? Frag nach Ford.«
Sie nickt. Ihre Augen sind rot gerändert, und sie hat eine ihrer kleinen Hände vor den Mund gelegt. Unter ihren Fingernägeln ist Erde. Sie dreht sich zu mir um, und sie sieht aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Als wolle sie in den Arm genommen werden. Als bräuchte sie eine menschliche Berührung, ganz egal von wem.
Ich gehe ein Stück beiseite, damit sie jemand anderen findet, der das übernimmt.
Sie geht zu Magda, deren Gesicht fast gänzlich hinter ihrer wilden grauen Mähne verschwunden ist. Ihr massiger Körper ist in ein gelbes Sommerkleid und eine gelbe Stola gehüllt und behangen mit gelbem Keramikschmuck, der bei jeder ihrer Bewegungen klackert. Die beiden sinken sich in die Arme, und Cannabelle dreht sich noch einmal zu mir um, mit enttäuschtem Gesicht. Tibo legt den beiden seine Hände auf die Schultern.
»Okay Ladies«, sagt er. »Geht jetzt bitte zurück.«
Die beiden lösen sich aus ihrer Umarmung und laufen los.
Hinter uns ertönt eine durchdringende Stimme. »Wir sollten ihn wegtragen.«
Marx steht am Rand der Lichtung, angriffsbereit, als wolle er sich auf jemanden stürzen. Er ist barfuß, hat eine alte Jeans an, deren Hosenbeine hochgekrempelt sind bis zu den Waden, und ein rotes T-Shirt. Dazu trägt er seine alberne schwarze Melone.
Mein Eindruck war immer, dass er und Pete befreundet sind, aber außer Wut ist Marx nichts anzumerken.
Tibo macht ein paar Schritte auf ihn zu. »Warum gehst du nicht mit den anderen zurück zur Zentrale?«
Marx wirft sich in die Brust. Gegen ihn wirkt Tibo, als wäre er nur Haut und Knochen. Marx ist zwar auch schlank, aber dabei kräftig. Man sieht ihm an, dass er viel draußen arbeitet. Ich bilde mir ja eine Menge auf meine Kraft ein, aber mit dem würde ich mich nicht anlegen. Doch ich schätze, irgendwann wird sich das wohl nicht vermeiden lassen, allein deshalb, weil er sich unmöglich benimmt und ich dazu neige, irgendwelchen Ärger heraufzubeschwören.
»Wir können ihn doch nicht hier auf dem Boden liegen lassen«, sagt Marx.
»Doch, können wir«, gibt Tibo zurück und schiebt sich seine dick gerahmte Sonnenbrille wieder hoch auf die Stirn, nachdem sie ihm auf der vor Aufregung schweißnassen Nase runtergerutscht ist. Sein Blick richtet sich jedoch nicht auf Marx, sondern auf irgendetwas weiter oben in den Bäumen. »Wir dürfen hier nichts verändern. Ich weiß, das fällt schwer, aber wir müssen uns jetzt ordnungsgemäß verhalten …«
»Ordnungsgemäß. Ihn auf dem Boden liegen lassen. Hätte ich mir denken können, dass dir das nichts ausmacht.«
»Das hat nichts mit mir und ihm zu tun«, sagt Tibo.
Marx tritt näher an ihn heran. »Ach nein? Vielleicht ja doch. Wie soll ich mir da sicher sein?«
Das ist der Beginn des üblichen kontraproduktiven Schlagabtauschs, also gehe ich direkt dazwischen. »Geh zu den anderen, Marx, und achte darauf, dass alles geordnet abläuft. Wir halten hier die Stellung.«
»Was zur Hölle soll …«
»Ich sage es dir nicht noch einmal«, unterbreche ich ihn. »Das Ganze ist so schon unerfreulich genug. Sehen wir zu, dass es nicht noch unerfreulicher wird. Und sollte das nicht deutlich genug gewesen sein: Ja, das ist eine Drohung.«
Marx scheint zu überlegen, ob es sich lohnt, sich wegen dieser Herausforderung mit mir anzulegen. Er mustert mich, als suche er nach einer Schwachstelle. Am liebsten würde ich sagen: Nein, es lohnt sich nicht. Aber damit würde ich bloß noch mehr Öl ins Feuer gießen. Ich halte dem Blick aus seinen jadegrünen Augen stand, für ihn offenbar einen Moment zu lange, denn irgendwann dreht er sich zu Tibo um und sagt kopfschüttelnd: »Ich finde das trotzdem nicht richtig.«
Tibo lässt sich gar nicht erst auf Blickkontakt ein. Und dann wendet Marx sich ab und geht. Wir sehen ihm hinterher, bis er verschwunden ist und wir beide allein sind.
Abgesehen von Pete, der auf dem Boden liegt.
Mit einem Kopfnicken in die Richtung, in die Marx verschwunden ist, sage ich: »Dieser Typ ist ein einziger wandelnder Drecksack.«
»Merkwürdiger Vergleich«, sagt Tibo. »Ich würde ihn einfach nur als Arschloch bezeichnen.«
Dann sehen wir uns die Szenerie genauer an. Die Hängebrücke. Der tote Körper. Das Baumhaus weiter oben.
»Kannst du da raufklettern?«, fragt Tibo.
»Eigentlich ist Cannabelle doch die geborene Kletterin. Soll ich da wirklich hoch?«
»Du musst.«
»Warum das denn?«
»Weil ich dir vertraue.«
Die Hände in die Hüften gestemmt, sehe ich Tibo an. »Was geht hier vor?«
»Ich will wissen, ob Pete da oben Drogen gebunkert hat«, antwortet Tibo. »Irgendwelche harten Drogen zumindest. Wir haben nicht viel Zeit, bis der Sheriff hier ist.«
»Was genau ist denn eigentlich passiert?«
»Gesehen hat es niemand. Sunny hat ihn gefunden. Und wenn ich es mir so anschaue, erklärt es sich wohl von selbst.«
»Knack, plumps, knack.«
»Es ist meine Schuld«, sagt Tibo. Er holt tief Luft und stößt einen Seufzer aus. »Es ist meine Schuld.«
»Ist es nicht.«
Er wirft mir einen Seitenblick zu. »Ich trage hier die Verantwortung. Es ist meine Schuld.«
»Lass uns diese Diskussion auf ein anderes Mal verschieben.«
Stirnrunzelnd beugt Tibo sich vor und schnuppert. »Noch ein bisschen früh, um zu trinken, findest du nicht?«
»Nur, wenn es einem an Entschlossenheit fehlt.«
Er verdreht die Augen und eilt davon. Ich gehe um den Baum herum – wobei ich einen weiten Bogen um den Toten mache – und suche nach einem Ast, an dem ich mich hochziehen kann. Zunächst entdecke ich keinen, der geeignet erscheint. Erst auf der anderen Seite des Baums sehe ich einen Ast in so niedriger Höhe, dass ich darankommen kann. Und er scheint ausreichend dick, dass er mein Gewicht hoffentlich trägt.
Hoffentlich! Einer mit gebrochenem Genick ist ja wohl genug.
Aber nein. Einer ist schon zu viel.
Ich trinke noch einen großen Schluck, und nachdem ich den Flachmann wieder in meiner Hosentasche verstaut habe, gehe ich ein paar Schritte zurück, um Anlauf zu nehmen, springe hoch und greife nach dem Ast. Die Rinde schneidet mir in die Haut, und der Ast biegt sich, aber er hält. Ich ziehe mich hoch, schwinge die Beine darum und drehe meinen Körper nach oben, sodass ich auf dem Ast liege. Dann rutsche ich in Richtung des Stamms, wo er noch dicker ist und genug weitere Äste wachsen, an denen ich mich festhalten kann, während ich mich aufrichte.
Ab dem Moment, als ich aufrecht stehe, ist es ein Kinderspiel, wie auf einer verbogenen Leiter von Ast zu Ast weiter hochzuklettern, bis ich vor einem der Fenster des Baumhauses stehe. Es hat kein Insektennetz, zum Glück, denn das hätte ich sonst zerreißen müssen. Ich klettere hindurch auf das Podest, wo Crusty Petes Schlafsack liegt, der nach ungewaschenem Körper und altem Essen riecht.
Ach, Crusty Pete, dein Spitzname war echt treffend!
Ich schiebe den stinkenden Schlafsack mit dem Fuß beiseite und springe auf den Boden. Hier drinnen ist es dunkel, und da dieses Baumhaus nicht mit Elektrizität ausgestattet ist, kann ich auch kein Licht einschalten. Und es ist stickig. Offenbar zieht nicht genug Luft durch das Fenster und die Tür. Außer dem Podest mit dem Schlafsack besteht die karge Einrichtung nur aus einem Stuhl und einem kleinen Tisch, beides grob zusammengezimmert aus Sperrholz, ungehobelt und nicht lackiert, also nicht gerade von Meisterhand geschaffen. Auf dem Tisch steht ein Pappteller, auf dem sich zwei schwarze Wasserwanzen mit ihren glänzenden Panzern an irgendwelchen Resten schadlos halten.
Scheiße noch mal! An den Anblick dieser Viecher werde ich mich nie gewöhnen. Jedenfalls nicht hier. Sie aus einem Gully kriechen oder unter einem Kühlschrank verschwinden zu sehen, geht ja noch, denn das kennt man zumindest. Aber mitten im Wald hätte ich sie nicht erwartet. Die sind schlimmer als die Kakerlaken in New York. Noch größer, und manchmal fliegen sie einem sogar ins Gesicht.
Aber diese beiden beachten mich nicht. Also hocke ich mich hin und inspiziere Petes zerschlissene, zerfledderte Reisetasche. Sie ist vollgestopft mit schmutziger Wäsche und einer kleinen Plastiktüte verschrumpelter brauner Pilze. Ich stecke die Tüte in die hintere Hosentasche. Neben dem Schlafsack auf dem Podest liegt ein kleiner Stapel Zeitschriften und Bücher. Überwiegend Bücher.
Rules for Radicals von Saul Alinsky, 1984 von George Orwell, Gott und der Staat von Michail Bakunin, Eine Geschichte des amerikanischen Volkes von Howard Zinn. Alle abgegriffen und zerlesen, die Standardlektüre der meisten Leute hier. Und ein Erotikroman mit dem Titel The Kiss of the Rose. Merkwürdig, aber was soll’s.
Unter den Büchern und Zeitschriften liegt ein Stapel Papiere, der mit einer Büroklammer zusammengehalten wird. Die Seiten sind vergilbt und an manchen Stellen gewellt, weil sie offenbar nass geworden waren und wieder getrocknet wurden. Auf dem Titelblatt befindet sich die schlecht gemachte Zeichnung eines Streichholzheftchens.
Setting Fires with Electrical Timers: An Earth Liberation Front Guide.
Ich blättere die Seiten kurz durch, und sie enthalten genau das, was der Titel verspricht: Massenhaft Schaltbilder als Anleitung für fanatische Brandstifter. Da gehen bei mir direkt sämtliche Alarmglocken an. Aber als Sohn eines Feuerwehrmanns muss das auch so sein. Schon als Kind habe ich die Leute über die Gefahren von Weihnachtsbäumen mit echten Kerzen und die Notwendigkeit der regelmäßigen Inspektion von Feuerlöschern belehrt. Der Gedanke an Brandstiftung ist mir absolut zuwider.
Es gibt zwei Sorten von Leuten, die nach South Village kommen, um dort zu campieren. Diejenigen, die auf der Suche nach irgendetwas sind – nach sich selbst, einem Abenteuer, einer Story oder was auch immer. Und dann diejenigen, die auf der Hippie-Schiene fahren. Und bei denen reicht das Spektrum von Woodstock bis Hardcore-Aktivismus. Magda ist von der Woodstock-Fraktion. Oldschool mit Friede, Freude, Eierkuchen. Marx ist einer der fanatischen Aktivisten. Crusty Pete konnte ich nie so richtig einordnen, weil wir nicht viel miteinander geredet haben. Aber wenn er nicht aus krankhafter Neugier alles gelesen hat, was er in die Finger bekam, spricht das, was ich jetzt hier sehe, eher für die letztere Fraktion.
Auf den Blättern selbst sind keine Notizen, aber die Rückseite des Stapels ist vollgeschrieben mit Zahlenreihen, unterteilt durch Schrägstriche. Diese Papiere sind sicher nichts, was man hier so rumliegen lassen sollte. Und da der Stapel zu dick ist, um ihn zu falten, rolle ich ihn zusammen und stecke ihn in die Tasche meiner Cargoshorts zu dem Flachmann.
Noch mal schnell umsehen. Nichts Weiteres, was offen rumliegt. Ich werfe einen Blick auf den Pappteller mit den beiden Käfern, die mich jetzt ihrerseits interessiert zu beäugen scheinen. Um festzustellen, ob ich etwas Essbares bin, vermutlich. Ich trete gegen den Stuhl und gehe sofort in Deckung, für den Fall, dass sie mich angreifen, aber sie krabbeln weg und sind nicht mehr zu sehen.