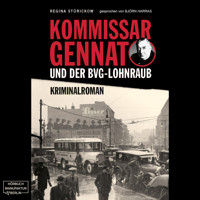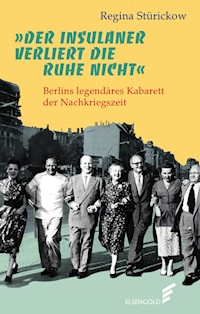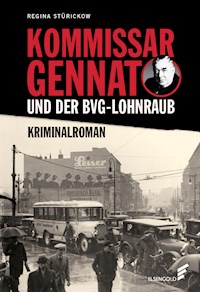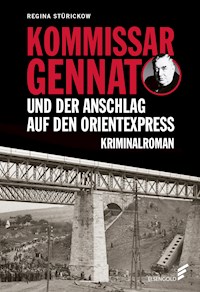
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elsengold Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gennat-Krimi
- Sprache: Deutsch
Max Kaminski ist eigentlich Reporter, aber viel zu neugierig, um nicht auch selbst auf die Fährte von Verbrechern zu gehen. Als 1931 in der Nähe der Kleinstadt Jüterbog bei Berlin ein Zug entgleist und ein anonymer Brief mit einer Geldforderung auftaucht, ruft das die Berliner Kriminalpolizei auf den Plan. Aber Kommissar Gennat und seine Kollegen tappen zunächst im Dunkeln. Nach einigen Monaten entgleist dann in Ungarn der legendäre Orient-Express auf dem Weg nach Wien. Nicht nur die Showgröße Josephine Baker ist unter den Fahrgästen, auch der Reporter Max Kaminsky und seine Frau Lissy. Kaminsky gibt alles, um dem Attentäter auf die Spur zu kommen, bis ihm ein Zufall zuhilfe kommt… Mit einem historischen Anhang zum tatsächlichen Kriminalfall.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REGINA STÜRICKOW
Kommissar Gennatund der Anschlagauf den Orientexpress
Kriminalroman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
E-Book im Elsengold Verlag, 2021
© der Originalausgabe:
Elsengold Verlag, Berlin, 2020
Umschlaggestaltung: Goscha Nowak
unter Verwendung eines Fotos von akg-images
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-96201-099-7 (epub)
ISBN 978-3-96201-070-6 (print)
Besuchen Sie uns im Internet: www.elsengold.de
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Nachwort
I
Frankfurt am Main, Hauptbahnhof.
Sonnabend, 8. August 1931, vormittags
Niemand beachtete den etwa 16-jährigen Jungen, der sich im Gleisbett an dem Schnellzug Basel-Berlin zu schaffen machte. Ein etwa gleichaltriges barfüßiges Mädchen in einem viel zu großen, zerschlissenen Leinenkleid rannte hinter ihm her: „Benno, bist du jetzt total verrückt geworden, komm zurück! Das ist doch Wahnsinn!“
Als hätten die Worte nicht ihm gegolten, ging er weiter. Freilich wusste er, dass Anni recht hatte. Eigentlich wollte er ja auch erst im Schutz der Dunkelheit in einem Güterzug abhauen. – Ein Personenzug war aber viel schneller. Außerdem kam ihm der Tumult im Bahnhof wie gerufen. Das war die Gelegenheit.
Benno und Anni hatten sich im Bahnhofsgebäude herumgetrieben, um Reisende zu beklauen, als eine Gruppe Kommunisten damit begann, Flugblätter in der Halle zu verteilen und Parolen zu skandieren. Noch bevor die Reichsbahnpolizei eingreifen konnte, stürmten SA-Leute herbei und fielen mit Knüppeln und Schlagringen über die Kommunisten her. Blutüberströmt blieben einige am Boden liegen. Auch der herbeigerufenen Schutzpolizei war es nicht gelungen, der Lage Herr zu werden. Schüsse fielen, Reisende gerieten in Panik und warfen sich schreiend zu Boden. Auf dem Bahnsteig, wo der D-Zug 43 aus Basel zur Weiterfahrt nach Berlin wartete, war es ebenfalls zu einem Handgemenge gekommen.
Benno und Anni kletterten über die Sperre. Jetzt oder nie, dachte Benno, denn alle Augen waren auf die blutigen Ausschreitungen gerichtet. Nur keine Zeit verlieren! In einem günstigen Augenblick sprang der Junge in das Gleisbett und gab Anni das Zeichen, abzuhauen. Mit einem mulmigen Gefühl blickte er sich immer wieder um, ob ihn nicht doch jemand beobachtete. Unter den Puffern kroch er auf die dem Bahnsteig abgewandte Seite des Zuges. Benno war perfekt vorbereitet. Unter seiner Joppe trug er trotz der Wärme einen Pullover und unter der Hose noch eine wollene. In der Hand hielt er etwas, das aussah wie ein selbst gestrickter Beutel oder eine unförmige, übergroße Wollmütze.
Durch ganz Deutschland war er schon in Güterzügen oder Bremserhäuschen als Blinder gefahren. Aber auf der Achse unter einem Personenzug, das war Neuland für ihn. Arne, sein Zimmergenosse, mit dem zusammen er aus der Anstalt getürmt war, hatte ihm genau erklärt, was er tun sollte. Erst hatte Benno gezögert, denn immer wieder hörte man von blinden Passagieren, die auf der Achse eingeschlafen, abgerutscht und von den Zügen zu unidentifizierbarem Hackfleisch zermalmt worden waren. Er hatte auch schon überlegt, auf einem Lastkahn anzuheuern, doch den Schiffern traute er nicht über den Weg. Außerdem blieb ihm nicht viel Zeit. In wenigen Stunden würde sein Steckbrief in der ganzen Stadt hängen. Nur weg, so schnell wie möglich. Am besten nach Berlin, denn wie er gehört hatte, konnte man da am besten untertauchen.
Bis zur Abfahrt des Zuges blieben ihm nur noch wenige Minuten. Unter dem dritten Waggon kroch er auf die Achse, einen guten halben Meter über dem Gleisbett. Dank Arnes Anweisungen wusste er gut Bescheid. Aus Stricken hatte er Halteschlaufen vorbereitet, die er irgendwie am Gestänge festbinden musste. Durch die Schlaufen konnte er dann die Handgelenke stecken und sich besser festhalten. Die beutelförmige Mütze hatte er sich aus Annis altem Pullover zusammengenäht – die Ärmel abgeschnitten und die Löcher zugenäht, ebenso das Loch für den Kopf. – Diese Mütze sollte er sich während der Fahrt über den Kopf ziehen. Andernfalls fräße sich der aufgewirbelte Dreck in sein Gesicht, was höllische Schmerzen verursachen und die Haut für immer ruinieren würde. Mehr noch sollte sie gegen kleine Steine schützen, die während der Fahrt aus dem Schotterbett hochgeschleudert würden und ihn wie Geschosse träfen. Die abgeschnittenen Ärmel des Pullovers zog er als Gamaschen über. Sie sollten warm halten. Bei mehr als 100 Stundenkilometern drohte der Fahrtwind selbst im August eisig zu sein, besonders in der Nacht. Stürben ihm die Gliedmaßen vor Kälte ab, bedeutete das den sicheren Tod.
Mehr schlecht als recht richtete sich Benno ein. Die Achse war breit genug, um eine halbwegs annehmbare Position zu finden. Dennoch kamen ihm Zweifel. Würde er tatsächlich bis Berlin durchhalten können?
„Einsteigen bitte!“
Aus seiner Perspektive sah Benno nur noch einen schmalen Streifen des Bahnsteigs und erspähte nicht mehr als die Schuhe der Einsteigenden. Bennos Blick fiel auf einen Reisenden – Benno war sich sicher, dass es ein Mann war –, der gerade einen mittelgroßen braunledernen Koffer neben sich abstellte. Vielleicht wollte er kurz nachsehen, ob er seine Fahrkarte nicht vergessen hatte, oder sich eine Zigarette anzünden. „Den müsste man jetzt klauen“, sagte Benno zu sich selbst. „Auch wenn da nur dreckige Wäsche drin ist. Allein für den Koffer zahlt der Hehler ein kleines Vermögen.“
„Vorsicht an der Bahnsteigkante!“ Der Zugabfertiger gab mit seiner Trillerpfeife das Signal zur Abfahrt. Erst im letzten Augenblick nahm der Mann seinen Koffer und stieg ein. Langsam fuhr der Zug an. Benno spürte die Bewegung kaum. Er starrte auf die Bahnsteigkante. Als der Zug aus der Halle gerollt war und das Labyrinth aus Weichen passierte, wurde er heftig durchgeschüttelt. Noch einmal gingen ihm die Warnungen durch den Kopf – nur nicht einschlafen!
Berlin, Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Vormittags
Kriminalrat Ernst Gennat sah gelangweilt aus dem Fenster und blickte über den Alexanderplatz. Gewitterwolken hatten sich vor die Sonne geschoben und entluden sich mit Platzregen und Hagel. Ihre Hüte festhaltend rannten die Menschen in Richtung S- und U-Bahn. Besonders amüsierte sich Gennat über zwei Frauen, die in einem Strandkorb, den ein Café als Werbung vor die Tür gestellt hatte, Zuflucht gesucht hatten. Sie hielten einen mittelgroßen Hund mit fuchsrotem Fell auf dem Schoß, den sie wegen des Gewitters offenbar zu beruhigen suchten.
Gennat hielt seine Anwesenheit bei der Dienstbesprechung, die Polizeipräsident Albert Grzesinski in seinem Konferenzzimmer anberaumt hatte, für reine Zeitverschwendung. Die meisten der Kollegen, die um ihn herum saßen, waren entweder von der Schutzpolizei oder von der Abteilung IA, der Politischen Polizei, deren Leiter Johannes Stumm neben dem Polizeipräsidenten Platz genommen hatte, um hin und wieder das Wort zu ergreifen.
„Das ist doch Sache der Politischen! Was haben wir hier eigentlich verloren?“, flüsterte Gennat, der Leiter der Mordinspektion, seinem Kollegen Ludwig Werneburg zu.
Noch bevor Werneburg antworten konnte, warf Grzesinski Gennat einen missbilligenden Blick zu. „Wollen Sie sich zur Sache äußern, Herr Kriminalrat?“
Gennat zuckte unmerklich zusammen. Wusste er doch aus Erfahrung, dass sein Vorgesetzter Tuscheleien während seiner Ausführungen übel nahm. „Nicht direkt“, sagte Gennat ruhig. „Ich habe mir nur zu bemerken erlaubt, wie lobenswert es ist, dass unsere Polizei auf den morgigen Tag so vorzüglich vorbereitet ist. Alle Bürger werden sich so sicher wie in Abrahams Schoß fühlen.“
Grzesinski, dem Gennats Ironie nicht entgangen war, räusperte sich und fuhr, den Blick auf seine Notizen geheftet, unbeirrt fort: „Also, meine Herren, die Polizei steht ab sofort in höchster Alarmbereitschaft. Zehntausend Beamte werden unterwegs sein, um Ruhe und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die kleine Alarmstufe beginnt heute um 14 Uhr, morgen früh um 7 Uhr der große Alarmzustand. 6000 uniformierte Beamte sind zum Straßendienst abkommandiert, zudem stehen 4000 Mann in den Polizeiunterkünften als Reserven bereit. Unsere vornehmste Aufgabe wird die Sicherung der Wahllokale sein. Deshalb werden wir vor jedem zwei Beamte postieren.“
„Als ob zwei Beamte gegen Nazi- oder Kommunistenhorden etwas ausrichten könnten“, murmelte Gennat vor sich hin, als es an der Tür des Konferenzraumes klopfte. Auf Grzesinskis Aufforderung trat Kommissar Rudolf Lissigkeit ein und deutete eine Verneigung an. „Entschuldigen Sie, Herr Polizeipräsident, aber ich muss dringend mit Kriminalrat Gennat sprechen. Es ist wirklich wichtig. Sonst würde ich es nicht wagen … – Aber uns ist soeben ein seit Tagen gesuchter Mörder ins Netz gegangen.“
Grzesinski nickte Lissigkeit anerkennend zu: „Da kann ich die Mordinspektion wohl zu einem neuerlichen Fahndungserfolg beglückwünschen, Herr Kommissar.“ Und mit einer Geste gab er Gennat das Zeichen, dass er gehen könne.
Gennat stützte sich am Konferenztisch ab und erhob sich schwerfällig. „Es tut mir außerordentlich leid, Herr Polizeipräsident. Aber die Pflicht ruft.“
„Schon gut, schon gut, Herr Kriminalrat. Das ist doch selbstverständlich.“
Gennat hasste diesen gönnerhaften Ton.
Auf dem Flur klopfte der schwergewichtige Kommissar seinem Kollegen auf die Schulter. „Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Was gibt es denn so Wichtiges?“
„Wir haben den Lehmann!“
„Lehmann? Welchen Lehmann? Helfen Sie mir mal auf die Sprünge.“
„Rudolf Lehmann. Das ist der, der vor fast genau einer Woche seine Frau erschossen hat.“
„Glückwunsch. Wo und wie haben Sie ihn geschnappt?“
„Um ehrlich zu sein, wir haben ihn nicht geschnappt, er hat sich gestellt und ein Geständnis abgelegt.“
„Hat ihn das schlechte Gewissen gepackt?“
„Das nun eher weniger. Die harten Parkbänke im Tiergarten waren wohl doch kein so komfortables Bett, und ein knurrender Magen zermürbt auf die Dauer ebenfalls. Kurzum: Er hat keinen Pfennig Geld mehr in der Tasche, und statt zu hungern und zu frieren geht er dann doch lieber für ein paar Jahre in Staatspension.“
„Warum sind Sie so zynisch, Herr Kollege?“
Lissigkeit zuckte mit den Schultern. „Manchmal habe ich von diesen Leuten einfach nur die Nase gestrichen voll. Dieser Lehmann ist wegen schwerer Körperverletzung mehrfach vorbestraft, hat schon etliche Jahre im Knast gesessen. Alle Nachbarn haben Angst vor ihm und gehen ihm wohlweislich aus dem Weg, denn fast jedem hat er schon einmal wegen einer Kleinigkeit eine reingehauen. Angeblich hat er seine Frau im Streit erschossen, ist dann in Panik und aus Entsetzen über seine Tat aus der Wohnung gerannt und tagelang durch die Stadt geirrt. – Außerdem mache ich mir Sorgen wegen morgen“, wechselte Lissigkeit das Thema. „Diesen unsäglichen Volksentscheid haben uns die Rechten eingebrockt, und die Kommunisten unterstützen dieses Affentheater auch noch. Auflösung des preußischen Landtages! Glauben diese Idioten tatsächlich, sie könnten Neuwahlen gewinnen? Was wollen die eigentlich besser machen als die jetzige Regierung? Die haben auch keinen Zauberstab, um die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Ich fürchte, morgen müssen wir besonders in den Kommunistenhochburgen mit schweren Krawallen rechnen, und unsere Jungs von der Schutzpolizei dürfen mal wieder ihre Köpfe hinhalten.“ Nach einer Pause fügte er hinzu: „Und Sie, Herr Kriminalrat? Gehen Sie hin?“
„Zu der sogenannten Volksabstimmung? Nee. Ich bin zu schwer.“
Lissigkeit warf Gennat einen verblüfften Blick zu. „Da will ich Ihnen nicht widersprechen, Herr Kriminalrat, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun?“
„Sehr viel“, antwortete Ernst Gennat schmunzelnd. „Hugenberg hat in seinen Zeitungen schreiben lassen, er wolle jeden Deutschen an die Wahlurne schleifen. – Schafft er bei mir aber nicht. Ich bin für den alten Herrn viel zu schwer!“
Lissigkeit lachte verhalten. „Mir ist nicht nach Scherzen zumute, Chef. Unsere Demokratie ist nicht die schlechteste und ich möchte sie gerne erhalten wissen.“
„Sie sind ein notorischer Schwarzseher, Lissigkeit“, sagte Gennat ruhig, als sie die Vorzimmertür des Büros der Mordinspektion erreicht hatten. „Die Bürger sind nicht so blöd, wie viele meinen. Den meisten ist schon klar, dass das Zu-Hause-Bleiben in diesem Fall ein klares Ja für die Demokratie bedeutet. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das Quorum erreicht werden wird. Da gehe ich jede Wette ein. – Aber zurück zu Lehmann. Wo ist er jetzt?“
„Im Polizeigefängnis. Ich lasse ihn gleich noch einmal vorführen. – Theoretisch ist alles erledigt. Ich habe ihn vernommen, Fräulein Steiner hat das Protokoll getippt und die Pressemitteilung ist auch schon raus. Aber irgendetwas an seiner Aussage gefällt mir nicht. Sie sollten ihn sich auch noch einmal vornehmen.“
„Aha. Verraten Sie mir auch, was Ihnen nicht gefällt?“
„Seine Aussage passt nicht mit den Tatumständen zusammen.“
„Menschenskind, machen Sie’s doch nicht so spannend!“, fuhr Gennat ihn an.
Lissigkeit machte eine beschwichtigende Handbewegung. „Lehmann will seine Frau im Affekt getötet haben. In der Küche, mit vier Pistolenschüssen.“
„Ja. Und?“
„Bei einem spontanen Streit in der Küche hat man normalerweise keine Pistole zur Hand. Eher greift man im Affekt zu einem Messer, das gibt es in jeder Küche. – Affekttaten geschehen meistens mit dem Messer, aber nicht mit der Pistole. Noch dazu mit vier Schüssen!“
„Interessante Theorie“, murmelte Gennat, als er die Klinke herunterdrückte. Er wollte noch etwas sagen, aber Lissigkeit war schon auf dem Weg zum Paternoster.
„Steinerchen“, rief er seiner Sekretärin zu, als er in sein Büro durchging. „Ich brauche jetzt dringend eine Tasse Kaffee. Ach was, am besten gleich einen ganzen Eimer. Aber so schwarz, dass der Löffel drin steht, und mit viel Zucker!“
D-Zug 43 zwischen Frankfurt am Main und Berlin
Der Mann mit dem Koffer trat in ein leeres Raucherabteil, verstaute seinen Koffer im Gepäcknetz über dem Fensterplatz und setzte sich auf den Platz gegenüber. Mantel und Hut legte er auf den Sitz neben sich. Es sollte so aussehen, als seien die Plätze belegt. „Dass mir jetzt bloß keine Familie mit Kindern auf die Nerven geht“, sagte er zu sich selbst, zündete sich eine Zigarette an und zog die Frankfurter Zeitung aus der Manteltasche. Doch statt zu lesen blickte er aus dem Fenster und grübelte vor sich hin. Er hatte genug von dieser ständigen Hin-und-her-Fahrerei. Ein paar Wochen musste er aber noch durchhalten. Jetzt nur keinen Fehler machen, dachte er. Als er seine Zigarette aufgeraucht hatte, lehnte er sich zurück und schloss die Augen.
Ein Geräusch ließ ihn aufschrecken. Jemand hatte die Abteiltür aufgeschoben. „Die Fahrkarte bitte!“ Schlaftrunken zog er sein Billett aus der Innentasche seines Jacketts und reichte es dem Schaffner. Dabei fiel sein Blick auf einen jungen Mann, der mit Gepäck im Gang stand und offenbar nach einem freien Sitzplatz suchte.
„Hier ist doch sicher für den jungen Mann noch was frei, nicht wahr?“, fragte der Schaffner, und ohne eine Antwort abzuwarten zeigte er auf den Koffer über dem leeren Fensterplatz. „Ist das Ihr Koffer? Den legen wir mal hier über Ihren Sitz. Ich dachte schon, hier ist auch besetzt.“
Der Angesprochene war so überrumpelt, dass er nur ein „Ja, natürlich“ stammeln konnte und den Schaffner gewähren ließ. Ohne weiter zu reagieren, faltete er seine Zeitung auseinander und vertiefte sich in die Lektüre. Der Schaffner nickte dem jungen Mann zu. „Sehen Sie, nun haben Sie sogar einen Fensterplatz. Gute Reise, meine Herren.“
Der junge Mann bedankte sich, trat in das Abteil, zog die Schiebetür hinter sich zu, hob seinen Koffer in das Gepäcknetz, stellte die Reisetasche neben sich und legte den Mantel darüber.
„Gestatten, Doktor Aribert von Weinhagen“, stellte er sich vor, nahm seinen Hut ab, legte ihn auf den Mantel und setzte sich.
„Angenehm. Arnold Tennstett – ohne Doktor“, brummte sein Gegenüber misslaunig und sah am Rand seiner Zeitung vorbei.
Weinhagen zog ein silbernes Zigarettenetui aus seinem Jackett. „Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten?“
„Nein danke. Ich rauche nicht.“
„Aber Sie gestatten, dass ich rauche?“
„Wenn ich mich recht erinnere, ist das hier ein Raucherabteil. Also tun Sie sich keinen Zwang an“, murmelte Tennstett, ohne sein Gegenüber anzusehen.
Ein gesprächiger Reisegefährte hatte ihm gerade noch gefehlt! Schon einmal war ihm das passiert. Vor Monaten war er im Speisewagen mit einem Mitreisenden ins Gespräch gekommen und man hatte bis Berlin angeregt geplaudert. Einige Tage später, er war mit seiner Frau, einem Dresdner Geschäftsfreund und dessen Gattin in den Rheinterrassen im Haus Vaterland zum Dinner, als sein Tischgefährte aus dem Zug auf ihn zukam und enthusiastisch begrüßte. Vehement stritt er ab, der Reisende aus dem Zug zu sein. Eine äußerst peinliche Situation, denn der Mann war nur schwer zu überzeugen. Seither setzte er alles daran, im Zug nicht erkannt zu werden, und nahm ein paar Veränderungen an seinem Äußeren vor, um ähnliche Vorfälle für die Zukunft auszuschließen.
Der junge Adlige gab seinen Konversationsversuch auf, zündete sich seine Zigarette an, zog ein Buch aus der Reisetasche und legte es auf den kleinen Tisch vor dem Fenster. Tennstett musterte sein Gegenüber noch immer am Rand der Zeitung vorbei. Weinhagen, er mochte etwa 35 Jahre alt sein, trug einen beigefarbenen Sommeranzug mit Weste der höchsten Preisklasse und statt einer Krawatte eine Fliege. Aus seiner Reisetasche fingerte er ein kleines Etui, nahm eine Brille heraus und setzte sie umständlich auf. Tennstett warf einen Blick auf den Buchtitel: Agatha Christie „The Mystery of the Blue Train“.
Weinhagen bemerkte Tennstetts Blick und nickte ihm zu. „Sehr zu empfehlen. Der deutsche Titel lautet: ‚Der blaue Express‘. Das ist ein Luxuszug, der von Calais in Frankreich an der italienische Riviera fährt. Ich bin an der Friedrich-Wilhelms-Universität Dozent für Anglistik. Mein Spezialgebiet ist die neuere englische Literatur. Schwerpunkt: Detektivromane. Ich habe gerade eine Vortragsreise beendet und fahre jetzt zurück nach Berlin. – Sind Sie auch beruflich unterwegs?“
Ohne von seiner Zeitung aufzusehen sagte Tennstett: „Könnte man so sagen. – Ich habe diesen Kriminalroman übrigens gleich nach seinem Erscheinen auf Deutsch gelesen. Wie war noch gleich die Handlung? – Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Wurde Ruth Kettering nicht in ihrem Abteil erwürgt? Ich glaube, weil sie zu neugierig war und zu viel geredet hat.“
„Ich habe es gerade erst angefangen. Verraten Sie mir lieber nicht zu viel.“ Weinhagen lächelte sein Gegenüber an und vertiefte sich in sein Buch.
Berlin-Charlottenburg, Kurfürstendamm 188/189, 3. Etage
Max Kaminski saß auf dem Balkon und rauchte eine Zigarette. Um eine Serie über Kunstdiebe weiterzuschreiben, die schon in den nächsten Tagen erscheinen sollte, war er sehr früh aufgestanden und hatte nicht einmal gefrühstückt. Gerade hatte er sich an seine Schreibmaschine gesetzt, als ihn sein Freund Rudolf Lissigkeit anrief und ihm berichtete, dass der Mörder Lehmann sich gestellt habe. Sofort schrieb er einen kurzen Artikel für die Abendausgabe und gab ihn seiner Redaktion telefonisch durch. Seit gut 15 Jahren war Maximilian Kaminski, den alle Max nannten, Polizeireporter, bei Bedarf Gerichtsberichterstatter und hin und wieder auch Feuilletonist beim Berliner Echo, das früher Berliner Abendblatt hieß.
Da es aber schon seit Jahren mit einer Morgen- und einer Abendausgabe erschien, hatte es seinen Namen geändert.
Bevor Kaminski weiterarbeitete, wollte er endlich frühstücken, denn es war schon elf Uhr durch. Lissy war mit den Kindern noch in den Ferien, und er hatte in dieser Zeit fast jeden Tag entweder im Café Jädicke, seinem Stammcafé im Zeitungsviertel in der Kochstraße, oder im Café Möhring am Kurfürstendamm, nur ein paar Häuser von seiner Wohnung entfernt, gefrühstückt. Heute wollte er lieber zu Hause bleiben. Ratlos stand er in der Küche, denn noch nie hatte er sich sein Frühstück allein machen müssen. Er wollte zwei Eier kochen, wusste aber nicht so recht, wie das geht. Zwar hatte er schon oft gesehen, wie Lissy die Eier für das Sonntagsfrühstück kochte, aber wie viel Wasser nahm sie? Er legte die beiden Eier in einen Topf und bedeckte sie bis zur Hälfte mit Wasser. So oder so ähnlich machte Lissy das wohl. Dann stellte er das Gas auf höchste Flamme. Dass seine Frau die Eier vier Minuten kochen ließ, wusste er allerdings genau. Max Kaminski warf einen Blick auf die Küchenuhr, setzte sich an den Tisch und begann die Morgenausgabe der Vossischen Zeitung zu überfliegen. Er hatte sich gerade in einen Artikel vertieft, als das Telefon klingelte. Ein erneuter Blick auf die Uhr sagte ihm, dass ihm noch eine halbe Minute blieb, um den Anrufer abzuwimmeln.
Er ging in sein Büro und nahm den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Rudi Neubauer, der Lokalchef des Berliner Echos. „Mensch Kaminski, was Sie für die Abendausgabe abgeliefert haben, ist recht dünne. Gibt es nichts Interessanteres als diesen Lehmann? Ein Kerl, der seine Alte umlegt und sich acht Tage später stellt, weil er keine Kohle mehr hat. Das reicht mir nicht. Ist aus der Geschichte nicht noch irgendwas rauszuholen? Hintergrund und so. Sie wissen schon, was ich meine.“
„Nun machen Sie mal halblang, Chef. Schließlich kann ich mir die interessanten Fälle nicht aus den Rippen schneiden. Wir berichten über alles, was in dieser Stadt passiert. Manchmal ist es eben nur was ganz Banales.“
„Banalitäten will niemand lesen, Kaminski. Schließlich wollen wir mit unserem Blatt auch ein bisschen Geld verdienen und unsere Leser nicht an die Konkurrenz verlieren. Die Zeiten sind schwer genug für uns. Sie haben doch einen guten Draht zur Mordinspektion. Da sind doch bestimmt noch ein paar nette Informationen zu holen, die die anderen nicht haben.“
Kaminski erahnte Neubauers süffisantes Grinsen durchs Telefon. „So schlau bin ich selber“, schnaufte er. „Hab längst bei Lissigkeit nachgehakt. Mehr ist nicht. Punkt.“
„Ach Kaminski, zieren Sie sich doch nicht wie die Zicke am Strick. Sie haben doch Fantasie. Es gibt immer noch eine Geschichte hinter der Geschichte. Da kann man doch das eine oder andere noch ein bisschen ausschmücken.“
„Den Teufel werd ich tun!“
„Ist ja gut! Ich hab ja gar nichts gesagt. Wie ich Sie kenne, haben Sie irgendwo in Ihrem Schreibtisch noch was Nettes rumzuliegen. Ich brauche noch ein paar Zeilen.“
„Aus der Rubrik Klatsch und Tratsch könnte ich was anbieten.“
„Klatsch geht immer. Her damit!“
„Die frisch geschiedene Frau von Sternberg verklagt Marlene Dietrich auf zwei Millionen Dollar wegen angeblicher Zerstörung ihrer Ehe. Außerdem will sie noch 400 000 Mark als Schadenersatz für den Scheidungsprozess, den sie gegen ihren Göttergatten geführt hat. Der Prozess soll demnächst in New York beginnen.“
„Alle Achtung! Die Dame weiß, was sie will. Richtig nett wird’s dann aber erst im Prozess, wenn die schmutzige Wäsche gewaschen wird. Jetzt ist das nur ’ne Fünfzeilenmeldung. Reicht mir nicht.“
„Tut mir leid. Dann müssen Sie sich wohl oder übel selbst was ausdenken.“
„Was war das denn gestern Abend in der Friedrichstraße?“
„Die Randale? Wollten Sie doch heute Morgen nicht, weil die Vossische darüber schon geschrieben hat.“
„Heute Morgen wollte ich so manches nicht! Alles Quatsch! Diktieren Sie mir das mal schnell. Ich sitze hier mit gespitztem Bleistift. Dann nehmen wir den Lehmann rein, die Sternbergsche, und die Krawalle. Dann ist die Seite voll. Perfekt.“
„Schön. Überschrift: Krawalle in der Friedrichstraße. – Neue Zeile – Kurz vor Geschäftsschluss versammelte sich am Freitagabend eine Horde Jugendlicher und zog – Komma – bewaffnet mit Pflastersteinen – Komma – von der Leipziger Straße krakelnd durch die noch sehr belebte Friedrichstraße in Richtung Unter den Linden – Punkt.“
„Mensch Kaminski, haben Sie ’n Vogel? Ich bin doch keine dämliche Tippse, der Sie die Interpunktion mitdiktieren müssen!“
„Wie Sie meinen. Also weiter. – In der Friedrichstraße warfen die Randalierer die Schaufenster der Schuhgeschäfte Salamander, Leiser, der Kaffeehandlung Zuntz, des Schokoladengeschäfts Most und vieler kleinerer Läden ein. An der Ecke Französische Straße stieß eine Gruppe ein geparktes Auto um und demolierte es vollständig. Die Randale verursachte beträchtlichen Sachschaden. Informationen aus dem Polizeipräsidium zufolge war die Aktion von Kommunisten angezettelt worden, denn bei der Polizei waren bereits im Vorfeld Hinweise auf bevorstehende Krawalle eingegangen. Demzufolge war sie auch sogleich mit einem Riesenaufgebot zur Stelle.“
„Konnten wenigstens welche festgenommen werden?“
„Das erwies sich als gar nicht so einfach, denn nicht nur verängstigte Passanten, auch die Krawallmacher flüchteten in die Nebenstraßen. Zwei junge Männer wurden aber festgenommen und gleich der Abteilung IA überstellt.“
„Wie sicher ist das denn, dass es Kommunisten waren? Könnte das Ganze nicht ebenso gut von den Nazis organisiert gewesen sein?“
„An diese Möglichkeit habe ich …“
Ein explosionsartiger Knall ließ beide zusammenfahren.
„Kaminski, Hallo? War das bei Ihnen? Soll ich die Polizei rufen? – Hallo, Kaminski – “
Kaminski warf den Hörer auf den Schreibtisch. „Das kam aus der Küche“, schrie er in Richtung Telefon. „Oh Gott, das Gas!“ Er rannte in die Küche. Die Eier! Der Topf stand noch auf der Gasflamme. Doch die Eier waren nicht mehr da und im Topf kein Tropfen Wasser. Geistesgegenwärtig drehte Kaminski das Gas ab. Hatte er vergessen, die Eier in den Topf zu legen? Er war doch nicht verrückt. Woher kam der Knall? Fassungslos blickte er sich um, bis sein Blick an der Decke haften blieb. Kaminski bekam einen Lachanfall. Wie war das möglich? Was hatte er falsch gemacht? Die Überreste der Eier klebten gelb und weiß, dekoriert mit brauner Schale, an der Decke, und der Küchenschrank zeigte gelbe Sprenkel. Dass bloß Lissy das nicht sieht! Sie bekäme einen Wutanfall. Da das Hausmädchen der Kaminskis noch bis Montag freihatte, würde er das Malheur wohl oder übel selbst beseitigen müssen, überlegte er, als er zurück ans Telefon ging.
„Was ist denn passiert, Kaminski, das hörte sich ja an, als habe man einen Anschlag auf Sie verübt.“
„Nee. Ich habe nur ein kleines physikalisches Experiment gemacht“, sagte Kaminski trocken.
„Wie bitte?“
„Keine Sorge, alles in Ordnung“, murmelte Kaminski und wurde wieder sachlich. „Gibt es sonst noch was?“
„Wie man’s nimmt. Morgen ist die Volksabstimmung. Ich hoffe, Sie haben sich viel Zeit genommen. Wir müssen mit Krawallen von links und rechts rechnen. Am besten, Sie schauen sich in den einschlägigen Gegenden ein bisschen um, suchen ein paar Kneipen auf, reden mit den Leuten. Ich will einen ausführlichen Stimmungsbericht. Sie kriegen mindestens vier Spalten.“
„Ich hatte ohnehin vor, mich umzuschauen und umzuhören.“
„Kann ich mich auf Sie verlassen?“
„Na klar. Das wissen Sie doch!“
„Na dann bis morgen.“
Als Kaminski das Gespräch beendet hatte, zog er Schuhe und Jackett an, verließ die Wohnung, lief die drei Treppen hinunter und klingelte im Erdgeschoss an der Tür der Portiersloge. Zu seiner Erleichterung war Frau Ritter, die gute Fee des Hauses, noch nicht zum Einkaufen gegangen. Er beichtete ihr sein Missgeschick. Die Portiersfrau schüttelte den Kopf, als tadele sie ein ungezogenes Kind. „Also wissen Se, Herr Kaminski“, seufzte sie. „Sowat kann aber ooch nur een Mannsbild passieren!“ Sie rief ihren Mann und schickte ihn mit einer Leiter nach oben, um das Malheur zu beseitigen.
Die Lust auf zwei Eier im Glas war Kaminski inzwischen vergangen. Er ging nun doch ins Café Möhring und genehmigte sich ein ausgiebiges englisches Frühstück, das ihm erlaubte, das Mittagessen ausfallen zu lassen. Anschließend fuhr er mit dem Bus ins Verlagshaus in der Kochstraße. Sein winziges Büro, seine Besenkammer, wie er es nannte, fand er immer noch besser als die leere 12-Zimmer-Wohnung. Ihm fehlte einfach alles: die sich ständig zankenden Zwillinge Wolfgang und Clara, sein großer Sohn, der in jeder freien Minute Klavier spielte, seine Frau Lissy, die sich über jede Kleinigkeit so herrlich aufregen konnte, sein Vater Dr. med. Georg Kaminski, der, wenn er aus seiner Praxis kam, über Politik schimpfte und seine Mutter Ruth, die immer ruhig und besonnen blieb und wachsam und umsichtig dafür sorgte, dass der Haussegen nie schief hing. Er setzte sich an den Schreibtisch, zog das Telefon zu sich heran, nahm den Hörer ab und ließ sich mit der Mordinspektion im Polizeipräsidium verbinden. Es dauerte eine Weile, bis er Kriminalrat Ernst Gennat an den Apparat bekam.
Kaminski fiel gleich mit der Tür ins Haus. „Was machen Sie heute Abend, Herr Kriminalrat?“
„Ich glaube, ich werde endlich mal wieder etwas früher nach Hause gehen und lesen.“
„Ich habe eine bessere Idee. Ich lade Sie in ein schönes Restaurant zum Essen ein.“
„Wie komme ich zu der Ehre? Haben Sie Knatsch mit Ihrer holden Gattin?“
Kaminski lachte. „Schlimmer! Ich bin Strohwitwer und Vollwaise. Lissy kommt mit den Kindern erst morgen Abend aus den Sommerferien auf Norderney zurück. Meine Eltern sind in Südtirol und kommen am Montag. Um ehrlich zu sein, mir fällt, so allein in der großen Wohnung, die Decke auf den Kopf. Diese Grabesruhe macht mich ganz krank. Ich schlage vor, wir machen uns bei einem guten Essen einen schönen Abend.“
„Aber nur unter der Bedingung, dass Sie mich nicht wieder in so einen edlen Schuppen wie das Adlon schleppen. Austern und winzige Fasanenmedaillons, das ist nichts für mich.“
Kaminski lachte. „Keine Sorge! Ich bestelle einen Tisch bei Else Klemke im Kindl-Bräu. Sagen wir um acht?“
„Da sage ich nicht Nein. Acht Uhr ist perfekt.“
D-Zug 43 zwischen Frankfurt am Main und Berlin
Benno hockte auf der Achse und wartete auf den nächsten Halt, um sich wenigstens einen kurzen Moment ausstrecken zu können. Nur nicht einschlafen! Er sprach leise vor sich hin, erzählte sich selbst, was er Anni noch alles hätte sagen wollen. Endlich hielt der Zug. Für einen Augenblick zog er die Mütze hoch. Es war offenbar längst dunkel geworden.
Tennstett warf indes einen Blick auf seine Armbanduhr. Die Zeit war günstig, im Speisewagen würde jetzt nur wenig Betrieb sein. Er stand auf und nahm seinen Koffer aus dem Gepäcknetz. Weinhagen sah kurz von seinem Buch auf. „Wenn Sie in den Speisewagen gehen möchten, können Sie Ihren Koffer ruhig hierlassen. Ich passe schon auf, dass niemand lange Finger macht.“
„Danke, nicht nötig“, gab Tennstett knapp zurück.
Dieser verdammte Koffer wird mir eines Tages noch zum Verhängnis werden, dachte er auf dem Weg in den Speisewagen. Die Aufkleber teurer Hotels aus Meran, Nizza und Wien gingen aber leider nicht mehr ab. Theoretisch hätte er keinen Koffer gebraucht, denn in Frankfurt hatte er alles, was er brauchte. Der Koffer musste aber sein, denn ohne Gepäck zu reisen wäre verdächtig gewesen. Im Speisewagen fand er einen freien Tisch, bestellte Gulaschsuppe und Bier und schaute aus dem Fenster. Nach dem Essen und einer Tasse Kaffee ging er zurück in sein Abteil. Der gesprächige Doktor hatte inzwischen sein Buch zur Seite gelegt und war eingenickt.
Kurfürstendamm / Ecke Joachimsthaler Straße, Berliner Kindl-Bräu
Kaminski war aus der Redaktion noch einmal nach Hause gefahren, denn er war neugierig, ob es dem Portier gelungen war, das Eierunglück ungeschehen zu machen. Als er in die Küche kam, meinte er nur noch einen schwachen Schatten an der Decke ausmachen zu können, den Lissy sicher nicht bemerken würde. Selbst die Sprenkel am Küchenschrank hatte der hilfsbereite Hauswart beseitigt. Kaminski würde sich großzügig dafür erkenntlich zeigen. – Das war er den Portiersleuten schon für ihr Schweigen gegenüber Lissy schuldig.
Um Viertel vor acht verließ er das Haus und ging den Kurfürstendamm hinunter bis zum Berliner Kindl-Bräu im Eckhaus an der Joachimsthaler Straße.
Schon von Weitem sah er den Kriminalrat aus dem schwarzen Wagen des Polizeipräsidiums aussteigen und ging ihm entgegen. Der schwergewichtige Gennat war eine stadtbekannte Persönlichkeit. Einige Passanten blieben sogar stehen, grüßten ihn, die Männer zogen den Hut, die Frauen warfen ihm ein Lächeln zu. Gennat erwiderte, zog ebenfalls den Hut und lächelte zurück.
Kaminski eilte ihm entgegen. „Ich habe einen Tisch bestellt, aber ich sehe, auf der Terrasse ist auch was frei. Wollen wir nicht lieber draußen sitzen?“, schlug Kaminski vor.
„Nee, das ist mir zu viel frische Luft. Es reicht mir schon, dass Steinerchen in meinem Büro laufend die Fenster aufreißt.“
Else Klemke, die Kindl-Wirtin, ließ es sich nicht nehmen, ihre Gäste persönlich zu begrüßen, und kam mit ausgestreckten Armen auf sie zu. „Herr Kriminalrat, Herr Kaminski! Schön, Sie auch mal wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben natürlich Ihren Lieblingstisch reserviert, Herr Kaminski“, und an Gennat gewandt: „Aber auf der Terrasse ist noch Platz. Wenn Sie also lieber an der frischen Luft sitzen wollen, Herr Kriminalrat …“
„Nun lasst mich doch mit eurer verdammten frischen Luft in Ruhe. Da draußen zieht’s und ich hole mir den Tod.“
„Nee, nee, lieber nicht, schließlich brauchen wir Sie ja noch!“, lachte Else Klemke. „Darf ich Ihnen schon etwas bringen lassen? Ein Glas Champagner zur Begrüßung?“
„Nee, da sind mir zu viele Löcher drin“, murmelte Gennat und musterte den Stuhl, bevor er sich setzte, als wolle er sichergehen, dass dieser sein Gewicht auch aushielt.
„Also ich nehme gerne zur Feier des Tages ein Gläschen. Und bringen Sie dem Kriminalrat mal ruhig auch eines. – Was empfehlen Sie uns denn heute? Gibt es etwas Besonderes?“, wollte Kaminski wissen. Er war sich sicher, einen äußerst unterhaltsamen Abend vor sich zu haben.
„Unsere Forelle blau kann ich Ihnen empfehlen. Solche Dinger sind das heute.“ Else Klemke deutete mit den Händen die Größe der Fische an.
„So eine ganze Forelle mit Kopf und Schwanz?“ Gennat schüttelte energisch den Kopf, sodass seine beiden Doppelkinne hin- und herwankten. „Nee. Ich kann’s absolut nich vertragen, wenn mein Essen mich noch ankiekt.“
Die Kindl-Wirtin warf Kaminski einen Blick zu und beide mussten unwillkürlich lachen. Gennat blieb todernst. „Das is nich zum Lachen“, murmelte er. „Das is ’ne ganz traurige Sache.“
„Wie wäre es mit Kalbsbraten? Und als Vorspeise ein schöner grüner Salat?“, empfahl Else Klemke und zwinkerte Kaminski zu.
„Nee, nee, das Grünzeug verfüttern Sie mal lieber an Ihre Kaninchen. Also ich will einen schönen Schweinebraten mit Rotkohl und einem Kloß extra. Und dazu ein Helles. Aber ein großes!“ Gennat rieb sich die Hände und strahlte übers ganze Gesicht.
Kaminski verkniff sich jeden Kommentar und bestellte die Forelle blau.
Beide hatten sich vorgenommen, heute Abend nicht über Polizeiangelegenheiten zu reden, obwohl Gennat eigentlich nie über etwas anderes als über Mordsachen sprach. Außer mit Kaminski, den er seit gut 15 Jahren kannte und – obwohl sie sich noch immer siezten – als guten Freund betrachtete. Der Reporter gehörte zu den wenigen Menschen, die auch Gennats private Seite kannten, zumindest einen Teil davon.
„Stellen Sie sich vor, ich habe endlich mein Klavier stimmen lassen“, begann Gennat, nippte nun doch an seinem Champagner und verzog dabei das Gesicht.
„Und? Haben Sie überhaupt Zeit zum Spielen?“
„Ich hab mir gleich was Leichtes herausgesucht. Den h-moll Walzer von Schubert. Den kann ich sogar noch.“
„Dann können Sie mit Wolfgang ja endlich wieder vierhändig spielen. Er fragt laufend nach Ihnen. Die Kinder haben nun mal einen Narren an Ihnen gefressen. Nach den Ferien sollten Sie uns endlich mal wieder besuchen kommen.“
„Wenn die Mörder mal Ferien machen, komme ich gerne.“
„Wolfgang spielt mit seinen zehn Jahren schon ziemlich gut. In seinem großen Bruder hat er natürlich auch ein großes Vorbild. David gibt ihm auch hin und wieder ein bisschen Nachhilfe.“
„Wie alt ist David jetzt eigentlich?“, wollte Gennat wissen.
„Er ist im Juli siebzehn geworden.“
„David ist ein bildhübscher Junge. Sicher hat er auch schon eine kleine Freundin.“
Kaminski lachte. „Er hat tatsächlich eine süße kleine Freundin. Seit einigen Wochen geht er sogar regelmäßig in die Synagoge, denn die Eltern der Kleinen sind sehr religiös und legen da großen Wert drauf. Hin und wieder begleite ich ihn auch.“
Gennat nickte. „Wenn ich mich recht erinnere, ist Ihre Familie nicht sehr religiös.“
„So halb und halb. David hatte natürlich seine Bar Mizwa, und an den hohen Feiertagen gehen wir auch alle gemeinsam in die Synagoge, aber wir halten zum Beispiel den Schabbat nicht wirklich ein, und vorschriftsmäßig koscher leben wir auch nicht. Lissys Familie hingegen ist sehr religiös.“
„Erinnern Sie sich noch?“, sagte Gennat. „Als wir damals zusammen nach Stettin wegen der Leiche im Reisekorb gefahren sind, haben wir darüber gesprochen.“
„Richtig. Das waren meine Anfänge als Polizeireporter.“ Kaminski lachte. „Und Sie fragten mich, ob ich denn sonnabends arbeite. Wie die Zeit vergeht! Da war ich erst achtundzwanzig. Jetzt gehe ich schon auf die fünfzig zu.“
Der Kellner servierte den Schweinebraten, und Gennat fragte, indem er sich die Serviette in den Hemdkragen steckte: „Warum sind Sie nicht mit Lissy und den Kindern auf Norderney?“
„Ich war ja zehn Tage da. Länger halte ich es am Meer nicht aus. Im Gegensatz zu Lissy mag ich die Nordsee nicht. Immer wenn man baden will, ist das Meer gerade weg. Die Berge sind mir lieber. Die bleiben wenigstens immer da, wo sie hingehören. Ich beneide meine Eltern. Die sind in Südtirol.“
„Wenn ich mal pensioniert bin, kaufe ich mir einen Hund und fahre mit ihm in die Berge zum Wandern. Aber eigentlich liebe ich beides – das Meer und die Berge.“
„Sind Sie sicher? Ist Ihnen das nicht zu viel frische Luft?“
„Nee. Das ist doch ’ne ganz andere Luft“, meinte Gennat.
Erst nach dem Essen hakte Gennat noch einmal nach: „Sagten Sie nicht neulich, Sie wollten mit Lissy im September noch einmal verreisen?“
„Verreisen ist übertrieben. Nur Lissy zuliebe fahre ich mit. Am 5. September geht es, aber ohne die Kinder, für ein paar Tage nach Budapest. Lissys ehemalige Schulfreundin Ella, die Tochter eines deutsch-ungarischen Konservendosenfrabrikanten, heiratet einen ungarischen Grafen. Am 12. fahren wir dann weiter nach Wien. Lissy will unbedingt einmal mit dem Orient-Express fahren.“
„Orient-Express? Ich dachte, der fährt gar nicht mehr“, wunderte sich Gennat.
„Von Konstantinopel – oder Istanbul –, wie man jetzt ja sagt, fährt er wohl nicht mehr, oder nur noch selten. Aber es gibt noch viele Strecken von Bukarest und Budapest bis nach Paris, Calais und Ostende. Wir fahren mit dem Arlberg-Orient-Express. So kann Lissy wenigstens einen Hauch vom Mythos Luxuszug genießen, und sie kommt endlich mal wieder in ihr geliebtes Wien. In ihrer Kindheit hat sie einige Jahre an der schönen blauen Donau verbracht. Sie war sogar an der Ballettschule der Staatsoper. Außerdem haben wir viele Freunde in Wien, die wir bei dieser Gelegenheit besuchen wollen.“
„Sind Sie nicht auch mit diesem unsäglichen Schreiberling aus Wien befreundet? Wie war noch gleich sein Name?“
„Sie sprechen doch nicht etwa von Imre Bekessy, beziehungsweise Emmerich Bekessy, wie er jetzt eingedeutscht heißt, diesem gerissen-genialen Journalisten?“ Kaminski runzelte die Stirn. „Immerhin gibt er ein sensationell erfolgreiches Blatt heraus.“
„Ja, Die Stunde, ein Käseblatt, das genüsslich in Skandalgeschichten schwelgt, deren Wahrheitsgehalt nie so recht nachvollziehbar ist. Deshalb hat er wohl auch einen Prozess nach dem anderen am Hals.“
„Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Da gibt es halt manchmal Ärger. Imre versteht sein Metier wie kaum ein anderer. Da können Sie Gift drauf nehmen.“
„Nee, Kaminski. Zwischen kein Blatt vor den Mund nehmen und dem, was Die Stunde ihren ahnungslosen Lesern vorsetzt, liegen Welten. Als ich mal in Wien war, habe ich mir Die Stunde aus reiner Neugier gekauft. Ich war mir allerdings nie ganz sicher, ob die Verbrechen, die in dem Blatt geschildert waren, tatsächlich passiert sind oder ob sie sich eher in den Köpfen der Reporter abgespielt haben.“
Kaminski zuckte mit den Schultern. „Ich persönlich finde das Blatt nicht schlecht. Jedenfalls beschäftigt es Reporter, die ausgesprochen gut schreiben. – Bekessys Sohn ist im Übrigen inzwischen auch Journalist.“
„Was? Der kleine Janos? Der ist doch noch grün hinter den Ohren!“
„Er ist gerade 20 geworden und seit Kurzem Chefreporter der Wiener Sonn- und Montagszeitung sowie des Wiener Montagsblatts.“
„Hat sicher der gute Papa dran gedreht“, mutmaßte Gennat und zündete sich eine Zigarre an.
Kaminski griff indes zu einer Zigarette. „Nicht unbedingt. Janos ist zwar blutjung, aber ein begnadeter Schreiber. Das muss der Neid ihm lassen.“
Gennat lehnte sich vorsichtig zurück und schloss die Augen. „Ach ja, Wien, Wien nur du allein … – eine wunderbare Stadt – so herrlich altmodisch. Zweimal war ich da. Zu irgendwelchen Kongressen. Leider hatte ich keine Zeit, mir in Ruhe die Stadt anzusehen. Nicht einmal in der Staatsoper war ich.“
„Sie sollten uns begleiten, Herr Kriminalrat. Lissy würde sich freuen.“
„Geht nicht. Ich kriege keinen Urlaub.“
„Dann müssen Sie sich halt etwas einfallen lassen und eine Dienstreise draus machen.“
Gennat lachte und schüttelte den Kopf. „Schön wär’s. Mit ein bisschen Wehmut denke ich im Übrigen auch oft an unsere Reise nach Paris zurück. Für mich war es ja tatsächlich eine Dienstreise, aber ohne Sie als Stadtführer wäre ich aufgeschmissen gewesen.“
„Wir hatten eine tolle Zeit und haben viel erlebt. Stimmt! Lassen Sie uns doch noch einmal hinfahren.“
„Lieber heute als morgen! Wie hieß noch gleich dieses große Restaurant, wo … na ja, Sie wissen schon.“
„Wo dieses bildhübsche Mädchen mit den kastanienbraunen Haaren unbedingt Deutsch von Ihnen lernen wollte?“
Gennat blickte verlegen zur Seite. Kaminski hakte nicht nach und beantwortete stattdessen die Frage. „Das war bei Chartier.“
„Ach ja, so hieß es wohl. Das Ambiente war wunderschön, aber das Essen lausig.“
„Es ist nun mal ein Restaurant für das einfache Volk.“
„Und mit vielen hübschen Mädchen.“
D-Zug 43 Basel – Frankfurt am Main – Berlin, kurz vor Jüterbog
Es war schon lange dunkel. Tennstetts Gegenüber schlief noch immer und schnarchte leise. Er hasste schnarchende Menschen. Bald müssten sie in Berlin sein. Tennstett nahm seinen Koffer und ging in Richtung Toilette. Er schloss sich ein und vergewisserte sich, ob auch wirklich zugeschlossen war. Seinen Koffer legte er auf das kleine Waschbecken und öffnete ihn. Dann nahm er sich die blonde Perücke ab, ebenso den Schnurrbart, schlug beides in Seidenpapier ein, legte die Sachen in einen flachen Karton und verstaute ihn in seinem Koffer. Vor dem Spiegel entfernte er noch die Reste des Bartklebers. Er sah auf die Uhr und fluchte. Er hatte sich mit der Zeit vertan. Es war erst 21 Uhr 40, also noch recht weit bis Berlin. Er beschloss, in der Toilette auszuharren, denn ohne Perücke konnte er unmöglich zurück in sein Abteil.
Benno taten alle Knochen weh. Wie viele Stunden mochte er wohl schon unterwegs sein? Bis Berlin war es sicher nicht mehr weit. Im nächsten Bahnhof musste er unbedingt herausfinden, wo sie waren, denn er durfte auf keinen Fall bis Anhalter Bahnhof mitfahren. Da hätte er nicht unbemerkt aus seinem Versteck kriechen können. So viel Glück wie im Hauptbahnhof von Frankfurt am Main würde er nicht ein zweites Mal haben. Auf den Berliner Bahnhöfen soll viel Polizei rumlaufen, hat er sagen hören. In einem Vorort wäre es leichter, sich aus dem Staub zu machen. Aber woher sollte er wissen, wann er in einem Vorort von Berlin war? Eine Uhr hatte er nicht. Die Stationsschilder konnte er aus seiner Position nicht lesen und die Durchsagen auf den Bahnhöfen waren kaum zu verstehen. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 120 Kilometern in der Stunde oder mehr, so vermutete Benno, raste der Zug dahin.
II
Der Lokomotivführer Fischer war in seinem Element. Er liebte diese Strecke. Schnurgerade über viele Kilometer hinweg. Hier konnte er seinem Affen Zucker geben. Er beschleunigte und pfiff den Schlager „Das ist die Liebe der Matrosen“ vor sich hin. 105 Stundenkilometer zeigte die Nadel des Tachometers. Vielleicht konnte er es noch auf 120 bringen. Auf dieser Strecke war das kein Problem. Die Nadel bewegte sich zitternd auf 106, 107 und erreichte gerade 109, als ihn ein gleißend heller Lichtschein blendete, gefolgt von einer heftigen Detonation. Die tonnenschwere Lok erzitterte, vibrierte, geriet ins Wanken. Mit Wucht wurde er von der einen Seite auf die andere geschleudert. Er klammerte sich am Haltegriff an der Tür fest. Spontan leitete er eine Vollbremsung ein. Die Räder kreischten, Funken sprühten von den Gleisen. Die Lok kam nach einigen Hundert Metern zum Stehen. Das erste Mal in seinem Berufsleben hatte er eine Vollbremsung machen müssen. Entsetzt starrte er in die Dunkelheit. Für mehr als zweihundert Menschen in den Personenwagen, die er mit seiner Lok hinter sich her zog, hatte er die Verantwortung. „Das war nicht meine Schuld!“, stammelte er. „Das war nicht meine Schuld. Die sanfte Kurve hier macht doch sonst auch keine Probleme. Die kann man doch sogar mit 120 nehmen.“ Seine Ohren dröhnten, seine Hände zitterten. „Ich habe nichts falsch gemacht“, murmelte er immer wieder.
Damit ihm die Beine nicht einschliefen, hatte Benno gerade versucht, sich vorsichtig zu bewegen, als ihn der gleiche helle Lichtschein traf. Trotz der Mütze schmerzte er in den Augen, und der gewaltige explosionsartige Knall drohte seine Ohren und seinen Kopf zu zerfetzen. Wie ein Fischkutter im Orkan auf hoher See wankte der Zug hin und her. Angsterfüllt klammerte Benno sich fest, mit den Füßen versuchte er im Gestänge Halt zu finden, doch seine Beine rutschten von der Achse. Der Schmerz ließ ihn laut aufschreien. Aus und vorbei, dachte Benno, und in Sekundenschnelle zog sein kurzes Leben an ihm vorüber. Ich bin von der Achse gefallen, ging es ihm durch den Kopf. Hatte ihn der Zug überrollt? Jemand hatte ihm mal erzählt, wenn man stirbt, sehe man einen hellen Lichtschein und in Gedanken liefe noch einmal das ganze Leben vor einem ab. Er gehörte also zu denen, die die Fahrt als Blinder nicht überlebt hatten. Aber die Schmerzen? Hat man noch Schmerzen, wenn man schon tot ist? Ihm war, als falle er einen Abhang hinunter, während der Knall noch immer in seinem Kopf nachhallte. Alles schien sich zu drehen. Er glaubte in ein tiefes Loch zu fallen. Mit letzter Kraft schaffte er es, die Kapuze vom Kopf zu ziehen. Über sich sah er den Sternenhimmel. Sonst war es stockdunkel. „Ist das nun der Tod?“, dachte Benno. Er war gerade 16 Jahre alt geworden. Vom Leben hätte er ohnehin nichts mehr zu erwarten gehabt – außer einer Mordanklage und Zuchthaus. Aber Anni, was wird nun aus Anni? Dann wurde es schwarz um ihn.
Der Heizer war von der Maschine gestiegen und rief zum Lokführer: „Was zum Teufel ist da explodiert?“ Fischer kletterte aus dem Führerstand. Seine Beine drohten zu versagen. „Keine Ahnung. Ich dachte, der Kessel ist in die Luft geflogen“, stammelte er.
„Ist bei euch alles in Ordnung?“, rief der Heizer in Richtung des Postwagens, dem ersten hinter der Lok. Der Postbeamte öffnete mit aller Kraft das Fenster, das sich verzogen hatte. „Was ist denn da explodiert? Ich dachte schon, die ganze Maschine ist in die Luft geflogen. Wo kam der Blitz her?“ Der Heizer half ihm, die Tür des Waggons zu öffnen, und der Postmann kletterte hinaus. Er riss ein Streichholz nach dem anderen an, um besser sehen zu können.
„Lass den Quatsch“, herrschte der Lokführer ihn an. „Habt ihr Taschenlampen an Bord?“
„Ja, zwei“, stammelte der Postbeamte, kletterte zurück in den Waggon und kam mit zwei Taschenlampen zurück. Der Heizer hatte inzwischen ebenfalls eine Taschenlampe und zwei Petroleumlaternen aus der Lok beschafft.
„Wir müssen sehen, was los ist“, kommandierte Fischer, der sich wieder gefangen zu haben schien. Mit Taschenlampen gingen die drei Männer in rückwärtige Richtung und blieben nach einigen Schritten wie angewurzelt stehen. „Mein Zug, wo ist mein Zug“, stammelte der Lokführer. Der Heizer und der Postbeamte sahen in die gleiche Richtung. Erst nach einer Schrecksekunde wurde ihnen klar: Nur der Postwagen und der erste Personenwagen dahinter standen noch auf der Böschung. Die übrigen acht Waggons waren entgleist, umgekippt und die Böschung hinuntergestürzt.
„Verdammt, der Zug nach München! Wenn das Gegengleis etwas abbekommen hat …“ Der Lokomotivführer mochte den Gedanken nicht weiterspinnen. Gemeinsam suchten sie das Gleis ab. „Hier sind Eisenschwellen festgemacht. Wir brauchen Werkzeug.“ Fischer rannte zur Lok zurück und kam mit einem Vorschlaghammer und einem Brecheisen zurück. Die beiden Männer machten sich an die Arbeit, während der Heizer die Petroleumlaterne anzündete. „Ich geb dem Zug ein Haltesignal“, rief er. „Beeilt euch, viel Zeit haben wir nicht.“