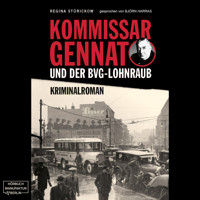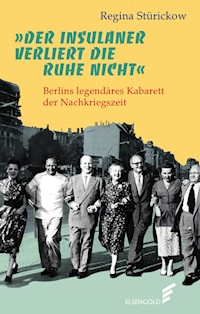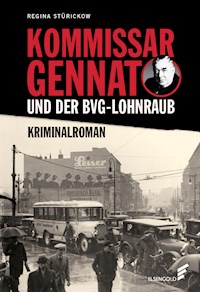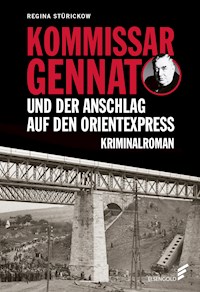Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elsengold Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gennat-Krimi
- Sprache: Deutsch
Sommer 1926. Der Berliner Kommissar Ernst Gennat wird wegen eines Mordfalles nach Hohenschönhausen gerufen. Aber als er am Tatort eintrifft, fehlt von der Leiche jede Spur. Zwei Zeugen können allerdings das angebliche Opfer gut beschreiben. Und ein Taxifahrer will eine auf die Beschreibung passende Frau gefahren haben. Sie trug eine auffällige, mit grünen Steinen besetzte Brosche – ein seltenes Schmuckstück. Auf einem Pressefoto taucht diese Brosche wieder auf. Aber wer ist die Trägerin? Gennat steht vor einem Rätsel und spannt mal wieder seinen langjährigen Freund ein, den Polizeireporter Max Kaminski. Kann er Gennat helfen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REGINA STÜRICKOW
Kommissar Gennatund der grüne Skorpion
Kriminalroman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
E-Book im Elsengold Verlag, 2022
© der Originalausgabe:
Elsengold Verlag, Berlin, 2022
Umschlaggestaltung: Goscha Nowak (Titelfoto: akg-images)
ISBN 978-3-96201-117-8 (epub)
ISBN 978-3-96201-111-6 (print)
www.bebraverlag.de
INHALT
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Nachwort
PROLOG
Die vier Frauen hatten sich im Romanischen Café getroffen. Wie immer saßen sie am dritten Tisch gleich rechts von der Drehtür. Um diese Zeit war das Café stets bis auf den letzten Platz besetzt. Dichter Tabakqualm mischte sich mit dem Duft von frischem Kaffee, und mit jedem Gang aus der Küche durch die Schwingtür zogen die Kellner den Dunst von Gulasch und heißen Würstchen hinter sich her.
„Ich begreife euer Zögern nicht“, sagte die Rotblonde mit dem auffälligen, mit Seidenblumen verzierten Hütchen. Sie hielt inne, nippte an ihrem Kaffee und blickte sich verstohlen um. Der Herr am Nebentisch, er schien in das Berliner Tageblatt vertieft, beunruhigte sie. Belauschte er ihr Gespräch? Sie beobachtete ihn aus den Augenwinkeln und sah, wie er seine Zeitung zusammenfaltete, den Kellner herbeiwinkte, seinen Kaffee zahlte und aufstand. Erst als er ihr beim Hinausgehen zulächelte, erkannte sie den bekannten Zentrumsabgeordneten. Vor einiger Zeit war er Gast in ihrer Pension gewesen, erinnerte sie sich jetzt. Sein Name fiel ihr im Augenblick jedoch nicht ein. Zwei junge Männer, die sich schüchtern an den Händen hielten, hatten schon auf den frei werdenden Tisch gewartet und setzten sich.
Sie beugte sich zu ihren drei Freundinnen vor und fügte mit gedämpfter Stimme hinzu: „Es wird alles so ablaufen, wie wir es besprochen haben. Schließlich habe ich das Haus nicht zum Spaß gemietet. Es liegt ideal. Morgen fahren wir zusammen hin und besprechen, wie wir vorgehen wollen. Freilich wird jede von euch eine Aufgabe übernehmen müssen. Das ist euch hoffentlich klar. Ein Zurück gibt es nicht mehr.“
Die drei anderen Frauen starrten wortlos in ihre Tassen. „Je länger ich darüber nachdenke“, sagte jetzt die Frau zu ihrer Rechten, „desto unwohler wird mir. Wir sind doch keine …“, sie hielt inne, schaute unsicher von einer zur anderen und hauchte dann fast unhörbar: „… keine Mörderinnen.“
Die Rotblonde lachte hell auf, so dass die Gäste an den Nachbartischen zu ihr hinüberschauten. „Aber meine Liebe, was redest du für einen Unsinn. Natürlich sind wir das nicht. Wir nehmen der Justiz ein wenig Arbeit ab und werden eine angemessene Strafe aussprechen.“ Erwartungsvoll sah sie die Frau zu ihrer Linken an, erwartete sie von ihr doch am ehesten Unterstützung. Dabei fiel ihr Blick auf eine auffällige Brosche, die sie heute zum ersten Mal an der Freundin sah: ein Skorpion aus grünen Steinen. Wider Erwarten schien die Frau mit dem grünen Skorpion skeptisch. Fast unmerklich schüttelte sie den Kopf. „Und was passiert, wenn es schief geht?“, wandte sie ein. „Reichen die Hinweise, die wir haben, nicht aus, um zur Polizei zu gehen oder die Staatsanwaltschaft zu informieren?“
Die Rotblonde lachte höhnisch. „Die Polizei! Die unternimmt doch nichts! Die Polizei ist allenfalls in der Lage, einen lahmen Eierdieb zu fassen! Der Mörder der Gräfin Lambsdorff läuft noch immer frei herum und der grauenvolle Mord an der kleinen Senta Eckert ist bis heute nicht geklärt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe alles gesammelt, jeden Artikel. Nun auch noch dieser entsetzliche Kindermord in Breslau. Sogar den angeblich so genialen dicken Kriminalrat aus der Roten Burg haben sie nach Breslau geschickt. Den Mörder hat er natürlich nicht gefunden.“ Sie zündete sich eine Zigarette an und ließ den Blick von einer zur anderen schweifen. „Mein Plan ist perfekt. Was wollt ihr noch?“
Die Jüngste der vier Frauen, die bisher geschwiegen hatte, sagte zögernd: „Wir sollten lieber nichts überstürzen. Ich bin sicher, dass ich in der nächsten Zeit noch wichtige Dinge herausfinden werde. Wir sollten den nächsten Brief meines Bruders abwarten. Im letzten deutete er an, er habe jemanden kennengelernt, der ihm wertvolle Informationen geben könne. Mehr verriet er leider nicht.“
„Du hast recht“, stimmte die Frau mit dem grünen Skorpion zu. „Wir brauchen Beweise. Schließlich geht es uns um Gerechtigkeit und nicht um Rache.“
Um Zeit zu gewinnen, trank die Rotblonde langsam ihren Kaffee aus. „Gut“, sagte sie nach einer Weile. „Mein Plan mag auf den ersten Blick etwas tollkühn klingen, aber letztendlich werde ich es auch sein, die alle Verantwortung trägt. Für euch birgt die Sache, wenn ihr den Mund haltet und eure Aufgaben gewissenhaft erfüllt, keinerlei Risiko.“ Mit besorgter Miene schaute sie zu der jungen Frau hinüber. „Allein du könntest dich durch Unvorsichtigkeit in Gefahr bringen. Bist du sicher, dass bis jetzt noch niemand hinter deine wahre Identität gekommen ist?“
Die Angesprochene schüttelte den Kopf. „Nein. Mach dir keine Sorgen. Niemand ahnt, wer ich bin. Man hält mich nach wie vor für das Bauerntrampel aus der ostfriesischen Provinz.“
„Aber wirklich Erhellendes hast du noch nicht herausgefunden. Das enttäuscht mich ein wenig“, sagte die Rotblonde streng.
„Es geht eben nicht so schnell. Diese Leute sind höllisch misstrauisch. Ich muss vorsichtig sein. Schließlich willst du ja auch nicht, dass ich auffliege.“
„Ich will dich nicht drängen. Alles ist gut“, beruhigte die Rotblonde.
Die Uhr der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche schlug fünfmal.
„Es ist allerhöchste Zeit für mich.“ Die Frau mit dem grünen Skorpion stand auf. „Ich habe noch eine Verabredung und möchte nicht zu spät kommen.“
„Eine Verabredung? Bist du deshalb heute so mit Schmuck behängt?“, spottete die Rotblonde.
„Etwas Privates. Nicht wichtig.“
„Dürfen wir erfahren, mit wem du dich triffst?“
„Nein, dazu ist es noch zu früh“, erwiderte sie, nahm ihre Pelzstola von der Stuhllehne, öffnete ihre Handtasche und zog ein Portemonnaie heraus. Die Rotblonde machte eine abwehrende Handbewegung. „Lass den Unsinn, meine Liebe. Du weißt doch, dass ihr meine Gäste seid.“
„Ich sollte auch lieber gehen“, sagte die junge Frau und erhob sich ebenfalls. „Sonst werden meine Herrschaften doch noch misstrauisch. Ich habe nur bis sechs Uhr frei.“
Die Dritte schickte sich ebenfalls an, aufzubrechen. „Wie ist es nun“, fragte sie, „nächste Woche wieder hier im Romanischen oder zur Abwechslung mal drüben bei Schilling?“
„Lieber hier“, warf die Frau mit dem grünen Skorpion schon im Gehen ein. „Aber bitte nicht später als um halb vier.“
Die Rotblonde zog die Augenbrauen hoch. „Hast du da etwa wieder eine Verabredung?“
„Ja. Jeden Dienstag um die gleiche Zeit“, erwiderte die Angesprochene. „Aber stellt mir jetzt bitte keine Fragen. Ich habe es eilig.“
Die Rotblonde blieb allein im Café zurück. Sie rief den Kellner herbei, bestellte einen Sherry, ließ sich die BZ am Mittag bringen und überflog die Schlagzeilen. Weil der Sherry sie müde gemacht hatte, trank sie noch eine Tasse Kaffee, bezahlte dann und verließ das Café.
Der Portier an der Drehtür deutete eine Verbeugung an: „Auf Wiedersehen, gnädige Frau, und einen schönen Abend noch.“
„Danke, Fritz. Ihnen auch“, gab sie lächelnd zurück, trat auf den Auguste-Viktoria-Platz hinaus und überlegte einen Augenblick, ob sie bei dem schönen Wetter nicht noch ein Stück den Kurfürstendamm hinaufschlendern sollte.
Es war Dienstag, der 17. August 1926, nachmittags um Viertel nach fünf.
I
Kriminalrat Ernst Gennat hatte es sich auf dem durchgesessenen grünen Sofa in seinem Büro im ersten Stock des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz bequem gemacht, hatte die Schuhe ausgezogen und die Beine hochgelegt. In der einen Hand die fast aufgerauchte Brasil, mit der anderen hielt er den Aschenbecher fest, den er auf seinen ausladenden Bauch gestellt hatte, und hauchte genüsslich Rauchringe in die Luft. Es war Dienstag, der 31. August 1926, kurz vor sieben Uhr abends.
„Steinerchen, haben Sie nicht noch eine Tasse Kaffee für mich?“, rief er in Richtung Vorzimmer. „Schön schwarz, so dass der Löffel drin steht und mit viel Zucker.“ Als sich nichts rührte, fiel ihm ein, dass Gertrud Steiner, seine Sekretärin, heute ausnahmsweise pünktlich Feierabend gemacht hatte. Gennat gähnte, legte die Zigarre ab, stellte den Aschenbecher auf den Sofatisch mit der Klöppeldecke und knipste die Stehlampe an. Seufzend erhob er sich und ging auf Strümpfen ins Vorzimmer. Neben der Schreibmaschine stand noch die Kaffeekanne. Er nahm den Deckel ab, schaute hinein und goss den restlichen kalten Kaffee in seine Tasse. „Kalter Kaffee ist besser als gar kein Kaffee“, sagte er zu sich selbst und ging herzhaft gähnend zurück in sein Büro, zog die mittlere Schublade seines Schreibtisches auf und holte die Tüte mit der Streuselschnecke heraus, die Fräulein Steiner ihm heute Morgen mitgebracht hatte. „Ich hasse Streuselschnecken“, murmelte er vor sich hin. „Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen.“ Jetzt erst bemerkte er, dass der Raum vom Qualm seiner Zigarre blau schimmerte. Zudem war es heiß und stickig. Vermutlich rührten daher auch seine Kopfschmerzen. Er öffnete das Fenster und schaute stirnrunzelnd auf die von Südwesten heraufziehende grafitschwarze Wolkenwand. In diesem Sommer spielte das Wetter völlig verrückt. Gerade stöhnte die Stadt noch unter der Hitzewelle und jetzt gab es fast täglich schwere Gewitter.
Er lehnte sich auf das Fensterbrett und sah hinunter. Vor der Kneipe im gegenüberliegenden Stadtbahnbogen war schon wieder eine handfeste Keilerei im Gange. Eine Szene, die sich da unten mehrmals täglich wiederholte. Eine S-Bahn kroch fauchend wie eine altersschwache Riesenechse in Richtung Bahnhof Alexanderplatz, denn die Elektrifizierung der Strecke ließ auf sich warten.
Gennat überlegte, ob er nicht nach Hause gehen sollte. Die letzten Nächte hatte er sich mit nicht enden wollenden Verhören um die Ohren schlagen müssen und kaum geschlafen. Er leckte sich den Zucker von den Fingern und setzte sich an seinen Schreibtisch. Erst jetzt sah er, dass Steinerchen ihm schon die abgetippten Vernehmungsprotokolle vom Nachmittag zur Durchsicht hingelegt hatte. Flüchtig blätterte er sie durch. Das hat Zeit bis morgen, dachte er, und warf sie zurück auf den Stapel, denn jetzt hatte er keine Lust mehr, sich mit irgendwelchen Protokollen zu beschäftigen. Er stützte den Ellenbogen auf, legte das Kinn in seine fleischige Pranke und blätterte lustlos ein paar der seit Tagen liegen gebliebenen Papiere durch.
Eine kräftige Windbö, die ein Häufchen Notizzettel von seinem Schreibtisch fegte, ließ ihn aufschrecken. Erste dicke Hagelkörner klackerten auf das Fensterblech und aus der Ferne ließ sich das dumpfe Grollen des rasch heraufziehenden Gewitters vernehmen. Schwerfällig erhob er sich, schloss das Fenster, sammelte die heruntergefallenen Zettel auf und beschloss, wenigstens noch so lange im Büro zu bleiben, bis das Unwetter abgezogen sein würde. Aus der Ablage im Vorzimmer holte er sich die Abendausgabe des Berliner Echos, lümmelte sich wieder in seine Sofaecke und begann, die Schlagzeilen zu überfliegen. Erst auf Seite vier fand er den ausführlichen Bericht des Polizeireporters Max Kaminski über die Festnahme des Raubmörders Karl Böttcher. Die Aussage des Strausberger Mörders, lautete die Schlagzeile. Gennat stimmte Kaminski, mit dem er seit Jahren befreundet war, nicht uneingeschränkt zu, wenn er schrieb, dass der wegen Diebstahls vorbestrafte 25-jährige Gelegenheitsarbeiter durch Not und Arbeitslosigkeit ins Verbrechen abgerutscht war. „Da ist ja was dran“, murmelte er vor sich hin. „Aber Not und Armut lassen niemanden zum brutalen Sexualverbrecher werden. Da läuft wohl eher im Kopf was nicht ganz richtig.“
Böttcher war gestern Nachmittag, kurz nachdem er in Hoppegarten eine junge Frau überfallen hatte, von einer Polizeistreife festgenommen worden. Gennat war sofort klar gewesen, mit Böttcher auch den Mörder der Gräfin Lambsdorff vor sich zu haben. Nicht nur die Täterbeschreibung von damals passte so verblüffend zu dem jungen Mann, dass kaum ein Zweifel bestehen konnte, sondern auch die Art und Weise des Überfalls. Zudem hatte er in beiden Fällen auf seine Verfolger geschossen.
Gennat hatte einmal mehr auf seine altbewährte Methode gesetzt: „Sie brauchen keine Angst zu haben“, hatte er auf Böttcher unmittelbar vor dem ersten Verhör am Abend eingeredet und ihm beruhigend die Hand auf die Schulter gelegt. „Ich tue Ihnen nichts. Ich bin auch nicht Ihr Richter. Erzählen Sie frei weg. Glauben Sie mir, anschließend wird es Ihnen viel besser gehen.“ Auch gehörte es zu Gennats Prinzipien, seine „Kundschaft“ zu siezen. Sie sollte sich ernst genommen fühlen. Nur seine alten Spezis, die er schon seit Langem kannte und etliche Male festgenommen hatte, duzte er im gegenseitigen Einvernehmen.
Nach einer Tasse Kaffee und einer Zigarette legte Böttcher dann tatsächlich ein umfangreiches Geständnis ab: Am 11. Mai hatte er in einem Waldstück bei Strausberg die Gräfin Lambsdorff brutal überfallen, ausgeraubt, vergewaltigt und schließlich erschossen. Auf zwei Spaziergänger, die durch die verzweifelten Schreie des Opfers und die Schüsse auf das Verbrechen aufmerksam geworden waren und ihn an der Flucht hindern wollten, eröffnete er sofort das Feuer. Die Verfolger blieben zwar unverletzt, mussten aber Deckung suchen und verloren ihn schließlich aus den Augen.
Heute Vormittag hatte Gennat dann das Verhör fortgesetzt. Obwohl Böttcher seiner Ansicht nach geistig zurückgeblieben war, berichtete dieser ruhig und detailgenau. Er erzählte, dass das erbeutete Bargeld gerade für die Fahrkarte nach Berlin und einen Kinobesuch in der Münzstraße gereicht hatte. Deshalb sei er auch noch am selben Tag zu einem Goldwarenhändler in der Artilleriestraße gegangen, um die goldene Uhr der Gräfin zu versetzen.
Umgehend hatte Gennat einen Durchsuchungsbefehl für Böttchers möbliertes Zimmer in der Linienstraße 161 erwirkt. Seine Vermutung erwies sich als richtig: Zusammen mit seinen Kollegen fand er zahlreiche Schmuckstücke, deren Herkunft noch zu klären war. Eine goldene Kette mit einem ebenfalls goldenen Anhänger in Herzform meinte Gennat auf Anhieb zu erkennen. Da er sich aber nicht sicher war, sagte er zunächst noch nichts. Er wollte erst den weiteren Verlauf der Ermittlungen abwarten. Jedenfalls wurden die Schmuckstücke beschlagnahmt. Gennat verschob ein weiteres Verhör auf Mittwoch, denn zum einen musste der betreffende Goldwarenhändler befragt werden, zum anderen sollten die Kommissare Albrecht und Engel die Akten ähnlicher, noch ungeklärter Raubtaten durchforsten. Gennat war der festen Überzeugung, dass noch weit mehr Überfälle und Vergewaltigungen auf Böttchers Konto gingen.
Das Schrillen des Telefons ließ Gennat hochfahren. Benommen blinzelte er auf die Uhr an der Wand über dem Aktenschrank. Es war halb zehn. Beim Zeitunglesen war er wohl eingenickt. Schwankend stand er auf, ließ sich aber gleich wieder in den Stuhl neben seinem Schreibtisch fallen, zog das Telefon an der Schnur zu sich heran und nahm den Hörer ab.
„Mordinspektion, Gennat“, brummte er.
„Gut, dass Sie noch da sind, Herr Kriminalrat.“
Gennat erkannte die Stimme des Kriminalassistenten Meyerhoff. Ein Neuling bei der Kripo, der heute erst seinen zweiten Bereitschaftsdienst hatte.
„Was gibt’s?“
„Ich bin nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe, Herr Kriminalrat, aber das Polizeirevier Hohenschönhausen am Orankesee bittet Sie, sofort zu kommen. Da soll was am See passiert sein. Ich hab denen gesagt, dass wir eine Reservemordkommission schicken werden, aber die Beamten bestehen darauf, dass Sie sich persönlich um die Sache kümmern.W-was s-soll ich d-denn n-nun m-machen?“
Gennat amüsierte sich insgeheim über den unbeholfenen jungen Mann, der stets ins Stottern geriet, wenn er aufgeregt war.
„Mensch, Meyerhoff“, seufzte Gennat. „Machen Sie doch nicht aus jeder Mücke gleich ’ne ganze Elefantenherde. Können Sie mir einen triftigen Grund dafür nennen, warum ich nach Feierabend nach Hohenschönhausen rausgondeln soll?“
„Es soll sich um eine Tote am See handeln – oder im See – d-das st-steht w-wohl noch n-icht f-fest.“
„Haben Sie getrunken, Meyerhoff?“
„Unsinn. Sie w-wissen doch, dass ich nicht t-trinke“, gab der Kriminalassistent pikiert zurück. „Außerdem g-gibt es Zeugen.“
„Sicher die Füchse, die sich da ‚Gute Nacht‘ sagen“, konterte Gennat.
„Nein. Ein Geschwisterpaar namens Ribbe.“
Der Name Ribbe ließ Gennat aufhorchen. „Vornamen?“
„Keine Ahnung.“
„Sagen Sie Schmidtchen Bescheid. Ich bin gleich unten. Und Sie kommen auch mit, Meyerhoff – zur Übung.“ Er legte den Hörer auf und erhob sich. Vom plötzlichen Hochfahren war ihm schwindlig geworden. Das schwülheiße Wetter vertrug er nicht. Einen Augenblick blieb er sitzen und atmete tief durch. Dann stemmte er sich an seinem Schreibtisch hoch, zog das Jackett über, setzte den Hut auf, steckte Notizbuch und Bleistift ein, knipste das Licht aus und schloss das Büro hinter sich ab. Gennat war schon an der Treppe, als er plötzlich eine ungewöhnliche Kälte an den Füßen spürte. Er hatte vergessen, seine Schuhe wieder anzuziehen. Wohl oder übel kehrte er noch einmal um.
Die schwarze Limousine der Kriminalpolizei wartete mit laufendem Motor im Hof. Das Gewitter war weitergezogen, und es nieselte nur noch leicht. Meyerhoff hielt dem Kommissar den hinteren Schlag auf, denn der Kriminalrat war es gewohnt, im Fond zu sitzen. Der Kriminalassistent stieg vorne ein.
„N’Abend Schmidtchen“, begrüßte Gennat den Chauffeur. „Schön, dass Sie heute Abend Dienst haben. Schauen wir mal, was uns am Orankesee erwartet.“
Erich Schmidt, von allen Schmidtchen genannt, musste erst einen mit eingeschaltetem Martinshorn die Grunerstraße hinunterrasenden Löschzug der Feuerwehr vorbeilassen, bevor er vom Hof fahren konnte. „Sicher schon wieder ein Dachstuhlbrand“, murmelte er und warf einen Blick über die Schulter nach hinten. „Wird wieder irgendwo eingeschlagen haben. Deshalb hat unsere Kleine, sie ist ja erst fünf, auch solche Angst bei Gewitter. Weil wir doch im vierten Stock wohnen und direkt über uns der Dachboden ist.“
„Schlimm, die vielen Blitzeinschläge in diesem Sommer. Wie singt doch dieser Otto Reutter so schön: ‚Berlin ist groß, Berlin ist herrlich, was man dort sieht ist interessant. ’S gibt jede Woche neue Bauten und jeden Tag nen Dachstuhlbrand‘“, zitierte Gennat und lehnte sich zurück. Noch immer fühlte er eine leichte Benommenheit. Erst als sie schon von der Landsberger Allee in die Oderbruchstraße abbogen, wandte sich Gennat an den Kriminalassistenten. „Was ist eigentlich passiert? Ich warte noch immer auf Ihre Erklärung.“
Meyerhoff zuckte mit den Schultern. „Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Sicherheitshalber habe ich aber den Erkennungsdienst und den Arzt verständigt.“
„Sie haben was?“, brauste Gennat auf. „Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst! Sie können doch nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, wenn Sie gar nicht wissen, ob da überhaupt etwas passiert ist!“
„Und wenn Sie mir nachher wieder Vorwürfe machen, ich hätte was verschlampt? So wie beim letzten Mal?“
„Das war doch eine ganz andere Situation. Da hatten wir eine Leiche und einen Tatort, der schnellstens gesichert werden musste.“
„Vielleicht haben wir hier ja auch eine Leiche und einen Tatort, der schnell gesichert werden muss. Das wissen wir doch noch gar nicht.“
Gennat stöhnte auf. „Genau das ist ja das Problem.“ Er verdrehte die Augen und murmelte vor sich hin: „Mein lieber Scholli! Das gibt Ärger! Ich höre Dr. Weiß und den Polizeipräsidenten schon toben.“
Um Viertel nach zehn bremste der Polizei-Mercedes vor dem Polizeirevier an der Lichtenberger Straße unweit des Orankesees. Ein Wagen des Erkennungsdienstes wartete bereits. Gennat begrüßte die Kollegen und bat sie um Geduld. Der Nieselregen hatte inzwischen aufgehört und der Revierchef kam den Kollegen vom Alexanderplatz entgegen. „Die Sache ist mir ausgesprochen peinlich, Herr Kriminalrat“, begann er und führte Gennat und Meyerhoff in sein Büro. „Bevor ich Ihnen die Zeugen bringen lasse, möchte ich Sie über die näheren Umstände informieren. Wir wären nie auf die Idee gekommen, Sie zu behelligen, Herr Kriminalrat, aber die beiden bestanden darauf.“
Gennat zog die Brauen hoch. „Sie haben mich sicher nicht hierher geholt, weil jemand mit mir plaudern möchte.“
Der Revierchef begann verlegen: „Gewiss nicht. Es war folgendermaßen: Während des Gewitters erschienen auf unserem Revier zwei junge Leute, völlig durchnässt und außer Atem, und behaupteten, am Orankesee, unweit des Zauns, der die Laubenkolonie abgrenzt, läge eine leblose weibliche Person. Ich persönlich ließ mir von den beiden den angeblichen Fundort zeigen, aber eine Leiche war weit und breit nicht zu entdecken. Als ich die beiden ermahnte, man könne sie wegen Irreführung der Polizei belangen, wurde der junge Mann ausfallend und bestand darauf, unverzüglich Kommissar Gennat aus dem Polizeipräsidium kommen zu lassen.“
Gennat schüttelte den Kopf. „Hat er einen Grund genannt, warum er ausgerechnet mit mir sprechen will?“
Der Revierchef zuckte mit den Schultern. „Nein, aber er drohte, sich beim Polizeipräsidenten zu beschweren und die Presse zu informieren.“
Noch einmal entschuldigte sich der Revierchef und ließ die Zeugen aus einem Nebenraum hereinführen. Über Gennats Gesicht ging ein breites Grinsen, denn jetzt begriff er, weshalb sie auf sein Kommen bestanden hatten: Die Geschwister Franziska und Felix Ribbe waren im Polizeipräsidium keine Unbekannten. Vor rund drei Jahren hatte Gennat den seinerzeit noch minderjährigen Felix Ribbe in fast regelmäßigen Abständen festnehmen müssen. Freilich handelte es sich – mal mehr, mal weniger – um Bagatelldelikte. Felix war weit davon entfernt, ein Verbrecher zu sein. Der heißspornige junge Kommunist hatte auf dem Höhepunkt der Inflation zusammen mit einigen seiner Genossen mehrfach Feinkostgeschäfte im Berliner Westen überfallen und ausgeraubt. Die Lebensmittel hatten sie jedoch nicht etwa verkauft oder selbst verbraucht, sondern an hungernde, kinderreiche Familien in den Arbeitervierteln verteilt. Insgeheim konnte Gennat eine gewisse Sympathie für die idealistischen Aktionen der Gruppe nicht verhehlen, denn die Not in den Armenvierteln war auch dem Kriminalisten nicht verborgen geblieben. Tagtäglich war er damit konfrontiert worden. Die jungen Leute hatten zwar Straftaten begangen, aber nicht aus Habgier, sondern für einen guten Zweck.
Mehr als dem Robin Hood von den Ackerstraße während des Verhörs goldene Brücken zu bauen, hatte er nicht tun können. Felix Ribbes Schwester Franziska, von allen Fanny genannt, hatte damals gerade bei Friedländer & Zaduck in der Krausenstraße eine Anstellung auf Probe als Näherin bekommen. An den Aktionen ihres Bruders war Fanny nie beteiligt, aber sie half der Gruppe, die Lebensmittel zu verteilen, und in ihrer Freizeit kümmerte sie sich um arme Familien. Gennat hatte ihr seinerzeit geraten, für ihren Bruder einen besonders ausgebufften Anwalt zu engagieren, und sie zu Dr. Dr. Erich Frey geschickt. Der Doppeldoktor, wie Gennat ihn nannte, übernahm das Mandat und erreichte für Felix beim ersten Mal einen Freispruch. Für den Überfall auf Rollenhagen, den Delikatessenprotz vom Tauentzien, so Felix’ Worte, musste der Junge allerdings eine geringfügige Jugendstrafe hinnehmen, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Felix hatte seinerzeit versichert, sollte er jemals wieder in Schwierigkeiten geraten, mit keinem anderen Polizisten als mit Kommissar Gennat zu reden. Der Junge hatte also Wort gehalten, konstatierte Gennat und wusste nicht, ob er sich darüber ärgern oder freuen sollte.
Er gab Meyerhoff ein Zeichen, draußen zu warten, und bat den Revierchef, mit den Zeugen allein sprechen zu dürfen. Widerstrebend zog sich der Beamte zurück.
„Gut, dass Sie kommen konnten, Herr Kommissar. Diese preußischen Bluthunde hier glauben, wir haben nicht alle Tassen im Schrank, aber …“, begann Felix, als sie allein waren.
„Nun mal sachte“, fiel Gennat ihm ins Wort und machte eine beschwichtigende Handbewegung. „Erstens erlaube ich dir nicht, meine Kollegen zu beleidigen, und zweitens weiß ich in groben Zügen schon Bescheid. Erzählt in aller Ruhe und von Anfang an, was passiert ist.“ Skeptisch begutachtete er die wackeligen Stühle, setzte sich dann doch lieber auf den massiven Tisch und zog Notizbuch und Bleistift aus der Innentasche seines Jacketts. „Dann legt mal los. Ich bin ganz Ohr.“
Vor Kälte in ihren nassen Kleidern zitternd, schlang Fanny die Arme um ihren Körper. Sie rutschte auf die vordere Stuhlkante und schaute auf ihre Schuhspitzen. „Ich bin über eine Leiche gestolpert. Und nun ist sie weg. Das ist alles. Sie glauben doch wohl nicht etwa, dass wir uns das nur ausgedacht haben!“
Gennat machte sich Notizen, stellte hin und wieder eine Zwischenfrage oder nickte nur. Die Geschwister hatten sich, um Fannys Geburtstag zu feiern, am frühen Abend zu einem Picknick am Orankesee getroffen. Felix brachte sogar, weil es schon recht früh dunkel wurde, eine Petroleumlaterne mit, die er sich an einer Baustelle „ausgeliehen“ hatte. Die beiden machten ein kleines Feuer, grillten die mitgebrachten Würstchen und tranken billigen Erdbeersekt. Als das Gewitter losbrach, packten sie ihre Sachen zusammen und rannten in Richtung Laubengelände, um in einer Bretterbude, die von Badenden gerne zum Umkleiden benutzt wurde, Schutz zu suchen. Plötzlich stolperte Fanny über etwas und fiel der Länge nach hin. Im Licht eines Blitzes sah sie, wenn auch nur schemenhaft, eine Frauengestalt auf dem Weg liegen. Entsetzt schrie sie auf. Felix rannte mit seiner Laterne zu ihr und versuchte die Frau, die gestürzt zu sein schien, anzusprechen. Er wollte ihr aufhelfen, aber sie rührte sich nicht. In Panik liefen die Geschwister im strömenden Regen zum nahegelegenen Polizeirevier. Aber als sie mit dem Beamten zurückkamen, war die Leiche nicht mehr da.
Die Hände auf den Tisch gestützt und mit gesenktem Blick saß Gennat schweigend da, bis er endlich fragte: „Was macht euch eigentlich so sicher, dass die Frau tot war? Vielleicht war sie betrunken oder ohnmächtig, ist wieder zu sich gekommen und weggegangen.“
Felix schien irritiert und zögerte einen Augenblick mit der Antwort: „Sie hat nicht reagiert, lag einfach so da. Doch. Sie war tot. Da bin ich ganz sicher.“
Gennat zweifelte, denn er hielt es durchaus für möglich, dass ein Laie in der Aufregung eine ohnmächtige oder bewusstlose Person für tot halten könnte.
„Vorher ist euch nichts Verdächtiges aufgefallen? Niemand ist euch begegnet? Ihr habt keine Schreie oder Hilferufe gehört?“
Beide verneinten.
„Könnt ihr die Frau beschreiben?“ Und direkt an Felix gewandt: „Du hast sie dir doch im Licht deiner Laterne sicher genau angesehen, oder?“
Felix nickte: „Ich glaube schon. Aber Fanny hat mich mit ihrer Heulerei so verrückt gemacht, dass ich gar nicht richtig hingeschaut habe. Jedenfalls war die Frau blond und trug ein weinrotes Kleid mit schwarzen Ornamenten. Meine Laterne war ja ziemlich hell. Dann hatte sie noch eine Pelzstola. Das fand ich bei diesem warmen Wetter allerdings seltsam. Und dann war da noch was, was ich eigenartig fand: Sie trug Handschuhe.“
Fanny nickte zustimmend. „Schwarze Satinhandschuhe.“
„Wenn sie Satinhandschuhe trug, hatte sie sicher auch einen Hut. Frauen tragen immer einen Hut“, murmelte Gennat vor sich hin und fragte dann laut: „Trug die Frau einen Hut? Habt ihr irgendwo einen Hut gesehen?“
Beide verneinten.
Gennat überlegte wieder einen Augenblick. „Ich muss das sehen“, sagte er, steckte Notizbuch und Bleistift wieder ein, ließ sich vom Tisch gleiten und ging zur Tür. „Ihr zeigt mir jetzt die Stelle, wo die Tote gelegen haben soll. Die Kollegen vom Erkennungsdienst sind ja ohnehin da. Wenn sie nun schon mal hier sind, dann können sie auch ihre Arbeit machen.“
Der Gewitterregen hatte die Wege aufgeweicht. Kriminalrat Gennat kratzte sich das Doppelkinn und blinzelte ins Licht der aufgestellten Karbidscheinwerfer, an deren Übelkeit erregende Ausdünstungen er sich in all den Jahren noch immer nicht hatte gewöhnen können. Die Männer vom Erkennungsdienst stapften durch Matsch und tiefe Pfützen. Nach kurzer Zeit hatten alle nasse Füße und schlechte Laune. Weder Fußabdrücke noch Schleifspuren waren auszumachen. Plötzlich tippte ihm von hinten jemand auf die Schulter. Gennat fuhr herum. „Ach, Doktor Siebert, schön dass Sie da sind.“
„Ja, was ist denn nun?“, fuhr der Polizeiarzt den Kriminalrat an. „Wo ist die Leiche?“
Gennat registrierte grinsend, dass Siebert schon wieder schlechte Laune hatte und zuckte mit den Schultern. „Die hatte keine Lust mehr, auf Sie zu warten. Hat sich’s kurzerhand anders überlegt und ist entschwunden.“ Gennat grinste noch immer, streckte die Arme zur Seite, hob sie an, als stünde er auf der Opernbühne und sang aus voller Kehle: „Martha, Martha du entschwandest und mit dir mein Portemonnaie“.
Fassungslos starrte Siebert Gennat an, machte den Mund auf, klappte ihn aber gleich wieder zu. Leise vor sich hin fluchend watete er den matschigen Weg entlang. Gennat schaute ihm nach. Erst jetzt bemerkte er, dass Siebert einen schwarzen Anzug und Lackschuhe trug, die der Matsch inzwischen ruiniert hatte. Plötzlich fiel es ihm wieder ein: Siebert hatte heute Silberhochzeit. Noch am Nachmittag hatten sie im Präsidium darüber gelästert, wie diese Feier bei seiner ewigen schlechten Laune wohl aussehen würde. – „Morgen gehe ich mit einer Flasche Kognak zu ihm und entschuldige mich“, murmelte Gennat.
Die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, ging er auf dem schmalen Weg auf und ab und dachte nach. Eine verlorene Haarnadel, ein abgerissener Knopf, das wäre wenigstens ein Anhaltspunkt, ging es ihm durch den Kopf. In dem Matsch nach etwaigen Blutspuren zu suchen, wäre sinnlos. Plötzlich blieb er stehen und winkte einen der Beamten zu sich heran: „Die Jungs sollen zusammenpacken und Feierabend machen“, ordnete er an. „Sperren Sie den Weg ab und sehen Sie sich bei Tageslicht noch einmal um. Es hat keinen Sinn, eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen, zumal wir nicht einmal wissen, ob es überhaupt eine Stecknadel gibt.“
Pohlmann, der diensthabende Beamte des Erkennungsdienstes, nickte zustimmend und befahl seinen Leuten: „Schluss für heute. Wir machen morgen früh bei Tageslicht weiter. Sichern Sie nur noch die vermutliche Fundstelle. Dann ziehen wir ab.“
Bevor Pohlmann ging, nahm er den Kriminalrat noch einmal zur Seite und zeigte auf eine kaum sichtbare Spur im Matsch. „Schauen Sie sich das hier mal an. Könnten Reifenspuren sein. Näher zu bestimmen sind sie durch den Regen leider nicht mehr. Könnte aber sein, dass die Leiche, wenn es denn eine gab, mit einem Auto abtransportiert wurde.“
Gennat verdrehte die Augen. „Ach Pohlmann! Hätte ich ein Los gekauft, könnte ich in der Lotterie gewonnen haben. – Was sollen wir mit einer Reifenspur, die nur vielleicht eine ist? Das könnte ebenso gut ein Pferdewagen gewesen sein. Sie können ja mal nach Pferdeäppeln suchen.“
„Sie haben ja recht. War ja auch nur so eine Idee“, meinte Pohlmann kleinlaut.
„Sie glauben uns also nicht“, konstatierte Felix Ribbe gleichermaßen enttäuscht wie empört.
„Was heißt glauben“, seufzte Gennat. „Im Moment ist es nur sinnlos, nach Spuren zu suchen. Hier ist nichts als Matsch.“
„Aber die Frau hat hier gelegen“, mischte Fanny sich ein. „Herr Kommissar. Wir erzählen Ihnen doch keine Märchen!“
Gennat legte dem Mädchen zur Beruhigung die Hand auf den Arm. „Ich bin sicher, dass ihr euch diese Geschichte nicht ausgedacht habt“, beruhigte er sie. „Aber ohne Indizien wird es schwer werden, ernsthaft zu ermitteln. Meine Leute werden morgen noch einmal bei Tageslicht suchen. Mehr können wir im Moment nicht tun. – Soll ich dafür sorgen, dass euch ein Polizeiwagen nach Hause fährt? Ihr seid ja noch immer pudelnass.“
„Nee, Herr Kommissar.“ Felix schüttelte energisch den Kopf. „Wir sind mit den Rädern gekommen und so fahren wir auch wieder nach Hause.“
Gennat zuckte wortlos mit den Schultern und ging zu Schmidtchen hinüber, der schon wartend neben dem Polizei-Mercedes stand. „Der Herr Meyerhoff fährt mit den Kollegen von der Spurensicherung zurück in die Stadt.“ Er hielt Gennat den Schlag auf und half ihm beim Einsteigen. „Ins Präsidium oder nach Hause, Herr Kriminalrat?“
„Nach Hause“, brummte Gennat, hielt dann aber inne und verbesserte sich: „Nein, nicht nach Hause. Fahren Sie mich in die Kochstraße.“
„In die Kochstraße? Ins Zeitungsviertel? Was wollen Sie denn da noch so spät, Herr Kriminalrat?“
„Fragen Sie nicht so viel, Schmidtchen, fahren Sie.“
II
Vor dem Verlagshaus, in dem das Berliner Echo seine Redaktion hatte, stieg Gennat aus. Er trat in die Halle und steuerte auf den Portier im Empfang zu. „Ist der Kaminski vom Berliner Echo noch im Haus?“
Der Portier hatte den Dicken vom Alexanderplatz sofort erkannt und machte einen devoten Diener. „Sie haben Glück, Herr Kriminalrat. Herr Kaminski ist in seinem Büro. Fahren sie in die fünfte Etage. Sie können ihn nicht verfehlen. Die Tür zu seinem Büro steht immer offen.“
„Danke, ich kenne mich aus“, rief Gennat, schon auf dem Weg zum Paternoster, über die Schulter zurück.
Seit gut zehn Jahren kannte Gennat den Polizeireporter Max Kaminski. Seinerzeit, es war das zweite Kriegsjahr, sollte der junge Journalist für seine Zeitung, die damals noch Berliner Abendblatt hieß, eine große Serie über die Arbeit der Kriminalpolizei schreiben. Der damalige Leiter der Kriminalpolizei Hans Hoppe erteilte Kaminski prompt die Erlaubnis, bei der Mordkommission zu kiebitzen. Die Kriminalkommissare im höheren Dienst waren von der Einberufung größtenteils verschont geblieben. So auch Ernst Gennat. Denn sie waren, wie man sagte, an der Heimatfront unabkömmlich. Dem jungen Reporter Kaminski blieb, obwohl erst 28 Jahre alt, der Kriegsdienst ebenfalls erspart: Der Stabsarzt hatte bei ihm einen Herzfehler diagnostiziert und ihn für untauglich befunden.
Hoppe bat Gennat, den jungen Mann unter seine Fittiche zu nehmen, wie einen Kollegen zu behandeln und in die Ermittlungsarbeit so weit wie möglich einzubeziehen. Gennats anfängliche Skepsis war schnell verflogen. Der Reporter bewies bemerkenswertes kriminalistisches Talent und trug erheblich zur Aufklärung eines komplizierten Falles bei. Gennat bedauerte, dass er Kaminski nicht überreden konnte, zur Kriminalpolizei zu wechseln. Er und Kaminski wurden bald Freunde und Gennat ging im Hause Kaminski am Kurfürstendamm, Ecke Bleibtreustraße ein und aus. Max Kaminski entstammte einer großbürgerlichen jüdischen Familie. Sein Vater Georg war ein bekannter Arzt, ebenso sein Onkel Jakob. Onkel Salomon Kaminski war Rechtsanwalt und hatte seine Kanzlei in der Lietzenburger Straße. Knapp zwei Jahre bevor Gennat ihn kennenlernte, hatte Max Kaminski 1914 geheiratet. Seine Frau Lissy war die Tochter von Hirsch Rosenzweig, dem Inhaber eines großen Stoff- und Trikotagengeschäfts auf dem Tauentzien mit zahlreichen Filialen in und um Berlin. Die Fabrik der Rosenzweigs war in der Nähe von Chemnitz beheimatet. Max’ und Lissys Sohn David war gerade zwei Jahre alt, als Gennat die beiden zum ersten Mal traf. Gennat schätzte Lissy sehr. Sie leistete freiwillige Arbeit für die städtische Fürsorge und begleitete Sozialpflegerinnen auf ihren Besuchsgängen zu armen Familien des Berliner Arbeiter-Nordens, kümmerte sich um verwahrloste Jugendliche oder erledigte Behördengänge und allerlei Papierkram für Kranke und Versehrte. Zudem verfügte sie, ebenso wie Max, über ein beachtliches kriminalistisches Talent. Im Fall der ermordeten Martha Franzke 1916 war es auch ihrem Einsatz zu verdanken, dass die wahren Mörderinnen gefasst und überführt werden konnten.
Inzwischen hatte sich die Familie Kaminski vergrößert: Die Zwillinge Clara und Wolfgang waren nun auch schon fünf Jahre alt. Wie die Zeit vergeht, dachte Gennat in diesem Augenblick. Max Kaminski hatte sich im Laufe der Zeit einen guten Namen als Polizei- und Gerichtsreporter gemacht, und immer wieder hatte er sich, fast immer zusammen mit Lissy, in Gennats Ermittlungsarbeit eingemischt, was ihrer Freundschaft so manches Mal um Haaresbreite ein jähes Ende beschert hätte. Als sei er einer von ihnen, ging Kaminski im Polizeipräsidium ein und aus. Gennat wusste, dass der von ihm so hoch geschätzte Kommissar Rudolf Lissigkeit in Max Kaminski einen guten Freund gefunden hatte. Auch er bedauerte, dass Kaminski nicht zu überreden war, zur Kriminalpolizei zu wechseln. Lissigkeit und Kaminski wären, so glaubte Gennat wenigstens, das perfekte Ermittlerteam gewesen. Doch Kaminski zog es vor, bei der Zeitung zu bleiben, war er doch ein leidenschaftlicher Reporter. Das Berliner Abendblatt, für das er schrieb, hatte vor eineinhalb Jahren, seit es mit einer Morgen- und einer Abendausgabe erschien, seinen Namen geändert und nannte sich jetzt Berliner Echo.
Als er in der fünften Etage ausstieg, sah er schon das Licht, das aus Kaminskis winzigem Büro auf den Flur fiel.
Gennat klopfte an den Türrahmen und grinste. Max Kaminski hatte die Füße auf den Schreibtisch gelegt, hielt einen Notizblock auf den Knien und kaute auf seinem Bleistift. „Na, Herr Polizeireporter, fällt Ihnen nichts ein?“, fragte Gennat breit grinsend.
Kaminski sah auf, nahm schnell die Füße herunter und warf Block und Bleistift auf den Tisch. „Herr Kriminalrat! Der Spruch stimmt also. Je später der Abend … Na ja, Sie wissen schon. Was führt Sie zu so ungewöhnlicher Stunde zu mir? Ich wette, Sie haben etwas an meinem Artikel über Böttcher auszusetzen.“
„Nicht direkt. Aber darüber möchte ich jetzt nicht mit Ihnen diskutieren.“
„Sie unterstützen doch wohl nicht etwa die Thesen von diesem Heindl über die sogenannten ‚Berufsverbrecher‘? Also ich sehe in Böttcher keinen ‚Berufsverbrecher‘ im eigentlichen Sinne.“
„Zwischen schwarz und weiß gibt es nun mal noch unendlich viele Farben. Aber bringen Sie bitte die Dinge nicht durcheinander: Böttcher ist kein Geldschrankknacker oder Einbrecher, sondern ein Mörder, der hemmungslos um sich schießt, Frauen ausraubt, misshandelt und vergewaltigt. Ich wette mit Ihnen, dass er noch weit mehr Verbrechen, respektive Morde auf dem Gewissen hat. – Aber lassen wir das Thema jetzt. Ich muss Sie in einer ganz anderen Sache sprechen.“
„Leider kann ich Ihnen in meiner Besenkammer keinen Platz anbieten.“ Mit einer entschuldigenden Geste wies Kaminski in den winzigen Raum, in dem nur ein Tisch, der augenscheinlich schon ein langes Leben als Küchentisch hinter sich hatte, ein Stuhl und ein altersschwaches Bücherregal Platz fanden. Der Stuhl für Besucher war unter den Tisch geschoben. Wer sich setzen wollte, musste ihn über die Türschwelle in den Flur stellen. „Lassen Sie uns in das kleine Weinlokal in der Charlottenstraße gehen. Da kann man gut reden“, schlug er vor.
Wenige Minuten später traten sie in das selbst zu so später Stunde noch gut besuchte kleine Lokal, bestellten Portwein, und Gennat berichtete von dem vermeintlichen Leichenfund am Orankesee. „Einerseits gibt es nicht den leisesten Hinweis auf ein Verbrechen, andererseits gehören die Ribbes nicht zu den Menschen, die sich etwas ausdenken, nur um die Polizei in die Irre zu führen“, endete er seinen Bericht.
Kaminski hatte sich Notizen gemacht und kaute auf seinem Bleistift. „Ich habe noch immer nicht verstanden, warum Sie mir diese Geschichte erzählen. Das ist nicht einmal eine Dreizeilenmeldung wert.“
„Mensch Kaminski, seien Sie doch nicht so begriffsstutzig. Sie mischen sich doch sonst laufend in meine Arbeit ein. Es wird nicht leicht sein, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Ich habe ja nichts in der Hand.“
„Aha. Sie wollen also, dass ich mich in der Laubenkolonie umhöre und ein bisschen in der Gegend herumschnüffele.“
Gennat grinste zufrieden. „So oder so ähnlich könnte man es ausdrücken. Ihnen als Reporter erzählen die Leute eher etwas als der Polizei. Wenn jemand was rauskriegt, dann Sie!“
Kaminski überlegte einen Augenblick, ehe er reagierte. „Sicher haben Sie schon eine Theorie.“
„Nein. Nicht wirklich. Aber irgendetwas steckt hinter dieser Sache. Ich weiß nur noch nicht, was.“
„Morgen in der Abendausgabe könnte ich einen Artikel unterbringen.“
„Lieber nicht. Ich will die Sache nicht an die große Glocke hängen. Dazu ist das, was ich weiß, viel zu vage.“
„Na schön. Ich werde mir die Gegend um den See gleich morgen früh ansehen. Natürlich halte ich Sie auf dem Laufenden. Wenn es wirklich eine Leiche gibt, ist es naheliegend, dass man sie zunächst in der Laubenkolonie versteckt hat. Aber von da muss sie natürlich wieder weg. Eine solche Aktion wird freilich nicht unbemerkt vonstattengehen können.“
„Eben. Ich kann mich auf Ihre Diskretion verlassen?“
„Ich werde schweigen wie ein Grab.“ Kaminski hob die Hand wie zum Schwur.
Sie zahlten und verließen das Lokal.
„Soll ich Sie nach Hause fahren?“, fragte Kaminski, als sie die Charlottenstraße entlanggingen.
„Sie sind mit dem Wagen hier? Wenn es Ihnen nichts ausmacht? Gerne.“
Kaminski half dem Kriminalrat in den feuerroten Opel, der eigentlich seinem Onkel, dem Rechtsanwalt Salomon Kaminski, gehörte. Doch wann immer sein Neffe wollte, durfte er ihn benutzen.
Wegen einer Baustelle hatte Kaminski sich verfahren und musste schließlich von der Neuen Kantstraße rechts in den Königsweg einbiegen und dann wieder rechts auf den Kaiserdamm.
„Setzen Sie mich hier ab“, sagte Gennat, als sie die Kreuzung erreicht hatten. „Ich will noch ein bisschen frische Luft schnappen.“ Kaminski hielt an und half dem Kriminalrat beim Aussteigen. Nach dem Gewitter war die Luft sauber und angenehm frisch. Gennat atmete tief durch. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, überquerte er den Kaiserdamm und passierte das Polizeiamt Charlottenburg in Richtung Sophie-Charlotte-Platz. „Ich sollte viel öfter mal ein Stückchen spazieren gehen“, sagte er zu sich selbst, denn in diesem Augenblick wurde ihm bewusst, dass dies sein erster Spaziergang seit der Rückkehr von seiner Dienstreise nach Breslau war. Sechs Wochen lang hatte er in der schlesischen Metropole erfolglos im Doppelmord an den Fehse-Kindern ermittelt. Die Geschwister, die achtjährige Erika und der elfjährige Otto Fehse, waren bestialisch umgebracht, ihre Leichen zerstückelt, die Leichenteile in Pakete verpackt und diese an exponierten Plätzen der Stadt abgelegt worden. Grausiger Höhepunkt des Falls: Kurze Zeit nach Auffindung der Leichenteile erhielt der Großvater der Kinder ein Päckchen zugeschickt. Es enthielt, eingewickelt in das Höschens des Mädchens, die abgetrennten Geschlechtsteile der Kinder.
Vor vier Wochen hatte Kommissar Werneburg ihn dann abgelöst, aber wie es schien, war auch der Kollege noch keinen Schritt weitergekommen. In den nächsten Tagen wurde er zurückerwartet.
Wenige Meter hinter dem Polizeiamt bog Gennat links in die Schloßstraße ein, ließ die kleine, sich bis zum Horstweg erstreckende Grünanlage links liegen, überquerte die Straße und stolperte über einen heruntergefallenen Ast. Gennat fluchte. Spricht jemand vom dunklen Berlin, konstatierte er, dann assoziiert man damit zwangsläufig die verrufenen Viertel im Osten der Stadt, die Gegenden um das Scheunenviertel, den Schlesischen und den Stettiner Bahnhof. Die Charlottenburger Schloßstraße jedoch, befand er, ist des Nachts nicht viel heller als die berüchtigte Mulackstraße. Hier wie dort spendeten die Gaslaternen nur schummriges Licht. Allein der fünfflammige Kandelaber auf der Mittelinsel an der Knobelsdorffstraße schien in dieser Nacht Helligkeit zu verbreiten, denn sein Licht wurde von dem noch immer nassen Kopfsteinpflaster und den zahlreichen Pfützen vielfach reflektiert.
Nach wenigen Schritten erreichte Gennat den vierstöckigen, kasernenartigen, terrakottaverzierten Backsteinbau der Werner-von-Siemens-Oberrealschule. Der Schule schräg gegenüber lag das ebenfalls vierstöckige, für Berliner Verhältnisse nur sparsam mit Stuck verzierte Haus Nummer 35, in dem Ernst Gennat seit seiner Jugend wohnte. Er schaute zur ersten Etage hinauf und sah, dass bei ihm noch Licht brannte. Marie ist bestimmt wieder über einem ihrer grässlichen Schmöker eingeschlafen, dachte er grinsend. Marie Hartmann, seit seinen Kindertagen Haushälterin im Hause Gennat, hatte eine unbändige Leidenschaft für Detektivromane.
Vor der Haustür angelangt tastete er seine Taschen ab. „Verdammte Scheiße“, murmelte er, „Schlüssel vergessen.“ Er drückte die Messingklinke der schweren Eichentür herunter und stemmte sich dagegen. Als sie nachgab, atmete er auf. Es war nicht abgeschlossen. Er stieg in die erste Etage hinauf und klingelte an der linken Tür.
Kaum eine halbe Minute verging, bis er hinter der Tür Geräusche wahrnahm.
„Haben Sie schon wieder Ihre Schlüssel vergessen?“ hörte er Maries verärgerte Stimme.
„Mach schon auf, Marie, ich hab meine Schlüssel im Präsidium liegen lassen.“
„Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt“, schimpfte sie. „Seien Sie froh, dass Ihr Hintern angewachsen ist, sonst würden Sie den auch noch vergessen.“
„Halt’ mir jetzt keine Vorträge. Mach’ lieber auf!“ Gennats Stimme dröhnte durch das Treppenhaus. Er hörte, wie Marie die Eisenkette zurückschob, sie löste und den Schlüssel im Schloss drehte. Erst öffnete sie nur einen Spalt, als wollte sie nachsehen, ob es tatsächlich Gennat war, der da vor der Tür stand.
„Also, Herr Gennat“, begann sie. „Das ist doch auf die Dauer kein Zustand, dass Sie immer erst mitten in der Nacht nach Hause kommen.“
„Ich bin nun mal kein Finanzbeamter mit Ärmelschonern, der morgens um halb acht mit der Aktentasche und dem Stullenpaket aus dem Haus geht und nachmittags pünktlich um fünf wieder auf der Matte steht“, konterte er. „Das müsstest du in all den Jahren kapiert haben.“ Gennat kannte Maries Vorwürfe zwar zu genüge, sie ärgerten ihn aber immer wieder von Neuem.
„Wie sind Sie ohne Schlüssel eigentlich ins Haus gekommen?“ fragte sie schnippisch.
„War nicht abgeschlossen.“
„Das war sicher wieder die Bergersche von oben. Die schließt nie ab. Können Sie nicht mal mit ihr reden? Das geht doch nicht, dass die die Haustür immer offen lässt…“
„Mach doch nicht so ein Theater um diese Lappalie. Jeder kann mal vergessen abzuschließen. Außerdem haben wir eine Hauswartsfrau. Die Krügersche hat gefälligst dafür zu sorgen, dass das Haus nach acht Uhr abends abgeschlossen ist.“ Er zog das Jackett aus, hängte es an die Türklinke seines Arbeitszimmers und murmelte: „Ich werd den Teufel tun und meine Mitmieter zurechtweisen. So weit kommt’s noch!“
Marie insistierte nicht weiter. Kopfschüttelnd nahm sie das Jackett und hängte es auf einen Bügel.
„Wollen Sie noch etwas essen?“
„Ein paar Schmalzstullen würden mir reichen.“
„Sie sollen doch kein Schmalz essen, hat der Doktor gesagt. Margarinebrote kann ich Ihnen machen.“
„Der Arzt ist ein Armleuchter. Margarine ist was für arme Leute. Ich will was Anständiges auf dem Teller haben.“
„Wenn Sie so weitermachen, dann wird Sie noch vorzeitig der Schlag treffen.“
„Es ist noch keiner gesund gestorben“, konterte Gennat.
Erst jetzt bemerkte er, dass etwas fehlte und er sah sich verwundert um. „Wo ist eigentlich Caruso?“ Der alte Graupapagei, der, wenn sich ein Schlüssel im Schloss der Wohnungstür drehte, sofort kreischend angeflattert kam und ein Höllenspektakel losbrach, hatte sich noch nicht blicken lassen.
„Die Leute aus dem zweiten Stock haben sich doch erst gestern beschwert, weil Caruso immer anfängt, Krach zu machen, wenn Sie erst nachts nach Hause kommen. Da habe ich ihn halt schon eingesperrt und zugedeckt.“
Gennat verzichtete darauf, noch einmal ins Wohnzimmer zu gehen und nach dem Vogel zu schauen.
„Gute Nacht, Marie“, grummelte er und zog sich gleich in sein Schlafzimmer zurück. Er wollte jetzt nichts weiter, als endlich seine Ruhe haben.
Als alles ruhig war und er sicher sein konnte, dass Marie schlief, stand er noch einmal auf, schnitt sich zwei Scheiben Brot ab, bestrich sie dick mit Griebenschmalz, streute ein wenig Salz darauf und goss sich ein Glas eisgekühlte Zitronenlimonade ein, denn dienstags kam immer der Eismann.
Kurz nach zwei Uhr morgens legte er sich wieder ins Bett und schlief augenblicklich ein.
III
Fluchend sprang Gennat aus dem Bett. „Verdammt, ich hab’ verschlafen!“ Der Wecker hatte zwar um sechs Uhr geklingelt, aber er war noch einmal eingenickt. Als er dann wieder aufwachte, war es bereits kurz nach halb acht. Er warf seinen rot-braun gestreiften Bademantel über und stampfte in die Küche. Marie hatte gerade Kaffeewasser aufgesetzt und hantierte mit dem Frühstücksgeschirr. In ihrem verwaschenen geblümten Morgenmantel, den sie schon getragen hatte, als er noch ein kleiner Junge war, erschien sie noch magerer, und das dünne, nur provisorisch zusammengesteckte graue Haar machte ihr farbloses Gesicht noch farbloser.
„Warum hast du mich nicht geweckt? Weißt du eigentlich, wie spät es ist?“ schnauzte er sie an.
„Ich wollte Sie ausschlafen lassen, weil Sie doch erst gegen Morgen ins Bett gegangen sind.“
„Bist du von allen guten Geistern verlassen, aber doch nicht, wenn ich in den Dienst muss.“
„Ich dachte nur…“
„Das Denken überlass mal lieber den Pferden. Die haben ’n größeren Kopp“, brummte er vor sich hin.
Mit einer ausladenden Geste wies er auf den Küchentisch, auf dem nur das Geschirr und eine Tüte Zwieback standen. „Und das Frühstück ist auch nicht fertig.“
„Das ist das Frühstück“, erwiderte Marie pikiert. „Sie sollen morgens nur Zwieback essen, hat der Arzt…“
„Ihr seid doch wohl alle mit’m Klammerbeutel gepudert“, brüllte Gennat. „Da kippe ich ja vor Schwäche aus den Latschen, noch bevor ich im Büro angekommen bin…“
Vor sich hin schimpfend zog er sich an, ging in sein Arbeitszimmer zum Telefon und rief im Polizeipräsidium an, um einen Wagen zum Witzlebenplatz kommen zu lassen, denn er wollte als Erstes nach Hohenschönhausen zum Orankesee fahren. Türknallend verließ er die Wohnung.
Von der Schloßstraße bog er rechts in den Kaiserdamm ein, vorbei am Polizeiamt Charlottenburg und steuerte zielstrebig die kleine Konditorei am Witzlebenplatz an. Als er eine Begrüßung murmelnd eintrat, putzte die junge Serviererin mit dem dunklen Pagenkopf und dem runden, rosigen Gesicht gerade die Tische. An diesem Morgen war er der erste Gast. „Morjen, Herr Kriminalrat. Hat Ihre Haushälterin Ihnen mal wieder ein ordentliches Frühstück verweigert?“ Es war kein Geheimnis, dass er immer dann zum Frühstücken kam, wenn seine Haushälterin wieder einmal einen ihrer hoffnungslosen Versuche gestartet hatte, ihn auf Diät zu setzen.
„Kann man so sagen“, sagte Gennat, steuerte auf seinen Lieblingsplatz am Fenster zu und bestellte zwei Eier im Glas, drei Schrippen, eine mit Wurst, eine mit seinem Lieblingskäse, mit dem, der so schön stinkt, eine mit Marmelade und reichlich Kaffee. Nach dem üppigen Frühstück stieg Gennat in den vor dem Café schon wartenden Wagen.
Als Max Kaminski das Verlagshaus betrat, sah er auf seine Armbanduhr. Es war Punkt acht. In seinem Besenkammerbüro war es noch immer unerträglich heiß und stickig. Durch das schmale Fenster, das auf einen Lichtschacht führte, kam statt frischer Luft nur ein modriger Dunst, den der Gewitterregen noch verstärkt hatte. Bevor er nach Hohenschönhausen zum Orankesee fuhr, um sich den Tatort – wenn es denn überhaupt einen solchen gab – anzuschauen, beschloss er, seinen Arbeitsplatz in sein heimliches Büro, wie er das Café Jaedicke nannte, zu verlegen. Hier konnte er am besten arbeiten, hier kamen ihm die meisten Ideen. Er stieg gerade im Erdgeschoss aus dem Paternoster, als Rudi Neubauer, der Lokalchef, auf ihn zukam. „Ach Kaminski, gut, dass ich Sie treffe. Ihren Artikel über diese seltsame Sache am Orankesee hab ich schon in die Mettage gegeben. Ich kriege ihn sonst nicht mehr in der Abendausgabe unter. Sie sagten doch, die Sache sei wichtig.“
„Ist sie auch“, bejahte Kaminski.
„Na dann ist es ja gut.“ Neubauer schien erleichtert. „Ich hab mir allerdings erlaubt, noch ein paar Kleinigkeiten zu ändern und zu kürzen. Sonst hätte er nicht auf die Seite gepasst.“
Kaminski zog die Brauen zusammen. „Sie wissen doch, dass ich das gar nicht mag, wenn Sie in meinen Artikeln rumredigieren. Da gab es nichts zu ändern.“
Neubauer hob beschwichtigend die Hände. „Regen Sie sich doch nicht gleich auf. Es war ja nur eine Kleinigkeit. Was soll ich denn machen, wenn ich auf der Seite keinen Platz mehr habe?“
„Trotzdem hätten Sie mich vorher fragen müssen“, sagte Kaminski verärgert. „Ich bin ja derjenige, der dann wieder Ärger mit Gennat bekommt, wenn Sie Mist geschrieben haben.“
„Ich muss doch sehr bitten, lieber Kollege! Habe ich jemals Mist geschrieben?“
„Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, aber ich möchte es mir mit dem Polizeipräsidium nicht verscherzen.“
„Nun haben Sie sich mal nicht so!“, winkte Neubauer ab und ging weiter.
Kopfschüttelnd verließ Kaminski das Verlagshaus und ging hinüber in sein Stammcafè an der Ecke Charlottenstraße. Ganz gleich zu welcher Tageszeit er die für ihren Baumkuchen berühmte Konditorei auch aufsuchte, immer traf er hier auf Kollegen, die etwas Neues wussten, sei es aus dem Reichstag, aus diplomatischen Kreisen – oder die den neuesten Gesellschaftsklatsch kannten. Das Café war weit mehr als nur der Treffpunkt der Journalisten der umliegenden Verlage. Es war Informationsbörse, Konferenzraum und Kantine zugleich. Hier konnte man nicht nur Kuchen essen und Kaffee trinken, sondern auch ein Champagner-Frühstück mit Lachs und Kaviar genießen. So mancher Kollege feierte bei Jaedicke Jahr für Jahr seinen Geburtstag.
Kaminski bestellte sich einen besonders starken Mokka, denn er hatte kaum vier Stunden geschlafen und brauchte dringend etwas zum Munterwerden.