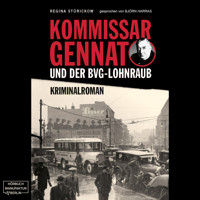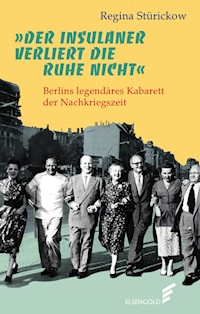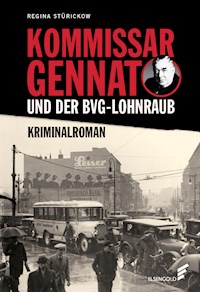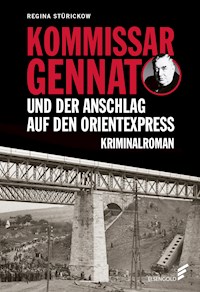Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elsengold Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gennat-Krimi
- Sprache: Deutsch
1916 leidet Berlin unter den Folgen des Ersten Weltkrieges. Viele Männer sind an der Front, die Frauen kämpfen zu Hause ums Überleben. In Zeiten der Not haben Verbrechen besonders Konjunktur. Eine Frau ist ermordet worden. Ihre Leiche wurde in einem Reisekorb von Berlin nach Stettin geschickt. Der junge Reporter Max Kaminski, kriegsuntauglich, ermittelt zusammen mit Kommissar Ernst Gennat in Berlin-Mitte. Zwischen "gefallenen Mädchen" aus dem Rotlichtmilieu und einer mysteriösen Dame der Gesellschaft tun sich tiefe Abgründe auf, die Kaminski auch selbst in Gefahr bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REGINA STÜRICKOW
Kommissar Gennatund die Toteim Reisekorb
Kriminalroman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
E-Book im Elsengold Verlag, 2021
© der Originalausgabe:
Elsengold Verlag, Berlin, 2021
Umschlaggestaltung: Goscha Nowak
unter Verwendung eines Fotos von akg-images
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-96201-098-0 (epub)
ISBN 978-3-96201-064-5 (print)
Besuchen Sie uns im Internet: www.elsengold.de
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Der Mordfall Martha Franzke
I
Behutsam tastete sie mit beiden Händen ihren dünnen hellblonden Zopf, den sie sich als Kranz um den Kopf gesteckt hatte, nach hervorstehenden Haarnadeln ab. Sie stand vor dem altersblinden Spiegel und betrachtete ihr von feinen, bläulich-roten Äderchen durchzogenes Gesicht wie durch eine Nebelwand. Die Haut war spröde und ausgetrocknet. Unzählige kleine Fältchen hatten sich unter den Augen gebildet. Resigniert schüttelte sie den Kopf. Schon seit Monaten war eine halbwegs erschwingliche Hautcreme nicht einmal mehr unter der Hand zu ergattern. Stattdessen hatte sie für diesen angeblich neuen Puder aus der Schweiz ein Vermögen ausgegeben. Ein Schleichhändler am Schlesischen Bahnhof hatte ihn ihr aufgeschwatzt. Die Maskenbildner der Theater rissen ihm das Produkt kistenweise aus den Händen, weil es alle Unreinheiten zuverlässig kaschiere und gleichzeitig gegen Fältchen wirke, hatte der wortgewandte Schieber ihr versichert. „Wie konnte ich nur darauf hereinfallen?“, fragte sie ihr Spiegelbild. Nicht ein einziges Äderchen vermochte der angebliche Wunderpuder zu verbergen. Vielleicht haben Schauspieler ja auch gar keine roten Äderchen, dachte sie. Sie konnte das nicht beurteilen, denn sie war noch nie im Theater gewesen. Sie zog ihren verschlissenen schwarzen Mantel über und fingerte zögernd an der altmodischen Kurbelverschnürung. Eigentlich hatte sie überhaupt keine Lust, zu dieser Einladung zu gehen. Sie warf einen flüchtigen Blick zu ihrem Hund hinüber. In Erwartung eines Spaziergangs wartete er schon schwanzwedelnd an der Tür.
„Na, Tobi, was meinst du? Sollen wir da wirklich hin?“
Der Hund spitzte die Ohren und begann ungeduldig am Türrahmen zu kratzen.
„Na schön. Vielleicht hast du ja recht. Einfach wegzubleiben wäre unhöflich“, murmelte sie und griff nach ihrer Handtasche. „Dann lass uns gehen.“
Den Hund an der Leine verließ sie die Wohnung, schlug hinter sich die Tür zu, drehte den Schlüssel zweimal im Schloss, ruckelte, um auch sicher zu sein, dass wirklich abgeschlossen war, am Türknauf und stieg die drei Treppen hinunter.
Im zweiten Hof spielten ein paar Mädchen Hopse und im ersten war eine handfeste Rauferei zwischen den Jungs aus dem Vorderhaus und denen aus dem vierten Hof im Gange. Den Hund nahm sie vorsichtshalber auf den Arm.
Gerade wollte sie die schwere Tür zu dem Durchgang aufstoßen, der vom Hof direkt auf die Straße führte, als diese mit Schwung von innen aufflog. Erschrocken wich sie zurück. Der alte Rosinski! Auf diese Begegnung hätte sie jetzt gerne verzichtet. Offenbar hatte er heute schon gute Geschäfte gemacht. Sein Bauchladen, aus dem er Schnürsenkel, Hosenträger, Kragenknöpfe, Nähzeug und Kämme feilbot, war fast leer. Er schob den ledernen Riemen über den Kopf, stellte den Kasten ab und baute sich provozierend vor ihr auf. Alkoholdunst schlug ihr entgegen.
„Lass mich vorbei, ich hab’s eilig“, fauchte sie und versuchte, ihn mit dem Ellenbogen wegzuschieben.
„Aber Marthaken, warum denn so eilig“, Rosinski bleckte seine vom Rauchen bräunlich-gelben Zahnstummel und hielt sie am Arm fest. Sein pockennarbiges Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. „Jehst’e schon wieder mit dein Köter spazieren? Bleib aber nich so lange. Ick will, dass de heute zu mir rüberkommst. Will dir mal wieder ’n bissken uffmuntern.“ Rosinski zog sie dichter an sich heran und kniff ihr in die Wange. Angewidert versuchte sie den Kopf wegzudrehen. Der Hund begann zu knurren. „Haste doch sicher ooch mal wieder nötig, nich? Hab mein’ juten Tach heute. Jibt’n Sonderzuschlag.“
„Geht nicht. Bin eingeladen von n’em richt’jen Kavalier. Kann lange dauern“, gab sie schnippisch zurück und setzte den knurrenden Hund auf den Boden.
Rosinski ließ sie los, stieß ein heiseres Lachen aus und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn.
„Du und ’n Kavalier. Nimm mal die Spinne von ’ne Backe! Wer kiekt dir hässliche Schrippe schon an? Außerdem sind die richt’jen Kavaliere alle anne Front. Du kannst froh sein, dass de mir hast.“
„Lass mich in Ruhe. Ich sage doch, heute geht’s nicht“, zischte sie, warf ihm einen bösen Blick zu und wollte gehen.
Rosinski packte ihren linken Arm und drehte ihn ihr so rabiat auf den Rücken, dass sie vor Schmerz aufschrie. Der Hund knurrte und kläffte abwechselnd mit gesträubtem Nackenfell.
„Pass mal uff, Marthaken. Mach jetzt keene Menkenke. Wenn de nich spätestens in ’ne Stunde oben bist, werd ick rabiat. Du kennst mir. Ick mach dir kalt, wenn de nich parierst. Hast’e mir vastanden?“
„Lass mich sofort los“, schrie sie ihn an, „oder ich brülle das ganze Haus zusa…“
Ein lautes Scheppern irgendwo im Vorderhaus ließ beide zusammenfahren. Spontan lockerte Rosinski seinen Griff. Sie reagierte schnell, zu schnell für ihn, riss sich los, schob sich an ihm vorbei und eilte zur Haustür hinaus.
Schimpfend ging sie die Ackerstraße in Richtung Elsässer Straße hinunter. Wie sie diesen widerwärtigen Rosinski hasste! Sie mochte das nicht. Sie ekelte sich davor. Aber hatte sie eine Wahl? Immerhin zahlte er gut, und sie brauchte das Geld. Meistens gab er ihr zusätzlich noch Lebensmittel mit: Fleisch, Wurst, Schmalz, Butter und hin und wieder sogar ein Huhn oder ein Kaninchen und Knochen für den Hund. Sollte sie auf all das verzichten? Ausgerechnet jetzt, wo es von Tag zu Tag mühseliger wurde, halbwegs bezahlbare Lebensmittel aufzutreiben? Im Nachhinein ärgerte sie sich, dass sie so schnippisch gewesen war. Hatte er nicht von einem Sonderzuschlag gesprochen? Sie hätte darauf eingehen und einen Vorschuss verlangen sollen, mindestens zwanzig Mark. Sie brauchte jetzt jede Mark.
Wenn ihr Plan, den sie so raffiniert ausgetüftelt hatte, geklappt hätte, wäre sie mit einem Schlag alle Sorgen los gewesen. Dann könnte sie Rosinski zum Teufel jagen und endlich ihre Schulden bezahlen. Doch so schnell wollte sie nicht aufgeben. Sie musste ihrer Forderung nur mehr Nachdruck verleihen und klar machen, dass es ihr ernst war. Und genau das gedachte sie noch heute zu tun.
Eigentlich machte sie das alles nur für Lene. Sie wollte, dass es der Lene gut ging. An nichts sollte es ihr fehlen. Wenn das Mädchen doch bloß damit aufhören würde, sich ständig herumzutreiben!
Langsam schlenderte sie die Ackerstraße entlang. Es war ein trüber Tag, und obwohl es recht mild war, ging der böige Ostwind durch und durch. Nun war sie doch froh, dass sie zwei Paar Strümpfe und den dicken Wollrock angezogen hatte. Zu dumm nur, dass sie vergessen hatte, ihren Hut aufzusetzen. Zurückgehen wollte sie deshalb aber nicht.
Als sie die Elsässer Straße erreicht hatte, begann Tobi ungeduldig an der Leine zu zerren. Sie machte ihn los und ließ ihn vorauslaufen. Der Hund kannte den Weg.
Es war Donnerstag, der 16. März 1916, nachmittags gegen Viertel vor zwei.
II
Völlig außer Atem hastete Max Kaminski über den Alexanderplatz dem roten Backsteinbau des Polizeipräsidiums entgegen. Im Laufen zog er seine goldene Repetieruhr, die noch von seinem Großvater stammte, aus der Tasche und ließ den Deckel aufspringen. Fünf vor neun. Er könnte es also noch gerade eben schaffen. Zwar hatte Pünktlichkeit noch nie zu seinen großen Stärken gezählt, aber ausgerechnet heute wollte er auf gar keinen Fall zu spät kommen. Vor der bronzenen Kolossalstatue der Berolina musste er dennoch einen Augenblick innehalten. „Diese verdammten Seitenstiche“, fluchte er leise vor sich hin und presste die Hand auf die schmerzende Stelle. Den ganzen Weg von der Münzstraße war er gelaufen, ja fast gerannt. Nun raste sein Herz und er schnappte nach Luft.
Rein zufällig hatte er in der Stadtbahn ein paar Gesprächsfetzen aufgeschnappt und mitbekommen, dass ein Geschäft in der Münzstraße unter der Hand englische Lavendelseife verkauft. Das Wort Lavendelseife hatte ihn aufhorchen lassen. Der mit dem Rücken zu ihm stehende junge Mann beschrieb seinem Nachbarn den Laden so genau, dass Kaminski sich spontan entschloss, einen kleinen Umweg zu machen und dieses Geschäft sofort aufzusuchen. Seit Beginn des Krieges war englische Seife praktisch nicht mehr zu bekommen, und zudem gingen die ersten Gerüchte um, dass auch Seife bald rationiert werden würde. Echte englische Lavendelseife! Kaminski hatte zwei Stück ergattert. Eines für Lissy, seine Frau, und eines für Ruth, seine Mutter.
Es versprach ein recht schöner, wenn auch ziemlich kühler Frühlingstag zu werden. Kaminski atmete tief durch und ließ seinen Blick über den weiten Platz wandern. Von der Stadtbahn zum Kaufhaus Hermann Tietz zwischen Königsgraben und Alexanderstraße im Norden, weiter zu den geschmacklos verschnörkelten Giebeln des Grand Hotels an der Ecke Neue Königstraße, zur Landsberger Straße, bis zum südlichen Teil der Alexanderstraße mit dem mächtigen roten Backsteinkoloss des Polizeipräsidiums. Wie leer und still die Stadt geworden war. Kaminski vermisste das Gewimmel der Menschenmassen, das Knattern und Hupen der Autos. Private Kraftfahrzeuge waren gleich zu Beginn des Krieges weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. Man hatte sie, ebenso wie einen Teil der Omnibusse, für den „Kriegseinsatz“ beschlagnahmt. Und jetzt hatte die immer prekärer werdende Gummi- und Benzinknappheit den einstmals lebhaften Automobilverkehr völlig zum Erliegen gebracht. Vor dem Krieg fuhr die Elektrische im Halbminutenabstand, spuckte Menschenmassen aus und sog sie wieder ein. Derzeit fuhren nur noch wenige Straßenbahnen, und die waren nicht einmal mehr voll besetzt.
Bevor Kaminski seinen Weg fortsetzte, atmete er noch einmal tief durch. Er fühlte sich wie Sherlock Holmes, als er sich dem Polizeipräsidium näherte, schlug den Mantelkragen seines Ulsters hoch und zog seinen Filzhut tiefer in die Stirn. Aber das hier war mehr als die Baker Street; das hier war so etwas wie Scotland Yard. Hier arbeiteten die besten Kriminalisten des Reiches. Ja, vielleicht die besten Europas. Und er durfte wenigstens vorübergehend einer von ihnen sein.
Die unbezwingbare Leidenschaft für die Kriminalistik hatte von ihm bereits Besitz ergriffen, als er noch ein Schuljunge gewesen war, und nach bestandenem Abitur wollte er unbedingt zur Kriminalpolizei. Doch sein Vater hatte die Ambitionen seines Sohnes als „Spinnerei“ abgetan und sie ihm letztlich ausgeredet. Als Jude werde er niemals höherer Beamter werden, hatte Vater ihn gewarnt, allenfalls den Rang eines Kriminalassistenten könne er erreichen. Ein weiterer Aufstieg bliebe ihm mit Sicherheit verwehrt. Dieser Argumentation vermochte Max Kaminski sich nicht zu entziehen, denn er wusste nur zu gut, dass Vaters Schwager, Theodor Blumenthal, seine Universitätsprofessur niemals erhalten hätte, wenn er sich nicht hätte taufen lassen. Auch er müsste sicher, wollte er die höhere Beamtenlaufbahn einschlagen, konvertieren. Nie und nimmer käme das für ihn infrage. So war der Traum jäh zerronnen, und nach langem Hin und Her entschloss er sich, Jura zu studieren. Eine fatale Fehlentscheidung, wie sich bald herausstellen sollte, und so hängte er die Jurisprudenz nach ein paar Semestern wieder an den Nagel; denn inzwischen hatte er eine neue Leidenschaft entdeckt: das Schreiben. Nun wusste er endlich, was er werden wollte: Reporter bei einer großen Berliner Tageszeitung. Er fand eine Anstellung beim Berliner Abendblatt, wo er inzwischen einer der geschätztesten Lokalreporter war.
Seine stille Leidenschaft für die Kriminalistik hatte ihn indes nie verlassen, und als sie auf einer Redaktionskonferenz darüber berieten, womit man die Leute ein wenig vom Krieg und der immer schlechter werdenden Versorgungslage ablenken könne, und niemand eine wirklich zündende Idee hatte, schlug Kaminski vor, eine große Serie über die Berliner Kriminalpolizei zu bringen. Er könne sich auch vorstellen, ein paar Tage im Polizeipräsidium zu recherchieren, hatte er noch hinzugefügt.
Chefredakteur Scholz war von der Idee so angetan, dass er alle Hebel in Bewegung setzte und bei Oberregierungsrat Hoppe, dem Chef der Kriminalpolizei, vorsprach. Hans Hoppe war einverstanden.
Am Freitag hatte er sich dann persönlich bei Hoppe vorgestellt. Bei einem wunderbaren Bordeaux, einem Chateau Lafite („Ein guter Deutscher liebt den ‚Franzmann‘ nicht, aber seine Weine trinkt er gern“, so der Gastgeber), hatten sie in Hoppes Privaträumen im Polizeipräsidium die Formalitäten besprochen.
Am Montagmorgen solle er sich pünktlich um neun Uhr bei der Mordkommission in Kommissar Gennats Büro melden. Ernst Gennat, im Moment sein bester Mann, sei immerhin schon zwölf Jahre dabei und kenne den Laden in- und auswendig. Zudem sei er geduldig, habe ein sonniges Gemüt und viel Humor. Genau der Richtige für einen Zeitungsmann, meinte Hoppe.
Es war bereits neun Uhr vorbei, als Kaminski das Präsidium durch den Haupteingang An der Stadtbahn 15 betrat. Hoppe hatte ihm den Weg zu Gennats Büro beschrieben, aber jetzt konnte er sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Irritiert stand er in der Halle und schaute sich suchend um: Ausgerechnet heute war der sonst stets anwesende, mit Argusaugen über Kommen und Gehen wachende Pförtner nicht an seinem Platz. Kaminski entschied sich spontan für den linken Gang.
Kaum hatte er die gläserne Flügeltür aufgestoßen und den langen, grau getünchten Korridor betreten, als er von irgendwoher eine aufgeregte Frauenstimme vernahm. Offensichtlich kam die Stimme aus dem zweiten Büro gleich links, aus dem Büro, dessen Tür eine Handbreit offen stand. Kaminski ging näher heran. „Erkennungsdienst – Vermisstendezernat“, las er auf einem Schild neben dem Türrahmen. Er warf einen vorsichtigen Blick in das Büro und erkannte einen großen Raum mit mehreren Tischen, an denen Polizeibeamte in Zivil saßen, geschäftig in Akten blätterten oder irgendetwas notierten. Auf dem Besucherstuhl vor dem zweiten Schreibtisch saß eine dunkelblonde Frau mittleren Alters. Sie hatte einen Hund auf dem Schoß; einen kleinen schwarzen Terrier-Mischling mit weißer Brust, weißen Pfoten und weißer Schwanzspitze. Kaminski kannte sich mit Hunderassen aus. Er mochte Hunde.
„Ihr muss etwas passiert sein“, hörte er die Frau sagen. Sie war außer sich, ihre Stimme überschlug sich fast. „So glauben Sie mir doch endlich. Für kein Geld der Welt hätte sie ihren Hund in irgendeinem Treppenhaus angebunden und einfach zurückgelassen. Tobi ist ihr Ein und Alles. Niemals würde sie ihm so etwas antun.“
„Vielleicht wollte sie einfach nur mal ein paar Tage verreisen und wusste nicht wohin mit dem Tier …“, meinte der Beamte gelangweilt.
„Das habe ich Ihnen doch nun schon lang und breit zu erklären versucht. Dann hätte sie ihn zu mir gebracht. Das hat sie doch sonst auch immer getan.“
„Vielleicht waren Sie gerade nicht zu Hause und …“
„Ach, das ist doch alles Unsinn“, fiel sie ihm ins Wort. „Ich war den ganzen Tag zu Hause.“
„Nun regen Sie sich mal nicht auf, gute Frau. Seit Donnerstag, sagen Sie, ist sie nicht mehr nach Hause gekommen? Also ich bitte Sie, heute haben wir Montag. Da würde ich mir an Ihrer Stelle nicht den Kopf zerbrechen. Diese … Diese – wie war doch noch der Name? – wird schon wieder auftauchen. Wenn Sie mich fragen, hat sie nur mal einen kleinen Wochenendausflug machen wollen – ohne Hund. Warten Sie wenigstens noch bis Mitte der Woche.“
„Das ist unerhört“, protestierte die Frau lautstark, sodass der Beamte zusammenzuckte. „Ich werde mich beim Polizeipräsidenten beschweren. So kann man mich hier nicht abwimmeln. Diese Behandlung lasse ich mir nicht gefallen. Ein Skandal ist das. Man sollte die Presse informieren.“
Max Kaminski trat ein Stück von der Tür zurück. Gespannt wartete er ab, was jetzt da drinnen geschehen würde. Auf jeden Fall wollte er so lange stehen bleiben, bis die Frau das Büro verließ, sie dann abfangen und fragen, was geschehen sei und wen sie vermisst gemeldet habe. Könnte eine interessante Geschichte sein, dachte er. „Vermisst an der Heimatfront“. Eine große Reportage über Verschwundene, ihre Schicksale und das Leiden der Angehörigen. So etwas interessierte die Leser, besonders die zahlreichen Leserinnen. Das steigerte die Auflage.
„Nun beruhigen Sie sich mal, gute Frau. Wir nehmen Ihre Vermisstenanzeige ja auf. Aber ich sage Ihnen, in ein paar Tagen ist Ihre Martha Soundso wieder zu Hause und lacht Sie aus, weil Sie so ein Theater gemacht haben. – Erst einmal brauche ich Ihre Personalien und die Personalien der Vermissten, versteht sich.“
Kaminski trat einen Schritt näher an die offene Tür.
„Name?“
„Mönke.“
„Vorname?“
„Isolde.“
„Wohnhaft?“
„Ackerstraße 35. Erster Hof rechts. Eine Treppe.“
Kaminski tastete seine Tasche nach Papier und Bleistift ab. Immer hatte er Notizzettel, Bleistift und ein Taschenmesser zum Anspitzen dabei. Doch ausgerechnet heute hatte er seine „Notausrüstung“, wie er es nannte, vergessen. Er fluchte still vor sich hin. „Suchen Se wat Bestimmtet? Kann ick Se helfen?“
Erschrocken fuhr Kaminski herum. Ein martialisch aussehender Schutzmann in dunkelblauem Waffenrock mit Krummsäbel, Revolver und dem obligatorischen dicken Notizbuch, das den Mantel zwischen den beiden obersten Knöpfen ausbeulte, hatte sich drohend hinter ihm aufgebaut. Kaminski blickte in ein rotes Ballongesicht mit kleinen runden Schweineäuglein und hochgezwirbeltem Kaiser-Wilhelm-Bart.
„Ich suche das Büro von Kommissar Gennat“, stammelte Kaminski verlegen.
„Da sind Se hier vakehrt. Der Gennat sitzt uff die andere Seite. Steht doch ooch dran. Komm’ Se, ick zeig’s Ihnen.“
Kaminski folgte ihm wortlos.
„Da drüben, da müssen Se rin. Da sitzt der Kommissar Gennat in Zimmer 48“, erklärte der Schutzmann, indem er mit der einen Hand die Flügeltür aufhielt und mit der anderen auf den gegenüberliegenden Gang wies.
Kaminski bedankte sich mit einem gequälten Lächeln.
Wieder in der Halle, verwünschte er den hilfsbereiten Beamten. Unmöglich konnte er noch einmal zurückgehen; nun würde er keine Gelegenheit mehr haben, die Frau mit dem Hund abzufangen. Bedauerlicherweise hatte er auch ihren Namen wieder vergessen. Nur an die Ackerstraße konnte er sich erinnern. Aber welche Hausnummer?
Noch immer verärgert, steuerte Kaminski die gegenüberliegende Glastür an. Mordkommission stand da in großen Lettern. Er trat in den Korridor und suchte nach Zimmer 48.
Es war Viertel nach neun.
Nummer 45 … 46 … 47 … Die Nummer 48 war mit einem kleinen Pfeil und dem Hinweisschild versehen: „Bitte an der nächsten Tür klopfen“.
Kaminski klopfte an der nächsten Tür. Als sich nichts rührte, drückte er vorsichtig die Klinke herunter und öffnete sie einen Spalt. Wie von einer Keule getroffen, prallte er zurück. Er glaubte, eine verruchte Kaschemme in der Mulackstraße zu betreten, aber nicht das Vorzimmer der Mordkommission. Dichte Schwaden graublauen Tabakqualms schlugen ihm entgegen.
An einem rechteckigen Tisch, auf dem fünf Kaffeetassen und ein großer, bis zum Rand gefüllter Zinnaschenbecher standen, saßen fünf Zigarre rauchende Männer. Offenbar war er mitten in eine Besprechung geplatzt.
„Guten Tag, die Herren, Kaminski ist mein Name“, stellte er sich vor und trat unaufgefordert ein. „Max Kaminski. Oberregierungsrat Hoppe schickt mich. Ich soll mich bei Kommissar Gennat melden.“ Er sah sich kurz um: ein großer Schreibtisch, auf dem, neben Aktenordnern und diversen Stapeln von Papieren, zugedeckt mit einem grünen Filzüberzug, eine Schreibmaschine stand. Aktenschränke, ein Tischchen mit Kaffeegeschirr und ein paar Grünpflanzen. Vor den Fenstern vergilbte Stores und dunkelgrüne Übergardinen aus einem billigen Baumwollstoff. Normalerweise war dieses Zimmer wohl die Domäne einer Sekretärin, konstatierte Kaminski überrascht, denn seit Jahren kursierte das Gerücht, nach dem die Kriminalpolizei ihre Berichte noch immer mit der Hand schrieb. Die weit offen stehende, von Aktenschränken eingerahmte Tür rechts führte offenbar in Ernst Gennats Büro.
Die fünf Männer musterten ihn mit unverhohlenem Misstrauen. Einer von ihnen stand auf und streckte Kaminski mit herablassendem Lächeln die Hand entgegen. „Willkommen im Club, Kaminski. Gestatten, von Findeisen, Kriminalkommissar von Findeisen.“ Von Findeisen verneigte sich mit süßsaurer Miene. „Und Sie sind also dieser Reporter, den Oberregierungsrat Hoppe uns angedroh… äh, angekündigt hat. Unsere Sekretärin, Fräulein Laubach, haben wir heute leider mal wieder einer anderen Abteilung ausleihen müssen. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich Ihnen meine Kollegen vorstelle.“
Mit der Hand von einem zum anderen weisend, begann er: „Die Kommissare von Beckmann, Liebermann von Sonnenberg – Liebermann reicht –, von Bähr, von Manteuffel.“
Die Namen kannte Kaminski aus den Polizeiberichten seiner Zeitung. Er schüttelte jedem die Hand.
„Der Mann von der Zeitung ist jetzt da“, rief Findeisen in Richtung Tür.
„Soll reinkommen“, dröhnte eine Stimme aus dem angrenzenden Raum.
Kaminski trat ins Nebenzimmer. Kommissar Ernst Gennat, ein großer, selbst in Kriegszeiten wohlbeleibter Mann, trat hinter seinem klobigen Schreibtisch hervor, kam mit ausgebreiteten Armen auf Kaminski zu und streckte ihm beide Hände entgegen. Sein fleischiger Kopf saß kurzhalsig auf seinem unförmigen Körper. Auf Äußerlichkeiten legte Gennat offenbar keinen großen Wert. Sein Anzug war abgetragen, an Kragen und Ärmeln abgewetzt, das graue Hemd hätte mal wieder eine Wäsche vertragen können, die Hosen waren ausgebeult, und seine Schuhe sehnten sich nach einem Schuhputzer.
„Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt!“, nuschelte Gennat grinsend, ohne seine Virginia aus dem Mundwinkel zu nehmen, drückte Kaminski so fest die Hand, dass dieser vor Schmerz am liebsten aufgeschrien hätte. Gennat grinste und schloss die Tür.
„Gestatten, Gennat mein Name. Legen Sie ab und setzen Sie sich. Oberregierungsrat Hoppe hat mir vor ein paar Tagen schon von diesem eigenartigen Kuhhandel erzählt.“
Er nahm Kaminski Hut und Mantel ab und warf beides über einen Kleiderständer.
„Kuhhandel?“ Kaminski massierte seine schmerzende Hand und nahm auf dem ihm angewiesenen Besucherstuhl neben Gennats Schreibtisch Platz.
„Na, wir lassen Sie hier mal ein Weilchen reinschnuppern und Sie schreiben dafür dann nette Sachen über uns.“ Verschämt wickelte Gennat die Klappstullen, die auf seinem Schreibtisch lagen, wieder in das Butterbrotpapier und ließ sie in einer Schublade verschwinden. Dem strengen Geruch nach zu urteilen waren sie mit Harzer Käse belegt.
Gennat setzte sich hinter seinen Schreibtisch, legte die Zigarre in den Aschenbecher, lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und musterte sein Gegenüber schmunzelnd. Offenbar amüsierte er sich über Kaminskis Anzug mit passender Weste aus teurem englischen Tweed, dem blütenweißen Hemd und der dezent gemusterten Krawatte.
Kaminski lächelte verlegen. So war sein Praktikum bei der Kriminalpolizei eigentlich nicht gedacht, und er war sich auch ziemlich sicher, dass Chefredakteur Scholz eine solche Zusage niemals gemacht hatte. Gennat war in der Tat ein Mann mit Humor.
„Nun erzählen Sie erst mal, was Sie bei uns wollen und warum Sie nicht im Felde sind, um unser schönes Vaterland zu verteidigen.“ Gennat zeigte ein breites Lächeln, bei dem ein Goldzahn aufblitzte.
„Zu Frage eins“, begann Kaminski, „um die Arbeit der Kriminalpolizei aus nächster Nähe kennenzulernen. Zu Frage zwei, weil ich einen Herzfehler habe. Es schlägt schneller, als es soll. Nervöses Herz nennen die Ärzte das. Unter diesen Umständen wollten die Herren mir das Wohl und Wehe des Vaterlandes dann lieber doch nicht anvertrauen. Untauglich für den Frontdienst.“
„Nervöses Herz“, wiederholte Gennat. Er schwieg eine Weile, schien über etwas nachzudenken und fügte dann hinzu: „Ob Sie damit bei uns richtig sind?“
Kaminski zuckte mit den Schultern. „Ich werd’s schon irgendwie hinkriegen.“
Gennat stützte das Kinn in die Hand und grinste ihn an. „Wenn wir mal wieder eine Wasserleiche aus dem Landwehrkanal fischen, müssen Sie ja nicht unbedingt hingucken. Dann drehen Sie sich halt mal kurz um.“
„Ich werde Sie also tatsächlich an Tatorte begleiten und bei Verhören zugegen sein dürfen?“
„Oberregierungsrat Hoppe hat mich gebeten, Sie wie einen Kollegen zu behandeln“, gab Gennat zurück. „Wenn Sie sich auch wie ein Kollege benehmen, wird es keine Probleme geben.“
„Ich werde bestimmt keine Probleme machen“, versicherte Kaminski.
„Na, dann auf gute Zusammenarbeit.“ Gennat reichte ihm seine Pranke über den Schreibtisch hinweg. Kaminski schlug ein und versuchte, diesmal ebenfalls fest zuzudrücken, was ihm, wie Gennats verblüffter Blick verriet, offenbar auch gelang.
Der Kommissar griff nach seiner Zigarre, nahm einen tiefen Zug und blies blaue Ringe in die Luft. Erst jetzt fielen Kaminski Gennats ungepflegte Hände auf, die vom Nikotin gelben Finger mit den abgeknabberten, schmutzigen Nägeln.
„Damit Sie im Nachhinein nicht allzu enttäuscht sind“, begann Gennat, „halte ich es für besser, Ihnen gleich alle Illusionen zu nehmen. Die meisten Leute machen sich ein völlig falsches Bild von der Arbeit der Kriminalpolizei. Hoffentlich erwarten Sie nicht, dass Sie mit uns den lieben langen Tag nichts anderes tun werden, als gefährliche Gangster quer durch die Stadt zu jagen. Unser tägliches Brot sind ganz banale Angelegenheiten. Familiendramen der niedersten Sorte, hervorgerufen durch Armut und Trunkenheit, Eifersucht oder Habgier. Wir nennen uns zwar Mordkommission, ermitteln aber in jeder Art von Kapitalverbrechen, also auch in Fällen von schwerem Raub. Hinzu kommen die täglichen Selbstmorde und der eine oder andere tödliche Unfall. Sicher brauche ich Ihnen nicht näher zu erläutern, dass wir nicht erst bei augenscheinlichem Mord, sondern immer dann, wenn der Tod auf nicht natürliche Weise eingetreten sein könnte, eine Untersuchung einleiten müssen.“
Kaminski nickte.
„Lästige und zudem gänzlich uninteressante Routineangelegenheiten“, fuhr Gennat seufzend fort. „Die meisten Morde werden im Übrigen innerhalb des Familienkreises verübt. So etwas ist in der Regel ziemlich unspektakulär. Oft wird der Täter noch am Tatort festgenommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das Ihren Lesern gefallen wird. Aufregende Verbrecherjagden gibt es allenfalls im Detektivroman.“
Kaminski schwieg und hörte sich Gennats Ausführungen geduldig an. Natürlich wusste er das alles, schließlich kannte er die Polizeiberichte seiner Zeitung. Und nur allzu oft berichteten sie von eben solchen Familiendramen.
„Die meiste Zeit verbringen wir am Schreibtisch mit endlosen Protokollierungen von Nichtigkeiten und nervtötendem Papierkrieg“, beendete Gennat seine Ausführungen.
„Ab wann darf ich Ihnen beim Papierkrieg Gesellschaft leisten?“, fragte Kaminski.
Der Kommissar zuckte mit den Schultern. „Von mir aus kann’s gleich losgehen. Oberregierungsrat Hoppe wird Sie erst einmal im Haus herumführen, damit Sie wenigstens halbwegs Bescheid wissen, wo was ist, und sich in diesem Labyrinth nicht verirren.“ Er lehnte sich zurück und zog noch einmal genüsslich an seiner Zigarre. „Gibt es irgendeine Abteilung hier im Haus, die Sie, neben der Mordkommission, ganz besonders interessiert?“, fragte er nach einer kurzen Pause.
Die Abteilung VII, die Politische Polizei, deren Dezernat für Presseangelegenheiten die Arbeit der Zeitungsleute seit Kriegsbeginn empfindlich behindert, dachte Kaminski, behielt es aber für sich. „Das Vermisstendezernat“, sagte er stattdessen.
Gennat runzelte die Stirn. „Warum ausgerechnet das?“
Zögernd erzählte Kaminski von dem Gespräch, das er zufällig mit angehört hatte, von der Frau mit dem Hund, der offenbar einer Vermissten gehörte, und von ihrer Empörung über die Ignoranz des Beamten.
Gennat starrte auf seine Zigarre und schüttelte fast unmerklich den Kopf. „Sie müssen in der Tat noch viel lernen, Kaminski. In diesem Falle muss ich meine Kollegen in Schutz nehmen. Die überwiegende Mehrzahl der angeblich Verschwundenen, die man schon erwürgt, ertränkt, ermordet und zerstückelt geglaubt hat, taucht nach einer gewissen Zeit völlig unversehrt wieder auf. Sie haben einfach vergessen, eine Nachricht zu hinterlassen, oder wollten nur mal ihre Ruhe haben. Und die Angehörigen, denen es am liebsten gewesen wäre, wir hätten unverzüglich eine Großfahndung eingeleitet, halten es dann nicht einmal für nötig, uns zu benachrichtigen, dass sich die Vermissten wieder eingefunden haben. Zur Rede gestellt, behaupten sie, es schlicht und einfach vergessen zu haben. Nee, nee, mein Lieber, die Fahndung nach Vermissten ist ein undankbares Geschäft, noch dazu, wenn es sich um erwachsene Menschen handelt, die nicht dazu verpflichtet sind zu sagen, wo sie hingehen oder was sie vorhaben. – Aber glauben Sie mir, ich habe da meine Erfahrung. Oft ist diese Art von Kundschaft nur hysterisch oder geltungssüchtig. Vergessen Sie die Frau mit dem Hund einfach ganz schnell wieder. Vergeudete Zeit.“
Zum Zeichen, dass er das Gespräch für beendet hielt, ließ Gennat beide Handflächen schwer auf die Schreibtischplatte fallen und stemmte sich hoch.
„Wenn Hoppe Ihnen alles gezeigt hat, kommen Sie wieder her. Vielleicht haben wir dann schon den ersten spektakulären Mordfall, den wir mit Ihrer Hilfe lösen können.“
III
Auf dem Weg in Hoppes Büro geriet Max Kaminski für einen Augenblick ins Grübeln. Hatte er wirklich die richtige Entscheidung getroffen? War es richtig gewesen, dieses Experiment zu starten? Der Empfang, den ihm Gennats Kollegen bereitet hatten, war nicht eben herzlich ausgefallen. Oder war er einfach nur zu empfindlich? Wie ein lästiger Eindringling war er sich vorgekommen. Doch wenn er es nüchtern betrachtete: War er das nicht auch? Schließlich war er Reporter und kein Polizist. Unmöglich konnte er erwarten, dass sie ihn mit offenen Armen empfingen. Zum Glück schien dieser Gennat aber ein durchaus umgänglicher Mensch zu sein. Und Hoppe hatte ihm ja ausdrücklich ans Herz gelegt, er möge sich an Kommissar Gennat halten. Sollten ihm diese adligen Schnösel doch gestohlen bleiben. Außerdem stand es ihm ja frei, das Experiment jederzeit abzubrechen und reumütig in die Redaktion zurückzukehren. Doch diesen Triumph würde er seinen Kollegen gewiss nicht gönnen.
Hoppe führte Kaminski durch die verschiedenen Abteilungen des Polizeipräsidiums, wobei er die Abteilung VII wohl absichtlich ausließ. Kaminski interessierte sich besonders für die Verbrecherkartei, die in eben jenem Büro im Erdgeschoss untergebracht war, wo die Frau mit dem Hund am Morgen die Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. In dem saalähnlichen Raum standen mehrere Schreibtische, über denen jeweils eine weiße Kugellampe baumelte. An jedem Tisch saß ein Beamter, blätterte geschäftig in einer Akte oder schrieb etwas in ein dickes Buch. Keiner der Männer mochte jünger als sechzig Jahre sein, konstatierte Kaminski und vermutete, dass es sich hier um ausgemusterte Kriminalbeamte handelte, die die jungen, an der Front stehenden Kollegen ersetzten. Kaminski ließ seinen Blick durch den Raum wandern. Den Beamten, der die Anzeige der Frau aufgenommen hatte, konnte er nicht entdecken.
Hinter der Reihe von Schreibtischen füllten bis an die Decke reichende Aktenschränke die ganze Breite der Wand aus. Die berühmte Verbrecherkartei! Der Stolz der Berliner Kriminalpolizei. Steckbriefe und Fotos Tausender verurteilter Verbrecher: Gewalttäter aller Art, Räuber, Erpresser, Hochstapler, Heiratsschwindler, Totschläger und Mörder. Hans Hoppe zog einen der Folianten heraus.
„Diese Kartei ist für uns Gold wert“, begann er zu dozieren. „Sie ermöglicht uns jährlich mehrere Hundert Entdeckungen. Zu verdanken haben wir die einzigartige Sammlung dem früheren Chef der Kriminalpolizei Meerscheidt-Hüllessem. Aus freien Stücken hatte er 1876 damit begonnen, Fotografien von Verbrechern aller Art zu sammeln und zu katalogisieren. Später hat er diese Privatsammlung dann dem Polizeipräsidium überlassen. Inzwischen ist sie durch eine alphabetische Zusammenstellung der Spitznamen von Verbrechern ergänzt worden, und genaue Messungen von Kopf- und Körpermaßen haben wir natürlich auch längst eingeführt. Zuletzt ist noch eine daktyloskopische Kartei hinzugekommen, in der wir bereits Tausende von Fingerabdrücken registriert haben.“
Kaminski wusste das alles längst, doch um nicht unhöflich zu erscheinen, gab er sich interessiert.
Zu guter Letzt besuchten sie das Polizeigefängnis, das immerhin Platz für 328 Männer und 94 Frauen bot und in dem Teil des Gebäudes untergebracht war, der an der Alexanderstraße lag. Kaminski verschwieg lieber, dass er mit dem Polizeigefängnis bereits nähere Bekanntschaft gemacht hatte: Am 1. Dezember vergangenen Jahres hatte Lissy an der großen Frauendemonstration Unter den Linden teilgenommen. Dabei war es zu Rangeleien mit den Schutzleuten gekommen, und Lissy, die sich ein heftiges Wortgefecht mit einem Beamten geliefert hatte, gehörte zu den achtundfünfzig Frauen, die seinerzeit verhaftet worden waren. Der Vorwurf: Aufwiegelung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Unverzüglich begab sich Kaminski mit Onkel Salomon, dem jüngeren Bruder seines Vaters, der gerade erst eine Anwaltskanzlei am Kurfürstendamm eröffnet hatte und bisher vergeblich auf zahlungskräftige Klienten aus den höchsten Kreisen der Gesellschaft wartete, ins Polizeigefängnis. Dank Onkel Salomons Verhandlungsgeschick und Redegewandtheit konnten sie Lissy gleich wieder mitnehmen. Es war Salomon Kaminskis erster großer Erfolg als Anwalt. Inzwischen war er so bekannt geworden, dass er seine Kanzlei vergrößern musste.
Gegen Mittag ging Kaminski zurück in Ernst Gennats Büro, um seinen Hut und seinen Mantel zu holen. Das Vorzimmer war jetzt verwaist. Offenbar hatte inzwischen auch endlich jemand gelüftet. Kommissar Gennat, der ihn anscheinend nicht hatte hereinkommen hören, saß hinter seinem Schreibtisch wie eine brütende Henne und studierte irgendein Schriftstück. Um auf sich aufmerksam zu machen, klopfte Kaminski an den Türrahmen.
„Ich wollte nur meine Sachen holen“, sagte er leise.
„Ach, Kaminski, da sind Sie ja endlich.“ Gennat schob die Akte weg, stemmte sich an seinem Schreibtisch hoch, ging zu dem mit grünem Plüsch bezogenen Sofa hinüber und bedeutete Kaminski mit einer Handbewegung, sich auf das Sofa oder in einen der beiden Sessel zu setzen. Kaminski entschied sich für einen Sessel. Erst jetzt bemerkte er, dass auf dem Couchtisch mit der Klöppeldecke eine Kaffeekanne und zwei Tassen standen.
„Ich habe extra Kaffee bringen lassen“, sagte Gennat und befühlte die Kanne, um zu prüfen, ob der Kaffee noch heiß genug war. „Ich hoffe, Sie haben noch ein wenig Zeit. Ich wollte Ihnen nämlich erläutern, woran wir uns derzeit gerade die Zähne ausbeißen. Kaffee?“ Kaminski nickte.
Gennat schenkte ein und schüttete sich selbst zwei gehäufte Teelöffel Zucker in die Tasse.
„Auch Zucker?“
Kaminski verneinte.
„Seit einigen Wochen sind wir nach Kräften bemüht, einen internationalen Mädchenhändlerring auffliegen zu lassen“, begann Gennat, während er seinen Kaffee umrührte. „Leider sitzen die Köpfe der Bande im Ausland, vornehmlich in Südamerika, was uns die Arbeit nicht eben erleichtert. Es wäre schön, wenn Sie darüber mal etwas schreiben würden. Dieses Thema findet in der Öffentlichkeit nach meinem Dafürhalten viel zu wenig Beachtung. Wären die jungen Mädchen nämlich über die Tricks und Machenschaften dieser Leute besser informiert, würden sicher auch weitaus weniger in die Fänge dieser völlig skrupellosen Verbrecher geraten. Erschwerend kommt darüber hinaus noch hinzu, dass wir zurzeit auf unseren Experten in Sachen Mädchenhandel nicht zurückgreifen können. Der Kollege von Tresckow, den Sie ja sicher kennen, steht uns leider nicht zur Verfügung.“
„Hans von Tresckow kann doch unmöglich schon pensioniert sein“, warf Kaminski überrascht ein. Tresckow schrieb seit Jahren, unter Pseudonym freilich, sogenannte Skizzen aus der Verbrecherwelt und publizierte sie in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. Auch das Berliner Abendblatt hatte schon einige davon gedruckt.
Gennat winkte ab. „Viel schlimmer. Dieser Unglücksmensch hat sich unmittelbar nach Anordnung der Mobilmachung freiwillig gemeldet, und man hat ihn, obwohl er nicht mehr der Jüngste ist, tatsächlich noch ins Feld geschickt. Jetzt ist er Kompanieführer in irgendeinem Jägerbataillon in Frankreich.“
Gennat nahm einen Schluck Kaffee, stellte seine Kaffeetasse langsam zurück auf die Untertasse, lehnte sich zurück und schaute Kaminski schmunzelnd an: „Der Name Kaminski kommt ja nun nicht gerade selten vor, aber sind Sie zufällig mit dem Rechtsanwalt Salomon Kaminski verwandt?“
„Ja, das ist mein Onkel. Salomon ist der jüngere Bruder meines Vaters.“
„Na das is ja ’n Ding. Hab schon ewig nichts mehr von dem alten Gauner gehört.“
„Sie kennen meinen Onkel?“
„Aber ja. Wir haben zusammen Jura studiert. Ich hab dann kurz vor dem Examen die Fliege gemacht und bin zur Kriminalpolizei. Diese trockene Paragrafenreiterei war auf die Dauer nichts für mich. Ich bin mehr ein Mann der Praxis. Salomon hat mich seinerzeit für völlig verrückt gehalten. – Für mich war das damals aber genau die richtige Entscheidung.“
„Salomon hat nie etwas von seiner Studienzeit erzählt. Waren Sie eng befreundet?“
„Wir waren die dicksten Freunde. – Wenn er mir allerdings gerade mal wieder ein Mädchen ausgespannt hatte, war unsere Freundschaft weniger dick.“
Kaminski lachte. „In der Hinsicht hat er sich nicht geändert. Ein Schürzenjäger ist er noch immer.“
„Ich wusste, dass Salomon zwei ältere Brüder hat. Damals habe ich allerdings nur Jakob mehr oder weniger flüchtig kennengelernt. Er stand kurz vor seinem Examen in Medizin. – Hoppe hat mir erzählt, dass Ihr Vater Arzt ist. Demnach ist Jakob also Ihr Vater?“
„Falsch kombiniert, Herr Kommissar!“, scherzte Kaminski und lachte. „Onkel Jakob ist der ältere Bruder meines Vaters und praktiziert in der Linienstraße. Mein Vater, das ist Georg Kaminski. Er ist zwar auch Arzt, hat seine Praxis allerdings auf dem Kurfürstendamm.“
Gennat schüttelte den Kopf und sagte mit ehrlichem Erstaunen: „Es ist unglaublich. Wenn ich Sie so ansehe, mag ich es kaum glauben, dass Sie mit Salomon verwandt sind.“
Kaminski lachte wieder. „Sie meinen, wegen meiner blonden Haare? Die haben mir damals in der Schule schon Schwierigkeiten gemacht.“
„Inwiefern Schwierigkeiten?“, wollte Gennat wissen.
„Der Religionsunterricht wurde bei uns, ich habe nämlich keine jüdische Schule besucht, getrennt nach Konfessionen erteilt. Wegen meiner blonden Haare wollte man mich unbedingt zum protestantischen Unterricht schicken. Mein Vater musste sich persönlich zum Direktor begeben, um das Missverständnis aufzuklären.“
„Ihre Mutter dürfe demnach blond sein.“
„Nein, meine Mutter entstammt einer galizischen Familie. Sie hat ganz wunderbare kastanienbraune Haare. Aber einer meiner Vorfahren väterlicherseits war mit einer Dänin verheiratet. Durch mich ist die Familie Kaminski wieder an ihre nordischen Verwandten erinnert worden. In Kopenhagen soll tatsächlich eine entfernte Cousine soundsovielten Grades von mir leben.“
„Wie alt sind Sie eigentlich?“
„Achtundzwanzig.“
„Erzählen Sie mehr von sich. Wo kommen Sie her, wie leben Sie? Auch wenn es nur für vorübergehend ist, mache ich mir immer gerne ein Bild von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.“
Gennats verbindliche Art machte es Kaminski leicht, Persönliches preiszugeben.
„Eigentlich gibt es da nicht viel zu erzählen“, begann Kaminski etwas zögerlich, denn er machte nicht gern viel Aufhebens von sich. „Die Familie meines Vaters kam vor rund fünfzig Jahren aus Breslau nach Berlin. Einer der Brüder meines Großvaters hatte in Berlin, in der Leipziger Straße, ein Trikotagengeschäft. Als er sich vergrößern wollte, bot er meinem Großvater, der in der gleichen Branche als Vertreter tätig war, die Teilhaberschaft an. Großvater akzeptierte und siedelte mit seiner Frau und den drei kleinen Söhnen nach Berlin über. Nach dem Tod seines Bruders übernahm Großvater dann das Geschäft als alleiniger Inhaber. Zu seinem großen Kummer verspürte allerdings keiner seiner Söhne Ambitionen, das Geschäft eines Tages zu übernehmen. Zwei Söhne studierten Medizin, der jüngste Jura.“
„Und was ist aus dem Geschäft geworden?“, fragte Gennat.
„Großvater hat es an einen gewissen Ignaz Blumenthal verkauft, den Vater meiner Mutter. Meine Eltern haben sich aber rein zufällig in der Charité kennengelernt. Meine Mutter war bös mit ihrem Pferd gestürzt und hatte sich das Bein gebrochen. Mein Vater, damals Assistenzarzt, hatte das Bein wieder in Ordnung gebracht. Die beiden kamen sich wohl ziemlich schnell näher, denn meine Mutter interessierte sich seit jeher für Medizin und unterstützte als Vorsitzende einer Hilfsorganisation die Schaffung einer geregelten Ausbildung für Krankenschwestern. Auf einer Englandreise hatte sie Florence Nightingale persönlich kennengelernt. Sie war von deren Pflegetheorie begeistert und wollte eine Art Pflegeschule in Berlin ins Leben rufen. Damit lief sie bei meinem Vater offene Türen ein. Stundenlang sollen die beiden an Ruths Krankenbett über dieses Thema diskutiert haben. Mutter war schon längst verheiratet, als sie sich dann selbst zur Krankenschwester ausbilden ließ. Jetzt hilft sie meinem Vater in der Praxis.“
Gennat nickte. „Ich sehe einen Ehering an Ihrem Finger. Sind Sie schon lange verheiratet?“
„Im Juli werden es zwei Jahre. Wir haben auch einen kleinen Sohn.“
„Demnach muss er ja noch ein Säugling sein.“
„Im Juli wird er zwei Jahre alt.“
Gennat runzelte die Stirn. „Ich denke, Sie haben im Juli vor zwei Jahren erst geheiratet.“
Kaminski grinste. „Wir hatten es gerade geschafft, die Zeremonie hinter uns zu bringen, als unser Sohn geboren wurde. Niemand kann uns also vorwerfen, er sei unehelich auf die Welt gekommen.“ Gennat lachte herzlich.
Es war noch nicht einmal ein Uhr, als Kaminski Gennats Büro verließ. Zielstrebig steuerte er das Vermisstendezernat beim Erkennungsdienst an. Die Tür stand noch immer halb offen, und Kaminski atmete auf, als er sah, dass der Beamte von heute Morgen jetzt wieder hinter seinem Schreibtisch saß und in irgendwelchen Akten blätterte. Kaminski klopfte an die offene Tür, trat ein und steuerte auf den Beamten zu.
„Entschuldigen Sie“, begann er mit gespielter Verlegenheit. „Mir ist da ein Missgeschick passiert. Heute Vormittag war eine Frau mit einem Hund, einem Terrier-Mischling, bei Kommissar Gennat. Unmittelbar davor hatte sie wohl bei Ihnen eine Verwandte als vermisst gemeldet. Nun will der Kommissar noch einmal zu ihr hin. Doch dummerweise hatte ich die Personalien nur auf einen Zettel geschrieben. Der ist mir dummerweise aber abhandengekommen. Der Kommissar ist ziemlich sauer auf mich. Ob Sie mir da vielleicht weiterhelfen könnten?“
Ohne Kaminski anzuschauen, stand der Beamte auf und sah den Aktenstapel durch.
„Den Gennat hat diese Nervensäge also auch vollgequatscht?“, brummte er kopfschüttelnd. „Dass der sich überhaupt auf so was einlässt –“ Er nahm einen der Aktendeckel und schlug ihn auf.
„Sie haben Glück. Erst wollte ich die Sache ja gar nicht aufnehmen. Aber diese Frau hat so ein Gewese gemacht – Hat sogar gedroht, zum Polizeipräsidenten zu gehen. – Völlig hysterisch – den Weibern fehlen halt die Männer. – Hier ist die Anzeige.“
Kaminski hielt schon Notizblock und Bleistift bereit. Beides hatte er in einem günstigen Augenblick von Gennats Schreibtisch „ausgeliehen“. – Kaminski wollte es nicht „klauen“, allenfalls „stibitzen“ nennen.
Der Beamte rückte seinen Kneifer zurecht.
„Die Frau heißt Isolde Mönke. Wohnhaft Ackerstraße 35. Erster Hof rechts, eine Treppe.“
Zufrieden steckte Kaminski den Notizblock wieder ein. „Vielen Dank noch mal. Auch im Namen von Kommissar Gennat.“
Eilig verließ er das Polizeipräsidium. Die Ackerstraße war zwar etwas weiter als einen Katzensprung vom Alexanderplatz entfernt, aber durchaus zu Fuß zu erreichen. Er wollte keine Zeit vergeuden, sondern sich gleich auf den Weg machen. Vielleicht bot diese Sache tatsächlich Stoff für eine Reportage.
Doch zunächst musste er etwas essen. Ihm war schwindlig vor Hunger und der kalte Schweiß brach ihm aus. Das passierte ihm öfter, wenn er zu wenig gegessen hatte, und er beschloss, schnell zu Aschinger zu gehen, wo es Löffelerbsen ohne Spitzbein gab. Im Oktober vergangenen Jahres waren in den Restaurants „fleischlose Tage“ eingeführt worden. Demnach durfte montags und donnerstags überhaupt kein Fleisch und sonnabends kein Schweinefleisch angeboten werden. Und heute war Montag.
Die Erinnerungen an seine Kindheit waren nur mit wenigen Bildern verknüpft, doch eines dieser Bilder hatte er jetzt deutlich vor sich. Wie so oft war er mit seinem Vater bei Aschinger gewesen und hatte sein Lieblingsessen bekommen: Wiener Schnitzel mit Beilage. Es war das teuerste Gericht und kostete fünfundsiebzig Pfennig. Vater hatte immer eingelegten Hering genommen, der, wenn er sich recht erinnerte, fünfunddreißig Pfennig kostete, und ein kleines Helles für einen Groschen. Die Schrippen waren umsonst – so viel man wollte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: