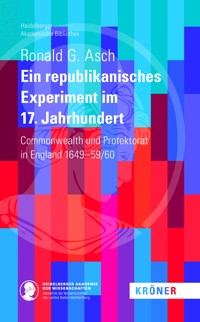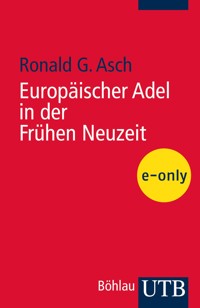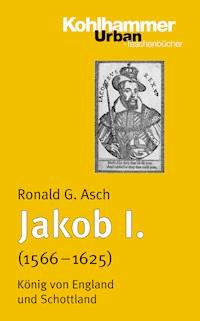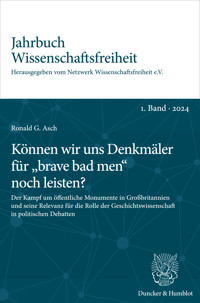
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Beitrag setzt sich mit der Forderung nach Denkmalstürzen in Großbritannien auseinander. Die Argumente gegen ältere Monumente,sind oft ähnlich zugeschnitten wie diejenigen, die gegen vermeintlich intolerable Ansichten im universitären Milieu vorgebracht werden. Es wird behauptet, Angehörige ethnischer oder anderer Minderheiten könnten sich durch ein Monument verletzt fühlen. Daher müsse man diese Monumente beseitigen. Zudem herrscht in beiden Debatten eine Einstellung vor, die davon ausgeht, dass schon ein einziges „böses“ Symbol die Welt, in der wir leben, negativ prägen könne. Eine solche Betrachtung neigt dazu, die Wirkung von Denkmälern vergangener Epochen stark zu überschätzen und will nicht wahrhaben, dass Monumente oft schon zum Zeitpunkt ihrer Errichtung vieldeutig waren. Diese Ambiguität von Heroisierungsprozessen und ihrer bildlichen Ausgestaltung durch Statuen im öffentlichen Raum wird in dem Beitrag an einer konkreten historischen Figur, an Oliver Cromwell, dem Feldherren, „Königsmörder“ und Lord Protector, demonstriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[37]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 37 – 61https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1431101
Können wir uns Denkmäler für „brave bad men“ noch leisten?
Der Kampf um öffentliche Monumente in Großbritannien und seine Relevanz für die Rolle der Geschichtswissenschaft in politischen Debatten
Von Ronald G. Asch*
I.
Im März 2022, also etwa vor einem Jahr fällte das Konsistorialgericht der Diözese Ely der Church of England ein Urteil in einem Streit, in dem es um die Auseinandersetzung mit Englands kolonialer Vergangenheit ging.1 In der Kapelle des Jesus College in Cambridge befindet sich eine Gedenktafel für einen Kaufmann des späten 17. Jahrhunderts, Tobias Rustat. Das College verdankt Rustat erhebliche Geldzuwendungen und einen Teil seines heutigen Vermögens. Allerdings war Rustat Anteilseigner der Royal African Company und anderer Gesellschaften, die mit Sklaven handelten, ein Geschäft, in dem englische Reeder und Kaufleute im späten 17. Jahrhundert eine zunehmend wichtige Rolle spielten, bis sie es nach dem Frieden von Utrecht (1712/13) weithin dominierten.2
Rustat nahm zwar in der Royal African Company keine prominente Position ein und hatte auch nur einen kleinen Teil seines Vermögens auf diese Weise investiert, aber immerhin gehörte er zeitweilig zum Court of Assistants (Aufsichtsrat) der Gesellschaft, war also mehr als ein beliebiger Aktionär unter vielen.3 Rustat ist in der Kapelle des College begraben und eine [38] Gedenktafel erinnert dort an ihn. Sie ist an der Westwand der Kapelle angebracht und ist eigentlich nicht übermäßig auffällig, wenn man sie etwa mit vollplastischen Grabmälern in Lebensgröße vergleicht. Im Zuge der allgemeinen Debatte über die Dekolonisierung des englischen Geschichtsbildes und über eine Auseinandersetzung mit den weniger erfreulichen Seiten der englischen kolonialen Expansion, setzte sich in der Leitung des College jedoch der Wunsch durch, diese Gedenktafel zu beseitigen. Es war einem offenbar peinlich, an prominenter Stellen einen Wohltäter des College zu ehren, der in den moralisch verwerflichen Sklavenhandel involviert war.
Das ist auf den ersten Blick nachvollziehbar, allerdings, wenn man dieser Argumentation folgt, sieht man sich relativ bald mit dem Problem konfrontiert, dass sich in Kirchen landauf landab unzählige Grabmäler für Personen befinden, die gemessen an unseren heutigen moralischen und politischen Vorstellungen eher problematische Gestalten waren. Beseitigt man die Gedenktafel für Rustat, dann müsste man die sichtbare Erinnerung an die meisten anderen historischen Figuren in Kirchenräumen und natürlich auch im öffentlichen Raum generell eigentlich auch tilgen; bestenfalls in Museen wäre dann für solche Kunstwerke – denn darum handelt es sich ja meist auch – noch Platz. Nicht zuletzt aus der Sicht des Denkmalschutzes wäre das schwer zu rechtfertigen, von dem Wunsch, die eigene nationale Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen im öffentlichen Raum durch markante Zeichen und Monumente sichtbar werden zu lassen, einmal ganz abgesehen.
Von daher überrascht es auch nicht, dass das Ansinnen der Collegeleitung, den Kirchenraum von den Spuren einer peinlichen kolonialen Vergangenheit zu reinigen, auf Widerstand stieß. Insgesamt 65 Alumni, darunter auch Nachkommen von Rustat stellten sich diesem Ansinnen entgegen, so dass es zu einem förmlichen Prozess vor dem zuständigen Kirchengericht in Ely kam – denn ohne eine explizite kirchliche Genehmigung, eine „faculty“ konnte das Grabmal nicht aus der Kirche entfernt werden. Obwohl das College die Unterstützung des Bischofs von Ely besaß und auch der Erzbischof von Canterbury. der generell viel Verständnis für linksliberale oder linke Initiativen zeigt, erklärte, er sei für die Entfernung des Monuments aus der Kirche, entschied das Konsistorialgereicht gegen die Antragsteller.
Der gesamte Prozess, aber auch die Urteilsbegründung sind aufschlussreich, wenn man die heutigen Kulturkämpfe, denn darum handelt es sich ohne Zweifel, verstehen will. Auf der einen Seite steht die Sehnsucht nach moralischer Reinheit, die sich eben auch in Kirchenräumen und Stadtlandschaften manifestieren solle, auf der anderen Seite die Weigerung, die Geschichte an den Werten der Gegenwert zu messen, verbunden freilich auch mit dem Beharren auf einer nationalen historischen Tradition, die trotz ihrer dunklen Seiten, auch in der Gegenwart politische Identität zu begründen [39] vermag. Dieser Konflikt hat sich freilich in Großbritannien besonders stark zugespitzt, weil bislang eine kritische Generalabrechnung mit der eigenen Geschichte wie sie in Deutschland, wenn auch zeitverzögert, nach 1945 stattfand, ausgeblieben war, eher gratulierte man sich in der breiteren Öffentlichkeit dazu, historisch stets auf der Seite des Guten gestanden zu haben, auf der Seite der Freiheit im Kampf gegen Despotien und auf der Seite der Menschenrechte im Konflikt mit Gewaltherrschern. Diese Selbstgewissheit, die die akademische Forschung so natürlich nie teilte, wird jetzt massiv in Frage gestellt und das umso stärker, weil Großbritannien stärker als Deutschland unter dem direkten Einfluss der amerikanischen Kulturkriege und namentlich der dort von Liberalen und Linken vorgebrachten Forderung, für die Sünden des Weißen Mannes Busse zu tun, steht.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: