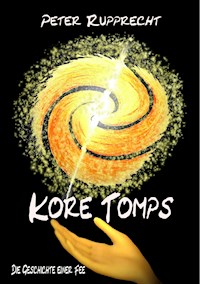
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kore Tomps
- Sprache: Deutsch
286 Jahre nach einem großen Religionskrieg werden in einem Waisenhaus ein Mädchen und ein Junge unter mysteriösen Umständen abgegeben. Die Findelkinder Kore und Neko entwickeln eine tiefe Verbundenheit zueinander, die mit der Adoption von Kore ein jähes Ende findet. Als Kore zehn Jahre später von brutalen Schlägern angegriffen wird, rettet Neko ihr das Leben und verschwindet spurlos. Sie entschließt sich, Neko zu suchen und gerät dabei in den Konflikt zweier Welten, bei dem ihre Mitmenschen in große Gefahr geraten. In diesem Moment offenbart sich das Geheimnis ihrer Abstammung, was Kores Körper und Geist vor ungeahnte Herausforderungen stellt. Sie erkennt, dass ihre größte Angst nicht darin besteht, ohnmächtig zu sein, sondern ganz im Gegenteil, grenzenlos Macht zu haben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Geschichte ist rein fiktiv. Ich lege größten Wert darauf keinen Bezug zu aktuellen Tagesgeschehen, Themen oder Personen herzustellen.
Mein Dank gilt allen Personen und Ereignissen, die diesem Buch zur Geburt verholfen haben.
Peter Rupprecht
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Indreen
Kapitel 2 Neko
Kapitel 3 Dora und Edward
Kapitel 4 Adalmus
Kapitel 5 Einen Schritt zurück
Kapitel 6 Feenstaub
Kapitel 7 Ipsy
Kapitel 8 Elisabeths Erbe
Kapitel 9 Eine weitere Lektion
Kapitel 10 Feenkraft
Kapitel 11 Phileas
Kapitel 12 Tabacot
Kapitel 13 Der Weg des Löwen
Kapitel 14 Im Doppel
Kapitel 15 Kaimlakhan
Kapitel 16 Feenmacht
„Wahre Helden handeln im Verborgenen.“ (Ipsy)
Prolog
Manche sagen, wenn sie zu den Sternen hinaufsehen, dass von dort oben die Seelen der Verstorbenen auf sie herabblicken. Es wären, so sagen sie, sowohl mächtige Herrscher der vergangenen Zeiten darunter als auch die engsten Verwandten und Freunde. Von dort oben wachen sie über die Lebenden und beobachten ihre Nachkommen dabei, wie sie ihr Erbe fortführen.
Andere wiederum behaupten, dass die Sterne nichts anderes seien als leuchtende Kugeln aus Gas. Ihr Licht wäre bereits vor langer Zeit in die Ewigkeit des Alls ausgesandt und erreicht erst jetzt seinen Beobachter. Gerade dieses eindrucksvolle Leuchten zeigt, wie groß und mächtig die Schöpfung ist. Der Kosmos wäre sowohl eine Wiege neuer Sonnensysteme und Lebensformen als auch ein Grab der vergangenen Zeiten. Aus dem Staub vergangener Welten entstehen neue Welten. Auch sie würden einer Blume gleich, aus dem Samen keimen, in die Höhe wachsen, erblühen, verwelken und zu Staub zerfallen, damit wieder neue Welten aus ihnen entstehen. Die Erde selbst wäre ebenso Teil dieses Kreislaufes und täte es den anderen Planeten im Weltall gleich.
Aber eigentlich ist es egal, was ein jeder in den Sternen zu sehen glaubt, denn in einem haben all diese Sichtweisen etwas Gemeinsames. Wer in das All sieht, sieht eine Momentaufnahme der Vergangenheit. Es ist ein Moment, der sich im ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens zu wiederholen scheint. Er vermittelt den Eindruck, dass es eine klare Antwort über die Sterne geben müsse. Trotz allem aber bleibt es nur eine von vielen möglichen Antworten, da ein jeder Beobachter sein ganz eigenes Verhältnis zum Universum hat. Hinzu kommt, dass er sich nur solange mit dieser Antwort begnügt, wie sie der eigenen Vorstellung entspricht. Der Lauf des Lebens aber ist dazu bestimmt neue Erfahrungen zu sammeln und sich so unendlich, wie die Schöpfung selbst, auszudehnen. Gerade deswegen wird sich die Beziehung des Beobachters zum Universum laufend verändern. Die Sterne sind und müssen daher ein ewiger Diskussionsstoff der Generationen bleiben. Solange sich der Betrachter der einen Frage nicht entziehen kann, was er beim Blick in das Sternenzelt vor sich sieht, wird er zu reifen angehalten sein. Er wird jeden Tag aufs Neue eine Antwort darauf suchen und er wird immer eine Erklärung dafür finden, die für ihn die absolute Wahrheit darstellt. Nach dieser Wahrheit lebt und handelt er. Sein ganzes irdisches Leben lang.
Der erste Teil dieses Buches befasst sich mit dem, was die Einen Physik und die Anderen eine Frage des Glaubens nennen. Es ist die Erzählung von einer Fee, von einem Jungen und von einem mächtigen Feind. Ihren Anfang und ihr Ende, wenn es denn dergleichen gibt, nimmt sie in einer sternenklaren Nacht, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit ...
Kapitel 1
Indreen
Wallendes Blut. Tiefrot und aufgewühlt. Ein ganzes Meer davon umgab Indreen. Doch es beeindruckte ihn nicht im Geringsten. Er wusste genau, was was er tat. Obwohl das Blut direkt in seinen Kahn hinein spitzte und dort eine immer größere Lache bildete, brachte ihn nichts von seinem Kurs ab. Es besudelte sogar die goldglänzende Rüstung, die er an seinem stämmigen Körper trug. Vergeblich versuchte es dort anzuhaften, wie der Efeu an einer Hausfassade. Der edle Panzer aber ließ es abperlen, gleich der Regentropfen von einem Lotusblatt. Der Pfleger setzte fest entschlossen seinen Weg fort. Heroisch starrte er, mit gezücktem Schwert in seinen kräftigen Händen, am Bug seines Nachens über den Horizont hinweg. Den Blick immer nach vorne geheftet. Nie zurück. Er hielt direkt auf ein grelles Licht zu. Es blitzte und glänzte in der Ferne gleich eines Sterns, der hell erleuchtet am Himmel steht. Ihm folgte er schon seit vielen Jahren, was nicht immer so war. Seine Vergangenheit brodelte aus der Tiefe empor und stellte sich dem Kurs seines Bootes entgegen. Eine starke Strömung suchte ihn von dem Licht wegzutragen. Sie zog ihn wieder zurück. Zurück in eine vertraute Ordnung, in der alles seinen Platz hatte. Auch er. Drohende Stimmen verfolgten seinen einsamen Ritt durch die widerspenstigen Wellen. Er ließ sich nicht von ihnen vereinnahmen, auch wenn ihre Worte seine Seele bei der Ehre packten. Seine Ohren verschlossen sich ihrer boshaften Predigt. Als das nichts half, goss sie über ihn Schande und Verderben, Verrat und den Vorwurf der Feigheit aus. Indreen aber durchschaute ihre düstere Absicht. Sie wollte ihn mit allen Mitteln stoppen. Versuchte die Zweifel in ihn zu schüren und seinen Mut sinken zu lassen. Dunkle, turmhohe Wolken zogen über ihn auf und verliehen der verbalen Anfeindung eine hässliche Fratze. Geschwärzt wie die Dunkelheit der Nacht, thronte sie über ihn. Aus ihren leeren Augenhöhlen zuckten grelle Blitze, die nach ihm schlugen. Die Urgewalten, die einen tosenden Sturm über ihn entfesselten, fixierten sich vollends auf seinen Standort.
„Du bist voller Blut, wie wir alle“, rief die donnernde Stimme. „Wie lange willst du mich verleugnen? Gib auf und stehe zu mir.“
Starker Wind voller Moder blies ihm ins Gesicht. Er stank bestialisch nach verwesendem Fleisch. Ein blutrotdurchwirkter Dunst hüllte ihn bald vollends ein. Es versuchte ihm, die Sicht zu nehmen. Indreen blieb hartnäckig. Sogar im Nebel hielt er Kurs. Je mehr der Druck anhielt, umso mehr sein Feind ihn in Versuchung führte, desto entschlossener wurde er, nicht locker zu lassen.
„Mich kriegst du nicht“, schrie er der tobenden See entgegen. „Du hast mich lange genug beherrscht und meine Seele vergiftet. Es gibt keinen Lohn mehr, den du mir bieten könntest.“
„Versuch nicht zu leugnen, was doch so offensichtlich ist“, brüllte ihn der Sturm unaufhörlich an. „Du bist noch immer der Diener meines Tempels und du wirst es immer bleiben. Deine Flucht vor mir ist zwecklos.“
„Dem dessen einziger Diener ich bin ...“, trotzte er keck zum wütenden Orkan, „... ist jenes Licht, dort am Horizont. Du wirst mich nicht daran hindern, zu ihm zu gelangen.“
„Es gibt kein Licht. Es gibt nur mich.“
„Wenn es dich gibt, gibt es auch das Licht.“
„Was für eine seltsame Logik? Bin ich dir nicht Beweis genug?“
„Was ich erschaffen habe, muss nicht so bleiben. Ich werde meine Macht wieder an mich nehmen und dich dahin bringen, wohin du gehörst.“
„Das werde ich zu verhindern wissen“, giftete der Sturm voller Bosheit entgegen. Die Strömung des Blutes verstärkte sich und wirbelte ihn mit seinem Boot herum. Es bildete sich ein immer größerer Strudel, dessen Kraft Indreens Boot unweigerlich erfasste. Der Sog zog ihn in seine Mitte hinein. Indreen blieb dennoch standhaft auf Position. Aufrecht stehend, Haltung bewahrend. Ungebrochen.
„Du wirst in mir zugrunde gehen …“, lachte die Stimme, als eine gellende Sirene durch seinen Albtraum heulte. Sie ließ das Licht am Horizont ruckartig aufblitzen. Indreen schreckte auf.
Aufgerüttelt und tief durchatmend starrte der Erzieher auf die digitale Plasmauhr seines Dienstraumes. Sie blendete gerade die Mitternachtsstunde ein.
„Schon wieder“, dachte er angespannt zu sich. Das Grauen seiner Vergangenheit hatte sich erneut im Schlaf zu Wort gemeldet. Wie lange musste er diese ständig wiederkehrenden Albträume noch aushalten? Indreen erinnerte sich gerade daran, warum es ihn hierher verschlug. Es machte ihn glücklich, wenn er daran dachte und es vertrieb den Schrecken seiner Träume. Glaubte er hier im Waisenhaus eine Schuld einzulösen? Doch in sich zu gehen, um darüber nachzudenken, blieb keine Zeit. Erneut ging das scheppernde Hämmern der mechanischen Glocke, die ihn aus seinem Albtraum holte. Die nervtötende Klingel machte ihm klar, seinen Blick wieder nach vorne zu richten. Denn obwohl sie ihn aus dem Schlaf riss, teilte ihr Ertönen mit, dass das Leben weiter ging. Das Leben selbst forderte ihn jeden Tag aufs Neue auf, sich Perspektiven zu verschaffen und nicht dauerhaft in seiner Vergangenheit festzuhängen.
Die Glocke besaß in dem Waisenhaus eine einfache Aufgabe. Sie ertönte immer dann, wenn jemand ein Kind durch die Babyklappe schob. Für die Bediensteten bedeutete ihr Auslösen eine Arbeit, die einem Ritual glich. Dabei war es eher selten, dass überhaupt jemand die Babyklappe gebrauchte. In den Aufzeichnungen des Archives fanden sich nur wenige Fälle. Die letzten beiden Neuzugänge über die Babyklappe gab es vor sieben Jahren. Die meisten Kinder, die das Heim der Stadt Presson aufnahm, kamen ganz offiziell. Entweder brachte sie die Polizei hier hin oder sogar die leiblichen Eltern selbst. Daher kannte die Anstaltsleitung die Mütter und Väter der Kinder. Der häufigste Hintergrund, der die frischgebackenen Eltern erfahrungsgemäß dazu trieb, ihr Kind dem Tompswaisenhaus anzuvertrauen, lag an befürchteten Versorgungsproblemen oder auch daran, dass die Eltern sich ihrer künftigen Rolle nicht gewachsen fühlten. Bevor aber ein Kind verwahrlost aufwuchs und somit wertvolle Zeit verlor, nahm sich das Waisenhaus ihrer an. Es gab ihnen eine Grundausbildung, bestehend aus Rechnen, Lesen und Schreiben mit auf ihren Lebensweg. Nicht selten bestand für die Kinder die Aussicht, in der Verwaltung in einem der städtischen Magistrate auf dem Planeten unterzukommen. Diese Hauptorte des Erdballs beschäftigten überwiegend ehemalige Waisen. Gerade sie galten als absolut zuverlässig und loyal. Dass überhaupt Neugeborene ihren Weg über die Babyklappe in diese Einrichtung fanden, war nicht selbstverständlich. Damals, an seinem ersten Arbeitstag, war es Indreen gegönnt, die Ankunft der Zwillinge Karol und Holger mitzuerleben. Zunächst dachte er, dass das Heim bald rappelvoll wäre, wenn jede Nacht auf diese Art und Weise ein Kind zu ihnen käme. Seine Befürchtung der Überbelegung blieb aus. Ganze sieben Jahre lang blieb die Glocke stumm. Auch untertags kamen keine Eltern, die ihr Baby dem Waisenhaus anvertrauten. Es wirkte so, als raubte jemand bewusst diesem Haus seine Bestimmung. Dabei besaß das Heim schon immer eine große Kapazität und wäre mit einem Kind pro Nacht spielend fertig geworden.
Als die Heimleiterin Miss Conners ihn und Michelle an seinem ersten Tag durch das Haus führte, erzählte sie von seiner bewegten Geschichte und dem großen Eichenhain, in dem es stand. Die Historie des Hauses verknüpfte sich eng mit der des Waldes. Beide waren nicht älter als 286 Jahre. Die Bäume wuchsen mittlerweile so hoch, dass sogar deren Kronen über das spitze Giebeldach der Einrichtung ragten. Im Sommer spendete ihr hellgrünes Laub einen dichten Schatten gegen die Hitze. Der Wald selbst bedeckte eine riesige Fläche, die sogar bis zum Rifgensteinmassiv reichte. Einem aus geologischer Sicht sehr jungen Gebirgszug, auf dessen Gipfeln fast das ganze Jahr über Schnee zu finden war. Doch so abgesondert lag das Heim nicht, wie es auf den ersten Blick erschien. Es war sogar von der nächsten Stadt Presson aus in nur einer Viertelstunde zu erreichen. Das lag an der globalen Hypertrasse, die gerade hier einen Haltepunkt unterhielt. Von hier aus gelangte man innerhalb weniger Stunden in jeden Winkel des Planeten. Die Stadt Presson wählte den Standort ihres Waisenhauses aus gutem Grund hier aus. Alle anderen Heime des Planeten standen in den Wohnzentren. Für seine ungewöhnliche Lage sorgte der Standort der zentralen Gedenkstätte des letzten kriegerischen Konflikts der Menschheit. Von oben wirkte die Gestaltung des Memorials wie ein einziger Krater, den ein Meteorit durch einen Einschlag auf der Erdoberfläche hinterlässt. Etliche, pechschwarze Granitstelen ragten darin krumm und schief aus der Erde hervor. Sie symbolisierten die ungeheure Zerstörungskraft, die während der Auseinandersetzung wütete. Außerdem versinnbildlichten sie die zahllosen Schicksale, die der "Mystische Krieg", so benannten die Historiker dieses Ereignis, auf brutale Art und Weise aus dem Leben riss. Die sakral wirkende Stätte beeinflusste die Erziehung der Kinder in aller Welt und prägte deren Charakter.
„Bereits früh müssen Kinder lernen ...“, erklärte Miss Conners damals Indreen geduldig, „ ... dass nichts auf dieser Welt selbstverständlich ist. Schon gar nicht der Frieden. Die Wunden des "Mystischen Krieges" sind heute immer noch zu sehen und auf der ganzen Erde spürbar. Von seiner gesellschaftlichen Auswirkung ganz zu schweigen. Er schuf erst die gegenwärtigen Lebensumstände. Das ist heute leider in Vergessenheit geraten.“
Diese Gründe des Vergessens verstand Indreen aufgrund seiner eigenen Erfahrung in dieser Sache recht gut. In dem, dass einer der Orte der totalen Vernichtung direkt vor der Haustüre lag, blieb die Erzählung von dem schrecklichen Krieg vor über 286 Jahren kein bloßes Geschwafel. Lebhaft wurde gerade hier den Nachfahren bewusst gemacht, dass die Gefahren, denen der Frieden ausgesetzt ist, viel schlimmer sind, als die in einem bewaffneten Konflikt. In einem offenen Krieg gibt es klare Fronten. Im Frieden aber, und das lehrte die Vorgeschichte des religiösen Konflikts, ist es nicht so leicht zu erkennen, was sich hinter der Fassade der Kriegsparteien abspielt. Bewusst streuten diese Falschinformationen, um sich der Zustimmung des Pöbels sicher zu sein. Es bestätigte sich eine alte Regel: Krieg bleibt immer gleich. Es spielt keine Rolle, wer gegen wen einen Konflikt austrägt. Es gibt immer nur Verlierer. Selbst die, die glauben, sich damit bereichern zu können, werden letzten Endes von ihrer eigenen Gier verschluckt. Die Waffen wurden zwar immer mächtiger und brutaler, aber das Prinzip blieb immer dasselbe. Die Krux dieses Ereignisses war es, dass gerade dieser Auseinandersetzung ein massiver gesellschaftlicher Umbau folgte. Der Ära nach dem Religionskrieg entsprang eine Gesellschaft, in der es den Begriff der Völker nicht mehr gab. Die Nachfahren verschmolzen zu einer globalen Gemeinschaft, in der die Begriffe Rassismus oder Religion keinen Platz mehr fanden. Ebenso endete damals der Wettlauf der Nationen um Ressourcen mit samt ihrer Finanz- und Währungssysteme. Diesen Hintergrund an die künftigen Generationen weiterzugeben, war die Aufgabe der Erzieher der Heime. Einem Erzieher wie Indreen. Ja, er sehnte sich danach, dies tun zu können und wurde enttäuscht. Denn je länger er hier seinen Dienst tat, umso erstaunlicher fand er es doch, dass seither kein Kind mehr hier ankam. Dabei las man oft in der Multimedialzeitung von Babys, welche man leblos in der Gegend auffand. Gerade für solche Fälle hielt man das Waisenhaus noch immer in Betrieb. Hier lehrte man dem Aufgenommenen alles, was er brauchte, um im Leben überhaupt eine Chance zu haben. Mit dem Schlag der Glocke heute Nacht keimte in Indreen eine neue Hoffnung auf, am Anfang eines beginnenden Lebens, einer sich entwickelnden Ordnung zu stehen. Er durfte sich als erste Person mit dieser neuen Perspektive befassen. Das Leben in dem Hause, so erklärte es ihm die Waisenhausleiterin Miss Conners schon an seinem ersten Arbeitstag, ist jeden Tag immer ein Anderes. Stetig ist nur der Wandel. Mit jedem Tag lernen nicht nur die Kinder hinzu, sondern auch das Personal. Gerade der Erzieher zeigt durch sein Vorbild seinen Schösslingen, wie Verantwortung aussieht. Dazu gehörte auch die Nachtwache, die Indreen heute ableistete. Oftmals sorgten zu dieser späten Stunde die ruhelosen Waisenkinder unterschiedlichsten Alters für die nächtliche Störung. Gerade dann, wenn sie nicht einschliefen, verursachten sie durch ihr reges Tun eine gespenstische Unruhe im Haus. Sie wanderten trapsend in der Dunkelheit umher und suchten sich einen der Erzieher, der sich ihrer annahm. Am allerliebsten besuchten die Kinder Indreen. Natürlich nur, wenn er die Nachtwache hielt. Wenn sie in ihren Schlafanzügen vor ihm standen und ihn mit großen Augen anstarrten, konnte der Pfleger nicht nein zu ihnen sagen, um sie auf den Schoß zu nehmen. Von ihm sehnten sie sich nach einem Wort der Zuneigung und der Nähe. Sie wollten ihn spüren. Nicht wenige fühlten sich einsam in den Nächten. Es kam darum oft vor, dass Indreen sich aufregende Geschichten für seine ruhelosen Besucher einfallen ließ, um sie wieder ins Bett zu kriegen. Wenn er erzählte, handelten seine improvisierten Stücke von mutigen Helden, die gefährliche Monster besiegen. Von Fantasiewesen, die mit ihrem mystischen Zauber die kleinen Zuhörer in den Bann zu ziehen verstanden. Manchmal beruhigte auch eine romantische Geschichte über Mut und Liebe die Kinder mit einem versöhnlichen Ende. Das war gut so, denn nur wenn eine Geschichte gut endete, schliefen die Kinder ohne weitere Fragen ein. Für seine selbst erdachten Märchen liebten die Waisenkinder den Pfleger sehr, denn Indreen verstand es, sehr anschaulich und facettenreich seine Ideen darzustellen. Der Zuhörer glaubte nur zu oft, selbst dabei zu sein. Direkt bei den Hauptdarstellern zu stehen und sich in die Geschichte einfühlen zu können.
Pflichtbewusst erhob sich der Pfleger aus seinem Nachtlager und schlurfte in den breiten Flur hinaus. Er dehnte unterm Gehen seine Glieder. Es knackte in seinem Rücken. In der Nacht lag der Korridor wie ausgestorben da, was nicht hieß, dass man in ihm kein Licht sah. Die Wände des Ganges waren übersäht mit winzigen Bildpunktzellen. Die kleinen Leuchtzellen strahlten unterschiedlich stark auf das Auge des Betrachters ein. Nur für sich gesehen wirkte der einzelne Punkt langweilig und wenig aussagekräftig. Zusammengenommen aber ergaben die Punkte das vergrößerte Bildnis der Mondoberfläche. Den ganzen Durchgang hinunter leuchteten sie in unterschiedlicher Intensität und sorgten erst für die Konturen, damit das ganze Bild seine Wirkung bekam. Sie zeigten den nächtlichen Flurgänger genau die tiefen Mondkrater, die die Meteoriten im Laufe der Zeit auf der Mondoberfläche hinterließen. Sie gaben seiner Außenhülle die Gestalt, die den Mond zu dem machte, wofür ihn die irdischen Beobachter bewunderten. Zu einem geheimnisvollen Ort, der Fantasie und Neugierde anregt. Für Indreen bedeutete der Mond, bevor er hier anfing zu arbeiten, nichts. Doch mit der Zeit lernte er, eher beiläufig zu dem Unterricht, den Miss Conners den Kindern gab, dass der Mond erst das ihm bekannte Leben auf der Erde ermöglichte. Ohne Mond gäbe es keine Menschen und Tiere. Es gäbe keine Jahreszeiten und keine Ebbe und Flut. Ohne Mond wäre die Erdgeschichte anders verlaufen und hätte niemals an dem heutigen Punkt gestanden. Seine Entstehung verdankte er einem kosmischen Unfall. Vor vielen Jahrmillionen stieß die Protoerde mit einem riesigen Brocken zusammen. Dabei sprengte sich jenes Stück heraus, das sich zum gegenwärtigen Mond verformte.
Tapsend näherte er sich dem Kontaktmikro auf dem Flur und rief aufscheuchend zu den mittlerweile schlafenden Kolleginnen in dem Ruheraum hinein: „Raus aus den Federn, Mädels. Die Klappe hat ausgelöst, wenn ihr es nicht schon gehört habt. Wir haben einen Neuen. Mildred, Michelle, geht ihr schon mal in den Untersuchungsraum. Macht den Archivierer an. Ich komme mit dem Kleinen zu euch.“
Der Pfleger tippelte anschließend weiter in die kreisförmige Empfangshalle des Heimes. Der Ort, an dem Miss Conners die Paare willkommen hieß, welche ein Kind adoptieren oder dem Heim übergaben. Gerade hier flossen die meisten Emotionen zwischen den leiblichen Eltern und ihren Kindern, wenn sie sie ins Heim brachten. Im umgekehrten Fall wurden die adoptierten Kinder hier offiziell verabschiedet, was nicht ohne Rührung blieb. Die Angestellten nannten den Raum daher die Halle der Tränen. Bis auf eine weiße Sitzreihe und einer Kübelpflanze besaß er keinerlei Einrichtung. Auf die Besucher wirkte er kahl und schmucklos. Sogar der Fußboden erstrahlte in hellem schlichten Weiß. Seine Wände jedoch und die leicht gewölbte Decke waren, wie alle anderen Wände des Waisenhauses auch, mit Bildpunktzellen versehen. In dieser Nacht zeigte jener Teil des Hauses abwechselnd Nahaufnahmen von der Venus, dem Abendstern. Sie stammten von einem Röntgenteleskop, mit dem die Kosmologen das Weltall erforschten. Die Atmosphäre, des der Erde am nächsten gelegenen Planeten, durchdrang hauptsächlich das Treibgas Kohlendioxid. Es bildete dichte gelbliche Wolken aus Schwefelsäure. Sie gaben dem, nach der römischen Göttin der Liebe benannten Himmelskörper seine wohl bekannte Farbe. Allein schon wegen der astronomischen Darstellungen an seinen Wänden und Decken konnte man das Tompswaisenhaus von Presson nicht mit den anderen Waisenhäusern auf der Erde vergleichen. Das lag an dem speziellen Unterricht des Hauses. Miss Conners vermittelte den Waisenkindern neben den Grundfächern mit ihrem Gehilfen Godje zusätzlich ein weiteres Fach. Sie nannte es Kosmologie oder die Lehre vom Allergrößten: dem Universum. Dieses Fach stellte die Heimleiterin mit großer Leidenschaft dar. Miss Conners liebte das Weltall und scheute sich nicht, dies offen zu sagen. Sie erklärte, dass nur dank ihm der Platz zu verstehen ist, den jeder Einzelne einnimmt. Wenn man das Wunder des Diesseits begreifen will, kam man nie am Kosmos vorbei. Dem trügerischen Ort des Friedens und der Zerstörung, der Kollisionen, der Sternenexplosionen, der schwarzen Löcher, deren Gravitation so stark ist, dass sogar das Licht angezogen wurde. Er war der Platz riesiger Staubwolken. Die Kinderstube neuer Sonnensysteme inmitten eines gigantischen Raumes. Seine Materie wird sich eines Tages wieder bündeln, um irgendwann wieder neu zu expandieren. Ein ewiger Kreislauf des Werdens und des Vergehens. Am Anfang eines jeden neuen Zyklus stand die Zerstörung. Lag nicht in der Zerstörung aller Anfang eines jeden neuen Werdens und Vergehens?
Für Indreen hatten diese Betrachtungsweisen von Miss Conners über das Universum keine Bedeutung. Der Beruf selbst und seine Idee dahinter trieben den Pfleger an, hier sein Lebensglück zu suchen. Auf die Bezahlung kam es ihm dabei nicht an. nicht an. Sein Verdienst als Pfleger des Waisenhauses war klein. Kost und Logis waren frei. Er lebte zwar wie seine Kolleginnen Mildred und Michelle ein gutes Stück abseits der Hauptstadt Presson, aber Indreen drängte es nicht dorthin. Wenn man von der Welthauptstadt Presson sprach, durfte man sich nicht die Metropolen vor dem "Mystischen Krieg" vorstellen. Damals gab es unvorstellbar große Menschenansammlungen auf engstem Raum. Freier Boden wurde zu einem lukrativen Spekulationsobjekt. Man baute daher riesige Wohnkomplexe in die Höhe, errichtete ganze Wälder aus Beton und Stahl, die dennoch nicht genug fassten, um die Millionenmassen an Menschen auf engsten Raum unterzubringen. Die Enge sorgte für massive logistische Probleme. Angefangen von der Entsorgung der Abfälle bis zur Versorgung mit sauberem Wasser und Elektrizität. Hinzu kamen die sozialen Kluften, was vor allem bei Krisen schnell zum gesellschaftlichen Sprengstoff mutierte. Wenn eine Megacity sich auf nur einem Wirtschaftszweig konzentrierte, führte eine Flaute in dieser Branche zu besonders hoher Arbeitslosigkeit. Weil es innerhalb kurzer Zeit keine neuen Beschäftigungsmöglichkeiten gab, lagen soziale Unruhen förmlich in der Luft. Vor dem "Mystischen Krieg" gab es das zuhauf und die Regierungen schickten meist das Militär aus, um die Aufstände brutal niederzuschlagen. So eine Stadt war Presson nicht. Gegründet wurde sie auf den Ruinen einer Vorgängerstadt. Kurz nach dem "Mystischen Krieg". Sie entstand auf dem Reißbrett. Die Linien und Strukturen waren genau vorgegeben. Eine jede Institution hatte dort ihren festen Platz. Von oben wirkte sie wie ein großer Kreis, den vier Hauptachsen durchschnitten. Diese vier Hauptwege dienten als zentrale Versorgungsrouten und endeten direkt an der Stadtgrenze. Wenn man nun in die anderen Städte der Welt reisen wollte, benutzte man dafür die Hyperbahn. Die Hyperbahnhöfe befanden sich immer im Zentrum einer jeden Siedlung. Direkt neben dem Ideenmarkt und dem Meditationszentrum. Im südlichen Halbkreis lagen die beiden Wohnbezirke Hailwood und Dails. Im Norden lag der Akademiedistrikt und im Osten der städtische Magistrat mit samt der Versorgungseinrichtungen. Hier gab es außerdem noch das Medizinzentrum, die Polizei und die Feuerwehr mit dem Recyclinghof. Außerhalb der Stadtgrenzen richteten sich die Forschungs- und Produktionszentren der Nanotecmaschinen und Rohstoffgewinnung ein, welche die Arbeitgeber der ansässigen Bevölkerung waren. Zwischen den meist einstöckigen individuell gestalteten Häusern der Stadteile und im Stadtpark reckten sich noch die Ruinen der Vorgängerstadt in die Höhe, welche man seinerzeit „Wolkenkratzer“ nannte. Diese spitzen Reste der Vergangenheit zu beseitigen, wäre ein Leichtes für die Techniker des städtischen Magistrates. Der Rat der Sechs verfügte aber, dass diese „Skulpturen“ der Geschichte als Mahnmal stehen blieben. Ein jeder solle für immer sehen, auf welch tönernen Füßen die Lebensverhältnisse der Einwohner standen. Ein produzierendes Gewerbe gab es in der ganzen Stadt nicht, weil Nanotecapparate alle Alltagsgegenstände vor Ort herstellten. In diesen Tagen bezeichnete man bereits eine Stadt schon dann, wenn sie mehr als fünftausend Einwohner beherbergte. Die Welthauptstadt Presson brachte es sogar auf knapp zweihunderttausend Einwohner und diese Zahl blieb alles in allem konstant. Dies lag zum einen an der Geburtenrate, welche der Rat der Sechs festlegte. Zum Anderen auch daran, dass sich der Generationenvertrag erübrigte. Ein jedes Paar musste, wenn es eigene leibliche Kinder zur Welt bringen und groß ziehen wollte, eine Pflichtuntersuchung des Erbgutes beim örtlichen Medizinzentrum über sich ergehen lassen. Erst bei einwandfreier genetischer Struktur, durften Kinder gezeugt werden. Die tompschen Gesetze ermöglichten eine kostenlose DNA-Analyse im Medizinzentrum. Verstießen Eltern gegen diese Auflagen und zeugten mit defektem Erbgut Kinder, verdonnerte das Gesetz die Eltern zu einer langwierigen DNA-Therapie. In der Bevölkerung war die Maßnahme der Genetikkur für die Väter und Mütter nicht sonderlich beliebt, weil sie vollends zulasten der Freizeit der Patienten ging. Der Rat kannte aber in dieser Hinsicht nicht die geringste Milde. Er sagte schlicht und einfach dazu: Wenn Eltern verantwortungslos ihrem Nachwuchs genetische Defekte auferzwingen unter dem es ein Leben lang leidet, ist der Freizeitentzug für die Korrektur, nur ein geringes Opfer. Die meisten Menschen unterwarfen sich so einem Diktat für das werdende Leben nicht und empfanden es als einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre. Die Heimleiterin Miss Conners verteidigte hingegen die Haltung des Rates zu dieser Frage vehement. Sie meinte dazu, dass ein jeder von den Menschen nicht nur die Verantwortung für sein Leben trug, sondern auch das der künftigen Generationen. Sie sah daher in den abgelieferten Kindern die stummen Opfer dieser gesellschaftlichen Haltung. Gerade weil viele der werdenden Eltern davor fürchteten, brachten sie nicht selten diese Kinder um. Wegen dieser Problematik hielt der Rat an den Waisenhäusern fest, obwohl der ursprüngliche Hintersinn der Einrichtung bereits abhanden kam. Man verbreitete öffentlich, dass ein jedes Baby, das anonym zur Welt kam, in den Waisenhäusern Aufnahme fand. Dort konnte ein Kind unerkannt durch die Babyklappe abgegeben werden und keiner müsste Angst vor einer Bestrafung haben. Durch die enormen medizinischen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte sahen die Heilungschancen von Erbkrankheiten wesentlich besser aus. Vor allem durch bahnbrechende Leistungen auf dem Gebiet der Zellforschung seit den religiösen Konflikten, wurden nun einstmals unheilbar geltende Behinderungen kurierbar. Der Rat verfügte, dass jedes dort abgegebene Kind medizinisch zu versorgen und, wenn möglich, zu heilen war.
Miss Conners selbst wohnte ebenso wie Indreen im Tompswaisenhaus. Allerdings in einem besonderen Trakt. Sie und ihr Nanoroboter Godje. Letzterer, ein Wunderwerk der Nanotechnik, war ihr, noch vor Indreens erstem Arbeitstag im Waisenhaus, geschenkt worden. Verpackt in einer schlichten Holzkiste. Seine Ankunft im Waisenhaus erfolgte durch eine Transportdrohne, die direkt in den hufeisenförmigen Innenhof des Waisenhauses seine Fracht ablud. Per digitalisierter Post musste Miss Conners den Empfang bestätigen, bevor sie sich an das Öffnen des Paketes machte. Ihre erste Reaktion auf ihn war abwartend, als sie ihn vor versammeltem Personal und den Kindern auspackte. Zunächst hielt man ihn für einen schlichten Eisenwürfel bis Godje sie mit seinen Fähigkeiten eines Besseren belehrte. Niemand der Angestellten wusste, wer Godje konstruierte. Denn obwohl er auf dem ersten Blick einfach und primitiv wirkte, erwies er sich auf dem zweiten Blick als gut durchdacht und ausgereift. Die Kinder fingen just an, ihn mit ihren bunten Wachsfarben zu bemalen. Die Farbpartikel saugte Godje in seine Robotermasse auf und fügte sie in seine außergewöhnliche Fähigkeit ein, dreidimensionale Objekte plastisch darzustellen. Seine Oberfläche wirkte glatt und geschmeidig. Wenn er durch die Gänge des Heims schwebte, glaubte man einen stupiden Eisenklotz vor sich zu haben. Er war aber alles andere als das. Godjes Sprachausgabe hörte sich elektrifiziert an. Es übersteuerte immer etwas, wenn er seine Lauttöne aussendete. Mit der Farbe, mit der ihn die Kinder beschmierten, schrieb er in deutlich lesbaren Lettern ganze Bücher, wenn es sein musste. Die Heimleiterin nutzte ihr Geschenk seither für ihren Unterricht. Natürlich um drei dimensionale Planetenmodelle oder ganze Sonnen- und sogar Galaxiesysteme zu formen. Sie sagte dem Roboter nur, welchen Himmelskörper er darstellen sollte und Godje verformte sich entsprechend zu einem passenden Modell. Zu seinem größten Kunststück gehörte die Darstellung der Plejaden; einem mit bloßem Auge von der Erde aus zu erkennenden Sternhaufen im Sternbild des Stiers. Er verfärbte und teilte dazu seine Oberfläche in den entsprechenden Leuchttönen der jeweiligen Sonnen, Planeten oder Monde, wie es sie im Weltall gab. Als Miss Conners neugierig Godje fragte, wer ihn gebaut und ihr zum Geschenk machte, spukte der Roboter das Wort „Sumdala“ aus. Sie reagierte scheinbar ratlos darauf. Mildred bekam aber einen anderen Eindruck. Sie erlebte als Einzige noch diensthabende Angestellte die Amtseinführung von Miss Conners vor achtzehn Jahren im Waisenhaus. Es wirkte, als ob Miss Conners ihren Mitarbeitern und den Kindern nur etwas vorspielte. Sie vermutete schon damals, dass sie einen heimlichen Verehrer besaß. Bereits bei der Einführung in ihr Amt benahm sich Miss Conners noch in manchen Dingen selbst wie ein kleines Kind. Sie kannte sogar die einfachsten Dinge, wie das Flurmikrofon nicht, obwohl dieser Einbau in allen Waisenhäusern zum Standard gehörte. Als sie die neue Heimleiterin auf ihre Unbeholfenheit mit der technischen Ausstattung ansprach, sagte Miss Conners, dass sie einen langen Aufenthalt in einem der Rehabilitationszentren hinter sich hatte. Auf die nun folgende verständliche Frage, was denn mit der Heimleiterin zuvor passiert sei, antwortete Miss Conners nicht. Sie sagte ihr: „Mildred, seien sie mir bitte nicht böse, aber ich will diese Sache für mich behalten. Ich weiß selbst nicht alles darüber und ich ergieße mich nicht gerne in Spekulationen, die mir den Blick auf meine Zukunft verstellen.“
Schon bald verstand Mildred, warum der Rat Miss Conners zur Heimleiterin berief. Selten begegnete sie in ihrem Leben einem so aufgeschlossenen und wahrhaftigen Charakter. Gegenüber ihren Angestellten verhielt sie sich absolut fair und delegierte nur Arbeiten an sie weiter, wenn es gar nicht anders ging. Ebenso ließ sie es sich nicht nehmen selbst in die Erziehung der Kinder einzugreifen. Das Halten des Unterrichts war da nur ein Bruchteil davon. Die Heimleiterin achtete sehr darauf den Zusammenhalt unter den Kindern zu fördern und duldete keine Konkurrenz unter ihnen. Für sie gab es ein höher- oder minderwertig nicht. Sie begründete dies auf simple Art und Weise: „Gerade das Konkurrenzdenken hat zu einem Irrweg in der Menschheitsgeschichte geführt und trägt Mitschuld am Ausbruch des "Mystischen Krieges". Im Wahn seine Mitmenschen überbieten zu müssen, werden Versagensängste erzeugt. Jeder weiß, dass die Angst ein schlechter Ratgeber ist und ein weiteres Verfolgen nur in einer Katastrophe endet. Ich knüpfe meine Liebe nicht an Bedingungen und nehme ein jedes Kind so an, wie es ist. Es darf laut sein. Es darf wütend sein. Es darf Angst haben. Es darf traurig sein, es darf lachen. Immer werde ich es so lieben, wie es ist. Auch wenn es neidisch ist oder missgünstig gegenüber seinen eigenen Brüdern oder Schwestern auftritt. Das sind alles Erfahrungen, die die Kinder machen müssen. Sie brauchen sie, damit sie mit ihnen umzugehen lernen. Mir ist wichtig, dass sie lernen Konflikte aufzuarbeiten und sie selbst zu lösen. Denn nur dann sind sie in der Lage, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.“
In diesem Zusammenhang erlernten die Kinder die Artikulation und Sprechweisen. Diesen Unterricht hielt Indreen ab, denn er studierte einmal Sprachwissenschaft auf der Akademie. Etwas, dass seiner einzigartigen Erzählkunst zugutekam. Indreen betonte die Wichtigkeit der Kunst der freien Rede. Jemand, der dies nicht lernte, geriet in Versuchung, sich laufend wie ein Schaf zu verhalten, das blökend einem Leithammel folgt. Diese Lebensweise, so Indreen, ist einem Menschen nicht würdig. Wir sind Individuen, die keinen Hirten brauchen, der uns den Weg weist.
Indreen ließ auf seinem Weg die breite Eingangshalle hinter sich. An seine Zeit bei der Akademie dachte der Pfleger verschlafen, als er sich den Weg zur Babyklappe bahnte. Nur noch wenige Schritte trennten sie voneinander. Er dachte an seine Freunde und auch an die Mädchen, mit denen er gemeinsam im Aditorsaal lernen durfte. Seine Kameraden von damals waren größtenteils in der städtischen Gesellschaft untergekommen und ergriffen Berufe, die wesentlich mehr Komfort und Beachtung versprachen. Dass ausgerechnet er als einer der Wenigen seines Jahrgangs das Tompswaisenhaus als seinen Arbeitsplatz auswählte, überraschte Indreens Freunde dann doch. Sie sagten zu ihm, dass er lange in seinem Leben weit abgeschieden von der Zivilisation blieb. Ein Mann, der mit solchen beachtlichen Fähigkeiten gesegnet wäre, müsse sein Potenzial doch viel effizienter einsetzen. Als Kindererzieher führe er ein karges Dasein. Auch wenn ihm für den Lebensabend ein Platz in einem altersgerechten Wohnheim sicher war. Dass Indreen all ihre Einwände in den Wind schlug und dennoch sein Schicksal in dem Waisenhaus zu finden glaubte, lag daran, dass er mit seinem ganzen Herzen hinter dem Zitat des Mannes stand, der dem Waisenhaus seinen Namen gab. Es hieß: „Schließe mit dir selbst den Frieden.“
Dieses Zitat stand über dem Eingang des Hauses und wirkte wie ein Kainsmal auf der Anstalt. Es gab noch ein weiteres Gebäude, das ein anderes Zitat des Gründers Tomps trug. Dieses war im Gegensatz zum Waisenhaus keine soziale Einrichtung. Viele sichtbare Hinterlassenschaften des Waisenhausgründers gab es sonst nicht. Obwohl er bereits vor 221 Jahren verstarb, wirkte sein Geist im nichtsichtbaren Bereich unverändert weiter. Außer dem Nachnamen der Waisenkinder und der Betitelung ihrer Heime trug, auf Anordnung des Rates, wegen eines historischen Ereignisses, die Zeitrechnung seinen Namen.
„Tomps...“, so erklärte sich der Rat hierzu „... sah sich nicht als Mensch einer neuen Zeit. Er begriff sich selbst als jemand, mit dem eine Ära zu Ende ging. Er sagte, um wirklich frei sein zu können und Neues zu beginnen, muss man loslassen. Es war seine Absicht, dass wir loslassen und die Vergangenheit mit dieser Tat würdigen, damit sie in Liebe gehen kann. Erst nach seinem Tod bräche eine neue Zeit an. Eine Zeit, die mit dem großen Leid und der Ohnmacht seiner Epoche nichts mehr zu tun hat. Deshalb ist sein Sterbedatum als der Beginn der neuen Zeitrechnung zu verstehen.“
Indreens Freunde vermuteten aber auch einen anderen, unterschwelligen Grund für seinen Dienst im Tompswaisenhaus. Michelle nämlich, das Latinomädchen im gleichen Alter wie er. Indreen kannte sie schon seit der Einschulung an der Akademie. Beide waren in der Tat gute Freunde. Sie besuchten zwar nie die gleichen Kurse, trafen sich aber oft in ihrer Freizeit. Seine Freunde glaubten zu merken, dass Indreen sich nach ihr sehnte. Sein Schwarm reagierte nüchtern auf seine galanten Offerten, ihre Freundschaft weiter zu vertiefen. Für Michelle bedeutete ihr Dienst an den elternlosen Kindern mehr als ein Techtelmechtel mit ihrem ehemaligen Akademiekollegen. Indreen akzeptierte für sich längst Michelles Neigung zu ihrem Beruf. Auch wenn es für ihn nicht leicht erschien, sich damit abzufinden. Er tröstete sich mit seiner verantwortungsvollen Aufgabe, denn nicht jeder durfte in einem der Tompswaisenhäuser arbeiten. Der Rat der Sechs lud hierzu alle in Frage kommenden Personen zu sich ein und unterhielt sich mit ihnen unter vierzehn Augen. Auch Indreen erinnerte sich noch gut an seine Vorstellung beim Rat aufgrund seiner Bewerbung als Erzieher. Diese tiefgreifende Begegnung hätte er am Liebsten aus seinem Gedächtnis gelöscht. Aber sein Unterbewusstsein war gnadenlos mit ihm. In den Nächten, wenn er seine Wache hielt, träumte er ab und zu davon. In einem schummrigen Weiß sah er sich dann wieder dem Rat gegenüberstehen. Sie überreichten ihm die goldene Rüstung. Dazu hörte er allzu deutlich die Worte des Hausspruches in seinen Kopf nachhallen. Seither nahm er sich vor, nur nach vorne zusehen. Keinesfalls wollte Indreen weiter in seiner Vergangenheit leben und er glaubte fest daran, hier mit ihr am Besten fertig zu werden. Es machte den Pfleger glücklich, den Kindern bei ihrem Werdegang zuzusehen und er freute sich über jeden einzelnen Fortschritt, den sie schafften. Egal ob es ihre ersten Worte waren, oder der erste Schritt. Er fühlte sich, als wäre er ihr Vater und doch war er sich seiner Rolle bewusst, die er tatsächlich spielte.
Der Pfleger näherte sich nun der angenehm warmen Kammer, in der die Babyklappe ihre Funktion erfüllte. Dort konnte man unerkannt ein Kind abgeben. Niemand filmte oder überwachte die Abgebenden dabei, wenn sie ihren Nachwuchs hier herbrachten. Allerdings gab es ein verstecktes Fenster im Gebäude, das einen risikolosen Blick auf die Klappe von innen heraus ermöglichte. Um die Klappe zu betätigen, musste der Abgebende nur den bereitgestellten Korb hinter der Öffnung hervorholen, das Baby in den Korb hineinlegen und wieder durch die durch die Klappe schieben. Sobald sie sich schloss, löste sich die mechanische Glocke aus. Wie in dieser Nacht. Sie rief einen der Pfleger herbei, um sich dem Baby anzunehmen. Es kam auch vor, dass die Eltern sich nach der Abgabe wieder im Waisenhaus meldeten, um ihr Kind abzuholen. Wenn das geschah, dann wurden sie von den Angestellten des Waisenhauses aufopferungsvoll empfangen. Michelle kümmerte sich dann fürsorglich um die Eltern und versprach mit Rat und Tat bei ihrer Lebensaufgabe zu helfen.
Indreen seufzte, als er die Tür zu der Kammer öffnete. In seinem Geiste malte er sich ein kleines Bündel aus weißem Leinen in dem bereitgestellten Korb liegend aus. Der Pfleger trat über die Schwelle und ging auf den Korb zu. Er beobachtete das eingewickelte Knäul in ihm, dessen Atmung die Tücher auf und ab bewegten. Deutlich vernahm er die Geräusche der Luftzüge des elternlos Gewordenen, dass die ersten Lebensmomente auf diese Weise so unwirtlich zu spüren bekam.
„Na warte, mein Kleiner. Onkel Indreen ist schon bei dir“, sagte er Mut machend zu ihm und legte seine Hand an.
Indreen wog schon oft Babys mit seinen Händen. So wusste er in etwa ihre Größe und das Gewicht einzuschätzen. Nie und nimmer rechnete er damit, dass es bei diesem Kind anders war. Als er das Neugeborene aus dem Korb hob, glaubte er eine Feder in seinen Armen zu halten. Es wirkte, wie wenn das Kind reine Luft wäre.
„Was zum Henker …“, murmelte er überrascht, als er das Leichtgewicht in der Hand wiegte.
„Das gibt es ja nicht“, staunte er und schwenkte es ungläubig in den Armen. Bis zu den saphirblauen Augen, mit dem das Neugeborene ihn anblinzelte, reichte sein Blick nicht. Auch nicht in das sonnige Lächeln des rosigen Mundes, mit dem das Baby ihm ein „Hallo“ signalisierte. Seine Verwunderung über die kuriose Eigenschaft des Kindes war viel zu groß dafür.
„Bist du nur aus Pappmaschee? Du wiegst ja fast nichts. Das muss ich sofort Michelle zeigen.“
Hastend legte Indreen das Kind wieder in den Korb zurück und lief damit zu seinen Kolleginnen in den Aufnahmeraum. Michelle und Mildred richteten dort bereits alles für den Neuankömmling her. Maßband, Waage und das Wichtigste, der Achivierer. Indreen glaubte, während seines Weges durch die verwinkelten Gänge der Anstalt, einen leeren Korb zu tragen. Normalerweise besaßen Babys ein Gewicht von etwa dreieinhalb Kilo. Dieses hier wog nicht einmal halb so viel. Auch von der Größe her war es deutlich kleiner als alle anderen.
Mildred saß bereits am Archivierer, als Indreen ankam. Ihre langen, bereits mit grauen Strähnen durchzogenen Haare waren zu einem Dutt zusammengebunden. Ihre Frisur wirkte immer sehr geglättet. Das milchige Gesicht dazu zog bei der ganzen Prozedur eine steife Mine.
„Na Indreen“, begrüßte Michelle ihn ohne Umschweife und warf dem Korb in seinen Händen einen herausfordernden Blick zu. „Wen haben wir diesmal?“
„Leute“, haspelte Indreen mitgenommen, als er zur Tür herein stolperte und den Korb mit dem Kind auf der Arztliege abstellte. „Das ist unglaublich. Hebt es mal hoch. So etwas hab ich noch nicht erlebt.“
„Gut“, sagte Michelle beruhigend und nahm behutsam das Kind aus dem Korb in ihre Arme. Erstaunlicherweise blieb es ruhig und ließ sich von der rasanten Aufnahmeprozedur nicht beirren. Vielmehr nahmen seine Augen neugierig den Blickkontakt zu den Pflegern im Raum auf.
„Indreen“, fuhr Mildred dazwischen. „Hast du den Korb durchsucht? Manchmal lassen die Eltern Dinge zurück, damit sich die Kinder ihr restliches Leben lang den Kopf darüber zerbrechen können, wer ihre Eltern waren.“
„Äh, ja“, merkte Indreen auf. „Nur das Kind war drin. Sonst nichts.“
„Das ist ja unfassbar“, bestätigte Michelle erstaunt und runzelte die Stirn, nachdem auch sie sich von dem Fliegengewicht des Neuankömmlings überzeugte. Ihre Augen trafen sich mit dem Blick des Neugeborenen. Michelle glaubte, in einen tiefblauen Ozean zu blicken. So unergründlich und weit wie das Universum selbst kam es ihr vor. Sie glaubte, ein Leuchten darin spiegeln zu sehen. Gleich einer aufgehende Sonne.
„Es lebt tatsächlich. Nach normalen Maßstäben müsste es Tod sein. Für gewöhnlich bringt ein Baby etwa drei bis vier Kilo auf die Waage, aber dies hat ja nur …“, sagte sie verwundert und legte es in die Messingschale der Waage „... achthundertdreiundvierzig Gramm.“
„Also gut, dann notier ich mal achthundertdreiundvierzig“, bemerkte Mildred kühl und tippte kommentarlos das Gewicht des Kindes in das Archiviergerät ein. Ein lautes Tastenklappern erfüllte den Raum. „Weiter. Größe? Vergiss dieses Mal nicht, den Kopfumfang zu messen."
Michelle zog das Maßband hervor. Sie wickelte das Baby von den Leinentüchern auf, welches seltsamerweise keine Windel trug. Meist ließen die unbekannten Eltern dem Kind wenigstens dieses Kleidungsstück auf dem Leib. Dieses hier lag nur mit dem eingehüllt im Korb, was das Heim bereitstellte. Das Band legte sie zuerst um den Kopf und dann der Länge nach an.
„Einmal einundzwanzig Kopf und dann achtunddreißig Zentimeter Körperlänge“, sagte sie nicht ohne ihr Erstaunen zu verbergen. „Die Neuen sind sonst immer viel größer. Ist es etwa ein Frühchen? Aber das kann auch nicht sein. Ein Frühchen von dieser Größe und Gewicht kann nur in einer Geburtsklinik großgezogen werden. Normalerweise wäre es nicht überlebensfähig. Aber es scheint dennoch wohl auf zu sein.“
„Größe Kopf Einundzwanzig, Körperlänge Achtunddreißig“, wiederholte Mildred monoton und fragte nüchtern weiter: „Junge oder Mädchen?“
„Es ist ein … ein …“, murmelte Michelle noch über die eigenartigen Maße rätselnd und erwähnte das Geschlecht eher beiläufig dabei “, … ein Mädchen.“
„Gut, ein Mädchen, also“, sagte Mildred unberührt und nannte auch gleich den Namen ihres Neuzugangs. Der Archivierer vergab automatisch einen Namen, sosobald das Geschlecht feststand. Dies war in allen Tompswaisenhäusern der Erde schon seit der Gründerzeit so üblich.
„Also gut. Kore heißt sie, unsre Neue. Kore Tomps“, sagte Mildred zufrieden die Bildanzeige des Archivierers lesend und beendete ihre Eingabe.
Alle Waisenkinder hießen Tomps mit dem Nachnamen, weil der Waisenheimgründer Tomps die Patenschaft der Elternlosen übernahm. Diesen Namen konnten sie erst ab ihrem achtzehnten Lebensjahr abändern, wenn sie das Waisenhaus verließen oder wenn sie zuvor adoptiert wurden. Der Nachname Tomps verriet die Herkunft des Erdenbürgers. Etwas, das unzähligen Kindern zum Anstoß genügte, um über die elternlosen Sprösslinge herzuziehen.
„Ich fasse zusammen“, räusperte sich Mildred und las laut vor: „Heute dem 12. Tag des dritten Monats im Jahr 221 nach Tomps, wurde bei uns Kore Tomps über die Babyklappe abgegeben. Eltern unbekannt. Keine Gegenstände im Korb gefunden. Ihr Gewicht bei Aufnahme im Pressonwaisenhaus ist achthundertdreiundvierzig Gramm, Kopfumfang 21 Zentimeter, Körperlänge 38 Zentimeter. Gibt es weitere Besonderheiten an dem Kind, außer dass es nicht weint?“
Kore erschrak ob des harschen Tons, den Mildred anschlug und erfüllte alsbald den Raum mit einem lauten Flennen. Michelle versuchte die kleine Kore wieder zu beruhigen. Sie wog das Baby in ihren warmen Händen, was es wieder besänftigte. Kore kuschelte sich in ihren Oberkörper hinein, während sie dabei ihren Rücken zu Mildred drehte.
„Ah, zwei Narben auf der Kehrseite“, sagte Mildred mit ihrem scharfen Blick. „Knapp zwei Zentimeter groß. Längs auf gleicher Höhe unter den Schulterblättern.“
„Was? Das kannst du auf die Entfernung sehen?“, fragte Indreen erstaunt.
„Ja. Ich habe ein Auge für so was. Das Mal, das ich nicht sehe, muss erst erfunden werden“, antwortete Mildred salopp und ergänzte die Eintragung.
„Gut, dann wickle ich sie und lege sie in den Säuglingsraum. Indreen, du wirst zuerst Miss Conners von unserer Neuen unterrichten, bevor du dem Rat und den Magistrat über sie verständigst. Wie ich sie kenne, wird sie unsere Neue gleich ansehen wollen. Kore braucht jetzt erst mal Ruhe und viel Schlaf“, sagte Michelle aufopferungsvoll und ging mit ihr nach draußen. Indreen verdrehte nur verwundert den Kopf und dachte bei sich: „So ein eigenartiges Kind habe ich noch nie gesehen. Es ist so leicht und so klein. Aber was soll es, sich darüber Gedanken zu verlieren. Morgen ist auch noch ein Tag. Vielleicht wissen wir mehr, wenn der Doktor morgen kommt und sie eingehend untersucht hat.“
Indreen machte sich auf dem Weg zum Kontaktmikro auf dem Flur. Er betätigte die Taste für den Rufton in das Büro der Heimleiterin.
„Miss Conners“, meldete er sich. „Sind sie wach?“
„Ich bin wach. Was gibt es Indreen?“, antwortete Miss Conners wie aufgetaut. Sie schien aus ihren Gedanken gerissen worden zu sein.
„Wir haben eine Neue. Es ist ein Mädchen. Kore heißt sie. Kore Tomps. Miss Conners, sie müssen sie sich ansehen. Sie ist viel kleiner als die anderen Babys. Genau achtunddreißig Zentimeter und wiegt nur achthundert Gramm“, sagte er aufgeregt. „Michelle sagt, dass ein Baby mit diesen Werten normalerweise tot sein müsste.“
„Danke Indreen. Ich sehe sie mir gleich an. Und Indreen, sagen sie bitte dem Arzt wegen der Untersuchung morgen Bescheid.“
„Soll ich den Rat wegen des Kindes unterrichten? Die wird das bestimmt interessieren, zumal wir nicht wissen mit was wir es zu tun haben“, fragte er vorsichtshalber nach.
„Tun sie das“, sagte Miss Conners nachdenklich und fügte hinzu. „Mit dem Mädchen stimmt was nicht, das ist klar. Aber das Kind deswegen Sonderzubehandeln halte ich allerdings für falsch. Wer auch immer sie herbrachte. Ich ziehe sie genauso auf, wie jedes andere Kind, das den Weg in unsere Einrichtung findet. Sagen sie das dem Rat.“
„Jawohl, Miss Conners“, bestätigte Indreen und meldete sich ab.
Wie es Michelle vorhersah, ließ es Miss Conners sich nicht nehmen, auf Kore einen Blick zu werfen. Egal wie spät es schon war. Sie begab sich umgehend nach dem Gespräch zu Michelle. Der Pfleger brachte den Korb zurück und nahm sich vor, den Rest der Schicht vor sich hinzuduseln. Am nächsten Tag käme ohnehin der Arzt. Er nahm dem Kind mit dem pistolenartigen Transleptor Blut ab und impfte es mit seiner spritzenförmigen Serumatix. Eventuell erfuhren sie alle nach seiner Diagnose mehr über die seltsamen Eigenschaften und vielleicht sogar etwas über die Herkunft des eigenartigen Mädchens. Indreen dämmerte alsbald wieder in seinem Stuhl ein und ein leises Schnarchen erfüllte sogleich den Nachtdienstraum. Auf dem Flur herrschte nun wieder die unheimliche Stille, wie schon in den Nächten zuvor. Dennoch schreckte Indreen wenig später hoch, als er ein paar leise Atemzüge neben sich zu hören glaubte. Im Nu umrangen den Pfleger gut zwanzig Kinder unterschiedlichsten Alters, die vorwitzig auf ihren geliebten Erzieher starrten.
„Oh, ihr seid es Kinder. Zum Glück“, sagte Indreen erleichtert, als er seine vertrauten Waisen bemerkte. „Ich dachte schon, es wäre wieder so ein Vieh, das sich hier drin verirrt hat.“
„Was ist passiert?“, fragte ein etwa achtjähriges Mädchen neugierig stellvertretend aus der Gruppe.
„Ihr habt eine neue Schwester bekommen“, antwortete Indreen zufrieden.
„Welchen Namen hat der Computer ihr gegeben?“, fragte das Mädchen weiter.
„Sie heißt Kore. Er stammt, soweit ich weiß, aus dem griechischen Sagenkreis“, antwortete Indreen.
„Ja, das lese ich gerade im Mediaraum“, sagte ein weiteres der Waisenkinder. „In der Sage ist Kore die Tochter von Zeus, dem Göttervater und Demeter, der Fruchtbarkeitsgöttin. Ihr Name bedeutet übersetzt nichts anderes als Mädchen. Zeus widerstand ihrer anmutigen Schönheit nicht und schwängerte Kore. Sie bekam einen Sohn, der von Titanen zerfetzt wurde. Zeus nahm Rache und verwandelte sie alle zu Asche. Prometheus formte aus dieser Asche den Menschen, was nach der griechischen Sage, das Gute und Böse im Menschen erklärt. Hades, der Gott der Unterwelt, raubte später Kore und machte sie zu seiner Frau. Er gab ihr den Namen Persephone, jedoch wollte Demeter ihre Tochter wiederhaben und Hades gab sie nicht so ohne weiteres her. Die Götter einigten sich auf einen Kompromiss. Seither ist Kore neun Monate auf dem Olymp, was den Frühjahr, den Sommer und den Herbst beschert und drei Monate in der Unterwelt. Das erklärt den Winter. Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, trauert in dieser Zeit um ihre Tochter. Neun Monate lang heißt sie Kore und drei Monate Persephone.“
„Meine Güte, Harol, du weißt aber viel darüber“, lobte Indreen ihn anerkennend. „Ihr werdet sie morgen sehen, aber nun lasst mich und eure Schwester schlafen. Die Kleine braucht jetzt, wie ich, viel Ruhe“, sagte Indreen gähnend. Eigentlich wollte er ein Nickerchen machen, aber die Kinder waren auf den Geschmack gekommen, eine seiner improvisierten Erzählungen zu hören.
„Erzähl uns eine Geschichte“, bettelte daraufhin ein stämmiger Junge und die anderen stimmten wie im Chor das wichtigste Wort bei einem Gefallen ein: „Bitte.“
„Also schön. Wie ihr wollt“, murmelte Indreen müde und riss sich zusammen. Denn er wusste, dass ihn alle Kinder des Hauses für seine Geschichten liebten. „Aber dann geht ihr wieder in euer Bett. Versprecht es mir“, sagte er auffordernd.
„Versprochen“, sagten die Kinder aus einem Mund und lauschten gespannt, was Indreen sich heute Neues ausdachte.
„Etwas Schönes oder etwas Gruseliges?“, fragte er freundlich.
„Etwas Gruseliges“, sagten die Kinder voller Erwartung.
„Also etwas Gruseliges“, bestätigte Indreen den Wunsch und richtete sich auf. In seinem Kopf spulte sich der grobe Ablauf seiner Erzählung vor dem geistigen Auge ab und er begann, ein improvisiertes Stück zu schildern.
„Es war einmal ein einfacher Holzfäller. Er lebte in einer Blockhütte in einem großen Eichenwald so wie der, der unser Waisenhaus umgibt. Morgens, wenn die Sonne aufging, verließ er seine Heimstatt, fällte einen ausgewachsenen Baum und spaltete ihn zu Holzscheiten auf. Abends, wenn die Sonne sich hinter den Horizont senkte, kehrte er von der Arbeit zurück. Erschöpft zwar, doch glücklich den Tag gut überstanden zu haben. Obwohl er mit einer einfachen Axt seine Arbeit verrichtete und er sich enorm plagte, fühlte er sich glücklich. Den ganzen Tag stählte er an der frischen Luft seinen Körper durch seine mühselige Arbeit. Vor allem ging er einer Beschäftigung nach, die seine Seele erfüllte. Ihm kam es nicht in den Sinn, etwas daran zu verändern, denn dort, wo man sich wohl fühlt, da ist man wirklich glücklich. Dass der Holzfäller dem Wald jeden Tag einen Baum aus seinem Bestand nahm, war nicht schlimm. Zum einen verfügte der Wald über riesige Holzreserven. Zum anderen wuchsen mit der Zeit so viele junge Bäume nach, dass selbst nach dem Tod des Holzfällers der Wald noch größer wäre als zuvor. Eines Tages aber kam ein Mann aus dem Tal mit einer eleganten Gleiterlimousine zu ihm in den Wald. Er bot ihm ein neuartiges Gerät, eine Motorsäge an. Mit der könne er innerhalb der Zeit, in der er einen Baum mit der Axt zum Fällen benötigte, sechs Bäume fällen, sie zerlegen und zu Stapel verarbeiten. Die Arbeit ginge ihm spielend von der Hand, da die Motorsäge dank seiner scharfen Sägeblätter, mit bedeutend weniger Kraftaufwand von statten ging. Der einfältige Holzfäller kaufte dem Vertreter das Gerät ab und begeisterte sich schon bald dafür. Seine Arbeit flutschte wie von selbst von der Hand. Wie ein Berserker stürzte er sich auf die Bäume und zerlegte sie in Rekordzeit zu handlichen Holzstößen. Die giftigen Gase und der grässliche Lärm, den das Gerät absonderte, waren seinem ohnehin nicht bewandertem Verstand schädlich. So merkte der Holzfäller nicht, was er da eigentlich anrichtete. Er kannte ja auch keinen, der ihn darauf aufmerksam gemacht hätte. Er lebte einsam und abgeschottet von jeglicher Zivilisation. Wenn man mal von dem Holzhändler absah, der ihm das handelsfertig gespaltene Holz abkaufte. Von dem Verkauf des Holzes häufte sich der Waldmann ein beträchtliches Vermögen an, das auf irgendeinem Bankkonto in der Stadt vor sich hindümpelte. Das gab er aber nie aus, weil er seine Erfüllung in seiner Arbeit sah und alles, was er zum Leben brauchte, vor Ort in dem Wald fand. Wer gab freiwillig auf, was er am Liebsten tat? Der Wald litt unter dem zunehmenden Kahlschlag des Holzfällers, aber sein riesiger Baumbestand verkraftete diese Verluste spielend. Wenn der Holzfäller starb, wären immer noch genügend Bäume da, die die ihm beigebrachten Wunden durch ihre Samen heilten. Nach mehreren Monaten kam der Mann, der ihm die Motorsäge verkaufte, wieder und schlug ihm ein neues Geschäft vor. Seine Firma, die er vertrat, bot ihm eine einzigartige Innovation an. Den ultimativen Umhauer, wie sie ihn tauften. Mit ihm fegte man über den Wald, wie mit dem Rasenmäher über einen Gartenrasen. Mit seinen unzähligen Klingen und Messern schält und stapelt das Ding in Handumdrehen Hunderte von Bäumen pro Tag zu verkaufsfertig verpackter Brennholzware. Das vom Holzfäller auf dem Konto angesparte Geld könne er als Anzahlung für das Wunderwerk nehmen und der Rest machte sich durch den Verkauf des noch zu schlagenden Holzes verdient. Der Holzfäller, mittlerweile verdummt von seiner eintönigen Arbeit, den Gasen und dem Lärm der Motorsäge, ging auf den Handel ein und kaufte sich das einmalige Hochleistungsgerät. Er pflügte damit über den Wald wie ein Bauer mit dem Traktor über ein Getreidefeld bei der Ernte und rodete ihn in Nullkommanichts vollständig ab. Wofür der Wald Jahrhunderte brauchte, um sich aufzubauen, entstand innerhalb weniger Wochen eine kahle Einöde. Die Baumstümpfe glichen geköpfter Leichen. Aus ihren abgetrennten Hälsen sprudelte das Harz, wie Blut und vermochte nicht die schrecklichen Wunden zu heilen, die das Klingenmonster anrichtete. Wie es der Vertreter vorhersagte, reichte das Geld gerade aus, den Kauf des Gerätes vollends zu bezahlen. Das war es auch schon. Aber nun gab es weit und breit keine Bäume mehr, die er hätte fällen können. Wie ein Bettler musste er nun von der Sozialhilfe des Staates leben. Er selber war zu ungebildet und zu alt etwas anderes zu tun. So fand er kein neues Auskommen mehr. Zudem zerfraßen ihm die giftigen Gase und der Lärm das Gehirn, wodurch er nicht mehr alles wahrnahm, was um ihn herum passierte. Er verstand sich als Einziges nur auf das Bäumefällen. Von da an besaß der Holzfäller keine Beschäftigung mehr und saß trübsinnig in seiner Blockhütte herum. Es fröstelte ihn in der Einsamkeit seiner schlichten Behausung und er wurde senil. Nur ab und zu ging er nach draußen. Dann musste er wieder mit Wehmut an die alte Zeit denken. Er stellte sich im Geiste vor, wie es früher war, als der Wald da stand. Er erinnerte sich mit Freude daran, wie er mit der Axt bepackt fröhlich singend in den Wald ging. Dazu die gute Luft atmend und die Wildtiere und Vögel beobachtend. Nun standen tote Baumstümpfe herum, die den Humus nicht mehr hielten. Der Regen wusch die fruchtbare Erde weg und zurück blieb nur nacktes Gestein, auf dem keine Pflanzen mehr wurzelten. Im Winter pfiff Eiseskälte über das nun baumlose Plateau und im Sommer herrschte eine brütende Hitze. Die Sonne drang ungehindert auf den blank gewaschenen Fels und heizte ihn auf wie eine Herdplatte. Das Einzige, was in dieser Gegend so etwas wie einen Schatten spendete, war das Monstergerät mit seinen unzähligen Stahlmessern, Walzen und Sägeblättern neben seiner Hütte. Dieses Ding rostete nun langsam dahin. Genauso wie er jetzt auch. Verkaufen konnte er den Koloss nicht. Wer kauft schon einen Baumfäller, wenn es keinen Wald mehr gibt? Aber auch die Firma des Mannes im Tal, die ihm den Umhauer verkaufte, kam nicht ungeschoren davon. Durch die Rodung des Waldes hielt sich das Wasser bei Regengüssen nicht mehr im Erdreich. Es schwemmte, wozu es vorher Wochen durch den Erdboden brauchte, auf einem Schlag zu Tal. Der Fluss trat dort mit einer nie da gewesenen Schlammflut über die Ufer. Die Überschwemmung betonierte mit ihrem Schlick alles vernichtend ganze Dörfer und die Städte an seinem Lauf ein. Es entstand ein solch immenser Schaden, der den Kaufpreis des Umhauers um ein Vielfaches übertraf. Ganz zu schweigen von den zahllosen Tier- und Menschenleben, die das reißerische Hochwasser einforderte. Diejenigen die überlebten standen von heute auf morgen vor dem Nichts. Schlimme Seuchen, wie der Ausbruch des Infinityvirus, drohten wegen des verunreinigten Wassers und mancher zog von dem Unglücksort weg, um sein Überleben zu sichern.
Wir Menschen, Kinder, glauben oft, dass wir die Erde im Griff hätten, aber das ist ein fataler Irrtum. Wer unüberlegt in das Ökosystem der Natur eingreift, riskiert irreparable Folgen. Die Natur kann sich im Laufe der Jahrtausende wieder erholen. Wir Menschen aber haben diese Jahrtausende nicht. Dem sollten wir uns immer bewusst sein. Am Ende ergeht es uns wie dem Holzfäller. Wir sitzen auf einer kargen Einöde fest, die wir durch unsere Arroganz und Gier selbst geschaffen haben. Zunächst glauben wir daran, ein gutes Geschäft zu machen, was auch die Kunst des Betruges ist. Bald aber müssen wir feststellen, dass sie zu Lasten unserer Lebensgrundlage ging. Es gibt für uns keine Zukunft mehr und uns bleibt es nur, auf den Tod zu warten. So Kinder. Jetzt lasst es gut sein und nun schlaft schön. Bis Morgen früh dann“, beendete Indreen seine kurze Geschichte und scheuchte sie aus dem Dienstraum. Ruhig und leise gingen die Kinder aus dem Zimmer hinaus in ihre Betten. Leise diskutierten die Waisen lange in ihrer Stube über seine Geschichte. So wie jede Nacht, wenn er ihnen etwas zum Einschlafen erzählte. Indreen selbst fielen alsbald die Augen zu und er fand endlich einen gnädigen Schlaf.
Kapitel 2
Neko
Kore lugte neugierig durch das mit frischem Tau beschlagene Fenster hinaus. Ihr wissbegieriger Blick aus ihren unübersehbaren kristallblauen Augen fiel durch ihre dicht gelockte blonde Strähnenmähne. Er erfasste den Haupt-Haupteingang des Waisenhauses, der im tristen dampfigen Wetter an diesem Tag verschwommen erschien. Direkt neben dem Haupteingang befand sich die Babyklappe in der Wand eingelassen. Jener Klappe, durch die sie vor etwa vier Jahren in das Waisenhaus gelangte. Neugierig fragte sie heute Morgen Indreen, woher sie kam. Der Pfleger zeigte ihr die Babyklappe von dem Fenster aus, an dem sie jetzt stand. Dem Einzigen, von dem man von Innen heraus auf das Gebäudeteil mit der Klappe einsah. Indreen führte Kore anschließend in den Nebenraum beim Haupteingang und führte ihr den Korb mit der Decke vor. Schnell erfuhr das kleine Mädchen, dass es nicht hier geboren wurde. Woher sie stammte, hatte ihr keiner sagen können. Dabei interessierte sie sich ungemein dafür. Wie es so oft auch die anderen Kinder interessierte, wer ihre Eltern waren, von denen sie allerdings nie etwas erfuhren. Sie lief anschließend zu dem Sichtfenster zurück, an dem sie jetzt schon seit fast einer Viertelstunde in sich verharrend stand. Ihr Blick ruhte in sich gekehrt auf der Öffnung. Indreen mutmaßte nur, was in ihr vorging. Es musste das kleine Mädchen sehr bewegen, denn Kore befasste sich selten so lange mit einer Sache.
Seit ihrer Ankunft vor vier Jahren wurde er Zeuge ihrer atemberaubenden Entwicklung. An sich war es schon ungeheuerlich, wie schnell sich ein normales Kind in die Welt eingliederte. Angefangen von den ersten Laufversuchen und der Motorik des Greifens mit der Hand. Bei Kore aber geschah das viel schneller als er es bisher bei anderen Kindern kennenlernte. Am Meisten aber beeindruckte Indreen ihr reger Geist, der an Aufmerksamkeit alle anderen Kinder ihres Alters deutlich in den Schatten stellte.
„Dort also komm ich her?“, murmelte sie ergriffen, als Indreen von hinten zu ihr an das Fenster trat. Sie bemerkte ihren Lieblingspfleger, wie er zu ihr kam. Seine sanften Schritte waren Kore bestens vertraut.
„Mochte mich meine Mutter etwa nicht?“, fragte das kleine Mädchen sich traurig und sah fürchtend zu Indreen hoch, der nun neben ihr stand.
„Wer weiß das schon. Niemand kennt den wahren Grund, warum hier ein Kind abgegeben wird“, sagte Indreen verständnisvoll.
„Wir können es nur vermuten. Wichtig ist doch viel mehr, dass es dich gibt und dass du am Geschenk des Lebens teilhaben kannst. Nicht viele Kinder haben das Glück bis zu uns zu kommen. Es gibt viele verzweifelte Eltern, die ihren ihren Nachwuchs verschwinden lassen oder sogar töten, bevor sie ihn hier herbringen“, antwortete Indreen, doch Kore gewann den Eindruck, das Indreen mehr darüber wusste. Sie fragte ihn dennoch nicht weiter über das rätselhafte Verschwinden der Kinder aus. Vielmehr richtete sich ihre Neugierde auf ein Wort, das sie nicht kannte.
„Sie töten sie?“, fragte Kore aufhorchend, während sie noch immer auf den Eingang starrte. „Was ist Töten?“
Sie wandte interessiert ihren Blick zu Indreen empor, durch dessen Gedanken derweil alle möglichen Erklärungsformen für dieses Wort huschten. Aber wie vermittelt man einer Vierjährigen mit einfachen Worten, was man unter Totschlag versteht?
„Töten tut jemand, der einem anderen das Leben nimmt“, begann er vorsichtig. „Ich meine damit, dass man das wird, was die Blätter der Bäume im Herbst werden“, erklärte Indreen mit dem Versuch ein anschauliches Beispiel anzuführen.
„Sie welken?“, fragte Kore sich das vertraute Herbstbild des Eichenhains ins Gedächtnis holend.
„Nicht ganz. Sie kehren viel früher, als es Zeit wäre in den Schoß der Erde zurück“, sagte Indreen. „Es ist bei ihnen so, dass sie schon zu Beginn des Frühlings gewaltsam aus den Zweigen gerissen werden. Sie müssen verwelken, ehe sie den Sommer gesehen haben“, seufzte er traurig.
„Das ist schlimm“, sagte Kore erzitternd.





























