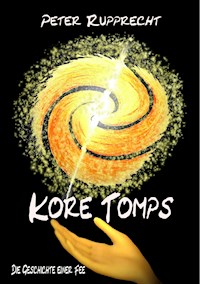2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Beim Absuchen des Strandes nach Fundstücken finden Miro und Raissa einen mysteriösen Schiffbrüchigen, der sie mit einem teuflischen Erbe aus der Vergangenheit des Planeten konfrontiert. Dabei geraten die Geschwister in ein grausiges Abenteuer, das sie zwingt, Hals über Kopf von ihrer Insel zu fliehen. Ziemlich bald bekommen sie nicht nur hautnah zu spüren, dass sie es mit einem Verfolger zu tun haben, der im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Wassern gewaschen ist, sondern auch, was es heißt ein Mensch zu sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Diese Geschichte ist rein fiktiv. Ich lege größten Wert darauf keinen Bezug zu aktuellen Tagesgeschehen, Orten, Themen oder Personen herzustellen.
Mein Dank gilt allen Personen und Ereignissen, die diesem Buch zur Geburt verholfen haben.
Peter Rupprecht
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Fremdes Blut
Kapitel 2 Noha
Kapitel 3 Coogan
Kapitel 4 Excalibur
Kapitel 5 Aaron
Kapitel 6 Nuri
Kapitel 7 K I
Kapitel 8 Coals Vermächtnis
Kapitel 9 Götterdämmerung
Kapitel 10 Nachwort
Die Mathematik kommt dem göttlichen Denken am Nächsten. (Roger Bacon, Opus maius)
Prolog
Am Anfang, da war Raja, die goldene Scheibe des ewigen Himmels und Gaia, die fruchtbare Mutter Erde. Sie liebten einander sehr und zogen dadurch den heimtückischen Neid von Gaias Schwester Nuri, dem weiten und tiefen Ozean auf sich. Sie missgönnte ihre Liebe zueinander und schob sich mit ihrem dunstigen Leib zwischen ihnen. Nuri machte der Erdenmutter weis, dass Rajas Licht sie schwächen und krank macht. Denn überall, wo dessen Segen auf Gaias Haut traf, bekam sie tiefe Risse in ihrer Haut und vertrocknete. Nur wenn sie sich wie eine Tänzerin um die eigene Achse drehe, entginge sie ihrem grausamen Schicksal sich in eine leblose Sandwüste zu verwandeln. Zu ihrem Schutz webte Nuri für Gaia einen dichten weißen Schleier aus ihrem Blut. Mit dem feinen Stoff hüllte Nuri Gaia ein und erklärte ihr: „Dieser Schleier verleiht dir erhabene Schönheit und vor allem schützt er vor dem Licht und den begehrlichen Blicken der vielen Brüder, die mit Raja im Himmel sind. Denn du sollst für ewig sein bleiben.“
Doch als Gaia sich Raja in ihrem neuen Schleier zeigte, reagierte ihr Geliebter verwirrt. Er fragte sie: „Warum verhüllst du dich vor mir? Schämst du dich etwa deiner Gestalt? Ich liebe dich, wie du bist und ich liebe es vor allem, dich in deiner Pracht mit deinen wunderschönen Farben leuchten zusehen.“
Die Erdenmutter geriet in großer Verlegenheit ob seiner bewundernden Worte. Um ihrem Liebsten nicht vorzuwerfen, dass es an seiner Energie lag, weswegen sie sich hinter dem Schleier verbarg, antwortete sie ihm: „Das tue ich, damit auch deine Brüder wissen, dass ich dich begehre und sonst niemanden. In meinem Schleier tanze ich für dich und hin und wieder werde ich Teile davon lüften, damit ich dir weiterhin wohl gefalle. Nur was verhüllt ist, behält seinen Reiz.“
So ganz gab sich Raja mit ihrer Antwort nicht zufrieden, denn auch er schämte sich aufgrund seiner Blöße nicht.
„Gaia“, sagte er darauf hin. „Meine Liebe zu dir ist stark. Wenn du dich hinter einem Schleier aus Nebel verbirgst, wie kannst du meine Berührung, ja meine Liebe zu dir noch spüren?“
Gaia sah ein, dass ihr Liebster Recht hatte. Sie vermisste seine zarten Berührungen doch sehr. Das konnte nicht so bleiben.
„Gib mir deinen Samen“, antwortete Gaia ihm daraufhin. „Ihn will ich in meinem Bauch aufnehmen und sie zu dir in den Himmel austreiben lassen. So wird dein Geist und deine Berührung in Form deiner Kinder auf mir sein.“
Um den Samen ihres Liebsten zu empfangen, lüftete Gaia ihren Schleier über einen Flecken ihrer Haut, dem sie den Namen Noha gab. Dies Eiland lag inmitten des von Nuri beherrschten Ozeans. Dorthin schickte Raja seine zahlreichen Samen aus. Große und Kleine befanden sich darunter. Manche von ihnen überstiegen nicht die Größe eines Staubkorns. Sie gelangten auf die auserwählte Insel, nisteten sich dort in Gaias Haut ein. Nie vergaßen die Keimlinge ihre Herkunft und trieben ihre Köpfe zu ihrem Vater Raja in den Himmel hinauf. Aus diesen Sprossen erwuchs alles, was es heute auf dieser Insel gibt. Die immergrünen Bäume und die Sträucher des Lebens mit all ihren leuchtenden Blättern, Blüten und Früchten. Mit ihrem süßlichen Nektar, ihrer duftenden Harze und ihren heilenden Wurzeln. Den würzigen Gräsern, den tiefgrünen Algen und den Geschöpfen der Genesung. All dies fand auf dem Eiland Platz und der Erdenmutter Gaia tat dies sichtlich wohl. Mit großem Stolz säugte sie seine Früchte mit ihren Schätzen und trug sie aus, bis auch sie wiederum ihren Samen abgaben. Ihr kam es vor, als gäbe es die Barriere des weißen Schleiers zwischen ihnen nicht mehr.
So stellte sich Nuri das nicht vor. Im Gegenteil, sie wurde sehr wütend darüber, dass ihr Plan drohte, zu misslingen. In ihrem Zorn entfesselte sie einen mächtigen Orkan mit starken Winden und fegte mit ihnen über die Insel Noha hinweg. Alles in der Hoffnung, der Hurrican würde der Haut Gaias die Geschenke ihres Liebsten entreißen. Als Raja aber bemerkte, dass ein großer Sturm unter dem aufgewühlten Schleier Gaias tobte, griff er hastig ein. In seiner Eile trieb er eine dünne Nadel durch ihre dichte Wolkendecke. Er tat dies in der Absicht, jenen Orkan damit abzuschwächen, der seine Kinder auf der Insel bedrohte. Doch da Gaia sich drehte, verfehlte Raja sein Ziel. Auch die dunstige Nuri wich seiner Attacke gekonnt aus und so fand sich Rajas Nadelspitze stattdessen tief im Fleisch Gaias wieder. Sie schrie vor Schmerzen auf, weshalb sich Nuri´s Winde laut kichernd zurückzogen. Die wähnte Rivalin sich am Ziel, denn nun, so dachte sie, wären sie endgültig getrennt. Aber Raja tat es schrecklich leid, als er sah, was er da in seiner unbedachten Handlung anrichtete. Er entschuldigte sich aufrichtig bei Gaia, wollte er doch seinen Samen, seine Kinder vor dem Zorn des Ozeans bewahren. Er schaffte es nicht, die Nadel wieder aus ihrem Leib zu ziehen. Dazu war sie viel zu fein und steckte zu tief darin, weshalb sie sich auch heute noch tief im Körper seiner Geliebten befindet. Gaias Liebe zu ihm war aber so groß, dass sie ihm nicht nur verzieh, sondern ihrerseits eine weitere Lebensform aus ihrem Schoß gebar. Alles in der Absicht, durch ihre Gabe den Samen ihres Geliebten vor dem Zorn Nuris zu schützen.
Direkt aus Gaias Schoß, so hieß es, stiegen einst die 98 Urväter und Mütter der heutigen Insulaner auf Noha aus ihrem Bauch. Sie wussten um den Wert von Rajas Samen und seinem damit verbundenen Erbe. Wie ehedem hegen und pflegen sie ihn sorgsam, leben sie von und mit ihm. Auch zeugen und gebären sie ihrerseits Kinder. Genauso, wie es auch Gaia mit dem Samen Rajas jeden Tag aufs Neue tut …
Kapitel 1
Fremdes Blut
„Sir …“, hallte eine mittlerweile vertraute männliche Stimme laut durch Raissas Traum. Sie erklang auffordernd. Immer, wenn Raissa einschlief, wiederholte sich das folgende Nachterlebnis aufs Neue. Gleich der Endlosschleife eines Ohrwurms, der stoisch und berechenbar nicht mehr aus ihrem Kopf ging. So etwas kannte Raissa bisher nur von den Gesängen und Riten der Insulaner auf Noha, wenn sie sich am Abend zur Unterhaltung und zum Tanz auf dem Dorfplatz in Mitten ihrer kleinen Siedlung trafen. Dann entzündeten sie in der Dämmerung ein großes Feuer aus den Schalen der geernteten Kokosnüsse und spielten mit selbst gemachten Instrumenten, wie Trommeln, Flöten und Rasseln das musische Erbe ihrer Vorfahren auf. Dies hieß nicht, dass es besonders viele Legenden in ihrer Mythologie gäbe, die sich mit ihnen künstlerisch untermalen ließen. Sicher, da gab es die Geschichten und Lieder, die den Schöpfungsmythos des Sonnengottes Raja, der Erdenmutter Gaia und ihrer Schwester, der missgünstigen Meeresgöttin Nuri zum Thema besaß. Selbst die Ballade von der Reise der Kokosnuss über die stürmische See, die vor allem ihren Bruder Miro begeisterte, war von ganz anderer Art als ihr Traum. Er passte nicht im Entferntesten dazu. Seinen immer gleichen Handlungsstrang kannte die junge Frau mittlerweile mit jeder Kleinigkeit so in und auswendig, dass er ihr bereits zum Halse heraushing. Gleich eines nicht endenwollenden Fluches.
„Sir ...“ wiederholte sich erneut das Wort, was Raissas Blick, wie jede Nacht zuerst nach dem Rufer sehen ließ. Doch irgendwie gelang ihr das im ersten Anlauf nie so recht, obwohl sie sich dauernd vornahm, es mit jedem neuen Einsetzen zu versuchen. Es schien, als übernahm ein anderer die Führung in der Szene und sie verdammte sich zu einer reinen Beobachterin der weiteren Ereignisse.
„Bolton“, antwortete ihm Raissa erst jetzt, obwohl noch nie von dieser Person je zuvor hörte. Ja, sie war sich sogar sicher, dass sie selbst nicht einmal in dem Leib der handelnden Person steckte, welche mit seinem Wort wie ferngesteuert auf diesem Mann einging. Erst im zweiten Anlauf gelangte Raissas Blick auf jenem ominösen Rufer Bolton. Dieser hochgewachsene Herr mittleren Alters stach mit seiner wohl geordneten Langhaarfrisur heraus. Sein Äußeres bildete einen krassen Gegensatz zu dem Auftreten ihres Volkes. Sofort bemerkte Raissa die ungewöhnliche Gepflegtheit seiner glänzenden schwarzen Haare. Auf Noha frisierte sich niemand sein Haupthaar so akkurat wie er. Keiner glättete und färbte sie auch so. Auf Grund der Dauerschleife sah sie ihm das so nach und nach an. Auch dessen Kleidung stammte nicht von der Weberei der Insel, in der ihre Mutter um diese Zeit Laken aus Hanffasern fertigte. Auf Noha durchsetzten sich die Gewebe grobmaschiger und nicht mit so kräftigen Farben, wie sie dieser Bolton trug. Man färbte auf Noha die Fasern der Hanfballen lediglich mit Erdtönen, die aber an Leuchtkraft nicht an die Tiefe von Boltons Kleidung heranreichte. Dessen Kluft hielt sich vollkommen in schwarz bis zum Halsansatz und sie knüpfte sich zu dem sehr eng an seinem Körper. Die Verarbeitung seiner Kleidung erreichte eine höhere Qualität, als es je eine Hand auf Noha zu tun vermochte. Daher erkannte sie sofort, dass sich diese Szene nicht auf der Insel abspielte. Auch fiel ihr auf, dass er im Gesicht nicht einmal einen Bartansatz trug. Auf Noha enthaarten sich die Männer nie so glatt im Gesicht wie er. Wie bekam dieser Bolton das bloß hin? Er nahm doch nicht etwa den kostbaren Honig dafür her? Jener, mit dem sie ihre Wunden verbanden und nutzten, wenn jemand erkrankte? Nein, er stammte nicht von ihrer Insel. Woher kam er dann? Und wo befand sie sich hier eigentlich? Der Raum, in dem sich ihr Avatar aufhielt, besaß so gar nichts mit den Räumlichkeiten ihrer Insel gemein. Alleine die hellgelb getünchten Wände des Raumes verrieten, dass es sich um ein gemauertes oder gar gegossenes Gebäude handelte. Etwas, dass es so auf Noha nur in der Zuflucht gab oder bei dem seltsamen Steinring über dem Höhleneingang. Doch der Traum zog sie ohne innezuhalten weiter in der Handlung vorwärts.
„Ihre User warten auf sie. Es wird Zeit die Katze aus dem Sack zu lassen“, fuhr dieser Bolton unvermindert fort. Schon diese zwei Sätze ließen Raissa nächtelang über seine Bedeutung grübeln. Was war ein User und was war eine Katze? Was ein Sack war, wusste sie, aber die beiden anderen Begriffe, entzogen sich gänzlich ihrer Vorstellung. Sie vermutete bald, dass es sich um eine Redewendung handelte, deren Bedeutung sie im Augenblick nicht verstand.
„Du hast Recht, mein lieber Bolton. Dieser Tag wird in die Geschichte unserer Art eingehen, auch wenn es die Lieben da draußen noch nicht im Entferntesten erahnen.“
Die Stimme Raissas im Traum klang erneut unzweifelhaft männlich. Sogar mit einem erstaunlich weichen Klang. Pfiffig und entspannt drangen die Worte ihres Avatars durch ihr Ohr. Irgendwie besaß ihr anderes Ich etwas Charmantes. Einnehmendes. Begeisterndes. Wie konnte sie im Körper eines Mannes stecken, ohne sich wie ein Mann zu fühlen? Was war das für ein seltsames Gefüge? Vor ihrem Unfall im Palmenhain träumte sie ganz anders. Da fühlte sie in den Handlungen ihrer Träume deutlich ihren weiblichen Körper. Nun aber schaltete sich diese Empfindung aus. Auch inhaltlich unterschieden sich ihre früheren Träume deutlich von dem hier. Dazu lief er viel zu geordnet ab.
„Wie viel Zeit wird uns noch bleiben?“, merkte Bolton fragend an, doch der Avatar, in dem Raissa zwangsläufig feststeckte, überging seine Frage gezielt. Sie spürte das deutlich. Schnell warf sie anstatt dessen einen Blick in ein Ding, der als eine Art Spiegel fungierte. Es zeigte seinen ganzen Körper, der in einer ähnlichen Kleidung steckte, wie die von Bolton. Nur hielt sich seine Kluft ganz in Weiß. Einen Ganzkörperspiegel dieser Größe gab es auf Noha nicht. Ihr Schmied Ragnar fertigte auf Wunsch allenfalls glatt polierte Handspiegel aus Metall an. Wer aber seinen vollständigen Körper von oben bis unten betrachten wollte, ging bei ruhiger See an den Strand oder suchte die Algenbassins auf, in dem die Insulaner ihren Wassersalat zogen. Der große Spiegel zeigte ihr einen kahlgeschorenen Mann mit einem gläsernen Aufsatz vor seinen Augen. Raissa vermutete, dass es als eine Art Vergrößerungsglas diente. Im Dorf verwendete man solche Linsen, um Holzsplitter aus der Haut zu entfernen oder wenn es darum ging, einen fein gesponnenen Faden durch eine kleine Öse zu zwängen. Am oberen Eck des seltsamen Spiegels zeigte sich ein Ausschnitt mit einer riesigen Menschenmenge. Jedenfalls kam die Menschenmenge für Raissa riesig vor. Sie skandierte und johlte. Weswegen die Menge so euphorisch reagierte erfuhr Raissa auch im Rest des Traumes nicht. Ebenso fiel Raissa ein Emblem auf, das ihr Avatar am Revers seines weißen Anzuges befestigte. Mit ihm betrachtete er sich in dem großen Spiegel. Er deutete auf dieses Symbol. Es zeigte zwei waagrecht gelagerte Wellen in roter und blauer Farbe, die zwei senkrechte Wellen in gelber und grüner Farbe durchschnitten. Ihr Avatar grinste dabei triumphierend wie ein Sieger in den Spiegel hinein, während er sich so etwas wie ein fein gewebtes Band mit einem silbernen Saum um seinen schmalen Hals schnürte. Dann strich er sich einmal mit einem Tuch über seine Stirn, um die sich dort bildenden Schweißperlen abzuwischen. Mit einem Lächeln zeigte er, dass er mit seinem Aussehen zufrieden war. Dann wandte er sich von dem Spiegel ab und ging auf einen weißen Vorhang zu.
So etwas Ähnliches kannte Raissa hingegen auch von den Eingängen der Basthütten in ihrer Siedlung. Man verwendete sie, damit keine der Insekten sich in den Behausungen verirrten. Ihr Avatar holte einmal kurz Luft und schob den dünnen Behang zur Seite. Helles Licht von der anderen Seite traf auf ihre Augen. Auf der anderen Seite des Vorhangs zeigten sich der Träumenden sogleich grelle Blitze. Ähnlich denen von Nuri bei Sturm. Nur, dass sich hier keine Wolken zeigten. Über ihr befand sich anstatt dessen ein tiefes Blau, während sie in der Ferne jene goldene Scheibe ausmachte, die sie im Schrein ihres Dorfes als ihren Vater Raja verehrten. Die große goldene Scheibe. Unverhüllt, strahlend und vor allem frei von Gaias Schleier präsentierte sich hier der Sonnengott. Deutlich zeigte er sich über einem hohen Klotz mit vielen viereckigen Gläsern, der sich wie ein dicker Pfahl in den endlos erscheinenden Himmel bohrte. Handelte es sich etwa dabei um die legendäre Himmelsnadel aus dem Schöpfungsmythos ihres Volkes? Wohl nicht, denn die Legende schilderte sie als sehr dünn. Ihrem Auge entgingen auch die hohen Berge in der Ferne nicht. Das Aufblitzen der seltsamen grellen Lichter riss nicht ab. Eindeutig gingen diese Blitze von der riesigen skandierenden Menschenmenge aus, die sie vorhin im Ausschnitt des großen Spiegels bemerkte. Sie standen hinter einer hüfthohen eisernen Barriere, vor der weitere Menschen in schwarzen Kleidern so etwas wie Wache standen. Auch sie trugen blitzende Dinger bei sich. So viele Leute auf einmal sah Raissa noch nie in ihrem Leben. Auf Noha lebten, trotz aller Bemühungen die Population weiter anzuheben, gerade mal knapp über hundert Menschen. Doch hier ging es weit in die Tausende hinein. Sie gebärdeten sich auf dem Platz so aufgewühlt, wie die wilden Bienen, die Großvater Jockel im Tal der Blüten betreute. Die herbeigeeilte Masse umjubelte diesen Mann im weißen Anzug, wie wenn er Raja höchstpersönlich wäre. Sichtlich glücklich schritt der Hochgepriesene auf die begeisterte Menge zu, die Bolton schlicht die „User“ nannte. Was auch dieser Begriff bedeutete. Die Begeisterten wiederholten unablässig ein Wort, das Raissa zuerst nicht verstand.
„Coal, Coal“, riefen sie unablässig wie im Chor.
Ihr Leihkörper trat an die erste Reihe der Menge heran und reichte einigen die Hände. Die Wenigen, die er erreichte, schüttelten sie begierig. Raissa fühlte regelrecht den Glücksrausch, der in ihrer vermeintlichen Figur während seiner Begrüßung aufstieg. Er genoss es und dennoch fühlte sie, dass eine gewisse Bitternis darin steckte. Worüber und worauf, sie wusste es nicht. Soweit spürte sie dann doch nicht in ihn hinein. Dann erreichte er ein Pult, auf dem ein langer dicker Stahldraht herauslugte. An seinem Ende beulte sich eine Art Fingerhut. Das Ding wirkte zuerst so für Raissa, aber seine Funktion diente zur Verstärkung der Stimme. Coal zog ihn aus der Halterung heraus und pustete kurz hinein. Nun machte ihr Traum einen kleinen, unmerklichen Sprung. Als Raissa diesen Traum zum ersten Mal erfuhr, fiel ihr das nicht auf. Doch mit jeder Wiederholung des Traumes bekam sie den Eindruck, dass da im Ablauf etwas fehlte. Sie befand sich zwar weiterhin im Körper von Coal, jedoch veränderte dieser schlagartig seine Körperhaltung. Raissa fiel an dieser Stelle nie auf, dass er sich auch dorthin bewegte, wo sie sich wieder in ihm fand. Man hörte dieses Geräusch des Pustens überdeutlich. Offenbar eine Art Stimmenverstärker, denn sogleich hieß dieser Coal die Menge mit warmherzigen Worten willkommen. Ihrem Avatar fiel es nicht leicht, sich inmitten der ausgelassenen Euphorie Gehör zu verschaffen.
„Meine lieben Freunde“, begann er, während ihn vereinzelte Rufe hochleben ließen, aber sogleich darauf verstummten, weil sie gierig seinen Worten lauschten. Er wiederholte seine Worte nochmals „Meine lieben Freunde. Ich heiße euch herzlich auf dem Gelände der Coal-Solution University willkommen. Nach so vielen Jahren der Entwicklung ist es heute soweit. Das alles wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Dafür sage ich euch herzlich Danke.“
Ein unvergleichlicher Jubel toste über den Redner hinweg. Gleich eines sintflutartigen Orkans, den Nuri hin und wieder über ihre Insel Noha brachte.
„Ohne Zweifel ist dieser Tag als historisch zu betrachten. Denn heute präsentiere ich euch den ersten, den ultimativen Durchbruch der IT Geschichte.“
Raissa verstand von alledem kein Wort. Seine Worte lösten allerdings Begeisterungsstürme bei den sogenannten Usern aus. Andauernd johlten die Menschen anfeuernde Sprechchöre der Begeisterung. Immer wieder kamen die anfeuernden Rufe: „Coal, Coal“, darin vor.
„Es wird unserem Slogan gerecht. Dem Motto, unter dem das ganze Unternehmen seit vielen Jahren erfolgreich arbeitet. Seit es von meinem Vater gegründet wurde, ist es bestrebt, eine Alternative zu sein. Erfolg ist keine Frage von Größe ...“
Plötzlich riss Raissas Traum ab, denn ein starkes Rütteln durchfuhr ihren Körper. Die ruppige Stimme ihres Bruders Miro drang in ihr Ohr.
„Wach endlich auf“, rüttelte Miro ungeduldig ihren Körper durch, als Raissa endlich ihre Augen aufschlug. Die junge Frau wusste zunächst nicht, wie ihr geschah. Sie gähnte erst einmal kräftig und versuchte als Erstes sich in ihrem bescheidenen Nachtlager die Glieder vom Leib zu strecken. Doch Miro beugte sich zu tief über ihren Körper, was dies zunächst verhinderte.
„Was ist denn los?“ stöhnte sie und drückte mit einem Ruck genervt ihren Bruder zur Seite. Sie konnte es nicht leiden, wenn er ihr so dicht beim Aufwachen auf die Pelle rückte.
„Der Sturm hat sich gelegt. Lass uns den Strand absuchen, ehe es sich Nuri anders überlegt.“
Raissa ächzte müde auf. Obwohl Miro schon der erste Flaum im Gesicht wuchs, bremste sich sein kindlicher Erforscherdrang nicht aus.
„Wo ist Mutter?“, fragte sie gähnend und rieb sich erst einmal den Schlaf aus den Augen.
„Sie ist schon in der Weberei. Komm, wer weiß, wie lange Nuri uns Zeit lässt, den Strand abzusuchen. Lass mich dir beim Anziehen helfen.“
Miro zog die Decke aus Hanffasern von ihrem Körper und faltete sie zu zusammen. Raissa stand derweil tapsig auf, um sich erst einmal mit einem hölzernen Eimer lauwarmen Wassers beim Waschbassin zu übergießen. Diese erfrischende Dusche schüttelte sie durch und allmählich füllten sich ihre müden Glieder mit Leben. Dann schob sie den Vorhang am Fenster ihrer Basthütte zur Seite, damit mehr Licht in das Innere fiel. Heute war es, im Gegensatz zu den meisten Tagen, draußen angenehm warm. Oft lag eine tropische Hitze über der ganzen Insel, was sie und ihre Mitbewohner tagsüber träge und müde machte.
Ihre Mutter stellte für sie zwei Hanfbrötchen zum Frühstück auf ihrem Flechttisch bereit. Sie riss sich ein Stückchen davon ab und tauchte es in das bereitgestellte Kokosmus. Daneben strich sie sich etwas Honig vom Rosastrauch mit einem Holzspatel darauf. Genussvoll biss Raissa in das knusprige Brötchenstück hinein, während Miro mit ihr weiter sprach und sich eine Hanftasche für ihre Fundsachen umhängte. Man wusste nie, was sich so alles nach einer unruhigen See am Strand finden ließ.
„Wenn wir Glück haben, lüftet sogar Gaia ihren Schleier. Dann kann ich Ragnar beim Starten des Segelfliegers helfen.“
„Nun werde mal nicht übermütig“, versuchte Raissa seine Begeisterung für das gute Wetter zu bremsen. Verglichen mit den meisten Tagen auf der Insel, war es heute ausgesprochen hell. Auch wenn sich Raja nicht direkt zeigte. Meist hingen dunstige Wolken über Noha, was die Tage ansonsten trüb und trist machte. Raissa zog sich ihrerseits ein frisches Hanflaken mit einem Ausschnitt für ihre Hände und dem Kopf über ihren schlanken Körper, das sie mit einer geflochtenen Kordel um ihre Hüfte fixierte. Es verdeckte dezent ihre üppigen Brüste. Zu gerne hätte sie jetzt jenen großen Spiegel gehabt, mit dem sich Coal in ihrem Traum auf seinen Auftritt vor den Usern vorbereitete. Sie drehte sich anstatt dessen zu Miro um und fragte ihn als Spiegelersatz: „Na, wie seh ich aus?“
„Gut soweit, aber wenn du noch deine Haare hättest …“
Raissa seufzte wehleidig.
Das traurige Thema, das Miro so direkt ansprach, war das wohl schlimmste Erlebnis, das Raissa in ihrer jüngsten Vergangenheit überstand. Früher nannte sie wunderschöne blonde Haare ihr Eigen. Nun aber besaß sie einen kahlen Schädel, auf dessen Mitte gleich einer Narbe verfüllt, eine giftgrüne Substanz dauerhaft ihre Bleibe fand. Ihre Haare versuchten außerhalb der Narbe vergeblich wieder zu sprießen, fielen aber nach ein paar Zentimetern erneut ab. Raissa spürte keine körperlichen Schmerzen in ihrem Schädel mehr, doch wenn ihre Umgebung sie auf ihr unübersehbares Mal ansprach, dann durchzuckte sie es, als sei er allgegenwärtig. Raissa liebte ihre Haare. Vor dem Unfall pflegte sie ihre Frisur penibel mit dem Öl aus den Kokosnüssen, was sie weich und geschmeidig machte. Auch Miro fand sie wunderschön, doch an dem Tag, als sie bei der Ernte von einer Kokospalme fiel, geschah es um sie.
„… wenn die Äbtissin nicht gewesen wäre …“, fuhr Miro sie tröstend fort, „… dann könntest du mir diese Frage nicht mehr stellen. Ich hatte solche Angst um dich, als du mit deinem Kopf auf den Stein aufschlugst. Wir hätten dich sonst Nuri übergeben müssen. Vielleicht wachsen sie ja wieder nach.“
„Das will ich doch hoffen. Diese Schmerzen vergesse ich nie. Die Äbtissin rettete mich, aber seither verfolgt mich dieser seltsame Traum. Ich hatte ihn vorhin schon wieder.“
„Du meinst den anderen Kahlschädel?“, antwortete Miro. Auch er kannte Raissas Traum schon auswendig. Raissa erzählte ihm bereits ausführlich davon. Genauso wie den anderen Dorfbewohnern. Aber niemand, nicht einmal die Äbtissin Marsha machte sich einen Reim auf seine Bedeutung. Es kam nicht selten vor, dass man das Oberhaupt ihrer Gemeinde mit Traumfragen konfrontierte. Sahen doch die Insulaner in den Träumen verborgene Wünsche und Sehnsüchte, denen es sich im Leben zu stellen galt.
„Es wirkt so lebensnah. Als ob ich er wäre. Ich glaube, dass es mit dem grünen Zeugs in meinem Schädel zu tun hat …“ „… dem du dein Leben verdankst. Der Verlust deiner Haare ist da ein kleines Opfer. Na ja und dann träumst du halt ab und zu den gleichen Traum. Denke einfach an die Geschichte der Kokosnuss. Das gibt dir Kraft jede noch so schlimme Lage zu überstehen.“ Miros ungebremster Optimismus die Welt zu sehen erheiterte Raissa. Die Legende, auf die Miro anspielte, erzählte ihm Ragnar einmal bei seiner Bastelei im Hangar unweit der Zuflucht. Damals werkelte der Schmied mit dem Jungen an seinem Fluggefährt herum und Miro stellte ihm viele Fragen über die Luftströme und die Technik, die den Flieger stabil in der Luft hielt. Er hoffte insgeheim, einmal selbst am Steuer des Luftgefährts zu sitzen und sich von Nuris Winden in die Höhe treiben zu lassen. Der Segelgleiter war Ragnars größter Schatz. In ihn steckte er sein ganzes Herzblut hinein. Vielleicht aus dem Antrieb heraus, die die Ballade von der Kokosnuss und dem Meer verhieß.
„Als Raja seiner Geliebten Gaia die Samen aller Wesen der Welt schickte, kam ihm die große Kokosnuss über dem Meer aus. Vielleicht weil sie ihm viel zu schwer war und auf Grund ihrer Größe nicht zu den vielen anderen kleinen Samen und Sporen passte. Die Kokosnuss plumpste anstatt auf Noha direkt in das salzige Meer zu Nuri hinein. Die Meeresgöttin bemerkte den dumpfen Aufschlag und den treibenden Samen auf ihrer Oberfläche. Sie erzürnte ob seiner Anwesenheit, da sie Rajas Gaben verabscheute. So beschwor sie einen mächtigen Sturm herauf, um Rajas Geschenk von Noha abzutreiben. Doch egal, wie viel sie auch mit ihrem strengen Wind nach der Nuss blies, egal wie sie mit ihren Wassermassen tobte, egal wie viele Blitze sie nach ihr schleuderte und auch versuchte mit ihrer schieren Masse den Samen in ihr Element zu erdrücken, die Nuss tauchte immer wieder an ihrer Oberfläche auf. Unnachgiebig trotzte sie ihrer Gewalt. Obwohl der Samen über keine Augen, Ohren oder einer Nase verfügte, schmeckte die Nuss das Salz des Meeres. Sie wusste daher, dass es jetzt noch nicht Zeit war, auszutreiben. Ebenfalls wusste sie nicht, wo sie gerade befand und kannte nicht die Weite bis zum nächsten Festland. Ihr Optimismus an das ihr vorherbestimmte Ziel nach Noha zu gelangen, blieb dennoch ungebrochen. Denn in ihrem Herzen trug sie den Segen Rajas. Einer Kraft, die niemals erlosch und sich dazu bestimmte, von Generation zu Generation weiter durch die Zeit zu tragen. Erst wenn sie festes Land träfe und dies spürte, trug sie seine Kraft nach außen.
Während Nuri sich mit ihrer zerstörerischen Macht vergeblich an der Nuss abarbeitete, kam der Göttin der Gedanke die Nuss zu täuschen. Sie aus der Reserve zu locken. Sie bremste ihre Wellen und Winde ab und hüllte die Nuss in einen so dichten Nebel, bei dem man nicht einmal mehr die Hand vor Augen sah. Da aber die Nuss keine Augen besaß, überkam ihr auch nicht das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung. Solange das Licht Rajas in ihrem Herzen schien, blieb sie nicht verlassen. Auch wenn ihr der Weg durch die dichte Nebelsuppe unbekannt und ungewiss war, sie trieb mit der göttlichen Macht durch den tückischen Smog. Die Nuss dachte bei sich, dass selbst Nuris Zorn auch ihr Gutes in sich trug. Durch ihre ungeheure Kraft schaffte sie den Weg über das salzige Meer. Sie strandete schließlich auf einer kleinen Insel und verfing sich mit ihren Fasern im lockeren Sand. Dass es sich bei diesem Ort nicht um Noha handelte, störte die Nuss nicht. Sie wusste, dass ihre Reise über das weite Meer nicht die ihres eigenen Lebens war, sondern der ganzer Generationen. Auch jener, die weit nach ihr kamen. Im Augenblick kam es nur darauf an, dass sie weit genug ins Landesinnere gelangte, um auszutreiben. Aufgrund des fehlenden Wellengangs fühlte die Nuss, dass sie sich nicht mehr auf dem tödlichen Meer befand. So keimte sie sich tief in den lockeren Sand der Insel hinein. Ihre Wurzeln fanden dort salzarmes Wasser vor, wodurch sie nun im zweiten Schritt nach oben austrieb. Ihr zunächst dünner Hals reckte sich höher und höher in den Himmel empor, bis sie genügend von Rajas Segen verspürte. Erst dann breitete sie ihre großen Blätter aus und empfing so dessen Energie und somit seinen Segen. Mit Rajas Gabe wuchsen weitere Nüsse an ihrem Stamm, welche sich mit Rajas Kraft, seiner Energie beseelten. Solange, bis diese ebenfalls wieder zu Boden fielen und erneut zu ihrem Fuße Wurzeln schlugen. So nach und nach säten sich ihre Nachkommen auf dem ganzen Eiland aus. Sie besetzten jede freie Stelle, bis die Ersten wieder an den Meeressaum gelangten. Die Samen ihrer Kinder erfassten Nuris Strömung, um sich erneut auf eine Reise ins Ungewisse über das weite Meer zu begeben. Diesesmal aber waren es viele Nüsse und eine von ihnen erreichte irgendwann ihr Ziel, die Insel Noha. Auch wenn seit Rajas Gabe an Gaia viele Jahre und Generationen vergingen, eine von ihnen erreichte so den Ort ihrer Bestimmung.“
„Heißt das, dass es weitere Inseln wie die unsre da draußen gibt?“
„Es ist gut möglich …“, meinte Ragnar grübelnd „… obwohl ich keine andere Insel kenne. Wir sind zwar keine Kokosnüsse, Miro, aber unsere Nachkommen erreichen diese Inseln vielleicht einmal. Du musst es sehen wie die Kokosnuss: Egal, welche schlimmen Ereignisse sie auf ihrem Weg durch das tödliche Meer erfährt, eine von ihnen erreicht den Ort, der für sie bestimmt ist. Wenn nicht du in deinem Leben, dann geschieht es im Leben deiner Kinder. So grausig auch Nuri unsere Insel mit ihren tückischen Winden und starken Stürmen heimsucht, so helfen ihre Launen dabei, sie zu überwinden. Ihre Kraft ist zwar unberechenbar, aber sie lassen erst meinen Fluggleiter vom Boden abheben und über die Wolken zu Vater empor fliegen.“
Im Gegensatz zu den übrigen Insulanern besaß Ragnar ein entspanntes Verhältnis zu der Wettergöttin. Er gelangte zur Überzeugung, dass der Wind, das Wetter und die Strömungen des Ozeans wie der Körper einer Frau mit viel Empathien beschaffen seien. Ragnar beobachtete die Launen der Göttin genau, und wusste, wie sie tickte. Das lies sich auf die Flugtechnik mit dem Gleiter übertragen.
Natürlich unterhielt sich Miro mit ihm auch über den seltsamen Traum seiner Schwester. Auch Ragnar sah die ganze Sache von einer lockeren Seite. Also versuchte Miro seine Schwester entsprechend zu trösten.
„Dein Traum doch nicht schlimm. Wenigstens gibt es darin keine Meeresungeheuer oder so“, sagte er daher Mut machend zu Raissa.
„Ab und zu ist gut. Es ist jede Nacht der Gleiche. Darin verändert sich rein gar nichts ...“
Miro kam ihr näher und umarmte sie liebevoll, um sie auf andere Gedanken zu bringen.
„Schwester, ich bin so froh, dass du da bist“, flüsterte er ihr ins Ohr. „Ich sah dich schon bei Nuri. Ich liebe dich viel zu sehr. Dein Tod hätte mir das
Herz gebrochen.“
„Ist schon gut“, erwiderte Raissa angetan und beide nahmen sich die Zeit einander zu spüren. „Hey, jetzt lass uns an den Strand gehen, solange das gute Wetter anhält.“
„Au ja“, antwortete Miro begeistert und sogleich verließen beide Geschwister ihre Basthütte.
Die meist viereckigen Behausungen der Insulaner standen im Kreis zueinander, sodass sich in ihrer Mitte ein großer Platz bildete. Dort kamen sie des Abends nach ihren erledigten Arbeiten zum Klatsch und Tratsch zusammen. Hier erzählten sie einander Geschichten und sangen gemeinsam ihre Lieder. Die Insellegenden, die sie mit ihren selbst gemachten Instrumenten untermalten, füllten ganze Stunden aus. Daneben beratschlagten sie die weiteren Vorhaben, die ihr Leben auf der Insel organisierten. Dazu entzündeten sie mit Hilfe von Rajas Tränen ein Feuer, das sie mit den leeren Schalen der Kokosnüsse und deren Holzfasern speisten. Aus was die mystischen Tränen Rajas bestanden, wussten selbst die Dörfler nicht wirklich. Der Legende nach fielen sie einst vom Himmel als Raja ob der Schmerzen Gaias wegen der Himmelsnadel weinte. Von der Form her sahen die Tränen wie abgerundete Kügelchen aus, doch in geladenen Zustand waren milchig trüb. Diese eher weißen Kügelchen fanden sich oft am Strand nach einem Sturm. Wenn man zwei von ihnen aneinander rieb, dann gaben sie bald eine enorme Hitze ab. Sogleich warf man sie in das Brennmaterial hinein, wodurch wenig später eine lodernde Flamme in die Höhe stach und sich die zur Verbrennung bestimmten Reste entzündeten. Das so entfachte Feuer brannte stundenlang, ohne auch nur ein Grad abzuschwächen. Es gab ein freundliches Licht und eine angenehme Wärme ab. Dazu wirkte sein Schein behaglich auf das Gemüt und verbreitete ein Gefühl der Geborgenheit. Wenn das Feuer herabbrannte, fanden sich in der Asche Rajas Tränen unversehrt und vor allem ausgekühlt wieder. Dann waren sie fast durchsichtig. Wenn man anschließend die durchsichtigen Kugeln direkt in Rajas Strahlen legte, bekamen sie wieder ihre milchige Trübung zurück. Dann konnten sie erneut ein Feuer entzünden.
Zu vorgerückter Stunde trat die Äbtissin in die Mitte des Dorfplatzes und dankte Gaia mit einer lauten Ansprache für den erfolgreichen Tag. Sie segnete die Erdenmutter für ihre Gaben und dankte für ihren Schutz, den das Eiland ihrem Volk bot. Dazu hob sie ein Stück Erde auf und sprach die folgenden Worte:
Aus deiner Erde stammen wir,
zu deiner Erde werden wir,
Zu hüten, was Raja dir vermachte,
Auch wenn Nuri drüber lachte,
So geben wir dir unser Leben hin,
dies ist unser aller Daseinssinn.
Dann lies sie das Stück Erde fallen, worauf hin sich alle erwachsenen Dörfler um das Feuer mit den entzündenden Tränen des Raja aufstellten und einander musterten. Die, die nun bleiben wollten, gingen einander zu, die die nicht konnten oder keine Lust verspürten, zogen sich in ihre Hütten zurück. Der Abend auf dem Dorfplatz gehörte in den nächsten Stunden den Liebenden. Auch Raissa und Miro hätten den andern Dörflern in die Hütten folgen können, doch es machte nichts, wenn sie dem nun folgenden Akt der verbliebenen Insulaner auf dem Dorfplatz beiwohnten, denn so erklärten die Erwachsenen, gehöre es zum Leben, das Leben wie Raja an Gaia zu geben und auch ihre Körper zu feiern. Auch sie, die demnächst zu ihrem Kreis gehörten, sollten wissen, was einander gut tat. Dazu verwendeten die Insulaner Öle und weitere Lustbringer auf den Platz und verwöhnten damit hingebungsvoll ihre Leiber, bis sie sich in der sexuellen Erfüllung ergaben. Natürlich konnten sich die Liebenden auch einzeln in leere Hütten zurückziehen, wenn sie es wollten. Denn nichts durfte der fließenden Energie entgegenstehen. Als Raissa vor einigen Wochen zum ersten Mal blutete, feierte dies ihr Volk auf dem Dorfplatz mit Tanz und Musik. Dazu reichten die Dörfler ihre selbst gemachten Köstlichkeiten, wie den gegrillten Fisch aus der Forellenzucht auf frischem Hanfbrot. Den süßen Honigkuchen mit den herben Kakaobruchstücken oder die lockeren Kokoskekse und dem nahrhaften tiefgrünen Algensalat. Zum Abschluss ihres Mahls gab es Früchte und Nüsse. Jetzt, so betonte es die Äbtissin, nahm Gaia sie in ihrem Kreis auf. Bereit eine Wiege des Lebens zu sein.
„Sei stolz“, sagte sie damals zu ihr. „Du lebst jetzt, was deine Bestimmung ist.“
Dennoch trat Raissa diesem festlichen Ereignis nicht gerade gerne entgegen. Hieß es doch auch, nun einen passenden Samen zu suchen und das konnte der von Miro nicht sein. Sie liebte ihren Bruder abgöttisch. Vielleicht lag es ja daran, dass sie einander, als ihre leiblichen Eltern nicht im Dorf weilten, einmal sich in der Massage ihrer Leiber versuchten. So wie sie es an der abendlichen Zeremonie beobachteten. Es zeigte sich, dass Miro großes Talent darin besaß, mit seinen Händen große Lust in Raissa zu erzeugen. Hinterher tat es ihr Leid und sie machte sich Vorwürfe überhaupt jene Versuchung gewagt zu haben. An all das dachte Raissa in diesem Moment, als sie mit Miro auf den Dorfplatz trat. Ebenfalls entging ihr dabei der Blick auf die Hütte der Niederkunft nicht. Sie stand genau dort, wo morgens das erste Licht Rajas auf ihr Dorf traf. Dabei handelte es sich um den Ort ihrer Geburt. Lange vor ihrer Zeit, zur Zeit der großen Stürme kamen ihre Vorfahren in der Zuflucht zur Welt. Sie selbst tat bereits hier in dieser Hütte ihren ersten Schrei. Oder vielmehr tauchte sie zum ersten Mal auf aus dem Wasser auf. Die Geburten vollzogen die Insulanerinnen in einem speziellen Geburtsbecken, dass ihre Vorfahren aus einem einzigen Steinblock eigens zu diesem Zweck meißelten. Wenn die Wehen bei der Schwangeren einsetzten, brachten die Geburtshelfer sie zu dieser Hütte und befüllten den Geburtsstein mit körperwarmem Wasser. Bei einer Niederkunft halfen vor allem die jungen Frauen der werdenden Mutter. Eine jede wurde von einer älteren Frau angeleitet, um die Geburt perfekt zu begleiten. Zumal auch sie eines Tages in die Situation der Schwangeren kamen oder ihr erworbenes Wissen darüber an die nächste Generation weitergeben mussten. Dazu gehörte neben dem Abkochen von sterilen Tüchern, dem Sorgen für das richtige Umgebungslicht, der Lautstärke und der Luftzufuhr während der Geburt, auch das Führen des Geburtsmessers. Damit durchtrennte man die Nabelschnur zwischen Mutter und Kind. Schnell lernte Raissa, diese Verbindung zwischen den beiden erst zu lösen, nachdem die Nabelschnur aufhörte zu pulsieren. Solange das Blut von der Mutter zum Baby und zurück floss, blieb dieser Versorgungsstrang unberührt. Im Gegenteil, während die Verbindung noch stand, kam es zum ersten Augenkontakt zwischen der frischgebackenen Mutter und dem Baby. Auch reichte die Länge der Nabelschnur aus, um dem Baby die Brust zu geben. Einem erhabenen Moment, dem die Insulaner große Bedeutung für die spätere Entwicklung des Kindes zumaßen. Dem leiblichen Vater blieb es im Übrigen selbst überlassen, ob er dem Geburtsablauf beiwohnen wollte. Während der schon rituellen Abläufe kam es auf die richtige zeitliche Abstimmung der einzelnen Handlungen jener Helfer an. Erst mit dem durchtrennen der Nabelschnur löste sich symbolisch das Neugeborene von Gaia und trat als eigenständiges Wesen auf die Welt.
Für das ganze Dorf bedeutete eine Niederkunft ein festliches Ereignis. Denn dann versammelten sich die übrigen Bewohner auf dem großen Platz vor der Hütte und stimmten feierliche Lieder ihrer Weltenschöpfer von Raja, Nuri und Gaia an. Wenn die Geburtshelfer mit dem neuen Mitglied ihrer Gemeinschaft vor die Hütte traten und es hoch hielten, sprach das ganze Dorf mantrahaft Rajas Segen über das Kind aus. Die Auserwählung des Namens für das Kind überlies die Gemeinschaft zwar den leiblichen Eltern, doch ab diesem Moment gehörte das Kind ihnen nicht mehr. Es gehörte nun der Insel Noha, dem Meer, der Luft, dem Wind und dem Segen Rajas.
Auf der anderen Seite des Platzes, genau gegenüber an dem Ort, an dem am Abend das letzte Licht erlosch, befand sich die Hütte des Dankes. Dort bahrten die Insulaner fünf Tage lang ihre Verstorbenen auf. Ein jeder besaß solange die Gelegenheit, sich von den Toten zu verabschieden und zu trauern. Doch dann, nach fünf verstrichenen Tagen brachten die Insulaner den Leichnam an den Strand, errichteten aus Palmwedel und Kokosschalenresten einen Scheiterhaufen und verbrannten ihn. Symbolisch schickten sie ihre Toten in das Reich Rajas zurück, damit er zu neuer Kraft würde, um vielleicht eines Tages wieder ein Kind zu beseelen.
Rings um den zentralen Versammlungsort mit der Hütte der Niederkunft und des Dankes, befanden sich die übrigen Hütten ihrer Gemeinschaft. Sie bestanden, ähnlich wie die ihre aus Bastwänden und deckten sich mit den Blättern der Kokospalme ab. Die meisten Hütten besaßen ein steinernes Fundament. Es kam oft vor, dass nach einem starken Sturm die Behausungen wieder neu aufgebaut wurden. Jeder Dorfbewohner half den anderen dabei. Da sich die Wände aus geflochtenen Bastmatten leicht zusammenfügen ließen, reparierte sich der Schaden durch die Stürme innerhalb eines Tages. Die einzelnen Behausungen besaßen keine eigenen Gärten, denn auf der Insel bewirtschaftete die Dorfgemeinde den ganzen Boden im Kollektiv. Ein jeder besaß in dem Gefüge seine feste Aufgabe und kam seiner ihm anvertrauten Arbeit mit Gewissheit nach. Welche dies einmal sein würde, kristallisierte sich erst während der Entwicklung ihrer Kinder heraus. Die Gemeinschaft setzte die Heranwachsenden in den verschiedenen Bereichen ihrer Inselwirtschaft ein und stellte so fest, was ihnen am besten lag. Miros und Raissas Mutter betrieb den Webstuhl bei der Windmühle, während ihre leiblichen Väter auf den Algen-, der Kakao- oder Kokospalmenplantagen die Gewächse pflanzten, pflegten und ernteten. Als nicht ganz Volljähriger half Miro daher den Dorfbewohnern unter Tags aus, wo gerade jemand gebraucht wurde. Er half Großvater Jockel bei den Bienen oder auch Karolin in der Algenfarm. Aber auch bei den Reusenfischern lernte Miro sehr viel. Er sammelte Erfahrung nach den Fangkörben vor den Klippen der Insel zu tauchen. Dort holte er die Fallen vom Meeresboden herauf, um sie zu leeren. Dadurch gelang es ihm durch Übung die Atemluft länger anzuhalten und sie mit dem Luftdruck in den Ohren zu regulieren. Aber am Liebsten hielt sich Miro aber bei Ragnar, ihrem Schmied, am Hangar auf. Am meisten faszinierte ihn der Fluggleiter, den ihr findigster Kopf der Insel ersann. Auf seiner Tragfläche platzierte er in einer Art Fassung entweder einen Lichtwürfel oder jene Tränen der Raja mit der sie am Abend ihr Feuer entfachten. In dem Augenblick, in dem Rajas Segen auf die Fundstücke traf, fingen sie seine göttliche Energie ein. Auch Raissas Werdegang ihrer Tätigkeiten auf der Insel glich zunächst dem ihres Halbbruders. Jedenfalls bis zu ihrer ersten Blutung. Sie wechselte davor die einzelnen Tätigkeitsstätten von der Weberei bis zu den Plantagen durch. Schon bald stellte sich heraus, dass sie ein großes Talent darin hatte, die Dattel- und Kokospalmen hinaufzuklettern und von dort durch Drehung um die eigene Achse der Frucht sie zu Boden plumpsen zu lassen. Nach ihrer ersten Blutung setzte sie die Äbtissin Marsha daher vorrangig auf der Palmenplantage ein. Das Ernten der Kokosnüsse schien wie gemacht für Raissa zu sein, doch der Unfall vor einigen Wochen riss sie aus ihrer Bestimmung heraus. Im Moment herrschte in der Dorfgemeinschaft eine Unschlüssigkeit darüber, als was man Raissa künftig einsetzte. Solange ihre Genesung nicht als gesichert galt, half sie daher Miro bei der Strandgutsuche aus. Eine Arbeit, die vor allem die nicht volljährigen Kinder auf der Insel erledigten.